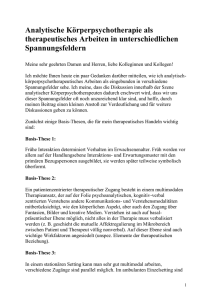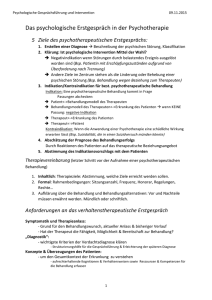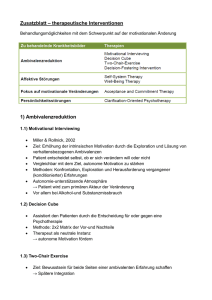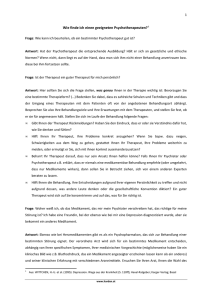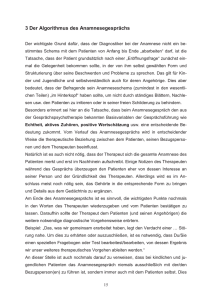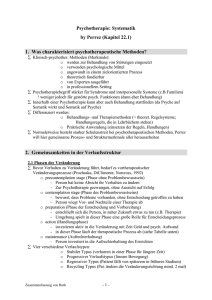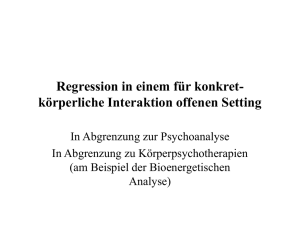Vorbemerkungen - bei DI Gerhard Lang
Werbung

Selbstregulation – (Körper)Psychotherapie – Entwicklungspsychologie (Säuglingsforschung) – aus der Sicht der analytischen Körperpsychotherapie Peter Geißler In diesem Beitrag möchte ich dem Zusammenhang zwischen dem Konzept der Selbstregulation, der Methode der analytischen Körperpsychotherapie (AKP) und der ihr zugrunde liegenden Entwicklungspsychologie – die sich u. a. auf die zeitgenössische Säuglings- und Kleinkindforschung beruft - eingehen. Zunächst spreche ich über die evolutionäre Bedeutung der Affekte in einer relationalen Sichtweise, die also in Bezogenheit, Bindung etwas Zentrales sieht. Dann versuche ich ein paar Kernaspekte bzw. Thesen der intersubjektiv-relationalen Psychoanalyse herauszuarbeiten, weil sie als theoretische Grundlage für AKP angesehen werden kann. Im dritten Teil geht es um Entwicklungspsychologie, besonders um Arbeiten von Beebe und Lachmann im Hinblick auf Selbstregulation als gemeinsame, als Ko-Regulierung, und abschließend fasse ich therapeutische Konsequenzen zusammen, unter besonderer Berücksichtigung des Konzepts der sog. Kreditierung. Ich verwende übrigens die Begriffe Selbstregulation, Selbstregulierung, Selbststeuerung und Selbstorganisation synonym – dies als definitorische Anmerkung. Mit G. Heisterkamp (2007) ist zu sagen: Würden wir Menschen nicht über so starke selbstregulierende Kräfte verfügen, wären wir als Rasse vielleicht schon ausgestorben. Das Seelische ist seit Jahrtausenden ohne Psychotherapie ausgekommen, und trotzdem war eine biologische und eine seelische Evolution möglich. Man denke nur an die evolutionären Schöpfungen, mit denen unsere Vorfahren auf veränderte Lebensbedingungen reagieren konnten: an die wegen des Klimawechsels notwendige Verlagerung des Lebensraumes aus den tropischen Wäldern in die Savanne; an die Entwicklung neuer Bewegungsmuster unter den erhöhten Gefahrensituationen in der Savanne durch Raubtiere; an die Entwicklung von Intelligenz und 1 Sprache innerhalb der Komplexität größer werdender Gruppen, usw. usw. Selbstregulation, Entfaltung von Ressourcen und Potenzialen, und Evolution im Seelischen und Biologischen sind somit zusammengehörige Kategorien, wobei wichtig ist herauszustreichen, wie sehr der Mensch immer schon auf das Miteinandersein in der Gruppe, in der Horde angewiesen war. Wenn man als Vorformen von Psychotherapie bestimmte schamanistische, magische oder spirituelle Praktiken anerkennt, dann ist der Gedanke einer Selbstregulierung dort immer schon vorhanden gewesen – allerdings meist in Zusammenhang mit Geistern oder Göttern, d. h. einer anderen Wirklichkeit, mit der es einen Einklang zu finden galt. Damals war Verbundenheit mit einer rational nicht begreifbaren Welt ein wichtiger Grundgedanke. Der Gedanke einer Verbundenheit, wenn auch mystisch orientiert, geriet durch den Siegeszug des frühneuzeitlichen Rationalismus ins Hintertreffen. Descartes sagte: Cogito ergo sum - Ich denke, also bin ich. Der grundsätzlichen Orientierung an Denken und Vernunft, an mechanischen Vorstellungen, und die hohe Bewertung wissenschaftlichen Denkens auf Kosten der Intuition wurde so im 17. Jahrhundert ein Grundstein gelegt – und fand in der frühen Freud´schen Psychoanalyse ihren Niederschlag – übrigens auch bei Reich, denn auch er bezieht sich stark auf mechanische Modelle der Psyche. Emotionen und Affekte hatten für lange Zeit die Rolle eines Stiefkindes im wissenschaftlichen Diskurs. Neuerdings wird die Domäne Vernunft seitens der Wissenschaften aber ernsthaft hinterfragt: die Emotionen rücken in den Vordergrund – hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang Damasios Buch „Descartes Irrtum“; in Zusammenhang damit seine Idee der somatischen Marker – es handelt sich um physiologische Reaktionen, die als Kriterien herangezogen werden, um unser Handeln zu strukturieren – aufbauend auf emotional-körperlichen Erinnerungen. Hervorheben möchte ich auch ein heuer erschienenes Buch von Greenspan und Shanker, die zu belegen versuchen, dass es die affektive Mikrokommunikation, beginnend im Säuglingsalter ist, die den Grundstein für spätere kognitive und symbolische Prozesse legt – 2 beim Menschen ebenso wie bei unseren nächsten tierischen Verwandten, den Menschenaffen. Innerhalb der Psychotherapie – der Begriff geht übrigens auf Bernheim, dem Begründer der Suggestionstheorie, aus dem Jahre 1881 zurück – ist die Idee einer Selbstregulierung so alt wie die Psychotherapie selbst. In der Psychoanalyse taucht der Begriff der Selbstregulation zuerst bei Reich auf, in dem Moment, als er sich vom klassischen psychoanalytischen Gedankengut verabschiedet; später dann bei Kohut, dem Begründer einer humanistisch orientierten Psychoanalyse. Trotzdem muss man sagen, dass die Idee einer Selbstregulation auch der klassischen Psychoanalyse immer eigen war – die Technik der freien Assoziation geht von der These aus, dass unbewusste Inhalte einen gewissen Druck auf das Bewusstsein ausüben, gleichsam einen Auftrieb haben, der sie von selbst an die Oberfläche treibt. Für Psychoanalytiker ist dabei die Technik der Widerstandsanalyse ein notwendiger Zwischenschritt. Für Freud waren die wesentlichen unbewussten Inhalte, die sich – gleichsam selbstregulatorisch – bei geeignetem analytischen Zugang manifestierten, unbewusste Fantasien – also kognitive Elemente, als Derivate des Triebhaften in uns. Reich folgte dieser trieborientierten Vorstellung und entwickelte die Theorie des Charakterpanzers, d. h. der Widerstand wurde ins körperliche verlegt und dort therapeutisch bearbeitet. Dazu dienten bestimmte Übungen, mit dem Ziel, die orgastische Potenz wiederherzustellen, den sog. Orgasmusreflex möglich zu machen, sich den selbstregulatorischen Körperprozessen hingeben zu können. AKP orientiert sich insofern auch an körperlichen Prozessen, an Körperassoziationen, als sie deren Manifestation in der Interaktion zwischen Patient und Therapeut beachtet, d. h. darauf achtet, wie sie spontan auftauchen und einen Zugang zu unbewussten Ebenen des Seelischen ermöglichen. Szenische Arbeit heißt im Rahmen der AKP NICHT Übungen durchzuführen, mit dem Ziel affektiver Katharsis oder der Auslösung vegetativer Reaktionen, sondern – ausgehend von der gegenwärtigen Übertragungssituation - ggf. szenische Situationen gemeinsam zu konstruieren, die bestimmte Beziehungsmuster auf dem 3 Wege der Handlungssymbolisierung besser verdeutlichen sollen. Wir sprechen statt Übungen besser von Probehandlungen oder Handlungsproben. Mit ihrer Hilfe kann ein Zugang zu körperlichprozedural verankerten Beziehungs- und Gefühlsgewohnheiten ermöglicht werden – denken Sie an die somatischen Marker von Damasio: sie strukturieren das Handeln, die Interaktion. Der Psychoanalytiker Holderegger (2002) spricht in diesem Zusammenhang von der „primären Lebensorganisation“ und meint damit die Welt der vorsprachlichen Interaktionserfahrungen. D. h. in der AKP ist die Beziehung im Mittelpunkt der Betrachtung, und ihre körperliche Manifestation ist die stattfindende Interaktion. Von der theoretischen Konzeptualisierung des Körpers her sprechen wir heute in der AKP – im Gegensatz zu Reichs energetischem Körper und zu Freuds unbewusstem Körperbild – von einem interaktionellen Körper, dessen wichtigste genetische Wurzeln in den unzähligen körperlichen Interaktionen innerhalb unserer ersten Lebensjahre anzusiedeln sind, die zwischen dem Kind und seinen Pflegepersonen stattfinden. In der AKP benutzen wir beide Wege als Zugang zum Unbewussten: die Arbeit an dynamisch relevantem Material ebenso wie der körperassoziative Zugang zu prozeduralen Mustern - die nicht verdrängt bzw. durch Widerstände abgewehrt sind, sondern ein bestimmtes Setting brauchen, damit sie sich die „Körpererinnerungen“ entfalten können; all dies vorzugsweise in der Übertragung. Die analytische Widerstandsarbeit, die auch für die AKP Gültigkeit hat, bezieht sich auf jene unbewussten Manifestationen, die in einem dynamischen Sinn unbewusst sind. In unserem Lehrbuch gibt es dazu einen eigenen Beitrag von G. Worm. Die neuere Systemtheorie hat einen Teil der Psychoanalyse stark beeinflusst – wir sprechen heute von relationaler Psychoanalyse. In der Untersuchung selbstorganisierender Prozesse in Systemen ist deutlich geworden, dass der menschlichen Interaktion spontane und nicht planbare Elemente immanent sind – denken Sie nur an das Konzept der Now-Moments von Daniel Stern – als Gegenparadigma gegen eine an klaren technischen Vorstellungen orientierte Psychoanalyse wie z. B. bei Ralph Greenson, oder auch bei Reich, der ein ganz bestimmte Reihenfolge in seiner Charakteranalyse im Auge 4 hatte; auch bei Lowen die Vorstellung der Analyse von „unten nach oben“. Aus interaktioneller Perspektive müssen solche Therapieregeln relativiert werden. Intersubjektiv-relationale Psychoanalyse als theoretische Grundlage analytischer Körperpsychotherapie Es handelt sich um eine Entwicklungslinie, die aus der Objektbeziehungstheorie kommt. Ferenczi gilt als Urvater. Loewald 1977 – in Beantwortung der uralten psychoanalytischen Frage der „Objektsuche“ – warum sucht der triebhafte Säugling die Mutter? „ Eine solche Frage macht keinen Sinn, denn sie setzt voraus, dass „Selbst“ und „Objekt“ getrennte Wesenheiten sind. Die relationale Sichtweise sagt: Das ist nicht so! „Selbst“ und „Objekt“ sind keinesfalls getrennte Wesenheiten, d. h. wir sind unsere Objekte und unsere Objekte sind wir.“ Objektsuche ist daher kein Trieb, sondern sie ist uns Menschen als Hordenwesen evolutionär angelegt. Aus der Sicht der relationalen Psychoanalyse sind gesunde Objektbeziehungen nicht nur und auch nicht vor allem durch ein klares Unterscheiden-Können zwischen Selbst und Anderem definiert, sondern durch die Fähigkeit, verschiedene Formen von Bezogenheiten, von Erlebsnismodi, Domänen des Erlebens, wie Stern sie nennt, zu integrieren, je nach Erfordernis der realen Situation; z. B. die Domäne der Kernbezogenheit mit jener der verbalen Bezogenheit, die sich dann in einer sog. verbundenen Sprache äußert. Gemeinsam mit den Körpertherapeuten ist den Relationalisten, dass die einzelnen Ansätze stark individuell variieren, sodass man kaum von einer einheitlichen Methode sprechen kann – höchstens von einer Strömung. Die folgenden Kernaspekte gelten also nicht für alle Relationalisten in gleicher Weise: These 1: Das Bedürfnis nach Bezogenheit (Bindung) ist der menschlichen Natur inhärent Grund: Weil Menschen während der Evolution so stark aufeinander angewiesen waren. Folge: Es hat sich eine enorm differenzierte affektive Kommunikation entwickelt. 5 These 2: Die Psyche ist eine soziale Entität Das ist das Gegenstück zu einer monadischen Sichtweise der Psyche, wie sie für Freud typisch war, oder für Reich, und später in etwas abgeschwächter Form auch für M. Mahler, für welche Autonomie und Individuation DAS Therapieziel war. Das sehen die Relationalisten anders – Bezogenheit, Bindung, Eingebettet-Sein in eine soziale Matrix ist für sie selbstverständlich. Nicht der Charakter ist der wesentliche Bezugspunkt in der Therapie, sondern die Beziehung. Das gilt für die psychotherapeutische Situation ebenso wie für die Eltern-Baby-Beziehung. Menschen erleben gemeinsame Affektzustände, Affekte sind gewissermaßen ansteckend. Beispiel: Sullivan machte z. B. schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts klar, dass Affekte für ihn wichtiger sind als Triebe, und dass beispielsweise die Angst eines Babys nicht eine Trieb-Angst ist, sondern dass der Säugling von der Angst der Mutter angesteckt – er nahm damit Konzepte wie Affektabstimmung und Affektansteckung aus der Säuglingsforschung um Jahrzehnte vorweg. These 3: Therapie ist ein zutiefst intersubjektives Geschehen, es ist die Interaktion zweier Menschen, die einander auf gleicher Ebene begegnen (jedoch unter der Voraussetzung unterschiedlicher Funktionen bzw. Rollendefinitionen.) Der Therapeut ist immer Teilnehmer und nie Beobachter des Therapieprozesses. Die Veränderung wird in der Therapie durch Beziehung und nicht durch Deutung eingeleitet, und sie betrifft beide Teile, wenn auch meist in unterschiedlichem Ausmaß. Es handelt sich um ein beidseitig determiniertes Wirkgeschehen, um wechselseitige Be-Handlung. Wenn der Patient die Deutungen des Therapeuten hört, macht er eine Beziehungserfahrung, die eine Veränderung seiner Beziehungsmuster in Gang setzen kann. Weder Therapeut noch Patient haben einen privilegierten Zugang zu dem, was wirklich zwischen ihnen geschieht („perspektivische 6 Position“). Der Realitätswahrnehmung des Therapeuten kommt kein privilegierter Status zu. Die Authentizität in der Begegnung ist für den Verlauf der Therapie von wesentlicher Bedeutung und rechtfertigt einen gewissen Grad an Selbstenthüllung seitens des Therapeuten. These 4: Es findet ununterbrochen ein Miteinander-Handeln statt In jeder psychoanalytischen Vorgehensweise ist das Unbewusste der Schlüsselaspekt zum Verstehen. Im Verstehen des Unbewussten ist nicht nur die unbewusste Fantasie so wichtig, sondern genauso unbewusste Anteile der Interaktion im Sinne prozeduraler Muster, an denen beide Interaktionspartner beteiligt sind – auf der Ebene der primären Lebensorganisation (Holderegger), einer präsymbolischen, präkonzeptuellen Erfahrungswelt, die in etwa Sterns Domäne der Kernbezogenheit entspricht. These 5: Ein Agieren des Therapeuten ist daher unvermeidlich, da Patient und Therapeut ununterbrochen miteinander handeln. Wenn Handeln sowieso stattfindet, spricht nichts dagegen, bewusst geplante Handlungsproben in die Arbeit mit einzubeziehen – im Wissen, dass ein Unterschied besteht zwischen solchen Probehandlungen und unbewussten Inszenierungen auf der Ebene des unbewussten Handlungsdialoges. Beides kann zum Verstehen beitragen. Agieren des Patienten und/oder des Therapeuten ist also nicht per definitionem kontrapdoduktiv, wie Freud meinte. In der Therapie spielt die Einsicht in die Interaktion auf der Ebene prozeduraler Muster, auf der Ebene der primären Lebensorganisation, eine entscheidende Rolle. Parallel zur kognitiven Einsicht sind es aber unmittelbare Wirkfaktoren im Miteinander-Handeln und sich gegenseitig Be-Handeln, die therapeutische Wirkung ausmachen. In unserem Lehrbuch sprechen G. Heisterkamp und ich von einem unmittelbaren Wirkgeschehen, das im „Hier und Jetzt“ geschieht, anstatt dass es nachträglich reflektiert wird. These 6: Übertragung ist nicht im klassischen Sinn zu verstehen 7 Übertragung ist nicht nur eine verzerrte Projektion des Patienten, sondern auch eine soziale Reaktion auf das Verhalten des Therapeuten – die Übertragung enthält klassische Übertragungskomponenten, aber auch solche, die nicht Teil der Übertragung sind – sie ist ein interaktionelles Phänomen, und der reale Beziehungsaspekt ist ebenso herauszuarbeiten. Die Realität des Patienten und auch des Therapeuten wird während konkret-körperlicher Interaktionen besonders gut wahrnehmbar, sie wird sogar unabweisbar – und genau dies birgt in einem interaktionellen Vorgehen verschiedene Möglichkeiten und auch Schwierigkeiten, weil der Therapeut eigene Schwachstellen nicht verleugnen kann. Sie kennen alle das Phänomen, dass schwer gestörte Patienten den Therapeuten regelrecht erpressen können, wenn der bestimmte Fehler macht – Fehler aus der Sicht des Patienten. Hat der Patient nun sozusagen konkrete körperliche Beweise, kann es für den Therapeuten sehr eng werden – v. a. wenn er kein gutes psychoanalytisches Rüstzeug im Umgang mit negativen Übertragungen und projektiven Identifizierungen hat. Dadurch wird die Belastung für den Therapeuten größer, weil er aus der Sicht der Patienten leichter angreifbar wird – real sowie symbolisch. D. h. die Möglichkeiten der Verstickung nehmen zu, je mehr man sich als realer Interaktionspartner betrachtet. Dies ist der Preis eines interaktionellen Vorgehens. Entwicklungspsychologie Der intersubjektiv-relationalen Psychoanalyse liegt ein Entwicklungskonzept zugrunde, das sich auf die moderne Säuglingsforschung stützt und in dem Selbstregulation eng verflochten ist mit interaktiver Regulierung. Hartmann (2004, S. 41) in dem von mir herausgegebenen Buch sagt: „Selbstregulation ist einer der entscheidenden, wenn nicht der entscheidende Prozess im Verlauf der Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen. Es geht um… die Beibehaltung eines individuell als kontrollierbar empfundenen Spannungsniveaus, welches trotz unterschiedlicher Umwelteinflüsse beibehalten werden kann.“ 8 Und Schore, ein gegenwärtig sehr bedeutsamer Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker, stellt fest: „Wir können heute… sagen, dass die Förderung der Selbstregulierung von zentraler Bedeutung für die kindliche Entwicklung ist, und es sieht so aus, als wäre die größte Leistung der frühen Zeit die Fähigkeit, Affekte zu regulieren (Schore 2002, S. 2). In den neueren Entwicklungspsychologien wird mit Selbstregulierung also besonders die Fähigkeit bezeichnet, affektive Erregungszustände selbständig zu steuern. Obwohl die Affekte in der Selbstregulierung eine zentrale Rolle spielen, geht es auch um mit den Affekten zusammenhängende Reaktionsweisen, wie die Stressreaktivität und die Aufmerksamkeitsregulierung, die beide zu den Temperamentsfaktoren gerechnet werden. Die motorische und emotionale Reaktionsbereitschaft auf Stress ist sehr unterschiedlich ausgeprägt und ist bereits pränatal über die physische und psychische Beeinflussung der Genexpression von Stresshormonen veränderbar. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass hier der Erziehungsstil der Elterntiere gegenüber genetischen Anlagen wesentlich bedeutsamer war und transgenerational weitergegeben wurde – wiederum auf nicht-genetische Weise. Die Qualität der Bindungserfahrung ist maßgeblich verantwortlich für die Art und Weise, wie der Säugling auf Stress reagiert. Bei der Aufmerksamkeitsregulierung geht es um die Frage, wie es gelingen kann, dass einzelne Aspekte im Wahrnehmungsfeld bemerkt werden, andere unbeachtet bleiben. Ausgehend vom Orientierungsreflex des Säuglings kommt hier – in enger Verflechtung mit der Stressregulierung – ein kognitiver Prozess in Gang, der im positiven Fall darin mündet, dass etwa ab dem dritten Lebensjahr das Kleinkind zunehmend in der Lage ist, sein Verhalten durch selektive Ausrichtung der Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Neben sicherer Bindung sind dabei die Eltern schon in den ersten Lebensmonaten gefordert, Zustände von Anspannung dadurch zu vermindern, dass sie 9 die Aufmerksamkeit des Säuglings durch fesselnde Reize fokussieren und dadurch die seelische Spannung verringern können. Hier liegt vermutlich der Beginn des Gefühls von Urheberschaft, Effektanz und Kompetenz gegenüber Unbehagen und Kummer. Zwar verfügt das schon das Neugeborene über selbstberuhigende Strategien, wie Daumenlutschen, jedoch ist der Säugling zentral auf interaktive Regulation durch die Bezugspersonen angewiesen. Dabei spielt – neben dem taktilen - der auditive Kanal eine große Rolle – d. h. die Art und Weise, wie die Bezugspersonen über stimmliche Signalgebungen den Affektzustand des Säuglings regulieren können. Die Qualität der Bindung ist wiederum eng verzahnt mit der Emotionsregulierung, zuerst durch Affektspiegelung, dann durch Mentalisierung – diese bildet den Ausgangspunkt für Affektregulation auf repräsentationaler Ebene. Mit Hilfe metakognitiver Fähigkeiten stellt sich ein feinfühliger Elternteil die geistige Welt des Säuglings vor, bedenkt seine möglichen Motivationen mit und bezieht Auswirkungen eigener Zustände und Verhaltensweisen auf den Säugling mit ein. Kindliches Unbehagen kann somit im Hinblick auf mögliche elterliche Auslöser verstanden werden, und der affektive Zustand des Säuglings kann als etwas gewürdigt werden, das sich vom eigenen Zustand unterscheidet. All dies sind keine selbstverständlichen Voraussetzungen bei Eltern, wie wir aus der Arbeit mit unseren Patienten nur zu gut wissen. Fonagy und Target (2002) legen den Schwerpunkt auf mentale Prozesse der Eltern. Ihrer Meinung nach ist die Fähigkeit zur Selbstregulation intrinsisch mit der Fähigkeit zur Mentalisierung verbunden, d. h. Selbstregulation benötigt die Repräsentation mentaler Zustände von sich selbst und von anderen. Eine der wichtigsten neueren Beiträge zur Selbstregulation kommen von Beebe und Lachmann – sie kombinieren psychoanalytische mit systemtheoretischen Überlegungen. Beide Interaktionspartner werden von ihrem eigenen Verhalten beeinflusst (z. B. Selbstberührung als Mittel der Spannungsregulierung) - als auch vom Verhalten des Interaktionspartners, und zwar auf einer kontinuierlichen Moment-zu10 Moment-Basis. Selbstregulation und interaktive Regulation beeinflussen einander konstant wechselseitig – die Autoren sprechen von Ko-Regulierung. Diese geht so weit, dass sich das gemeinsame innere Erleben auf einer organismischen Basis bis hin zu einer Abstimmung von Biorhytmen synchronisiert, indem also beide Partner an einem Prozess nonverbaler, reziproker Beeinflussung partizipieren, der sich zum größten Teil außerhalb der bewussten Wahrnehmung befindet. Die beidseitige Ko-Regulierung ist im Prinzip – d. h. von den Fähigkeiten des Säuglings her – auf Systeme ausweitbar, wenn der Säugling dafür die nötige Unterstützung erhält. E. FivazDepeursinge aus Lausanne konnte zeigen, dass Säuglinge fähig sind, sich auf beide Eltern einzustimmen und die Beziehung zu beiden mitzuregulieren, wenn sie dazu die nötige Unterstützung erhalten. Schon im ersten Lebensjahr und vermutlich sogar schon vor der Geburt organisieren Säuglinge bzw. Feten Erfahrung – vor der Geburt überwiegend im Signalaustausch über den akustischen Kommunikationskanal. Die elterliche Stimme ist in der zweiten Schwangerschaftshälfte das Transportmittel elterlicher Affekte, und das Neugeborene erkennt sie sofort. Es werden, vermutlich bereits pränatal, Vorstufen unbewusster Erwartungen ausgebildet, die über die Determinanten Zeit, Raum, Erregung und Affekt organisiert werden. Spätestens gegen Ende des ersten Lebensjahres werden diese Erwartungen prototypisch organisiert, kategorisiert und abstrahiert. Auf dieser Basis bilden sich erste Formen von Interaktionsrepräsentanzen (sie beinhalten Selbst- und Objektrepräsentanzen, der wesentlich repräsentierte Teil ist aber die Interaktion und die damit verbundene affektive Erfahrung). D. h. auf präsymbolischer Ebene wird der Interaktionsprozess selbst repräsentiert, d. h. die Art und Weise des reziproken Zusammenspiels und wie dieses der Säugling erlebt. Die Gedächtnisbildung hat daher wesensmäßig mit dem Prozess selbst zu tun, d. h. der Interaktion – D. Stern spricht folgerichtig von Interaktionsrepräsentanzen als kleinsten strukturellen seelischen Bausteinen. Interaktion ist somit ein wesentlicher Grundbaustein des Seelischen, und die Abstimmung trägt im Bereich der Affekte das ihre bei. Mittlerweile gelingt es einigermaßen verlässlich, aufgrund der 11 Videoanalysen Bindungsstile vorauszusagen – z. B. aufgrund stimmlicher Rhythmen. Es zeigt sich, dass keinesfalls sehr hohe bzw. optimale Abstimmung zu sicherer Bindung führt. Ein mittleres Koordinationsmuster mit der Möglichkeit für Eigengestaltung des Babys und dem Erleben von Grenzerfahrungen erweist sich für eine sichere Bindung und gute Selbstregulierung als optimal. D. h. sowohl Erfahrungen von Entsprechung als auch Nicht-Entsprechung der jeweiligen Affektmuster sind wichtig und werden auf prozeduraler Ebene kodiert. Babys besitzen allerdings unterschiedliche Toleranzgrenzen – erinnern Sie sich an Stressreaktivität als Temperamentsfaktor – d. h. manche Babys brauchen eine präzisere elterliche Abstimmung als andere. Problematisch werden Fehlabstimmungen erst dann, wenn diese Toleranzgrenzen immer wieder massiv überschritten werden. Beebe und Lachman unterscheiden drei Organisationsprinzipien präsymbolischer Repräsentation: Prinzip ständiger Regulierung Prinzip der Unterbrechung und Wiederherstellung Prinzip der Momente von Affektsteigerung Unter Verwendung dieser drei Prinzipien bildet der Säugling Modelle von Interaktionsmustern, die als Beziehungsregeln repräsentiert werden. Diese drei Prinzipien sind auch in Therapieprozessen voll gültig. Das Prinzip der ständigen Regulierung umfasst charakteristische, erwartbare Muster von Interaktionen, die sich in der Therapiesituation ständig wiederholen. Beide Interaktionspartner tragen Moment für Moment aktiv dazu bei, ihren Austausch miteinander so zu regulieren, dass diese Muster hergestellt werden. Der Austausch läuft über nonverbale Verhaltensweisen wie Körperhaltung, Mimik, Tonfall, stimmlichem Klang usw. Beide Teilnehmer an der Interaktion erwarten und repräsentieren diese spezifischen Regulierungen und deren einzigartige Wirksamkeit mit dem jeweiligen Partner. 12 Im Prinzip der Unterbrechung und Wiederherstellung liegt der Schwerpunkt dort, wie es gelingt, die ständig stattfindenden „Risse“ im Kontakt auf der Mikroebene wieder zu kitten. Von Unterbrechungs- und Wiederherstellungsprozessen geprägte Interaktionen treten besonders in Phasen der Konfrontation oder der Deutung auf. Sie lassen sich unter dem Aspekt betrachten, dass sie für die Entwicklung notwendig sind und vom Widerstand des Patienten ausgehen. Die Art und Weise, wie es beiden Interaktionspartnern gelingen kann, die Kontaktbrüche zu reparieren, hängt entscheidend mit dem Erfolg/Misserfolg der Therapie zusammen. Zum Prinzip von Momenten der Affektsteigerung kann man sagen: Eine Form elterlicher Regulierung zielt darauf ab, die Erregungstoleranz des Babys zu steigern. In ihrem Verhalten stimulieren sie ihr Kind über dessen momentanes Erregungsniveau hinaus und ermöglichen ihm auf diese Weise eine neue Qualität inneren Erlebens oder äußeren Verhaltens. Beispiel: Ein Kind trägt gern einen Ball herum – Papa sagt: Oh, das ist aber toll! Dabei wird die Begeisterung des Elternteils verbal und verhaltensmäßig ausgedrückt, z. B. über die stimmliche Signalgebung. Finden genügend Wiederholungen einer solchen Erfahrung gemeinsam geteilter positiver Spitzenaffekte statt, finden sie als Rigs (Stern) ihren repräsentationalen Niederschlag. Gerät das Kind später in eine ähnliche Situation, taucht innerlich – unbewusst – diese Repräsentanz auf, wobei Stern den Objektaspekt als „evozierten Gefährten“ bezeichnet. Dieser „innere Begleiter“ fördert die weitere Entwicklung und hilft dem Kind dabei, das eigene Erregungsniveau immer wieder in Richtung positiver Affekte zu überschreiten. Im Falle positiver Spitzenaffekte geht es beim Kind um eine Bewegung hin zu einem Zustand, den es noch nicht erreicht hat. Man spricht von einem proximalen Entwicklungsbreich (Stern 1998, S. 272), und er wird dadurch möglich, dass die Eltern diesbezüglich eine mentale Vorstellung haben – bewusst oder unbewusst glauben sie daran, dass eine solche Ko-Regulierung in einen proximalen Entwicklungsbereich möglich ist. 13 Kreditierung Mit dem Begriff der Kreditierung, der von Heigl-Evers stammt, ist ein bestimmter Modus entwicklungsfördernder Kommunikation gemeint – eine bestimmte Form der Bezogenheit, wenn Sie so wollen. Alfred Adler sprach von Ermutigung. Grundlage für diese Bezogenheit ist eine elterliche Haltung, die alle Lebensbewegungen des Kindes, schon im Mutterleib, mit einer positiven Entwicklungsaussicht verknüpft, d. h. sie als positives Anzeichen für eine weitere Entfaltung in der Zukunft sehen kann. Den Lebensbewegungen des Kindes – ein Begriff, den G. Heisterkamp und ich im Lehrbuch geprägt haben wird eine Entwicklungsperspektive zugeschrieben, die Eltern geben den Kindern gleichermaßen „Kredit“, indem sie davon ausgehen, dass diese aus ihrem Potenzial das Beste machen werden. Beispiel: Die unspezifische Lautäußerung, das Brabbeln des Babys – die Eltern glauben unbewusst daran, dass sich aus ihnen irgendwann sinnvolle Mitteilungen entwickeln werden. Die positiven Erwartungen der Eltern steuern ihre Aufmerksamkeit und das Maß an Anerkennung und Förderung, das sie dem Kind geben. Kreditierung meint einen Beziehungsmodus, der motivierend und ermutigend wirkt, nach dem Motto: „Ich glaube an Dich!“ Das gilt für Baby, und es gilt für unsere Patienten!! Dieser Modus fördert die Selbstregulationskompetenz. Das Gegenteil von Kreditierung gibt es natürlich auch – die Diskreditierung, das Absprechen von Kompetenzen – „Aus Dir wird ja sowieso nichts!“ ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLUSS 1. In menschlichen Diaden werden Bezogenheiten ständig neu ausgehandelt, von Moment zu Moment (das kann man in Videomikroanalysen eindrucksvoll beobachten); dadurch sind Bezogenheitsmuster grundsätzlich für Veränderungen offen. Wir befinden uns bei diesen Aushandlungsprozessen auf einer prozeduralen Ebene, also in der Sphäre des unmittelbaren Handelns 14 bzw. Wirkgeschehens, von dem uns nur ein kleiner Teil bewusst ist. Patient und Therapeut behandeln einander ständig gegenseitig im Sinne eines unmittelbaren Wirkgeschehens, das oft nicht reflektiert werden muss, das aber trotzdem wirkt, im Positiven genau wie im Negativen. Der psychoanalytische Zugang über die Widerstandsanalyse und die nachträgliche verbale Reflexion des Therapiegeschehens ist also nur ein Teil der therapeutischen Aufgabe, in den analytischen Therapieformen natürlich ein wichtiger Teil. Es betrifft den sog. Konfliktpol. Das psychische Heilungssystem ist ein lebendiges System, das organisch und selbstregulierend zwischen den Polen Konflikt und Ressourcen schwankt bzw. Übergänge von funktionalen zu dysfunktionalen Ordnungsmustern (und umgekehrt!!!) von selbst erzeugt. Der Therapeut ist permanent an der Ko-Konstruktion der Beziehung beteiligt – die Beziehung wird aus intersubjektiv-relationaler Sicht als System betrachtet, d. h. die beiden Interaktanden werden nicht so sehr als getrennte Einheiten gesehen, sondern als System, das etwas sehr Spezifisches hervorbringt. Sie bewegen sich gemeinsam, als System, konstant zwischen dem Konflikt- und dem Ressourcenpol. Durch Psychotherapie kann das Einlassen beider Partner in einen interaktiven Regulierungsprozess zur Veränderung von Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit führen. Dabei gibt es viele verschiedene Wege das zu tun (AKP ist einer von ihnen), jedoch ist das unmittelbare gemeinsame Wirkgeschehen in jedem dieser Wege am Werk – analytische Körperpsychotherapie nutzt zusätzlich den Weg der bewussten und unbewussten Handlungsdialoge als Verstehensquelle im Hinblick auf unbewusste Prozesse, basierend auf Theorien über die Interaktion, die u. a. auf die neue Säuglingsforschung einbeziehen. 2. Wenn Patienten zu uns kommen, haben sie in der Regel das Vertrauen in ihre Selbstregulierungsfähigkeiten verloren. Sie sind daher in der 15 Therapie auf ein Gegenüber angewiesen, das ihnen glaubwürdig Zuversicht auf Veränderung und auf Vertrauen in die eigenen Entwicklungsfähigkeiten entgegenbringt, ohne den Patienten zu entmündigen und auch ohne als omnipotenter Retter aufzutreten. Im Eröffnen einer Hoffnungsperspektive liegt somit ein zentraler therapeutischer Wirkmechanismus. Dabei ist zu beachten, dass die Vermittlung positiver Therapieerwartungen kein technisch handhabbares Instrument darstellt, sondern dass es dabei um die echte Erwartung und Einstellung des Therapeuten geht. Der Therapeut muss so viel Wertschätzung für die Person des Patienten und Zutrauen in seine Entwicklungsmöglichkeiten aufbringen, dass er in seiner inneren Einstellung einen positiven Entwurf für eine eventuelle therapeutische Zusammenarbeit erstellen kann. Dem Patienten Kredit zu geben heißt auch, ihm etwas zuzumuten, ihn herauszufordern, ihn zu konfrontieren. In der Therapie übernimmt der Therapeut die Funktion eines selbstregulierenden Anderen, der sich im Stadium der Unsicherheit und Angst als Hilfs-Ich, als Selbstobjekt anbietet und den Patienten in seinem proximalen Entwicklungsbereich anspricht. Besonders in jenen Fällen ist therapeutische Kreditierung notwendig, wo die Verinnerlichung entwicklungsstimulierender Selbstregulationsfunktionen noch gar nicht stattgefunden hat. Eine kreditierende Haltung des Therapeuten zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Therapeut den Patienten zur Anerkennung des eigenen Akteurstatus herausfordert. Im Gespräch versucht der Therapeut daher die Aufmerksamkeitsausrichtung so zu steuern, dass sich der Patient mehr seiner Täterrolle bewusst werden kann. Konkrete Handlungsszenen ermöglichen es u. U. besonders gut, dass sich der Patient seiner Täteranteile bewusst wird – vorausgesetzt, die therapeutische Beziehung ist stabil genug, damit der Patient diese Konfrontationen ertragen kann. Der Therapeut übernimmt also weder die ihm häufig vom Patienten angetragene Rolle des Sympathisanten im Leiden, der den Patienten als Opfer bedauert, noch die Rolle des omnipotenten Helfers, der den 16 Patienten gesund macht. Grundlegend ist eine Haltung, die etwa so beschreibbar ist: „Ich glaube, dass Du diesen Schritt schaffen kannst, und deswegen erwarte ich ihn auch von Dir.“ Gemeinsam geteilter Freude über Entwicklungsfortschritte kommt dabei eine wichtige Rolle in der wachsenden Selbstregulationskompetenz des Patienten zu. 17