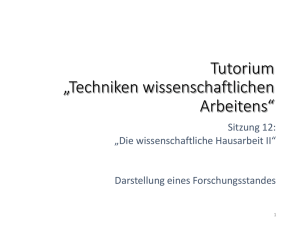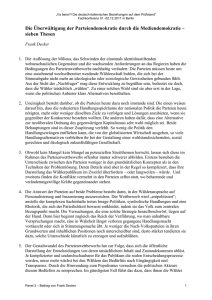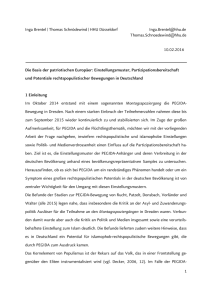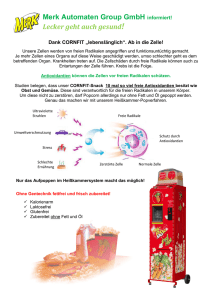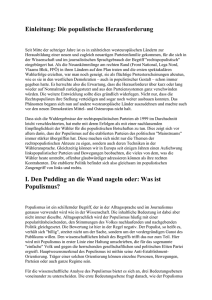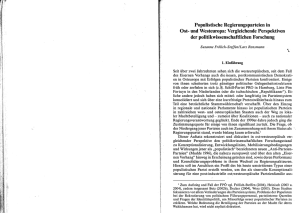Rechtspopulistische Parteien als Parteienfamilie
Werbung
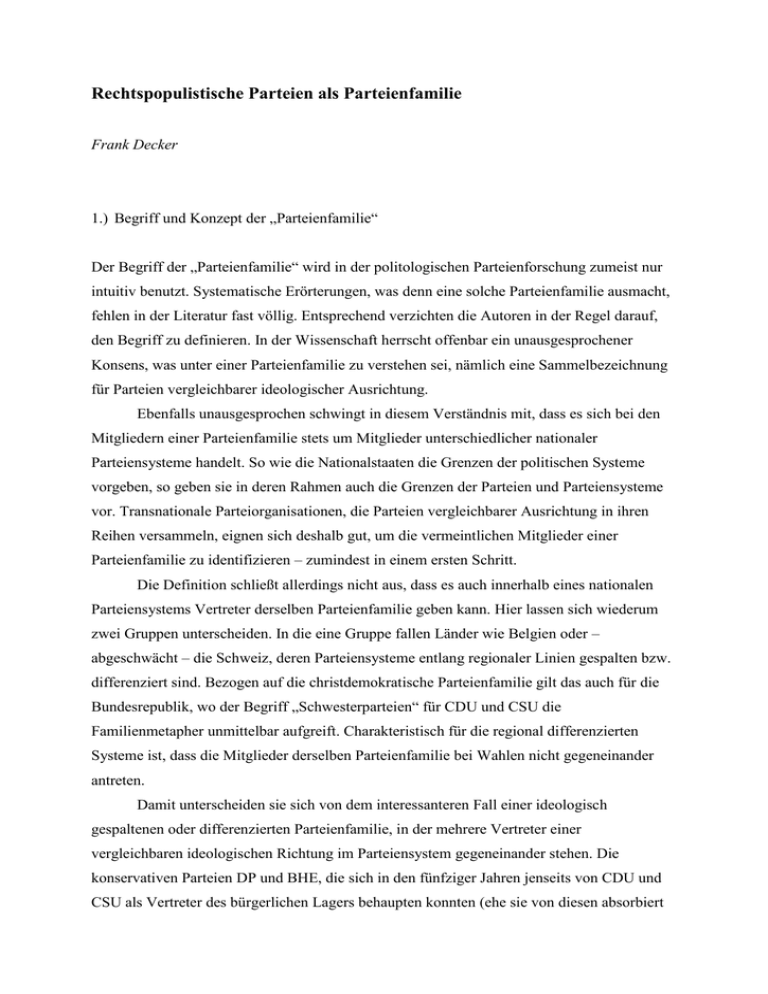
Rechtspopulistische Parteien als Parteienfamilie Frank Decker 1.) Begriff und Konzept der „Parteienfamilie“ Der Begriff der „Parteienfamilie“ wird in der politologischen Parteienforschung zumeist nur intuitiv benutzt. Systematische Erörterungen, was denn eine solche Parteienfamilie ausmacht, fehlen in der Literatur fast völlig. Entsprechend verzichten die Autoren in der Regel darauf, den Begriff zu definieren. In der Wissenschaft herrscht offenbar ein unausgesprochener Konsens, was unter einer Parteienfamilie zu verstehen sei, nämlich eine Sammelbezeichnung für Parteien vergleichbarer ideologischer Ausrichtung. Ebenfalls unausgesprochen schwingt in diesem Verständnis mit, dass es sich bei den Mitgliedern einer Parteienfamilie stets um Mitglieder unterschiedlicher nationaler Parteiensysteme handelt. So wie die Nationalstaaten die Grenzen der politischen Systeme vorgeben, so geben sie in deren Rahmen auch die Grenzen der Parteien und Parteiensysteme vor. Transnationale Parteiorganisationen, die Parteien vergleichbarer Ausrichtung in ihren Reihen versammeln, eignen sich deshalb gut, um die vermeintlichen Mitglieder einer Parteienfamilie zu identifizieren – zumindest in einem ersten Schritt. Die Definition schließt allerdings nicht aus, dass es auch innerhalb eines nationalen Parteiensystems Vertreter derselben Parteienfamilie geben kann. Hier lassen sich wiederum zwei Gruppen unterscheiden. In die eine Gruppe fallen Länder wie Belgien oder – abgeschwächt – die Schweiz, deren Parteiensysteme entlang regionaler Linien gespalten bzw. differenziert sind. Bezogen auf die christdemokratische Parteienfamilie gilt das auch für die Bundesrepublik, wo der Begriff „Schwesterparteien“ für CDU und CSU die Familienmetapher unmittelbar aufgreift. Charakteristisch für die regional differenzierten Systeme ist, dass die Mitglieder derselben Parteienfamilie bei Wahlen nicht gegeneinander antreten. Damit unterscheiden sie sich von dem interessanteren Fall einer ideologisch gespaltenen oder differenzierten Parteienfamilie, in der mehrere Vertreter einer vergleichbaren ideologischen Richtung im Parteiensystem gegeneinander stehen. Die konservativen Parteien DP und BHE, die sich in den fünfziger Jahren jenseits von CDU und CSU als Vertreter des bürgerlichen Lagers behaupten konnten (ehe sie von diesen absorbiert wurden), ließen sich hier als Beispiele nennen – oder die Koexistenz von drei christlichen Parteien in den Niederlanden bis zu deren Zusammenschluss im Jahre 1980. Noch häufiger als im gemäßigten politischen Spektrum kommen solche Spaltungen an den extremen Rändern vor, wo ideologische Radikalität und das Fehlen demokratischer Prinzipien den Zusammenhalt oder Zusammenschluss der Gruppierungen erschweren. Die potenzielle Zugehörigkeit unterschiedlicher nationaler Parteien zur selben Parteienfamilie wirft die Frage nach ihrem gemeinsamen ideologischen Kern auf. Welche Prinzipien und Positionen müssen geteilt werden, dass von einer einheitlichen Parteienfamilie gesprochen werden kann? Die Frage schließt direkt an die Familienmetapher an. Darunter können die Mitglieder der Kernfamilie bekanntlich ebenso fallen wie die näheren oder entfernten Verwandten. Der Kreis der Familienzugehörigen lässt sich also mal enger oder weiter ziehen, je nachdem, welcher Verwandtschaftsgrad der Parteien zugrundegelegt wird. Die Familienmetapher gestattet dabei über die Betrachtung der horizontalen Verwandtschaftsbeziehungen hinaus auch eine genealogische Betrachtung. Im nationalen Kontext gilt das ohnehin. Hier stammen die heutigen Parteien sämtlich von ihren historischen Vorläufern ab, was auf die Kontinuität der parteienbildenden gesellschaftlichen Konfliktlinien hindeutet. Als komplette Neuerscheinungen in den vergangenen dreißig Jahren können lediglich die grüne und – mit gewissen Abstrichen – die rechtspopulistische Parteienfamilie identifiziert werden. Im transnationalen Kontext stellt sich des weiteren die Frage nach einem möglichen pater familias, einer Referenzpartei, die die gesamte Parteienfamilie als Prototyp verkörpert und von anderen Angehörigen der Familie vielleicht sogar unmittelbar zum Vorbild genommen wird. Bezogen auf den Rechtspopulismus hat man das gelegentlich für den französischen Front National behauptet (z.B. Kitschelt/McGann 1995). So unbestritten die ideologische Ausrichtung das zentrale Kriterium der Zugehörigkeit zu einer Parteienfamilie darstellt, so fraglich ist, ob sich deren Definition darin schon erschöpft. Parteien werden in der Literatur ja auch nach anderen als ideologischen Kriterien typologisiert, etwa ihren Funktionen im politischen System, ihrem Entstehungshintergrund, ihrer Wählerstruktur und ihrer Organisation (Lucardie 2007). Diese Kriterien können bei der Bestimmung der Parteienfamilie schon deshalb nicht außer Acht gelassen werden, weil sie mit den ideologischen Merkmalen der Partei eng verbunden bzw. aus diesen ableitbar sind. So haben z.B. die sozialdemokratischen Parteien einen anderen historischen Entstehungshintergrund als die christdemokratischen, der sich in der Struktur ihrer jeweiligen Anhänger- und Wählerschaft sowie im jeweiligen Organisationsverständnis bis heute widerspiegelt. Auch zwischen Anhängerstruktur und Organisation gibt es Zusammenhänge, die sich am Umfang der Mitglieder und deren Einfluss auf die Parteiführung ablesen lassen. Die Erweiterung der Definition über die rein ideologischen Merkmale hinaus scheint bei der rechtspopulistischen Parteienfamilie geradezu zwingend. Zum einen sind die so bezeichneten Parteien in den meisten nationalen politischen Systemen in Europa relativ zeitgleich neu entstanden, was sie von ihren räumlich und zeitlich versetzt aufgetretenen populistischen Vorläufern unterscheidet. Zum anderen gewinnt die Organisationsform bei ihnen eine so herausgehobene Bedeutung, dass manche Autorin in ihr ein noch wichtigeres Erkennungsmerkmal erblicken als in der ohnehin nur vage zu umreißenden rechtspopulistischen Ideologie. 2.) Die Definition von Cas Mudde Die rechtspopulistische Parteienfamilie darf inzwischen als gut erforscht gelten (Decker 2006). Über ihre genaue Abgrenzung herrscht allerdings alles andere als Klarheit. Ein überblicksartiger Zusammenschnitt der verschiedenen in der Literatur angebotenen Definition würde ins Uferlose führen. Er kann hier unterbleiben, weil mit der 2007 erschienenen Gesamtdarstellung von Cas Mudde inzwischen eine verdienstvolle Forschungssynthese vorliegt, die sich mit bemerkenswerter Akribie an einer solchen Definition versucht. Mudde (2007: 11 f.) listet zu Beginn seiner Darstellung nicht weniger als 22 Begriffe auf, die in der Literatur für das fragliche Phänomen Verwendung gefunden haben. Er selbst plädiert dafür, die Parteienfamilie als „populistische radikale Rechte“ zu bezeichnen. Die Verwendung der „Rechten“ als Substantiv soll signalisieren, dass der Rechtsradikalismus dem Populismus als härteres ideologisches Merkmal definitorisch vorausgeht. Bei der populistischen radikalen Rechten handelt es sich also um eine bestimmte Form oder Spielart derselben, die von anderen (nicht-populistischen) Formen abzugrenzen ist. Als „radikal“ bezeichnet Mudde ideologische Positionen, die wesentliche Grundwerte der liberalen bzw. pluralistischen Demokratie ablehnen. Im Unterschied zu extremen oder extremistischen Parteien sind die radikalen Parteien aber nicht antidemokratisch schlechthin, sondern bekennen sich zumindest nominell zur Demokratie. Die populistischen Vertreter der radikalen Rechte beanspruchen sogar, die wahren Hüter der demokratischen Werte zu sein, also eine höhere Form der Demokratie zu verkörpern als der liberale Mainstream. Unter „rechts“ versteht Mudde im Anschluss an Umberto Bobbio (1994) eine Position, die bestimmte Ungleichheiten der Menschen als natürlich und mithin durch staatlichpolitisches Handeln nicht überwindbar betrachtet. Die radikale Variante der rechten Ideologie sieht er durch zwei Hauptmerkmale bestimmt: den Nativismus und den Autoritarismus. Der Nativismus steht für eine illiberale (aber nicht zwingend rassistische oder völkische) Spielart des Nationalismus, die für einen in kultureller Hinsicht möglichst homogenen Nationalstaat eintritt, diesen also von „fremden“ Personen und Ideen freihalten will. Die Bedrohung der Homogenität kann dabei von einwanderungsbedingten und / oder Nationalitätenkonfllikten ausgehen, was z.B. einen wichtigen Unterschied zwischen den meisten west- und mittelosteuropäischen Vertretern der radikalen Rechten markiert (Decker 2000: 264 f.). . Muddes Autoritarismus-Definition schließt wiederum an das klassische sozialpsychologische Verständnis der Frankfurter Schule an, die das Festhalten an traditionellen Moralvostellungen und den Glauben an die hierarchische Gliederung der Gesellschaft als Kern der autoritären Persönlichkeit begreift. Das dritte Element der Definition, der Populismus, wird von Mudde im Unterschied zu vielen anderen Autoren (und seinen eigenen früheren Arbeiten) nicht bloß als politisches Stilmittel betrachtet, sondern ebenfalls als ideologisches Merkmal. Anders als beim Nationalismus, Faschismus oder Sozialismus handelt es sich beim Populismus aber allenfalls um eine „schlanke“ oder Bindestrich-Ideologie, die damit zugleich an unterschiedliche „harte“ Ideologien anschlussfähig bleibt (Rensmann 2006). Sein Kern ist die Abgrenzung zwischen dem als selbstsüchtig gegeißelten herrschenden Establishment und dem sogenannten einfachen Volk. In der Gedankenwelt der Populisten geht folglich nichts über den allgemeinen Willen der Bürger, nicht einmal Menschenrechte oder sonstige verfassungsstaatliche Garantien. Auf der Basis dieser Definition der populistischen radikalen Rechten kann Mudde eine eindrucksvolle Liste von nicht weniger als 113 Vertretern aufmachen, die der so bezeichneten Parteienfamilie in Europa gegenwärtig angehören (75 Parteien) oder in der jüngeren Vergangenheit angehört haben (38 Parteien). Die eindrucksvolle Zahl rührt einerseits daher, dass nicht nur die etablierten westeuropäischen Demokratien, sondern auch die jungen Demokratien Mittel- und Osteuropas in die Darstellung mit einbezogen werden, was Muddes Werk unter allen Überblicksdarstellungen des neuen Rechtspopulismus deutlich heraushebt. Mit 57 Parteien in den 19 westeuropäischen und 56 in den 18 mittelosteuropäischen Ländern sind die Vertreter geografisch dabei annähernd gleich verteilt. Lediglich drei Länder (Island, Litauen und Norwegen) sind laut Muddes Zählung von dem Phänomen bislang ganz verschont geblieben. Zum anderen begnügt sich Mudde nicht damit, die in ihren jeweiligen nationalen Systemen relevanten Parteien zu betrachten; auch Splitterparteien sind in seine Untersuchung mit einbezogen. Für die Bundesrepublik wird z.B. mit der „Deutschen Liga für Volk und Heimat“ (DLVH) eine Partei als Angehöriger der fraglichen Parteienfamilie aufgeführt, die bei staatlichen Wahlen gänzlich erfolglos geblieben ist. (Bei den Landtagswahlen in BadenWürtttemberg erreichte sie 1992 mit 0,5 Prozentpunkten ihr bestes Ergebnis.) Legte man die von Sartori (1976: 121 ff.) – zugegebenermaßen etwas willkürlich – als Relevanzschwelle gesetzte Zweiprozentmarke bei nationalen Wahlen zugrunde, würde die Liste von 113 Parteien bereits erheblich zusammenschrumpfen. Mudde selbst räumt ein, dass er bei 15 Parteien aufgrund der unzureichenden Quellenlage keine sichere Zuordnung vornehmen konnte. Sein unbedingter Vollständigkeitsanspruch verdient zwar Anerkennung, dürfte aber auch zu Missverständnissen verleiten, was den tatsächlichen Umfang der von den rechtsradikalen Parteien ausgehenden Gefährdungen angeht. 3.) Kritik und ein Alternativvorschlag Der Verfasser hat vor einigen Jahren einen Typologisierungsvorschlag der rechtspopulistischen Parteienfamilie unterbreitet, der von dem Muddes in mehrerlei Hinsicht abweicht. Der Hauptunterschied liegt darin, dass ich den Populismus als ideologisches Hauptmerkmal der neuen Rechtsparteien betrachte, während Mudde ihn als Ideologiemerkmal dem Rechtsradikalismus nachordnet. Das bedeutet zugleich, dass ich die am Nativismus festgemachte Zugehörigkeit zur radikalen Rechten nicht als zwingendes Merkmal des Rechtspopulismus erachte. Daraus ergibt sich eine Erweiterung der Definition in beide Richtungen; sowohl Vertreter der gemäßigten als auch Vertreter der extremen Rechten können zur rechtspopulistischen Parteienfamilie gezählt werden. In Muddes Konzept der populistischen radikalen Rechten bleiben sie außen vor. Indem Mudde den Populismus in seine Definition der radikalen Rechten einbezieht, möchte er Vertreter der alten oder traditionellen extremen Rechten wie etwa die deutsche NPD aus der rechtsradikalen Parteienfamilie ausschließen. Diese mögen sich zwar in der Wähleransprache und Themenwahl bisweilen populistischer Elemente bedienen, zeichnen sich ansonsten aber durch eine betont elitistische, antidemokratische Ideologie aus, die populistischem Gedankengut geradewegs zuwiderläuft. Muddes Behauptung, dass populistische Parteien per se nicht-extrem sind, lässt sich allerdings schwerlich aufrechterhalten. Vertreter wie der französische Front National oder der ehemalige Vlaams Blok, die Mudde zur radikalen Rechten rechnet, werden von der Mehrzahl der Autoren als rechtsextrem eingestuft (z.B. Ivaldi / Swyngedouw 2006). Populistische und rechtsextreme Elemente bilden bei ihnen eine ideologische Synthese. Der Populismus erweist sich darin als eigentlicher Erfolgsgarant, der einerseits für eine wirksame Wähleransprache sorgt und andererseits dazu beiträgt, den anti-demokratischen Kern der rechtsextremen Ideologie zu verschleiern.1 Beides unterscheidet die populistischen Neuankömmlinge von den nichtpopulistischen Vertretern des alten Rechtsextremismus. Charakteristisch für die erstgenannten ist zudem, dass sie die rechtsextremen Inhalte auf eine neue, modernisierte Grundlage gestellt haben, die in der Literatur zumeist als „neo-rassistisch“ apostrophiert wird. Mudde grenzt dagegen den nativistischen Kern der radikalen Rechten von rassistischen Positionen ausdrücklich ab. Noch problematischer ist der Ausschluss der nicht-radikalen Vertreter des Rechtspopulismus aus der Definition. Parteien wie die Liste Pim Fortuyn, die Schweizerische Volkspartei, die norwegische Fortschrittspartei oder die Schill-Partei kommen in Muddes Liste nicht vor. Sie seien zwar eindeutig populistisch, doch fehle ihnen der nativistische Kern der rechtsradikalen Ideologie. Wird dagegen der Populismus als übergeordnetes Ideologiemerkmal betrachtet, dann erweiset sich der Nativismus (und der von Mudde als weiteres Merkmal aufgeführte Autoritarismus) nur als ein – wenn auch hervorgehobener – Teil des thematisch-programmatischen Spektrums, das von den Rechtspopulisten bedient werden kann. Die von mir vorgeschlagene Typologie unterscheidet zwischen einer kulturellen, ökonomischen und politisch-institutionellen Spielart des Rechtspopulismus. Die von Mudde genannten Ideologiemerkmale fallen unter die kulturelle Spielart, sind aber auch in deren Kontext zu eng angelegt. In der neueren Forschung hat sich der Vorschlag von Hans-Georg Betz (2002) weitgehend durchgesetzt, die rechtspopulistischen Parteien als Vertreter einer wertebezogenen „Identitätspolitik“ zu begreifen. Die Identität muss dabei nicht zwingend durch die Nation gestiftet werden, sondern kann auch in anderen – regionalen oder religiösen – Gruppenzugehörigkeiten Ausdruck finden. Beispiele für letzteres sind die italienische Lega Nord und die neue Christliche Rechte in den USA. Je stärker das Identitätsthema in den 1 Zumindest was das erste angeht, gibt es dafür mit dem italienischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus auch historische Vorbilder. Beides waren rechtsextreme Ideologien, die sich in ihrer Aufstiegsphase der populistischen Agitationstechnik meisterhaft bedient haben. Vordergrund rückt, umso größer ist der Hang des Populismus zur Radikalität. Von daher ist es kein Zufall, dass es sich bei den rechtsextremen Mitgliedern der populistischen Parteienfamilie allesamt um Exponenten der kulturellen Spielart handelt. Allerdings beweist das Beispiel der Liste Pim Fortuyn, die sich ihren niederländischen Wählern als Vorreiterin einer libertären Variante der Multikulturalismuskritik empfohlen hat, dass ein solcher Zusammenhang keineswegs zwingend ist. Bei der zweiten – ökonomischen – Spielart müssen neo-liberale und sozialpopulistische Positionen voneinander unterschieden werden. Weil die letzteren sich nicht unbedingt als rechts charakterisieren lassen, fallen ihre Vertreter nur dann unter die rechtspopulistische Rubrik, wenn wirtschaftspolitischer und kultureller Protektionismus miteinander einhergehen. In den neunziger Jahren wurde die neo-liberale Komponente in der Programmatik der meisten populistischen Parteien zurückgedrängt, während sozialpopulistische Positionen an Boden gewannen. Mit Berlusconis Forza Italia gibt es heute eigentlich nur noch einen Vertreter, den man der ökonomischen Spielart des Populismus eindeutig zurechnen kann. Die politische oder institutionelle Spielart des Populismus ergibt sich unmittelbar aus dessen Anti-Establishment-Orientierung; sie findet vor allem in den parteienstaatlich geprägten Systemen Anknüpfungspunkte. Auch regionalistische Parteien könnten hierunter subsumiert werden, zumal wenn ihre Ziele – wie im Falle der Lega Nord – durch antiparteienstaatliche Positionen überwölbt werden. Zu den parteiübergreifenden Gegenständen der institutionellen Systemkritik gehört schließlich die Einbindung in internationale Organisationen wie z.B. die Europäische Union; gerade letztere ist in jüngster Zeit zu einem immer wichtigeren Mobilisierungsissue der neuen Rechtsparteien geworden (Neumayer / Roger / Zalewski 2008). Das Thema EU ist für eine populistische Ausbeutung deshalb prädestiniert, weil es die kulturellen, ökonomischen und politisch-institutionellen Aspekte der Systemkritik zusammenführt. Dies lässt sich auf die Gesamtagenda der rechtspopulistischen Parteien ohne weiteres übertragen. Vergleicht man deren Wahlergebnisse untereinander, so waren diejenigen Vertreter am erfolgreichsten, denen es gelungen ist, aus allen drei Problembereichen gleichzeitig Kapital zu schlagen und sie zu einer programmatischen Gewinnerformel zu verbinden. Beispiele sind die FPÖ (bis 1999), die Schweizerische Volkspartei oder die Liste Pim Fortuyn (2002), deren typologische Zuordnung zum kulturellen (SVP, LPF) oder politischinstitutionellen Populismus (FPÖ) insofern nur den Schwerpunkt ihrer inhaltlichen Ausrichtung abbildet. Dass diese Parteien ideologisch zu den eher gemäßigten Rechtspopulisten gehören, ist ebenfalls kein Zufall. Allerdings zeigen die Beispiele des Vlaams Blok und des französischen Front National, dass auch extremistisch ausgerichtete Vertreter beachtliche Wahlerfolge erzielen können.