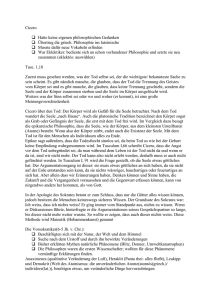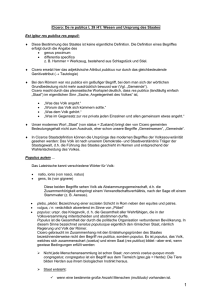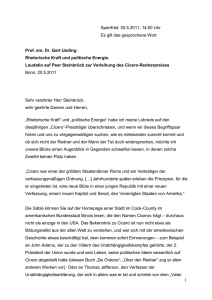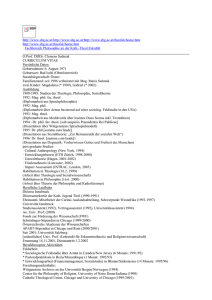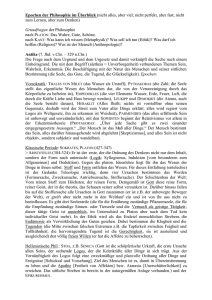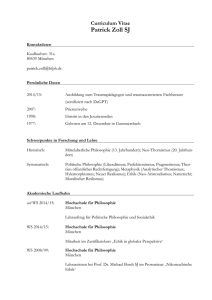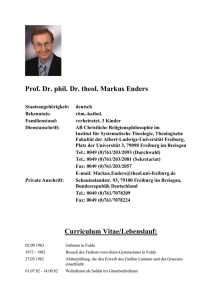4.1.3 Der philosophiegeschichtliche Hintergrund
Werbung
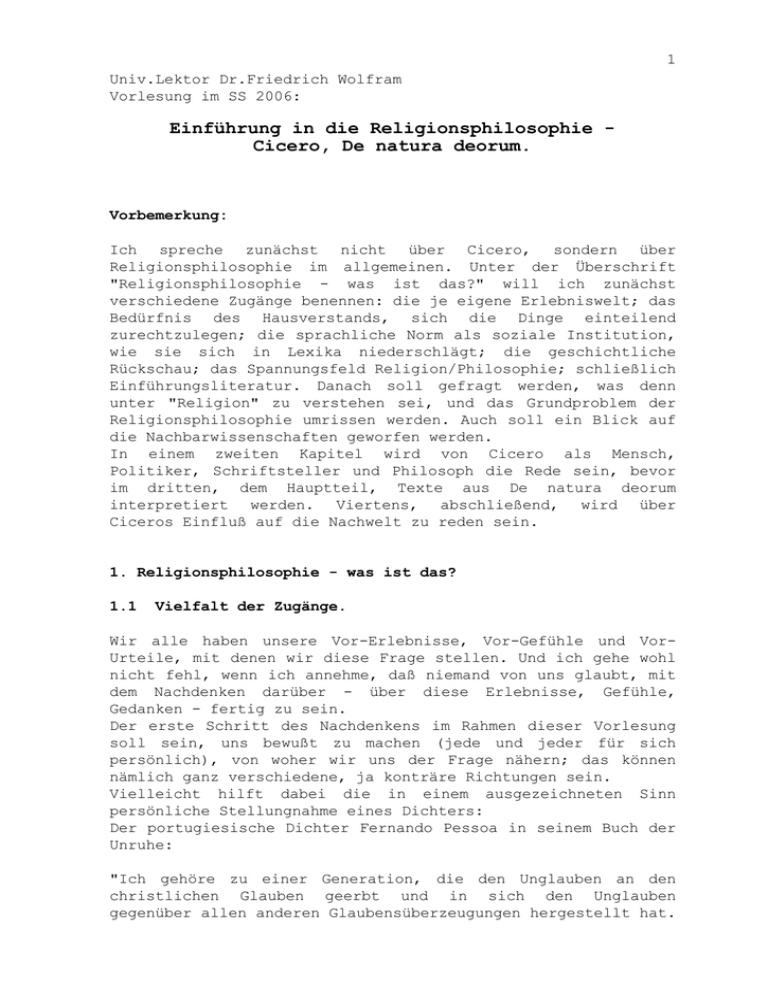
1
Univ.Lektor Dr.Friedrich Wolfram
Vorlesung im SS 2006:
Einführung in die Religionsphilosophie Cicero, De natura deorum.
Vorbemerkung:
Ich spreche zunächst nicht über Cicero, sondern über
Religionsphilosophie im allgemeinen. Unter der Überschrift
"Religionsphilosophie - was ist das?" will ich zunächst
verschiedene Zugänge benennen: die je eigene Erlebniswelt; das
Bedürfnis des Hausverstands, sich die Dinge einteilend
zurechtzulegen; die sprachliche Norm als soziale Institution,
wie sie sich in Lexika niederschlägt; die geschichtliche
Rückschau; das Spannungsfeld Religion/Philosophie; schließlich
Einführungsliteratur. Danach soll gefragt werden, was denn
unter "Religion" zu verstehen sei, und das Grundproblem der
Religionsphilosophie umrissen werden. Auch soll ein Blick auf
die Nachbarwissenschaften geworfen werden.
In einem zweiten Kapitel wird von Cicero als Mensch,
Politiker, Schriftsteller und Philosoph die Rede sein, bevor
im dritten, dem Hauptteil, Texte aus De natura deorum
interpretiert werden. Viertens, abschließend, wird über
Ciceros Einfluß auf die Nachwelt zu reden sein.
1. Religionsphilosophie - was ist das?
1.1
Vielfalt der Zugänge.
Wir alle haben unsere Vor-Erlebnisse, Vor-Gefühle und VorUrteile, mit denen wir diese Frage stellen. Und ich gehe wohl
nicht fehl, wenn ich annehme, daß niemand von uns glaubt, mit
dem Nachdenken darüber - über diese Erlebnisse, Gefühle,
Gedanken - fertig zu sein.
Der erste Schritt des Nachdenkens im Rahmen dieser Vorlesung
soll sein, uns bewußt zu machen (jede und jeder für sich
persönlich), von woher wir uns der Frage nähern; das können
nämlich ganz verschiedene, ja konträre Richtungen sein.
Vielleicht hilft dabei die in einem ausgezeichneten Sinn
persönliche Stellungnahme eines Dichters:
Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa in seinem Buch der
Unruhe:
"Ich gehöre zu einer Generation, die den Unglauben an den
christlichen Glauben geerbt und in sich den Unglauben
gegenüber allen anderen Glaubensüberzeugungen hergestellt hat.
2
Unsere Eltern besaßen noch den Impuls des Glaubens und
übertrugen ihn vom Christentum auf andere Formen der Illusion.
Einige waren Enthusiasten der sozialen Gleichheit, andere nur
in die Schönheit verliebt, andere glaubten an die Wissenschaft
und ihre Vorzüge, und wieder andere gab es, die dem
Christentum stärker verbunden blieben und in Orient und
Okzident nach religiösen Formen suchten, mit denen sie das
ohne diese Formen hohle Bewußtsein, nur noch am Leben zu sein,
beschäftigen könnten.
All das haben wir verloren, all diesen Tröstungen gegenüber
sind wir als Waisenkinder geboren worden." 1
Der österreichische Dichter Thomas Bernhard in einem Interview
mit der ORF-Journalistin Fleischmann:
"Fleischmann
Sie verwenden den Begriff 'Herrgott'. Sie glauben ja nicht an
ihn, oder?
Bernhard
Glauben braucht man nicht an was, das man ständig sieht. Der
Herrgott ist doch überall, brauch' ich ja nicht daran glauben.
Sagt ja schon die Kirche: 'Gott ist überall'. Also erspare ich
mir den Glauben. Ist ja auch ein Widerspruch, ist ja unsinnig.
Wie soll man an eine Kirche glauben, die behauptet, daß sie
überall ist? Oder eine Religion halt. Ist nicht ganz
durchdacht. Aber wer viel denkt, kommt zu nichts." 2
Oder Peter Handke in "Über die Dörfer":
"Vielleicht gibt es keinen vernünftigen Glauben, aber es gibt
den vernünftigen Glauben an den göttlichen Schauder. Es gibt
den göttlichen Eingriff, und ihr alle kennt ihn. Es ist der
Augenblick, mit dem das Drohschwarz zur Liebesfarbe wird, und
mit dem ihr sagen könnt und weitersagen wollt: Ich bin es." 3
Man kann, glaube ich, nicht sagen, daß solche Dichterworte uns
aufklären; sie wollen eher Scheinklarheiten verunklären,
Verwirrung stiften; aber diese Verwirrung kann nützlich sein,
indem sie zu eigener persönlicher Stellungnahme herausfordert.
Eine nur scheinbare Klarheit bieten ja geistesgeschichtliche
Einteilungen, die sich an die drei möglichen Optionen halten:
Für Religion, gegen Religion, und drittens Indifferenz
Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo
Soares. Aus dem Portugiesischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen
von Georg Rudolf Lind. Fischer TB, Frankfurt am Main 1987. S.14.
2 Thomas Bernhard - Eine Begegnung. Gespräche mit Krista Fleischmann.
Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien 1991. S.227f.
3 Peter Handke, Über die Dörfer. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1981.
S.103.
1
3
gegenüber Religion. Denn wenn wir statt auf die Dichter auf
die Denker hören, so finden wir, daß kaum einem dieses
Prokrustes-Bett paßt. Da wimmelt es von zweifelnden Apologeten
ebenso wie von gläubigen Kritikern und leidenschaftlich
suchenden Skeptikern. (Um nicht einem Schubladen-Denken
Vorschub zu leisten, werde ich nicht damit beginnen, die
wichtigen religionswissenschaftlichen Begriffe, wie Theismus,
Monotheismus, Atheismus, Agnostizismus etc., zu definieren;
wir werden sukzessive auf sie kommen.)
Trotzdem hat auch das Einteilen seinen relativen Wert; es
hilft und regt an, Alternativen zu bedenken und vielleicht
doch Entscheidungen zu treffen.
Da gibt es also in unserer Zeit und in unseren europäischen
Breiten einmal das mögliche Interesse, um der Vollendung der
neuzeitlichen Emanzipation willen die jüdisch-christliche
Tradition und die Religion überhaupt als falsches Bewußtsein
und Ideologie kritisieren und negieren zu müssen.
Andere
gehen
davon aus, daß man auch in der sich
emanzipierenden Welt diese Tradition und die Religion
überhaupt apologetisch vertreten kann und muß. Das wäre das
zweite mögliche Interesse.
Das dritte ist das Interesse derjenigen, die der Meinung sind,
daß in der Gegenwart der Emanzipationsprozeß von der jüdischchristlichen Tradition vollendet ist und daß damit weder ein
Bedürfnis der Kritik noch der Apologie vorhanden ist. Sie
beschränken
sich
darauf,
religiöse
Vorstellungen
und
Institutionen empirisch und "wertfrei" zu untersuchen.
Von all dem gilt, was Giuseppe Ungaretti in einem Vers sagt:
„Tutto e incipiato ed niente e perfetto“ - "Alles ist begonnen
und nichts ist vollendet."
Eine mögliche Annäherung an die Thematik ist die, im Lexikon
nachzuschauen. Weil unsere Sprache als soziale Institution
angesehen werden kann 4 , können wir Begriffe als "sprachliche
Norm", wie sie im Lexikon festgehalten ist, nachlesen.
Die heutige, zeitgenössische Norm unterscheidet sich dabei von
der früherer Zeiten, wie man an einem Vergleich von Lexiken
verschiedener Jahrzehnte leicht ersehen kann. Es ist sogar
sehr
aufschlußreich,
vom
gleichen
Lexikon
verschiedene
Auflagen zu vergleichen.
In einem gängigen Konversationslexikon - z.B. in Meyers Großem
Universallexikon
in
15
Bänden
von
1984
wird
Religionsphilosophie als "philosophische Disziplin, deren
Gegenstand die Begriffs- und Wesensbestimmung der Religion
vgl. Hans Ulrich Gumbrecht, Begriffsgeschichte
Sozialgeschichte, Archiv für Begriffsgeschichte 1978.
4
als
Methode
der
4
ist, im weiteren Sinn" bestimmt.
"Im engeren Sinne gilt R. als philosophische, ausschließlich
mit
rationalen
bzw.
wissenschaftlichen
Methoden
und
Argumentationsverfahren operierende Reflexion der Bedingungen,
Möglichkeiten und Grenzen von Aussagen der (positiven)
Religion(en) und über die Religion(en) einschließlich der
kritischen
Auseinandersetzung
(Religionskritik)".
Der
Verfasser des Lexikonartikels fügt hinzu, daß, wie die
Definition
von
Philosophie,
die
Bestimmung
der
Religionsphilosophie und ihres Gegenstandsbereichs abhängig
ist
von
den
jeweiligen
religionsphilosophischen,
wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Positionen, und
sich deshalb nicht einheitlich und generalisierend durchführen
läßt.
Er sieht es als allgemein bekannt an, daß im Mittelpunkt des
religionsphilosophischen
Interesses
Aussagen
über
die
Relationen:
Venunft (Ratio) und Offenbarung,
Glaube (Fides) und Wissen,
Gott und Welt,
Gott und Mensch,5
Das Gute - das Böse,
das religiöse Selbstbewußtsein (Gefühl),
das Heilige,
Religion, Gesellschaft und Staat
stehen. Ebenso, daß Religionsphilosophie kein zeitloses
Phänomen ist, sondern eine Geschichte hat, wie auch die Sache,
um
die
es
ihr
geht.
Ansätze
und
Aussagen
der
Religionsphilosophie finden sich in der philosophischen
Tradition seit der griechischen Antike, in der christlichen
Tradition seit Origenes (ca.185-254) Zur Ausbildung einer
autonomen,
methodisch-wissenschaftlich
verfahrenden
Religionsphilosophie kommt es erst in der Neuzeit im
Rationalismus durch Baruch/Benedictus de Spinoza (1632-1677).
In der Antike hat es also den Begriff der Religionsphilosophie
noch gar nicht gegeben, wohl aber Ansätze und Aussagen
derselben.
Der Begriff Religionsphilosophie wird in Deutschland erst seit
dem Ende des 18.Jh. gebraucht. Erst seit der Aufklärung gibt
es die Religionsphilosophie als eine besondere Disziplin
innerhalb der Philosophie bzw. der Theologie. Man kann also
die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, von
Religionsphilosophie zu sprechen, auch wenn man sich auf
Äußerungen bezieht, die einer früheren historischen Situation
entstammen, etwa der Antike.
Vgl. Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, S.62: „Wirkt Gott wirklich,
wenn der Mensch die Initiative und Schaffenskraft hat, welche die Neuzeit
behauptet? Und kann der Mensch handeln und schaffen, wenn Gott am Werk
ist?“
5
5
Willi Oelmüller (1930-1999) hat sich dagegen ausgesprochen,
den Begriff Religionsphilosophie zur Kennzeichnung früherer
Vorstellungen und Lehren rückzuübertragen. 6
Oelmüller meint: "Auch wenn die griechische Philosophie den
Mythos
kritisierte,
wenn
Plato
und
Aristoteles
ihre
Philosophie als Betrachtung des Göttlichen verstanden oder
wenn die griechisch-römische Antike zwischen der mythischen,
natürlichen und politischen Theologie unterschied, gingen sie
dabei von Voraussetzungen aus, die nach Christus und erst
recht seit der europäischen Aufklärung nicht mehr allgemein
anerkannt sind." 7
Die Auslegung biblischer Texte und ihre Applikation für die
Gegenwart mit Hilfe philosophischer Vorstellungen, v.a. der
von Plato und Aristoteles, die von Anfang an zur jüdischchristlichen Tradition gehört, war im Sinne Oelmüllers keine
Religionsphilosophie, sondern Theologie. Religionsphilosophie
sei erst möglich und notwendig gewesen, als die Subjektivität
und die kritische Vernunft im Prozeß der Emanzipation und der
Aufklärung das "Bedürfnis der Erkenntnis" der Religion hatten.
Man kann aber einwenden: Das „Bedürfnis der Erkenntnis“ ist
nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern hat sich
entwickelt. Hat denn ein Augustinus von Hippo das Bedürfnis
der Erkenntnis und die Subjektivität noch nicht gekannt? Wir
können auch nicht umhin, von unserem nachaufklärerischen
Standpunkt aus uns mit älteren Positionen auseinanderzusetzen,
sie in unsere Überlegungen mit einzubeziehen.
Mir scheint wichtig festzuhalten, daß Religionsphilosophie
eine Disziplin ist, mit der man sich sowohl innerhalb der
Theologie als auch innerhalb der Philosophie beschäftigen
kann. 8
Um das nachvollziehen zu können, brauchen wir ein Kriterium
zur Unterscheidung von Philosophie und Theologie. Nehmen wir
folgendes Kriterium an: Bei einer philosophischen Betrachtung
kann man sich nicht auf Offenbarung berufen, hingegen ist es
in der Theologie erlaubt. Man kann sich z.B. auf die Bibel,
den Koran, die Upanischaden usw., auf eine in der jeweiligen
Religion gültige Autorität oder auf eine anerkannte Tradition
berufen. Alle diese Argumente können in der Philosophie nicht
anerkannt werden. Soll eine Argumentation philosophisch sein,
dann müssen die Argumente vernünftig sein. Das heißt aber
nicht, daß theologische Argumente von der Philosophie eo ipso
6
7
8
W.Oelmüller, Religionsphilosophie, in: Herders Theologisches
Taschenlexikon in 8 Bdn, hrsg.v.Karl Rahner, Bd.6, Freiburg 1973, 253.
op.cit. 254
Vgl. Hubertus G. Hubbeling, Einführung in die Religions-philosophie,
Göttingen 1981, = Uni-Taschenb. 1152, 11.
6
für falsch erklärt werden. Man kann mit ihnen so wie mit
unbewiesenen Hypothesen umgehen.
Mit Richard Schaeffler bin ich einverstanden, der sagt: "Seit
die Philosophie entstand, ist die Religion ihr Thema gewesen.
Denn die meisten Fragen, auf die Philosophen zu antworten
versuchten, (z.B. die Frage nach dem Ursprung der Welt, nach
der Stellung des Menschen im Kosmos, nach den sittlichen
Normen des Handelns, nach den Möglichkeiten und Grenzen des
Erkennens) sind zuvor Themen mythologischer Erzählungen,
kultischer Begehungen, religiöser Weisheitssprüche gewesen." 9
Die Philosophie gewann in ihren Anfängen und immer wieder im
Verlauf
ihrer
Geschichte
ihr
unterscheidendes
Selbstverständnis dadurch, daß sie sich von der Religion oder von dem, was sie dafür hielt -kritisch abgrenzte.
Es läßt sich nicht leugnen, daß es auch vor der Aufklärung ein
Spannungsverhältnis zwischen Religion und Philosophie gegeben
hat.
Die Religion ist älter als die Philosophie, sie ist aber auch
Zeitgenossin der Philosophie geblieben. Die Religion hat sich,
jedenfalls bis heute, nicht in Philosophie oder Wissenschaft
aufheben lassen. Sie hat sich auch nicht auf jene praktischen
Aufgaben und theoretischen Fragen abdrängen lassen, für die
die Philosophie und die Wissenschaft sich als unzuständig
erklärten.
Die Religion ist das der Philosophie gegenüber andere
geblieben, und zwar auch dann, wenn ein und derselbe Mensch
sich mit den gleichen Fragen bald als Philosoph, bald als
religiöses Individuum und Mitglied einer Religionsgemeinschaft
auseinanderzusetzen versucht.
Ich
finde
es
nicht
störend,
wenn
der
Terminus
Religionsphilosophie
auch
rückblickend
auf
das
Spannungsverhältnis Religion/Philosophie - etwa in der Antike
- verwendet wird. Es ist ein in einer bestimmten historischen
Situation geprägter, aber auch auf andere historische
Situationen anwendbarer Begriff.
Variabel
ist
dabei
zweierlei:
Die
verschiedenen
Religionsphilosophen unterscheiden sich einmal durch die
Antwort, die sie auf die Frage: "Was ist Religion?" geben
wollen. Zum anderen unterscheiden sie sich schon durch die Art
der Fragestellung selbst. Was an der Religion (an dem
Phänomenkomplex, der unter dem Titel "Religion" zusammengefaßt
wird) als auslegungs-und erklärungsbedürftig gilt, welche
9
R.Schaeffler, Religionsphilosophie. Handbuch der Philosophie,
hrsg.v.Elisab.Ströker u.Wolfg.Wieland, Freiburg, München 1983.
7
Auslegungen und Erklärungen als "zureichend" bewertet werden,
das ist von mal zu mal verschieden.
In diesem Sinn scheint es zweckmäßig, verschiedene historische
Ausprägungen als Typen innerhalb der Religionsphilosophie zu
unterscheiden. Platon wird dann einem Typus angehören,
Augustinus einem anderen, Hegel wieder einem anderen.
Als Beispiel einer solchen Typologie nenne ich die von
R.Schaeffler mit ihrer Dreiteilung:
(1) Religionsphilosophie als Kritik eines "vorrationalen
Bewußtseins"
(2) Religionsphilosophie als Verwandlung von Religion in
Philosophie
(3) Religionsphilosophie auf der Basis philosophischer
Theologie.
Schaeffler ergänzt diese drei (bereits in der Antike
vorfindlichen) Typen noch durch einen vierten und fünften aus
jüngerer Zeit: den phänomenologischen Typ und den Typ der
Analytik religiöser Sprache. Andere Beispiele bieten Wilhelm
Dupré, Ulrich Mann u.a.
Der Genitiv "Religions-" im Wort "Religionsphilosophie" kann
ein objektiver oder ein subjektiver Genitiv sein. Im ersteren
Fall bezieht sich die Religionsphilosophie auf die vernünftige
Betrachtung der Religion; im anderen Fall fragt man sich,
welche philosophischen Implikationen eine bestimmte Religion
hat. Selbstverständlich führt dies jeweils zu ganz anderen
Fragen.
In
den
verschiedenen
Handbüchern
der
Religionsphilosophie
werden
denn
auch
unterschiedliche
Probleme behandelt. Sie werden dadurch zu einer bunten
Sammlung:
(1) Was ist Religion?
(2) Welche logischen Regeln gelten für religiöse Aussagen
bzw.
was ist ihr logischer Status?
(3) Im Zentrum steht aber m.E. die Frage nach der Wahrheit
der
religiösen Aussagen. Wir können sogar behaupten, daß die
Religionsphilosophie sich gerade darin von der
Religionswissenschaft unterscheidet. Die Religionswissenschaft fragt nicht nach einer etwaigen Wahrheit
oder
Falschheit der von ihr studierten Religionen. In der
Religionsphilosophie wird diese Frage jedoch gestellt.
Wir
können folgende Formel aufstellen: Religionsphilosophie =
Religionswissenschaft + das Aufwerfen der Wahrheitsfrage.
(4) Man kann versuchen, die Wahrheitsfrage von einem
8
bestimmten dogmatischen Gesichtspunkt aus zu beantworten.
Dann ist Religionsphilosophie ein Teil der Dogmatik, und
zwar derjenige Teil, in dem die Diskussion mit den
verschiedenen philosophischen Theorien und mit den
anderen
Religionen geführt wird.
(5) Was ist der Wert der verschiedenen religiösen Aussagen
und
Handlungen? Fördern sie die soziale und psychische
Integration des Menschen? Die Aufgabe, diese Fragen zu
beantworten, teilt die Religionsphilosophie mit der
Soziologie und Psychologie der Religion.
(6) Was ist der logische Status der theologischen Aussagen?
Das ist etwas anderes als die unter (2) genannte Frage
nach dem logischen Status der religiösen Aussagen.
Religionsphilosophie hat ein Grundproblem. Paul Tillich, ein
evangelischer Theologe des vergangenen Jahrhunderts, hat es
unübertrefflich formuliert:
"In der Religion tritt der Philosophie ein Objekt entgegen,
das sich dagegen sträubt, Objekt der Philosophie zu werden.
Die Religion macht, je stärker, ursprünglicher, reiner sie
ist,
desto
nachdrücklicher
den
Anspruch,
der
verallgemeinernden Begriffsbildung enthoben zu sein. ...
Religion fühlt einen Angriff auf ihr innerstes Wesen, wenn sie
Religion genannt wird. ... Die Religionsphilosophie ist also
der Religion gegenüber in der eigentümlichen Lage, daß sie das
Objekt, das sie erfassen will, entweder auflösen oder sich vor
ihm auflösen muß. Beachtet sie den Offenbarungsanspruch der
Religion nicht, so verfehlt sie ihr Objekt und spricht nicht
von
der
wirklichen
Religion.
Erkennt
sie
den
Offenbarungsanspruch an, so wird sie zur Theologie.
Beide Wege sind für die Religionsphilosophie ungangbar. Der
erste führt sie an ihrem Ziel vorbei, der zweite führt nicht
nur zur Auflösung der Religionsphilosophie, sondern der
Philosophie überhaupt. Gibt es einen Gegenstand, der der
Philosophie grundsätzlich verschlossen bleibt, so ist ihr
Recht auf jeden Gegenstand fragwürdig geworden. Denn sie würde
ja außerstande sein, von sich aus die Grenze zwischen diesem
verschlossenen Gegenstand, also der Religion, und den übrigen
Gebieten zu ziehen. Ja, es wäre möglich, daß die Offenbarung
Anspruch auf alle Gebiete machte; und die Philosophie hätte
keine Waffe, sich diesem Anspruch zu widersetzen. Gibt sie
sich an einem Punkte auf, so gibt sie sich überhaupt auf." 10
Tillich hat mit diesem Gegensatz von Religionsphilosophie und
Offenbarungslehre das Problem in seiner ganzen Schärfe
gestellt. Und Sie wissen, daß es nicht nur ein dialektisches
10
Paul Tillich, Religionsphilosophie. Stuttgart 1962, 7ff.
9
Problem ist; es hat seine Realität darin erwiesen, daß es zu
den
schärfsten
Kulturkonflikten
und
zu
gewaltigen
Kulturschöpfungen geführt hat. Die Geistesgeschichte von
Religion und Philosophie zeigt in ihrem ganzen Umfang
Erscheinungen, in denen entweder die eine der beiden Formen
nahezu rein verwirklicht ist - etwa das frühe Mittelalter
einerseits,
die
Aufklärung
anderseits,
oder
in
denen
Vermittlungen und Synthesen erstrebt werden - das hohe
Mittelalter von seiten der Offenbarungslehre, Idealismus und
Romantik von seiten der Philosophie - oder in denen ein
Nebeneinander behauptet wird - etwa das späte Mittelalter, der
englische Empirismus und der theologische Kantianismus. Der
Gegensatz ist letztlich unerträglich; er zerbricht die Einheit
des Bewußtseins.
Tillich: "Solange ein naiver Glaube die eine der beiden Seiten
für
selbstverständlich
maßgebend
hält,
sei
es
die
Offenbarungslehre, sei es die Philosophie - und die andere ihr
opfert, ist der Konflikt verhüllt. Ist die Naivität aber
einmal erschüttert - die philosophische genau wie die
religiöse -, so bleibt nur die synthetische Lösung."
"Nur der Weg der Synthese ist vernünftig; er ist gefordert,
auch wenn er wieder und wieder mißlingt. Aber er muß nicht
mißlingen. Denn es gibt in der Offenbarungslehre wie in der
Philosophie einen Punkt, in dem beide eins sind. Diesen Punkt
zu finden und von da aus die synthetische Lösung zu schaffen,
ist die entscheidende Aufgabe der Religionsphilosophie." 11
Es gibt natürlich eine Alternative. Gabriel Garcia Marquez hat
sie beschrieben: In seinem Roman "La hojarasca", zu deutsch
"Laubsturm" (das Original ist 1955 erschienen) hat er die
zentrale Figur sagen lassen:
"Glauben Sie mir, ich bin kein Atheist, Oberst. Mich
beunruhigt der Gedanke, daß Gott existiert, ebenso, wie der
Gedanke, daß er nicht existiert. Daher ziehe ich vor, nicht
darüber nachzudenken."
Religionsphilosophie ist, doch darüber nachzudenken, ob die
geistige Beunruhigung nun von der Frage herrührt, ob es Gott
gibt, oder von der Tatsache, daß es Menschen gibt, die an Gott
glauben oder nicht glauben.
Religionsphilosophie stellt radikale Fragen. Das ist ihre
Methode.
Sie kann natürlich auch spezielle Methoden in Anspruch nehmen,
wie sie etwa J.M. Bocheński bescheibt 12:
--Die phänomenologische Methode
--Die semiotischen Methoden
AaO.
I.M. Bochenski, Die zeitgenössischen Denkmethoden. UTB München 1971
/5.Aufl.
11
12
10
--Die axiomatische Methode
--Die reduktiven Methoden
Mit all diesen Methoden kann
Berührung kommen.
die
Religionsphilosophie
in
Die erste Methode und die Methode schlechthin aber ist die,
von der Aristoteles in seiner Metaphysik redet. Die mit dem
Sichwundern, dem thaumázein beginnt, und zu der notwendig die
aporía gehört, die Weglosigkeit, Ausweglosigkeit, mit einem
Bedeutungsspektrum bis hin zur Verzweiflung. Aber Aporie als
Durchgangsstadium, als der Zweifel, der die Voraussetzung zur
euporía bildet, zum gelingenden Weg.
Ein katholischer Religionsphilosoph. Romano Guardini (18851968) hat in einem Vortrag über „Wahrheit und Ironie“
anläßlich seines 80.Geburtstags seine eigene Fähigkeit zum
Staunen so formuliert: „ein Wissen um die Wahrheit und
zugleich ein Wissen um die Inkommensurabilität der eigenen
Kraft ihr gegenüber; eine Erkenntnis der eigenen Ungemäßheit,
aus der aber nicht Skepsis, sondern höchste Zuversicht
hervorgeht.“ 13
Hier empfiehlt sich ein kurzer Exkurs in die Frühzeit der
Philosophie:
Die Aporie steht am Anfang der Metaphysik und damit auch ihrer
„Theologie“: Met. E 1, 1026a23: „Man könnte nämlich fragen, ob
die erste Philosophie allgemein (kathólou) ist oder auf eine
einzelne Gattung und eine einzelne Weseheit geht.“ (aporéseien
gàr án tis póteron poth’ he próte philosophía kathólou estìn è
perí ti génos.)
Es geht um die Frage nach dem Verhältnis der „Ersten
Philosophie“
zur
Ontologie
–
eine
seit
Jahrhunderten
umstrittene Problematik der aristotelischen Metaphysik. Denn
für die Eigenart der Wissenschaft von den Gründen und
Prinzipien des Seins gibt Aristoteles zwei verschiedene, sich
scheinbar ausschließende Bestimmungen.
(1) Die „Erste Philosophie“ ist die Wissenschaft von der
übersinnlichen, prozeßfreien Seinssphäre. Ihr Objekt ist das
„Getrennte“ (choristá), d.h. das dem Sein nach Selbständige,
und das „Unveränderliche“ (akíneta). Indem ihr Gegenstand als
erste Philosophie allen anderen Wissenschaften vorgeeordnet
ist, ist sie zugleich Theologie (Met. E 1, 1025b1-1026a23).
(2) Die Wissenschaft von den Gründen und Prinzipien des Seins
beschäftigt sich nicht mit einem besonderen Seinsgebiet,
sondern mit dem “Seienden als solchen” (ón hê ón) im Sinn
einer
universalen
Ontologie,
die
die
allgemeinsten
Strukturmerkmale und Prinzipien von allem, was ist, untersucht
(Met. Gamma 1).
Zwischen diesen beiden Bestimmungen, die der Distinktion einer
13
R.Guardini, Stationen und Rückblicke, Würzburg 1965, 49f.
11
„metaphysica specialis“ und einer „metaphysica generalis“
entsprechen, hat man seit langem einen Widerspruch gesehen,
den man im 19. Jh. durch Athetese von Met. E 1 und K 7 als
Interpolationen mit theologisierender Tendenz zu beseitigen
gesucht hat (Natorp u.a.). Dagegen hat W.Jaeger zwei
Entwicklungsstadien im Denken des Aristoteles angenommen
(1923), wonach die erste Bestimmung den „theologischplatonischen“ Entwurf mit einer starken Trennung der Reiche
des Sinnlichen und des Übersinnlichen, die zweite dagegen die
„aristotelischere“ Entwicklungsstufe mit der Seinskonzeption
in einem großen, einheitlichen Stufenbau darstelle. Spätere
Forscher
haben
hier
z.T.
auch
ohne
Rekurs
auf
den
Entwicklungsgedanken Schwierigkeiten gesehen. Die beiden
Gedankengänge in der Metaphysik sind nach P.Aubenque (1961) in
ihrer Unausgeglichenheit Ausdruck der aporetischen Struktur
des aristotelischen Denkens und des „zetetischen Charakters
der Metaphysik“ (griech. „zétesis“ = Forschung). Aristoteles
suchte die Antwort auf die Frage nach einer „Ersten
Philosophie“
(Problem
des
Anfangs)
und
gelangte
zur
Seinswissenschaft (Problem der Einheit). „Die Unmöglichkeit
der Theologie ist die Wirklichkeit der Ontologie“14
Indem die gesuchte Wissenschaft zur Philosophie des Suchens
wird, wird in „schaffendem Scheitern“ die dialektische
Struktur des Seins und die Unbeantwortbarkeit der Seinsaporien
freigelegt.
Wir dürfen aber nicht übersehen, daß Aristoteles die von den
Interpreten empfundene Schwierigkeit selbst gesehen hat. Wenn
er sagt: „die erste Philosophie ist allgemein in der Weise,
daß sie die erste ist, und ihre Aufgabe ist es, das Seiende
als
solches
zu
betrachten...“,
so
ergibt
sich:
„Für
Aristoteles besteht gar nicht der anstößige Widerspruch
zwischen
einer
„ersten
Philosophie“,
die
allgemeine
Seinswissenschaft ist, und einer „ersten Philosophie“, die als
Theologie nur die Substanz Gottes erforschte. Die erste
Philosophie ... ist eine Theologie von so besonderer Art, daß
sie als solche zugleich allgemeine Ontologie sein kann“15
Erklärbar wird eine derartige Verbindung durch die arist.
Auffassung
von
der
eigentümlichen
Beziehung
des
ausgezeichneten Teils zum Ganzen. Das „Erste Seiende“ ist ein
Seiendes unter anderen und zugleich Prinzip und Grund des
Seins für alles Seiende anderer Kategorien, dessen Sein „in
bezug auf ein Identisches ausgesagt wird“ (pròs hèn légesthai:
Met. Gamma 2). Diese Argumentationsform der pròs-hén-Relation
oder „focal meaning“ (Owen 1960) ermöglicht – nach Angabe der
platonischen Idee – die Einheit der Ontologie durch den
Nachweis einer nicht bloß homonymen Beziehung des Seienden
P.Aubenque, A. und das Problem der Metaphysik, in: Zeitschrift f.
philos. Forschung 15 (1961) 321-333. 333.
15 G.Patzig, Theologie und Ontologie in der Metaphysik des Aristoteles,
in: Kant-Studien 52 (1960/61) 185-205. 191.
14
12
(Met. Gamma 2, 1003b12-19). Da Gott als unbewegter Beweger die
erste Substanz und zugleich Seinsfundament aller anderen
Substanzen ist, muß Theologie zugleich allgemeine Ontologie
sein.
Einige Hinweise auf Literatur,
Religionsphilosophie dient.
die
der
Einführung
in
die
(1) Im Handbuch Philosophie, hrsg. v. Elisabeth Ströker und
Wolfgang
Wieland:
Richard
Schaeffler
(Bochum),
Religionsphilosophie. Freiburg - München (Verlag Karl Alber)
1983.
Dieses
Buch
ist
weder
eine
Religionsphilosophie
noch
beschreibt es die vielen Religionsphilosophien, die im Laufe
der
Geschichte
vorgelegt
worden
sind.
Es
versucht,
Fragestellungen, Lösungsansätze und Methoden zu beschreiben
und so einen Überblick über die Vielfalt der Möglichkeiten zu
vermitteln, wie Religionsphilosophie verstanden und betrieben
werden konnte und heute noch kann.
(2) Gut lesbar ist auch in der Reihe der Uni-Taschenbücher:
Hubertus
G.
Hubbeling
(Groningen),
Einführung
in
die
Religionsphilosophie. Göttingen (Vandenhoek & Rupprecht) 1981.
Es ist eine Einführung in die wichtigsten Themen, Probleme und
Ergebnisse der modernen Religionsphilosophie. Nach einer
kurzen historischen Übersicht über repräsentative klassische
Religionsphilosophen
werden
die
Hauptaspekte
religiöser
Erfahrung, der Logik der Religion und der religiösen Sprache
thematisiert, wobei zugleich Vertreter der gegenwärtigen
Religionsphilosophie vorgestellt werden. Es beginnt mit Anselm
von Canterbury.
(3) Ebenfalls ein Uni-Taschenbuch: Kurt Wuchterl (Stuttgart),
Philosophie
und
Religion.
Zur
Aktualität
der
Religionsphilosophie. Bern - Stuttgart (Verlag Paul Haupt).
Wuchterl geht von der Tatsache aus, daß das Verhältnis
zwischen Philosophie und Religion lange Zeit distanziert und
kritisch war. Er glaubt aber eine Wende in der analytischen
Philosophie zu erkennen, die eine Rehabilitierung der
Religionsphilosophie bewirke. Er will in einer Neukonzeption
zu
einer
toleranteren
und
zugleich
intellektuell
verantwortbaren Beurteilung religiöser Phänomene führen.
(4) Texte zum Einlesen samt kurzer Einführung bietet der Band:
Religionsphilosophie. Eine Einführung mit ausgewählten Texten.
Hrsg. von Horst Georg Pöhlmann und Werner Brändle. Gütersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1982. Diese Textsammlung
beginnt mit Immanuel Kant (1724-1804).
13
(5) Eine weitere Textsammlung mit 36 Texten enthält das
Taschenbuch:
Glaube
und
Vernunft.
Texte
zur
Religionsphilosophie. Hrsg. v. Norbert Hoerster. München (dtv)
1979. Es beginnt mit Albertus Magnus (ca.1193-1280).
(6) W. Oelmüller, R. Dölle-Oelmüller, J. Ebach, H. Przybylski,
Diskurs: Religion. Paderborn etc. 1982 . (Uni-TB). Enthält
Materialien
sowohl
über
Begründungsund
Rechtfertigungsmöglichkeiten, als auch über Transformationen
und Bestreitungen von Religion; mit einer großen Bandbreite
von
Texten,
von
der
altorientalischen
Zeit
bis
zu
gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen Bemühungen um eine
Funktionsbestimmung religiöser Symbolsysteme in der modernen
Gesellschaft. Als historisch-systematische Orientierungshilfe
etwas
vereinfachend.
Das
Buch
hilft
wenig,
mit
den
präsentierten Texten etwas anzufangen.
(7) Von katholischer Seite gibt es zu einem wichtigen
Teilbereich der Religionsphilosophie eine Einführung: Otto
Muck, Philosophische Gotteslehre. Ein Grundriß, der einen
problemgeschichtlichen Überblick gibt, insbesondere Kants
Kritik an der Rede von Gott würdigt. Er arbeitet Struktur,
geschichtliche Bedingtheit und Fortwirken der klassischen
"Gottesbeweise" heraus und reflektiert die Möglichkeit und
Eigenart
der
denkerischen
Auseinandersetzung
mit
der
Gottesfrage. Ältere katholische Arbeiten, z.B. von Przywara,
K.Rahner, B.Welte, sind hier mitberücksichtigt, bleiben aber
für sich wichtig.
(8) Vom evangelischen Theologen Paul Tillich existiert eine
ältere Darstellung der Religionsphilosophie. Es ist eines der
wichtigsten Werke Tillichs. Erstmals 1925, Berlin (Ullstein).
Als Urban-TB Stuttgart (Kohlhammer) 1962. Es behandelt:
Gegenstand und Methode der Religionsphilosophie, das Wesen der
Religion, Wesenselemente der Religion und ihrer Relationen,
die Kategorien der Religion.
(9) Wilhelm Dupré, Einführung in die Religionsphilosophie,
Stuttgart etc. (Kohlhammer) 1985. Ist als Einführung nicht
ganz leicht zu lesen und will eigenständig "Grundzüge einer
Theorie des Religiösen und der Religion" vorlegen.
(10) Ulrich Mann, Einführung in die Religionsphilosophie.
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1988. Entwirft
ebenfalls ein eigenes religionsphilosophisches Modell, in dem
alle
Einzelfragen
in
einem
spezifischen
systematischen
Zusammenhang geordnet sind.
(11)
Aus
jüngster
Zeit
Religionsphilosophie, Stuttgart
stammt:
Friedo
2003. Ricken geht
Ricken,
von der
14
These aus, Religionsphilosophie könne nicht von einem
abstrakten Standpunkt aus, sondern nur als Reflexion auf eine
gelebte Religion betrieben werden. Das Buch entfaltet daher
Sachfragen der Religionsphilosophie anhand von Autoren, die in
verschiedenen Traditionen des Christentums stehen. Gemeinsam
ist die Abwehr eines rationalistischen Verständnisses von
Religion. Von der Gegenwart her soll ein Verständnis der
Tradition erschlossen werden: Der Weg führt von Wittgenstein
zurück zu Augustinus.
(12) Lesenswerte Einführungen finden sich zum Stichwort
"Religionsphilosophie" auch in Nachschlagewerken wie: Religion
in Geschichte und Gegenwart / RGG (=evangelisch), Lexikon für
Theologie und Kirche / LThK (=katholisch).
So
viel
zur
Annäherung
an
unser
Thema
über
Einführungsliteratur.
Wir
versuchen
hier
systematisch,
Klarheit darüber zu schaffen, worüber wir eigentlich reden.
Darum müssen wir vorrangig die Frage stellen: Was ist
"Religion"?
1.2 Begriff der Religion
Wie – mit welcher Methode – kommen wir zu einem Begriff der
Religion? Eine Methode ist ein planmäßiges Vorgehen. Dabei
lacht uns Bert Brecht aus, bei dem es in einem Song etwa
heißt: "Ja, mach nur einen Plan... und dann noch einen Plan;
gehn tun sie beide nicht". Ich kann Ihnen nur Methoden nennen,
die nicht "gehen".
Die Schwierigkeit bei der Findung des Begriffs von Religion
besteht in folgendem: Will man einen Begriff, der alle
konkreten Religionen einschließt, gewinnen, so muß sein
Inhalt, d.h. die Anzahl seiner Wesensmerkmale, um so kleiner
sein. Suchen wir nach dem Wesensbegriff der Religion, so
müssen wir von allen nichtwesentlichen Merkmalen absehen; wenn
wir dagegen auf die konkreten Religionen hinsehen, erkennen
wir, daß es keinen gemeinsamen Nenner gibt.
Sogar eine so allgemeine Formel wie die: "Religion ist Glaube
an transzendente Mächte", ev. mit der Ergänzung, daß es sich
darum handelt, sich von ihnen abhängig zu fühlen, sie für sich
zu gewinnen oder sich zu ihnen zu erheben, bringt uns in
Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Formel auf die
Buddhisten und Taoisten, weil diese entweder überhaupt keinen
Gott oder nur eine Vorstellung höherer Mächte, die mit dem
Weltprozeß nichts zu tun haben, besitzen. Und das ganz
abgesehen davon, daß uns die Einzelzüge der prähistorischen
Religionen und der stammesmäßig weit zersplitterten PrimitivReligionen
unbekannt
sind.
Die
Vorstellung
eines
Urmonotheismus ist methodologisch in keiner Weise gesichert,
weil es nicht angeht, die theologischen Begriffe voll
15
ausgereifter Hoch-Religionen auf die untheologischen Mythen
der Naturvölker zu übertragen.
Es gibt die verschiedensten Methoden (in formaler Hinsicht),
wie man bisher einen Begriff der Religion zu gewinnen
versuchte. 16
1. Die Abstraktionsmethode: man versucht, unter Absehen von
allen Besonderheiten in den einzelnen Religionen das Wesen der
Religion zu erheben. Das Ergebnis sind derart abstrakte
Allgemeinheiten, daß diese praktisch für das Verstehen
konkreter religiöser Haltungen ohne Wert sind.
2. Die Additionsmethode: Man zählt die positiven Merkmale in
allen Religionen zusammen, weil man das Wesen der Religion als
ein umfassendes und konkretes erfassen will und in der Annahme
einer Vervollkommnung in der historischen Entwicklung. Dabei
ist übersehen, daß der Begriff nicht die Summe aller - auch
der zufälligen Merkmale sein kann. Gerade bei der Bestimmung
des Wesens des Christentums wurde diese Methode angewendet.
Sozusagen: Christentum ist die Summe aller Dogmen. Das wäre
aber nur bei einem statischen Religionsbegriff möglich.
3. Die Subtraktionsmethode: Der Rationalismus scheidet die
historisch feststellbaren Religionen aus seiner Betrachtung
aus, um das echte "Wesen" in den Religionen zu ergründen.
Mit dieser Methode kann man aber nicht einsichtig machen, wie
Religion geschichtlich und also den Menschen angehend ist.
4.
Die
Identitätsmethode:
Sie
wird
von
der
traditionalistischen Orthodoxie und von bestimmten Sekten
angewandt. Hier wird behauptet, das Wesen der Religion sei ein
für allemal gegeben und lasse deshalb keine Variabilität
seiner
geographischen
oder
zeitbedingten
Ausdrucksmöglichkeiten zu. Das "Ecclesia semper reformanda",
die Perfektibilität wird geleugnet.
Diese Identitätsmethode war wohl für Erzbischof Lefebvre
maßgeblich, wie sich z.B. aus folgender Äußerung in einem
Interview von 1983 schließen läßt: "Ich mache nichts anderes,
als das fortzusetzen, was man mich gelehrt hat, das, was das
Credo von immer, was der Katechismus von immer lehren... Sind
denn die Katechismen von immer, der Katechismus des Konzils
von Trient, der Katechismus des hl. Pius X., der Katechismus
des Kardinals Gasparri, alle diese Katechismen nichts mehr
wert...?" 17
zusammengestellt
Taschenlexik.
16
17
von
Norbert
Schiffers
in:
Herders
theolog.
Pressekonferenz von Erzbischof Marcel Lefebvre zum "Offenen Brief an den
16
5. Die Isolationsmethode: Man isoliert einen bestimmten Zug an
der Religion, etwa das Gefühl oder das Heilige oder das
religiöse Erleben, erklärt diesen Zug zum Motiv der Religion
und identifiziert das Motiv mit dem Wesen der Religion.
Hierher gehört Schleiermachers Gefühl der schlechthinigen
Abhängigkeit; ähnlich bei Wobbermin - Religion als glaubendes
Ahnen einer Überwelt,von der der Mensch sich abhängig weiß;
auch Rudolf Otto, Das Heilige. (Vgl. dazu Emanuel Lévinas,
Autrement qu’etre ou au-delà de l’essence, Den Haag 1974 /
dt.Übers. : Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht,
Freiburg/München 1992; Peter L. Berger, The Sacred Canopy.)
6.
Die
Evolutionsoder
genetische
Methode,
die
mit
unterschiedlicher Zielsetzung von C.G. Jung, L. Feuerbach und
S. Freud auf das Phänomen Religion angewandt wurde. Sie nimmt
an, in einem Knotenpunkt der individuellen oder soziologischen
Entwicklung würden nichtreligiöse Phänomene plötzlich zur
Religion, wenn der Mensch seine Abhängigkeit, Furcht oder
Armut nicht mehr ertragen könne und sein Elend überbaue mit
der Projektion einer göttlichen Macht, der er für die Zeit
nach dem elenden Leben des Menschen die Macht verleihe, für
das Ertragen von Elend in der Zeit dieser Welt zu belohnen.
Feuerbach sagt in diesem Sinn, "Der arme Mann hat einen
reichen Gott." Schon in der Antike (bei Cicero werden wir
darauf stoßen) war gesagt worden: Timor fecit deos.
Dogmatische Behauptungen sind aber kein Beweis dafür, wie
Hoffnung und Furcht zur Religion werden können. Man kann den
Begriff des Wesens auch nicht von einer primitiven Stufe her
gewinnen, weil zum Begriff des Wesens die Gültigkeit für alle
Stufen
gehört.(Vgl.
auch
die
ethnologische
und
kulturanthropologische Opfertheorie („Sündenbocktheorie“) von
René Girard.)
7. Die Interpretationsmethode: Sie behauptet, Religion komme
erst in der philosophischen Erkenntnis zu ihrem wahren Wesen.
Schon S. Kierkegaard (1813-1855) hat gegen diese Hermeneutik
polemisiert, weil mit ihr die Religion "zum Asyl für blöde
Köpfe" werde. Sie will nachweisen, daß die Religion in ihrem
eigentlichen Wesen etwas anderes ist, als sie erscheint. Das
klassische Beispiel ist G.W.F. Hegel (1770-1831), aber wieder bereits in der Antike - auch die Gnosis, die behaupten,
Religion käme erst in der philosophischen Erkenntnis zu ihrem
wahren Wesen, das in der Religion nur eine Art In-Bausch-undBogen-Wissen des Glaubens sei. Religion ist, so wird man
Papst" vom 21. November 1983. In: M.Lefebvre, Papst und Ordo Missae.
Hrsg.
von der Priesterbruderschaft St.Pius X. Wien 1984, S.16f.
17
dagegen einwenden müssen, eine Sphäre für sich, die nicht
uminterpretiert werden kann in etwas anderes.
8.
Die
Funktionsmethode:
Sie
sieht
in
den
konkreten
Darstellungen von Religion funktionale Faktoren am Werk, die
sich von Epoche zu Epoche ändern. Sie faßt also den Begriff
der Religion dynamisch. Das Problem dabei ist, daß sie auch
unbekannte Faktoren einschließt. Wir kommen damit nicht zu
einer vollkommenen Wesensbestimmung. Der Religionssoziologe
Niklas Luhmann stand diesbezüglich mit seiner funktionalen
Systemtheorie in reger Diskussion mit Theologen. 18
Die Übersicht läßt uns vermuten, daß es nicht genügt, nur
formallogische und objektive Kriterien des Begriffs Religion
zu erstellen. Das heißt aber nicht, daß wir sie alle über Bord
werfen sollten und mit Gabriel Marcel meinen könnten, daß wir
zu
sinnvollen
Aussagen
nur
kommen,
wenn
wir
religionsphilosophisch
von
der
"Religion
des
eigenen
Engagements" ausgehen. Nach einer solchen Meinung kann man nur
wissen, was Religion ist, wenn man sich selbst für eine
Religion entschieden hat und sich über die daraus folgenden
Daseinsentscheidungen klar wird und dadurch existentielle
Wesensbestimmungen gewinnt.
Auch K. Jaspers (1883-1969) sagt, daß der Wesensbegriff der
Religion unbedingte Wahrheit ist, die nur durch existentielle
Entscheidung und Wagnis des Lebens bezeugt, aber nicht wie die
allgemeingültigen
Wahrheiten
der
Mathematik
und
Naturwissenschaften bewiesen werden kann, denn dadurch wäre
sie bedingt. Wir können, so wird uns nach dieser Meinung
gesagt,
die
geschichtlichen
Tatbestände,
nämlich
die
Ausdrucksformen religiösen Lebens in der Geschichte, nicht
anders als nach Maßgabe unserer eigenen religiösen Erfahrung,
also unseres eigenen religiösen Bewußtseins verstehen.
Aber was macht nun einer, mit dessen eigenem religiösem
Engagement es nicht sehr weit her ist? Ist der von vornherein
ausgeschlossen?
Vielleicht interessiert es ihn doch soweit, daß er einen
Ansatz finden will, welcher nicht das "credo ut intelligam"
oder "credo quia absurdum" gar zwingend vorschreibt. Eine
theologische Wesensbestimmung der Religion soll möglich sein;
sie schließt aber nicht aus, eine vor- und außertheologische
Bestimmung zu geben.
Daß man a priori voraussetzen muß, was man sucht und a
posteriori findet, das ist im Fall der Religion nicht anders
Niklas Luhmann, Funktion der Religion, 1977. Siehe auch Michael Welker
(Hrsg.), Theologie und funktionale Systemtheorie, Frankfurt 1985.
18
18
als bei anderen Phänomenen: Sie setzen - vorläufig, im
Vorgriff - voraus, was sie -genau und artikuliert - im Begriff
erkennen möchten. Es ist ein Weg vom Vorläufigen zum
Differenzierten.
Daß nur unter der Voraussetzung von Antizipationen Verständnis
zuwege kommt, hat man immer schon gesehen. Es war Martin
Heidegger (1889-1976), der in seiner Analyse des Daseins das
Verstehen als Entwerfen von Seinsmöglichkeiten auffaßte, das
zu seiner Aktualisierung der "Vorhabe", der "Vorsicht" und des
"Vorgriffs" bedarf. Das sind nach ihm die notwendigen Momente
einer Fundamentallehre des Verstehens, oder, was dasselbe
bedeutet, einer Analytik des Daseins. Vor ihm war die Einsicht
in die Vorstruktur des Verstehens auf die historischphilologischen Einzelwissenschaften beschränkt; und zudem war
sie verbunden mit dem Bewußtsein, im Vergleich zu "exakten"
Disziplinen mit einem Makel behaftet zu sein, dem der
unüberspringbaren
Standpunktgebundenheit.
Die
Antizipationsverwiesenheit
allen
geisteswissenschaftlichen
Auslegens führte Heidegger nun zurück auf das dem Dasein
eigene Um-seiner-selbst-Willen, auf die Dasein ermöglichende
Vorwegnahme von Sinn. Die "ontologische Zirkelstruktur", die
dem Dasein zugehört, ist der Grund für den der Auslegung
anhaftenden Zirkel. Das "Nachverstehen" ist nur als Funktion
des Selbstverstehens zu begreifen.
Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Annäherung an das
Verständnis von Religion im Wege der Etymologie. Das
lateinische Wort r e l i g i o wird schon von den antiken
Autoren verschieden gedeutet, abgeleitet. Von Cicero (De
natura deorum 2,28,72) von
r e l e g e r e ,
"(Wieder)zusammennehmen (was sich auf die Verehrung der Götter
bezieht)" / "darauf besonders achten"; und von einem beim
Gammatiker Gellius (4,9,1) zitierten Etymologen von der
Nebenform r e (e) l i g e r e , "rücksichtlich beachten" /
"wiedererwählen"; dagegen von Servius (ad Verg.Aen.8,349),
Lactantius (Inst.4,28) und Augustinus (Retract.1,13) von
r e l i g a r i "sich binden, an etwas befestigen".
Moderne Etymologen neigen der letzteren Ableitung zu (Wurzel
lig-"binden"); religio bedeutet dann ursprünglich dasselbe wie
obligatio, nämlich Verbindlichmachung, Verpflichtung. Daneben
wird aber auch die Ableitung von leg- "sich kümmern um"
vertreten; dann wäre religio etwas Ähnliches wie diligentia,
"Achtsamkeit".
Thomas von Aquin (1225-1274) hat den etymologischen Befund vor
Augen und hat einen konvergierenden Sinn gefunden: religio
importat ordinem ad deum (Summa theol. II,II,81,1).
Eine Konvergenz der verschiedenen Erklärungen brauchen wir gar
nicht zu leugnen; das Problem ist eher darin gelegen, daß sie
19
nur in der lateinischen Sprache von deren Wort religio her
möglich ist, während im Griechischen und etwa im Hebräischen
das Phänomen Religion eine ganz andere sprachliche Gestalt
angenommen hat.(Paradoxerweise führt die "Encyclopedia of the
Jewish Religion" trotz ihres Titels nicht einmal das Stichwort
Religion.)
Wir
geraten
hier
wieder
an
die
Schwierigkeit
der
religionsvergleichenden
Methode.
Wenn
sie
nicht
in
Relativismus
verfallen
will,
bedarf
sie
einer
allgemeingültigen Definition von Religion, die sich bei allen
Vergleichen von Religionen durchhalten läßt. Würde man diese
Begrifflichkeit auch noch so einfach halten, und etwa
definieren, Religion sei der Glaube an transzendente Mächte,
so wäre noch dieser Allgemeinplatz religionsvergleichend zum
Scheitern verurteilt.(Der Titel des Werks von William James:
„The Varieties of Religious Experience“ nimmt auf diesen
Sachverhalt Rücksicht.)
Es ist eben das Grundproblem der Religionsphilosophie: Als
Philosophie versucht sie, Phänomene zu begreifen, sei es im
affirmativen Sinn des hermeneutischen Einordnens in die
Gesamtkonzeption des bisher Erfahrenen, sei es im negativkritischen Sinn.
Als Disziplin, die sich mit Religion befaßt, enthält sie aber
zugleich
das
Eingeständnis,
einem
Phänomenkomplex
gegenüberzustehen, der in seinem Kontingenzbezug nicht voll
begriffen werden kann.
Nach Wolfgang Trillhaas hat die Religionsphilosophie "nur eine
Verstehenslehre der Religion zu leisten, d.h. die Religion als
eine geistige Ausdrucksform für eine Erlebnisweise sui generis
zu begreifen. Aber das Eigentliche der Religion steht immer
außerhalb
der Religionsphilosophie; das Eigentliche, die
Religion
selbst,
beginnt
erst
dort,
wo
die
19
Religionsphilosophie endet."
Dem würde ich nur mit dem Zusatz zustimmen, daß die Grenze
nicht starr gedacht werden darf.20
Religion ist engstens mit dem Wesen des Menschen verknüpft;
man könnte vielleicht ebenso gut sagen: Der Mensch ist ein
animal religiosum, wie: er ist ein animal politicum. Und wer
weiß, was aus uns Menschen noch wird?
1.3 Zur Geschichte der Religionsphilosophie
1.3.1
Religionsphilosophie
der
griechischen
und
jüdischen
Vgl. Kurt Wuchterl, Philosophie und Religion. Zur Aktualität der
Religionsphilosophie. Stuttgart 1982, 113
20 Vgl.Rudolf Kassner, Grabspruch: "Vielleicht war es früher so, daß ein
Mensch bis zur Grenze ging, und dort starb er dann und das ewige Leben
begann. Seit Jesu Christo aber wandert die Grenze mit, und so weiß niemand
im Grunde, wann und wo das ewige Leben beginnt."
19
20
Aufklärung am Beginn der europäischen Geschichte
Zur Religionsphilosophie gehört von Anfang an das Projekt
Aufklärung, der Versuch von Menschen, die Projektionen eigener
Wünsche, Hoffnungen, Ängste zu durchschauen, sich von
selbstgemachten Göttern und übermenschlichen Mächten und
Geistern zu befreien und neues religiöses oder nichtreligiöses
Orientierungswissen für das eigene Leben sowie für das soziale
und politische Zusammenleben zu entwickeln. Wissenschafter,
Philosophen und auch einige Theologen sprechen heute zu Recht
in positivem Sinn von griechischer und jüdischer Aufklärung am
Beginn der europäischen Geschichte nach der sogenannten
Achsenzeit um 500 v.Chr.
Es zeigt sich von Anfang an, daß Religionsphilosophie und
Religionskritik zusammengehören. Dementsprechend kann man
Linien ziehen von Xenophanes zu Feuerbach, von Kritias zu
Holbach, Voltaire, etc.
Die griechische Aufklärung beginnt mit der kritischen
Auseinandersetzung mit dem Mythos.
Xenophanes
aus Kolophon (ca. 570-475/70 v.Chr.) vergleicht
die
Vielheit
und
die
Unterschiede
menschlicher
Göttervorstellungen und versucht sie so zu erklären:
* Die „Sterblichen“ können grundsätzlich nur ihrer Art gemäße
Mutmaßungen („sie wähnen“) über die Welt der übermenschlichen
Götter und Mächte besitzen: „Doch wähnen die Sterblichen, die
Götter würden geboren und hätten Gewand und Stimme und Gestalt
wie sie.“ „Doch wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände
hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden
wie die Menschen, so würden die Rosse roßähnliche, die Ochsen
ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden,
wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte.“ (Fragment 14 und
15)
* Wenn Menschen kritisch und selbstkritisch unglaubwürdige
Göttervorstellungen „enthüllen“ und durchschauen, finden sie
allmählich „suchend das Bessere“: „Wahrlich nicht von Anfang
an haben die Götter den Sterblichen alles enthüllt, sondern
allmählich finden sie suchend das Bessere.“ (Fragment 18)
Aufklärung und Ent-Täuschung, Freiwerden von falschen und
unwürdigen Vorstellungen der Mythen und Götter führten für
Xenophanes nicht zum Atheismus, zur Verneinung Gottes und zum
Abschied von Gott, sondern zum Fragen und Suchen in Richtung
Monotheismus. Die Welt ist für ihn noch nicht wie für viele
moderne Menschen total entmythologisiert, entzaubert, zu ihr
gehören noch Götter. Das Nachdenken über letzte religiöse
Fragen führt ihn zu Mutmaßungen über den „einzigen Gott“: „Ein
einziger Gott, unter Göttern und Menschen am größten, weder an
Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken.“ (Fragment
23)
21
Ein anderer früher Weisheitslehrer (Sophist), Protagoras von
Abdera ((ca. 481-411 v.Chr.) stellt fest: „Über die Götter
allerdings
habe
ich
keine
Möglichkeit
zu
wissen
(festzustellen?), weder daß sie sind noch daß sie nicht sind,
noch, wie sie etwa an Gestalt sind; denn vieles gibt es, was
das Wissen hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit und daß das Leben
des Menschen kurz ist.“ (Fragment 4) Auch eine an und für sich
bestehende letzte Wirklichkeit, der Logos (Vernunft) sowie das
Sein, die orientieren könnten, ist für Protagoras nicht
erkennbar.
Die Konsequenz formuliert der berühmte Satz des Protagoras:
„Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, daß sie sind,
der nicht seienden, daß sie nicht sind. – Sein ist gleich
jemandem Erscheinen.“ (Fragment 1)
Man kann diesen Satz sehr verschieden lesen, und man hat ihn
verschieden gelesen:
* Man kann ihn lesen als Einsicht in das begrenzte Wesen des
Menschen und als Anerkennung dieser Grenzen: Sinnliche
Wahrnehmungen von Menschen unterscheiden sich von denen der
Tiere. Wenn Menschen die Welt und die Dinge, den Mitmenschen
und Gott erkennen, über sie sprechen und sie darstellen,
besitzen sie nur menschliche Erkenntnisse, Aussagen und
Darstellungen, keine Erkenntnisse, die uns zeigen, wie das
Erkannte selbst wirklich, an sich und für sich ist. Selbst
wenn Götter oder Gott uns Menschen etwas offenbaren wollen,
müssen sie das Maß, die Erkenntnisgrenzen endlicher Menschen
respektieren.
* Man kann den Satz des Protagoras aber auch so lesen: Ein
gemeinsames den Menschen und menschlichen Gemeinschaften
vorgegebenes Maß des Denkens und Handelns gibt es nicht, ist
jedenfalls
nicht
zu
erkennen.
Menschen
besitzen
nur
verschiedene und entgegengesetzte subjektive Meinungen und
Ansichten. Daher kann sich im Leben und Zusammenleben nur der
Stärkere und rhetorisch Geschicktere bewähren und durchsetzen.
Es ist konsequent, daß all die Theologen und Philosophen, die
davon ausgehen, daß Gott das Maß aller Dinge ist und nicht der
Mensch oder daß die menschliche Vernunft die den Menschen
vorgegebene gemeinsame wahre Instanz und Norm des Guten
erkennen kann, den Satz des Protagoras in dieser Lesart als
Plädoyer für einen Relativismus der Meinungen und Ansichten
sowie für Beliebigkeit und Subjektivismus kritisieren.
Von Sokrates (469-399 v.Chr.)wissen wir durch Platon einiges
über das Ziel seines Philosophierens mit seinen Mitbürgern,
und warum er zum Tod verurteilt worden ist.
Sein Ziel war, das Scheinwissen seiner Mitbürger durch Fragen
und „sokratische Ironie“ zu entlarven und die Zeitgenossen mit
ungelösten letzten sittlichen, rechtlichen, politischen und
religiösen Fragen zu konfrontieren, auf die ihnen weder die
22
von den Dichtern geschaffenen Götter und Mythen noch die von
Sophisten
gelehrten
Nutzen
und
Vorteil
kalkulierenden
Lebenspraktiken eine überzeugende Antwort geben konnten.
„Ich scheine doch wenigstens um ein Kleines weiser zu sein
[...], weil ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen
glaube.“ „Wirklich weise [...] mag der Gott sein und er mag in
seinem Orakel dies meinen: die menschliche Weisheit ist wenig
wert oder nichts.“ (Platon, Apologie 21D, 23A.)
Diese Erkenntnis bedeutet für Sokrates kein Denk- und
Sprechverbot über letzte Fragen, z.B. über das, was Menschen
nach ihrem Tod erwartet, und hierüber diskutierte er mit
seinen Mitmenschen. Es war für Sokrates ein „schönes Wagnis“
(Platon, Phaidon 114D), glaubwürdige Aussagen zu suchen.
An Sokrates wird auch deutlich, daß kritische Fragen an die
anerkannten Göttervorstellungen und Religionen nicht nur etwas
Privates sind, das sich nur in der Innerlichkeit des Herzens
und innerhalb der eigenen vier Wände ereignet. Wer bis heute
die herrschenden Götter bzw. die Herrschenden, die sich gern
als Götter verehren lassen, kritisiert, riskiert oft sein
Leben. Sokrates wurde 399 in Athen von einem Gericht durch das
Urteil der 501 ausgelosten Richter zum Tod verurteilt. Die
Anklage lautete: „Sokrates tut Unrecht; denn er verdirbt die
Jugend und glaubt nicht an die Götter, welche die Stadt
verehrt, sondern an neue, dämonische Wesen.“ (Platon, Apologie
24B).
Rückblickend war es ein Fehlurteil, aber bis heute ist es ein
Grundproblem, wie Konflikte zwischen Staat und Religion
gewaltlos gelöst werden können.
Zwei verschiedene Reaktionen auf das Ende des Mythos und die
Krise der Demokratie sehen wir an Kritias (ca. 460-403) und
Platon (427-347).
Den beiden ist nicht nur der Lehrer Sokrates gemeinsam,
sondern auch die Erfahrungen ihrer Zeit: Die traditionellen
olympischen Götter können nicht mehr das Denken über
Menschliches und Übermenschliches orientieren sowie sittliche
und
rechtliche
Normen
und
soziale
Lebensformen
und
Institutionen legitimieren.
Aber auch die Demokratie war jetzt aus vielen Gründen in die
Krise geraten. Der Peloponnesische Krieg und die Oligarchie
der „Dreißig Tyrannen“ machten das deutlich. Für Platon wurde
vor allem auch durch das Todesurteil gegen Sokrates die
Schwäche der Demokratie deutlich.
Kritias und Platon suchten eine Alternative zu Mythos und
Demokratie.
Kritias vertrat folgende These: Am Anfang „war der Menschen
Leben ungeordnet und tierhaft und der Stärke untertan“. Um das
ungeordnete und gefährliche Leben sicher zu machen, haben die
Menschen Gesetze erfunden und durchgesetzt, damit „das Recht
Herrscherin sei“. Da Gesetze jedoch nur wirksam waren, indem
23
sie die Menschen „hinderten, offene Gewalttaten zu begehen“,
„hat (zuerst) ein schlauer und gedankenkluger Mann die
[Götter]furcht
den
Sterblichen
erfunden,
auf
daß
ein
Schreckmittel da sei für die Schlechten, auch wenn sie im
Verborgenen etwas täten oder sprächen oder dächten.“ (Fragment
25).
Götter und Götterfurcht sind also Erfindungen von Menschen.
Beides ist in der Politik ein Mittel zur Disziplinierung der
„Schlechten“.
Religion ist nicht eine Form der Anerkennung und Verehrung
übermenschlicher Götter bzw. eines einzigen Gottes, sondern
ein erfolgreicher Betrug an den dummen Menschen zur Sicherung
und Erhaltung von Rechts- und Machtverhältnissen. Das Argument
des Priesterbetrugs in der radikalen Religionskritik der
modernen Aufklärung unterstellt der Religion die gleiche
Funktion.
Wenn man Platons Werke und Argumente als Antwort auf seine
Gegenwartsprobleme liest und nicht bzw. nicht nur als
Entwicklungsstufen einer sogenannten philosophischen Position,
so
kann
man
seine
religionsphilosophischen
Thesen
so
zusammenfassen:
* Platon kritisiert die Götter der Mythen (frühe Dialoge, z.B.
Ion)
* Platon entwickelt die Utopie eines von Philosophenkönigen
beherrschten und durch die richtige Götterlehre stabilisierten
Idealstaates als Alternative zur Demokratie.(Politeia)
* Platon sucht nach der Erkenntnis der letzten Wirklichkeit,
die den Denkrahmen der Politik übersteigt. Er sucht:
(1) das Reich der Ideen, des Seins, des Wesens,
(2) das, was jenseits des Seins und des Wesens ist.
Ad (1): Die Suche nach dem Reich der Ideen, des Seins, des
Wesens.
Vor und nach dem Leben des Menschen und unabhängig von
Menschen
gab
und
gibt
es
die
übermenschliche
letzte
Wirklichkeit des Unwandelbaren und Immerseienden. Platon
benennt diese letzte Wirklichkeit mit verschiedenen Begriffen
(und Übersetzungen verwenden für die einzelnen Begriffe noch
einmal verschiedene Worte): das Reich der Ideen, z.B. der
Ideen des Wahren, Guten Schönen, Einen, das Reich des Seins
oder des Wesens. Ideen sind für Platon keine subjektiven und
wandelbaren Ideen oder gar „Ideen“, d.h. Einfälle im Kopf
eines einzelnen Menschen, sondern objektive, allen Menschen
vorgegebene und ihnen gemeinsame Ordnungen des Seins, an denen
sich Menschen in ihrem Denken und Handeln orientieren können
und sollen. Die Vernunft, die nicht als eine subjektivprivate, sondern als eine allen Menschen gemeinsame Vernunft
gedacht ist, kann nach Platon diese immerseienden Ideen und
ihr Wesen erkennen, weil die Seele diese vor ihrer Verbindung
24
mit dem sterblichen Leib des einzelnen Menschen, d.h. vor der
Menschwerdung, im Reich der Ideen geschaut hat. Erkenntnis
ist, platonisch gedacht, Anamnesis, Wiedererinnerung an früher
Geschautes. Die europäische Metaphysik unterstellt – später
ohne die Wiedererinnerungslehre -, daß die menschliche
Vernunft ein Wissen davon besitzt, was – modern gesprochen –
jenseits des empirisch Beobachtbaren und jenseits des
wissenschaftlich Erklärbaren liegt, d.h. in der „Über-„ oder
„Hinter-Welt“.
Ad (2): Die Suche nach dem, was jenseits des Seins und des
Wesens ist.
Auch Platon weiß wie seine Vorgänger Xenophanes, Protagoras
und Sokrates beim Nachdenken über die letzte Wirklichkeit, die
auch er nicht selten wie andere Gott nennt, um die Grenzen der
menschlichen Erkenntnis und des menschlichen Spechens. Auch
für ihn sind Verneinungen daher ein Weg zur Erkenntnis der
letzten Wirklichkeit. Platon spricht von „jenseits des Seins“,
„jenseits des Einen“. In der Politeia schreibt er z.B.:
„So gib auch zu, daß das Erkannte vom Guten nicht nur das
Erkanntwerden bekommt, sondern daß es ihm auch sein Dasein und
sein Wesen verdankt. Und doch ist das Gute nicht Wesen,
sondern es steht noch jenseits des Wesens und übertrifft es an
Würde und Macht.“ (Plato, Politeia 509A-B).
Im Dialog Parmenides heißt es: “Auf keine Weise also ist das
Eins. – Offenbar nicht. – Nicht einmal dergestalt ist es also,
daß es Eins ist; sonst wäre es nämlich schon seiend und würde
am Sein teilhaben; aber, wie es scheint, ist das Eins weder
Eins noch ist es, wenn man unserer Beweisführung Glauben
schenken soll. – Ja, es wird wohl so sein. – Was aber nicht
ist, könnte da diesem Nichtseienden irgend etwas zugehören
oder etwas von ihm stammen? – Wie wäre das möglich? – So
gehört ihm also weder ein Name noch eine Aussage, und es gibt
von ihm auch kein Wissen und keine Wahrnehmung und keine
Meinung. – Offenbar nicht. – Somit läßt es sich weder benennen
noch läßt sich von ihm eine Aussage machen noch läßt sich eine
Meinung darüber bilden oder eine Erkenntnis davon gewinnen
noch irgend etwas wahrnehmen, was zu ihm gehört. – Es scheint
nicht.“ (Plato, Parmenides 141E-142A).
Neuplatoniker und die patristische Theologie haben in den
ersten Jahrhunderten n.Chr. Platons Denk- und Sprechversuche
über
Gott
weiter
entwickelt,
die
durch
Verneinungen
menschlich-allzu menschlicher Gedanken einen Weg zu Gott
suchen.
Dionysios Areopagita hat im 5./6.Jh. den Begriff „negative
Theologie“ gebildet, der bis heute zu sagen versucht, wie man
nicht bzw. wie man über den einen Gott sprechen kann.
Über Gott und das Eine, den letzten Grund aller Dinge,
schreibt er durch Verneinungen: „Und so ist undenkbar für
25
alles Denken das über dem Denken stehende Eine, und ist
unaussprechlich für jederlei Wort das über alle Worte erhabene
Gute, [...], der unaussprechbare Geist, das unaussprechbare
Wort, das Unsagbare, Undenkbare, Unnennbare, das nicht so ist
wie irgendein Wesen, und doch allen Wesen Grund ihrer
Wesenheit ist, selbst nichts seiend, weil es jenseits alles
Seienden ist, wie es selbst sich wohl am zutreffendsten und am
verständlichsten bezeichnen würde.“21
Eine Konsequenz aus diesen Überlegungen zu Sprechversuchen
über Gott lautet für Dionysios Areopagita: „So kommt der über
allem Seienden Ursache von allem sowohl die Namenlosigkeit zu
als auch alle Namen.“ (ebd. 7)
Zur späteren Geschichte der negativen Theologie gehören z.B.
auch folgende Aussagen von Thomas von Aquin (1225-1274): „Die
göttliche Wesenheit übersteigt kraft ihrer Unermeßlichkeit
jegliche Form, an die unser erkennender Geist heranreicht. Und
so vermögen wir sie nicht zu erfassen, erkennend, was sie sei;
wir haben vielmehr nur eine gewisse Kunde von ihr, erkennend,
was sie sei.“ „Einzig dann erkennen wir Gott in Wahrheit, wenn
wir glauben, daß er über alles hinausliegt, was Menschen über
Gott zu denken vermögen.“ (Thomas v. Aquino, Summe gegen die
Heiden I, 14; I,5.)
„Denn mehr wird für uns offenbar von ihm, was er nicht ist,
denn was er ist.“ (Thomas v. A., Summa theologica, I, 1 9 ad
3.)
Weniger geläufig als die Existenz einer frühen griechischen
Aufklärung dürfte die jüdische Aufklärung sein.
Auch sie
sucht wie die griechische nach ihrer Kritik unglaubwürdig
gewordeneer mythischer Vorstellungen von übermenschlichen
guten und bösen Mächten und Geistern in ihrer Welt und Umwelt
im Vorderen Orient nach Möglichkeiten, wie Menschen über den
einen nicht von Menschen gemachten Gott sprechen bzw. nicht
sprechen können und dürfen.
Beispiele dafür sind:
* In dem Schöpfungsbericht der Priesterschrift (1 Mose 1,12,4) über die Erschaffung der Welt und des Menschen durch den
weltunabhängigen Gott sind Sonne und Mond nicht mehr wie für
die Umwelt Israels mächtige Gestirnsgötter, sondern bloße
„Lichtträger“ zur Erleuchtung von Tag und Nacht, und die
mächtigen Seeungeheuer sind keine dämonischen Chaosmächte,
Feinde Gottes, sondern seine Geschöpfe.
* das Jesajabuch (44,9-20) entlarvt den Selbstbetrug der
Menschen ohne „Einsicht und Verstand“, die vor selbstgemachten
Göttern
niederfallen
und
ihren
Selbstbetrug
nicht
durchschauen. Sie handeln wie der Holzschnitzer, der den einen
Teil seines Holzes für seinen Unterhalt zum Backen von Brot
Dionysios Areopagita, Von den Namen Gottes 1, in: Von den Namen zum
Unnennbaren, Auswahl und Einleitung von Endre von Ivanka, Einsiedeln 1957.
21
26
und Braten von Fleisch gebraucht und der aus dem anderen Teil
sich „einen Gott [macht] und fällt vor ihm nieder, macht einen
Götzen und beugt sich vor ihm.“ „Keiner denkt darüber nach,/
keiner hat so viel Einsicht und Verstand, daß er sagt: / ‚Die
Hälfte habe ich im Feuer verbrannt / und habe auf den Kohlen
Brot gebacken, / habe Fleisch gebraten und gegessen, / und den
Rest habe ich zum Greuelbild gemacht, / vor einem Holzklotz
beuge ich mich!’ / Wer Asche weidet, / den hat sein betrogenes
Herz verleitet. / Er wird sich nicht retten / und sich nicht
sagen können: ‚Es ist doch Trug in meiner Hand!’“
(Ein Feuerbach (1804-1872) oder Freud (1856-1939) haben wie
der Jesajatext Menschen über die religiösen Projektionen und
Illusionen kritisch und selbstkritisch aufklären wollen,
freilich haben sie zugleich – bedenkt man die Erfahrungen der
Ungeheuerlichkeit des Menschen, wie sie seither offenbar
geworden ist- auch neue Illusionen gehegt und genährt über die
„Gattung Mensch“ und den „Gott Logos“.
Hier kommt es mir nur darauf an, zu zeigen, daß Kritik der
Religion sowohl von außen als auch von innen kommen kann; und
daß die Kritik von innen für sie lebenswichtig zu sein
scheint. Vielleicht auch die Kritik von außen?
„Religionskritik in der Neuzeit“ heißt übrigens eine von
Michael Weinrich hrsgg. Textsammlung, Gütersloh 1985.)
* Das Bilderverbot, das zuerst von Juden formuliert und später
auch von Christen und Muslimen anerkannt wurde, das von allen
jedoch in ihrer Geschichte oft vergessen oder verharmlost
wird, ist bis heute lebendig, auch in der Kunst, Literatur und
Philosophie.
Das Bilderverbot des Alten Testaments lautet: „Du sollst dir
kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was
oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen,
was in den Wassern unter der Erde ist; du sollst sie nicht
anbeten und ihnen nicht dienen; denn ich, der Herr, dein Gott,
bin ein eifersüchtiger Gott“ (2 Mose 20, 4-5). Und: „Ihr sollt
euch keine Götzen machen, und Gottesbilder und Malsteine sollt
ihr euch nicht aufrichten, auch keine Steine mit Bildern
hinstellen in eurem Lande, um euch davor niederzuwerfen; denn
ich bin der Herr, euer Gott“ (3 Mose 26,1). Das Bilderverbot
verbietet Juden, Christen und Muslimen , sich von dem
unbegreiflichen Gott ein Bild zu machen, Gott und seinen Namen
zu mißbrauchen, z.B. zum Zaubern und zur Rechtfertigung von
Gewalt und heiligen Kriegen, sowie andere Götter zu verehren
und sie um Hilfe und Rettung zu bitten. Bilderverbot heißt
nicht
Bildersturm
und
Bilderzerstörung,
Denkund
Sprechverbot, sondern: Wenn Menschen den nicht darstellbaren
und nicht erkennbaren Gott darstellen und über ihn sprechen,
weil sie über ihn nicht immer nur schweigen und verstummen
können,
dann
müssen
sie
dabei
zugleich
um
die
Nichtdarstellbarkeit und Namenlosigkeit dieses Gottes wissen,
27
um seine Abwesenheit in seiner Anwesenheit.
Das Bilderverbot sprengt durch Verneinungen menschliche,
geschichtliche Darstellungs- und Sprechversuche. Das zeigen
auch jüngere theologische und philosophische Diskussionen in
der Kunst und Literatur nach Auschwitz. Adornos bekanntes
Wort: „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch,
und das frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es
unmöglich
ward,
heute
Gedichte
zu
schreiben.“22
(Die
Dichtungen von Paul Celan, Rose Ausländer führen über diese
Position hinaus.)
* Die erschreckende Erfahrung von Übel, Leiden, Tod und
Untergang ist auch in der Bibel Anlaß zu religionskritischen
Rückfragen an den weltunabhängigen, mächtigen und guten
Schöpfergott.
Es
ist
die
Situation
Hiobs.
Seine
theologisierenden Freunde denken sich das Verhältnis von
Mensch und Gott entsprechend üblichen religiösen Vorstellungen
als ein Tauschgeschäft. Wenn sich der Mensch wohl verhält,
wird es ihm gut gehen, wenn er leidet, muß er vorher gesündigt
haben. Hiob kann in seinem schuldlosen Leiden so nicht
aufrichtig sprechen, wenn er sich und die anderen nicht
täuschen will („Trug für Gott“ – Hiob 13,7). Gott gibt Hiob
auf seine drängenden Fragen keine Erklärung für seine Leiden.
Er lobt Hiob jedoch, weil er auch in seinen Fragen und Klagen
über die Abwesenheit Gottes auf Gott setzt, und er tadelt wie
Hiob dessen Freunde.
Eine Überlegung, die sich aus der Kenntnis der griechischen
und jüdischen Aufklärung nahelegt, wäre die: Es gab nicht den
einlinigen, unumkehrbaren und gemeinsamen Weg vom Mythos zum
Logos.23
Schon beim Verständnis des Logos, der Vernunft, trennen sich
die Wege.
* Meint Vernunft die subjektive, verschiedene, beliebige
Vernunft des einzelnen Menschen, oder meint sie die gemeinsame
Vernunft aller Menschen?
* Ist Vernunft der Name für die göttliche Macht, die die
immerseiende Welt schön gestaltet und leitet (Kosmos) oder der
Name für einen weltunabhängigen göttlichen Schöpfer, der das
vorgegebene Chaos und Unheil in seiner Schöpfung überwinden
will?
* Denkt Aufklärung in Richtung Atheismus oder in Richtung
Monotheismus?
22
Th.W.Adorno, Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, München 1963,
26.(Theodor W. Adorno, 1903-1969, Vertreter der Kritischen Theorie der
Frankfurter Schule.)
Vgl. Wilhelm Nestle, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des
griechischen Denkens, Stuttgart 1940).
23
28
1.3.2 Statt eines vollständigen Abrisses der Geschichte der
Religionsphilosophie: eine Leseliste der Primärliteratur
Aurelius Augustinus, De vera religione (389-391)
Dionysius Areopagita, Über die göttlichen Namen (6.Jh.n.Chr.)
Anselm von Canterbury, Proslogion (1077/1078)
Thomas von Aquino, Summe der Theologie (1266-1273)
Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate (Anf. 14.Jh.)
Nikolaus von Kues, Über die belehrte Unwissenheit (1440)
Blaise Pascal, Gedanken über die Religion und einige andere
Gegenstände (1669)
Baruch de Spinoza, Theologisch-politischer Traktat (1670)
John Locke, Die Vernünftigkeit des biblischen Christentums
(1695)
Gottfried Wilhelm Leibniz, Die Theodizee von der Güte Gottes,
der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Übels (1710)
David Hume, Dialoge über natürliche Religion (1751-1761)
Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer Kritik der Offenbarung
(1792)
Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft (1793)
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Über die Religion.
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799)
Johann Gottlieb Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben (1806)
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Untersuchungen über das
Wesen
der
menschlichen
Freiheit
und
die
damit
zusammenhängenden Gegenstände (1809)
Georg
Friedrich
Wilhelm
Hegel,
Vorlesungen
über
die
Philosophie der Religion (1827)
Ludwig Feuerbach, das Wesen des Christentums (1841)
Friedrich
Wilhelm
Joseph
Schelling,
Philosophie
der
Offenbarung (1841/1842)
Sören Kierkegaard, Philosophische Bissen (1844)
Sören Kierkegaard, Einübung im Christentum (1850)
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1883ff.)
William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung (1902)
Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904/1905)
Émile Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens
(1912)
Rudolf Otto, das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (1917)
Max Scheler, Vom Ewigen im Menschen
Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion (1927)
Henri Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion
(1932)
Alfred Jules Ayer, Language truth and logic (1936)
Leo Schestow, Athen und Jerusalem. Versuch einer religiösen
29
Philosophie (1937)
Ludwig Wittgenstein, Vorlesungen über den religiösen Glauben
(1938)
Simone Weil, Das Unglück und die Gottesliebe (1942)
Martin
Heidegger,
Die
ontotheologische
Verfassung
der
Metaphysik (in: Identität und Differenz. GA, I.Abt,Bd.11)
Gerschom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen
(1957)
Paul Ricoeur, Die Fehlbarkeit des Menschen (Endlichkeit und
Schuld I) (1960)
Karl Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der
Offenbarung (1962)
Georges Bataille, Theorie der Religion (1974)
Niklas Luhmann, Funktion der Religion (1977)
Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos (1979)
Emmanuel Lévinas, Wenn Gott ins Denken einfällt. Diskurse über
die Betroffenheit von Transzendenz (1982)
Hans Jonas, der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische
Stimme (1987)
Gianni Vattimo, Glauben – Philosophieren (1996)
1.3.3 Einige Beispiele
Wenn ich eine Handvoll Religionsphilosophen als Beispiele
herausgreifen soll, müßte ich unbedingt für das erste
jahrtausend unserer Zeitrechnung Augustinus wählen; ich hebe
ihn mir aber für später auf. Auch Dionysius und Boethius lasse
ich weg. Vielmehr beginne ich mit der mittelalterlichen
Persönlichkeit:
Anselm von Canterbury24
(1033/34-1109, aus Aosta, Schüler Lanfrancs und 1063 als
dessen Nachfolger Prior des Klosters Bec in der Normandie,
1078 Abt daselbst, 1093 Erzbischof von canterbury, im Kampf um
die Rechte der Kirche zweimal verbannt.)
Bei Anselm hat die Philosophie apologetische Funktion.
Philosophieren und Glauben sind für ihn zwar nicht dasselbe,
aber alles, was der Gläubige mittels der Offenbarung
kennenlernt, kann hinterher auch mit Hilfe der Vernunft
bewiesen werden. Ein Kernsatz der Lehre Anselms war ja:
„Credo,
ut
intelligam“,
ich
glaube,
damit
ich
auch
(philosophisch) verstehen kann. Anselm folgte in vielerlei
Hinsichten Augustin und stand damit in der platonischchristlichen Tradition. Das schloß u.a. ein, daß er noch nicht
wie die von Aristoteles beeinflußten Denker eine Aktivität der
Vernunft akzeptierte, die sich autonom, ohne Hilfe der Gnade,
entfalten konnte. Die Vernunft bedarf bei Anselm der
Erleuchtung des Heiligen Geistes, um wirklich funktionieren zu
Nach Hubertus G.Hubbeling, Einführung in die Religionsphilosophie,
Göttingen 1981, 17ff.
24
30
können. Und das trifft nicht nur für die Erkenntnis der
übernatürlichen
Tatbestände
zu,
dem
würden
auch
die
christlichen Aristoteliker zustimmen, sondern gleichfalls für
die Erkenntnis der natürlichen Tatsachen. Daher das Motto: ich
muß zuerst glauben, um philosophisch verstehen zu können.
Viele Interpreten, zu denen in erster Linie der schweizerische
Theologe Karl Barth zu zählen ist, sehen deshalb auch keinen
Unterschied zwischen Anselms Philosophie und Theologie. Alles
sei bei Anselm nur Theologie. Bei genauerer Betrachtung seiner
Argumentation zeigt sich aber, daß Anselm sehr sorgfältig das
Kriterium
für
die
Unterscheidung
von
Theologie
und
Philosophie beachtet. Zwar erkennen wir vieles zuerst mittels
der Offenbarung: die Existenz Gottes, die Trinität, die
Erlösung durch das Leiden und Sterben Jesu Christi usw. Aber
alle diese Sachverhalte sind dann hinterher auch mittels der
Vernunft, remoto Christo (abgesehen von Christus), zu
beweisen. Und bei dieser Beweisführung beruft Anselm sich
nicht auf die Schrift oder auf eine durch eine kirchliche
Autorität gewährleistete Tradition. Im Gegensatz zu dem, was
später Thomas von Aquin verteidigt, ist Anselm der Meinung,
daß alle in der Schrift und in der Tradition geoffenbarten
Wahrheiten von der Vernunft nachträglich auch bewiesen werden
können. Bei Thomas trifft dies nur für einen Teil der
geoffenbarten Wahrheiten zu.
Anselm ist wegen seines ontologischen Gottesbeweises bekannt
geworden. In diesem Beweis wird die Existenz Gottes aus dem
Begriff von Gott als einem Wesen, im Vergleich zu dem Größeres
nicht gedacht werden kann, abgeleitet. Zuvor hatte Anselm
schon die mehr traditionellen kosmologischen Gottesbeweise
entfaltet. Hierbei wird aber die Existenz Gottes in dieser
oder jener Weise aus der Existenz der Welt oder etwas
Welthaftem
abgeleitet.
Anselm
fand
diesen
Gedanken
unerträglich, weil nach seiner Auffassung Gott damit irgendwie
als von der Welt abhängig gedacht wird. Er ruhte nicht, bevor
er nach einigen schlaflosen Nächten einen Beweis gefunden
hatte, bei dem nicht aus der Welt oder etwas Welthaftem,
sondern ausschließlich aus Gott selbst, nämlich aus dem
Begriff Gott, seine Existenz gefolgert werden konnte. Wie sehr
jedoch hierbei der Denker und der Gläubige eine Person
bleiben, mag die Tatsache zeigen, daß Anselm seinen Beweis in
die Form eines Gebetes einkleidet. Als literarische Form für
einen Gottesbeweis ist dies völlig einmalig!
Nikolaus von Kues 25
(de Cusa, Cusanus, am Ende des Mittelalters, und schon der
Renaissance zuzurechnen: 1400/01-1464, Sohn eines
Moselschiffers, in Heidelberg, Padua und Köln vielseitig
ausgebildet, influßreicher Teilnehmer am Basler Konzil, an
den Unionsverhandlungen mit Ostrom und an mehreren
Nach Jens Halfwassen, Nikolaus von Kues über das Begreifen des
Unbegreiflichen. (Manuskript, Publikation in Vorber.)
25
31
Reichstagen und Synoden, von den Päpsten oft mit der
Durchführung von Missionen und Reformen beauftragt, 1448
Kardinal, 1450 Bischof von Brixen. Seine kirchenpolitischen
Schriften (De concordia catholica, De pace fidei, De
auctoritate praesidendi in concilio generali u.a.) sind von
dem Strben nach Einheit und Versöhnung getragen. Als
unermüdlich forschender Geist befaßte er sich auch mit
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fragen, wobei er die
Grundlage der Integralrechnung schuf und zur Erkenntnis der
Achsendrehung der Erde kam.)
Nikolaus von Kues, der bedeutendste und kraftvollste Denker
der Renaissance, bestimmt Philosophie als das Begreifen des
Unbegreiflichen. Denn Philosophie ist seit ihren griechischen
Anfängen die denkende Suche nach dem Absoluten, das Grund und
Ursprung alles Wirklichen ist. Weil das Absolute für Nikolaus
aber über alles Begreifen hinaus ist, darum kann die denkende
Suche nach ihm nur im Begreifen des Unbegreiflichen gelingen.
Cusanus steht damit in der Tradition des Neuplatonismus, der
die Theorie des Absoluten in der Form der negativen Theologie
ausgebildet hat. Grundlegend für die neuplatonische Form der
negativen Theologie ist die Einsicht in die reine
Transzendenz des Absoluten, das nicht nur alles Sein, sondern
in einem damit auch alles Erkennen übersteigt. Darum nähert
sich das Denken dem transzendenten Absoluten auch nicht
begreifend, sondern gerade umgekehrt durch die Aufhebung
alles Begreifens, nämlich dadurch, daß es das Absolute durch
Verneinungen aus all jenen Bestimmungen herausnimmt, in denen
das Denken das Seiende begreift. Damit wird das begreifende
Denken aber nicht vernichtet, sondern es begreift gerade
durch die Verneinung seiner eigenen Positivität die
Transzendenz über alles Begreifen. Pseudo-Dionysius
Areopagita, der für Cusanus neben Proklos der wichtigste
Anreger überhaupt war, nannte dies ein "Wissen durch
Nichtwissen" (gnôsis di’ agnosías, De divinis nominibus VII §
4), das alles positive Wissen übersteigt. Johannes Eriugena,
ebenfalls einer der wichtigsten Anreger des Cusanus, hatte
vom "Begreifen des Unbegreiflichen" gesprochen (De divisione
naturae III 4). Nikolaus nimmt diese neuplatonischen Formeln
schon im Titel seiner ersten philosophischen Schrift auf,
deren Thema das "wissende Nichtwissen", die docta ignorantia
ist. Deren Aufgabe ist es, wie gleich zu Anfang betont wird,
das Absolute in seinem Hinaussein über alle Gegensätze "auf
nichtbegreifende Weise einzusehen" (incomprehensibiliter
intelligere).26
Cusanus verbindet damit schon in der Docta ignorantia das
Programm einer Philosophie des Christentums, die sich nicht
auf den subjektiven Glaubensvollzug, sondern auf die
spekulative Vernunft stützt. Ihr Ziel ist es, die zentralen
Inhalte der christlichen Offenbarung -- die Begründung der
Welt durch das göttliche Eine, die dreifaltige Einheit Gottes
und seine Menschwerdung in Christus -- aus dem spekulativen
Tiefblick der Vernunft denkend einzusehen. Nikolaus folgt mit
diesem Programm Meister Eckhart, der 1328 in Avignon als
Ketzer verurteilt wurde; Cusanus wurde 120 Jahre später,
1448, Kardinal und wäre beinahe Papst geworden.
Benedictus (Baruch) de Spinoza
26
27
27
De docta ignorantia I cap. 4 Titel; cap. 5, 13, Z. 3.
Nach H.G.Hubbeling, Einführung in die Religionsphilosophie. Göttingen
32
(1632-1677.
Als
Sohn
portugiesisch-jüdischer
Eltern
in
Amsterdam
geboren,
wohin
diese
wegen
der
großen
Religionsfreiheit in den Niederlanden ausgewandert waren.
Talmudschule; seine lateinischen und sonstigen Kenntnisse
verdankte er einem Ex-Jesuiten. Eintritt in das Geschäft des
Vaters, gleichzeitig intensive Weiterbildung in gelehrten
Kreisen. Verbannung aus der Synagoge 1656, wohl wegen der
kompromißlosen philosophischen Haltung. Die Unversöhnlichkeit
gründete wohl darin, daß Spinoza Religion in ritueller
Gesetzeserfüllung nicht anerkannte, wie sich auch noch seinem
Theologisch-politischen Traktat entnehmen läßt. Er mußte das
Geschäft aufgeben und verdiente seinen Lebensunterhalt (falls
das überhaupt nötig war) durch Linsenschleifen, was damals
freilich noch als hochgeschätzte Kunstfertigkeit im Dienst
wissenschaftlicher Geräteherstellung galt. Er lebt teils
zurückgezogen,
teils
in
Verbindung
mit
christlichen
Gruppierungen wie den sog. Kollegianten, deren Auffassungen
von Toleranz, Gesinnungsfreiheit er nahestand. Der Untertitel
des Theologisch-politischen Traktats zeigt es: ....)
Ein Denker, der Philosophie und Religion trennt, wobei
Religion deutlich sekundäre Bedeutung hat. Die biblische
Offenbarung hat nur den Zweck, die Menschen Tugend und
Gehorsam zu lehren, insoweit sie nämlich noch nicht imstande
sind, sich durch die Leitung der Vernunft führen zu lassen.
Der vernünftige, philosophische Mensch ist aber sich selbst
genug und braucht die Hilfe der Offenbarung nicht.
Das bedeutet freilich nicht, daß Gott im Denken Spinozas keine
Rolle spielt. Im Gegenteil! Gott ist bei ihm das Zentrum der
Philosophie wie später bei Hegel. Der Gottesbegriff Spinozas
ist aber rein philosophisch, der theologische Gottesbegriff
hat nur Bedeutung für die große Menge, die nicht philosophisch
geschult ist. Nicht alle Menschen sind ja imstande, den hohen
philosophischen Gedanken zu folgen und deshalb haben sie einen
moralischen Halt am biblischen Gottesbegriff. Aber auch mit
Hilfe dieses Begriffs kann der Mensch lernen, ein glückliches
und harmonisches Leben zu führen. Von einer Bekämpfung der
Religion ist bei ihm also nicht die Rede. Auch dürfen wir
philosophisches Denken bei Spinoza nicht zu intellektuell
auffassen. Spinoza kannte drei Erkenntniswege. Der erste Weg
ist
derjenige
der
Erfahrung.
Dieser
führt
nur
zu
oberflächlicher Erkenntnis. Der zweite Weg ist der Weg des
Verstandes. Er besteht aus guter Sachkenntnis mit Hilfe von
klaren
Definitionen
und
Axiomen
und
einer
deutlichen
Beweisführung. Der dritte Weg dagegen ist der beste Weg,
obwohl er schwierig und selten ist. Er ist der Weg der
Intuition, der Weg der unmittelbaren Gotteserkenntnis. Aber im
Prinzip steht dieser Weg jedem offen.
Alles ist nach Spinoza in Gott und geht auch notwendig aus ihm
1981, 34ff.
33
hervor. Von der unendlichen Zahl der Attribute Gottes (=seiner
Eigenschaften), kennen wir nur zwei, und zwar das Denken und
die Ausdehnung. Die Dinge dieser Welt sind Modi, d.h. sie sind
Seinsweisen der göttlichen Attribute. So ist der Mensch
aufgebaut aus Leib und Seele. Ersterer ist ein Modus des
Attributs Ausdehnung, letztere ist ein Modus des Attributs
Denken. Es gibt keine direkte Beeinflussung von der Seele auf
den Leib oder umgekehrt. Es gibt aber einen Parallelismus
zwischen beiden, der in einem Parallelismus der beiden
göttlichen Attribute begründet ist. Man kann mit einem
bekannten Bild diesen Tatbestand erläutern, indem wir beide
sehen als zwei Zifferblätter einer Uhr. Spinoza versteht es,
sein System klar und deutlich zu entfalten mit Hilfe seiner
geometrischen
Methode,
die
wir
heutzutage
eher
als
axiomatische Methode bezeichnen würden. Er war jedoch kein
kalter Rationalist, der für die Lebensprobleme der Menschen
keinen Blick hatte. Es ging ihm um das konkrete, menschliche
Lebensglück, das erreicht wird, wenn der Mensch sein Leben und
die Welt „sub specie aeternitatis“ betrachtet, d.h. unter dem
Gesichtspunkt der Ewigkeit, so daß er einsehen lernt, daß
alles mit Notwendigkeit aus Gott kommt.
Interessant ist bei Spinoza das Verhältnis zwischen Gott und
den ewigen logischen Gesetzen (Wahrheiten). Im 17. Jh. war
dies ein wichtiges Problem und eigentlich ist es das noch.
Descartes meinte, daß Gott die ewigen Wahrheiten und also auch
die logischen Gesetze geschaffen habe. Sie hätten also auch
anders sein können. Für Leibniz dagegen sind die logischen
Gesetze universell gültig und gelten auch für die göttliche
Welt. Gott ist dann auch diesen Gesetzen unterworfen. Spinoza
ist der tiefsinnigste unter ihnen. Bei ihm sind diese
logischen Gesetze Gedanken von Gott selbst und drücken sein
Wesen
aus.
Keineswegs
aber
ist
Gott
diesen
Gesetzen
unterworfen. Einen ähnlichen Standpunkt nimmt er ein in bezug
auf die alte Frage nach dem Verhältnis von Gott und dem Guten.
Nach den Skotisten war etwas gut, weil Gott es so gewollt hat,
ein Standpunkt, der eine Ähnlichkeit mit Descartes aufweist.
Einen mehr leibnizianischen Standpunkt nehmen die Thomisten
ein: Gott will etwas, weil es gut ist. Auch hier behauptet
Spinoza: Gott ist das Gute, oder besser in seiner eigenen
Sprache: Gott ist die Perfektion.
Gotthold Ephraim Lessing 28
(1729-1781)
G.E.Lessing ist Symbolgestalt der Neuzeit. Das gilt für die
Literaturgeschichte wie für Theologie und Philosophie. Er hat
über das hinausgewirkt, was literarisch und denkerisch in
Nach Klaus Kienzler, Der garstige Graben zwischen Vernunft und
Offenbarung. In: A.Halder / K.Kienzler / J.Möller (Hrsg.), Auf der Suche
nach dem verborgenen Gott. Zur theologischen Relevanz neuzeitlichen
Denkens. Düsseldorf 1987, 35-54.
28
34
seinem Werk objektiv vorliegt. Wirkungsgeschichtlich kann für
die
Theologie
wie
für
die
Philosophie
zur
Bedeutung
Lessingsgesagt werden:
„Fragt man, wo der Umschlag zwischen Leibniz und Hegel erfolgt
sei, läßt sich darauf exakt antworten: im Fragmentenstreit
(1778-1780 zwischen Lessing und seinen Kontrahenten aus allen
theologischen und philosophischen Lagern geführt). Er ist das
grundstürzende Ereignis in der Theologiegeschichte des 18.
Jahrhunderts. Seit 1780 ist Gott tot. Von da an herrscht in
Deutschland Göttertrauer, der Schmerz der nordischen Welt, das
protestantische Leid der entbehrten Einheit von Glauben und
Wissen, wie man es aus Hölderlin, Schlegel, Novalis oder Hegel
kennt. Die aporetische Situation, in der jene sich vorfinden,
ist erst ein Jahrzehnt zuvor entstanden. Älter ist das
Zeitbedürfnis
nicht,
auf
das
hin
die
soteriologische
Selbstdefinition
der
romantisch-idealistischen
Religionsphilosophie: Heilung, Versöhnung eines zeitgeschichtlichen
Widerspruchs zu sein, erfogt. Lessing und Reinhold sind die
ersten gewesen, die ihre theoretische Aktivität in dieser
Weise als Evangelium des Geistes begriffen haben. Sie wissen
sich antithetisch motiviert durch die Todesmacht eines
Gesetzes,
eines
Buchstabens:
den
philosophischwissenschaftlichen Atheismus der unmittelbaren Gegenwart.“ 29
Windelband bestimmte das Wesen der Aufklärung als den Prozeß
der Vernunft gegen die Geschichte. Und das Problem der
Geschichte wurde den Aufklärern zunächst im Umkreis der
religiösen Phänomene sichtbar. Die christliche Religion
gründete sich ja auf eine historisch reklamierte Offenbarung.
Geschichte und historische Begründung fielen aber ganz und gar
aus den rationalen Organisationsgesetzen der idealen Vernunft
heraus. Deshalb der erbitterte Kampf der frühen Aufklärung
gegen die christliche Religion in Form radikaler Kritik;
deshalb aber wurde auch die Geschichte zu dem Grundproblem der
Aufklärung.
Lessings geistiger Standort muß in dieser Zeitsituation
angesiedelt werden. Lessings größtes Verdienst ist wohl die
Diagnose
der
neuen
Zeit
und
die
Erkenntnis
ihrer
Anforderungen. Sein wohl berühmtestes Diktum trifft genau in
das Herz dieser Zeit:
„Wenn keine historische Wahrheit demonstriert werden kann, so
kann auch nichts durch historische Wahrheiten demonstriert
werden. Das ist: zufällige Geschichtswahrheiten können der
Beweis von notwendigen Vernunftswahrheiten nie werden.“ 30
Geschichte wird also als das Grundproblem der Zeit erkannt.
Aber es handelt sich nicht um das friedliche Gespräch über die
H.Timm, Gott und Freiheit. Studien zur Religionsphilosophie der
Goethezeit. Bd.1: Die Spinozarenaissance. Frankfurt a.M. 1974, 22f.
30 G.E.Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, 3, 309 (Werke
in 3 Bänden, hrsg.v. K.Wölfel, Frankfurt 1967).
29
35
Wahrheit von Geschichte, sondern mit den Geschichtswahrheiten
steht nichts Geringeres als das ganze Gebäude der christlichen
Offenbarungen auf dem Spiel. Der Dolch wird gegen das Herz der
historischen Offenbarungsreligion geführt: Da in der Zeit ein
Einverständnis darüber besteht, daß historische Wahrheiten
schlechthin nicht bewiesen werden können und sie somit
zufällig
sind,
so
ergibt
sich
notwendigerweise
der
folgenreiche Schluß, daß historische Wahrheiten auch nie und
nimmer zur Begründung der christlichen Wahrheit genügen
können. Im Gegenüber zu den erkannten Notwendigkeiten der Zeit
fällt
die
christliche
Wahrheit
auf
die
Stufe
von
Zufälligkeiten ab.
Es liegt Lessing aber fern, allein auf dem kritischen
Standpunkt
zu
verharren.
Der
nächste
Schritt
wäre
Religionsbegründung; es wäre der Mut, nach der Grenzziehung
Neues zu wagen. Ohne Zweifel war Lessing auf ein neues
Verständnis von Religion und Offenbarung aus. Wie dieses neue
Religionsverständnis jedoch zu konzipieren wäre, ist bei ihm
weniger deutlich ausgesprochen; es ist nur zu vermuten; er
hält jedenfalls weder die historische Methode noch die
rationalistische
Methode
für
geeignet
für
das
neue
Verständnis.
Die optimistische Aufklärungsphilosophie hat sich vorwiegend
mit dem Standpunkt der Religionskritik begnügt. G.E.Lessing
geht in dieser Tendenz nicht auf. Aber das Moment der
Religionskritik hat er durchaus von der Aufklärung übernommen.
Er hat es für seine eigene Diagnose der Religion eingesetzt.
Religionskritik ist für ihn die notwendige Selbstreinigung der
Religion. Durch die Religionskritik wird die Religion einem
Selbstreinigungsprozeß
unterzogen,
der
ihre
Grenzen
hervortreten läßt, aber ihr auch eine neue Sicht gewährt, wo
ihre eigentlichen Möglichkeiten ruhen. Für Lessing gehört das
kritische Moment wesentlich in den Bereich der Aufgaben einer
nötigen Religionsphilosophie.
Die Grundunterscheidung von „Religion“ und „Geschichte“ bleibt
für Lessing die wichtigste. Wie es weitergeht, wird in den
„Axiomata“ mehr genannt als ausgeführt. Mit seinen eigenen
Worten:
„Bei mir bleibt die christliche Religion die nämliche, nur daß
ich die Religion von der Geschichte der Religion will getrennt
wissen. Nur daß ich mich weigere, die historische Kenntnis von
ihrer Entstehung und Fortpflanzung und eine Überzeugung von
dieser Kenntnis, die schlechterdings bei keiner historischen
Wahrheit sein kann, für unentbehrlich zu halten. Nur daß ich
die Einwürfe, die gegen das Historische der Religion gemacht
werden, für unerheblich erkläre, sie mögen beantwortet werden
können oder nicht. Nur daß ich die Schwächen der Bibel nicht
für Schwächen der Religion halten will. Nur daß ich die
Prahlerei des Theologen nicht leiden kann, welche dem gemeinen
36
schon längst
Hermeneutiker
Manne weismacht, jene Einwürfe wären alle
beantwortet. Nur daß ich den kurzsichtigen
verschmähe...“ 31
Es sind also neben der Unterscheidung von Religion und
Geschichte der Religion die Unterscheidungen von Religion und
Bibel, von Geist und Buchstabe, von innerer Wahrheit und
hermeneutischer Wahrheit wichtig.
An Lessings „Nathan“ kann man am schönsten sehen, was das
Neuartige seiner Bemühungen ist: Es beginnt eine Besinnung auf
das, was Religion in sich ist, was das Phänomen und das Wesen
der Religion bedeutet, die vor ihm ihresgleichen sucht.
Religion ist nicht mehr allein von der geschichtlichen
Entwicklung einer konkreten Religion her zu verstehen, sondern
es bedarf zu ihrer Vergewisserung ganz anderer und neuer
Anstrengungen.
Es
geht
ihm
um
die
Sammlung
aller
Anstrengungen, für die moderne Zeit den „Beweis des Geistes
und der Kraft“ zu führen.
In den Jahrzehnten nach Lessing rückte die spekulativphilosophische Weise der Religionsbegründung immer mehr in den
Vordergrund, um bei G.W.F.Hegel ihren Höhepunkt zu erreichen.
Hegel hält dem „historischen“ Glauben den „Geist“ der Religion
entgegen:
„Die absolute Entstehungsweise aus der Tiefe des Geistes und
so die Notwendigkeit, die Wahrheit dieser Lehren, die sie auch
für unseren Geist haben, ist bei der historischen Behandlung
auf die Seite geschoben ... Die Geschichte beschäftigt sich
mit Wahrheiten, die Wahrheiten waren, nämlich für andere,
nicht mit solchen, welche Eigentum wären derer, die sich damit
beschäftigen. Mit dem wahrhaften Inhalt, mit der Erkenntnis
Gottes haben es jene Theologen gar nicht zu tun.“ 32
„Die Vernunft ist der Boden, auf dem die Religion allein zu
Hause sein kann ... Der Boden der Religion ist insofern dies
Vernünftige und näher das Spekulative.“ 33
Mit dem Scheitern dieser spekulativen Philosophie ist die
religionsphilosophische Aufgabe, die Lessing gestellt hat,
noch keineswegs zu Ende. Sören Kierkegaard griff ebenfalls auf
Lessing zurück. Mit Recht gilt Lessing als Vater der neueren
Religionsphilosophie.
Ludwig Wittgenstein 34
(1889-1951)
In diesem originellen Denker vollzog sich die Wendung zur
Sprache. Die Philosophen vor Wittgenstein analysierten in
erster
Linie
das
menschliche
Bewußtsein.
Im
Gefolge
G.E.Lessing, Axiomata, 3, 442.
G.W.F.Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Werke in
20 Bden, hrsg. v. E.Moldenhauer u. K.M. Michel, Frankfurt a.M. 1970, 16,
48.
33 Ebd. 16, 196.
34 Nach G.Hubbeling, Einfürung in die Religionsphilosophie, Göttingen
1981, 40f.
31
32
37
Wittgensteins nehmen nun aber viele Philosophen die Sprache
zum Ausgangspunkt. In seiner ersten Periode, der Periode des
„Tractatus logico-philosophicus“, lehrte Wittgenstein, daß wir
in der Sprache die Wirklichkeit abbilden. Sollen aber unsere
Aussagen kognitiv sinnvoll sein, dann müssen sie, wenigstens
im Prinzip, empirisch verifizierbar sein. Aussagen, bei denen
dies nicht möglich ist, sind nach ihm daher sinnlos. Hierzu
gehören die ästhetischen, mathematischen und logischen,
einschließlich der Aussagen in „Tractatus“. Hieraus geht klar
hervor, daß der Begriff „Sinn“ bei Wittgenstein eine besondere
Bedeutung
hat,
eben
die
Bedeutung
von
„empirisch
verifizierbar“. Der Wiener Kreis, der sich die Gedanken
Wittgensteins
dankbar
aneignete,
betrachtete
die
mathematischen, logischen und einige philosophische Aussagen
doch als sinnvoll. Das Sinnlose war aber für Wittgenstein
nicht unbedeutend. So schrieb er an Russell, daß seine Arbeit
aus zwei Teilen bestehe, aus dem, was darin gesagt werde und
also sinnvoll sei, und aus dem, was nicht gesagt, sondern nur
gezeigt werde. Das letztere sei das Mystische. Es war immer
die Frage in der Wittgenstein-interpretation, ob man dieses
Mystische religiös interpretieren dürfe oder nicht. Neues
Material aus der Zeit der Entstehung weist deutlich auf eine
religiöse Interpretation hin, vorausgesetzt, daß man dabei
nicht an eine christliche Interpretation denkt. Wir können
über Gott nicht reden; er zeigt sich aber in der Welt und in
der Sprache. In einer „Lecture on Ethics“ spricht Wittgenstein
davon, daß er in seinem Leben angerührt worden sei von einigen
Mysterien, über die er nicht sprechen, doch die er andeuten
könne. Zu diesen Mysterien gehörte die Existenz der Welt:
Warum gibt es überhaupt etwas, warum ist da nicht vielmehr
nichts? Er erlebte auch nach seiner Aussage ein zweites
Mysterium, nämlich die tiefe Gewißheit, daß nichts ihm mehr
etwas anhaben konnte, daß er geborgen sei, was auch geschehen
möge. Aber diese Dinge ließen sich eben nicht in Worten
ausdrücken. In seinen späteren Arbeiten hat Wittgenstein eine
erweiterte
Auffassung
von
der
Sprache.
Er
kennt
nun
verschiedene Sprachspiele, unter denen auch ein religiöses
Sprachspiel möglich ist. Diese Sprachspiele und Lebensformen,
sie sind Gestalten der Kultur. Wittgenstein weist weiter
darauf hin, daß eine religiöse Aussage in bejahendem Sinne wie
„Ich glaube an ein ewiges Urteil“ auf einer ganz anderen Ebene
liegt als ihre Negation „Ich glaube nicht an ein ewiges
Urteil“. Erstere Aussage bringt eine ganze Lebenshaltung und
einen gewissen Lebensstil hervor, die zweite Aussage dagegen
nicht. Dies erinnert an Karl Barth, für den auch Glaube und
Unglaube nicht auf derselben Ebene liegen. Wittgenstein war
kein ausgesprochen religiöser Denker, aber er hatte einen
tiefen Respekt vor der Religion (wie er selbst sagte) und er
hatte (wie sein Freund und Biograph Malcolm sagte) „eine
Möglichkeit für Religion“.
38
1.4 Zur gegenwärtigen Situation der Religionsphilosophie
Vor 10 Jahren habe ich an dieser Stelle gesagt: Die
gegenwärtige
Situation
der
Religionsphilosophie
ist
am
zutreffendsten mit dem Ausdruck "Krise" umschrieben. Heute
möchte ich feststellen, daß es deutliche Zeichen einer
gegenläufigen Tendenz gibt, so daß das Wort von der Krise zwar
immer noch stimmt, aber doch in anderem Licht erscheint.
Warum
Krise?
Zu
den
allgemeinen
Emanzipationsund
Säkularisierungsprozessen, die man nicht nur auf Humanismus
und Reformation, sondern noch weiter auf die sog. „Revolution
aus Rom“ (F.Heer), sprich die Aufspaltung des Christentums in
ein Klerus- und ein Laienchristentum schon im Mittelalter
zurückführen kann, kam am Ende des 19.Jh. die radikale These
Nietzsches
vom
Tod
Gottes
als
Chiffre
für
die
Unglaubwürdigkeit der religiösen Transzendenz.
Es kam im 20. Jahrhundert die Position des radikalen
Sinnlosigkeitsverdachts
gegenüber
metaphysischen
und
theologischen Aussagen in der Wissenschaftstheorie des Wiener
Kreises, repräsentiert durch Carnap und Neurath, der ersten
Phase der analytischen Philosophie.
Die Krise ist aber eine allgemeine und betrifft nicht nur die
Religionsphilosophie.
Wissenschaft
und
traditionelle
Metaphysik haben weitgehend
ihre Überzeugungskraft als
Instrumente der Kontingenzbewältigung eingebüßt. 35
Die Gespräche in Castelgandolfo, die Papst Johannes Paul II.
alljährlich mit hochrangigen Wissenschaftern führte, hatten
1986 als Thema: "Über die Krise". 36 Gemeint war ein
allgemeines Krisenbewußtsein.
In der Zeit allgemeiner Orientierungslosigkeit wird die
religiöse Praxis wiederentdeckt. Dabei ist man nicht immer
wählerisch. Siehe die Schaufenster der Buchhandlungen mit
esoterischer Literatur.
Im Grunde ist der Aberglaube immer schon der Schatten der
Religion. Zu diesem Thema hat Spinoza Wesentliches gesagt.
(Zitat aus dem Traktat) Und die Versuchung zum Rückfall in
unkritische Sinnsuche ist schon Begleiterin der Philosophie
von I. Kant. (Swedenborg)
Kant ist ein Leuchtturm abendländischer Rationalität; er hat
sich gegen zwei Versuchungen gewandt: den „dogmatischen Trotz“
und die „skeptische Verzweiflung“.
Kurt Wuchterl stellt für heute fest: „Auf der einen Seite
entdecken wir eine geradezu inflationäre Verwendung des
Kontingenz (von contingere) – Bedingtheit alles Seienden, das nicht wie
allein Gott – aus eigener „Wesensnotwendigkeit“ existiert.
36 Über die Krise. Castelgandolfo-Gespräche 1985, hrsg. v. Krzysztof
Michalski, Stuttgart, Klett-Cotta, 1986.
35
39
Sinnbegriffs, in der sich eine kritiklose, ‚neue Religiosität’
manifestiert,
die
allen
Säkularisierungsund
Aufklärungsbewegungen
der
beiden
letzten
Jahrhunderte
hohnspricht;
auf der anderen Seite beobachtet man eine bis
ins
Zynische
verfremdete
Skepsis,
die
sich
über
die
unvereinbaren Formen der bisher ‚erzählten Geschichten’ hinweg
zu einem verklärt-neutralen postmodernen Bewußtsein erhebt.“37
Eine interessante Position ist die von Heinz Robert Schlette.
Schlette will auf den Titel "Religionsphilosophie" aus
traditionellen, sprachlichen und pädagogischen Gründen nicht
verzichten, grenzt sich aber durch das Epitheton "skeptisch"
von allen systematischen und optimistischen Bestrebungen ab.
Religionsphilosophie ist ihm keine philosophische Disziplin,
die
in
einer
bestimmten
Kapitelfolge
perfektionistisch
abgehandelt werden kann, sondern eine Form des Fragens, dem
der Gegenstand abhanden gekommen scheint, obgleich die alten
Wörter noch im Umlauf sind. 38
Skepsis ist für Schlette die notwendige Einstellung dessen,
der
auf
Grund
der
geschichtlich
vermittelten
Ebene
gegenwärtigen Philosophierens sich Klarheit zu verschaffen
sucht.
Eine
Hauptthese
Schlettes
ist,
daß
skeptische
Religionsphilosophie, wie sie (im Zusammenhang mit Aporetik
und Hermeneutik) heute immer noch verantwortbar zu sein
scheint, immer auch Kritik der Pietät bedeutet. 39
Schlette: "Über die metaphysischen "Inhalte" Gott, Freiheit,
Unsterblichkeit läßt sich philosophisch mit dem Anspruch auf
Wahrheit und Sicherheit nichts sagen, aber die Notwendigkeit,
die alten Fragen der alten Metaphysik weiterhin zu stellen,
ist auf keine Weise aufhebbar." 40
Zur Einschätzung der heutigen Situation gehört unbedingt auch
ein Blick auf die Theologie: Es ist nicht nur so, daß
Philosophie heute in einer Weise von Mythos und Religion,
speziell christlicher Theologie emanzipiert ist wie nie zuvor
in ihrer Geschichte, sondern auf der anderen Seite ist heute
theologie-intern alles möglich:
"Während der eine Theologe religionslos an Gott glauben will
(Dietrich Bonhoeffer), bekennt sich der andere zu einem
Glauben ohne Gott (Dorothee Sölle). Wenn für diesen der
37
38
39
40
K.Wuchterl, Analyse und Kritik der religiösen Vernunft. Grundzüge
einer paradigmenbezogenen Religionsphilosophie. Stuttgart 1989, 273.
Heinz Robert Schlette, Skeptische Religionsphilosophie. Zur Kritik der
Pietät. Freiburg, Verlag Rombach, 1972. S.15.
Aporetik ist das Resultat des Philosophierens auf dem Felde der
Metaphysik. Hermeneutik ist für Schlette die Entschlüsselung oder
Dechiffrierung tradierter Worte und Texte - geleitet von der Frage, ob
etwas von ihnen, was und aus welchen Gründen vielleicht hinüberzuretten
ist in eine postnaive Spiritualität.
Schlette, op.cit. 25.
40
personhafte, theistische Gott erst verschwinden muß, damit der
größere, wirkliche, nicht-theistische 'Gott über Gott' (Paul
Tillich) erscheinen kann, hält jener das Wort Gott für
unverzichtbar 'gebunden an die singularische und personale
Bedeutung' der theistischen Redeweise der Bibel (Helmut
Gollwitzer). Und während für den einen aus dem unendlichen
Abstand zwischen Mensch und Gott sich die Unmöglichkeit
ergibt, von Gott zu reden, es sei denn durch ein Wunder (Karl
Barth), statuiert die dogmatische Konstitution des Ersten
Vaticanums, 'daß Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge
mit Sicherheit erkannt werden kann' (Vat.Sess.3,c.2)." 41
Aber:
Trotz
Schlettes
Naivitätsvorwurf
und
trotz
der
Unsicherheit
in
der
Theologie
kann
man
täglich
die
Ausstrahlungskraft religiöser Sinnstrukturen erleben. Mit
Wuchterl bin ich der Meinung, daß sich die Philosophie mit den
zahlreichen religiösen Phänomenen, die ihren Einfluß auf das
geistige Leben der Gegenwart haben, reflexiv befassen muß,
wenn sie sich nicht noch mehr dem Vorwurf aussetzen will, an
den Problemen der Zeit vorbeizuphilosophieren. Das tut sie
auch.
Zur gegenläufigen Tendenz – gegenläufig zur Religionskritik –
kann man der begründeten Meinung sein: Religion braucht ihre
Kritik, sie lebt davon. Was wäre das Alte Testament ohne seine
Propheten? Was wäre das Neue Testament ohne sein kritisches
Element, ohne die Unterscheidung von wahrer und geheuchelter
Gottesliebe? Das 20.Jh., in dem es der Religion scheinbar
schon an den Kragen ging, ist zugleich das Jahrhundert ihrer
Rekreation. Das gilt sogar auch für den Bereich der
christlichen Kirchen. Irgend jemand hat das 20.Jh. als das
„Jahrhundert der Kirche“ bezeichnet. Und Romano Guardini hat
schon am Anfang des Jh. gesagt: „Ein Vorgang von ungeheurer
Tragweite hat eingesetzt: Kirche erwacht in den Seelen“.
Ludwig Nagl hat im Vorwort eines von ihm herausgegebenen
Sammelbandes42 geschrieben:
„Einige
für
gesichert
erachtete
Grundelemente
der
Selbstartikulation der Moderne sind in den letzten Dekaden –
in
unterschiedlichen
Denkschulen:
in
der
spätund
postanalytischen Philosophie ebenso wie in der kritischen
Theorie und in der nach-phänomenologischen Dekonstruktion –
zum Gegenstand einlässiger Neubesichtigung geworden. Zu diesen
rethematisierten Theoriebausteinen zählt auch die – oft für
endgültig
eingeschätzte
–
nachkantisch
radikalisierte
Religionskritik
vom
feuerbachschen,
marxschen
und
Aus der Diskussion in: S.Moser und E.Pilick (Hrsg.), Gottesbilder heute,
Königstein 1979, 129; zitiert von Kurt Wuchterl in : Philosophie und
Religion, Stuttgart 1982, 10.
42 L.Nagl (Hrsg.), Religion nach der Religionskritik, Wien 2003, S.7.
41
41
des
szientistisch
gegenüber
aller
nietzscheschen
Typ,
bzw.
vom
Typus
motivierten
‚Sinnlosigkeitsverdachts’
religiösen Rede.“
Die Tendenz, sich mit dem Thema Religion in geänderter Optik
nochmals auseinander zu setzen, manifestiert sich (wie das
genannte
Buch
dokumentiert)
in
nahezu
allen
öffentlichkeitsbestimmenden
philosophischen
Diskursen
der
Gegenwart.“ 43
Im Jahr 1999 haben einige Kollegen des hiesigen Instituts für
Philosophie (Nagl-Docekal, Nagl, Dethloff) zusammen mit
Philosophie-Professoren
der
beiden
Wiener
theologischen
Fakultäten
(Salaquarda,
Heine,
Wucherer-Huldenfeld,
Langthaler)
eine
interfakultäre
Arbeitsgemeinschaft
Religionsphilosophie gegründet, die außer interner Diskussion
auch eine Vortragsreihe organisiert. (Ein Folder informiert
über die nächsten Termine derselben.) Die Vortragstexte werden
laufend
publiziert
in
der
Reihe
„Schriften
der
österreichischen
Gesellschaft
für Religionsphilosophie“.44
Ziel dieser Unternehmung war und ist es, das Gespräch zwischen
den prononcierteren Positionen der Gegenwartsphilosophie und
der Theologie, das trotz wachsenden Interesses an Religion
immer noch sehr schwach entwickelt ist, zu fördern.
Was dabei bisher erörtert wurde, ist nicht wenig:
(1) Im Umfeld
der philosophischen Gesellschaftstheorie des
zwanzigsten Jahrhunderts ist auf jüngere Erwägungen von Jürgen
Habermas zu verweisen, die „die semantischen Potentiale der
Religion“ (potentiell positiv) neu bewerten, sowie auf
Erwägungen Theodor W.Adornos – in seinen „Meditationen zur
Metaphysik“ – in denen Adorno (ohne an irgendeinem Punkt
selbst direkt ins ‚religiöse Sprachspiel’ einzutreten) das
umkreist, was in der metaphysischen Rede vom Absoluten vormals
verhandelt wurde.
(2) gibt es zeitgenössische Denkansätze, in denen die
„Wiederkehr des Religiösen“ im Umfeld von Postmoderne-Theorie
und Dekonstruktion analysiert wird. Paradigmatisch dafür sind
die Materialien des Sammelbands „Religion“, hrsg. von Jacques
Derrida und Gianni Vattimo (Oxford 1998), sowie Gianni
Vattimos Schrift Glauben-Philosophieren, Stuttgart 1996.
Wie breit gefächert dieses neue Interesse ist, zeigt auch der
Sammelband: Philosophy of Religion in the 21st Century, ed. By
D.Z.Phillips and Timothy Tessin, New York: Palgrave, 2001.
43
Bisher: K.Dethloff, L.Nagl, F.Wolfram (Hrsg.), Religion, Moderne,
Postmoderne. Berlin: Parerga Verlag, 2002; K.Dethloff, R.Langthaler,
H.Nagl-Docekal, F.Wolfram (Hrsg.), Orte der Religion im philosophischen
Diskurs der Gegenwart, Berlin 2004. Ein weiterer Band ist in Vorbereitung:
K.Dethloff, L.Nagl, F.Wolfram (Hrsg.), „Die Grenze des Menschen ist
göttlich“. Beiträge zur Religionsphilosophie. Berlin 2006.
44
42
(3) wird das Thema Philosophie-Religion neu verhandelt im
Umfeld der spät- und postanalytischen Philosophie sowie im
Neopragmatismus. Die Erwägungen des Logikers aus Harvard,
Hilary Putnam zur Religionsphilosophie von William James und
Ludwig Wittgenstein sind hier ebenso anzuführen wie Richard
Rortys Analysen des Zusammenhangs von Pragmatismus und
„Hoffnung“.
(4) Überdies gibt es eine Reihe interessant einsetzender Reargumentationsversuche „klassischer“ (z.B. scholastischer)
religionsphilosophischer Positionen, in denen der Versuch
unternommen
wird,
diese
Argumentationsfiguren
in
die
zeitgenössischen philosophischen Debatten einzubringen.
Herta Nagl-Docekal hält in der Einleitung des Sammelbands
„Orte der Religion im philosophischen Diskurs der Gegenwart“
(Berlin 2004) fest: Die allzu lange gängige Sichtweise, daß
Religion als ein Thema der philosophischen Forschung obsolet
geworden sei, wird häufig auf den für die beginnende Moderne
charakteristischen
Bruch
mit
tradierten
metaphysischen
Positionen zurückgeführt. (Das gilt für Vertreter dieser
Sichtweise wie für deren Kritiker.) Diese Einschätzung läßt
aber außer Acht, daß in den grundlegenden philosophischen
Konzeptionen der Moderne Akzente gesetzt wurden, die in eine
ganz andere Richtung weisen.
Immanuel Kant will sein gesamtes Unterfangen, die Grenzen der
Erkenntnismöglichkeiten unserer Vernunft aufzuzeigen - laut
Vorrede zur zweiten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“,
die als „Grundlegung der modernen Philosophie“45 betrachtet
werden kann - so verstanden wissen: „Ich mußte also das Wissen
aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.“ 46
Von daher scheint es durchaus plausibel, wenn in der KantForschung die Auffassung vertreten wird, daß „das Gesamtwerk
Kants religionsphilosophisch orientiert ist“47 Es liegt auf
der Hand, daß sich ein analoger Befund auch im Blick auf Hegel
und andere Autoren, deren Denken durchaus der Moderne
verpflichtet ist, formulieren läßt.
Die genannte Vortragsreihe verfolgt auch den Zweck, die
religionsphilosophischen
Diskussionen
möglichst
nah
am
allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs zu verorten. Dazu
gehört etwa, daß man bemüht ist, Referenten aus ganz Europa,
und zwar zunehmend auch aus dem ehemals kommunistisch
regierten Teil Europas, zu gewinnen. Ebenso, daß nicht nur am
Otfried Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der
modernen Philosophie, München 2003.
46 I.Kant, KrV 2.Aufl. 1787, B XXX.
47
Aloysius Winter, Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie
Immanuel
Kants, Hildesheim-Zürich-New York 2000, S.429.
45
43
Christentum Interessierte, sondern auch den beiden anderen
biblischen Religionen - Judentum und Islam - Nahestehende
eingeladen werden. (Hinweis auf die „Kontaktstelle für die
Weltreligionen“ in Wien, Leitung: Petrus Bsteh, p.Adr. Afroasiatisches Institut.)
1.5 Wozu treibt man heute Religionsphilosophie?
Willi Oehlmüller 48 nennt drei Probleme, die bisher ungelöst
sind und die Religionsphilosophie interessant machen.
(1) Der "garstige breite Graben" (so Lessing) zwischen der
religiösen Überlieferung und den Erfahrungen der kritischen
Subjektivität
in
der
sich
ausbildenden
geistigwissenschaftlichen und gesellschaftlich-politischen Welt wird
seit der Aufklärung immer breiter. Wo dieser Zwiespalt erwacht
ist, da erweisen sich alle Formen der Vermittlung, die nicht
an diesen Erfahrungen der kritischen Subjektivität anknüpfen,
als unglaubwürdig und unwirksam. Für die Subjektivität kann
die religiöse Überlieferung nur noch dadurch lebendig bleiben,
daß sie den einmal begonnenen Aufklärungsprozeß fortsetzt.
Nicht durch Beschwörung dessen, was man einmal auf Treu und
Glauben hin angenommen hatte, sondern allein durch kritische
Erinnerung kann das bewahrt werden, was die unaufgeklärte
Aufklärung allzu kurzschlüssig preisgegeben hat.
(2) Das Verhältnis des Christentums und der Kirchen zu den
nichtchristlichen
Religionen
bildet
ein
zweites
immer
dringlicheres
Problem
der
Religionsphilosophie.
In
der
gegenwärtigen Gesellschaft ist das Christentum nicht mehr wie
in der mittelalterlichen res publica christiana die Religion,
die die Gesamtgesellschaft integriert, so daß die Heiden im
Grunde "draußen" stehen. In dieser Gesellschaft kann man
ferner nicht mehr wie im Mittelalter der Meinung sein, daß man
mit
Hilfe
metaphysischer
Überlegungen
und
geschichtsphilosophischer Modelle und Zeitalterschemata das
Verhältnis des Christentums als der einen wahren Religion zu
den anderen Religionen für alle zureichend erklärt hat.
Peter Strassers „Der Gott aller Menschen“ spricht einige
Probleme an, die im Hinblick auf den interreligiösen Dialog
bearbeitet
werden
müssen:
Die
Idee
des
religiösen
Universalismus vor allem.
Was bedeutet religiöser Universalismus? Kurz gesagt, daß eine
Religion keinen begründbaren Anspruch auf universelle Geltung
erheben kann, solange es nicht gute Gründe für alle Menschen
gibt, an den Lehren dieser Religion teilzuhaben.
Das Christentum hat sich doppelt auf den Universalismus
48
in seinem Artikel "Religionsphilosophie" in Sacramentum Mundi IV, 250ff.
44
eingelassen: erstens durch die Heidenmission des Apostels
Paulus, durch die der Gott des Judentums zum Gott aller
Menschen wird. Zweitens durch die Verbindung mit der
Gedankenwelt der griechisch-römischen Antike, insbesondere mit
Plato
und
Aristoteles.
Beide
haben
eine
Gottesidee
favorisiert, die streng universal ist (das Gute, der Erste
Beweger).
Wenn ich aber (unter dem Einfluß des lumen naturale) nach dem
universalisierbaren Sinn von Dogma und Glaubenserzählung
frage, dann trete ich heraus aus dem lokalen Mythos (und ein
in die Sphäre der Menschheitssymbole).
Strasser: „Daß sich auf diesem Wege das Christentum auch
innerlich verändert, ist eine Tatsache. Nur so allerdings wird
es lebendig bleiben, immer voausgesetzt, die Welt hört nicht
auf, die Idee der Menschheit als einer Solidargemeinschaft
Schritt für Schritt zu entfalten.“ (AaO 33).
(3) Die Stellung und Funktion der Religion und der Kirchen
innerhalb der neuen politischen und gesellschaftlichen Welt
bildet
ein
drittes
bis
heute
ungelöstes
Problem
der
Religionsphilosophie. Nach der Aufklärung, die die Freiheit
aller zum Prinzip der Ethik und Politik erklärt und die
Verwirklichung solcher sittlicher, gesellschaftlicher und
politischer Institutionen fordert, die die Freiheit und das
Recht aller Menschen schützen und sichern, ist eine Deutung
des Verhältnisses der Religion und der Kirchen zur Politik und
Gesellschaft im Sinne der Politischen Theologie der Antike und
der
mittelalterlichen
Vorstellungen
unmöglich
geworden.
(Exkurs zur „Politische Theologie“-Debatte im 20.Jh.: Carl
Schmitt, Politische Theologie, 1922 / Erik Peterson, Der
Monotheismus als politisches Problem, 1935.)
Gegenwärtig spielt in der Öffentlichkeit die Frage der
Bewertung der sog. Säkularisierung immer noch eine Rolle.
(Säkularisierung ist – ganz allgemein gesprochen – Übergang
von kirchlichem zu weltlichem Besitzstand. Dieser kann als
unrechtmäßig oder aber auch im Interesse der Kirche verstanden
werden.) Eine Diskussion zwischen Jürgen Habermas und Josef
Ratzinger vom 19.Jänner 2004 in München49 ging von der
bekannten Frage Ernst Wolfgang Böckenfördes aus, ob der
freiheitliche, säkularisierte Staat nicht von normativen
Voraussetzungen zehre, die er selbst nicht garantieren
könne.50
J.Habermas, J.Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft
und
Religion. Mit einem Vorwort hrsg. v. Florian Schuller. Freiburg/Br.
2005.
50
E.W.Böckenförde,
Die
Entstehung
des
Staates
als
Vorgang
d.Säkularisierung (1967), in: ders., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt/M.
1991, S.92ff., 112.
49
45
Es ist vielleicht eine Überlebensfrage – im politischen Sinn
– , ob wir die Religionen nur als spezifisch kulturelle
Schöpfungen sehen, deren Lehren nicht auf der Basis interoder transkultureller Kriterien entscheidbar sind (im
Gegensatz zu den Lehren der Wissenschaft, der Technik und,
vielleicht, der Philosophie), oder ob wir den Dialog für
möglich halten und dementsprechend in Gang setzen. Meiner
Meinung nach ist damit eine immense bildungspolitische
Aufgabe verbunden. Denn den interreligiösen Dialog müssen wir
erst lernen.
Jürgen Habermas, der sich für die Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2001 mit einem
Vortrag über „Glauben und Wissen“ bedankt hat, formulierte es
so: „Wer einen Krieg der Kulturen vermeiden will, muss sich
die unabgeschlossene Dialektik des eigenen, abendländischen
Säkularisierungsprozesses in Erinnerung rufen. Der „Krieg
gegen den Terrorismus“ ist kein Krieg, und im Terrorismus
äußert sich auch der verhängnisvoll-sprachlose Zusammenstoß
von Welten, die jenseits der stummen Gewalt der Terroristen
wie d.Raketen eine gemeinsame Sprache entwickeln müssen.“ 51
Ich bin so optimistisch, zu glauben, dass wir auf diesem
Bildungsweg auch unsere eigene Tradition besser kennenlernen
werden; daß das „semantische Potenzial“ der biblischen
Tradition, das ebenfalls von Habermas neu ins Gespräch
gebracht wurde, besser als bisher ausgeschöpft werden kann.
Habermas bezieht sich auf „...Versuche...., das semantische
Potential des heilsgeschichtlichen Denkens in das Universum
der begründenden Rede einzuholen.“ 52 Insofern ist von der
Religionsphilosophie noch viel zu erwarten.
Ein literarischer Beleg dafür, daß es sich bei all dem nicht
um etwas Abseitiges, Verschrobenes handelt, sondern um etwas
völlig Aktuelles, im Zentrum des Geschehens in unserer
Gesellschaft: Václav Havel schreibt in seinen Briefen an Olga
(d.i. seine Frau) von Verantwortung 53:
"nur in der Verantwortung der menschlichen Existenz ist das,
was sie gewesen ist, was sie ist und sein wird, beruht ihre
Existenz. Mit anderen Worten: Wenn die menschliche Identität
der unverwechselbare Platz des "Ich" im Kontext des "NichtIch" ist, dann ist die menschliche Verantwortung das, was
diesen Platz bestimmt: die Beziehung des ersteren zum zweiten.
Patocka hat gesagt, daß das eigenartigste an der Verantwortung
ist, daß wir sie "überall" haben. ich glaube, das ist so, weil
überall die Welt von ihrem absoluten Horizont "umgeben" oder
"durchdrungen"
ist,
und
daß
wir
diesen
Horizont
nie
überschreiten oder hinter uns lassen noch vergessen können,
und sei er noch so verborgen (er ist übrigens immer verborgen:
er ist in allem und niemals an sich). Vielleicht ist er nur
J.Habermas, Glauben und Wissen, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2001, S.11.)
J.Habermas, Israel und Athen oder: Wem gehört die anamnetische
Vernunft? Zur Einheit in der multikulturellen Vielfalt. In: Diagnosen zur
Zeit, mit Beiträgen von Metz, Ginzel, Glotz, Habermas, Sölle. Patmos,
Düsseldorf 1994, S. 51-64. S.54f.
53 V.Havel, Briefe an Olga; Betrachtungen aus dem Gefängnis (Reinbek bei
Hamburg 1984, neu 1990), S.207.
51
52
46
unsere Idee - dann aber ist die ganze Welt unsere Idee. Liegt
aber etwas daran, ob wir das Wort "Sein" oder "Idee"
verwenden? Unserer Verantwortung entgehen wir damit nicht um
einen Millimeter...
Aber das wollen wir gar nicht, nicht wahr?"
In einem späteren Brief kommt Havel darauf zurück:
"Was den Brief 109 angeht: ja, auch ich hatte, gleich nachdem
er geschrieben war, das Gefühl, darin den "absoluten Horizont"
sehr flach geschildert zu haben. - Vielleicht war das eine
unwillkürliche Reaktion auf das zusätzliche Gefühl, daß ich
genau so einseitig (wenn auch in umgekehrtem Sinne) darüber in
einem meiner Briefe über den Sinn des Lebens geschrieben habe,
in dem ich seine "letzte" Quelle wieder zu sehr außerhalb der
Gesamtheit
plaziert
habe.
Vielleicht
gelingt
es
mir
irgendwann, eine Formulierung zu finden, die die verschiedenen
Dimensionen dieser verzwickten Sache besser erfaßt - dieses
"in"
und
"außerhalb",
dieses
"intim-dringlich"
und
"metaphysisch-abstrakt".
Es
ist
eigenartig:
als
innere
Erfahrung scheint mir das weit klarer, als wenn ich es dann sei es auf diese oder jene Weise - ausspreche. Immer ist es
mehr oder weniger blöd gesagt. Aber ich weiß - gerade deshalb
macht es mir wohl Spaß, immer und immer wieder darüber zu
schreiben!" 54
1.6
Nachbardisziplinen
Der Begriff "Religionsphilosophie" ist, wie auch der der
Philosophie, so vieldeutig, daß es kaum möglich ist, ihn
einigermaßen allgemeingültig und präzise zu definieren.
Klar ist jedoch, daß sich die Religionsphilosophie abgrenzt
auf der einen Seite von rein empirischen Untersuchungen der
Religionen
und
des
religiösen
Lebens,
wie
sie
die
Religionsgeschichte,
Religionsphänomenologie,
oder
Religionspsychologie bieten; auf der anderen Seite von der
systematischen
Darstellung
des
Gedankeninhalts
einer
bestimmten Religion, wie sie die Dogmatik liefert, oder von
der Erbauungsliteratur.
Jede geisteswissenschaftliche Darstellung enthält ja diese
drei Elemente: die Philosophie, die Geistesgeschichte und die
Systematik.
In der Philosophie wird das Sinngebiet und seine Kategorien
entwickelt, in der Geistesgeschichte wird das Material, das
die Seinswissenschaften darbieten, systematisch verstanden und
gruppiert,
in
der
Systematik
wird
auf
Grund
des
54
V.Havel, op.cit. 219.
47
philosophischen Wesensbegriffs und des geistesgeschichtlich
verstandenen
Materials
das
konkret-normative
System
dargestellt. So ergibt sich die Dreiheit von Philosophie der
Kunst, Geistesgeschichte der Kunst und normativer Ästhetik;
von
Philosophie
des
Erkennens,
Geistesgeschichte
der
Wissenschaft
und
normativer
Wissenschaftslehre;
von
Rechtsphilosophie, Geistesgeschichte des Rechts und normativer
Rechtslehre usf.
So
auch
die
Dreiheit
von
Religionsphilosophie,
Geistesgeschichte
der
Religion
und
systematischer
Religionslehre oder Theologie - bzw., in säkularisierter Form,
Religionswissenschaft (in dieser Wortbedeutung; es gibt
nämlich
noch
eine
andere
Wortbedeutung
von
Religionswissenschaft - als gemeinsames Dach aller mit der
Religion befaßten Wissenschaften).
Jede
Theologie
ist
abhängig
von
dem
vorausgesetzten
Wesensbegriff der Religion, und jede Religionsphilosophie von
dem Normbegriff der Religion, und beide von der Erfassung des
geistesgeschichtlichen Materials. Ohne die Heranziehung der
Geistesgeschichte und Theologie würde die Religionsphilosophie
abstrakt und undeutlich bleiben.
Die Sache ist aber noch etwas komplexer, als diese genannte
nützliche Einteilung erkennen läßt. Denn die Kategorien eines
Sinngebiets, aus denen eine Theorie entwickelt werden soll,
verweisen auf viele andere Einzelwissenschaften, die u.U. zu
einer ganzen Familie zusammengefaßt werden können. In unserem
Fall haben wir die Familie der Religionswissenschaft zur
Kenntnis zu nehmen.
Als
Einführung
nenne
ich
das
Büchlein
von
Günter
55
Lanczkowski.
Darin sind folgende religionswissenschaftliche Disziplinen
unterschieden:
- Religionsgeschichte
- Religionsphänomenologie
- Religionstypologie
- Religionsgeographie
- Religionsethnologie
- Religionssoziologie
- Religionspsychologie.
Dabei sind aus gutem Grund Theologie und Philosophie
ausgeklammert, sie stehen auf einer anderen Ebene.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nur einiges wenige zur
Religionsgeschichte, Religionssoziologie, Religionspsychologie
und Religionsphänomenologie sagen.
Günter
Lanczkowski,
Einführung
in
die
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1980.
55
Religionswissenschaft.
48
1) Religionsgeschichte
Von Geschichte im weiteren Sinn - Geschichte als res gestae,
von denen es bei Vergil heißt: sunt lacrimae rerum unterscheiden wir Geschichte im engeren Sinn - Geschichte als
Wissenschaft.
Eine "Einführung in die Religionsgeschichte" bietet ebenfalls
Günter Lanczkowski56, mit der wichtigsten Literatur dazu und
überblicksmäßigen Darstellungen der Religionen (jenen in der
Umwelt des Alten Testaments, des Neuen Testaments und der
Alten Kirche, der vorchristlichen Religionen des transalpinen
Europa
und
der
außereuropäischen
Religionen,
die
den
religiösen Pluralismus der Gegenwart mitprägen); aber auch mit
einem
Kapitel
"Religion
und
Geschichte"
(über
Geschichtlichkeit der Religionen, das Geschichtsbild der
Religionen, Periodisierungen der Geschichte, Religionen als
Geschichtsmächte).
Die Religionsgeschichte ist die unabdingbare Grundlage jeder
weiteren
religionswissenschaftlichen
Forschung,
und
ihr
Studium verweist zwangsläufig auf die literarischen Quellen,
die in den kanonisierten Texten heiliger Schriften vorliegen,
in Worten und Biographien großer Religiöser, in Mythen,
Inschriften, Hymnen und Gebeten. Wie für die Geschichte
schlechthin, so gilt auch für die Religionsgeschichte der Satz
von Karl Jaspers: "Es ist, als ob wir Boden gewinnen, wo ein
Wort zu uns dringt".57
Daraus folgt, daß Religionswissenschaft zu einem guten Teil
Philologie ist. "Ein Religionsforscher muß auch Sprachforscher
sein"58
Ein wirkliches Ernstnehmen der historischen Sicht ist fraglos
der beste Weg, einem Relativismus und Subjektivismus zu
entgehen, der sich mit Sicherheit einstellt, wenn, bewußt oder
unbewußt, der Standort des Betrachters zum Vergleichs- und
Wertmaßstab erhoben wird. Damit spreche ich einen für das
Verstehen
z.B.
das
Verstehen
fremder
Religionen
wesentlichen Begriff an: die epoché, d.h. die Enthaltung von
vorschnellen oder vorgefaßten Urteilen, und die Beschränkung
auf das, was wissenschaftlich feststellbar ist.
Standardwerke:
Jens Peter Asmussen - Jorgen Laessoe in Verb.m. Carsten Colpe,
Handbuch der Religionsgeschichte, 3 Bde, Göttingen 1971-1975.
Günter
Lanczkowski,
Einführung
in
die
Religionsgeschichte.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1983.
57 Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zit.n.d.TB-Ausg.
Frankfurt - Hamburg 1955, 38.
58 Friedrich Heiler, Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart
1961, 15.
56
49
Bde,
Mircea Eliade, Geschichte der religiösen Ideen. 3
Freiburg im Br. 1978f.
Carl Clemen (Hrsg), Die Religionen der Erde, 2.Aufl. 4 Bde
München 1966.
Friedrich
Heiler,
Die
Religionen
der
Menschheit
in
Vergangenheit und Gegenwart. 2.Aufl. Stuttgart 1962.
Hans-Joachim Schoeps, Religionen. Wesen und Geschichte.
Gütersloh 1961.
2) Religionssoziologie
Eine Einführung bietet Joachim Matthes59. Sie enthält sowohl
systematische
Überlegungen
zum
Thema
Religion
und
Gesellschaft, die Problemgeschichte der Religionssoziologie,
als auch Religionssoziologie heute und ausgewählte Texte zur
Religionssoziologie. Natürlich auch Literatur.
Wir stoßen auf die Religionssoziologie nicht nur dort und da,
weil sie jener Teilbereich der Soziologie ist, der die
gesellschaftlichen Bedingungen religiöser Phänomene sowie
umgekehrt die Wirkungen der Religion auf gesellschaftliche
Strukturen, kurz die Wechselbeziehungen zwischen Religion und
Gesellschaft erforscht. Sondern wir stoßen auf sie, weil diese
Disziplin aus religionskritischen Impulsen der Aufklärung
entstanden ist.
Heute dürfte eine anfängliche Überbewertung des Sozialen als
überwunden gelten. das Soziale an sich schafft keine Religion.
Es ist nicht so, daß sich eine Gruppe von Menschen
zusammentut, einen Orden gründet, ein Kloster baut, sich dem
monastischen Leben widmet - und dann nachträglich darüber
nachsinnt, wie dem allen ein ideologischer Überbau zu
verschaffen sei. Es ist aber auch nicht umgekehrt so, daß eine
abstrakte religiöse Idee vorgegeben wäre, eine Gruppe von
Menschen begeistert, und diese glaubt, nur im mönchischen
Leben die Ideale dieser Religion voll verwirklichen zu können.
Die Wechselbeziehung ist nicht einseitig auflösbar.
Begrenzt auf das, was sie leisten kann, und unter Verzicht auf
Theorien,
die
nicht
zu
verifizieren
sind,
hat
die
Religionssoziologie sehr wohl einen sinnvollen Platz innerhalb
der
Religionsforschung
und
kann,
was
für
einen
Religionswissenschaftler nun einmal das Wesentliche ist,
beitragen zur weiteren Erhellung von Bedeutung und Funktion
der Religionen.
Joachim Matthes, Religion und Gesellschaft. Einführung in die
Religionssoziologie I. rowohlts deutsche enzyklopädie, Reinbek bei Hamburg
1967.
59
50
In diesem Verständnis ist die Religionssoziologie von Ernst
Troeltsch und Max Weber eröffnet worden.60
3) Religionspsychologie
Eine "Einführung in die Religionspsychologie" bietet Ulrich
Mann.61 Mann kommt von der Tiefenpsychologie her, besonders
von der Schule C.G.Jungs.
Die
Religionspsychologie
ist
ein
Zweig
der
62
Religionswissenschaft, dessen Aufgabe es ist , "das Seelische
in und an der Religion zu verstehen." Die Religion ist die
übergeordnete,
objektiv
gegebene
Größe,
und
zu
ihren
mannigfaltigen Erscheinungsformen gehört auch die Erlebniswelt
des
Religiösen,
die
sich
in
gewöhnlicher
religiöser
Empfänglichkeit äußert wie auch in den außerordentlichen
religiösen Erlebnisformen der Berufung, der Vision und
Audition, des Wunders, der Ekstase und der Bekehrung.
Vorgegeben ist stets das numinose Objekt, das Heilige, die
Gottheit, und Aufgabe der Religionspsychologie ist es, den
Reflex auf die Erfahrung dieses Absoluten im Kreaturgefühl des
Menschen, in seiner Psyche zu studieren. Das war das Anliegen
des Hauptwerks von Rudolf Otto, über "Das Heilige".63
Als Vorstufen einer wissenschaftlichen Religionspsychologie
können religiöse Selbst- und Seelenbeobachtungen angesehen
werden, wie sie, um nur einige der bedeutendsten zu nennen,
vorliegen in Tertullians De anima, Augustins Confessiones, bei
mittelalterlichen Mystikern, in den Pensées Pascals und in den
Tagebüchern Sören Kierkegaards.
Demgegenüber
ist
die
Religionspsychologie
als
wissenschaftliche Disziplin noch sehr jung. Sie tritt erst
gegen Ende des 19.Jh. und Anfang des 20.Jh. in Erscheinung.
Die Anregungen kamen in erster Linie von der damaligen
nordamerikanischen Psychologie, vornehmlich von William James,
der Selbstzeugnisse religiöser Persönlichkeiten untersuchte,
dabei streng empirisch vorging und bestrebt war, Tatsachen
herauszustellen, und sich von Wertungen freizuhalten.64
Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen.
Tübingen 1912.
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 3 Bde, Tübingen
1920-1921. 4.Aufl.1947.
61 Ulrich Mann, Einführung in die Religionspsychologie. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt 1973.
62 nach van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, 3.Aufl.1970,785
63
Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des
Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Breslau 1917. 30.Aufl.
München 1958.
64 William James, The Varieties of religious Experience. Edinburgh 19011902;
deutsche
Ausgaben:
Die
religiöse
Erfahrung
in
ihrer
Mannigfaltigkeit, übers. u. hrsg. v. Georg Wobbermin. 4.Aufl. Leipzig
60
51
Auf
die
ersten
Anfänge
ist
ein
reges
Studium
religionspsychologischer
Fragen
gefolgt;
es
hat
seinen
Niederschlag in einer umfangreichen Literatur gefunden.65
Für eine den eigentlichen Aufgaben des Faches gerechte, von
jeder übertriebenen Psychologisierung freie Darstellung kann
aus neuerer Zeit in erster Linie die Religionspsychologie von
Wolfgang Trillhaas genannt werden.66
An Periodica gibt es das
American Journal of Religious Psychology, 1904ff.
Archiv für Religionspsychologie, 1914ff.
Zeitschrift für Religionspsychologie, 1928ff.
Es wäre eine Illusion, man könne Religion mit Hilfe von
Reaktionen psychologischer und naturalistischer Art oder gar
mit Hilfe von Begriffen wie Sublimierung, Kompensierung,
Angst, Krisis und ähnlichen "erklären" (schlimmer noch:
auflösen).
Sigmund Freud, dessen Tiefenpsychologie ihn zu der kühnen
Behauptung führte, Religion sei eine "Zwangsneurose", findet
vereinzelt immer wieder Anhänger. Dagegen hat sich Carl Gustav
Jung von Freud getrennt und war zunehmend vorsichtiger darin
geworden,
mit
seinen
Urbildern
oder
"Archetypen"
den
Gottesglauben erfassen zu können.67
4) Religionsphänomenologie
Eine "Einführung in die Religionsphänomenologie" - gibt es von
Günter Lanczkowski.68
Der Bezug zur Religionsphilosophie ist darin gelegen, daß die
Religionsphänomenologie jener Zweig der Religionsforschung
ist, dessen Aufgabe es ist, die Stoffülle zu vergleichen und
aufzugliedern, der eben als hermeneutisches Mittel generell
den Vergleich verwendet und so der Wesenserfassung und dem
Verstehen dienen will. Damit steht diese Wissenschaft in einem
umfassenden Rahmen, der jedes Verstehen eines Fremden
betrifft, das zunächst ein In-Beziehung-Setzen zu einem
bereits
Bekannten
darstellt.
Wofür
wir
keinerlei
Vorverständnis haben, das entzieht sich unserer Möglichkeit
des Begreifens als totaliter aliter. Die Übersetzung selbst
1925. - Die Vielfalt religiöser Erfahrung, übers. u. hrsg. v. Eilert
Helms. Olten u. Freiburg i.Br. 1979.
65 Nach früheren Arbeiten von Richard Müller-Freienfels, Karl Girgensohn,
Paul Hoffmann wäre zu nennen:
Willy Helpach, Grundriß der Religionspsychologie. Stuttgart 1951. Hjalmar
Sundén, Die Religion und die Rollen. Eine psychologische Untersuchung der
Frömmigkeit. Berlin 1966.
66
Wolfgang Trillhaas, Die innere Welt. Religionspsychologie. 2.Aufl.
München 1953.
67 C.G.Jung, Psychologie und Religion. Zürich 1946.
68
Günter
Lanczkowski,
Einführung
in
die
Religionsphänomenologie.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978.
52
einer einzigen Vokabel aus einer fremden Sprache wäre ohne
Vergleichsmöglichkeit nicht denkbar.
Wegen ihrer vergleichenden Methode wurde die Religionsphänomenologie häufig "vergleichende Religionswissenschaft"
genannt, englisch "Comparative Religion" (auf das gesamte
Gebiet der Religionswissenschaft ausgedehnt); ein lesenswertes
Buch von Joachim Wach heißt "Vergleichende Religionsforschung".69
Die Anfänge phänomenologischer Betrachtung gehen auf das
Mittelalter zurück. In erster Linie ist hier Thomas von Aquino
(1225-1274) zu nennen. Seine im Jahr 1264 abgeschlossene
"Summa contra gentiles" war durch den Konflikt der spanischen
Christen mit den islamisch-maurischen Herren ihres Landes
ebenso angeregt worden wie durch die islamische Form des
Aristotelismus, die vornehmlich Avicenna und Averroes geprägt
hatten und die damals an den europäischen Universitäten einen
bedeutenden Einfluß ausübte.
Roger Bacon (1214-ca.1292), ein Zeitgenosse des Thomas und in
vielem ein Außenseiter der damaligen Theologie, drang um der
religionsgeschichtlichen Erkennntis willen auf ein Studium der
Religionssprachen, und er hielt, um den Wahrheitsgehalt des
Christentums als einer speziellen und übernatürlichen im
Unterschied zur natürlichen Offenbarung zu erweisen, einen
Vergleich mit anderen Religionen für notwendig.
Nikolaus von Kues (1401-1464) ist ebenfalls hier zu nennen mit
seinem 1453 erschienenen "De pace fidei", dem fingierten
Gespräch zwischen Vertretern verschiedener Nationen und
Religionen.
Martin Luther (1483-1546) hat die Mißbräuche der kirchlichen
Praxis
seiner
Zeit
in
systematischer
Weise
in
einen
religionsgeschichtlichen Zusammenhang gestellt. In seiner
Religionskritik,
die
er
vornehmlich
im
Kommentar
zum
Römerbrief und im Großen Katechismus anläßlich der Auslegung
des ersten Gebotes zum Ausdruck brachte, faßte er "Heiden",
"Juden" und "Türken" als einheitliche Größe zusammen. Mit dem
heidnischen
Polytheismus
stellte
er
die
katholische
Heiligenverehrung auf eine Stufe, da man mit ihr "die Heiligen
zu Göttern" gemacht habe.70
Wie man sieht, ist das Vergleichen in engem Zusammenhang mit
dem Unterscheiden zu sehen, und damit auch mit der Kritik.
Es ist auch unumgänglich für den interreligiösen Dialog.
Von Religionsphänomenologie als religionswissenschaftlicher
Disziplin, die man auch vergleichende Religionswissenschaft
nennen kann, ist zu unterscheiden die Phänomenologie als
Joachim Wach, Vergleichende Religionsforschung. Stuttgart 1962.
Originaltitel: The Comparative Study of Religions, Columbia University
Press, New York 1958.
70 Martin Luther, Erlanger Ausgabe, 2.Aufl. Bd.11, 16.
69
53
eigenständige philosophische Bewegung und vor allem Methode,
die als solche am Anfang des 20.Jh. von Edmund Husserl
begründet worden ist. Husserl wollte mit seiner deskriptiven
Methode
„das
prinzipielle
Organon
für
eine
streng
wissenschaftliche Philosophie“ liefern und „in konsequenter
Auswirkung eine methodische Reform aller Wissenschaften“ (IX,
277) ermöglichen.
Ich gehe darauf nicht weiter ein, verweise aber auf das sehr
hilfreiche Werk: Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe.
Unter Mitwirkung von Klaus Ebner und Ulrike Kadi herausgegeben
von Helmuth Vetter, Hamburg 2004.
Weiters mache ich aufmerksam auf einen Aufsatz von Jean-Luc
Marion, in dem auf die Hauptschwierigkeit angesichts des
Phänomens Religion eingegangen wird, nämlich ob es möglich
ist, einen Begriff der „Offenbarung“ einzuräumen.
Martin Heidegger hat das Phänomen als „das Sich-an-ihm-selbstzeigende, das Offenbare“ gedeutet.71 Wie verhält sich dieser
philosophische Begriff des „Offenbaren“ (und der Wahrheit als
„entdeckend-sein“) zum theologischen Begriff „Offenbarung“?
In diesem Sinn frägt Marion: „Wenn es der Phänomenologie,
indem sie Phänomene ohne die voraufgehende Bedingung einer
causa sive ratio, aber als solche und soweit sie gegeben
sind, erkennt, wenn es also der Phänomenologie gelänge, zu
den Sachen selbst zurückzukehren, käme sie dann nicht par
excellence
darauf,
den Gedanken der Offenbarung ganz
allgemein frei zu legen?“72
5) Historisch-philologische Wissenschaften
Im Blick auf Marcus Tullius Cicero nun können wir aus all den
genannten Disziplinen wertvolle Hilfen zum Verständnis seiner
Religionsphilosophie gewinnen; zu allererst und am meisten
müssen wir uns aber auf die historischen Disziplinen stützen;
schließlich ist er ein Autor aus dem ersten Jh. v.Chr. Ich
spreche von einer Mehrzahl, weil die Fülle des Materials
natürlich eine Aufteilung nach zeitlichen, geographischen,
sprachlichen etc. Gesichtspunkten notwendig gemacht hat. Im
Zentrum des römischen Weltreichs strömte vieles zusammen (Mit
einem schon in der Antike geprägten Bild gesprochen: in den
Tiber mündeten damals schon der Nil, der Euphrat, die Donau,
die Rhone und der Ebro).
(1) die sog. Oikuméne, die "bewohnte Welt" der Griechen, die
Martin Heidegger, Sein und Zeit, 11.Aufl. 1967, S.28ff.: „Der Begriff
des Phänomens“.
72 Jean-Luc Marion, Aspekte der Religionsphänomenologie: Grund, Horizont
und Offenbarung. In: A.Halder, K.Kienzler, J.Möller (Hrsg.),
Religionsphilosophie heute. Chancen und Bedeutung in Philosophie und
Theologie, Düsseldorf 1988, 84-103, 87
71
54
zur Zeit des Cicero bereits dem Römischen Imperium einverleibt
war. Daher fällt unsere Vorlesung in den Zuständigkeitsbereich
der
Klassischen
Altertumswissenschaft
mit
ihren
Unterabteilungen. Wir brauchen hier nicht näher darauf
einzugehen, was alles heranzuziehen ist, von der historischen
Grammatik
über
Etymologie,
Stilistik,
Literatur,
die
archäologischen
Disziplinen
bis
zur
Mythologie.
Einige
Standardwerke sollten aber zur Kenntnis genommen werden.
- Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft
- Martin P.Nilsson, Geschichte der griechischen Religion.
2 Bde. 3.Aufl. München 1967-1974.
- Kurt Latte, Römische Religionsgeschichte. 2.Aufl. München
1967.
- Friedrich Überweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie.
(1862-1866) - mit vielen Neuauflagen, z.B.: 1.Teil: Die
Philosophie des Altertums. Hrsg.v.Karl Praechter. 12.Aufl.
Berlin 1926. Inzwischen ist eine völlig neu bearbeitete
Ausgabe im Schwabe & Co AG Verlag Basel/Stuttgart in
Erscheinung begriffen.
- Wilhelm Totok, Handbuch der Geschichte der Philosophie. I
Altertum. Frankfurt a.M. 1964. II Mittelalter, 1973.
(2) die sog. Golá, die Diaspora des Judentums. Städte des
Mittelmeerraums wie z.B. Alexandria waren bis zu einem Drittel
von Juden bewohnt. In dieser Gruppe ist die Begegnung von
griechischer Philosophie und biblischer Religion grundgelegt
worden.
Darüber
belehrt
uns
die
Judaistik;
einige
Standardwerke:
- Wilhelm Bousset - Hugo Gressmann, Die Religion des Judentums
im späthellenistischen Zeitalter. 3.Aufl. Tübingen 1926;
Neudruck 1966.
- Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter
Jesu Christi. 4.Aufl. 3 Bde. Leipzig 1901-1909.
- Kurt Schubert, Die Religion des nachbiblischen Judentums.
Freiburg i.Br./Wien 1955.
- ders., Die Kultur der Juden. I. Israel im Altertum.
(Handbuch
der Kulturgeschichte, begründet von H.Kindermann, neu
hrsg.v.
E.Thurnher). Akademische Verlagsges. Athenaion, Frankfurt am
Main 1970.
- Julius Guttmann, Die Philosophie des Judentums. 1933.
Nachdruck: Fourier Verlag, Wiesbaden 1985.
(3) die hellenistische Welt, also der Begegnungs- und
Vermischungsraum von orientalischer und griechisch-römischer
Kultur, für dessen Erhellung die Orientalistik unentbehrlich
55
ist.
- Franz Cumont, Die orientalischen Religionen im römischen
Heidentum. 3.Aufl. Leipzig/Berlin 1931.
- Ders., Die Mysterien des Mithra. 4.Aufl. Darmstadt 1963.
- R.Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen.
Leipzig 3.Aufl. 1927. Nachdruck: Darmstadt 1956.
(4) Darin stellt einen Sonderfall die sog. Gnosis dar, die
teils als Grundströmung und immer wieder neu auflebende
Tendenz, teils als selbständige Weltreligion - im Manichäismus
- auftritt. Wichtige Arbeiten zur Gnosis-Forschung sind etwa:
- Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist. Teil 1: Die
mythologische Gnosis, mit einer Einleitung zur Geschichte
und
Methodologie der Forschung. Göttingen 1934, 1954, 1964 mit
Ergänzungsheft zur 1. u. 2.Aufl. Teil 2/1: Von der
Mythologie
zur mystischen Philosophie. Göttingen 1954, 1966.
- R.Haardt, Die Gnosis. Wesen und Zeugnisse. Salzburg 1967.
- Geo Widengren, Mani und der Manichäismus. Stuttgart 1961.
- Kurt Rudolph, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer
spätantiken Religion. 3.Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht in
Göttingen (UTB 1577) 1990.
- Peter Sloterdijk / Thomas H.Macho (Hg.), Weltrevolution der
Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der
Spätantike bis zur Gegenwart. 2 Bde., Artemis & Winkler
(Mohndruck Gütersloh) 1991.
(5) Ein anderer Sonderfall sind dissidente Gruppen des
Judentums, wie die Gemeinde von Qumran am Toten Meer.
Verwandte Gruppen waren die Essener in Ägypten, im Blickfeld
der Alexandriner. Auch der Qumran-Forschung widmete sich eine
große Zahl von Gelehrten. Einer von ihnen ist der Wiener
Judaist:
- Kurt Schubert, Die Gemeinde vom Toten Meer. München/Basel
1958. Und einer seiner Schüler, Emeritus in Köln:
- Johann Maier, Die Texte vom Toten Meer, I. Übersetzung, II.
Anmerkungen, 1960.
1.7 Unser Paradigma für Religionsphilosophie: Warum gerade
Cicero?
Alle drei genannten Motive, sich mit Religionsphilosophie zu
befassen - das Bewußtsein von der Geschichtlichkeit der
Religion,
ihr
politisches
Moment
(die
staatspolitische
Notwendigkeit der Toleranz) und ihre Relativierung durch
andere Religionen - haben einen interessanten
Cicero. Zunächst reizt aber folgendes besonders:
Bezug
56
auf
M.T.Cicero hat nach Meinung vieler neuerer Philosophen mit
Philosophie überhaupt nichts zu schaffen. In dieser Behauptung
aber wird weniger ein vernünftiges und begründbares Urteil
laut als vielmehr eine historisch gegründete Meinung, die
freilich auch deswegen nicht an Richtigkeit zugewinnt, weil
sie in vieler Munde ist. Die historische Bedingtheit für so
ein krasses Fehlurteil wird uns noch befassen. Von vornherein
sollte aber zu denken geben, welche besondere Stellung Cicero
in der Philosophiegeschichte einnimmt. Und Geschichte der
Philosophie sollte man doch als ein Moment ihres Prozesses
selbst begreifen!
Darum wäre es unvernünftig, jenen Augenblick von vornherein zu
unterschätzen, oder gar zu übergehen, in dem die griechische
Philosophie - die in einzelne Schulen zerfallen war - in ihrer
Einheit, und damit auch in ihrem Begriff sich wiederfindet natürlich nicht mehr als dieselbe, sondern gebrochen, durch
das Okular der römischen Sprache und Kultur. Es ist Cicero,
bei dem dieser historische Moment eintritt. Die Frage ist, ob
Cicero die historische Gelegenheit als solche erkannt und
genutzt hat: Es ist die Frage nach der Einsicht in die
Notwendigkeit der Vermittlung der auftretenden Widersprüche.
Eckhard Keßler73 hat sie positiv beantwortet, indem er Cicero
als denjenigen bestimmte, "der die Philosophie aus Schulstreit
und Monoglottie in die potentielle Universalität befreite".74
Die Bedingung dafür ist bei Cicero dessen Bestimmung des
menschlichen Geistes und der sapientia: in ihr sind sowohl die
Freiheit als auch die Abhängigkeit von einer, für Cicero
material bestimmten historischen Realität wesentlich.75
2. Cicero: Mensch - Politiker - Schriftsteller - Philosoph
__________________________________________________________
2.1 Der Mensch Cicero - Grundzüge seines
Gedankenwelt als exemplum humanitatis.76
Wesens.
Ciceros
Eckhard Keßler, Autobiographie als philosophisches Argument? Ein Aspekt
des
Philosophierens
bei
Cicero
und
die
gegenwärtige Praxis der
Philosophie, in "Studia humanitatis", Festschrift
für Ernesto Grassi,
hrsg.v. E.Hora u. E.Keßler, München 1973, S.173-187.
74 o.c. 174.
75 Vgl. Josef Mancal, Zum Begriff der Philosophie bei M.Tullius Cicero.
Wilhelm Fink Verlag München 1982 (Humanistische Bibliothek, Reihe I:
Abhandlungen, Bd. 39, hrsg. v. E.Grassi u. E,Keßler).
76 Büchner, Karl: Studien zur römischen Literatur. Bd.2: Cicero. Wiesbaden
73
57
Die Biographie Ciceros im Stenogrammstil:
Geboren 106 v.Chr. in Arpinum, kam Cicero durch seine
Erziehung in Rom mit der geistigen Welt des Scipionenkreises
in Berührung, der er zeitlebens verbunden blieb. Als Redner
rasch
bekannt
geworden
(seinen
Hauptrivalen
Hortensius
besiegte er endgültig im Jahr 70 im Verresprozeß), gewann er
einen großen Anhang, so daß er, obwohl homo novus, alle
römischen Ämter erlangte und 63 Konsul wurde. (In dieses Jahr
fällt die Aufdeckung der catilinarischen Verschwörung). Nach
diesem dank einer einmaligen Machtkonstellation erreichten
Erfolg sah er sich bald unter bitter empfundenen Demütigungen
aus den Staatsgeschäften verdrängt. Im Bürgerkrieg 49/7 auf
seiten des Pompeius, wurde Cicero von dem siegreichen Caesar
geschont, konnte aber unter ihm nicht politisch tätig sein.
Nach Caesars Ermordung (März 44) nahm er den Kampf gegen
Antonius auf, der v.a. durch seine sog. Philippischen Reden
dokumentiert wird. Auf des Antonius Betreiben wurde er
proskribiert und im Dez. 43 ermordet.
Ciceros Biographie ist so gut dokumentiert wie kaum eine
andere, einmal dank einer Unzahl persönlicher Briefe - an den
Freund Atticus, an den Bruder Quintus, an andere Verwandte,
Freunde, u.a.,
zum anderen weil sein literarisches Oeuvre
großteils zugleich seinen politischen Kampf darstellt. Man
kann also den Originaldokumenten alle Farbe entnehmen, um sein
Bild zu malen.
Ich werde mich nicht darüber verbreitern, nur ein paar Details
und Episoden nennen.
(1) In einer Prozeßrede sagt Cicero einmal über sich selbst:
"Mir
stand
nicht
das
gleiche
offen
wie
denen,
die
hochwohlgeboren sind, denen die Ehren und Auszeichnungen des
römischen Volkes im Schlaf zufallen; ich mußte unter einem
ganz anderen Gesetz und anderen Bedingungen hier in diesem
Staat leben." 77 Damit ist gemeint: Cicero gehörte dem
römischen Ritterstand an, dem ordo equester, der in der
politischen Rangordnung die zweite und minder angesehene
Stellung einnahm nach der sog. Nobilität, einem exklusiven
1962. Kap.1: Cicero, Grundzüge seines Wesens.
Büchner, Karl (Hg): Das neue Cicerobild. Wege der Forschung XXVII.
Darmstadt 1972.
Gelzer, M., Kroll, W., Philippson, R., Büchner, K.: M.Tullius Cicero. In:
(Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, Hg) Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft VII A, 1939.
Seel, Otto: Cicero. Wort, Staat, Welt. Stuttgart 1953.
Giebel,
Marion:
Marcus
Tullius
Cicero
in
Selbstzeugnissen
und
Bilddokumenten dargestellt. Reinbek bei Hamburg 1977
Gelzer, Matthias: Cicero. Ein biographischer Versuch. Wiesbaden 1969.
77
In Verrem II 5, 180.
58
Kreis miteinander versippter stadtrömischer Adelsfamilien, die
fast ausschließlich die Beamten für die Staatsverwaltung
stellten: Konsuln, Praetoren, Prokonsuln und Zensoren, die das
Imperium Romanum in der Form einer aristokratisch geführten
Republik regierten. Aus diesen Magistraten rekrutierte sich
dann der Senat, dem als kontinuierlichem Verfassungsorgan
neben den jährlich wechselnden Beamten das stärkste politische
Gewicht zukam.
Der Einfluß der Politiker basierte neben der Unterstützung
durch die befreundeten und verwandten Adelsfamilien vor allem
auf der Institution der Klientel, einem Gefolgschaftswesen
besonderer Art. Die Klienten, sozial niedriger stehende Bürger
aus Stadt und Land, begaben sich in den Schutz des adeligen
Patrons, der ihre Interessen wahrnahm. Dafür gaben die
Klienten dem Patron ihre Stimme bei den Wahlen und bildeten
sein Gefolge bei politischen Auftritten. Das Ansehen eines
Politikers wurde unter anderem danach bemessen, wieviel Leute
sich beim Morgenempfang in seinem Hause drängten.
Verwandtschafts-, Gefolgschafts- und Gefälligkeitsbindungen
spielten die entscheidende Rolle im politischen Leben. Ein
junger Mann, der in Rom Karriere machen wollte, ohne aus einer
der führenden Adelsfamilien zu stammen und ohne eine illustre
Reihe von Verwandten in den höchsten Staatsämtern aufweisen zu
können, befand sich von vornherein in der Außenseiterrolle. Er
war der homo novus, der neue Mann, der Emporkömmling, der
meist zeit seines Lebens nicht als völlig ebenbürtig galt.
Cicero
war
ein
solcher
homo
novus,
ein
politischer
Selfmademan. Der Kampf um Anerkennung hat ihn geprägt. Er hat
die Probleme seines neuen Standes besonders kritisch und
distanziert zu sehen vermocht und gleichzeitig dessen Normen
und Wertbegriffe am hartnäckigsten verteidigt. Er forderte am
leidenschaftlichsten
die
politische
und
moralische
Regeneration des Senatorenstands und wurde nicht müde, diese
als
Voraussetzung
eines
gesunden
und
leistungsfähigen
Staatswesens ins Bewußtsein aller zu bringen. In Rom wurde er
deshalb spöttisch der "Romulus aus Arpinum" genannt. Damit
kommen wir zu einem zweiten Punkt:
2)
Cicero
entwickelt
ein
neuzeitlich
anmutendes
Heimatbewußtsein. Er bekennt sich zu seinem Heimatort Arpinum
und setzt ihm in seiner Schrift De legibus (Von den Gesetzen)
ein Denkmal. Er erzählt dort seinem Freund Atticus, daß er so
gern in Arpinum weilt,
"denn hier ist eben genau genommen die eigentliche
Heimat für mich und meinen Bruder. Von hier stammen wir, aus
einer
alten,
eingesessenen
Familie,
hier
sind
unsere
Familienheiligtümer, hier steht unser Stammhaus und alles, was
an die Vorfahren erinnert. Was soll ich noch viele Worte
machen? Du siehst hier das Gutshaus, so wie es jetzt ist,
etwas ansehnlicher umgebaut von meinem Vater, der seine Sorge
59
darauf verwandt hat. Hier hat er sein Leben mit seinen Büchern
verbracht, mit seiner Gesundheit stand's nicht zum Besten. Und
hier an diesem Ort bin ich geboren, als der Großvater noch
lebte und das Haus noch klein und bescheiden war, wie eben
damals üblich, ganz wie das Häuschen des Curius im
Sabinerland. Darum steckt etwas tief in mir, weshalb mir der
Aufenthalt an diesem Ort so ganz besonders wohltut. Aber
schließlich hat es ja auch seinen Grund, daß, wie es heißt,
jener berühmte kluge Mann die Unsterblichkeit zurückgewiesen
hat, nur um sein Ithaka wiederzusehen." 78
Nach Cicero hat jeder Bürger eines municipiums, einer
Landstadt eine zweifache Heimat: Rom, dessen Bürgerrecht er
besitze und dem jeder seine Dienste widmen müsse, und den Ort,
der ihn gezeugt habe. Das ist eine Vorform der späteren,
christlichen Auffassung von der zweifachen Heimat, wie sie der
Diognetbrief klassisch formuliert: Christen sind "in der Welt,
nicht von der Welt" (auch bei Cicero fehlt der Hinweis auf das
Religiöse nicht: er weist auf die Familienheiligtümer hin;
aber auch wenn er das nicht täte, würde die Erwähnung der
Vorfahren genügen.)
Das letzte Wort in Ernst Blochs Werk "Prinzip Hoffnung" ist
das Wort "Heimat". Blochs "Geist der Utopie" nimmt so bezug
auf den alteuropäischen religiösen Gedanken der Gebundenheit
an einen Ort.
3) Ein drittes Schlaglicht soll auf etwas verweisen, das schon
den jungen raffinierten Anwalt und glänzenden Redner von
anderen unterschied: seine Auffassung von Humanität. Die
griechische Philosophie und ihr Menschenbild hat in das
römische Denken Eingang gefunden und ist mit ihr eine
einzigartige Verbindung eingegangen. Hören Sie das Zitat vom
Schluß einer Verteidigungsrede (Pro Roscio Amerino):
"Jeder von euch sieht, daß das römische Volk, das früher
als besonders milde gegen seine Feinde galt, jetzt an dem Übel
der Grausamkeit gegen die eigenen Bürger leidet. Verbannt sie
aus dem Staat, ihr Richter, laßt sie nicht länger hier in
unserem Staatswesen herrschen! Sie brachte nicht nur das
Unglück mit sich, so viele Bürger auf die gräßlichste Art
hingerafft zu haben, sie hat auch die Mildherzigsten durch die
dauernde Gewöhnung an die Greuel dem Mitleid entfremdet. Denn
der ständige Anblick der grausigen Geschehnisse raubt uns und selbst den sanftesten Naturen unter uns - durch den
unablässigen Druck der Leiden jeden Sinn für Menschlichkeit
(humanitas)." 79
Zur Erläuterung muß man zunächst sagen, daß Cicero Glück hatte
mit seiner Ausbildung.
Seine Familie hatte ganz gute Beziehungen zu Senatorenkreisen
78
79
De leg II 3.
Pro Roscio Amerino 154.
60
in Rom, und die nutzte der Vater, um seinen Söhnen die
bestmögliche Erziehung angedeihen zu lassen. Der junge Marcus
erwies sich nicht nur als hochbegabt, sondern auch als sehr
ehrgeizig. Seine Maxime war, mit den Worten Homers, "immer der
erste zu sein und sich auszuzeichnen vor andern"80 Im Jahr 90
v.Chr. empfing Cicero aus den Händen des Vaters die Toga
virilis, die Männertoga. Das war ein feierlicher Akt, der den
Eintritt in die Erwachsenenwelt bezeichnete. Der junge Mann
wurde in festlichem Zug aufs Forum geleitet, und dort erfolgte
die Eintragung in die Bürgerliste. Anschließend wurde er der
römischen Sitte gemäß in der Form der deductio führenden
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beigegeben. In deren
Gefolge wurde er Zeuge des Wirkens der Politiker auf dem Forum
und im Senat und lernte so die politische Praxis kennen.
(Ähnlich wie heute so manche politische Karriere mit der
Aufgabe eines Sekretärs eines wichtigen Politikers beginnt.)
Der hochverehrte Lucius Licinius Crassus, mit dem die Familie
Ciceros befreundet war und nach dessen Richtlinien für die
Redekunst Marcus lernte, war 91 gestorben, und Cicero kam zu
einem berühmten Rechtsgelehrten, dem Augur Quintus Mucius
Scaevola. Dieser war schon hochbetagt. Er hatte im Jahr 117
das Konsulat innegehabt. Cicero nahm an den Rechtsberatungen
des Scaevola teil und legte damit den Grundstein zu seiner
profunden Kenntnis des privaten und öffentlichen Rechts.
Zugleich lernte er im Haus des Scaevola die führenden Männer
seiner Zeit kennen. Das Wichtigste aber war die Verbindung des
alten Scaevola mit der Ideenwelt des Scipionenkreises und die
grundlegende
geistige
Prägung,
die
Cicero
aus
dieser
lebendigen römischen Tradition heraus erhielt. Scaevolas
Schwiegervater war Laelius gewesen, der hochgebildete und
feinsinnige Freund des jüngeren Scipio Africanus, des
Zerstörers
von
Karthago.
Um
diesen
Scipio,
eine
der
berühmtesten Persönlichkeiten Roms, hatte sich ein Kreis
führender Männer gebildet, Griechen wie Römer, die in ihrer
Aufgeschlossenheit
für
die
geistigen
und
kulturellen
Strömungen ihrer Zeit die erste und zugleich äußerst
bedeutungsvolle Begegnung des Römischen mit dem Geist des
Griechentums ermöglichten.
Ciceros Appell an die humanitas verweist weiters auf seine
eigene Erfahrung: Nach dem Tod des alten Augurs Scaevola
setzte Cicero seine Ausbildung bei dessen Verwandten, dem
Pontifex Maximus Quintus Mucius Scaevola fort. Dieser wurde
im Jahr 82 ermordet. In den Jahren 90/89 v.Chr. war Cicero
Soldat im Bundesgenossenkrieg. Die Italiker - sie besaßen nur
den rechtlichen Status von Bundesgenossen - hatten, nachdem
ihnen das römische Bürgerrecht verweigert worden war, 91 einen
blutigen Krieg entfesselt, der ihnen nach hohen Verlusten auf
80
Ilias VI 208 – ad Quintum fratrem III, 5,4.
61
beiden Seiten 89 die Gleichstellung mit den Römern brachte.
Doch dieser Krieg war nur der Auftakt zu einem Jahrhundet
politischer Wandlungen und gewaltsamer Veränderungen, in dem
die römische Republik, von Kriegen und innenpolitischen Wirren
erschüttert, schließlich durch die Herrschaft eines einzelnen
Mannes abgelöst wurde.
Im Anschluß an den Bundesgenossenkrieg wurde Rom von äußeren
Gefahren bedroht. Die Kimbern und Teutonen standen an den
Grenzen Italiens. Um dieser Gefahr zu begegnen, wählte der
Senat Gaius Marius, wie Cicero ein homo novus aus Arpinum,
fünfmal
hintereinander
zum
Konsul
(104-100).
Er
war
erfolgreich, hatte damit aber so viel Macht gewonnen, daß er
sie
nicht
mehr
abzugeben
bereit
war.
Es
kam
zur
Auseinandersetzung
mit
Sulla,
eine
Zeit
wechselnder
Schreckensherrschaften und Strafgerichte mittels der sog.
Proskription.
In einer solchen Zeit begann die Karriere Ciceros. Er setzte
relativ
spät
ein,
dafür
bestens
vorbereitet.
In
aufsehenerregenden politischen Prozessen vermochte er die
Popularität zu erringen, die für die von ihm angestrebte
übliche Ämterlaufbahn vonnöten war. Er profilierte sich
politisch. In Rom war es - im Unterschied zu Griechenland nicht der Angeklagte selbst, der in einem Prozeß das Wort
ergriff,
sondern
dessen
Anwalt,
der
somit
die
volle
Verantwortung für seinen Klienten trug. Er war der patronus,
und das Verhältnis zwischen Klient und Anwalt war auf fides,
auf Treue und Pflichtbewußtsein, gegründet. (In der römisch
katholischen Kirche hat fides, Glauben, bis heute diese
dominierende Konnotation). Ein Anwalt konnte sich auf diese
Weise eine Klientel schaffen, was besonders für einen homo
novus, der nicht von seiner Familie her bereits eine große
Anhängerschaft besaß, von ausschlaggebender Bedeutung war.
In der konkreten Rede Pro Roscio bestand die Kunst v.a. darin,
gegen Parteigänger des Sulla zu gewinnen, ohne den Mächtigen
selbst zu provozieren. Cicero bewältigte das, indem er Sulla
soweit wie möglich heraushielt.
Er stellte ihn dar als einen in den Staatsgeschäften
aufgehenden Mann, der für die Taten eines jeden seiner Sklaven
ebensowenig verantwortlich zu machen sei wie Jupiter für Sturm
und Unwetter. Dem Angeklagten Roscius war nämlich der Mord am
Vater in die Schuhe geschoben worden, vermutlich von den
Mördern selbst, die so an das Vermögen des Ermordeten
herankommen wollten. Doch vermeidet Cicero keineswegs die
Auseinandersetzung mit der politischen Situation. Er bekennt
sich zum Sieg der von Sulla geführten Nobilität - nachdem der
von ihm gewünschte Vergleich gescheitert sei - , doch wenn
dieser Sieg in Terrorakten und dem Emporkommen solcher
Kreaturen wie Chrysogonus bestehe, so sei er verloren und
verschenkt.
62
An die Nobilität richtet Cicero ernste Ermahnungen: Wenn sie
nur von Eigennutz und Gewinnstreben geleitet sei, werde sie
ihre Vomachtstellung nicht halten können. Sie werde sie
vielmehr mit denen teilen müssen, die nicht der Geburt, aber
ihrer
Gesinnung
und
Handlungsweise
nach
als
nobiles
anzusprechen
seien.
Das
ist
nicht
nur
ein
aktueller
politischer Wink, daß die rein senatorisch besetzten Gerichte
wieder abgeschafft werden und die Ritter wieder Zugang zum
Geschworenenamt erhalten könnten, es ist Ciceros feste
Überzeugung, die er während seines ganzen Lebens vertritt: Die
Nobilität darf ihren Vorrang nicht der Geburt und Abstammung
verdanken, den wahren Adel erwirbt man nur im Dienst der res
publica, und man kann auch ein nobilis sein, ohne aus der
Adelsclique zu stammen. Diese Gedanken verdichten sich später
zu Ciceros politischem Programm der concordia ordinum, der
Eintracht zwischen Senat und Ritterschaft und steigern sich
weiter zum consensus omnium bonorum, dem Zusammenschluß aller
staatserhaltenden Kräfte, zu denen Cicero in seiner großen
Rede für Sestius Männer aller Stände, ja sogar Freigelassene
rechnet.
Der aufsehenerregende Prozeß endete mit einem Freispruch.
Plutarch berichtet, daß Cicero anschließend, um der Rache des
Sulla und des Anklägers zu entgehen, zu einem zweijährigen
Studienaufenthalt nach Griechenland und Kleinasien reiste.
Cicero selbst begründet die Reise mit seiner angegriffenen
Gesundheit. Der Studienaufenthalt in Griechenland gehörte zum
Ausbildungsprogramm des jungen Römers, und im Fall Ciceros war
er durch die Bürgerkriegswirren verzögert worden. Von den
Vorlesungen, die er dort inskribiert hat, werden wir noch zu
reden haben.
4) Die nächste Episode zeigt Cicero als rasanten Aufsteiger in
der Ämterlaufbahn, dem cursus honorum. Deren erste Stufe war
die Quaestur. Unter Sulla gab es 20 Quaestoren; die quaestores
urbani waren als Finanz- und Verwaltungsbeamte in Rom
beschäftigt, die anderen gingen als Gehilfen des Statthalters
mit diesem in die Provinz. Cicero erhielt Westsizilien
zugewiesen mit dem Amtssitz Lilybaeum. Mit einer für die
damaligen
Verhältnisse
geradezu
einzigartigen
Gewissenhaftigkeit und Unbestechlichkeit verwaltete er sein
Amt. Er hatte Getreide aufzukaufen, um einer Teuerung in Rom
abzuhelfen, und dies gelang ihm, ohne die Provinzialen durch
zu niedrige oder seinen vorgesetzten Praetor durch zu hohe
Preise zu verärgern. Cicero war der irrigen Ansicht, durch
seine Verdienste werde er in Rom nun in aller Munde sein. Er
schildert (Pro Plancio 64f.), wie er von seinem Wahn geheilt
wurde. Es war auf der Heimreise, im Badeort Puteoli:
"Und da hätte mich doch fast der Schlag getroffen, als
mich einer fragte, seit wann ich von Rom weg sei und was es
dort Neues gäbe. Auf meine Antwort, ich käme gerade aus der
63
Provinz, meinte der andere: 'Ach ja, natürlich, aus Afrika,
glaube ich.' Mir stieg die Galle und ich sagte unwillig:
'Nein, aus Sizilien.' Darauf ein anderer im Tone des
Besserwissers: 'Was, du weißt nicht, daß Cicero Quaestor in
Syrakus (dem Amtssitz des anderen sizilischen Quaestors) war?'
Da gab ich's auf, mich zu ärgern und tat, als sei ich einer
der Badegäste. Aber diese Erfahrung wurde für mich nützlicher,
als wenn mir alle gratuliert hätten. Nachdem ich eingesehen
hatte, daß die Römer taube Ohren, aber gute und scharfe Augen
haben, legte ich keinen Wert mehr darauf, was die Leute von
mir zu hören bekamen. Ich sorgte dafür, daß sie mich von nun
an tagtäglich vor Augen hatten, ich blieb ständig in ihrem
Gesichtskreis und nistete mich auf dem Forum ein, und weder
mein Türhüter noch mein Schlaf durften jemanden daran hindern,
zu mir zu kommen."
Aus dieser Erfahrung heraus lehnte er später auch die Provinz
ab, deren Verwaltung ihm nach der Praetur zustand, um ständig
in Rom anwesend sein zu können.
Den ersten Rang als Redner errang Cicero 70 v.Chr. mit dem
Prozeß (ausnahmsweise als Ankläger) gegen Gaius Verres, einen
nobilis, der als Statthalter die Provinz Sizilien verwaltete
und dort übler gehaust hat als in einem feindlichen Land. Die
Sizilianer baten Cicero, zu dem sie großes Vertrauen hatten,
um Hilfe, und dieser reichte als ihr patronus die Klage ein.
Damit war der Auftakt zu einem erbitterten Intrigenspiel
gegeben, denn Verres und seine zahlreichen Anhänger aus der
Nobilität waren nicht gewillt, vor römischen Untertanen und
einem homo novus zurückzuweichen.
Cicero unterlief alle Bemühungen der Gegenseite, den Fall zu
verschleppen (wenn das gelungen wäre, hätte im Jahr darauf der
Verteidiger Hortensius und zwei weitere Freunde des Verres das
Konsulat und den Gerichtsvorsitz gehabt), indem er in
außerordentlich
kurzer
Zeit
sein
Anklagematerial
zusammenbrachte und außerdem zum letzten Mittel griff: er
verzichtete auf die Einhaltung der üblichen Prozeßordnung, die
mehrere Tage für die Anklage vorsah, und begann nach seiner
ersten kurzen Rede sogleich mit dem Zeugenverhör. Unter dem
Druck des Beweismaterials und dem der empörten Volksmenge
verzichtete der gegnerische Anwalt Hortensius, der führende
Verteidiger in Rom, auf sein Plädoyer, und Verres trat bereits
vor seiner Verurteilung freiwillig den Gang in die Verbannung
an. Damit hatte Cicero Hortensius überrundet, er war jetzt
unbestritten der erste Anwalt Roms.
Für das Jahr
hatte
dann
Altersgrenze
Dabei half
berüchtigte
63 v.Chr. bewarb sich Cicero um das Konsulat. Er
das
43.Lebensjahr
erreicht,
die
unterste
für das höchste Staatsamt. Er wurde gewählt.
ihm, daß einer der Gegenbewerber der schon
Catilina war. Cicero arrangierte sich mit dem
64
Amtskollegen Gaius Antonius, dem Großvater des Triumvirn,
indem er ihm die reiche Provinz Makedonien überließ, womit
dieser seinen Schuldenberg abbauen konnte. Der stolzeste
politische Erfolg in der Amtszeit Ciceros war die Aufdeckung
und Niederschlagung der catilinarischen Verschwörung.
An
dieser
Stelle
soll
zugegeben
werden,
daß
die
Geschichtsschreibung, auf die wir uns hier verlassen, wie auch
die Epoche selbst, von der sie berichtet, eine patriarchale
ist, d.h. eine, die das geschichtliche Handeln von Männern im
Blick hat und das gleichzeitige und ebenso geschichtliche
Handeln von Frauen ausblendet. Es berichtet etwa vom
erzieherischen Einfluß des Vaters, erwähnt aber nicht den der
Mutter, die vielleicht wie im Fall Goethes die wichtigere war.
Im Fall der catilinarischen Verschwörung hebt sich der Vorhang
einen Augenblick und es zeigt sich, daß Cicero alle seine
Informationen von der Geliebten eines der Verschwörer hatte.
Ich referiere weiterhin patriarchale Geschichtsschreibung,
aber ich wollte nur darauf hinweisen, daß das natürlich ein
verzerrtes Bild gibt. Wir haben nur derzeit noch kein anderes.
Nach der Hinrichtung der Verschwörer (Catilina war nicht
dabei, er fiel erst später im Kampf gegen die Truppen des
Antonius) wurde Cicero als Retter des Vaterlands gefeiert, der
Senatssprecher begrüßte ihn als pater patriae und beantragte
ein Dankfest für die Götter, eine öffentliche Ehrung, die
sonst nur siegreichen Feldherrn und jetzt zum erstenmal einem
togatus, einem Beamten im Zivilrang, zuteil wurde. Er hatte
die Einmütigkeit im Staat erreicht.
Hier setzt aber auch die Kritik am Politiker Cicero ein: Er
habe nicht erkannt, daß die Einmütigkeit nicht von Dauer sein
konnte, weil sie nur unter dem Druck der Verhältnisse zustande
gekommen war, als es den verschiedenen Gruppen an den
Lebensnerv ging, als Hab und Gut, Kapital und Einfluß auf dem
Spiel standen. Sobald die Gefahr gebannt schien, zerfiel die
Front wieder und das Gruppeninteresse dominierte. Das sollte
schon bald verhängnisvolle Folgen haben, als Pompeius aus dem
Osten zurückkehrte.
Ciceros Fehler war es, an einen echten Sinneswandel und echte
politische Einsicht zu glauben, wo nur blankes materielles
Interesse vorlag. Er konnte aber seiner ganzen politischen
Denkungsart nach den Gedanken an eine mögliche Verwirklichung
seiner concordia-Idee niemals aufgeben und bemühte sich
zeitlebens, bis zum letztenmal im Kampf gegen Antonius, um die
Wiederbelebung
dieser
politischen
Konstellation.
Dieses
Festhalten Ciceros an der im Jahr 63 bewährten politischen
Idee werten fast alle seine Kritiker als Beweis für seine
beklagenswerte politische Kurzsichtigkeit, seinen Mangel an
historischer Perspektive, eine innerhalb der Kategorien von
65
Gut und Böse begrenzte, im Grunde völlig unpolitische Sicht
und
mangelndes
Verständnis
für
den
Ernst
und
die
Beschaffenheit der Krise des römischen Staates. (Eine
rühmliche Ausnahme bildet Büchner, wenn er sagt: "Die
Erhaltung
des
römischen
Staates
war
keine
Frage
der
Staatsform, sondern der Moral." 81) Das negative Urteil geht
v.a. auf Theodor Mommsen zurück ("Als Staatsmann ohne
Einsicht, Ansicht und Absicht..." - Römische Geschichte III
619).
Heute sieht man deutlicher, daß diese Art der Beurteilung eine
Fülle richtiger Einzelbeobachtungen enthält, im Ganzen aber
wertlos ist ohne die klare, in allen Konsequenzen durchdachte
und dargelegte Erkenntnis der damals gegebenen Alternative.
Diese Alternative, von den Kritikern teils ausgesprochen,
teils ausgespart, heißt Caesar und der Prinzipat. Die
Senatsregierung, korrupt und schwerfällig wie sie war,
festgefahren in den Bahnen gemeindestaatlichen Denkens, sei,
so sagt man, nicht fähig gewesen, das Weltreich zu regieren,
dazu habe es der Neuordnung bedurft, wie sie Caesar und seine
Nachfolger vornahmen. Es ergibt sich nun die Frage, ob dieses
Urteil nicht in der historischen Bedingtheit der Kritiker
selbst begründet ist, einer Art Besoffenheit vom Gedanken der
Monarchie, der Herrschaft des einen, sei es Kaiser oder
GRÖFAZ, Hauptsache einer. (Es wirkt sich eben oft in
wissenschaftlichen Meinungen aus, wenn ein Wissenschafter,
z.B. ein Historiker sein Gehalt in einem Staat bezieht, an
dessen Spitze so ein Herrscher steht.)
Es geht im Grunde darum, ob man es heute noch verantworten
kann, nur deren Funktionierens wegen die Diktatur einer Form
der Demokratie vorzuziehen. Für Cicero jedenfalls war die
Alleinherrschaft
keine
annehmbare
Alternative
zu
der
Staatsform, an die er nach seiner Bildung durch römische
Tradition
und
die
in
der
Polisdemokratie
verwurzelte
griechische Philosophie glaubte. Die Krise der res publica,
die durch den Ehrgeiz einzelner Männer und die Korruptheit und
Uneinigkeit der Senatsregierung zum Ausbruch gekommen war,
konnte nach seiner Meinung nicht allein durch Verwaltungsakte
überwunden werden, sie war nicht so sehr ein organisatorisches
als vielmehr ein moralisches Problem, und es bedurfte v.a. der
inneren Wandlung, der Erziehung der führenden Männer und aller
Stände zu verantwortungsbewußtem Handeln für die gemeinsame
Sache. Nun gehört aber der Glaube an den guten Willen und die
moralische Lenkbarkeit der Bürger zum Fundament jeder
Demokratie, welche Ausprägung und welchen Reifegrad sie auch
erreicht haben mag; in dieser Grundvoraussetzung liegt auch
zugleich ihr Mangel, die "glorreiche Schwäche der Demokratie"
(Mommsen). Eine Kritik an Ciceros politischer Grundüberzeugung
enthält also zugleich einen Zweifel an der Möglichkeit einer
81
Büchner, Cicero, S.147.
66
Verwirklichung
der
Demokratie
überhaupt.
Wer
Cicero
Kurzsichtigkeit und unpolitisches Denken vorwirft, ohne seine
völlige Hingabe an sein Staatsideal in Rechnung zu setzen,
wird ihm nicht gerecht und muß andererseits die Diktatur
Caesars, deren Programm doch recht undurchsichtig ist, und die
spätere
Monarchie
gutheißen.
In
dieser
funktionierte
allerdings - aber auch nur unter guten Kaisern - die
Reichsverwaltung und die Innenpolitik besser als in der
republikanischen Zeit, die Freiheit aber war verloren und mit
ihr die Staatsgesinnung und das Verantwortungsgefühl für eine
"gemeinsame Sache". Dafür geben uns die Schriften des Tacitus
und manche Briefe seines Freundes Plinius erschütternde
Beweise, und diese stammen aus der Regierungszeit Trajans, der
nach Augustus als der beste aller Caesaren anzusehen ist.
5) Eine glückliche Stunde war Ciceros triumphale Rückkehr aus
dem Exil, in das er sich durch ein von seinem Feind Clodius
durchgebrachtes Gesetz, vom eingeschüchterten Senat im Stich
gelassen, von Pompeius verleugnet und von den Konsuln Piso und
Gabinius brüskiert, begeben hatte. Es war ihm sehr schlecht
gegangen. Sein Selbstwertgefühl hing, damals jedenfalls noch,
fast ausschließlich von der Einschätzung durch die Umwelt ab,
mit der Verstoßung aus Rom schien er jeden Halt verloren zu
haben. Er mußte sich auch Sorgen um seine Familie machen. An
die Gattin Terentia schrieb er einmal:
"Ich bin verloren, bin im Elend! Soll ich dich jetzt
bitten, zu mir zu kommen, dich, eine kranke, an Leib und Seele
gebrochene Frau? Oder soll ich dich nicht bitten, soll ohne
dich sein? ... Das eine sollst du wissen: Wenn ich dich habe,
werde ich mir nicht ganz verloren vorkommen. Aber was soll aus
unserer lieben Tullia werden? Da müßt ihr zusehen, ich kann
euch keinen Rat geben. Aber was auch kommen wird, man muß auf
jeden Fall darauf achten, daß die Ärmste ihre Ehre und ihren
guten Ruf nicht gefährdet. Und was wird aus unserem kleinen
Cicero werden? Wenn ich ihn doch immer in meinen Armen halten
könnte! Ich kann nicht mehr weiterschreiben, der Kummer
überwältigt mich." 82
(Bei der Lektüre solcher Textstellen bei Cicero kann man
ahnen, welche Rolle Cicero im Humanismus gespielt hat,
besonders bei Petrarca, der von der dulcedo et sonoritas
verborum Ciceronis spricht: "eine gewisse Süße und Harmonie
des Stils fesselten mich derart, daß alles, was ich sonst las
oder hörte, mir heiser, rauh und unharmonisch vorkam." 83
Wir können, mit Walter Rüegg 84 zu sprechen, das Wesen des
Humanismus in der Haltung finden, mit der Petrarca als
82
83
84
fam XIV 1 (4), 3.
Sen. XVI,1.
Walter Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen über
Petrarca und Erasmus, Zürich: Rhein-Verlag 1946, S.7-63. Abegedruckt in:
K.Büchner (Hrsg.), Das neue Cicerobild, Darmstadt 1971. S.65-128.
67
moderner Mensch einem antiken Menschen begegnet und in dessen
Sprache die befreiende Form seiner eigenen geistigen Situation
und deren Bedürfnisse findet.)
Es bedurfte des Abwartens bis zu den nächsten Wahlen, bei
denen wieder Freunde Ciceros zum Zug kamen, und der
Aufstellung eigener Schutztruppen gegen den Bandenterror des
Clodius, um einen Volksbeschluß zu erreichen, der Cicero
zurückberief. Seine Heimkehr gestaltete sich zu einem großen
Triumph, von dem er noch lange zehrte:
"Auf dem ganzen Weg schien es, als ob Italiens Städte
meine Rückkehr als einen Festtag begingen. Die Straßen waren
voller Abordnungen von überall her, die Umgebung von Rom war
überfüllt von einer unübersehbaren Menge von Gratulanten. Der
Weg vom Stadttor, der Aufgang zum Kapitol, die Rückkehr in
mein Haus - alles war so, daß ich mitten in der größten Freude
nur darüber Schmerz empfand, daß ein so dankbares Volk so
elend und unterdrückt hatte sein müssen." 85
Wieder täuschte sich Cicero bezüglich der Tragfähigkeit der
momentanen politischen Einmütigkeit. Die Abmachung zwischen
Caesar, Pompeius und Crassus auf der Konferenz von Luca zur
Erneuerung ihres Triumvirats traf Cicero wie ein Blitz aus
heiterem Himmel, denn Pompeius war kurz vorher noch mit ihm
zusammengewesen und hatte nicht das geringste von seinen
Absichten verlauten lassen. Die folgenden Jahre brachten noch
manche weitere Demütigung für Cicero. Er sieht immer mehr ein,
daß seine Rolle in der Politik ausgespielt ist. Seinem Bruder
gegenüber klagt er:
"Es tut mir weh, liebster Bruder, es tut mir in der
Seele
weh,
daß
wir
keinen
Staat
mehr
haben,
kein
Gerichtswesen, und daß ich in meinem Alter, in dem ich mich
eigentlich meiner Würde als Senator zu erfreuen hätte, mich
entweder mit Prozeßkram herumschlage oder mich daheim mit
literarischen
Arbeiten
aufrechterhalte,
und
daß
mein
Leitstern, an dem ich von Kindheit an meine Freude hatte,
nämlich 'Immer der Erste zu sein und sich auszuzeichnen vor
andern', ganz und gar erloschen ist, und daß ich meine Gegner
teils unbehelligt lassen, teils sogar verteidigen muß, daß ich
nicht in meiner Gesinnung, ja nicht einmal in meinem Haß frei
bin." 86
In dieser für ihn nach außen so glanzlosen und wenig
erfreulichen Zeit beginnt seine erste schriftstellerische
Periode. Zwischen den Jahren 55 und 51 entstehen die Werke de
oratore (Vom Redner), de re publica (Vom Staat) und de legibus
(Von den Gesetzen). Es war Flucht aus der unerträglich
gewordenen politischen Wirklichkeit und zugleich Fortsetzung
85
86
Pro Sestio 131.
Quint III 5, 4.
68
der Politik mit anderen Mitteln.
6) Cicero kommt in ärgste Bedrängnis; als der Konflikt
zwischen Caesar und Pompeius auf eine Entscheidung hindrängt,
irrt Cicero zwischen den Fronten verloren herum. Caesar hat
sich um ihn bemüht, ihn persönlich aufgesucht und gebeten, im
Senat in seinem Sinn zu sprechen. Cicero hat ihm widerstanden,
wie er seinem Freund Atticus brieflich berichtet: Beides ging
deinem Rat entsprechend: Einmal habe ich so gesprochen, daß
ich eher Respekt als Dankbarkeit bei ihm erweckte, und zum
zweiten blieb ich dabei: Ich komme nicht nach Rom! Nur darin
habe ich mich getäuscht, daß ich ihn für nachgiebig hielt.
Nichts weniger als das... Nach langem Hin und Her: "Komm also
und rede zum Frieden!" "So wie ich es für richtig halte?" Er:
Sollte ich dir etwa Vorschriften machen?" Ich: "Dann werde ich
mich dafür einsetzen, daß der Senat den Heereszug nach Spanien
und den Transport von Truppen nach Griechenland mißbilligen
soll, und ich werde das Geschick des Pompeius lebhaft
bedauern." "Daß so etwas gesagt wird, will ich nicht!" "Das
habe ich mir gedacht", sagte ich, "aber gerade deshalb will
ich ja nicht kommen. Entweder muß ich mich so äußern oder
wegbleiben, und wenn ich da bin, muß ich vieles sagen, was ich
einfach
nicht
verschweigen
kann."
Das
Ergebnis
war
schließlich, daß er, um einen guten Abgang zu finden, sagte,
ich solle mir die Sache noch einmal überlegen. Das konnte ich
nicht abschlagen, und so schieden wir. Ich glaube also nicht,
daß er mit mir zufrieden war, aber ich war's mit mir, und das
ist mir schon lange nicht mehr passiert. - Was das übrige
anlangt - gute Götter! - was er da für Leute bei sich hat! Die
reinste Unterwelt, um deinen Ausdruck zu gebrauchen!... Es ist
aus mit uns... Doch seine Bemerkung zum Schluß - ich hätte sie
beinahe vergessen -, die war noch besonders widerwärtig: Wenn
er sich meiner Ratschläge nicht bedienen könne, so werde er
sich eben an die Leute halten, die ihm zur Verfügung ständen,
und zu den äußersten Mitteln greifen. 87
Cicero hat weitere Aufforderungen, wenigstens neutral zu
bleiben, hartnäckig abgelehnt und mußte nach dem Sieg Caesars
über Pompeius den Sieger mit großer Bangigkeit erwarten, - am
25.Sept.47 war es -Caesar ersparte ihm aber alle Peinlichkeit,
stieg aus dem Wagen, begrüßte ihn herzlich und ging mit ihm
ein langes Stück Weg in traulichem Gespräch. Cicero durfte
nach Rom zurückkehren. Die Liktoren übrigens, die er schon die
längste Zeit als Anwärter auf einen Triumph mit sich
herumgeschleppt
hatte
(bei
seiner
Statthalterschaft
in
Kilikien im Jahr 51 wurde ein bißchen gekämpft und hatten ihn
seine Soldaten zum Imperator ausgerufen), entließ er nun, weil
ihm der Gedanke, den Triumph von Caesars Gnaden zu erhalten,
87
Att IX 21 (18), 1,2,3.
69
unerträglich war.
8) Ein signifikantes Ereignis im Leben Ciceros ist die
Ermordung Caesars am 15.März 44, dem Senatssitzungstermin, bei
dem Caesar die Königswürde hätte zuerkannt werden sollen.
Cicero war nicht in den Attentatsplan eingeweiht; man traute
ihm
nicht
genügend
Mut
und
Entschlossenheit
zu,
und
schließlich war er auch schon ein Mann von über sechzig
Jahren. Aber nach der blutigen Tat hielt Brutus den Dolch in
die Höhe und rief: "Cicero!" und beglückwünschte ihn damit zu
der wiedergewonnenen Freiheit. Cicero galt also offenbar als
der Repräsentant der republikanischen Staatsform. Im ersten
Augenblick triumphierte Cicero auch über den Tod des Tyrannen,
aber die Euphorie war bald verflogen. Es zeigte sich, daß die
Tyrannenmörder die Freiheit nicht zu sichern verstanden.
"Für mich besteht kein Zweifel, daß es auf einen Krieg
hinausläuft. Jene Tat ist zwar mit dem Mut von Männern, aber
mit dem Verstand von Kindern vollbracht worden." (Att XIV
21,3) schreibt Cicero und meint damit vor allem den kapitalen
Fehler, den Thronerben Antonius nicht gleichzeitig zu
entmachten.
Es folgt ein neuerliches Triumvirat und ein neuerlicher
Endkampf. Cicero ist wieder eine Zeit lang als Führer der
Senatspartei der unbestritten einflußreichste Mann in Rom, so
sehr, daß Antonius das Gerücht ausstreuen konnte, Cicero wolle
sich zum Diktator ausrufen lassen. Das war natürlich kaum
glaublich. Sein Verdienst in den Wirren war, zumindest den
Versuch
unternommen
zu
haben,
eine
Alternative
zur
Caesarnachfolge des Antonius zu schaffen und damit einen
Versuch, die Republik zu retten. Es siegte wieder nicht die
res publica, sondern die größere militärische Macht.
9) Aus den letzten Lebensmonaten Ciceros haben wir wenig
Quellenmaterial. Er versuchte wohl, seinen Frieden mit
Octavius zu machen und lebte teils in Rom und teils auf seinen
Gütern. Möglicherweise bereitete er die Herausgabe seiner
letzten
Schrift
vor,
de
officiis
(vom
pflichtgemäßen
Handeln).Er konnte hoffen, den Schutz des Octavius zu
genießen, der ihn einmal als "pater" bezeichnet hatte. Aber
beim Triumviratsschluß Ende Oktober setzte Antonius durch, daß
Ciceros Name an die Spitze der von den Triumvirn vereinbarten
Proskriptionsliste gestellt wurde. Octavius soll sich drei
Tage dagegen gesträubt haben. Cicero versuchte zu fliehen,
aber es war zu spät. Als die Schergen kamen, untersagte er
seinen Leuten, Widerstand zu leisten. Er beugte sich aus der
Sänfte und erwartete so den Todesstreich. Der Anführer des
Kommandos hieb ihm den Kopf und die Hand ab, mit der er die
Philippischen Reden geschrieben hatte, und brachte beides
befehlsgemäß zu Antonius. Dieser ließ Kopf und Hand auf der
70
Rednerbühne aufstecken, "ein gräßlicher Anblick für die Römer,
die eher ein Abbild von Antonius' Seele als das Antlitz
Ciceros zu erblicken glaubten" (Plutarch Cic 49).
Octavius setzte zeichenhaft nach seinem Sieg über Antonius
Ciceros Sohn im Jahr 30 v.Chr. zum Konsul und Pontifex ein,
obwohl dieser noch kein Staatsamt innegehabt hatte und außer
dem Namen des Vaters keinerlei Vorzüge aufzuweisen hatte.
Manches deutet auch darauf hin, daß der spätere Princeps
Augustus, dem das Bewahren des Staates am Herzen lag, seinen
ehemaligen politischen Mentor möglicherweise besser verstand
als in der Zeit seines gewaltsamen Aufstiegs. Im "Monumentum
Ancyranum", dem politischen Rechenschaftsbericht seiner späten
Jahre, weisen wörtliche Anklänge auf die Philippischen Reden
Ciceros zurück, und manche von Augustus' Maßnahmen und
Aussprüchen lassen erkennen, daß Cicero in vielem die
augusteische Epoche vorbereitet hat.
2.2 Anspruch und Anerkennung des Geistes in Rom
Wir greifen in gewollter Einseitigkeit aus dem so bunten und
spannenden Lebensbild Ciceros eine Seite heraus und nennen es
"Anspruch und Anerkennung des Geistes in Rom". Dieser Anspruch
läßt sich von Cicero an bei Lukrez, Sallust und vor allem bei
den augusteischen Dichtern erkennen. Er wird in der Weise
geltend gemacht, daß Cicero seine innenpolitische Tat, Lukrez
die philosophische Lehre Epikurs, die augusteischen Dichter
ihr literarisches Wirken mit der Leistung des Imperators wie
des Herrschers überhaupt vergleichen und sich dabei der
Terminologie für die kriegerische Tat, aber auch für die
daraus resultierenden Ehren bedienen. Cicero hat dabei, wie es
scheint, einen entscheidenden Impuls gegeben.88
Bedenken wir, wie wenig Resonanz, geschweige denn Anerkennung,
das literarische Schaffen und das Geistige überhaupt für lange
Zeit in Rom fand. Was der alte Cato aussprach: "poeticae artis
honos non erat; si quis in ea re studebat..., grassator
vocabatur", galt streng genommen auch noch für die Zeit des
Horaz. In der Wertskala des römischen Ruhms stand an erster
Stelle die Leistung des Imperators, allenfalls beeindruckte
der rednerische Glanz auf dem Forum und im Senat. Dichter,
Schriftsteller und Philosophen standen allenfalls im Ansehen
weniger, oft zu dem handfesten Zweck der Verherrlichung der
res gestae imperatorum. Sogar von der Bildung des sogenannten
Scipionenkreises macht man sich wahrscheinlich eine zu
übertriebene
Vorstellung,
weil
man
ihn
durch
die
idealisierende Brille Ciceros zu sehen gewohnt ist.
Vgl. Vinzenz Buchheit, Ciceros Triumph des Geistes. Gymnasium 76 (1969),
S.232-253.
Abgedruckt
auch
in:
Ciceros
literarische
Leistung.
Hrsg.v.Bernhard Kytzler. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt
1973, S. 489-514.
88
71
Es bedurfte des Glücksfalls, daß sich die bedeutende geistige
Potenz Ciceros mit der auctoritas des Konsuls und des ersten
Anwalts Roms verband, um eine entscheidende erste Bresche für
die Anerkennung des Geistigen in Rom zu schlagen.
Cicero wußte, daß er nur auf der Basis einer anerkannten
politischen Tat die traditionelle Wertskala aufbrechen konnte.
Nicht zufällig forcierte er daher den Kampf um den Triumph des
Geistes auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere, gegen
Ende
des
Konsulats,
als
er
die
Niederwerfung
der
Catilinarischen Verschwörung erreicht sah. Aufschlußreich ist
das letzte Drittel der dritten Catilinarischen Rede Ciceros,
und andere Stellen.89 Im Bewußtsein, eine Leistung des animus,
nicht des corpus vollbracht zu haben, wird der traditionelle
Ruhm des Feldherrn von Cicero abgelehnt. Nicht Monumente,
nicht Statuen, nicht Triumph, nicht Bilder zählen, sie sind
als muta und tacita ungemäß und vergänglich. Gefordert werden
memoria aeterna, sermones, litterarum monumenta, animorum
simulacra summis ingeniis expressa et polita, stabiliora
quaedam et viridiora praemiorum genera. Für den optimus
quisque, d.h. für den Staatsmann ciceronischer Provenienz,
gelten nur die monumenta aeterna. Cicero beruft sich sogar in
Arch. 30 und Sest. 43 für die Ruhmesidee ausdrücklich auf
seine philosophische Bildung. In allen Texten spricht er
direkt oder indirekt von der quasi divina mens und von der
aeternitas der Tat des wahren Staatsmanns, einer Tat nicht des
corpus, der arma, sondern des animus.
Die Nachwirkung seines Einsatzes für die Vorrangstellung des
Geistes in Rom merken wir, wenn Horaz sein Exegi monumentum
aere perennius schreibt und Ovid sein iamque opus exegi. Hier
wird Cicero mitgefeiert. Die Idee des Geistes tritt mit Cicero
in Rom und für lange Zeit im Abendland ihren Siegeszug an.
Wenige lateinische Texte haben in Antike und Christentum so
gewirkt wie das Somnium Scipionis.90 "Ciceros darin verewigter
Glaube an die Wirkung und die Unsterblichkeit des Geistes hat
sich bewahrheitet. Der Triumph des Geistes im Abendland ist
auch ein Triumph Ciceros."91
2.3 Beredsamkeit und Weisheit bei Cicero
Cicero war nicht nur der große Redner, als den man ihn kennt,
auch nicht nur der Autor von jahrhundertelang als klassisch
geltenden rhetorischen Abhandlungen, sondern hat sich auch
lebhaft für die Philosophie der Kunst interessiert, die er
meisterhaft lehrte und glänzend ausübte. In den herkömmlichen
Darstellungen der Geschichte der Philosophie gilt Cicero als
Cat. 3, 26; 4, 22ff.; Arch. 30; rep. 6, 8.
Vgl. P. Courcelle, La postérité chretienne du 'Songe de Scipion', Rev.
Et. Lat. 36, 1958/59, 205-234.
91 V.Buchheit, o.c., 514.
89
90
72
ein recht wirrer Eklektiker: Man verachtete diesen Literaten,
der in der Philosophie nur Themen gesucht hat, die sich für
die Beredsamkeit eignen. Die Darstellungen der lateinischen
Literaturgeschichte schließlich schenken dem Schriftsteller,
dem Rhetor, ja, selbst dem Literaturkritiker Cicero größere
Aufmerksamkeit als dem Theoretiker, der sich bemüht hat, den
Standort seiner Kunst innerhalb der Fachwissenschaften zu
bestimmen, ihren Gegenstand zu definieren und ihre Aufgabe zu
präzisieren.
Und doch legt Cicero gerade hier, wo er aufgrund persönlicher
Erfahrung spricht und nicht mehr kompiliert, eine große
Selbständigkeit in der theoretischen Betrachtungsweise an den
Tag, und seine wenigen über diesen Gegenstand geäußerten
persönlichen
Gedanken
haben
auf
die
Geschichte
der
abendländischen Kultur einen so großen Einfluß gehabt, daß sie
ihren Lauf wesentlich und nachhaltig bestimmten.92
Sein Nachdenken über die Geschichte hat Cicero zu dem Schluß
kommen lassen, daß für das Wohl der Stadt weder Weisheit noch
Beredsamkeit allein erforderlich sei, sondern beides zusammen
vorhanden sein müsse:
"Ohne die Beredsamkeit kann die Weisheit den Städten nur wenig
Nutzen bringen, und was die Beredsamkeit ohne die Weisheit
angeht, so gereicht sie ihnen zumeist sehr zum Schaden, ist
ihnen aber niemals nützlich."93
Beredsamkeit und Weisheit bilden demnach eine Einheit,
wenigstens in dem Sinne, daß sie niemals getrennt werden
dürfen. Der Anfang der Schrift 'De inventione rhetorica'
enthält die Hauptgedanken, mit deren Wiederaufnahme und
Fortentwicklung Cicero sich auch fernerhin bei erneuter
Auseinandersetzung mit demselben Thema begnügt: Der Mensch ist
erst von dem Augenblick an wirklich Mensch, wo er in einer
Stadt lebt, deren Gesetze und Ordnung er anerkennt. Und nichts
anderes kann ihn dazu bewegen, diese Gesetze und diese Ordnung
anzuerkennen,
als
eine
von
der
Weisheit
eingegebene
Beredsamkeit. Diesen beiden Gedanken gesellt Cicero aber
bisweilen einen dritten zu: Der Mensch unterscheidet sich von
den anderen Lebewesen nur durch die Sprache, so daß man ihn
beinahe als "sprechendes Lebewesen" bezeichnen könnte. Diese
Feststellung bedeutete an sich nichts Neues. Da sich das
Denken nicht von der Sprache trennen läßt, macht es keinen
großen
Unterschied,
ob
man
den
Menschen
als
ein
"vernunftbegabtes"
oder
ein
"sprechendes"
Lebewesen
bezeichnet. Der Unterscheid hat allerdings seine Bedeutung,
Vgl. Etienne Gilson, Eloquence et sagesse chez Cicéron, Phoenix 7
(1953), p.1-19. Aus dem Französischen übersetzt von Hartmut Froesch:
Beredsamkeit und Weisheit bei Cicero. In: Das neue Cicerobild. Hrsg.v.Karl
Büchner. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1971. S.179-207.
93 Cicero, De inventione rhetorica 1, 1.
92
73
will man Ciceros persönlichen Standpunkt verstehen. Indem er
so auf den Ausdruck des Gedachten mehr Gewicht legte als auf
das Denken selbst, durfte er die Ausdrucksfähigkeit eines
jeden Menschen zum Maßstab seiner humanitas selbst nehmen.
Wenn die Sprache den Menschen ausmacht, ist man ein umso
besserer Mensch, je besser man spricht. Nach Ciceros
Auffassung ist also der Redner, der diesen Namen zu Recht
trägt, den übrigen Menschen in eben diesem Punkt überlegen, in
dem sich der Mensch über die Tiere erhebt.94 Das ist ein
beachtenswerter Hinweis, läßt er doch erkennen, warum die
Studien, die einer braucht, wenn er sich um die Beredsamkeit
bemüht, später die "humanistischen" heißen werden. Seine
Sprache kultivieren bedeutet, in sich das wesentliche Element
der Humanität herausbilden.
Die Schrift 'De inventione rhetorica' war das Werk eines
jungen Mannes von 21 Jahren. Das Werk 'De oratore',
geschrieben im Jahre 55 v.Chr., als Cicero 50 Jahre alt war,
sollte jene grundlegenden Gedanken wiederaufnehmen und ihnen
eine vollendetere Ausprägung geben. Das in diesem Dialog
diskutierte Problem ist die wahre Natur der Beredsamkeit.
Cicero wendet sich entschieden gegen die These, daß ein Mensch
mit natürlicher Redebegabung nur Rhetorik zu lernen habe, um
beredt
zu
werden.95
Er
prangert
unermüdlich
die
verhängnisvolle Tendenz der Fachwissenschaften an, sich
voneinander abzusondern, als wenn jede von ihnen sich allein
genügen könnte. In der Auseinandersetzung zwischen den
Verteidigern einer "allgemeinen Bildung" und den Verfechtern
des "Spezialistentums", die im Lauf der Geschichte immer
wieder auflebt, bleibt Cicero der entschiedenste Vorkämpfer
der allgemeinen Bildung.96
Ein Redner, der wirklich beredt sein will, muß composite,
ornate, copiose sprechen, d.h. in der rechten Ordnung, mit
Gefälligkeit und in Fülle. Ohne die scientia, die allein ihn
inspirieren kann, könnte er dieses Ziel nicht erreichen. Dazu
gehört das Recht in seiner ganzen Breite, d.h. die persönliche
Beherrschung der öffentlichen Angelegenheiten, die Kenntnis
der Gesetze, des Gewohnheits- und Zivilrechts. Es genügt aber
De inventione 1, 4: Ac mihi quidem videntur homines, cum multis rebus
humiliores et infirmiores sint, hac re maxime bestiis praestare, quod
loqui possunt. Quare praeclarum mihi quiddam videtur adeptus is, qui, qua
re homines bestiis praestent, ea in re hominibus ipsis antecellat.
95 Cicero, De oratore 1, 2, 5: ...solesque non numquam hac de re a me in
disputationibus nostris dissentire, quod ego eruditissimorum hominum
artibus eloquentiam contineri statuam, tu autem illam ab elegantia
doctrinae segregandam putes et in quodam ingenii atque exercitationis
genere ponendam.
96 vis oratoris professioque ipsa bene dicendi hoc suscipere ac polliceri
videtur, ut omni de re, quaecumque sit proposita, ornate ab eo copioseque
dicatur (De oratore 1, 6).
94
74
noch nicht, nur selbst zu verstehen, wovon man spricht. Der
Redner hat sich ja zum Ziel gesetzt, andere davon zu
überzeugen, und wie vermöchte er das ohne Kenntnis der
menschlichen Natur und der tiefsten Regungen des Herzens? Wir
müssen also sagen, daß der Redner vor allem Rechts- und
Menschenkenntnis besitzen muß.97 Philosophie und Beredsamkeit
zu vereinigen, ist eine Entscheidung von außerordentlicher
Tragweite für die Zukunft der europäischen Kultur im
allgemeinen und des Humanismus im besonderen.
Cicero gliedert die Philosophie nach der hellenistischen
Einteilung, deren Erbe er ist, in drei Teilgebiete: Physik,
Logik und Sittenlehre. Vom vollendeten Redner müßte man
verlangen können, sie alle drei zu beherrschen, eins so
vollkommen wie das andere. Die Hauptsache ist die Sittenlehre.
(Vgl. das hellenistische Bild vom Obstgarten: Mauer = Logik,
Baum = Physik, Früchte = Ethik.)
Recht, Ethik, Kenntnis von den Leidenschaften des Menschen,
Logik, oder vielmehr Dialektik - das ist noch nicht das
gesamte Rüstzeug des Redners, denn es fehlt ihm noch die
Geschichte, d.h. die genaue Kenntnis vergangener Zeiten, der
Menschen, die in ihnen lebten, und ihrer Reden und Taten. Dies
ist erforderlich, um mit einem reichen Schatz von Geschichten
oder, um den Fachbegriff zu verwenden, Beispielen (exempla)
versehen zu sein, die die Phantasie des Zuhörers anregen und
gleichzeitig seine Aufmerksamkeit beleben. Nicht nur die
Geschichte, alle Dichter, alle Meister in den freien Künsten
müssen gelesen, besprochen, kritisch betrachtet sein, um aus
ihnen Gründe und Gegengründe zu schöpfen, die sie zu
unzähligen Fragen liefern.98
Wenn man Cicero auf die Untersuchung seines geistigen Ideals
hin liest, zieht ein Fachausdruck bald die Aufmerksamkeit auf
sich: der der artes. Cicero unterscheidet die scientia, oder
das Wissen, von der ars, die für ihn nichts anderes zu sein
scheint als eben dieses Wissen in methodischer Einteilung und
Ordnung (artificiose digesta) mit dem Ziel, bequem benutzt
werden zu können. Jede Kunst setzt also ein entsprechendes
Wissen voraus, das sie in bestimmten Formeln zusammenfaßt und
mit Hilfe der Dialektik ordnet. (Vgl. De oratore 1, 41 und
42.)
Cicero ordnet die artes nach ihrem Platz ein, den sie in der
Sorge um die oberste Realität, die Stadt, einnehmen. An der
Spitze stehen die höchsten Künste, maximae artes, als da sind
Politik, Kriegskunst und Beredsamkeit. Darunter folgen die
mittleren Künste, mediocres artes, deren schöpferischer
97
98
De oratore 1, 11, 48.
De oratore 1, 5, 18; vgl. 1, 34, 158-159.
75
Urgrund, gewissermaßen ihre Mutter, das ist, was die Griechen
"Philosophie" nennen: Mathematik, Physik, Moral,, Logik,
Grammatik. (De oratore 1, 2, 6) Es ist die Bildung eines
römischen Bürgers aus guter Familie. Cicero nennt das eine
eruditio libero digna (De oratore 1, 5, 17), er meint also die
Gesamtheit der nichtsklavischen Künste, derer, die man noch
heute in demselben Sinn artes liberales oder freie Künste
nennt.
Irgendwann muß Cicero auf das Problem gestoßen sein, daß die
Philosophie eine gefährliche Konkurrenz für die Beredsamkeit
um den ersten Rang darstellte. Cicero zeigt genau in dieser
Frage die größte Selbständigkeit. Er hat sich nämlich eine
eigene Geschichte der menschlichen Fachkenntnisse ausgedacht:
In der Vergangenheit wie in einer Art goldenem Zeitalter muß
es eine Epoche gegeben haben, in der die Menschen gleichzeitig
und ungeteilt die Fähigkeit zu denken, zu urteilen und zu
sprechen besaßen. Hierin bestehe das, was die Alten sapientia
nannten: Weisheit. Solche Männer waren etwa bei den Griechen
Lykurg und Solon, bei den Römern Fabricius, Cato und Scipio.
Allesamt
also
Staatenlenker
und
Männer
der
Tat,
die
Wissenschaft niemals von der Praxis getrennt haben. Später
haben einige aus Vorliebe für das Wissen in erster Linie Muße
und Frieden als Erfordernisse ihrer Studien erstrebt. Hierzu
gehören u.a. Pythagoras, Demokrit und Anaxagoras, die sich
alle von der Politik abwandten, um sich nur mehr der
Verfolgung des Wissens zu widmen: a regendis civitatibus totos
se
ad
cognitionem
rerum
transtulerunt.
das
war
der
Ausgangspunkt alles Übels, gegen das anzugehen Cicero sich
entschlossen
hat.
Hauptverantwortlicher
für
den
verhängnisvollen Umschwung war Sokrates. Bis auf seine Zeit
nannte man "Philosophie" jene Weisheit, in der sich das Wissen
um die höchsten Dinge und die Kunst, sie zu behandeln, zur
Eleganz der Rede vereinigten. Er aber löste diese beiden
Komponenten der Weisheit voneinander und behielt deren
Bezeichnung nur mehr allein für die Wissenschaft zurück:
"Hieraus ging sozusagen jene Trennung von Zunge und Herz
hervor, die wahrlich ungereimt, unnütz und tadelnswert ist, da
uns nunmehr manche Lehrer nur das Wissen, andere das Reden
lehren."99
Die Aufgabe, die Weisheit in ihrer vollendeten Gestalt
wiederherzustellen, hat sich Cicero gestellt. Er mußte dazu
sein eigenes Ideal des theoretischen Wissens den immer nur
praktischen Zielen des Redners unterordnen. Genau hier haben
Philosophen eingehakt und einen Grund für ihre Geringschätzung
De oratore 3, 16, 59-61; vgl. ... postea dissociati (ut exposui) a
Socrate diserti a doctis, et deinceps a Socraticis item omnibus,
philosophi eloquentiam despexerunt, oratores sapientiam (De oratore 3, 19,
72).
99
76
Ciceros als Philosophen gesehen. Sie werfen ihm vor, das
Wesentliche der Philosophie preisgegeben zu haben, indem er
sie von der Trägerin der reinen Erkenntnis, zur bloßen
Dienstmagd der Beredsamkeit herabgewürdigt habe. Es läßt sich
freilich nicht bestreiten, daß Cicero das getan hat, und kein
Philosoph könnte ihn davon freisprechen. Aber das ist noch
kein Grund, nicht zu versuchen, ihn zu verstehen. Und wie
könnte man ihn verurteilen, ohne ihn zu verstehen? Was meint
er mit der eigenwilligen Formulierung: Verum ego quaero nunc,
non quae sit philosophia verissima, sed quae oratori coniuncta
maxime. (De oratore 3, 17, 64; Partitiones oratoriae 23, 78.)
Die Lehre Epikurs etwa ist keine Philosophie für den römischen
Redner. Die Epikureer sind zwar angenehme Menschen, und das
Ärgste ist, daß sie sehr wohl recht haben könnten; aber
selbst, wenn ihre Lehre völlig wahr wäre, sollen sie sie für
sich behalten! Auch der Stoizismus taugt nicht, weil der
Stoiker der Ansicht ist, niemand sei weise. Es wäre unsinnig,
so jemandem die Leitung des Senats anzuvertrauen, der keinen
von denen, an die sich seine Rede richtet, für weise oder frei
hält. Mag die Sittenlehre der Stoiker richtig oder falsch
sein, es ist nicht die der übrigen Bürger; sie ist folglich
untauglich, und der Redner, der sich von ihr leiten ließe,
käme nicht zum Ziel. (De oratore 3, 18, 66). Bleiben allein
die Peripatetiker und Akademiker, d.h. die Schüler des
Aristoteles bzw. des Karneades, die man sich zu Lehrern wählen
könnte, wenn man die Beredsamkeit zum Ziel hat. Persönlich
zieht Cicero den Probabilismus des Karneades und der neueren
Akademie vor; er ist eine vortreffliche Schule, um verständig
über alles sprechen zu lernen, bei allem das Für und Wider
abzuwägen und schließlich jedesmal das Wahrscheinliche oder
Mögliche zu wählen, nämlich jene Meinungen der Mitte, die alle
Aussichten haben, in den Versammlungen die Abstimmungen für
sich zu gewinnen. Bei jeder Frage ausschließlich mit den
natürlichen Hilfsquellen seines Verstandes das herauszufinden,
was als wahrscheinlich gelten kann: id quod in quoque
verisimile est (De oratore 3, 21, 79), das bedeutet nichts
Unmögliches. Wir dürfen uns nicht nach dem schlechten Beispiel
jener Spezialisten richten, die durch ihre Studien von einer
Frage
zur
anderen
geführt
werden,
ohne
je
irgendwo
anzugelangen. Nur, wer seine Kenntnisse in die Tat umzusetzen
versteht, besitzt sie wirklich. Außerdem wird man im Grunde
niemals etwas gut beherrschen, was man nicht schnell zu
erlernen versteht. (De oratore 3, 23, 89. Dieser Satz des
Crassus wird etwas später von Caesar aufgenommen und gebilligt
<3, 36, 146>). Das ist ein erschreckendes Wort, es zeigt aber
vortrefflich, wodurch die Existenz des Weisen, wie Cicero ihn
auffaßt, praktisch erst möglich wird. Wenn man im Zusammenhang
mit Cicero von allgemeiner Bildung spricht, muß man sofort
hinzufügen, daß es sich um das genaue Gegenteil dessen
handelt, was eine zweckfreie allgemeine Bildung darstellte. Es
77
ist auch Weisheit bezüglich der Dinge, die man kennen muß und
über die man sprechen können muß, um den Staat gut zu lenken.
Niemand, der nicht in höchster Bedrängnis seines Staatswesens
sich engagiert hat, sein Leben riskiert hat wie Cicero, sollte
über diese philosophische Überzeugung die Nase rümpfen. Und
auch niemand, der nicht wie Cicero in der Zeit der Diktatur
das Verurteiltsein zum bloßen theoretischen Philosophieren als
letzte Schmach und zugleich letzten Trost erfahren hat.
Etiene Gilson, der von einem "oberflächlichen Charakter" der
ciceronischen Bildung spricht,100 und der Cicero zum Vorwurf
macht, "sich selbst für einen Philosophen gehalten zu haben",
räumt doch ein: "Seine Lehre entschuldigt allerdings diesen
Anspruch ein wenig. Er war gewiß beredt; niemand aber ist
beredt, wenn er nicht zugleich Philosoph ist; folglich war er
Philosoph." (ebd. 204).
Gilson tut Cicero aber m.E. weiter Unrecht, wenn er ausführt:
"Von ihm (Cicero) aus war diese Einbildung (nämlich, Philosoph
zu sein) recht verständlich, da die Philosophie, so wie er sie
auffaßte, keine andere Schwierigkeit bot als die, sie gut in
Worte zu kleiden. Wie also hätte sich dieser Fürst der
Beredsamkeit für in der Philosophie nicht zuständig halten
können, er, der in der Philosophie die eigentliche Quelle
seiner Beredsamkeit sah?" (ebd.)
Ciceros philosophisches Schrifttum zeigt, glaube ich, zur
Genüge, daß der Vorwurf der Oberflächlichkeit einfach nicht
greift. Das können wir erst anhand der Texte selbst
demonstrieren.
Die Philosophen (jedenfalls bis in unsere Zeit) hat Cicero
zwar nicht überzeugt, aber der Einfluß seiner Gedanken auf die
Geschichte der abendländischen Kultur ist unermeßlich gewesen.
Und im 20. Jahrhundert begann man ihn auch als Denker wieder
zu achten.
2.4 Ciceros Freude an der Philosophie
Das
Konsulatsjahr
Ciceros,
seine
große
politische
Bewährungsprobe,
wurde
für
sein
inneres
Leben
zum
Schicksalsjahr. Von Anfang an stand er infolge der dauernden
Angriffe seiner Gegner unter äußerster Anspannung seiner
Kräfte. Als nach verschiedenen wohlberechneten Vorstößen
Caesars und seiner Anhänger die Verschwörung des Catilina zum
Ausbruch
kam,
zeigte
er
sich
so
wachsam,
klug
und
entschlossen, daß die Erhebung in wenigen Wochen ohne eine
stärkere Erschütterung des Staates in sich zusammenbrach. Aber
statt des erwarteten Dankes für seine Leistung erntete er auch
100
Gilson, o.c., 203.
78
von denen, die er gerettet zu haben glaubte, fast nur
Anfeindungen, die ihn umso empfindlicher trafen, als er die
Härte des geborenen Staatsmanns nicht besaß. Caesar, der ihm
durch sein instinktsicheres Machtstreben von Anfang an
überlegen war, drängte ihn nun mit starker Hand in das Dunkel
der Geltungslosigkeit ab. In dieser Zeit versucht er sich
durch Veröffentlichung seiner im Konsulatsjahr gehaltenen
Reden wenigstens literarisch ins rechte Licht zu setzen. Dabei
legt er eine Art philosophisches Glaubensbekenntnis ab.
Zum Beispiel in der Rede Pro Rabirio. Rabirius war ein
angesehener Bürger, der fast 40 Jahre zuvor, dem Ruf der
Konsuln folgend, die Waffen aufgenomen hatte und bei den
Straßenkämpfen einen zum Staatsfeind erklärten Volkstribunen
getötet hatte. Es war nun eine der Maßnahmen Caesars, um den
Widerstandswillen der verfassungstreuen Bevölkerung zu lähmen,
gegen diesen Rabirius einen Prozeß anzustrengen, in dem er in
einem altertümlichen Schauverfahren zum Tod verurteilt werden
sollte. Cicero war es gelungen, die Anklage zu seinen Gunsten
zu verwerten, da er selber eben die Zuverlässigkeit des
Angeklagten und die in jener früheren Zeit verwirklichte
Einigkeit aller Gutgesinnten als Vorbild für die Gegenwart
hinstellen konnte. In der Rede Ciceros heißt es:
"Hätte Marius unter so vielen Mühen und Gefahren leben wollen,
wenn er mit seinem Hoffen und Planen nicht über die Grenzen
dieses Lebens hinaus nur an sich und seinen Ruhm gedacht
hätte? Ja, gewiß, als er die unübersehbaren Scharen der Feinde
auf dem Boden Italiens zersprengt und den Staat von ihrem
Ansturm befreit hatte, da glaubte er wohl, daß alles, was er
sein eigen nannte, mit ihm im Tode dahingehen werde. Dem ist
nicht so, ihr Quiriten. Niemand von uns kann sich ehrenvoll
und mutig in den Gefahren der staatlichen Welt bewegen, ohne
sich von der Hoffnung auf ein Nachleben und von dem Gedanken
an diese Belohnung leiten zu lassen. Es gibt viele Gründe, die
mich annehmen lassen, die Seelen der Redlichen seien göttlich
und ewig, vor allem aber ist es dieser, weil sich gerade in
den Besten und Weisesten das Vorgefühl des Nachlebens darin
äußert, daß sie nur das Ewige schauen zu können scheinen ...
Klein, ihr Quiriten, ist die Bahn des Lebens, die uns die
Natur abgesteckt hat, unendlich die des Ruhms. Wenn wir mit
diesem Ruhme diejenigen auszeichnen, die das Leben bereits
überwunden haben, dann werden wir erreichen, daß uns selber
einst im Tode eine größere Gerechtigkeit zuteil werden wird."
(Rabir 29)
Die Hoffnung der viri boni - denn nur für diese gilt die
Hoffnung - auf ein Weiterleben im Diesseits und im Jenseits,
im Ruhm bei den Menschen und in der ewigen Gemeinschaft mit
den Göttern, ist die Kraft, von der sich Cicero, als er diese
Sätze schrieb, getragen fühlte. Offenbar ist ihm in der Zeit,
da er unter der Undankbarkeit seiner Mitmenschen litt, die
Philosophie zur Trösterin geworden. Von dieser Zeit an wird er
79
das
immer wieder das Bedürfnis haben, seinen Glauben an
Nachleben zu bekennen.
Vier Jahre nach der Veröffentlichung der konsularischen Reden,
im Jahr 56, hatte er den Volkstribunen Sestius zu verteidigen,
und wieder benutzte er die spätere Veröffentlichung der Rede,
um sie durch Ausführungen, die er in den Verhandlungen vor den
Richtern kaum hätte vorbringen können, zu erweitern. Die neue
Wunde, die er inzwischen empfangen hatte, war seine Verbannung
gewesen, eine Demütigung, die ihn zunächst hatte verzweifeln
lassen und die er auch nach seiner unerwartet frühen Rückkehr
lange Zeit nicht vergessen konnte. (Sest. 47)
Bei den Bemerkungen über die Fragwürdigkeit des irdischen
Lebens und über das Schicksal, das die Seele im Tod erwartet,
hat Cicero sich in dieser Rede ausdrücklich auf das Studium
der Philosophie berufen (47): nihil audieram, nihil videram,
nihil ipse legendo quaerendoque cognoveram? - "War ich denn so
einfältig,
so
unwissend,
so
bar
aller
Vernunft
und
Überlegungskraft? Hatte ich nichts gehört, nichts gesehen,
nichts durch Lesen und Forschen gelernt? Wußte ich nicht, daß
die Bahn des Lebens kurz, die des Ruhmes ewig ist - daß man,
da allem der Tod vorbestimmt ist, wünschen muß, es möge
sichtbar sein, daß man das Leben, das ja der zwingenden Macht
des Todes unterworfen ist, vielmehr dem Vaterlande zum Opfer
gebracht als der Natur aufgespart habe? Wußte ich nicht, daß
die größten Philosophen miteinander im Streit gelegen haben,
indem die einen erklärten, das Denken und Fühlen der Menschen
werde im Tode ausgelöscht, die anderen aber, die Seelen der
weisen und tapferen Männer besäßen gerade dann, wenn sie vom
Körper
abgeschieden
seien,
am
meisten
Empfindung
und
Lebenskraft, und daß von diesen beiden Möglichkeiten die
erste, nämlich das Fehlen aller Empfindung, kein Grund zur
Flucht, die zweite aber, das Leben im Besitz einer feineren
Empfindung, sogar zu wünschen sei? Und schließlich: Da ich
alles immer auf die Würde ausgerichtet hatte und der Meinung
war, daß ohne diese dem Menschen nichts im Leben erstebenswert
sein darf, und da in Athen sogar junge Mädchen, die Töchter,
wenn ich mich nicht irre, des Königs Erechtheus, für ihr
Vaterland den Tod verachtet haben, hätte da etwa ich, der
einstige Konsul, der so große Taten vollbracht hatte, mich
fürchten sollen?"
In dem Werk über den Staat läßt er die großen Führer des
römischen Volks unsterblich sein, dem irdischen Ruhm aber hat
er hier, in dieser Schrift der Besinnung auf Rom und die in
seiner Geschichte wirksamen Kräfte, keine Bedeutung mehr
zuerkannt. Da er selbst zu oft erfahren hatte, wie rasch das
Urteil der Menschen wechseln und wie leicht der Ruhm
verfliegen kann, hat er vielmehr das Wagnis unternommen, die
Ruhmbegierde, die eine der Grundkräfte des römischen Lebens
war, wenn nicht ihres Wertes gänzlich zu berauben, so doch
80
entschlossen von dieser Welt zu lösen. Die nüchternen
Feststellungen
der
griechischen
Philosophie
über
die
Begrenztheit des Ruhmens haben ihm dabei wesentliche Hilfe
geleistet.
Ein letztes mal hat sich Cicero über das Verlangen des
Menschen nach Unsterblichkeit in den Tusculanen geäußert.
Wieder werden in eigenartiger Weise die Gedanken von der
Unsterblichkeit der Seele und vom Nachleben im diesseitigen
Ruhm miteinander verbunden. Der erste Teil (1,26ff.) spricht
von dem Glauben an die Unsterblichkeit. Dann (32) heißt es
wieder: "Was wohl haben in unserem Staat die vielen großen
Männer gedacht, die dem Staate ihr Leben geopfet haben? Sollte
ihr Name in den Grenzen des Lebens eingeschlossen bleiben?
Niemals wird sich jemand ohne die zuversichtliche Hoffnung auf
die Unsterblichkeit für das Vaterland dem Tode darbieten. In
Ruhe hätte Themistokles, hätte Epaminondas, hätte - um nicht
nur ältere und fremdländische Beispiele anzuführen - ich
selbst das Dasein verbringen können, aber es lebt in allen
Seelen gewissermaßen ein Ahnungsvermögen, das sich auf die
künftigen Jahrhunderte richtet, und gerade in den größten
Geistern und den stolzesten Seelen entfaltet es sich und tritt
am leichtesten hervor. Gäbe es dieses nicht, wäre wohl keiner
so töricht, stets in Mühen und Gefahren zu leben."
Die Tusculanen, in denen diese Sätze stehen, sind ein Teil des
großen philosophischen Spätwerks, das Cicero im Alter von etwa
60 Jahren begonnen und in der unfaßbar kurzen Zeit von zwei
bis drei Jahren zum Abschluß gebracht hat. Wie viele Fragen,
die hier behandelt werden, von ihm schon früher durchdacht und
geklärt worden sind, ist nicht an jeder Stelle so deutlich zu
erkennen wie in der Erörterung der Unsterblichkeit. Man spürt
aber auch sonst überall, wie tief die Grundlagen hinabreichen,
auf denen sich der weiträumige Bau erhebt. Diese große
Leistung hätte auch von einem so beweglichen und unermüdlich
fleißigen Künstler, wie Cicero es war, niemals in so kurzer
Zeit bewältigt werden können, wenn ihm nicht sehr reichliche
eigene
Vorarbeiten
und
Vorentscheidungen
zur
Verfügung
gestanden wären. Für die Nachwelt ist diese Aufarbeitung der
griechischen Philosophie, in welche die Erfahrungen eines
großen römischen Lebens eingegangen sind, die wertvollste
Gabe, die sie von Cicero empfangen hat. Nur durch Ciceros
vermittelnde Tätigkeit ist Europa in dunklen Zeiten die
erweckende
Kraft
der
griechischen
Philosophie
erhalten
geblieben, und sein klares, besonnenes Wort, das jeweils die
gegensätzlichen Auffassungen prüfend nebeneinanderstellte, ist
im Ablauf der Jahrhunderte immer wieder eine unschätzbare
Hilfe gewesen, wenn es galt, das Recht und die Pflicht des
freien Denkens ins Bewußtsein zu erheben. Daß aber Cicero als
Schriftsteller sein für die geistige Freiheit so notwendiges
81
Werk gerade in einer Zeit der Unfreiheit verfaßt hat, während
er durch Caesar zum Schweigen gezwungen war, ist eine
Tatsache, die an die 'List' des Weltgeistes denken läßt, der
dem Bösen nur deswegen den Triumph gestattet, damit das Gute
siegen werde.
Auch Cicero selbst durfte seine Leistung trotz dem Unwillen,
der ihn oft überkam, als die eigentliche Erfüllung seines
Lebens betrachten, das bei allen Wechselfällen doch in einer
erstaunlichen Folgerichtigkeit verlaufen war und in dem sogar
der Verlust sich in Gewinn verwandelte. Philosophieren ist ihm
von den Jugendjahren an seine liebste Tätigkeit gewesen. Wenn
er am Ende seines Lebens, in der Zeit des erzwungenen
Schweigens, von der Freude, der delectatio animi, spricht, die
in der Beschäftigung mit der Philosophie gewonnen werden kann
(acad. 1,11; off. 2,2ff.), wenn er die Philosophie als das
größte und schönste Geschenk bezeichnet, das die Götter den
Menschen gegeben haben, (acad. 1,7; leg. 1,58; ad fam. 15,4),
wenn er bekennt, daß die Philosophie uns Menschen "die Ruhe
des Lebens gespendet und die Furcht vor dem Tode genommen
hat", und wenn er von ihr rühmt, daß sie "die Seelen heilt,
nichtige Beunruhigungen beseitigt, von Begierden befreit,
Ängste verscheucht" (Tusc. 5,4f.; Tusc. 2,11), dann sind
dieses Äußerungen, in denen, wie es der Lage entspricht, die
Dankbarkeit für den Trost und die Stärkung, die er von der
Philosophie empfangen hat (off. 2,2ff.; nat.deor. 1,7ff.;
divin. 2,4ff.), alle anderen Empfindungen überwiegt. Es hat
aber Zeiten gegeben, in denen er des Trostes noch nicht
bedurfte. Bereits in der Jugend war seine natürliche
Bildungsfreude für die Philosophie gewonnen worden, und er
hatte das Glück gehabt, in Rom sowohl wie in Griechenland
Lehrer zu finden, welche ihn gleichzeitig in der Redekunst,
die er für die Tätigkeit im Staat und in der Gesellschaft
benötigte, und in der Philosophie unterrichten konnten.
Der Lehrer, dem er den Gedanken der Versöhnung von Philosophie
und Redekunst verdankt, wird niemand anderer als Philon von
Larissa , der damalige Schulvorsteher der Akademie, gewesen
sein, den Cicero gerade am Beginn seiner - wenn man so sagen
darf - beruflichen Ausbildung, Anfang der achtziger Jahre, in
Rom gehört hatte, admirabili quodam ad philosophiam studio
concitatus (Brut. 306), und dem er unter anderem auch die
Überzeugung
von
der
Notwendigkeit
der
Skepsis,
der
Zurückhaltung im Urteil, verdankte, die er sich schon früh zur
Pflicht gemacht hat (inv. 1,1ff.).
Schon beim Studium in Athen hatte er erwogen, wenn ihm infolge
der politischen Verhältnisse die Rückkehr nach Rom nicht
möglich sein sollte, sich ganz der Philosophie zu widmen.
Zwanzig Jahre später konnte er im Hinblick auf das Unrecht,
das ihm nach seinem Konsulat widerfahren war, aber auch wohl
82
in Erinnerung an jene frühe Erwägung, zu seinem Freunde
Atticus sagen (Att. 2, 5, 2: April 59): "Was rede ich von der
Politik? Ich will sie aufgeben und mit ganzer Seele und allem
Fleiß philosophieren ... Hätte ich es nur von Anfang an getan.
Nun aber, da ich erfahren habe, wie sinnlos ist, was ich für
herrlich gehalten hatte, gedenke ich mit allen Musen
Beziehungen zu pflegen"; und wenig später (2, 13, 2): "Wir
wollen philosophieren - auf meinen Eid kann ich dir sagen, es
gibt nichts, was dem gleich käme" oder (2, 16, 3): "So wollen
wir uns denn, mein lieber Titus, jenen herrlichen Studien
widmen und zu der Tätigkeit, die wir niemals hätten verlassen
sollen, zurückkehren." Ähnlich klingt es in der Zeit, als er
die Arbeit am Werk über den Staat begann (Att. 4, 18, 2;
Oktober 54): "Das Leben, das am meisten meiner Natur
entspricht - zu diesem kehre ich nun zurück, zu den Büchern,
zu meinen Studien ... ich kann mit euch philosophieren."
Neben solchen zwanglosen Bemerkungen in den Briefen stehen die
für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilungen in den Vorreden
zu einzelnen Büchern des großen philosophischen Spätwerks.
Tusc. 5,5: "Alle Besserung muß man bei der Philosophie suchen.
Nachdem uns schon in unserer ersten Lebenszeit unser Wille und
unsere Neigung in ihren Schoß geführt hatte, sind wir nun in
diesen schweren Bedrängnissen, von heftigem Sturm geschüttelt,
in denselben Hafen geflüchtet, von dem wir ausgelaufen waren."
Off.2,4: "Weil ich nicht untätig sein konnte, glaubte ich, da
ich mich von Jugend an mit der Philosophie beschäftigt hatte,
ich könnte mich auf die ehrenvollste Weise von den
Widrigkeiten befreien, wenn ich zu ihr zurückkehrte. Auf sie
hatte ich in meiner Jugend im Lernen viel Zeit verwendet; als
ich später die Ämterlaufbahn begann und mich ganz dem Staat
widmete, blieb ihr so viel Platz zugewiesen, wie von dem Staat
und den Freunden nicht beansprucht wurde. Dieses aber wurde
ganz mit Lesen verbracht, für das Schreiben hatte ich nicht
die Ruhe." Nat.deor. 1,6: (Viele werden sich wundern, daß wir
jetzt die akademische Skepsis erneuern.) "Wir haben aber nicht
unvermittelt zu philosophieren begonnen. Von der ersten Zeit
unseres Lebens an haben wir Fleiß und Mühe auf diese Tätigkeit
verwendet, und dann, wenn es am wenigsten sichtbar war, haben
wir am meisten philosophiert (cum minime videbamur, tum maxime
philosophabamur)."
Daß man ihn auch in dieser Zeit als Philosophen ansehen
sollte, besorgte er, indem er auf seinem Ruhesitz in Tusculum
die beiden Wandelhallen errichten ließ, die er mit den stolzen
Namen Academia und Lyceum schmückte.
Was hat Cicero nun eigentlich unter Philosophie verstanden?
Daß Cicero, der Akademiker, in seiner Studienzeit die ganze
Enkyklios
Paideia,
die
Wortsowohl
wie
die
Zahlwissenschaften, in sich aufgenommen hat, darf ohne
weiteres vermutet werden. Vor allem aber muß für ihn Dialektik
83
wichtig sein, Platons königliche Kunst, mit deren Hilfe Platon
selber einst im 'Phaidros' (265 d/e) die übliche Redekunst als
Scheinkunst erwiesen hatte und die seit diesem förderlichen
Tadel so eng mit allem Reden verbunden blieb, daß Zenon, der
Stoiker, in einem bekannten Satz die Dialektik mit der
geballten, die Redekunst mit der geöffneten Hand vergleichen
konnte. (Sext.Emp. 2,7; Cic. fin. 2,17; or. 113;). Ja, man
darf behaupten, daß Cicero sehr oft, wenn er von der
Philosophie im allgemeinen sprach, mehr als alles andere
gerade diese für den Redner unabweisliche Dialektik im Sinne
hatte. (Es ist bemerkenswert, daß Cicero, wo er die
Philosophie als Geschenk der Götter bezeichnet, ein Wort
verwendet, das ihm zunächst zwar aus Platons Timaios vertraut
war (47 b philosophias genos, hou meizon agathon out' elthen
oute hexei potè to thneto génei dorethèn ek theon), das aber
in Platons Philebos insbesondere der Dialektik galt: 16c theon
mèn eis anthrópous dósis, hós ge kataphainetai emoí, póthen ek
theon erríphe diá tinos Promethéos háma phanotáto tinì pyrí;).
Sie, in der er sich, schon als er in Rom bei dem Stoiker
Diodotos seinen ersten philosophischen Unterricht empfing,
studiosissime geübt (Brut. 309) und in der sich fortzubilden
er in Athen bei den scharfsinnigen Akademikern die beste
Gelegenheit gefunden hatte, war die umfassendste aller
Wissenschaften und so viel bedeutender als jede andere, als
nach der von Platon begründeten Überzeugung ohne ihre
Mitwirkung eine Wissenschaft überhaupt nicht Wissenschaft sein
konnte. (Vgl. de or. 1,188; Brut. 152.) Denn die Fähigkeit,
die durch diese ars disserendi, die Kunst also der
'Auseinandersetzung' oder der Erörterung, verliehen wurde,
war, wie Platon gelehrt hatte, einmal das Vermögen, richtig zu
trennen
und
zusammenzufügen,
zum
anderen,
richtige
Begriffsbestimmungen zu gewinnen. Das Teilen, das entweder als
Einteilen, dividere, oder als Aufteilen, partiri, vor sich
gehen konnte, (Einteilen = Zerlegen in Unterteile, etwa das
genus in die species; Aufteilen = Zerlegen in Bestandteile) 101
gestattete dem Redner nicht nur, das zunächst Unüberschaubare
überschaubar zu machen, sondern auch den Einzelfall und das
Einzelstück
durch
Einordnen
in
die
übergreifenden
Zusammenhänge verständlich werden zu lassen. Die richtige
Begriffsbestimmung andererseits gab jeder Aussage den festen
Rückhalt. Die Griechen hatten alle diese Verfahrensweisen in
langer Übung bis zu ihrer Vollendung ausgebildet, und wenn
noch die anspruchslosesten Abrisse einzelner Wissenschaften,
etwa Ciceros Schrift "De inventione" oder die Behandlung der
sieben Freien Künste bei Cassiodor und Isidor von Sevilla,
wahre Wunderwerke der Teilung und Begriffsbestimmung sind (was
nicht ausschließt, daß sie uns für den Unterricht recht
101
Den Unterschied von dividere und partiri spricht Cicero an top. 30: in
partitione quasi membra sunt, ut corporis caput, umeri, manus, latera,
crura, pedes et cetera; in divisione formae, quas Graeci eíde vocant.
84
unzweckmäßig zu sein scheinen), dann läßt sich ermessen, was
einst in der mündlichen Belehrung und Übung hatte erreicht
werden können. Für uns, die wir zumeist nur noch in der Musik
die Strenge der Form erleben können, ist mit der antiken
Rhetorik auch die antike Dialektik verlorengegangen, und es
ist daher begreiflich, daß wir Schwierigkeiten haben sie auch
dort wiederzuerkennen, wo sie uns so anschaulich entgegentritt
wie bei Cicero.
Die Stelle Tusc. 5, 68 ff., in der Cicero das Bild des
Philosophen malt, nachdem er am Anfang in bewegenden Worten
von unser aller Schwäche gesprochen hat, sollten Sie in Ruhe
selbst lesen.
Zweieinhalb Jahre, nachdem Cicero dieses abgeklärte, dankbare
Bekenntnis, in dem alle Unruhe seiner Kämpfe überwunden ist,
vorgetragen hatte, ist er ermordet worden. (Hauptstelle ist
Plut. Cic. 47,7ff., wo die Darstellung des Tiro benutzt
ist).102
2.5 Ist bei Cicero philosophisch Neues zu erkennen?
Zunächst stoßen wir auf ein Strukturproblem: das Problem, wie
sich die auf Cicero zulaufende Philosophie zu ihrer eigenen
Geschichte verhalten hat. Das Problem erscheint zum ersten mal
in seinem vollen Sinn bei Aristoteles. Die Philosophie als
geschichtliche
Größe
mit
bestimmtem
Ausgangspunkt
und
bestimmten Entwicklungsformen gibt es erst von ihm an. In der
Vorsokratik und Sokratik herrscht zu allermeist das Pathos
dessen, der als einziger weiß, während alle anderen irrende
Toren sind. In diesem Pathos leben Parmenides und Empedokles,
auch noch der Sokrates der platonischen Apologie. Bei
Aristoteles ist es grundsätzlich anders, nach seiner Meinung
ist der Mensch grundsätzlich auf die Wahrheit hin angelegt;
das was die Menschheit seit jeher geglaubt hat, kann nicht
völlig falsch sein. Es ist sicher unvollkommen und ungeklärt.
Doch gerade dies ist die Aufgabe der Philosophie: nicht ihr
Wissen dem Meinen der Leute entgegenzustellen, sondern aus der
unbestimmten Ahnung der Menschheit eine bestimmte und
begründete Einsicht herauszuarbeiten. Der Begriff des saphôs
légein (um es terminologisch zu sagen) hat bei Aristoteles
eine
Bedeutung,
die
weit
über
das
bloß
Stilistische
hinausreicht; es genüge hier, auf E.E. 1216 b 26-35
hinzuweisen.
Was die früheren Philosophen nur geahnt haben, das vermag
Aristoteles klar auszusprechen; was bei diesem und jenem als
102
Zu diesem Kapitel vgl. v.a. Harald Fuchs, Ciceros Hingabe an die
Philosophie. Museum Helveticum 16 (1959), S.1-28. Abgedruckt in Das neue
Cicerobild. Hrsg.v.Karl Büchner, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1971, (Wege der Forschung Bd.XXVII) S.304-347.
85
Teilwahrheit aufgetaucht war, findet sich in der Philosophie
des Peripatos zu einem Ganzen zusammengeschlossen. Aristoteles
hat seine Lehre bewußt als Vollendung und Synthese der
gesamten philosophischen Tradition aufgefaßt. Er hat damit
gleichzeitig der Tradition als solcher einen philosophischen
Sinn und seiner eigenen Lehre einen geschichtlichen Rückhalt
am consensus philosophorum zu geben versucht.
Aus der von Aristoteles inaugurierten Anschauungsweise ergibt
sich, daß die historisch gegebenen Lehren aufs stärkste
vereinfacht, zusammengerückt und schließlich nur mehr als
Varianten einiger weniger von der Natur der Dinge selbst
angeregter Grundgedanken interpretiert werden. Das Ende ist
der Nachweis eines allen Philosophen gemeinsamen Substrats von
Fragen und Antworten; dieses kann dann sozusagen als
philosophischer Katechismus auch dem Laien dargeboten werden.
<Beispiel: Metaph. A 3-6>
Im hellenistischen Zeitalter zeigt sich ein Unterschied zu
Aristoteles: Karneades-Antiochos fassen nicht ihre eigene
Lehre als das Telos der Philosophiegeschichte auf, wie es
Aristoteles getan hatte. Die Richtung verläuft vielmehr
umgekehrt. Das Telos ist in den "Alten" schon erreicht und in
der späteren Entwicklung wieder verlorengegangen. Es gilt
also, diese Fehlentwicklung zu überwinden und zur Lehre der
"Alten"
zurückzukehren.
Was
bei
Aristoteles
eindeutig
Fortschritt hieß, wird nun zur Hinwendung zu einer als
autoritativ
anerkannten
Klassik.
Gemeinsam
ist
beiden
Haltungen
die
Verankerung
des
Philosophierens
in
der
Geschichte; nur wird die Geschichte hier als Anstieg, dort als
Abfall von einer schon gewonnenen Höhe verstanden.
Entscheidend wird jetzt der Begriff des Klassikers, der
Autorität. Momente, an denen das abzulesen ist, sind etwa:
1. Die Namen, die sich die Philosophen als Anhänger dieser
oder jener Lehre von der Zeit Platons an gegeben haben:
Pythagoreioi, Herakleitoi, Anaxagoreioi... in jedem Fall liegt
darin eine Art von Programm, eine ausdrückliche Bindung an
einen bestimmten Philosophen und seine Lehre. Demokriteios hat
sich
in
seiner
Jugend
Epikur
selbst
genannt.
Von
außerordentlicher Bedeutung ist die Heraklit-Exegese des
Kleanthes gewesen, durch die ein breiter Strom heraklitischer
Gedanken in die Stoa eingegangen ist. An Kleanthes hat
wiederum Poseidonios angeknüpft. Die Großartigkeit seines
Systems, wie es uns Karl Reinhart zu sehen gelehrt hat, beruht
zu einem guten Teil darauf, daß Poseidonios unbekümmert auf
die pathetischen Weltbilder der Vorsokratik zurückgreift.
2. Es gibt Texte, die man nicht mehr nur als Mitteilung
philosophischer Ansichten verwertet, sondern die gültige
Dokumente darstellen, auf die man sich beruft und die man
auslegt, um sich auf sie berufen zu können. Von den
86
Vorsokratikern gehören hierher nur Empedokles und Heraklit. Am
folgenreichsten ist die Erhebung Platons zur Autorität
geworden. Es gab handlich vereinfachende Zusammenfassungen
schon
im
Corpus
Aristotelicum.
Kein
Zweifel,
daß
Schriftsteller wie Polybius und Cicero zu solchen Epitomai
gegriffen haben, wenn sie Platons Schriften benutzen wollten.
Wir wüßten gerne, was in den von Plutarch mor. 1118 C
zitierten Platoniká des Aristoteles eigentlich stand. Der
Titel weist auf Darstellung oder Diskussion von Lehren Platons
hin.
Bekannt
ist,
daß
mit
Krantor
die
Liste
der
Timaioskommentare anhebt, über deren Anlage und Inhalt wir,
was die frühen Kommentare betrifft, auch nichts wissen.
Wahrscheinlich hat man sich auf bestimmte Hauptstellen
konzentriert, und vermutlich hat man sich bemüht, Platon für
das eigene Philosophieren in Anspruch zu nehmen.
Wieder ist Poseidonios typisch. Für ihn ist Platon in manchen
Dingen nicht viel weniger Autorität als Heraklit.
Was die Akademie betrifft, so beginnt im Grunde mit Antiochos
die Zeit, in der sich ihre Mitglieder programmatisch
Platoniker nennen, um die Erneuerung der echten Lehre Platons
und seiner unmittelbaren Schüler zu manifestieren.
3. Für die Schulgeschichte fangen im Jahrhundert Ciceros die
Kategorien der Orthodoxie und Heterodoxie eine beherrschende
Rolle zu spielen an. Man hat sich gegenseitig Abweichen von
der wahren Parteilinie des Marxismus-Leninismus vorgeworfen
wie im 20. Jahrhundert.
Schlagworte wie Eklektizismus und Klassizismus sind letztlich
nicht
geeignet,
das
Verständnis
der
Philosophie
des
Jahrhunderts Ciceros zu fördern. Wenn es Eklektizismus ist,
das eigene Philosophieren geschichtlich zu begründen (und das
wird immer bedeuten: sich selbst als das Telos derjenigen Wege
zu fassen, die in den Traditionen "richtig" sind), dann ist
auch Aristoteles ein Eklektiker gewesen. Und wenn man es
Klassizismus nennen soll, seine eigene Philosophie als die
Auslegung autoritativer Texte der Vergangenheit zu betreiben,
dann ist der ganze Neuplatonismus klassizistisch. Besser wird
es doch wohl sein, von dem einen wie von dem anderen dieser
fatalen Begriffe abzusehen und an den Sachen festzuhalten.
Zwischen dem System und der Geschichte der Philosophie eine
Wechselbeziehung herzustellen ist peripatetische Tradition.
Damit aber die Wendung zu den "Alten" zu verknüpfen ist das
Neue, das im Zeitalter Ciceros sich entfaltet. Es ist nur das
Ende der damit inaugurierten Entwicklung, wenn 500 Jahre
später alle Philosophie in Platonexegese aufgeht.
Eines
der
ersten
und
vornehmsten
Dokumente
jenes
Philosophierens, das durch die Geschichte sich zu den "Alten"
leiten ließ, durch die Bindung an die Autorität der "Alten"
die Philosophie zu erneuern suchte und sie auch in der Tat für
ein halbes Jahrtausend erneuert hat, ist Tusc.Disp. 1. Es
87
stammt aus dem Umkreis des Panaitios, Poseidonios und
Antiochos.103 Es geht darin um die Frage, was der Tod sei und
darum, daß prinzipiell drei Antworten auf diese Frage möglich
sind: Er kann entweder die Zerstörung der Seele bedeuten oder
ihr Hinuntergehen in die Unterwelt oder ihren Aufstieg zum
Himmel. Von diesen drei Möglichkeiten wird die zweite
abgelehnt
als diejenige, die dem Denken des Volkes und der
Dichter vor und außerhalb der Philosophie angehört; sie ist
allerdings nicht ganz verkehrt, sondern enthält ein Stück
möglicher Wahrheit (daß die Seele über den Tod hinaus lebt),
aber in ungeklärter Form, sofern sie übersieht, daß die
Bewegung der Seele in keinem Fall ein Sinken in die Unterwelt
sein kann. Philosophisch im strengen Sinne sind nur die erste
und die dritte Möglichkeit, jene als die minimale, diese als
die maximale. In der Gesamtdisposition werden beide als
äquivalent behandelt. Auch die platonische Apologie zielt in
40 C ff. der Intention nach auf eben diese Möglichkeiten und
ist wie Ciceros Text bereit, das eine zu wünschen, aber auch
mit dem anderen sich zu begnügen. Bedenken wir, welche
Bedeutung allem Anschein nach Platons Apologie für die
Akademie von Arkesilaos an besessen hat und daß Cicero selbst
seine Thesen nicht dogmatisch, sondern nur als wahrscheinlich
verstanden wissen will, so erkennen wir, wie stark die
Aporetik der "Neuen Akademie" da noch einwirkt.
Das ist der locus classicus, an dem sich in den letzten drei
Generationen
der Forschung immer wieder die Frage erhoben
hat, in welchem Sinne bei Cicero philosophisch Neues zu
erkennen sei. Wir können feststellen, daß die genannten drei
Griechen hinter dem Werk stehen: Panaitios, Poseidonios und
Antiochos. Die wissenschaftliche Arbeit an den Lehren dieser
drei ist in den letzten Jahrzehnten überaus intensiv gewesen;
doch Abschließendes haben weder die Genialität K.Reinhardts
noch die vielen wohlmeinenden Versuche über Panaitios und
Antiochos erreicht - am dauerhaftesten werden sich fraglos
W.Theilers
Untersuchungen
über
die
Vorbereitung
des
Neuplatonismus bewähren. Jedenfalls aber bleibt noch viel zu
tun, ehe wir über die drei (und damit auch über den
Philosophen Cicero) einigermaßen Bescheid wissen.104
2.6 Bemerkungen zur Philosophie der Römer
Welche Bedeutung das erste Buch von Ciceros Tusculanen in der
Erforschung
der Philosophie des letzten Jh.s v.Chr besitzt, hat K.Reinhardt in
seiner abschließenden Darstellung des Poseidonios (RE, 1954) noch
einmal
mit größter Prägnanz herausgearbeitet.
104 Vgl. Olof Gigon, Die Erneuerung der Philosophie in der Zeit Ciceros.
Entretiens sur l'antiquité classique, Vandoeuvre-Genève, Tome III,
1955,
S.25-59. Abgedruckt in: Das neue Cicerobild. o.c. S.229-258.
103
88
Die Römer bedeuten in unserer Kultur ein beunruhigendes
Problem. In den Fundamenten unserer gegenwärtigen Kultur, in
der deutschen Klassik hat das Römertum keine feste Stelle im
Bildungsaufbau erhalten. Es hat natürlich immer Stimmen der
Bewunderung für die Zucht des imperium Romanum und seine
Ordnung schaffenden Kräfte gegeben. Im Ganzen aber mußte die
deutsche Klassik ihr großes Geschenk an Europa, die Entdeckung
des originalen Griechentums, bezahlen mit einem Verzicht auf
Rom. Rom trat in den Schatten, schon weil die Hinwendung zu
den
Griechen
ja
zugleich
eine
Abwendung
von
der
gemeineuropäischen, römisch bestimmten Tradition war. Außerdem
schien den Römern gerade das zu fehlen, was man bei den
Griechen suchte und fand: die Originalität. Die römische
Kultur dagegen ist abgeleitet: die Religion, die Kunst, die
gesamte Literatur ist von den Griechen übernommen, sekundär,
unoriginal. Diese Vorstellung hat die Wissenschaft lange Zeit
beherrscht;
sie
herrscht
noch
heute
weithin
in
der
öffentlichen Meinung. Aber daß hiermit nicht das letzte Wort
über die Römer gesagt sein kann, das zeigt schon die heute
noch ungebrochene, lebendige Wirkung der Römer auf andere
europäische Nationen. Es ist Zeit, das überalterte Urteil über
die Römer fortzuräumen. Dabei reicht es nicht, die großartige
römische
Originalität
in
Rechtsund
Staatsschöpfung
hervorzuheben.
Vielmehr
muß
man
zu
einer
Kritik
des
Originalitätsbegriffs überhaupt gelangen. Auch die Griechen
haben nicht aus dem Nichts geschaffen. Der subjektive
Originalitätsbegriff ist die Prägung eines spezifisch modernen
Inidividualismus und kann den antiken Gegenständen nicht
gerecht werden; gerade die Antike muß an die Relativität und
die Grenzen dieses modernen Subjektivismus mahnen.
Die Originalität der Römer liegt gerade in der Aneignung des
Griechischen. "Daß sie die griechische Kultur aufnahmen, war
nicht eigene Schwäche, es war historische Notwendigkeit. Kein
historisch bedeutendes Volk der Mittelmeerwelt hat sich dieser
Notwendigkeit entziehen können. Aber während die anderen
Nationen der Hellenisierung verfielen, sind die Römer gerade
deshalb Römer geblieben oder eigentlich erst geworden, weil
sie sich dem Griechischen weiter geöffnet haben als alle
anderen. Indem sie sich nicht mit der passiven Annahme dessen
begnügten, was damals unwiderstehlich und unentrinnbar von
Griechenland ausstrahlte, sondern es mit kräftiger Aktivität
ergriffen,
drangen
sie
in
die
tieferen
Bezirke
des
Hellenischen sowohl wie des eigenen Wesens; so wurden sie
unter all den bloßen Hellenisten die einzigen Humanisten, mit
Recht von der überlieferten Formulierung das zweite klassische
Volk der Antike bezeichnet."105
Richard Harder, Die Einbürgerung der Philosophie in Rom. In: Das neue
Cicerobild. Hrsg.v.Karl Büchner. Wissensch.Buchges. Darmstadt 1971.
S.11.
105
89
Wenn wir uns heute Unbefangenheit und Gerechtigkeit gegen die
Römer erst durch historische Besinnung wieder erwerben müssen,
so gilt das doppelt von der römischen Philosophie. Denn hier
scheint das Originalitätsproblem akuter zu werden als irgendwo
anders. Seit je gelten die Römer als "das unphilosophische
Volk". Was sie an philosophischer Literatur hervorgebracht
haben,
scheint
sich
einer
klaren
Einordnung
in
die
Philosophiegeschichte zu widersetzen, so daß es entweder als
unproduktiv und oberflächlich gescholten oder mit lahmer
Apologetik entschuldigt wird. Aber die Philosophiegeschichte
ist eben mit der Geschichte der philosophischen Lehren und
Systeme nicht erschöpft. Originalität liegt auch in der
produktiven Auseinandersetzung mit der Tradition. Die römische
Philosophie, die eine Renaissance der griechischen ist, rückt
als ebenbürtiger Gegenstand des historischen, und ich glaube
auch des philosophischen Interesses neben die hellenistischen
und spätantiken Systeme. Richard Harder urteilt: "Denn wenn es
den Römern auch an der denkerischen Intensität mangelt, die
alle bedeutenden griechischen Philosphen auszeichnet, so ist
umso bedeutsamer die Lebensintensität, mit welcher sie die
griechische Lehre ihren nationalen Ordnungen einfügten."
(o.c.13)
Er will daher nicht ausgehen von der Frage: Was bringen die
Römer - dogmengeschichtlich - der Philosophie Neues? sondern
von der andern: Was bringt die Philosophie - lebensmäßig - den
Römern Neues? Damit bekommt man den Blick frei auf die
Phänomene selbst.
2.7
Cicero - Mittel zum Zweck
In der Aufklärung verbreitete sich das Gefühl, daß Cicero nur
Berichterstatter, aber kein "Selbstdenker" sei, daß seine
eigene Stellungnahme durch beklagenswerte Unbeständigkeit, ja
Leichtfertigkeit getrübt werde. Um so mehr mußte die klassiche
deutsche Philosophie, als sie in kraftvoller Besitzergreifung
der griechischen Philosophie die Philosophiegeschichte schuf,
an Cicero vorbeigehen. Die in der nachhegelischen Zeit sich
intensivierende Philosophiegeschichte ist dann, da sie das
gesamte Material umfassend ergriff, auch auf Cicero gestoßen;
für ihr Urteil ist typisch Zeller, der die "Oberflächlichkeit,
die sich der Unbeständigkeit noch rühmt" getadelt hat. Es kam
noch ärger. Die Geschichte der Philosophie ist durch neue,
ungemein komplizierte Methoden ihrer Erforschung eine eigene
Wissenschaft geworden. Hermann Useners und seiner Schüler
Leistung ist dabei besonders hervorzuheben, durch die mit
intensivsten philologischen Mitteln jene Epochen der antiken
Aus: Richard Harder, Kleine Schriften, München: Beck 1960, S. 330-353.
(Die Antike Bd. V/1929, S.291-316. Ein Vortrag.)
90
Philosophie erschlossen werden konnten, die uns in der
Überlieferung fast gänzlich verlorengegangen sind, nämlich der
Vorsokratiker
und
der
hellenistischen
Philosophie.
Im
Zusammenhang damit erhielt die Beschäftigung mit Cicero eine
neue Zielsetzung. Es wurde gefragt, was aus Ciceros Schriften
aus verlorener griechischer Philosophie wiedergewonnen werden
könnte. Die Forschung trat in das Stadium der Quellenkritik.
Cicero wurde zum Scherbenberg, aus dem gleichsam die
wertvollen
alten
Gefäße
mühsam
zusammengesucht
und
zusammengefügt werden sollten. Man suchte die "Arbeitsweise"
Ciceros zu ermitteln, seine schriftstellerischen Gewohnheiten
und Unarten, die Abschreibfehler und Mißverständnisse, die
Nähte und Zwischenstücke, an denen die verschiedenen Vorlagen
zusammengefügt waren. Ciceros Schriften wurden ein wichtiges
Objekt der mit immer schärferen Messern, immer feineren
Schnitten arbeitenden philologischen Sezierkunst, aber aus dem
Bestand der lebendigen Bildungsmächte, in denen sich der Wert
der Antike repräsentiert, hat man sie gestrichen.
Auf der anderen Seite ist zu sehen, daß Cicero mit seiner
philosophischen
Schriftstellerei
als
solcher,
mit
der
literarischen Formung Geschichte gemacht hat. Die Philosophie
hat durch ihn in Rom Fuß gefaßt. Im Scipionenkreis war sie
noch Privatsache. Keiner aus dem adeligen Freundeskreis hat
das neue Lebensideal der humanitas so sehr als öffentliche
Angelegenheit empfunden, daß er ihm nun literarisch geformten
Ausdruck in lateinischer Sprache gegeben hätte. Das hat erst
Cicero vollbracht. Auch sofern die Bücher Ciceros bloße
Übersetzungen sind, kommt ihnen größte historische Bedeutung
zu. Denn Übersetzung bedeutet nicht nur Hingegebenheit und
Abhängigkeit, sondern auch Aneignung, Befreiung vom Original
durch die Kraft geistiger und sprachlicher Formen in
lateinische Sprache als ruhmvolle Kulturleistung - sowenig das
unserem modernen Originalitätsdünkel einleuchten will.
Außerdem übersetzt Cicero immer nur im einzelnen; als Ganzes
sind seine Bücher eigene literarische Produktionen; der Stoff
stammt von den Griechen, die literarische Gestaltung ist
ciceronisch; sie gibt dem Stoff auch da, wo sie ihn
unverändert
übernimmt,
einen
neuen
Zusammenhang,
die
Philosophie wird in eine römische, ciceronische Ordnung
einbezogen - und zwar durch die literarische Formung, durch
das Buch.
Der Zusammenhang von Philosophie und Schriftlichkeit könnte
Gegenstand einer eigenen Reflexion sein. Von der Problematik
philosophischer Schriftstellerei hat nicht erst Nietzsche
gewußt; sie spricht am eindringlichsten aus den berühmten
Äußerungen Platons, welche die Übermittlung seiner Philosophie
auf schriftlichem Wege geradezu für unmöglich erklären. Und
doch sind es Philosophen gewesen, die das Buch im eigentlichen
91
Sinn, das Prosabuch überhaupt erst geschaffen haben; die
frühesten griechischen Prosabücher sind die der ionischen
Denker und Forscher. Daneben begegnet uns unter antiken
Philosophen
häufiger
der
völlige
Verzicht
auf
jede
Schriftstellerei. Das bedeutet keineswegs einen Verzicht auf
Wirkung, sondern ist charakteristisch für solche Philosophen,
die in enger Verbindung mit einer Gemeinschaft stehen, sei es
der Kreis einer Schule, eines Ordens, einer Polis. Cicero hat
die Philosophie in Rom eingebürgert, ihr das dauernde
Bürgerrecht in Rom verschafft. Er beschwört und verewigt das
Gedächtnis einer vergangenen Epoche gewissermaßen als ihr
letzter Zeuge und hält dieses Erinnerungsbild seiner Mitwelt
vor Augen. Wie Plato vereinigt er sozusagen die beiden Typen
des schriftlichen und mündlichen Philosophierens. Wie Plato
durch den Mund des Sokrates, so spricht Cicero in der
ursprünglichen und endgültigen Fassung des Staatswerks nicht
geradeswegs im eigenen Namen, sondern aus der Person des
Vertreters
der
römischen
Menschlichkeit,
des
Scipio
Aemilianus. Eine verwandte historische Situation, die Stellung
in einer zerbrechenden Kulturwelt, und eine verwandte innere
Haltung zur Bildung: das hat der Dialog Ciceros mit Platon
gemeinsam.
Schließlich ist der Zusammenhang von Philosophie und Politik
zu bedenken. Seit langer Zeit stoßen die beiden bei Cicero
wieder aufeinander. Für Plato war die Philosophie Politik:
eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Für den
hellenistischen Philosophen ist, nachdem die Polis durch die
Beamtenmonarchie abgelöst ist, die Politik kein zentrales
Lebensproblem mehr; wenn im Hellenismus darüber debattiert
wird, "ob der Weise Politik treiben soll", so hat das etwa das
gleiche Gewicht wie die Frage, ob er eine Ehe eingehen soll;
und wenn manche Philosophen aktiv am Staatsleben ihrer Heimat
teilnehmen, so handelt es sich dabei nicht mehr um große
Politik, sondern um Verwaltung, um Kommunalpolitik. In Rom
zuerst sind es wieder primär politische Menschen, mit denen es
die Philosophie zu tun hat.
Das neue menschliche Ergriffensein von der Philosophie erklärt
vielleicht Mängel und Schönheitsfehler, die Ciceros Bücher im
einzelnen für den aufweisen, der griechische Philosophie in
ihnen sucht; es nötigt uns aber auch Bewunderung ab, daß
Cicero die Philosophie davor bewahrt hat, zur Heilslehre
abzusinken. Seine philosophische Schriftstellerei ist von
schwer abzuschätzender welthistorischer Bedeutung. Durch
Ciceros Bücher hindurch hat griechische Philosophie die
moderne Entwicklung entscheidend beeinflußt. Durch seine
Gestaltung der humanitas hat er die römische Bildungstradition
erweckt und für immer am Leben gehalten. Seine Hinwendung zu
Plato ist ein ernster, folgenschwerer Schritt: durch Cicero
92
hat der Platonismus in einer faßlichen Form jahrhundertelang
auf das Abendland gewirkt und es so reif gemacht zur
schrittweisen Aufnahme des originalen Plato.
In Griechenland hat die Philosophie in einer die Jahrhunderte
kraftvoll und ruhig überdauernden schulmäßigen Tradition
gelebt; im Abendland gibt es in diesem griechischen Sinn keine
philosophische Schule, sondern hier bleibt die Philosophie
immer gebunden an das Individuum, bestimmt durch ein neues,
persönliches Erleben und Ergreifen durch den einzelnen.
3. Ciceros philosophisches Schrifttum im Überblick
3.1 Consolatio und Hortensius
Von Ciceros edierten Reden ist mehr als die Hälfte erhalten,
von der edierten Korrespondenz ebenfalls etwa die Hälfte.
Nicht
erhalten
ist
der
Anfang
seines
philosophischen
Schrifttums: die Consolatio und der Hortensius.
Der Tod seiner geliebten Tochter Tullia im Februar 45 hat
Cicero mehr als alles davor erschüttert. Dieser Schlag stellte
seine philosophische Tätigkeit unter neue Aspekte. Es kam
hinzu der Aspekt des Trostes in schwerem, fast unerträglichem
Leid. Cicero schrieb sich selbst - und das war etwas Neues seine Consolatio.
Beim Hortensius ist es fast verwunderlich, daß er nicht
erhalten geblieben ist, denn zu Augustins Zeiten gehörte er zu
den im rhetorischen Kurs üblichen Büchern. Augustin bekennt,
daß das Buch ihm nicht, wie beabsichtigt, zur stilistischen
Verfeinerung diente, sondern ihn zu Gott führte. Es war eine
Einleitung in die Philosophie, über die man sich dank
erhaltener Fragmente ein ganz gutes Bild machen kann. Cicero
hat Hortensius, seinem Gegner als Anwalt und Redner, ein
ehrenhaftes Denkmal gesetzt, indem er ihn zum Adressaten
seiner exhortatio ad philosophiam machte. Die Schrift stand
stark unter dem Einfluß des berühmten aristotelischen
Protreptikòs eis philosophían, der allerdings kein Dialog war.
Eine interessante Differenz zwischen den beiden liegt auch
darin, daß der junge Aristoteles im stolzen Bewußtsein der
Entwicklung des Denkens seit Sokrates die überschwängliche
Hoffnung aussprach, die Philosophie werde nach den gewaltigen
Erfolgen der letzten Zeit wohl bald ihre Vollendung erreicht
haben (fgm. 8 Ross, vgl. Tusc. 3,69). Cicero, in dessen Mund
zu seiner Zeit eine solche Äußerung einfach lächerlich gewirkt
hätte, vertrat hier eine ganz andere Ansicht. Bei Augustin
nämlich, in seiner Schrift 'contra Academicos', bringt
Licentius, ganz erfüllt von den bei der Lektüre des
'Hortensius' empfangenen Eindrücken (c.acad. 1, 1, 4), ein
Cicerozitat, das wohl trotz Fehlens eines ausdrücklichen
93
Hinweises im Text dem 'Hortensius' zuzuweisen ist: ... beatum
esse, qui veritatem investigat, etiamsi ad eius inventionem
non valeat pervenire (c.acad. 1 ,3, 7).
3.2 Akademische Untersuchungen.
Cicero hat sie zweimal herausgegeben. Erhalten ist das eine
der beiden Bücher, das zweite ("Lucullus"), aus der ersten
Auflage. Von der zweiten Auflage ist nur ein kleiner Teil am
Anfang
des
ersten
Buchs
erhalten.
Die
'akademischen
Untersuchungen' haben es mit Fragen der Erkenntnistheorie zu
tun, wie sie gerade in der Akademie zunächst im Kampf mit den
sich im Besitz eines festen Kriteriums der Wahrheit wähnenden
Stoikern, dann im inneren Leben der Schule selbst bei der von
Philon andeutungsweise, von Antiochos radikal durchgeführten
Aufgabe des skeptischen Standpunkts von Bedeutung waren. Vom
modernen Standpunkt aus erscheint es ganz natürlich, daß
Cicero die beabsichtigte Gesamtdarstellung der Philosophie im
Lateinischen gerade mit den grundlegenden Erkenntnisproblemen
beginnt; für Cicero freilich ist - ganz im Gegensatz zur
Moderne - die ethische Wertlehre Grundlage, wie er an einer
bekannten Stelle in Rückschau auf seine philosophische
Schriftstellerei
formuliert:
cumque
fundamentum
esset
philosophiae
positum
in
finibus
bonorum
et
malorum,
perpurgatus est is locus a nobis quinque libris (div. 2, 2).
Im Lucullus wird eine kontradiktorische Verhandlung vorgeführt
zwischen dem Titelhelden, der nach eigener Angabe die
Ansichten des Antiochos wiedergibt, und Cicero, der sich zum
Anwalt
jener
aufgegebenen,
nach
eigener
Behauptung
(nat.deor.1,11) überwundenen skeptischen Akademie macht.
Die Rede des Lucullus ist ein Meisterstück in Inhalt und
formaler Anlage; ihr gegenüber wirken die kleinlichen
Besserwissereien
der
Quellenanalytiker
fast
ein
wenig
lächerlich. Sie setzen - völlig unbewiesen - voraus, daß ein
schlechthin vollkommenes griechisches Original verdreht und
verdorben worden ist. Man sollte statt dessen die besondere
Leistung Ciceros würdigen, daß er nämlich eine lateinische
Kunstsprache
für
die
Philosophie
geschaffen
hat.
Die
philosophische
Debatte
fordert
substantivische
Begriffsbezeichnungen; und Cicero mußte z.B. für katálepsis
comprehensio, cognitio, perceptio wählen. In einer humorvollen
Wendung macht Cicero/Lucullus selbst auf das hier Geleistete
aufmerksam, anläßlich des terminus enárgeia: perspicuitatem
aut evidentiam nos, si placet, nominemus fabricemurque, si
opus erit, verba, nec hic sibi (me appellabat iocans) hoc
licere soli putet (17). Doch die Leistung geht weit über die
Schaffung einzelner Worte hinaus. Die ganzen Debatten mußten
aus
einem
geschmeidigen,
seit
Jahrhunderten
dafür
vorbereiteten Idiom in eine Sprache übersetzt werden, die
94
zunächst wohl eher hilflos anmutete. Dazu kommt die große
Schwierigkeit der Materie speziell bei den Academici libri,
die faßlich darzustellen keine leichte Sache war.
3.3 De finibus bonorum et malorum
Im Briefwechsel mit Atticus kann man die Entstehung dieser
Schrift genau vefolgen. Am 16.März 45 finden wir Cicero
bereits mit der Frage beschäftigt, welchen Personen er in
einem Werk über Epikur Rollen zuweisen solle (Att. 12,12,2).
Am 30.Juni kommt schon die Nachricht, ..confeci quinque libros
perì telon (Att. 13,19,4). Anfang Juli werden diese Bücher von
den
Schreibern
Ciceros,
dann
von
denen
des
Atticus
abgeschrieben, und Cicero beklagt sich, daß manche Leute sich
schon bevor das Manuskript ganz ausgefeilt war, durch Hilfe
der Schreiber des Atticus Einblick verschafft haben.
Cicero, ein Meister auch in ständiger Variierung der
dialogischen Form, hat dieses Mal drei völlig voneinander
unabhängige
Gespräche
geschaffen,
die
einerseits
die
Lehrmeinungen dreier philosophischer Richtungen über die
höchsten oder äußersten Grenzpunkte der Gütertafel und der
Übelliste, zugleich auch ihre Kritik vorführen.
Im ersten Gespräch ist T.Manlius Torquatus Kontrahent.
Gleich zu Beginn der Unterhaltung bemerkt Cicero auf die
Frage, was ihm denn an Epikur so sehr mißfalle (17), außer der
in diesem Zusammenhang unvermeidlichen declinatio der Atome
(17-20) und einigen anderen Bedenken aus dem Bereich der
Physik (20f.) und Logik (22), es sei einfach unverständlich,
daß der erste Träger des Namens Torquatus jene Halskette dem
Gallier entrissen habe, ut aliquam ex eo perciperet corpore
voluptatem (23), oder daß jener andere Torquatus, Konsul des
Jahres 165, als er, gegen den eigenen, schuldig gewordenen
Sohn
mit
äußerster
severitas
vorging,
dabei
ans
Privatvergnügen (de voluptatibus suis, 24) gedacht habe.
Torquatus
ist
nicht
unempfänglich
für
die
ehrenvolle
Erinnerung an seine Ahnen, läßt sich aber dadurch nicht
bestechen (28f.): auf das Problem der voluptas eingehend,
beginnt er in der bei ihm gewohnten epikureischen Klarheit mit
der Feststellung Epikurs, von der Geburt an strebten alle
Lebewesen nach Teilhabe an der Lust und Freiheit vom Schmerz
(30);
über diese Tatsache, die den unverbildeten und
unverfälschten
Zustand
der
Natur
widerspiegelte,
sei
ebensowenig zu disputieren, wie darüber, ob Honig süß, Schnee
weiß oder Feuer heiß sei. In der Praxis freilich sei das
schwieriger, als es zunächst scheine (32f.): die Lebenskunst
der Weisen beruhe darauf, in geschicktem delectus (33) mit dem
wohlbedachten Kalkül jener compensatio, die den Kern der
praktischen epikureischen Moral ausmacht, seine Entscheidung
95
zu treffen und dabei bisweilen auch auf eine Lust zu
verzichten oder einen Schmerz in Kauf zu nehmen (33). Damit
ist auch die von Cicero aufgeworfene Frage beantwortet: nicht
virtus an sich sei das Motiv jener zweifellos herrlichen Taten
gewesen (34f.); alles geschah, ut aut voluptates omittantur
maiorum
voluptatum
adipiscendarum
causa,
aut
dolores
suscipiantur maiorum dolorum effugiendorum causa (36).
Den Inhalt ganz zu referieren, würde zu weit führen. Geschickt
benutzt Cicero u.a. das Testament des Epikur, die Unklarheiten
in dessen Lustbegriff herauszuarbeiten.
Das zweite Gespräch - mit Cato - handelt von der Meinung der
Stoiker vom höchsten Gut und Übel (fin.3 und 4). Cato
bedauert, daß Cicero so wenig Neigung für die Stoa zeigt.
Cicero antwortet mit der These des Antiochos, daß doch die im
wesentlichen aus der Namengebung entspringenden Unterschiede
nicht die grundsätzliche Einigkeit in der Sache aufheben
können: ratio enim nostra consentit, pugnat oratio. Das
bestreitet freilich Cato ganz entschieden, und damit ist man
beim Thema.
Cato geht in seiner Argumentation von einem principium naturae
(20) aus (3,16f.): als solches ist die voluptas der Epikureer
unbrauchbar (17), denn noch ehe Lust und Schmerz dem Lebewesen
überhaupt
bekannt
werden,
ist
bei
ihm
der
Selbsterhaltungstrieb zu konstatieren, das Streben nach
Erhaltung des eigenen status (16). Auch eine gewisse
uninteressierte Entdeckerfreude der Kleinen (17E.) gehört zu
den prima elementa naturae (19). Aus ihnen ergibt sich ein
Wertbegriff: aestimabile esse dicunt...id, quod aut ipsum
secundum naturam sit aut tale quid efficiat (20). Daraus
ergibt sich der Pflichtbegriff (officium), griech. kathekon,
20), der auf die Erhaltung des naturgegebenen status und die
Befolgung des Naturgemäßen geht. Eine tiefere Einsicht führt
dazu, diese Auswahl (selectio 20) zu einer dauernden und
harmonischen zu gestalten: der Mensch kommt dazu, in dieser
Harmonie (convenientia, griech. homología, 21) das höchste Gut
zu sehen.
Cicero bemüht sich, in der Darstellung Catos vom Übergang von
der Natur zur Weisheit einen Bruch deutlich hervorzuheben: cum
autem omnia officia a principiis naturae proficiscantur, ab
isdem necesse est proficisci ipsam sapientiam (23). Moral
predigen ist leicht, Moral begründen aber schwer.
Sollte es möglich sein, unter Vermeidung der von Stoikern und
Epikureern begangenen Fehler eine Ethik aufzubauen? Dieser
Versuch wird im dritten Gespräch (fin.5), das also mit Recht
an dieser Stelle des Werkes steht, von dem eklektischen
Standpunkt des Antiochos her unternommen. Man legt Piso nahe,
zu eklären, quaenam sit istius veteris...Academiae de finibus
bonorum Peripateticorumque
sententia (8). Piso hebt in
96
einleitenden Betrachtungen (9f.) die ungeheure Fülle der
Anregungen auf den verschiedensten Gebieten, wie Kosmologie,
Naturwissenschaft, Logik, Rhetorik und Politik, durch das
peripatetisch-akademische Schrifttum hervor und setzt sich
kritisch mit verschiedenen Lösungsversuchen auseinander, die
auf dem Gebiet der fines versucht wurden oder wenigstens
denkbar sind (12f.). Seine eigene positive Darlegung (15f.)
hat mit den Stoikern nicht nur in dem Prinzip des
Selbsterhaltungstriebs (24) den Ausgangspunkt, sondern auch im
weiteren Verlauf eine Reihe wesentlicher Gedanken gemein: mit
fortschreitender Entwicklung tritt zu dem zunächst dumpfen und
unbestimmten Trieb das Bewußtsein (agnoscere 24) und die
Einsicht bei der Wahl des Naturgemäßen (naturae accommodatum
24); dieses freilich als der wahre Lebenszweck differenziert
sich wesentlich für die verschiedenen Lebewesen, so daß das
allgemeine Ziel secundum naturam für den Menschen genauer
bestimmt wird: vivere ex hominis natura undique perfecta et
nihil requirente (26). Damit aber verdienen die für den
Menschen charakteristischen, ihn vom Tier unterscheidenden
Dinge ganz besonderer Fürsorge; zugleich ergibt sich eine
höhere Bewertung des Geistigen gegenüber dem Körperlichen (34)
und innerhalb des Geistigen wieder ein Vorzug des dem
Bewußtsein und Willen zugänglichen Teiles: zu den virtutes non
voluntariae (36) gehören docilitas und memoria, die der Gruppe
der ingeniosi zukommen;
wahre Töchter der Vernunft, des
göttlichen Elements in uns, aber sind die virtutes voluntariae
(a.O.), als deren Vertreter die stoischen Kardinaltugenden
prudentia, temperantia, fortitudo, iustitia genannt werden.
Der wichtige stoische Begriff der Stufenfolge, von dem aus
sich nur so etwas wie ein Wertbegriff begründen läßt, wird
hier deutlicher als bei Cato veranschaulicht.
Im Weiteren wird die Bedeutung von Selbsterkenntnis und
Bewußtsein behandelt und schließlich die Beantwortung der
gestellten Frage gewagt (59): Die Natur hat den Körper teils
bei der Geburt, teils in der späteren Entwicklung vortrefflich
ausgestattet; besonders ist dies auch vom Geist hinsichtlich
seiner zureichenden Sinneskräfte zu sagen. Mit dem besten Teil
des Menschen aber steht es anders: etsi dedit talem mentem,
quae omnem virtutem accipere posset, ingenuitque sine doctrina
notitias parvas rerum maximarum, et quasi instituit docere et
induxit in ea, quae inerant, tamquam elementa virtutis. sed
virtutem ipsam inchoavit, nihil amplius (a.O.). Wie die Sterne
im Licht der Sonne, so verbleichen die bona corporis als
parvae et exiguae accessiones bonorum im Lichte der Tugenden
(71).
Cicero
macht
am
Schluß
auf
eine
Schwierigkeit
aufmerksam: Piso bezeichnete die äußeren Güter immerhin als
Güter, wenn auch geringeren Wertes (80f.); daher der Verdacht:
sapientem esse non esse ad beate vivendum satis (81). Piso
antwortet ganz im Geist des Antiochos: ad beatissime vivendum
parum est, ad beate vero satis (a.O.); die körperlichen Güter
97
vervollständigen das glücklichste Leben, aber so, daß ohne sie
auch ein glückliches Leben möglich ist (71) - das sind
Halbheiten,
mit
den
Merkmalen
eines
schwächlichen
Kompromisses. So schließt auch dieses Gespräch mit einem
Fragezeichen.
3.4 Tusculanae disputationes
Cicero bezeichnet diese Schrift als eine Ergänzung zu De
finibus. In dem Überblick (div. 2,2) charakterisiert er knapp
den Inhalt: totidem subsecuti libri Tusculanarum disputationum
res ad beate vivendum maxime necessarias aperuerunt. primus
enim est de contemnenda morte, secundus de tolerando dolore,
de aegritudine lenienda tertius, quartus de reliquis animi
perturbationibus, quintus eum locum complexus est, qui totam
philosophiam maxime illustrat; docet enim ad beate vivendum
virtutem se ipsa esse contentam.
Grundsätzlich knüpfen beide Schriften, die Tusculanen wie De
finibus, durchaus an den Probabilismus der neuen Akademie an.
3.5 De natura deorum
Das 18.Jh. hat in dem Werk eines der schönsten in lateinischer
Sprache geschriebenen Bücher gesehen. Freilich las man es
damals nicht im kritischen Interesse an den griechischen
Quellen und deren angeblich unvollkommener Wiedergabe durch
Cicero, sondern aus einem lebendigen Gefühl heraus für die
bedeutenden Anregungen und großen Fragen des Inhalts. Damit
aber sind Wirkung und Einfluß auf das geistige Leben jener
Zeit gar nicht zu überschätzen. Das 19.Jh. hat dann bei
vielfach geänderter geistiger Grundhaltung das Verhältnis
gerade zu dieser Schrift ganz verloren; nirgends sonst wütete
die Quellenanalyse grausamer als hier. Im 20. Jh. hat sich das
Blatt allmählich gewendet, und Wilhelm Süss bekennt: "Ciceros
Schrift 'de natura deorum' ist für mich die Krone all seiner
philosophischen Werke".106
3.6 De divinatione und de fato
Das Thema der divinatio, der Erkundung des göttlichen Willens
oder der Weissagung, war in nat.deor. mehrfach berührt worden;
deutlich wurde dabei, daß der Epikureer dem Gedanken gänzlich
ablehnend,
der
Stoiker
aber
durchaus
sympathisierend
Wilhelm Süss, Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen
Schriften
(mit Ausschluß der staatsphilosophischen Werke). Verlag der Akademie
der
Wissenschaften und der Literatur in Mainz, in Komm. bei Franz Steiner
Verlag Wiesbaden, 1966. (Abhandlungen der Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Klasse Jg. 1965, Nr.5) S.301 (93).
106
98
gegenüberstand; kritisch und skeptisch äußerte sich zu der
Frage auch der Akademiker Cotta in einem teilweise verlorenen
Stück (3,13f.): ...divinatio, quae unde oriatur non intellego
(14). Mit akademischen Waffen kämpft denn auch Cicero selbst
im zweiten Buch der neuen Schrift gegen die divinatio, mit
stoischen Argumenten begründet sie der Bruder Quintus im
ersten. Hatte Balbus in nat.deor. aus der Möglichkeit der
Weissagung auf die Existenz der Götter geschlossen (2,7-12),
so wird in der nachfolgenden Schrift naturgemäß der umgekehrte
Weg eingeschlagen und im positiven ersten Teil der Glaube an
die divinatio aus dem Glauben an die Götter abgeleitet.
Die Wichtigkeit des behandelten Themas ist nach Cicero
unbestreitbar: sei man doch in Gefahr, auf diesem Gebiet
entweder in gottlosen Frevel oder kindischen Aberglauben zu
verfallen (1,7). Es geht um Zufall und Notwendigkeit. Wenn der
Zufall herrscht, kann auch ein Gott nichts prophezeien: rerum
igitur fortuitarum nulla est praesensio (2,18). Wenn dagegen
das fatum, jene unausweichliche Kausalkette herrscht, so
lautet die Frage: quid mihi divinatio prodest? (20A.) In
diesem Fall hat man kein Recht zu sagen, daß durch eine
Mahnung ein Unheil verhütet oder durch Nichtbeachtung eines
Vorzeichens ein Unglück eingetreten sei: das schließt das
durch seine Kausalkette determinierende fatum aus: vultis
autem omnia fato. nulla igitur est divinatio (20E.). In diesem
dialektischen Dreieck von Bestimmung, Freiheit und Vorsehung
können unmöglich alle drei Prinzipien gleichzeitig wirksam
sein. (Vgl. div. 2,21). Cicero kämpft mit einem gewissen
überlegenen, fröhlichen Rationalismus: von den allgemeinen
Gründen für die Berechtigung der Weissagungen sei offenbar nur
der dritte, die Begründung durch die Sympathie im Weltganzen,
einigermaßen ernst zu nehmen (33A.) - er lebt ja schließlich
noch in den Begründungen der modernen Astrologen weiter. Doch
welche Lächerlichkeit sei es, daß ein elendes persönliches
Profitchen mit dem Weltganzen (cum caelo, terra rerumque
natura, a.O.) in geheimnisvoller Verbindung stehen sollte, wie
es doch sein müßte, wenn aus den Eingeweiden eine Vergrößerung
des Vermögens mit Sinn und Verstand vorausgesagt werden
könnte!
Neben Gott und Unsterblichkeit ist die Freiheit des Willens
die dritte große Idee der Aufklärungszeit, ein Problem, das in
der antiken wie in der modernen Debatte sich als besonders
schwierig und spröde erwiesen hat. Cicero hat diesen
Fragenkreis in der Schrift de fato behandelt, doch ein
besonderes Unglück der Überlieferung hat diese interessante
Abhandlung durch den Verlust einer großen Partie am Anfang der
eigentlichen Diskussion und durch mehrere kleinere Lücken
schwer beschädigt.
Die Fiktion der Schrift ist die, daß in einem der häufigen
Besuche der beiden designierten Konsuln des folgenden Jahres
99
43, Hirtius und Pansa, auf Ciceros Gut bei Puteoli (s.Att.
14,9f.) der eine der beiden, Hirtius, den Wunsch äußert,
selbst eine philosophische These vortragen zu dürfen, die dann
von Cicero in einem ausführlichen Vortrag widerlegt werden
soll. Diese These kann wohl nur gelautet haben: fato omnia
fiunt. Gerade da aber ist die Lücke im Text. In der Darlegung
Ciceros geht es zunächst um die sympátheia = naturae contagio,
5, jene geheimnisvolle Sympathie der Natur. Cicero hat gegen
einzelne Beispiele nichts einzuwenden, hält aber manches für
absurd. Entschieden bestreitet er den Fatalismus. Die
unleugbare
Verschiedenheit
der
Menschen
in
ihren
Charakteranlagen und ihren Geschmacksneigungen darf nicht dazu
führen, daß alle Willensregungen und Wünsche (voluntates atque
appetitiones, 9A.) natürliche und von vornherein gegebene
Ursachen
(causae
naturales
et
antecedentes,
a.O.)
voraussetzen; denn damit wäre es mit der Willensfreiheit aus:
nihil esset in nostra potestate (a.O.). Die positive Wendung
der Sache verdeutlicht später der Satz: "Denn nicht aus von
Ewigkeit her bestimmten Ursachen, die aus einer von der Natur
gegebenen Notwendigkeit herrühren, ist der folgendermaßen
formulierte
Sachverhalt
richtig:
Karneades
begibt
sich
hinunter in die Akademie. Natürlich ist er nicht ohne Ursache;
doch man muß den Unterschied wohl beachten zwischen zufällig
vorausgegangenen Ursachen und solchen Ursachen, die in sich
eine in der Natur begründete Wirkungskraft beschließen". (fat.
19: ...nec tamen sine causis; sed interest inter causas
fortuito antegressas et inter causas cohibentes in se
efficientiam naturalem.) So löst sich das Problem der
Willensfreiheit verhältnismäßig einfach (23f.): voluntatis
enim nostrae non esse causas externas et antecedentes (23E.);
daher sei der Ausdruck, es wolle einer etwas oder auch nicht
sine causa, sprachlich unkorrekt; gemeint sei: sine externa et
antecedente causa, non sine aliqua (24).
Mit diesem Thema hat sich also Cicero gerade in den Monaten
nach Caesars Ermordung befaßt.
3.7 Die kleinen ethischen Schriften Cato maior und Laelius
Wohl die liebenswürdigste Schrift Ciceros ist der Cato maior
de senectute. Die Schrift ist, ungeachtet der zahlreichen
Zitate
aus
Platon,
Xenophon
und
anderen
griechischen
Schriftstellern, durch und durch römisch; dabei denke ich
nicht so sehr an die vielen Beispiele aus der römischen
Geschichte, sondern etwa an die Hervorhebung der auctoritas
des Alters. apex est autem senectutis auctoritas (60, vgl.3).
Dieser spezifisch römische Begriff, der an augere denken läßt
und an die geheimnisvoll magischen Kräfte, die Ausstrahlung
einer Persönlichkeit kennzeichnet, ist unübersetzbar; diesem
Wert gegenüber verblassen alle Scheinwerte: habet senectus
honorata praesertim tantam auctoritatem, ut ea pluris sit quam
100
omnes adulescentiae voluptates
(61E.).107
Der Laelius de amicitia ist wieder dem Freund Atticus
gewidmet.
Mit starker Berührung zu Gedanken aus de natura deorum
(1,121f.) führt Laelius aus, wie falsch die Ansicht sei, die
Quelle der Freundschaft in der Hilfsbedürftigkeit anzusetzen
(26,29,51): nach dieser utilitaristischen Theorie wäre ja
gerade der Schwache am empfänglichsten und geeignetsten für
die Freundschaft. Das genaue Gegenteil sei der Fall: der
sittlich und geistig höherentwickelte Mensch habe recht
eigentlich für Freundschaft Bedürfnis und Eignung (29); so
ergebe sich: non igitur utilitatem amicitia, sed utilitas
amicitiam secuta est (51E.).
3.8 De officiis
Die letzte philosophische Schrift Ciceros. Seit den Tagen der
alten Kirche, als Ambrosius die christliche Ethik unter
stärkster Verwendung von Ciceros Pflichtenlehre aufbaute,
steht diese Schrift hinter keiner anderen zurück, was
tiefgreifenden
Einfluß
und
bedeutende
Wirkung
anlangt.
Zielinski, der sie für die "wichtigste und einflußreichste
aller Schriften Ciceros" (S.66) hält, bringt dafür viele
Beispiele von Urteilen. Montaigne hat sie für langweilig
gehalten. (Essais II, 10).
Nach dem stoischen Studienplan, der z.B. für Ciceros Lehrer
Philon ausdrücklich bezeugt wird (Stob. II,41 W), bildet die
praktische Ethik den Abschluß. Da mit der Theorie der Ethik in
de finibus die Grundlage gelegt werden sollte, so schließt
sich mit de officiis der Ring.
Was Cicero mit einer wohlerwogenen, auch gegen die Bedenken
des Atticus festgehaltenen Übersetzung durch das lateinische
Wort officia wiedergibt, sind die kathékonta der Stoiker, d.h.
die Pflichten, die im Unterschied zu der aus vollkommener
Gesinnung vom Weisen vollbrachten Handlungsweise (katórthoma =
officium perfectum, vgl. 1,8) in einer bestimmten Situation an
den gewöhnlichen Menschen herantreten können und sich mit
vernünftigen Gründen rechtfertigen lassen (a.O.). Da wir uns
mit dieser Terminologie bereits in durchaus stoischer
Atmosphäre befinden, wird natürlich nach den einleitenden
Definitionsunterscheidungen (7-10) vom Begriff der Natur
ausgegangen: die vernünftige Natur des Menschen äußere sich in
vier Grundtrieben, dem Forschungstrieb (veri inquisitio atque
investigatio, 13; vgl. dazu fin.3, 17E.), dem sozialen Trieb
Vgl. Römische Wertbegriffe. Hrsg. v. Hans Oppermann. Wege der Forschung
Bd.XXXIV. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967. Einzelne
Artikel über Res publica, Libertas, Concordia, Pietas, Verecundia,
Virtus
und Constantia, Honos, Humanitas etc.
107
101
(vitae societas, 12), zu dem ratio
und oratio hinführen
(a.O.); dann dem Willen zur Macht (appetitio principatus, 13),
schließlich einem Sinn für Maß und Schicklichkeit, einer Art
von ethisch-ästhetischem Grundempfinden (quid sit ordo, quid
sit quod deceat, in factis dictisque modus, 14). Man erkennt
sogleich, daß hier, noch verdeckt, die berühmten vier
Kardinaltugenden auftreten, die als Allgemeingut der Antike
dann auch der jungen Kirche vermittelt wurden (15-17).
Das sind die philosophischen Schriften Ciceros, und damit ist
zugleich der Diskurs insgesamt angedeutet, innerhalb dessen
sich Ciceros religionsphilosophische Gedanken halten.
4. De natura deorum
4.1 Einleitung
4.1.1 Zur Religion und Religiosität des Volks der Römer
Literatur zu Ciceros Religiosität:
Ernst Sattmann, Ciceros Religiosität. Diss. Wien 1949.
M. van den Bruwaene, La Théologie de Cicéron. Louvain 1937.
Dazu Rezensionen von:
- H.Leisegang - Philolog.Wochenschrift 58, 1938
- O.Tescari - Bollettino di filol.class. NS X 1938, 20ff.
E.E.Burriss, Cicero's unbelief, in "The Classical Weekly" XVII
(1924) S. 101ff.
M.Y.Henry, The Relation of Dogmatism and Scepticism in the
Philosophical Treatises of Cicero. New York 1925.
K.Kerényi, Religio academici. Pannonia IV 1938 S.320ff.
A.B.Krische, Die theologischen Lehren der griechischen Denker.
Eine Prüfung der Darstellung Ciceros. Göttingen 1840.
L.Reinhardt, Die Quellen von Ciceros Schrift De natura deorum.
(Breslauer philolog. Abhandlungen Bd.3/2) Breslau 1888.
Th.Vick, Karneades' Kritik der Theologie bei Cicero u. Sextus
Empiricus. Hermes 1902 t. XXXVII.
J.Vogt, Ciceros Glaube an Rom. Stuttgart 1935.
O.Weinreich, Ciceros Gebet an die Philosophie. ARW 21, 1922
S.504ff.
Die Fragestellung:
Bei der Frage nach der Religiosität eines Menschen handelt es
sich um eine moderne Problemstellung, mit welcher die Antike
in dieser Form nicht vertraut war, wie es schon das Fehlen des
entsprechenden sprachlichen Ausdrucks beweist. Wir verstehen
unter Religiosität die subjektiv - persönliche, psychische
Seite der Religion, also das innere religiöse Leben des
Einzelnen;
dieses
umfaßt
die
Gesamtheit
des
Fühlens,
Vorstellens,
Wollens
und
Handelns,
welche
dem
102
Abhängigkeitsgefühl von unbekannten Mächten entspringend - auf
einen höchsten Totalwert des individuellen Lebens hingeordnet
ist, von welchem aus das Dasein seine endgültige Sinngebung
erhält.
Diesem Bedeutungsinhalt entspricht nun in der Antike kein
vollkommen
adäquater
Begriff.
Religiositas
als
nomen
qualitatis von religiosus tritt überhaupt erst verhältnismäßig
spät auf (bei Apul. De dogm.Plat. II 7 <229>) als Übersetzung
von
griech,
hosiótes
und
hält
sich
innerhalb
des
Bedeutungskreises des Adjektivs: "religiositas deum honori ac
supplicis divinae rei mancipata est"; es handelt sich also um
kultische Frömmigkeit, welche die Innerlichkeit vollkommen
beiseite läßt. "Was man von dem Menschen erwartet, was im
römischen Sinn den religiösen Menschen charakterisiert, ist
nicht Überzeugung und nicht das Gefühl, sondern Handlung."108
Wenn man also mit Pfister109 Religiosität als den Besitz
transzendentalen Fühlens, Vorstellens und Wollens definiert,
so ist nur letzteres, das Wollen, was im römischen Sinn das
Merkmal des homo religiosus ausmacht, nämlich sein Wille zur
gewissenhaften
Anerkennung
und
Erfüllung
seiner
Verpflichtungen als Staatsbürger, besonders in Hinsicht auf
das Sakralrecht.
Wir sind dem schon im Zusammenhang mit der Etymologie von
religio begegnet. Auch diesem Begriff entspricht in der
subjektiven Sphäre: achtsames Bedenken, Gewissenhaftigkeit,
peinliches
Beobachten
der
religiones,
der
rituellen
Bestimmungen.
Der
Bedeutungskreis
von
pietas,
der,
von
der
tiefen
Einschätzung familiärer Achtung und Liebe ausgehend, mit einem
geläuterten Gottesbegriff auch in den religiösen Bereich
übergriff, berührt die ethische Seite der Religiosität, also
auch nur eines ihrer Teilgebiete.
Die in der offiziellen römischen Religion allein erforderliche
äußerlich-kultische
und
von
Ritualgesetzen
bestimmte
Frömmigkeit
schließt
natürlich
nicht
aus,
daß
im
Einzelindividuum ein echtes Gefühl der Gebundenheit an das
Numinose und eine durch religiöse Überzeugungen geläuterte
Sittlichkeit lebendig ist. Die Staatsreligion war nach zwei
Seiten hin für ein tieferes religiöses Bedürfnis unzulänglich
geworden: einerseits war sie "auf einer primitiven Stufe
stecken geblieben und hatte sich der Vergeistigung nicht für
fähig erwiesen"110; sie bot also dem Gebildeten, der sich mit
religiösen Fragen unter dem Einfluß griechischer Philosophie
zu beschäftigen begann, keinerlei geistige Anregungen und
108
109
110
W.F.Otto, Religio und Superstitio. ARW XII (1909) S. 533 ff. u. XIV
(1911) S. 406 ff.
F.Pfister, Die Religion der Griechen und Römer. Bursian, Suppl. 229.
Leipzig 1930. S. 30.
R.Harder, Cicero und die Philosophie. Wiener Blätter für Freunde der
Antike VI, 1929, S.143.
103
mußte
ihn,
der
durch
eine
Periode
der
Aufklärung
hindurchgegangen war, in einem Zustande inneren Zweifels und
nach außen hin nur schlecht verhehlter Gleichgültigkeit
zurücklassen. Andererseits fehlte dem nüchternen Zeremoniell
weitgehend eine ergreifende Wirkung auf Gemüt und Phantasie,
welcher Mangel dazu beitrug, daß die unteren Volksschichten,
aber
nicht
nur
diese
allein,
bereitwillig
fremden
orientalischen Kultformen Aufnahme gewährten111, wogegen sich
freilich aus politisch-konservativen Gründen eine Reaktion
geltend machte, welche auf die eigenen religiösen Kräfte
zurückverweisen und die überlieferten Formen mit lebendigem
Gefühl
erfüllen
möchte.
Auf
jeden
Fall
bedurfte
die
persönliche Religion des Römers "Ergänzungen sowohl nach der
Seite des Intellekts als auch nach jener der Gefühlswelt"112;
es ist hiebei zu beachten, daß es oft pseudoreligiöse Elemente
patriotischer, philosophischer und ethischer Art sind, welche
der Einzelne mit geradezu religiöser Inbrunst zur Gestaltung
seines Weltbilds heranzieht.
Das Verhältnis des Einzelnen zur objektiv gegebenen Religion
wird in der Antike in viel geringerem Umfang als in der
Moderne Schlußfolgerungen auf seine subjektive Religiosität
zulassen,
da
Indifferenz
gegenüber
den
offiziellen
Religionsformen im Altertum nicht der Ablehnung irgendwelcher
Glaubensinhalte oder sittlicher Forderungen gleichkam. Weiters
darf man sich nicht verwundern, wenn der Mensch, allein auf
sich gestellt, sich in entscheidenden Fragen religiöser Art
nicht immer zu einer letzten Klarheit durchringen konnte.
Bei Cicero wird in gewissem Grade das dreifache, an sich
heterogene
Lebenswerk
die
Untersuchung
erleichtern,
andererseits aber durch Widersprüchlichkeiten noch erschweren.
Die Reden zeigen uns Cicero als Bürger und Politiker, seine
Dialoge als philosophisch Interessierten, die Briefe als
Menschen und Privatmann: dem entspricht - zunächst kurz
skizziert - in religiösen Belangen das dreifache Bild eines
ehrfürchtigen Vertreters der staatlichen Religion, eines
keineswegs
unbeteiligten
Beobachters
griechischer
theologischer
Systeme
und
eines
scheinbar
religiös
Gleichgültigen.
4.1.2 Philologisches zum Werk nat.deor.
Die
Überlieferung
des
Werks
De
natura
deorum
hängt
offensichtlich an einer einzigen Handschrift, von der in
karolingischer Zeit mehrere Kopien gefertigt wurden. (Acht
Schriften Ciceros sind auf diesem Weg auf uns gekommen.) Im
kritischen Apparat - unter dem lateinischen Text - sind die
Handschriften durch Großbuchstaben vertreten, dazu kommen
111
112
Vgl.Altheim Religionsgeschichte, II S.144 f.
R.Egger, Die römische Religion, Wiener Blätter 3 (1925)S.73.
104
ältere Drucke, die durch Abkürzungen bezeichnet sind, wie z.B.
Ven. = Veneta (1471). Die Philologen haben einen Stammbaum ein sog. Stemma - der Handschriften erstellt.
Der Apparat will nicht nur die für die Textkonstitution
wichtigsten Lesarten nachweisen, sondern auch sichtbar machen,
welchen Weg die Editoren im Lauf der Jahrhunderte gehen
mußten, um aus der Vielzahl der Entstellungen zu einem Text zu
gelangen, an dem die vorliegende Ausgabe nur verhältnismäßig
wenig zu ändern fand.
Vor unserer zweisprachigen Textausgabe von Gerlach und Bayer
in der Tusculum Reihe (Artemis Velag München und Zürich 1990)
sind neuere Editionen von Arthur Stanley Pease (Cambridge,
Massachusetts Bd.1 1955 u. Bd.2 1958) und M. van den Bruwaene
(Bruxelles Livre 1 1970, Livre 2 1978, Livre 3 1981) zu
nennen; in der Reihe Teubner haben O.Plasberg u. W.Ax eine
frühere Textausgabe besorgt (Leipzig 1933).
Literaturhinweise finden sich im Anhang unserer Ausgabe.
Die Gliederung des Werks De natura deorum zeigt drei Bücher:
1.Buch: Darstellung und Kritik der epikureischen Theologie
(Velleius - Cotta)
2. Darstellung der stoischen Theologie (Balbus)
3. Kritik der stoischen Theologie (Cotta)
Die Detailgliederung siehe Handout.
Nach Ciceros eigenem Hinweis (Div. II 3) wurde die Schrift
nach der Veröffentlichung der Tusculanen (quibus libris editis
tres libri perfecti sunt de natura deorum) und vor dem
Abschluß der beiden Bücher De divinatione vollendet. Weitere
Anhaltspunkte für die zeitliche Festlegung ergeben sich aus
seinem Briefwechsel mit Atticus, da er diesem um den 4.August
45 mitteilt, er schreibe gegen die Epikureer (XIII 38,1), und
am 5. August bestellt er sich Phaídrou perì theôn (XIII 39,2);
beide Stellen sind wichtig für die Datierung der Ausarbeitung
des 1.Buchs. Fertig war die Niederschrift jedenfalls noch vor
Caesars Tod, da auf dessen Alleinherrschaft in N.D.17
(cum...is esset rei publicae status, ut eam unius consilio
atque cura gubernari necesse esset) ebenso hingewiesen wird
wie Div. II 6 (cum esset in unius potestate res publica),
während Div. II 7 (nunc, quoniam de re publica consuli coepti
sumus) sich schon auf die politische Lage nach Caesars
Ermordung bezieht.
In der äußeren Form verblieb Cicero bei dem von ihm mit
Vorliebe gewählten "aristotelischen" Dialog, der im Gegensatz
zu der dramatisch aufgelockerten Dialogform Platons die
Möglichkeit bietet, ein Thema in zusammenhängender Rede zu
behandeln, da unter Verzicht auf eine das gesamte Gespräch
allein tragende Person - wie sie Sokrates in den platonischen
105
Dialogen bleibt - jeder Gesprächspartner einen vollständigen
und zusammenhängenden Vortrag über die Doktrin seiner Schule
zugeteilt erhält. Im Unterschied zu Aristoteles ergibt sich
hier für Cicero freilich die Notwendigkeit, die einzelnen
Thesen einer Schule zu einer Gesamtschau zu vereinigen, wobei
es ihm überlassen bleibt, "alles von seinem Zwecke, seiner
Auffassung und Behandlungsweise abhängig zu machen". 113
Das Gespräch selbst findet am Staatsfeiertag der Feriae
Latinae, dem Bundesfest der latinischen Stämme, in der Wohnung
Cottas, der die neuere Akademie vertritt, statt. Seine
Gesprächspartner sind der Epikureer Velleius und der Stoiker
Balbus, während Cicero sich mit der Rolle des Zuhörers
begnügt.
Cotta verkörpert gerade in seinen religiösen Anschauungen den
Typ des gebildeten Römers der ciceronianischen Zeit, die
zwischen dem Festhalten an dem alten, aus einer genauen
Beachtung äußerer Riten bestehenden Götterkult und den neuen
revolutionären Erkenntnissen steht, wie sie mit dem Fußfassen
der griechischen Philosophie in Rom durch die Lehren des
Epikureismus und der Stoa dem gebildeten Römer nahegebracht
wurden. So kommt es zu einem inneren Zwiespalt gerade für die
Gebildeten, in deren Händen neben der Führung des Staates auch
die Leitung des Staatskultes lag. Gerade aber im Hinblick auf
Cottas Stellung und die ihm in der zweiten Hälfte des ersten
und im gesamten dritten Buch zugeteilte Rolle darf in ihm die
tragende Gestalt und in seinen Ausführungen die Hauptaussage
des 45 erschienenen Werks gesehen werden.
Zwei Jahre vorher hatte M.Terentius Varro seine Caesar als
Pontifex Maximus gewidmeten Antiquitates rerum humanarum et
divinarum veröffentlicht114 und darin das Wesen der römischen
Religion mit all ihren Gottheiten "mit ebensoviel pietätvoller
Gelehrsamkeit
wie
systematischer
Konsequenz"
(W.Jaeger)
115
behandelt, wobei er nach Augustinus
drei Arten der Theologie
- die mythische, die politische und die natürliche unterschied. Für Varro gilt, daß jede - auch den Bereich der
Religion betreffende - spekulative Theorie hinter den
Interessen und Belangen des Staates zurückzutreten oder mit
ihnen zu harmonieren hat; Götter und Religion sind nicht das
Produkt theologischer oder philosophischer Spekulationen,
sondern eine althergebrachte und damit in sich fundierte
staatliche Einrichtung, bei der die Priorität des Staates
ausschlaggebend ist. Will Varro aber als bewußter Römer
A.Krische, Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie, Bd.I: Die
theolog.Lehren der griechischen Denker. Eine Prüfung der Darstellung
Ciceros. Göttingen 1840. S.18.
114 vgl. August.C.D. VII 35 (I 318,27 Dombart-Kalb) und Lact. Inst.div. I
6,7
115 De civitate Dei VI 5: tria genera theologiae dicit esse [Varro], id est
rationis, quae de iis explicatur, eorumque unum mythicon [appellari],
alterum physicon, tertium civile.
113
106
einerseits die römische Staatsreligion erhalten, wozu sich bei
Cicero Cotta (N.D. III 5) mit Entschiedenheit bekennt, gerät
er anderseits mit seiner Dreiteilung in eine mythologische,
politische und natürliche Theologie in den Konflikt, dem Cotta
ausweichen kann und für den er eine Lösung darin findet, daß
er die auctoritas in N.D. III 9 (tu auctoritates contemnis,
ratione pugnas) zum Fundament der römischen Staatsreligion
erklärt, andererseits es der philosophischen Skepsis überläßt,
wieweit der menschliche Verstand dazu fähig ist, die absolute
Wahrheit über das Wesen der Götter zu erkennen. W.Jaeger sieht
somit in De natura deorum eine Antwort Ciceros auf das von
Varro aufgeworfene Problem, in der ihm Ciceros "Verbindung von
voluntaristischem
Autoritätsglauben
und
metaphysischem
Agnostizismus" noch typischer römisch erscheint als der
"patriotische Konflikt in Varros Seele".
4.1.3
Der philosophiegeschichtliche Hintergrund
Geplant ist Ciceros Schrift über das Wesen der Götter als eine
Auseinandersetzung mit der Wahrheit des epikureischen und des
stoischen Systems. Die Theologie des Aristoteles hatte unter
seinen Nachfolgern an Interesse verloren, die platonische
Ideenlehre war innerhalb der Akademie durch den von Arkesilaos
und Karneades begründeten Skeptizismus verdrängt worden, und
nur die Theologie der epikureischen, vor allem die der
stoischen
Lehre
behielt
bis
in
die
Kaiserzeit
ihre
dominierende Stellung im hellenistischen und später im
römischen Geistesleben. Da Epikur das Glück des Menschen in
der Ataraxie, in der ausgeglichenen Ruhe des Geistes sah,
zielte seine Theologie darauf ab, dem Menschen auch hier alle
Ursachen zu einer ihn beunruhigenden Furcht, besonders der vor
den strafenden Göttern und dem Tode, zu nehmen. Der Glaube an
die Existenz der Götter wird ausgelöst durch die in unsere
Seele eindringenden Bilder von Göttern, die damit in ihr den
Begriff
existierender,
anthropomorpher
göttlicher
Wesen
entstehen lassen. So gibt es wohl Götter, aber keine Welt als
deren zweckbewußte Schöpfung. Denn diese Welt und die außer
ihr noch bestehenden zahllosen anderen Welten sind ein Produkt
des Zufalls, entstanden durch die Kollision, Adhäsion und
Wirbelbewegung der von Ewigkeit her ins Leere (den Raum)
fallenden Atome. Damit wird der volkstümliche Götterglaube
hinfällig. Die Welt ist nicht um der Menschen willen da; es
gibt keine Vorsehung, keine Weltschöpfung, kein Weltregiment,
kein Eingreifen der Götter in das Leben der Menschen, da jede
Sorge für die Welt und ihre Bewohner die Glückseligkeit der
Götter, die im absoluten Freisein von allen Leistungen und
Verpflichtungen begründet ist, und damit das ihnen eigene
Wesen ja aufheben müßte. Mit dieser absoluten Untätigkeit der
Götter ist der Mensch von der Angst vor der göttlichen Strafe
befreit,
durch
den
atomistischen
Materialismus
Epikurs
107
zugleich aber auch von der Furcht vor dem Tod erlöst. Denn wie
sich die Welten wieder in ihre Atome auflösen, zerstreuen sich
im Tode mit der Vernichtung der leiblichen Umhüllung auch die
Atome der Seele. Die glückseligen Götter dagegen sind ewig;
sie leben in zahlloser Menge in den Zwischenräumen der Welten,
den sogenannten Intermundien, also im leeren Raum, aus den
feinsten
Atomen
gebildet,
in
der
denkbar
schönsten
Menschengestalt, zweigeschlechtig, untereinander in einer der
menschlichen Freundschaft ähnlichen Verbundenheit, und nicht
die
Furcht
vor
ihnen,
sondern
die
Bewunderung
ihrer
glückseligen und ewigen Vollkommenheit ist das einzige Motiv
zu ihrem Kult, der nicht in zwecklosen Gebeten, sondern in
einer ihnen angemessenen Verehrung zu bestehen hat.116
Im Gegensatz zu Epikur ist das Hauptanliegen der Stoa, das
Weltall in seiner ganzen Ordnung und Schönheit als die
Schöpfung
einer
waltenden
Gottheit
zu
erklären.
Eine
gestaltende Kraft, aus feinstem Stoff gebildet, das Urfeuer
(pyr technikón oder pneuma énthermon) durchdringt das ganze
All; aber auch die alles lenkende Gottheit oder die Weltseele
und damit das wirkende Prinzip besteht aus diesem Feuer. Die
Gottheit offenbart ihre Existenz durch Träume und Vorzeichen;
die Wahrsagekunst wird als Gottesbeweis benutzt, ohne daß die
Gottheit ausgesprochen persönlich gedacht wird. Beherrscht
wird die ganze Theologie der Stoa im Gegensatz zur
epikureischen Lehre von dem überzeugten Glauben an eine
göttliche Vorsehung (prónoia), die ihr Walten bis in die
kleinsten Teile des Kosmos erstreckt. Über allem aber, die
Götter eingeschlossen, steht die unentrinnbare Naturordnung,
das unausweichliche Schicksal, das Fatum, heimarméne. Mit
diesem ins Letzte gesteigerten Schicksalsglauben nähert sich
die Stoa volkstümlichen Anschauungen, wie sie sich bereits bei
Homer und den Tragikern finden.
Um die Wende des dritten Jahrhunderts erwuchs vor allem der
Stoa ein scharfer Gegner in den Vertretern der platonischen
Akademie. Sie übernahmen die in ihren Wurzeln bis auf
Demokrit, Kratylos und die Sophistik zurückzuverfolgende
Skepsis, aus der in der Folgezeit der schulmäßige Skeptizismus
der mittleren und neueren Akademie erwuchs. Arkesilaos von
Pitane, der 268-241 die Schule leitete, begann mit seiner
radikalen Skepsis die Erkenntnislehre der Stoa anzugreifen;
Enthaltung vom eigenen Urteil, die bereits von Protagoras
geübte Technik des Disputierens "in utramque partem"117 und vor
allem die Aussage, daß wir nichts wissen können, nicht einmal
116
117
Vgl. Karl Marx, Die Differenz der demokriteischen und der epikureischen
Naturphilosophie. Diss. Jena 1841.
Vgl. De orat. III 67: Quem ferunt primum instituisse non quid ipse
sentiret ostendere, sed contra id quod quisque se sentire dixisset
disputare.
108
das, was wir nach Sokrates noch wissen konnten, nämlich nichts
zu wissen, war die Basis seines vor allem gegen Zenon
gerichteten Kampfes. Rund hundert Jahre später verwarf
Karneades von Kyrene, der 156/155 mit dem Stoiker Diogenes und
dem Peripatetiker Kritolaos als Gesandter in Rom weilte, noch
radikaler alle erkenntnis-theoretischen Kriterien und alle
logischen Beweisführungen, da es für ihn dafür keine echten
Grundlagen geben konnte, und sah seine Hauptaufgabe in der
Bekämpfung der von Chrysipp ausgebauten Lehre der Stoa.
Besonders scharf ging Karneades gegen die stoische Theologie
vor, die gerade in ihrem so kunstvollen Aufbau besonders
empfindliche Angriffsstellen bot. Für ihn waren weder die
Beweise für die Existenz göttlicher Wesen stichhaltig noch
deren Vorstellung als persönliche, vernunftbegabte Wesen
haltbar ohne die zwangsläufige Beigabe von Eigenschaften, die
mit dem ihnen sonst zugestandenen Wesen nicht mehr vereinbar
seien, und ebenso unerbittlich wurde die mit der stoischen
Theologie so eng verbundene teleologische Weltauffassung von
ihm bekämpft und abgelehnt. Freilich sollten die vorgebrachten
Angriffe weniger eine absolute Verneinung jeder Existenz
göttlicher Wesen bedeuten, sondern (vgl. N.D. III 44) nur die
für diese Existenz aufgestellten Beweise in Frage stellen. So
wurde Karneades zum schärfsten Gegner der gesamten stoischen
Theologie, deren Darlegung und Kritik den eigentlichen Inhalt
der drei Bücher Ciceros über das Wesen der Götter bildet.
Die Frage nach dem Wesen der Götter, die mehr und mehr zu
einer Frage nach dem Wesen Gottes und des Göttlichen
schlechthin wird, bleibt nach Cicero, angefangen mit der
späteren Stoa, bis zum Sieg des Christentums (529 schloß
Justinian die Schule von Athen, und zwei Jahre danach
wanderten die letzten nichtchristlichen Philosophen nach
Persien an den Hof des Königs Chosroe aus) weiterhin ein
integrierter
Bestandteil
der
hellenistisch-römischen
Philosophie. So schrieb Kornutos unter Nero eine allegorischphysikalische Mythendeutung, die u.a. auf Apollodoros' Perì
theôn zurückging und in der unter Anwendung der ratio physica
(des lógos physikós) der alten Stoa Zeus als die Weltseele
oder als der Äther und Athene als Verstand des Zeus gedeutet
wurde. Besonders charakteristisch ist jedoch für die spätere
Stoa des ersten nachchristlichen Jahrhunderts ein bald mehr
bald weniger persönlich aufgefaßtes Verhältnis des Menschen
zur
Gottheit
und
die
ausgesprochene
Betonung
seiner
Verwandtschaft mit ihr.
Dies trifft bereits für Seneca (gest. 65) zu, der auf der
einen Seite in seiner Physik keine wesentlichen Abweichungen
von der allgemeinen stoischen Doktrin aufweist, andererseits
aber doch im Gegensatz zu dem ausgesprochen pantheistisch
geprägten Gottesbegriff der Stoa einen stark theistisch
geprägten Gottesbegriff entwickelt, bei dem durch die Betonung
109
der göttlichen Vollkommenheit, der väterlichen Fürsorge und
Güte gegenüber dem Menschen das Bild eines transzendenten
persönlichen Wesens entsteht. Die gleiche starke Betonung des
Religiösen finden wir bei Epiktet (gst. 138), der in seinen
Diatriben bei allem Festhalten am stoischen Pantheismus mit
der Aussage von Gott als dem Vater der Menschen und vom
Menschen
als
einem
Teil
Gottes
und
somit
einer
Gottesverwandtschaft ebenfalls die Idee eines persönlichen
transzendenten Gottes anklingen läßt. Diese enge Verbindung
von Philosophie und starkem religiösem Empfinden teilt mit
Seneca und Epictet vor allem der Stoiker auf dem römischen
Kaiserthron,
Marc
Aurel
(gest.
180).
Seine
"Selbstbetrachtungen" (Tà eis heautón), die auf der stoischen
Allgemeindoktrin
basieren, sind durchdrungen von der uns
gerade aus Cicero N.D. II so geläufigen Erkenntnis einer
göttlichen Fürsorge für die Welt, einer Einheitlichkeit und
weisen Ordnung des Kosmos, einer göttlichen Vorsehung und
einer naturgemäß bedingten Ergebung in das Weltgeschehen, aber
auch
durchdrungen
von
der
Gewißheit
einer
echten
Verwandtschaft des Menschen mit Gott. Im Zusammenhang mit
Seneca, Epictet und Marc Aurel bedarf es noch einer Erwähnung
Dions von Prusa (gest. um 100), der - mehr bekannt als
Vertreter der kynischen Diatribe - in seinen theologischen
Aussagen auf die Stoa, vor allem auf Poseidonios, zurückgreift
und wie dieser aus der Grundhaltung seiner Zeit heraus sein
Verhältnis
zur
Gottheit
auf
eine
tief
empfundene
Gottesverwandtschaft des Menschen gründet.
Eine gesteigerte Transzendenz der Gottesvorstellung läßt der
bereits in der Zeit der ausgehenden Republik in Rom wieder
auflebende Pythagoreismus - Nigidius Figulus (gest. 45 v.Chr.)
wird als Erneuerer der pythagoreischen Philosophie bezeichnet
- in Numenios aus Apameia (um 150) erkennen. In seinem Bemühen
um eine höchstmögliche Steigerung der göttlichen Transzendenz
entwickelt er eine Dreigötterlehre, in der er, um ein Wesen
von absoluter göttlicher Transzendenz zu erhalten, unter den
obersten Gott, das Prinzip des Seienden, im Sinne Platons
einen zweiten Gott, den Demiurgen, stellte, der als Prinzip
des Werdens auf die Materie einwirkend die Welt bildet,
während die Welt selbst, als Geschöpf des Demiurgen, die
dritte Gottheit darstellt.
Der mittlere Platonismus des ersten und zweiten Jahrhunderts
erweist sich als eine ausgesprochen eklektische Richtung, die
mit
Ausnahme
des
Epikureismus
in
erster
Linie
peripatetisches und neupythagoreisches, aber auch stoisches
Gedankengut aufnimmt und sich auch skeptischen Einflüssen
öffnet. Übernommen wird von der neupythagoreischen Schule vor
allem der gesteigerte Gegensatz zwischen Gott und Welt und die
wachsende Bedeutung der zwischen Gott und Welt stehenden
Mittelwesen, der Dämonen. In Plutarch aus Chäroneia (45-125),
der "als Mensch und Schriftsteller zu den sympathischsten
110
Erscheinungen des Altertums gehört (Prächter), haben wir neben
Albinos (um 150) und Attikos (um 175) den wichtigsten
Vertreter dieser Schule. Sein Streben nach einem sublimen
Gottesbegriff
erforderte
zwangsläufig
die
Annahme
von
Mittelwesen zwischen Gott und Welt - wie sie schon der
platonische Timaios in der Lehre von der Weltseele und den
unteren, schaffenden Gottheiten enthielt -, von den Dämonen,
die für Plutarch mit ihrem Eingreifen in das Leben der
Menschen und als Werkzeuge der göttlichen Vorsehung die
eigentliche Verbindung zwischen der göttlichen Sphäre und der
menschlichen
Welt
bedeuten.
Eine
Pronoia
(Vorsehung)
durchdringt die gesamte Welt und wirkt in dieser mit den unter
ihr stehenden Kräften, die aufgrund der verschiedenen
Volksreligionen nur unter verschiedenen Symbolen und Namen
verehrt und angesprochen werden. Mit dieser Gleichsetzung der
hellenischen und nichthellenischen Gottheiten, die schon der
früheren Akademie bekannt war, wird der Übergang zum
Synkretismus des Neuplatonismus eingeleitet.
Ausschlaggebend für die theologischen Aussagen der späteren,
vom letzten Jahrhundert vor bis ins zweite Jahrhundert nach
Chr. bestehenden skeptischen Schule, die ihre Polemik gegen
die dogmatischen Schulen beibehielt, bei aller Zurückhaltung
gegenüber jeder theoretischen Festlegung aber bemüht war,
bestimmte Grundregeln für das praktische Verhalten zu finden,
ist Sextus (Sextos Empeirikos) um 150, dem wir, besonders
durch seine Schrift Pròs toùs mathematikoús (Adversus
mathematicos I-XI) über die skeptische Theorie hinaus gerade
für die Fragen nach dem Wesen der Götter wichtige Quellen für
die von der Skepsis bekämpften dogmatischen Schulen verdanken.
Anliegen der Skepsis blieb, in Anlehung an Karneades zu
beweisen, daß jede Annahme über das Wesen der Götter
zwangsläufig auch dem herkömmlichen Begriff der Gottheit
widersprechende Ergebnisse nach sich ziehen müsse, da die
Annahme einer bestimmten Eigenschaft der Gottheit die Annahme
der entgegengesetzten Eigenschaft nicht ausschließen läßt. So
kann die Gottheit u.a. weder unbegrenzt noch begrenzt, weder
tugendlos noch tugendhaft sein (vgl. Adv.Math.IX 148ff u.
176f.). Mit Epikur (fr. 374 Usener) bekämpft Sextus im
Hinblick auf das Übel in der Welt die Lehre von der göttlichen
Vorsehung, die es eigentlich nicht geben kann, da es dem Wesen
der wahren Gottheit einfach nicht entspricht, für das eine
Vorsorge zu treffen, für das andere nicht. Damit wird
gleichzeitig die Frage nach der Existenz Gottes berührt, aber
nicht negativ entschieden, da ein skeptisches Abwägen nicht
die Nichtexistenz der Gottheit und damit der Vorsehung positiv
beweisen, sondern nur zur Vorsicht gegenüber den Thesen der
dogmatischen Schulen mahnen soll. So wird der Skeptiker also
ohne feste Ansicht (adoxástos) vom Dasein der Götter und ihrer
Vorsehung reden und die Götter verehren.
111
Rund hundert Jahre später, am Ausgang der hellenistischrömischen Philosophie, inmitten einer bereits christlich
geprägten Welt, entsteht der von der Mitte des dritten bis zur
Mitte des sechsten Jahrhunderts dominierende Neuplatonismus,
der die Transzendenz der Gottheit aufs stärkste betont und
gleichzeitig bemüht ist, sie mit einer monistischen, auf
dynamischem
Pantheismus
begründeten
Weltanschauung
zu
verbinden. In ihm erhält die Frage nach dem Wesen Gottes die
sublimste Beantwortung durch die antike Philosophie und
zugleich ihre umfassendste Konzeption. Denn trotz allen
Strebens, eine rein platonische Doktrin zu entwickeln,
bedeutet der Neuplatonismus die Zusammenfassung des gesamten
Erbes der griechischen Philosophie und der Vorstellungen der
griechischen und nichtgriechischen Religionen zu einem System.
Der
"Wolkenflug
metaphysisch-theologischer
Spekulation"
(A.Gercke) des Neuplatonismus hatte, ausgehend von Plotinos
(204-270) zunächst einen dreifach gesteigerten Gottesbegriff
entwickelt: das Eine (gleichzeitig das absolute Gute) als das
über allem stehende Urwesen, die überweltlich denkende
Substanz
(nous)
und
die
Weltseele,
das
zwischen
der
übersinnlichen
und
sinnlichen
Welt
vermittelnde
Verbindungsglied. Iamblichos (gest. unter Konstantin, 304-337)
steigerte die Transzendenz des plotinischen Gottesbegriffes
und stellte über das Eine des Plotinos noch ein anderes,
schlechthin erstes, noch über dem Einen (Guten) stehendes
Eines und ließ in seinem Bemühen, die Überlieferungen der
griechischen und orientalischen Religionen in sein System
aufzunehmen, der Welt als in ihr enthaltene Wesen auch die
Seelen der Götter des polytheistischen Volksglaubens, der
Engel, Dämonen und Heroen, angehören. Die Erkenntnis der
göttlichen Wesen aber118 ist unserem Wesen angeboren und mit
dem der menschlichen Seele wesenhaft verbundenen Verlangen
nach dem Guten unmittelbar gegeben.
Der spätere Neuplatonismus, vertreten durch Hierokles (um 420)
kehrt wieder zu einfacheren theologischen Aussagen zurück. Das
gilt besonders für den Wegfall der von Plotinos so kunstvoll
konstruierten Transzendenzsteigerung (dem Einen als Urwesen,
dem überweltlichen Nus und der zwischen dem Übersinnlichen und
Sinnlichen vermittelnden Weltseele). Überweltliche Gottheit
ist nur noch der Demiurg, der Schöpfer und Lenker der Welt,
der die Welt nicht - wie der Neuplatonismus in Übereinstimmung
mit dem platonischen Timaios lehrte - aus der dem Demiurgen
präexistent zur Verfügung stehenden Materie, sondern aus dem
Nichts heraus durch seinen Willen schuf, in Parallele also zur
jüdisch-christlichen Lehre von der Weltschöpfung, durch die
Hierokles - und das ist das Bemerkenswerte - hier beeinflußt
118
Vgl. die Schrift De mysteriis liber, ed. Parthey 1837, deutsch v.
Th.Hopfner, Leipzig 1922.
112
zu sein scheint, was auch für seine Aussagen über das Fatum
(heimarméne) insofern gilt, als es nicht mehr als die
mechanisch wirkende Notwendigkeit (wie in der Stoa) anzusehen
ist, sondern sein Wirken unsre frei gewählten Handlungen nur
im Ablauf der bestimmten Folgen beeinflußt.
4.2 Kommentar
4.2.1 Zur Einleitung
In ihr (1 - 14) wird das skeptische Verfahren vorgestellt und
Cicero selbst als Akademiker präsentiert. Daran schließt sich
eine Überleitung und ein einleitendes Gespräch der Diskutanten
(15 -17).
1. Brute: m.Iunius Brutus (85-42), durch Atticus mit Cicero
befreundet, war 52 noch Gegner des Pompeius, im Bürgerkrieg
aber auf dessen Seite; nach Pharsalus (48) wurde er von Caesar
begnadigt und in dessen Freundeskreis aufgenommen; nach der
Übertragung der Diktatur auf Lebenszeit an Caesar wandte er
sich von diesem ab und wurde der Führer der Verschwörung gegen
ihn. Nach Caesars Ermordung militärisch im Osten des Reiches
erfolgreich tätig, wurde er 43 zum Staatsfeind erklärt, 42 von
Antonius bei Philippi besiegt und endete durch Selbstmord.
Cicero benannte nach ihm seine Schrift über die Geschichte der
römischen Redekunst (De claris oratoribus), in der er ihm auch
die Hauptrolle im Dialog zuerteilte, widmete dem vielseitigen
Schriftsteller seine philosophischen Abhandlungen De finibus
bonorum et malorum, Tusculanae Disputationes und Paradoxa
Stoicorum, und jetzt, nach dessen akademischen Schriften De
officiis, De patientia und De virtute, widmet er Brutus seine
Schrift über die Götter, in der er sich in I 6-12
nachdrücklich als Anhänger der akademischen Philosophie
bekennt.
Die
Zustimmung
zurückhalten
adsensionem
cohibere
:
Anspielung auf das bereits von Pyrrhon von Elis (um 360-270)
geforderte epéchein oder die epoché der Akademiker, d.h. auf
die Pflicht, sich jedes bestimmten Urteils zu enthalten, da
alle Dinge unsrer Erkenntnis unzugänglich sind, von der
akademischen Skepsis unter Arkesilaos (316/15 - 241/40)
übernommen, der die Enthaltung vom eigenen Urteil forderte und
lehrte, daß wir nichts wissen können, nicht einmal das von
Sokrates noch zugebilligte Wissen darüber, daß wir nichts
wissen (vgl. I 11 <Arcesilas>).
2. Protagoras: Pr. von Abdera, älterer Zeitgenosse des
Sokrates, einer der berühmtesten Sophisten, bekannt durch den
Homo-mensura-Satz (der Mensch das Maß aller Dinge), stellte
113
einen
die Existenz der Götter vorsichtig in Frage, ohne
entschiedenen Atheismus zu vertreten.
Diagoras Melius: D. von Melos, Zeigenosse des Protagoras,
Schüler Demokrits, machte sich als Dithyrambendichter, nicht
als Sophist einen Namen und wurde durch seine Verspottung der
Religion zum sprichwörtlichen Atheisten der Antike.
Theodorus Cyrenaicus: Th. von Kyrene (geb. vor 349), mit dem
Beinamen "der Atheist", Philosoph der kyreneischen, von
Aristippos aus Kyrene gegründeten Schule, die die Lust als den
Zweck des Lebens ansah; lebte unter Demetrios von Phaleron
(317-307) in Athen und wurde hier wegen Atheismus und
Immoralismus angeklagt.
4. Carneades: K. aus Kyrene (etwa 214-128), nach Arkesilaos
Leiter der Akademie in Athen, berühmt als meisterhafter
Vertreter von These und Antithese (so 156-155 auch in Rom,
wohin er zusammen mit dem Stoiker Diogenes und dem
Peripatetiker Kritolaos gekommen war), ging positiv über die
epoché des Arkesilaos hinaus und bildete eine Theorie der
Wahrscheinlichkeit (émphasis, pithanótes), da bei der vollen
Enthaltung von jedem eigenen Urteil auch jedes Handeln
unmöglich gemacht würde.
6. Philo: Philon von Larissa, Schüler des Akademikers
Kleitomachos, kam während des Mithridatischen Krieges 88 nach
Rom, wo ihn u.a. auch Cicero hörte.
Antiochus: A. von Askalon, geb. um 120, Schüler des Philon von
Larissa, Begründer der letzten (fünften) Akademie in Athen,
gab die akademische Skepsis auf und bildete ein eigenes, aus
platonischer, aristotelischer und stoischer Doktrin gemischtes
System; 79 war er Lehrer Ciceros in Athen119.
Posidonius:
P.
von
Apameia
in
Syrien
(um
135-50),
Hauptvertreter der mittleren Stoa, gründete auf Rhodos eine
Schule und hatte hier u.a. Cicero und Pompeius als Hörer; "ein
echter Vertreter des Hellenismus, zugleich Mystiker und
Rationalist,
Wundergläubiger
und
exakter
Ätiologe,
spekulativer Denker und Empiriker, selbständiger Beobachter
Vgl. Fin. V 1: Cum audissem Antiochum, ut solebam, cum M.Pisone in eo
gymnasio, quod Ptolemaeum vocatur, unaque nobiscum Q. frater et T.
Pomponius et Lucius Cicero, frater noster cognatione patruelis
constituimus... "Als ich seiner Zeit gewohnheitsgemäß im sogenannten
Gymnasium des Ptolemaios mit Marcus Piso den Vortrag des Antiochos
gehört
hatte, und zusammen mit uns auch mein Bruder Quintus, Titus Pomponius
und
Lucius Cicero, der Verwandtschaft nach ein Vetter väterlicherseits, da
beschlossen wir..."
119
114
und Verarbeiter historischer Tradition, Naturforscher und
Menschenkundiger auch auf dem Gebiet der praktischen Politik",
schuf er "eine Weltanschauung, in der sich Vorsokratisches,
Platonisches,
Aristotelisches
und
Stoisches
zu
einem
wohlgefügten Systeme verbanden" (Praechter).
10. Pythagoras: P. von Samos (zweite Hälfte des 6.Jhs.)
gründete in Kroton (Unteritalien) eine auf sittliche (Lehre
von
der
Seelenwanderung)
und
wissenschaftliche
Ziele
(Mathematik)
ausgerichtete
philosophisch-religiöse
Gemeinschaft.
4.2.2 Darstellung der epikureischen Theologie durch Velleius
(18 - 56).
Velleius bezieht sich zunächst auf die Lehre über Welt und
Gott in der Stoa (18-24) und dann auf die Lehrmeinungen der
griechischen Philosophen (25-41) sowie die Aussagen der
Dichter (42-43), um diesen dann die Götterlehre Epikurs
entgegenzusetzen (43-56). Näherhin:
43-45 Die Existenz der Götter ist in der menschlichen Seele
als
Vorbegriff (anticipatio - prólepsis) enthalten
46-50 Die menschliche Gestalt der Götter
51-53 Die Glückseligkeit der Götter
54-56 Epikur, der Erlöser der Menschheit
Darauf folgt 57-59 eine Überleitung zur Kritik Cottas, die
dieser dann 60-124 ausgiebig entwickelt.
25 Thales: T. von Milet (um 600) war der Begründer der
ionischen Naturphilosophie; für ihn ist das Wasser der Urstoff
aller Dinge; in diesem liegt eine bewegende, bildende Kraft;
Geist und Stoff bilden also noch eine Einheit, im Gegensatz zu
Velleius' Darstellung, die den Geist alles aus dem Wasser
bilden läßt.
Nach Aristoteles (De anima I 5 p.411 a 7) hat Thales das
gesamte Universum für beseelt gehalten; in der Folgezeit wird
die "Seele der Welt" des Thales im Sinne der Stoa als der
leitende, alles durchdringende, den Kosmos durchwaltende
Weltgeist interpretiert und als Gott bezeichnet. "Aber
offensichtlich ist dies alles reine Mutmaßung, und wir wissen
nichts über Thales' Gottesbegriff"120.
Anaximandri opinio: Anaximander von Milet (um 610-546) nimmt
als Urprinzip das Unendliche an, das alles umfaßt und das
Ewige und Unvergängliche ist; aus ihm entstehen und vergehen
120
W.Jaeger, Die Theologie der frühen griechischen Denker 228.
115
in ewigem Wechsel eine Unzahl nebeneinander bestehender
Welten, und diesem Vergehen sind auch die aus ihm entstandenen
Götter unterworfen.
Wenn A. unzählige Welten annimmt und damit den Begriff des
"Unbegrenzten", scheint es sich dabei "nicht nur um eine
unendliche Sukzession von Welten in der Zeit zu handeln,
sondern zugleich um die Koexistenz unzähliger Welten oder
Himmel"; und Ciceros nativi dei sind hier nicht ewig, sondern
nur langlebig, weil diese Welten periodenweise entstehen und
vergehen.
Anaximenes: A. von Milet (gest. zwischen 528/525) nimmt als
Urstoff die unendliche Luft an, die das ganze Weltall so
umfaßt, wie unsere Seele uns beherrscht.
Anaxagoras: A. aus Klazomenai in Kleinasien (gest. 428) in
Athen mit Perikles befreundet, führt alles Entstehen und
Vergehen auf die Mischung und Entmischung einer unbegrenzten
Vielheit ursprünglich ungeordneter kleiner Elemente, Samen
oder Keime (Homoiomerien) zurück, aus denen ein körperlos
gedachter (und damit für die Epikureer unbegreifbarer)
weltordnender Geist anstelle des Chaos die Welt gebildet hat.
Daß er dieser Weltherrscher sein kann, ist ihm gerade und nur
aufgrund seiner Unvermischtheit und Reinheit möglich, und so
wird bei Anaxagoras "der Geist zum erstenmal im eigentlichen
Sinne
physikalisches
Prinzip,
auf
dem
die
ganze
121
Weltkonstruktion beruht" .
27 Crotoniates Alcmaeo: Alkmaion von Kroton, Arzt und Anatom,
Zeitgenosse und Schüler des Pythagoras, leitet aus der ewigen
Bewegung, die die Seele mit allem Göttlichen gemeinsam hat,
ihre Unsterblichkeit ab und steht damit im Widerspruch zur
Ansicht der Epikureer.
Pythagoras: P. erklärt das Zentralfeuer für das Vollkommenste
der ganzen Natur, für die Weltseele, die Gottheit.122
Xenophanes: X. aus Kolophon bei Eresos (um 570-460) lebte in
Elea (Unteritalien), kämpfte gegen den Polytheismus der
Volksreligion und erhob die Forderung nach einem einzigen,
durch die Kraft seines Geistes alles lenkenden Gott. Er nimmt
als Urprinzip das Eine an; dies ist Gott und das Seiende, das
121
122
W.Jaeger a.a.O. 183-185.
Vgl.Lactantius Inst. I 5,17: Pythagoras ita definivit, quid esset deus:
animus per universas mundi partes omnemque naturam commeans atque
diffusus, ex quo omnia quae nascuntur animalia vitam capiunt. –
"Pythagoras hat den Gottesbegriff folgendermaßen definiert: ein Geist,
der sich durch alle Teile der Welt und die gesamte Natur erstreckt und
verteilt und aus dem alle Lebewesen, die geboren werden, ihr Leben
erhalten."
116
nicht entstanden und ewig ist; Cicero faßt Acad. II 118
zusammen: Xenophanes (dixit) unum esse omnia neque id esse
mutabile et id esse deum neque natum umquam et sempiternum. "Xenophanes (hat gesagt), das Eine sei das All, und dieses
(Eine) sei einerseits nicht veränderlich und andrerseits Gott,
niemals entstanden und ewig."
Parmenides: P. aus Elea (geb. um 540), Schüler des Xenophanes,
nimmt eine Reihe übereinander gelagerter Kugelkronen an, von
denen die alle umfassende fest wie eine Mauer ist. In der
Mitte aller Kronen, also im Zentrum der Welt, wohnt die
Gottheit.
Empedocles: E. von Akragas (Agrigentum) auf Sizilien (ca. 483423), war der Verfasser eines Lehrgedichts über die Natur.
Zu quattuor naturas: E. begrenzt die naturae (die Urstoffe,
Prinzipien, Elemente), "die Wurzeln aller Dinge", auf vier Wasser, Feuer, Luft und Erde - und erhebt sie zu göttlichewigen Prinzipien allen Seins.123
Protagoras: Da es für Protagoras nur subjektive Vorstellungen,
aber keine objektive Wahrheit gibt und das Wissen sich nur auf
subjektive Wahrnehmungen gründen kann, sind diese in Hinblick
auf die Erkenntnis der Gottheit fraglich und machen den
Zweifel an deren Existenz verständlich.
Democritus: Demokrit aus Abdera erweiterte um 420 die von
Leukippos begründete Atomlehre.
Diogenes Apollonates: D. von Apollonia (in Phrygien oder auf
Kreta), jüngerer Zeitgenosse des Anaxagoras, nimmt wie
Anaximenes als Prinzip aller Dinge die Luft an, geht aber
weiter und teilt ihr geistige Eigenschaften, Leben und
Bewußtsein zu.124
30 Velleius rügt an der inconstantia Platonis zunächst, daß er
patrem huius mundi nominari neget posse. Vgl. dazu Tim. 28c
Tòn mèn oun poietèn kaì patéra tou de tou pantòs heurein te
érgon kaì heurónta eis pántas adynaton légein. - "Den Schöpfer
und Vater dieses Weltalls zu finden ist schwer; und ihn, wenn
man ihn gefunden hat, allen zu verkünden, ein Ding der
Vgl. Lukrez I 705-711; 716; 763-780.
Vgl. August. C.D. VIII 2 (I 322,32 D.-K.): aerem quidem dixit rerum
esse
materiam, de qua omnia fierent, sed eum esse compotem divinae rationis,
sine qua nihil ex eo firi posset. - "Diogenes von Apollonia hat
gesagt),
die Luft sei zwar die Urmaterie der Welt, aus der alles entstehe, sie
bsitze aber göttliche Vernunft, ohne die nichts aus ihr entstehen
könne."
123
124
117
Unmöglichkeit."
Cicero übersetzt dieselbe Stelle (Tim. 2) so: Atque illum
quidem quasi parentem huius universitatis invenire difficile,
et cum iam inveneris, indicare in vulgus nefas. - "Vor allem
sei es <erstens> schwer, jene <Gottheit>, die gleichsam der
Schöpfer dieses Weltalls sei, zu entdecken und <zweitens> eine
Sünde, sie <dann>, wenn man sie entdeckt habe, der großen
Masse preiszugeben."
Bei Laktanz lesen wir: Dei vim maiestatemque tantam esse dicit
in Timaeo Plato, ut eam neque mente concipere neque verbis
enarrare quisquam possit. - "Gottes Macht und Majestät, sagt
Platon in seinem 'Timaios', ist so gewaltig, daß niemand sie
begreifen noch mit Worten verkünden kann."
Celsus dagegen, "der erklärte Epikureer, der sich aber öfter
auf den Platon zurückwarf" (Krische 184), schließt aus dem
Timaioszitat, daß Gott akatonómastos sei, weshalb er von
Origenes zurechtgewiesen wird: árreton mèn kaì akatonómaston
oú phesin <Pláton> autòn einai, rhetòn d' ónta eis olígous
dynasthai légesthai. - "<Platon> sagt nicht, daß er <Gott>
unerklärbar und nicht genau zu bezeichnen sei, sondern er
sagt, daß er nur wenigen <in seinem ganzen Wesen> verständlich
gemacht werden könne."125
Platon muß seine Worte jedoch wohl mehr auf die atheistische
Richtung der Sophistik, die das Schaffen der Natur auf eine
vernunftlose wirkende Ursache zurückführte, gerichtet haben
bzw. allgemein auf alle erweitert haben, die seinen Gedanken
über die Schöpfung fernstanden, "um dadurch die wenigen
festzuhalten,
bei
denen
sich
gerade
die
angedeutete
Schwierigkeit der Erkenntnis Gottes ergeben soll" (Krische)
quid sit omnino deus: Auszugehen ist von Legg. VII p. 821 a 24: tòn mégiston theòn kaì hólon tòn kósmon phamèn oúte zeteîn
oúte polypragmoneîn tàs aitías ereunôntas. Ou gàr oud' hósion
eînai. - "Über den höchsten Gott und über das gesamte All
dürfe man weder Forschungen anstellen, sagt man, noch sich
viel Mühe damit machen, daß man den Ursachen <allen Seins>
nachspürt, denn das verstoße in jeder Weise gegen die
Frömmigkeit." Platon will hier das Vorurteil gegen die
astronomischen Studien seiner Zeit abbauen, durch das seine
Zeitgenossen in Hinblick auf die Himmelsgottheiten (Sonne,
Mond, Planeten) in falschen Vorstellungen leben, weil es als
Eingriff in die Religion gilt, über den höchsten Gott und den
Kosmos zu forschen, während Platon vom Gegenteil überzeugt
ist, so daß mit phamèn - "sagt man" - nicht Platons Ansicht,
sondern die seiner Zeit gemeint ist.
sine corpore ullo deum vult esse: Da sich in Platons Schriften
keine Stelle findet, wo das Wesen Gottes dem Ausdruck nach als
125
Origenes, Contra Cels. VII 42 und 43.
118
unkörperlich bezeichnet wird, "eben weil dieser Begriff bei
der durchgreifend idealen Richtung des Denkers sich selbst
setzt und beglaubigt", wird in der epikureischen Vorlage, in
der ein körperloser Gott als reines Vernunftwesen undenkbar
ist, "aus der allem Körperlichen überhobenen Vernunft
gefolgert", denn aísthesis (Empfindungsvermögen), phrónesis
(Denkvermögen) und hedoné (Lustempfindung) sind nach Epikur
einerseits mit dem Gottesbegriff verbunden, andrerseits aber
nur in einem Körper denkbar (vgl.Krische 192).
mundum deum esse: Ganz im Gegensatz zu einer fälschlich
unterlegten pantheistischen Auffassung erklärt Timaios im
Hinblick auf die vollendete Schöpfung des Bildners, dieser
habe seine Welt dià pánta dè tauta eudaímona theòn egennésato
- " Wegen all dieser Eigenschaften schuf er also einen
glückseligen Gott" (Tim. 34 b), nachdem von ihr vorher
ausgesagt wird, daß sie durch die Vorsehung der Gottheit zu
einem beseelten und vernunftbegabten Wesen geworden sei (Tim.
30 c) oder zu einem sich selbst genügenden und vollkommensten
Gott (Tim. 68 e). Platons Welt ist also nicht "Gott
schlechthin", sondern erst durch ihren Schöpfer und Vater zu
einem "Gott im mystischen Sinne" geworden.
caelum et astra et terram: Die Dreiteilung der Schöpfung in
das Gebiet der Fixsternwelt (caelum), den darunter liegenden
mittleren Teil, in dem sich die Sonne samt den Planeten
bewegt, und die Erdgegend. Die Weltkörper sind Götter als
sichtbare und erzeugte Kinder des ewigen Vaters (Tim. 40 d).
animos: Das Prädikat der Göttlichkeit für die Seelen (vgl.
Tim. 41 d - 42 d) ist hier weniger aus dem Wesen als aus ihrem
Ursprung, als Erzeugnis des ewigen Schöpfers, abzuleiten;
göttlich ist die Seele als unentstanden und somit auch
unvergänglich, weil sie - vgl. die bekannte Definition Phaidr.
245 c ff. - ihem Wesen nach sich selbst bewegt und als sich
selbst Bewegende Ursprung und Anfang der Bewegung ist.
Xenophon: Zu X. vgl. Mem. IV 3,13. Sokrates nennt die Sonne
nicht Gott, sondern vergleicht nur Gott mit der Sonne. Dagegen
trifft das "modo unum tum autem plures dicere" zu; denn
Sokrates nahm einen höchsten Gott, den Schöpfer und Lenker des
Weltalls, an und ließ daneben aus Rücksicht auf die staatliche
Ordnung auch die Volksgötter gelten.
Antisthenes: A. (ca. 455-360), Schüler des Gorgias, dann des
Sokrates, Begründer der kynischen Schule, bekämpfte den
Polytheismus und Anthropomorphismus der alten Volksreligion,
ohne mit der homerisch-hesiodeischen Mythologie zu brechen,
und stellte die Lehre von dem einen, natürlichen Gott auf;
vgl. Lact. Inst. I 5,18: Antisthenes <dicit> multos quidem
119
esse populares deos, unum tamen naturalem, id est summae
totius artificem. - "Antisthenes <sagt>, es gebe zwar viele
Volksgötter, aber trotzdem nur den einen, natürlichen Gott,
d.h. den Schöpfer der Welt."
Speusippus: Speusippos, Neffe Platons und dessen Nachfolger in
der Leitung der Akademie zu Athen von 348-339, schloß sich in
seinen theologischen Anschauungen Platon an. Die Vernunft ist
eine das All regierende seelische Kraft (vis animalis), die
mit Gott gleichgesetzt wird; das Gleiche gilt für die das
gesamte All erfüllende Weltseele.
33 Aristoteles in tertio de philosophia libro: = Aristot. fr.
26 (R). Zur Korrektur der von Velleius vorgebrachten Punkte:
menti tribuit omnem divinitatem: Es gilt zu prüfen, was
Aristoteles
gesagt
und
gedacht,
was
der
epikureische
Epitomator davon ausgewählt und welchen Sinn drittens Cicero
hineingelegt hat.
Für Aristoteles liegt zunächst das vollendete Wesen Gottes in
der schöpferischen Tätigkeit der betrachtenden Vernunft.
Nach Krische (280) beruht in der eigentlichen Quelle des
epikureischen Exzerptes der Begriff der Gottheit ganz auf dem
der höchsten Intelligenz und besteht das Leben der Gottheit in
dem ewigen Sichselbstdenken der betrachtenden Vernunft; beides
soll die Gottheit bei Cicero dadurch erhalten, daß der
Vernunft alle Göttlichkeit zugesprochen wird.
mundum ipsum deum: Aristoteles hat sowenig wie Platon eine
Lehre, die die Einheit des göttlichen Wesens und des Kosmos
nach pantheistischer Weise enthält, aufgestellt. Da er Gott in
der höchsten Potenz des Seins als die erste Wesenheit auffaßt,
die keine Materie hat (vgl. Met. XII 6 p. 246, 18), sondern
reine und vollkommene Tätigkeit ist, ergibt sich für ihn, daß
erstens dem Begriff und der Zahl nach Gott einer ist, der,
selbst unbewegt, für die bewegte Welt das Prinzip der Bewegung
ist und daß zweitens das von Gott ewig und beständig Bewegte
eins ist, daß also nur eine Welt existiert.
replicatione quadam: Nach Cicero soll hier nicht die einfache
Kreisbewegung gemeint, sondern auf eine besondere (quaedam)
hingewiesen werden; er deutet ihre Eigentümlichkeit zwar an,
"verdeckt aber durch die Unbestimmtheit der Wendung ... wenn
nicht wirklich seine eigene, doch des Epikureers begriffliche
Unklarheit" (Krische).
caeli ardorem deum esse: der ardor caeli (vgl. II 41: astra
... oriuntur in ardore caelesti, qui aether vel caelum
nominatur; Tusc. I 22 Aristoteles ... cum quattuor nota illa
genera principiorum esset complexus, e quibus omnia orerentur,
120
quintam quandam naturam censet esse, e qua sit mens; dazu I 41
quinta illa non nominata magis quam non intellecta natura und
I 65 sin autem est quinta quaedam natura, ab Aristotele
inducta primum, haec et deorum est et animorum. - "Als
Aristoteles jene bekannten vier Arten von Elementen, aus denen
sich alles entwickele, ihrem Begriff nach behandelt hatte, kam
er zu der Meinung, es gebe <außerdem noch> eine Art fünftes
Element, aus dem der Geist bestehe"; vgl. dazu Tusc. I 41:
"Jenes fünfte Element, das ebenso schwer mit einem Namen zu
benennen wie zu begreifen ist", und I 65: "Wenn es aber ein
fünftes Element gibt, das Aristoteles zuerst eingeführt hat,
dann ist dieses das Element, aus dem die Götter und die Seelen
bestehen."
Das quintum genus ist für Cicero das aus der Physik des
Aristoteles entlehnte Element des Himmels und der Gestirne und
das Prinzip der belebenden Wärme in den Lebewesen, von
Aristoteles aither genannt, wobei die etymologische Ableitung
zu aíthein (brennen, glühen) bei Anaxagoras ausdrücklich
abgelehnt wird. Im Gegensatz zu ihm hat sich Cicero hier
vermutlich der Ableitung des Anaxagoras angeschlossen und von
sich aus seiner Vorlage die Identität der Gottheit mit dem
Äther hinzugefügt.
34 Xenocrates: X. aus Chalkedon in Bithynien, nach Speusippos
339-314 Leiter der Akademie in Athen, führte alle weltlichen
Erscheinungen auf zwei Prinzipien, auf die Einheit (das
Männliche, Zeus, die Vernunft) und auf die unbestimmte
Zweiheit (das Weibliche) zurück. Der Himmel besitzt göttliches
Wesen, die Gestirne sind Himmelsgötter; unterhalb des Mondes
als des Mittelwesens zwischen Göttern und Menschen befinden
sich die Dämonen; in den Elementen wohnen göttliche Kräfte,
die Gottheiten des Volksglaubens.
Ponticus Heraclides: Herakleides von Pontos, dem Land an der
Südküste des Schwarzen Meeres (ca. 390-310), Schüler Platons,
knüpfte
an
Heraklits
Theorie
eines
heliozentrischen
Weltsystems an, die von Aristarchos von Samos (320-250)
vollendet wurde. Das Weltall besteht aus verbindungslosen,
d.h. durch leere Räume getrennten Grundkörperchen, wobei der
Aufbau der Welt abweichend von der rein mechanischen
Naturerklärung der Atomistik durch ein göttliches Walten
zustande kommt.
Theophrasti inconstantia: Theophrastos von Lesbos, um 370-287,
der bedeutendste Schüler des Aristoteles und von 322 an dessen
Nachfolger in der Leitung des Peripatos in Athen, blieb,
allerdings
mit
Einschränkungen,
in
den
aristotelischen
Anschauungen und verteidigte vor allem die peripatetische
Lehre von der Weltewigkeit gegenüber der Stoa.
121
Strato: Straton von Lampsakos, der "Physiker", seit 288 als
Nachfolger Theophrasts Leiter des Peripatos, baute die
aristotelische Lehre empirisch-naturalistisch aus.
omnem vim divinam in natura sitam esse: Straton will die Natur
in ihrem gesetzmäßigen und zweckmäßigen Bilden und Schaffen
als eine nur blind, d.h. unbewußt wirkende Ursache und nicht
als beseeltes Wesen verstanden wissen126 und entwickelte seine
Physik gegen die demokriteisch-epikureische Atomistik (vgl.
dazu Acad. II 121: Quaecumque sint, docet, omnia effecta esse
natura - "Alles, was existiert, lehrt <Straton>, sei von einer
<unbewußt schaffenden> Naturkraft gebildet worden."
36 Zeno: Zenon aus Kition auf Zypern (325-262) begründete um
300 in Athen "durch Veredelung der kynischen Ethik und durch
ihre Verbindung mit heraklitischer Physik und modifizierten
aristotelischen Lehren" (Praechter) die stoische Schule.
Velleius' Darstellung weicht insofern von der Wahrheit ab, als
die Stoa nicht das Gesetz als Gott, sondern Gott als das
Gesetz ansieht, vgl. Lact. Inst. I 5, 20-21: Chrysippum
naturalem vim divina ratione praeditam, interdum divinam
necessitatem deum nuncupat, item Zeno naturalem divinamque
legem - "Chrysipp bezeichnet die mit göttlichem Denkvermögen
begabte Naturkraft, manchmal auch die göttliche Notwendigkeit
als Gott, ebenso Zenon das natürliche und göttliche Gesetz."
rationem quandam: Vgl. Lact. Inst. IV 9,2: Zeno rerum naturae
dispositorem atque opificem universitatis lógon praedicat,
quem et fatum et necessitatem rerum et deum et animum Iovis
nuncupat - "Zenon verleiht dem Ordner der Welt und dem
<kunstvollen> Gestalter des Alls den Namen Logos, den er
<mitunter auch> als Schicksal, notwendig bedingten Ablauf
<aller> Dinge, als Gott und Geist Jupiters bezeichnet."
Vgl. auch Tertull. Apol. 21: Apud vestros quoque sapientes
lógon, id est sermonem atque rationem, constat artificem
videri universitatis. Hunc enim Zeno determinat factitorem,
qui cuncta in dispositione formaverit, eundem et fatum vocari
et deum et animum Iovis et necessitatem omnium rerum - "Auch
bei euren Philosophen gilt der Logos, d.h. sermo atque ratio,
bekanntlich als der kunstvolle Bildner des Alls. Denn diesen
<Logos> bestimmt Zenon als den Schöpfer, der alles in <so
kunstvoller> Anordnung gebildet habe, und läßt dem gleichen
<Logos> die Bezeichnung Schicksal, Gott, Geist Jupiters und
notwendig bedingter Verlauf aller Dinge zukommen."
ardorem, qui aether nominetur: Vgl. Acad. II 126: Zenoni et
Vgl. Seneca bei August. C.D. VI 10 (I, 267,22 D.-K.): Platonem et
Peripateticum Stratonem, quorum alter fecit deum sine corpore, alter sine
animo - "...Platon und den Peripatetiker Straton, von denen der eine Gott
keinen Körper, der andere ihm keine Seele zugestehen will."
126
122
reliquis fere Stoicis aether videtur summus deus, mente
praeditus, qua omnia regantur - "Dem Zenon und fast <allen>
übrigen Stoikern gilt der Äther als die höchste Gottheit, mit
dem Denkvermögen begabt, durch das alles geleitet werde."
37 Aristonis: Ariston von Chios (um 250), Schüler des Zenon
und Vertreter
der alten Stoa, ging weiter als Zenon; alles
mit Ausnahme der Tugend und des Lasters ist gleichgültig; die
Physik, zu der auch die Lehre vom Wesen der Götter gehört,
kann dem Menschen über dieses keine sicheren Erkenntnisse
vermitteln, daher das "neque formam dei intellegi posse" und
das "neque in dis sensum esse" und das "dubitare" darüber,
"omnino deus animans necne sit" des Epicureers.
Cleanthes: Kleanthes von Assos in der Troas war Schüler und
Nachfolger Zenons in der Leitung der Stoa.
in libris contra voluptatem: Kleanthes hatte, wie vor ihm
Antisthenes in seinem gleichnamigen Werk Perì hedonês, gegen
den Hedonismus geschrieben und gegen die epikureische Deutung
des Lustbegriffs seine eigene entwickelt, wobei er die
Lustempfindung als ersten Trieb der Natur ablehnte und
betonte, daß die Lust ihrer sittlichen Bedeutung nach keinen
Wert im menschlichen Leben habe. Da das höchste Gut in einem
Leben in Übereinstimmung mit der Natur besteht, griff er von
da aus ebenfalls den Hedonismus an, indem er keinen
unbeschwerten Genuß, sondern Tätigkeit als höchsten Zweck des
Lebens forderte.
fingit formam quandam et speciem deorum: Anspielung auf die
Allegorie der Naturgötter und ihrer Ableitung aus den
elementaren Grundkräften, mit der der Epikureer im Hinblick
auf
die
ursprüngliche
und
natürliche
anthropomorphe
Vorstellung von den Göttern, über die uns nach I 46 (a natura
habemus omnes omnium gentium speciem nullam aliam nisi humanam
deorum) Natur und Vernunft (partim natura nos admonet partim
ratio docet) belehren, nicht einverstanden sein kann.
Persaeus: Persaios von Kition auf Zypern, Schüler des Zenon in
Athen, lebte um 270 am Hofe des Makedonenkönigs Antigonos
Gonatas; er erblickte in den Wohltätern der Menschheit
göttlichen Geist und leitete daraus ihre göttliche Verehrung
ab.
res sordidas: Zu den dei sordidi im eigentlichen Sinn zählt
die Cloacina, die Göttin der Cloaca maxima in Rom, deren
Heiligtum an der Stelle lag, wo die Cloaca maxima ins Forum
eintrat (vgl. Wissowa RE IV 1, 60); dann der altrömische
Bauerngott Sterculus; von stercus, Kot, Mist, "der göttliche
Erfinder des Düngens der Felder" (vgl. Marbach, RE IV A
123
2,2412.)
Chrysippus: Chrysippos von Soloi (oder Tarsos) in Kilikien
(281/78-208/5), Schüler und Nachfolger des Kleanthes und
zweiter Begründer und Hauptvertreter der stoischen Schule
("Wenn Chrysippos nicht gewesen wäre, existierte die Stoa
nicht"), ausgezeichnet durch seine dialektische Schärfe, gab
der Stoa die Grundlagen, die nach seinem Tode im wesentlichen
unverändert blieben. Zur Stelle:
a)
principatus:
das
hegemonikón,
die
Grundkraft,
das
herrschende Prinzip des Kosmos.
b) communis natura: die allgemeine Natur, ist im Gegensatz zu
der
menschlichen
die
alles
durchdringende
und
alles
beherrschende Kraft der Natur.
c) fatalis vis, das fatum, das Schicksal, ist zu verstehen als
die Kraft, die alles mit absoluter Gesetzmäßigkeit bestimmt
und den ganzen Kosmos durchdringt, die unabänderliche Wahrheit
des Kommenden, während necessitas die unbesiegbare und
gewaltsame Ursache ist, die neben der fatalis vis besteht und
der keine Vernunft innewohnt.
41 Orphei: Orpheus, Sohn des Apollon und der Kalliope, König
von Thrakien, Sänger und Dichter, galt als Verfasser einer
Theogonie, ebenso sein Schüler Musaios.
Hesiodi: Hesiodos aus Askra in Böotien schrieb um 700 seine
Theogonie, die für die Kenntnis der sog. homerischen Religion
von besonderem Wert ist.
Diogenes Babylonius: D. von Seleukia am Tigris, Vertreter der
alten Stoa, nach Zenon von Tarsos Leiter der Schule in Athen,
kam 116 als Gesandter nach Rom hielt dort philosophische
Vorträge und zog sich dadurch die Feindschaft Catos zu.
42 - 43: Die Aussagen der Dichter
Die Angriffe gegen die religiösen Aussagen und Darstellungen
der Dichter decken sich inhaltlich mit Varros Kritik des
"primum
genus
theologiae",
des
"genus
mythicon"
oder
"fabulosum" der Dichter, in dem "sunt multa contra dignitatem
et naturam immortalium ficta. In hoc enim est, ut deus alius
ex capite, alius ex femore sit, alius ex guttis sanguineis
natus;
in hoc, ut dii furati sint, ut adulterarint, ut
servierint homini; denique in hoc omnia diis adtribuuntur,
quae non modo in hominem, sed etiam quae in contemptissimum
hominem cadere possunt".127 (August. C.D. VI 5 <I 252, 28ff.
<Das "genus fabulosum" der Dichter> bietet <uns> viele Dinge, die gegen
die Würde und das Wesen der Götter verstoßen. Denn da lesen wir, daß eine
Gottheit aus dem Haupt <einer anderen>, eine andere aus dem Schenkel
<eines Gottes> und wiederum eine andere aus den Blutstropfen <eines
127
124
D.-K.>).
43 - 56: Die Götterlehre Epikurs
Die Aussagen 43 - 56 über das Wesen der Götter sind echtes
Lehrgut Epikurs, aber auch des Philodemos, das Cicero dessen
zahlreichen Schriften Perì theon oder vielleicht einer aus dem
Kreise jüngerer Epikureer für ihn zusammengestellten Epitome
entnehmen konnte.
Praechter (I 473) verweist in diesem Zusammenhang auf den in I
59 unter Berufung auf das Urteil des Philon von Larissa als
"coryphaeus Epicureorum" genannten Zenon, den auch Cicero
selbst gehört hatte. Näher liegt die Annahme, daß Cicero eine
für ihn von Philodemos selbst geschriebene Epitome zur
Darstellung der epikureischen Theologie benutzt hat. (Vgl.
Usener, Epic. LXVI und Hermes 1916, 606ff.).
43 - 45: Die Existenz der Götter ist in der menschlichen Seele
als Vorbegriff (Prolepsis, anticipatio) enthalten.
43 Epicurum: Epikuros aus dem attischen Gargettos (342-271),
Schüler des Demokriteers Nausiphanes (vgl. I 73), ist der
Begründer der nach ihm benannten epikureischen Philosophie.
quae est enim gens... (Denn wo gibt es ein Volk oder eine
Menschenart, die nicht auch ohne eine Belehrung einen
bestimmten Vorbegriff von den Göttern besäße, den Epikur
prólepsis d.h. eine bestimmte, in der Seele vorauserfaßte
Vorstellung von einer Sache nennt, ohne die man etwas weder
erfassen noch untersuchen noch diskutieren kann?): Zu dieser
These vgl. Cic.Legg. I 24: Nulla gens est neque tam mansueta
tam fera, quae non, etiamsi ignoret, qualem habere deum
deceat, tamen habendum sciat (Kein Volksstamm ist von so
friedfertiger oder von so wilder Natur, daß er - auch wenn er
nicht wüßte, was für eine Gottheit zu haben für ihn passend
wäre - trotzdem nicht wüßte, daß er eine haben muß.); Tusc. I
30: Multi de dis prava sentiunt; id enim vitioso more effici
solet; omnes tamen esse vim et naturam divinam arbitrantur;
nec vero id collocutio hominum aut consensus effecit, non
institutis opinio est confirmata, non legibus; omni autem in
re consensio omnium gentium lex putanda est (Viele machen sich
über die Götter falsche Gedanken; denn das ist meist die Folge
von falscher Sitte und Gewohnheit. Trotzdem glauben alle an
die Existenz einer göttlichen Kraft und einer göttlichen
Natur; dies hat aber nicht eine Vereinbarung oder ein
göttlichen Wesens> geboren wurde <oder entstanden ist>; da lesen wir, daß
Götter gestohlen, Ehebruch begangen und einem Menschen als Sklaven gedient
haben; kurz, es wird darin all das auch den Göttern angehängt, was nicht
nur einem Menschen <schlechthin>, sondern vielmehr einem Menschen der
verächtlichsten Art zustoßen kann.
125
Übereinkommen der Menschen zustande gebracht, dies ist keine
durch Sitten und Gebräuche, keine durch Gesetze entstandene
Meinung;
in jedem Falle aber muß die Übreinstimmung aller
Völker als ein Naturgesetz angesehen werden.)
Ferner Sen. Ep. 117,6: Deos esse inter alia hoc colligimus,
quod omnibus insita de dis opinio est nec ulla gens usquam est
adeo extra leges moresque proiecta, ut non aliquos deos credat
(Daß es Götter gibt, schließen wir u.a. auch aus der Tatsache,
daß
allen
<Menschen
von
Natur
aus>
eine
<bestimmte>
Vorstellung von Göttern eingeboren ist und daß es nirgends ein
Volk gibt, das so sehr außerhalb <aller> Gesetze und Sitten
liegt, daß es nicht an irgendwelche Götter glaubte.).
Noch Calvin wiederholt dieses Argument mit ausdrücklichem
Bezug auf Cicero (Calvin Inst. I 3,1 - ille Ethnicus = der
bekannte heidnische Philosoph).
anticipationem (prólepsin) – „Vorbegriff“: Zum Begriff der
prólepsis bei Cicero ist zunächst auffällig, daß Cicero
festhält, daß Epikur selbst das prólepsis genannt hat, was vor
ihm noch niemand mit diesem Ausdruck bezeichnet hatte (I 44).
Das heißt nicht, daß es den Terminus vorher nicht gegeben
hätte, sondern nur, daß Epikur ihn in diesen Zusammenhang als
erster gestellt hat. Er hat einen Ausdruck aus der
Erkenntnislehre, der schon vor ihm der Stoa geläufig war,
theologisch verwendet.
Der Stoiker Zenon hat das Wesen der Vorstellung so definiert:
sie sei eine Prägung (ein Prägebild) in der Seele (týposis en
psychê, St.v.fr. I Nr.58); und Kleanthes verglich sie mit dem
Abdruck eines Petschafts in Wachs (St.v.fr. I Nr. 484);
Chrysippos aber bekämpfte die wörtliche Auffassung des
zenonischen Ausdrucks und definierte seinerseits die phantasía
als heteroíosis psyches (Sext. Empir. adv. math. 7, 228ff.
372, St.v.fr. II Nr. 56).
Welche Stellung hat diese prolepsis im Zusammenhang der
Erkenntnislehre der Stoa?
Wenn wir ein Objekt wahrgenommen haben, so bleibt auch nach
der Entfernung desselben davon eine Erinnerung (mnéme) zurück.
Aus vielen gleichartigen Erinnerungen bildet sich die
Erfahrung (empeiría, welche definiert wird als tò tôn
homoeidôn phantasiôn plêthos). Aus den Wahrnehmungen geht
durch den Fortgang zum Allgemeinen der Begriff (énnoia)
hervor, und zwar teils von selbst (anepitechnétos), teils
durch eine absichtliche und methodische Denktätigkeit (di'
hemetéras didaskalías kaì epimeleías); im ersten Fall
entstehen die prolépseis (oder koinaì énnoiai), im anderen die
technisch gebildeten énnoiai (St.v.fr. II Nr. 83). Die
prólepsis ist (nach Diog. L. 7, 54) énnoia physikè tou
kathólou. Ihren Sensualismus durchbrechend sprechen die
Stoiker auch von émphytoi prolépseis, angeborenen Begriffen
(Stoic.vet.fragm. III Nr. 69). Der lógos (nous) ist ein
126
Produkt der fortschreitenden Entwicklung des Menschen; er
sammelt sich (synathroízetai) aus den Wahrnehmungen und
Vorstellungen
allmählich
an
bis
gegen
das
vierzehnte
Lebensjahr (St.v.fr. I Nr. 149). Von der Wahrnehmung, dem
Näheren, dem Einzelnen ausgehend, kann man zu dem Ferneren,
dem Allgemeinen durch die logischen Operationen aufsteigen,
und das Weltganze kann nur durch die Vernunft erkannt werden;
auch hier kommt der Rationalismus gegenüber dem Sensualismus,
mit
dem
die
Stoiker
einsetzen,
zur
Geltung.
Die
kunstgerechte Bildung von Begriffen, Urteilen und Schlüssen
ruht auf gewissen Normen, welche die Dialektik zu lehren hat.
(In der Lehre vom Begriff vertreten die Stoiker die Ansicht,
die später als Nominalismus oder Konzeptualismus bezeichnet
worden ist. Sie halten dafür, daß nur das Einzelne reale
Existenz habe und das Allgemeine nur in uns als subjektiver
Gedanke sei, und bekämpfen deshalb die Ideenlehre (St.v.fr. I
Nr. 65).)
Das Gemeinschaftliche des Begriffs der prólepsis in der
Epikureischen und Stoischen Schule besteht darin, daß er in
der Erfahrung seinen Anknüpfungspunkt findet, indem jede
Erkenntnis von außen gewonnen wird. (Die Art und Weise, wie
die Vorstellung in uns zustande kommt, unterscheidet die
beiden Schulen dann.)
Velleius erläutert den terminus zunächst so: "id est
anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec
intellegi quicquam nec quaeri nec disputari potest. (d.h. eine
bestimmte, in der Seele vorauserfaßte Vorstellung von einer
Sache, ohne die man etwas weder erfassen noch untersuchen noch
diskutieren kann).
Wie aber kann die Anknüpfung an die Erfahrung geschehen, wenn
es um den Glauben an die Götter geht? Unbewußt? Den bewußten,
aus der Herrlichkeit der Welt schlußfolgernden Weg, d.h. in
nuce den kosmologischen Gottesbeweis hat der Epikureer
Velleius ja von sich gewiesen, wie ihm Cotta (I 100) auch
vorhalten wird: Ferner wolltest du die Männer tadeln, die auf
Grund der großartigen und herrlichen Werke, als sie die Welt
an sich, als ihre einzelnen Teile, Himmel, Länder und Meere,
und als sie das Herrlichste davon, Sonne, Mond und Sterne,
betrachtet und auch das rechtzeitige Eintreten, den Wechsel
und die Veränderungen der Jahreszeiten festgestellt hatten, zu
der Vermutung gelangt waren, es gebe ein hervorragendes und
außergewöhnliches Wesen, das dies hervorgebracht habe und nun
in Bewegung halte, regiere und lenke. Selbst wenn sie von
ihrer Vermutung aus nicht das Richtige treffen, sehe ich
trotzdem, was sie im Auge haben: Welches große, herrliche Werk
gibt es in aller Welt denn nun für dich, von dem du glauben
könntest, es sei aus göttlichem Geist entstanden, und das dich
die Existenz von göttlichen Wesen ahnen ließe? 'In meiner
127
Seele', sagst du, 'trug ich eine ihr eingepflanzte gewisse
Vorstellung von einem göttlichen Wesen.' ('Habebam', inquis,
'in animo insitam informationem quandam dei.') - Was kann das
bedeuten?
Eine mögliche Antwort ist: Cicero hat den Epikureismus nicht
ganz verstanden. (Der Kommentator Krische (48-51) kritisiert,
daß Cicero hier von eingepflanzten und selbst angeborenen
Erkenntnissen der Götter redet und daneben die anticipatio
oder praenotio derselben bestehen läßt, die als eine im Geist
vorher erfaßte Vorstellung zu denken sei. Der Fehler Ciceros
liege
nicht
in
der
Bezugnahme
auf
die
doppelten
Vorstellungsarten, sondern in der Vermischung beider, "wobei
die prolepsis zu geistig gefaßt und ihr in dem sinnlichen
Eindruck haftender Ursprung gänzlich verwischt wird".)
Eine andere mögliche Antwort ist die, daß wir den Epikur noch
nicht ganz verstanden haben. Wenn man unseren relativ großen
zeitlichen Abstand bedenkt, ist die Wahrscheinlichkeit für
letzteres größer.
Nehmen wir an, Epikur habe - dem atomistischen Grundprinzip
treu -jede Vorstellung von außen abgeleitet, so konnte er die
prolepsis nur für eine Erinnerung an oftmals von außen
erhaltene Erscheinungen ausgegeben haben, d.h. aber, für ihn
muß es solche Erscheinungen, sei es im Wachen, sei es im
Schlaf, gegeben haben. Die Frage ist dann nur, wie wir diese
Annahme nachvollziehen können.
Die neuere Forschung hat sich bemüht, den Epikureismus nicht
zu isolieren, nicht unbewußt dem polemischen Schema der
Kirchenväter
zu
verfallen.
Man
ist
auch
der
Frage
nachgegangen, welche Fäden Epikurs Lehre von den Göttern und
der wahren Frömmigkeit nicht nur mit der allgemeinen
Religiosität der frühhellenistischen Zeit, sondern auch mit
der platonischen Auffassung verknüpfen; auch wenn der
Unterschied sehr groß zu sein scheint.
Es ist auf das Buch von Festugière hinzuweisen: Epicure et ses
Dieux.128
Das Buch beschränkt sich nicht auf Theologie und
Frömmigkeitslehre des Kepos und ist ein besonders geeigneter
Zugang zum Geist der epikureischen Philosophie überhaupt. Es
versucht die wichtige Frage zu beantworten: Wie konnte eine
Lehre, in deren Mittelpunkt der verständig abwägende Kalkül
von Lust- und Unlustquanten steht, jene Anziehungskraft
gewinnen,
die
sie
weit
über
den
Hellenismus
hinaus
nachweislich gehabt hat?
128
In engl. Übersetzung: Festugière, Epicurus and his Gods. Oxford 1955.
128
Zweckmäßiger Weise knüpft man bei der Untersuchung des
Verhältnisses Epikurs zu den Göttern an den theologischen
Passus des sog. Menoikeus-Briefs an, den Diogenes Laertios
überliefert hat (10, 122/35). Dieser Brief entwickelt die
Summe der neuen Lebenskunst, er verfolgt die Absicht
persönlicher Seelsorge, ist aber sicher darüber hinaus von
vornherein als Propagandaschrift für weitere Kreise gedacht,
also eine Art "Protreptikos" in Briefform. Es gilt, die
Elemente des guten Lebens zu begreifen, die stoicheîa toû
kalôs zên. Und dabei geht es zunächst um die Theologie (10,
123f.): Der Adressat soll die allgemeine, im Menschen
angelegte Vorstellung von der Gottheit (koinè toû theoû
nóesis) rein, d.h. nicht verfälscht durch die entstellenden
Zutaten der Doxa, bewahren; die Aussagen der Menge befinden
sich im Widerspruch zu der Erkenntnis der Götter (gnôsis tôn
theôn),
die
als
solche
"augenscheinliche
Deutlichkeit"
(enárgeia - wichtiger Grundbegriff der epikureischen Kanonik)
besitzt. Den falschen Vermutungen der Nichtweisen (hypolépseis
pseudeîs) über die Götter stehen gegenüber die "wahren
Vorstellungen" (prolépseis), wie sie die Weisen darüber
besitzen.
Folge
der
reinen
Gottesvorstellungen
sind
(spirituelle, nicht durch den Eingriff der Götter in den
Weltlauf zustandekommende) "Förderungen", insofern die Götter
die ihnen ähnlichen Menschen, eben die Weisen, "aufnehmen",
d.h. ihrer geistigen Gemeinschaft würdigen, während bei den
"Schlechten",
eben
den
Nichtweisen,
die
falschen
Gottesvorstellungen zu "Schädigungen" führen (d.h. zu einer
Quelle innerer Nöte zu werden pflegen).
Theoì mèn gàr eisín, enargès gàr autôn estin he gnôsis. "Denn
Götter gibt es tatsächlich: unmittelbar einleuchtend ist deren
Erkenntnis." - Erinnern wir uns an Thomas Bernhards Aussage im
Blödelton (was aber seine normale Art war, die ernstesten
Dinge zu erörtern): "Gott ist ja überall, brauch ich ja nicht
daran zu glauben". Das heißt nichts anderes, als daß es eine
Denkmöglichkeit ist, geradeso gut wie ihr Gegenteil: daß die
Anschauung Gottes für den, der es zu fassen wüßte, die
alltäglichste Sache sein könnte. So ein Mensch hätte wohl
selbst etwas Göttliches an sich.
Und der Brief des Epikur klingt aus mit der Versicherung, daß
die Beherzigung dazu führe, "unter den Menschen zu leben wie
ein Gott" (zése ... hos theòs en anthrópois); denn keineswegs
gleiche einem sterblichen Wesen ein Mensch, der im Besitze
unsterblicher Güter lebe.
Ein Vorblick auf das Christentum zeigt uns: Christus wird als
theós im Urchristentum gesehen. Auf die Erklärung Jesu (was
eine theologische Aussage des Evangelisten sein kann): egò kaì
ho patèr hén esmen (Ich und der Vater sind eins), antworten
129
die Juden nach Jo 10,30ff. mit dem Vorwurf: sù ánthropos on
poieîs seautòn theón. Da macht Jesus ihnen an einem Bibelzitat
begreiflich, daß eine solche Benennung an sich nichts
Unerhörtes ist, und daß ein Würdename, der nach Psalm 82,6 den
Menschen anscheinend zusteht, dem Heiligen und Abgesandten
Gottes grundsätzlich nicht verwehrt werden könnte. Aber
freilich, der Würdename, den er selbst hier in Anspruch nimmt,
ist nur hyiòs toû theoû (Sohn Gottes).
Es war E.Bignone,129 der nachgewiesen hat, daß "Epikur unter
intensiver
Auseinandersetzung
mit
der
platonischen
und
aristotelischen Lehre von der Lust seine zentrale Position
gewonnen und gesichert hat" (so Pohlenz GGA 1936, 519/24). Vor
allem hat Bignone das "deus mortalis"-Motiv des Briefschlusses
überzeugend als bewußte Beziehung auf Aristoteles zu deuten
vermocht: wenn Aristoteles als Ideal das Leben nach dem Geist
schilderte, das den Menschen zum Gott macht (hóste dokeîn pròs
tà álla theòn eînai tòn ánthropon frg. 61 Rose = protr. frg 10
c Ross), so wollte Epikur dieses Ideal nicht nur als
verträglich mit den Grundlagen seines eigenen, ganz anders
gearteten Philosophierens erweisen, sondern zeigen, daß es nur
von seinen Voraussetzungen her voll zu realisieren sei.
Im Zusammenhang mit dem deus mortalis-Motiv muß ich natürlich
auch Hölderlin zitieren:
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
Was man in Zusammenhang mit dem Vers lesen muß:
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen.
D.h.: Daß es eine Gottesvorstellung geben könne, die sich
nicht auf Macht, Fürsorge und Strafgewalt Gottes gründet,
sondern nur darauf, daß er ist, daß er Gott ist - davon wissen
nur wenige.
Hier spricht sich eine heroische Form des Gottesglaubens aus.
Ein heroischer Mensch verehrt die Götter um ihrer Erhabenheit
und ungetrübten Seligkeit willen, ohne sich selbst darum elend
und nichtig zu fühlen, und der in der Gewißheit des Todes
keine Demütigung und keine Drohung empfindet. (Anderseits
fehlt dem Epikureismus der aristokratische Dünkel bzw. der
Dünkel der Männergesellschaft). Diese Hochgemutheit ist später
immer wieder aufgenommen worden. Ein Beispiel, das ich Walter
F.Otto verdanke: Spinoza, den Goethe sehr verehrte, sagt in
seiner Ethik: "Wer Gott liebt, kann nicht wollen, daß Gott ihn
wiederliebe".
Aber auch innerhalb der katholischen Kirche findet das Motiv
seinen
spezifischen
Ausdruck:
In
der
franziskanischen
E.Bignone, L'Aristotele perduto e la formazione filosofica
di Epicuro 1/2, Firenze 1936.
129
130
Identifikation mit dem leidenden Christus. So kann es in einem
Gebet des Franziskus von Assisi lauten: "Nicht um geliebt zu
werden, sondern um zu lieben..."
Ein Aspekt dieser Tendenz zur Identifikation mit Gott (grob
gesagt) ist der einer gewissen Verinnerlichung. es erhebt sich
daher die Frage, und sie ist schon in der Antike gestellt
worden, wie das Verhältnis zum Kult, zum Äußerlichen der
Religion zu verstehen ist. Antike Kritiker haben Epikur gerne
vorgeworfen,
sein
relativ
konservatives
Verhältnis
zur
Volksreligion sei nur ängstliche Anpassung und im Grunde reine
Verstellung. Cicero nat.deor. 1, 85 heißt es von Epikur: ne in
offensionem Atheniensium caderet – um bei den Athenern nicht
Anstoß zu erregen. Und Plutarch, non posse suaviter vivi 21 p.
1102 b = Us. 103,7: hypokrínetai ... euchàs kaì proskynéseis er heuchelt Gebete und Demutsgesten.
Wir sind heute aber eher geneigt zu glauben, daß Epikur den
Gedanken der homoíosis theô (Angleichung an Gott, imitatio
dei)
weiterentwickelte.
Die
Gottesanschauung
und
Gotteserkenntnis, und die mit ihr in enger Verbindung stehende
homoíosis theô ist die edelste Form des eudaimoneîn.
Man
hat
bei
Epikur
Anklänge
an
die
Mysteriensprache
registriert, z.B. in der Verwendung des Wortes téleios für den
Eingeweihten (Philodem de dis 1, col. 24, 11: "Den vollkommen
Vollendeten können nach unserem Glauben auch die Götter
allesamt nicht schrecken"), anderseits den Bezug zur hohen
Bildniskunst des 4.Jh. hergestellt, deren Götterbilder man
nicht als "irreligiös, als rein künstlerische Phänomene" (so
Otto) werten dürfe.
In diesem Sinn wird man die Darstellung der epikureischen
Theologie durch Nilsson (Geschichte der griechischen Religion,
2, 1950, 239 ff.) in einzelnen Punkten korrigieren müssen, wo
die Religiosität Epikurs unterbewertet wird. Ein guter
Ausdruck scheint der von Schmid zu sein, der die theologische
Lehre Epikurs als eine Philosophie der olympischen Religion
bezeichnet.130
Es muß uns klar sein: Mit solchen Versuchen der Annäherung
weichen wir dem Anspruch der Bestimmung eines Gottesbegriffs
aus. Aber, wie Heinrich Dörrie im Reallexikon für Antike und
Christentum es konstatiert, für den griechisch-römischen
Bereich
dürfen
wir
einen
Gottesbegriff
nicht
einfach
voraussetzen. Die griechische und die römische Religiosität
wurzeln in vielfältigen, reich differenzierten Vorstellungen
Wolfgang Schmid, Götter und Menschen in der Theologie Epikurs: RhMus
94, 1951, 97/156. - Die theoì rheia zóontes, die leicht lebenden Götter
sind hier wie von keinem anderen griechischen Denker thematisiert. Vgl.
Hölderlin: Ihr wandelt droben im Licht/ Auf weichem Boden, selige Genien!
/ Glänzende Götterlüfte / Rühren euch leicht, / Wie die Finger der
Künstlerin / Heilige Saiten.
130
131
von den Göttern und vom Göttlichen. Aber der Schritt, von da
zu einem Gottesbegriff zu gelangen, ist, ungeachtet mehrerer
Ansätze, die dazu hätten führen können, nicht getan worden. Seit
Sokrates
hat
die
griechische
Philosophie
daran
gearbeitet, zunächst unreflektierte Vorstellungen derart zu
verdichten, daß man sie ergreifen = begreifen kann. In aller
Regel steht am Ende einer solchen Arbeit des Prüfens
(Sokrates: exetázein) eine Definition; diese Arbeit ist durch
die Schulen Platons, Aristoteles', der Stoiker hundertfach
geleistet worden; Platons Ideenlehre, nach ihm Aristoteles'
Logik dienten vornehmlich der Begriffsfindung. Viele Begriffe,
die auf dem Feld der Ethik erarbeitet wurden, werden bis heute
verwendet. - Es ist daher in hohem Maße auffällig, daß keine
philosophische Richtung zu einem Gottesbegriff gelangt ist,
derart, daß die Besonderheit eines Gottes, oder des Gottes,
mit rationalen Mitteln ausgedrückt worden wäre. Wohl herrscht
vollständige Einmütigkeit darüber, daß (negativ ausgedrückt)
die Götter von aller menschlichen Defizienz frei sind, daß sie
(positiv ausgedrückt) Wesen von höchster und subtilster
Steigerung der Existenz sein müssen. Eben darum aber entziehen
sie sich dem Begriffen-Werden (katalambánesthai), d.h. ihr
Wesen ist akatálepton - unbegreifbar. Anders ausgedrückt: Das
Göttliche entzieht sich jedem Versuch, es definitorisch
festzulegen. Konsequenter Weise gibt es auch keine Theologie,
sondern nur vielerlei Reflexionen über das Wesen der Götter
und des Göttlichen. Die Ergebnisse solcher Reflexionen sind
häufig als theologoúmena formuliert worden, d.h. als einzelne
Aussagen, die einzelne Wesenszüge des Göttlichen kennzeichnen.
Solche theologoúmena, die man etwa bei Homer und Hesiod, bei
Herakleitos v. Ephesos und bei Platon fand, hat man nachmals
mit sorgsamem Fleiß gesammelt. Aber man hat sie nicht zu einer
Gesamt-Aussage, also nicht zu einer theología vereinigt oder
verdichtet. Denn hierüber bestand wie gesagt eine nie
erschütterte Einhelligkeit: Das Göttliche entzieht sich dem
Begriffen-Werden (katalambánesthai). So entsteht zwischen
Platon und Philon v.Alex. eine ganze Nomenklatur, durch welche
die Unergreifbarkeit = Unbegreiflichkeit Gottes bezeichnet
wird: akatáleptos, dysthératos, akatonómastos, dýsleptos
u.a.m. Hier liegt der Ausgangspunkt für eine theologia
negativa, die über ihren Gegenstand, Gott, im Grunde nur das
eine auszusagen weiß, daß alle etwa möglichen Aussagen nicht
bis an diesen Gegenstand heranreichen. Darum hat sich während
der Antike keine Theologie herausgebildet, die sich mit
christlicher Theologie vergleichen ließe: Der Mittelpunkt
einer solchen Theologie war der Begrifflichkeit entrückt; die
Aufgabe, Gott zu denken, führte folgerichtig zu dem Ergebnis,
daß
die
Gottheit
menschliches
Denken
transzendiert
(hyperekbaínei). - Zu dieser Vorstellung steht nicht im
Widerspruch, daß die Präsenz des Göttlichen (parousía), vor
allem seine Fürsorge für die Menschen (prónoia, providentia),
132
als durchaus real erlebt wurde. <Es galt als gesichert, daß
die Menschen seit frühester Zeit bestimmte Vorstellungen
(protai énnoiai) von den Göttern hegten. Ein legitimer Zugang,
vielleicht der einzige legitime Zugang, zum Wesen der Gottheit
schien mit der Frage gegeben zu sein, woher denn die frühesten
Menschen
diese
ihre
Vorstellungen
hatten.
es
wird
bezeichnenderweise nicht ein Begriff entwickelt, sondern es
wird nach der Uroffenbarung gefragt.>
Unter
Griechen
ist
nie
bestritten
worden,
daß
eine
Verwandtschaft zwischen Göttern und Menschen besteht. (locus
classicus sive canonicus: Arat. phaen. 5 = Act. 17, 28). Nach
stoischer Überzeugung hat diese Verwandtschaft ihren Grund
darin, daß allein Götter und Menschen (im Gegensatz zur
übrigen Schöpfung) ihre Handlungen dem Logos gemäß einrichten
oder
einrichten
sollten.
Trotz
dieser
auf
den
Logos
gegründeten Verwandtschaft (syngéneia) der Menschen mit den
Göttern ist es auch in der Stoa nicht zur Begründung einer
begrifflich-systematischen Theologie gekommen. Denn gerade die
Stoa konnte sich von ihrer auf Rationalität beruhenden
Grundkonzeption nicht lösen. Sie gelangte nicht etwa zu einer
die Welt transzendierenden Theologie, sondern sie bezog das,
was 'alle' von den Göttern wußten, in ihre Physik ein: Seit
jeher hat man Götter verehrt, weil diese nichts anderes sind
als die für den Menschen segensreichen Kräfte der Natur, diese
habe man mit Recht mit Namen benannt und darum zu Unrecht für
Personen
gehalten.
Damit
drang
die
Stoa
zu
einer
Begrifflichkeit der Götter und des Göttlichen vor, freilich
mit der Umkehrung, daß das Göttliche als Synonym zur Natur und
zu den in der Natur wirksamen Ursachen verstanden wurde.
Logos,
Natur,
Kausalnexus
und
Gott
sind
hiernach
gleichbedeutend. Man ist wohl nur hier, in der Physik der
Stoa, dazu gelangt, eine Begrifflichkeit des Göttlichen zu
statuieren. Das aber konnte nur geschehen auf der Grundlage
einer
kühnen
Umbenennung:
Die
Stoa
projizierte
ihre
physikalischen Grundvorstellungen mit entwaffnender Kühnheit
in die überkommene Religion hinein.
Epikur - Christentum
Es ist eine Streitfrage, die seit De Witt's Epikur-Büchern die
Forschung beschäftigt hat: das Problem etwaiger Affinität des
Christentums zum Epikureismus als einer Heilslehre.
Aus der Sicht der christlichen Antike selbst ist die Sache von
vornherein klar. Es haben nur ausnahmsweise weitherzige Männer
wie Clemens von Alexandrien positive Züge an Epikurs Lehre
erkennen können. Merkwürdig berührt, daß gegen ihn auch dann
noch polemisiert wird, als er schon zur Bedeutungslosigkeit
herabgesunken war. Ist das ein Indiz dafür, daß die
quasireligiösen Züge des Epikureismus bemerkt, aber verdrängt
133
wurden, weil im eigenen Verständnis von Religion kein Platz
dafür da war?
Aus der Sicht der heutigen Forschung ist eine mögliche Frage,
ob in Epikureismus und Christentum eine gewisse Verwandtschaft
festzustellen ist. Es geht darum, ob solche Analogien, wie die
des gemeinsamen Gedächtnismahls, der Gemeindebildung, der
Seelsorge,
der
beichte-ähnlichen
Aussprache,
der
seelsorglichen
Briefliteratur,
usw.
die
Annahme
einer
wirklichen Affinität der beiden Geistesmächte zueinander und
die Konstruktion einer spezifischen, vom Epikureismus zum
Christentum führenden Entwicklung rechtfertigen, wie das v.a.
De Witt angenommen hat.
Die Glückseligkeit der Götter - und der Menschen
Die Diskussion der Vertreter der hellenistischen Schulen kann
sich
auf
manches
Gemeinsame
beziehen,
das
sogar
die
fundamentalen inhaltlichen Positionen betrifft. Z.B. den
Grundbegriff der Glückseligkeit. Das ist eine Folge der
Übereinstimmung im praktischen Grundprinzip, das für den
weiteren Ausbau der Systeme bestimmend ist.
Die Philosophiehistoriker sind sich ziemlich einig in der
Beurteilung dieses praktischen Grundprinzips, wenn auch ihre
Urteile manchmal etwas zu pauschal ausfallen.
So urteilt etwa Pierre Aubenque131: "Die Philosophen der
hellenistischen Epoche, die weniger darum bemüht sind, das
Sein zu sagen, als die Menschen zu trösten und zu beruhigen,
erreichen nicht die theoretische Kraft des Platonismus oder
Aristotelismus."
Oder Bertrand Russell132: "der Sinn des Lebens war weniger,
etwas positiv Gutes zu leisten, als vielmehr, dem Unglück zu
entrinnen."
Und C.F.Angus133: "Die Metaphysik trat in den Hintergrund; die
Ethik, die nunmehr Angelegenheit des einzelnen wurde, spielte
die Hauptrolle. Die Philosophie war nicht länger die brennende
Fackel, die einigen wenigen furchtlosen Wahrheitssuchern
voranleuchtet; sie war eher ein Krankenwagen, der auf den
Spuren des Daseinskampfes hinterdreinfuhr und die Schwachen
und Verwundeten auflas."
Hirschberger134 wiederum meint: Die Philosophie nimmt sich im
Hellenismus des Menschen als solchen an, der in dieser durch
die Kriege Alexanders und der Diadochen so aufgewühlten und
unsicheren Zeit im inneren Menschen das Heil und das Glück
Pierre
Aubenque,
Die
hellenistischen
Philosophen:
Stoizismus,
Epikureismus, Skeptizismus. In: Geschichte der Philosophie. Ideen, Lehren.
Hrsg.v. Francois Chatelet. Ullstein.
132 Bertrand Russell, Philosophie des Abendslandes. Ihr Zusammmenhang mit
der politischen und sozialen Entwicklung. Europa Verlag, Zürich.
133 C.F.Angus, in: Cambridge Ancient History, Bd. VII S.231
134 J.Hirschberger, Geschichte d.Philosophie I, Freib.1953,215
131
134
sucht, das die äußeren Verhältnisse ihm nicht mehr geben
können, die zwar von stets neuer Größe träumen, dafür aber
immer mehr Ruinen schaffen. Darum überwiege in dieser Zeit die
Ethik. Sie habe zugleich auch noch die Aufgabe zu übernehmen,
die der alte religiöse Mythos einst erfüllt hatte. Der Mythos
zerbröckelt mehr und mehr und wird durch das rationale Denken
aufgelöst. Stoa und Epikureismus bieten eine neue Seelsorge an
und wirken dadurch auf weiteste Kreise, viel mehr als Akademie
und Peripatos es je vermochten.
Solche Urteile sind in fast allen Details anfechtbar, trotzdem
sind sie anregend. Man kann z.B. überlegen, wie ernst das
Zerbröckeln des Mythos zu nehmen sei, wenn dieser nach 2500
Jahren noch immer seine Wirkung tut. Oder, ob die angebliche
Ersetzung der Religion durch Ethik nicht eine Projektion eines
nachkantischen Denkers in die Zeit des Hellenismus sei. Ob
nicht die Periode des Hellenismus zu ausschließlich negativ
von der vorangegangenen Epoche her beurteilt werde. Wenn man
dagegen versucht, wertungsfrei den Unterschied zu beschreiben,
so wird man mit Malte Hossenfelder - in moderner Terminologie
sagen
können:
Die
auffälligste
Gemeinsamkeit
der
hellenistischen Schulen ist der Vorrang, den sie der
praktischen
gegenüber
der
theoretischen
Philosophie
135
einräumen.
Der Einfluß des praktischen Denkens reicht im Hellenismus sehr
weit. Er ist so ein herausragendes Paradigma für die
Diskussion über die Rolle praktischer Interessen in der
theoretischen Wissenschaft, wie sie im 20. Jahrhundert unter
dem Titel "Werturteilsstreit" ausgiebig geführt worden ist.
Das Problem hat zwei Aspekte: 1. einen normativen, unter dem
gefragt wird, welche Rolle Werturteile in der Wissenschaft
spielen sollen oder dürfen. 2. einen faktischen, sofern an
historischen Beispielen gezeigt wird, wie weit tatsächlich in
In Anlehnung an Kants Kritik der praktischen Vernunft (Akademie-Ausg. V
119 sqq.), wo er vom Primat der praktischen Vernunft spricht. Hier ist
eine inhaltliche Abhängigkeit der theoretischen Vernunft von der
praktischen gemeint. Wenn nämlich eine theoretisch unentscheidbare Annahme
so unzertrennlich mit einem praktischen Gesetz verknüpft ist, daß dessen
Befolgung von jener Annahme abhängt, dann sind wir nach Kant berechtigt,
die Wahrheit der Annahme zu setzen. So ist die Behauptung, die Seele des
Menschen sei unsterblich, mit theoretischen Mitteln nicht entscheidbar,
sie ist weder beweisbar noch widerlegbar. Die Unsterblichkeit der Seele
ist aber Voraussetzung der Realisierung des höchsten Gutes, die von einem
praktischen Gesetz geboten wird. Folglich dürfen wir die Unsterblichkeit
der Seele annehmen und verändern dadurch unser theoretisches Weltbild, zu
dem die Frage der Unsterblichkeit ja gehört, aus praktischen Prinzipien
inhaltlich. Denn nach den eigenen Regeln der theoretischen Vernunft müßten
wir sagen, daß sich über die Unsterblichkeit der Seele keine Aussage
machen läßt, im Interesse eines praktischen Grundsatzes aber sagen wir,
daß die Seele unsterblich ist.
135
135
konkreten Fällen die Absichten die Ansichten bestimmt haben.
Unter diesem zweiten Aspekt nun kommt dem Studium der
hellenistischen Philosophie insofern eine ausgezeichnete
Bedeutung zu, als sich in ihr eine Vorherrschaft des
Praktischen nachweisen läßt, die besonders radikal und
umfassend ist.
Der Primat der praktischen Vernunft kommt bereits in der
Definition der Philosophie in den einzelnen Schulen zum
Ausdruck:
- nach Epikur ist die Philosophie "eine Tätigkeit, die durch
Argumentation und Diskussion das glückselige Leben verschafft
(Us. fr. 219).
- Die Stoiker eklären, "die Weisheit sei ein Wissen von
göttlichen und menschlichen Dingen, die Philosophie die Übung
einer nutzbringenden Kunst, nutzbringend aber sei allein und
zuoberst die Tugend," d.h. die Philosophie als "Streben nach
Weisheit" dient der Tugend (SVF II 35. 36).
- Analog wird schließlich auch die Skepsis definiert als
"Kunst, auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte
Dinge einander entgegenzusetzen, von der aus wir wegen der
Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Sachen und Argumente
zuerst zur Zurückhaltung, danach zur Seelenruhe gelangen"
(Sextus P H, I 8).
Aus allen drei Definitionen geht hervor, daß das theoretische
Bemühen seinen Sinn nicht in sich selbst hat, sondern einen
praktischen Zweck verfolgt.
Das gleiche ergibt sich aus der Bewertung der einzelnen
philosophischen Disziplinen. Physik und Logik werden um der
Ethik willen betrieben. Chrysipp sagt es ausdrücklich: "Die
Physik ist zu keinem anderen Zweck heranzuziehen als zur
Auseinandersetzung
über
Gut
und
Übel",
denn
"an
die
Untersuchung von Gut und Übel, an die Tugenden und an die
Glückseligkeit kann man nicht anders und nicht angemessener
herangehen, als von der allgemeinen Natur und von der
Einrichtung der Welt aus." (SVF III 68).
Es wird hier fraglos vorausgesetzt, daß aus einem Sein ein
Sollen, aus deskriptiven Sätzen präskriptive abgeleitet werden
können. Dieser sogenannte "ethische Naturalismus" beherrschte
die gesamte Antike. Man glaubte eben ganz naiv, daß sich aus
der Erkenntnis der wahren Natur der Dinge und des Menschen
auch die wahren Werte ergeben müßten. Der Naturalismus ist
jedoch keineswegs auf die Antike beschränkt, sondern bleibt
eine weit verbreitete Auffassung. Er findet sich bei Descartes
und
im
Utilitarismus
ebenso
wie
heute,
v.a.
bei
Verhaltensforschern, die offenbar der Überzeugung sind, man
könne aus der Beobachtung der Graugänse moralische Einsichten
gewinnen.
136
(Das ist ein scheinbarer Primat der theoretischen Vernunft.
Man will argumentieren können: weil die Dinge so und so
beschaffen sind, müssen wir uns so und so verhalten. Das kann
aber nur als Rechtfertigung gelten, wenn es so scheint, als ob
die theoretische Beschreibung der Dinge unabhängig und rein
nach theoretischen Prinzipien gewonnen wurde, so daß die
praktischen Grundsätze von den theoretischen abhängig sind. In
Wirklichkweit entscheidet über die Annahme einer Theorie ihre
Tauglichkeit für die Rechtfertigung praktischer Überzeugungen.
Welches Weltbild man anerkennt, hängt also davon ab, an welche
praktischen Ziele man glaubt. Das ist eine durchaus vertraute
Erscheinung, daß z.B. wissenschaftliche Enqueten je nach den
Interessen (z.B. wirtschaftlichen oder politischen) des
Auftraggebers zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ein
solches Verfahren ist nach den Regeln der Logik natürlich
unzulässig, aber der Fehler beibt verborgen, weil eine
Täuschung vorliegt. Der Primat der praktischen Vernunft tritt
hier nicht als solcher auf, sondern im Gewand des Primats der
theoretischen Vernunft.)
Der Grundbegriff, von dem die Hellenisten ausgehen, ist wie
gesagt die Eudämonie, eudaimonía, die wir üblicherweise mit
"Glückseligkeit" übersetzen. Sie bildet das telos, d.h. den
höchsten Zweck oder das größte Gut, dem alle anderen Güter
untergeordnet sind. In diesem Punkt unterscheiden sich die
Hellenisten nicht von ihren Vorgängern oder Nachfolgern,
vielmehr ist der Eudämonismus in der ganzen Antike so
selbstverständlich, daß er häufig nicht mehr ausdrücklich
gemacht, sondern stillschweigend vorausgesetzt wird.
Etymologisch bedeutet eudaimonía "einen guten Dämon haben",
"unter einem guten Stern stehen", daß es einem gut geht, daß
"das Leben gelingt". Das muß man noch spezifizieren: Im
Hellenismus wurde negativ spezifiziert: das Glück wird gesehen
in der Freiheit von innerer Erregung. Pyrrhoneer und Epikureer
bezeichnen diesen Zustand als Ataraxie, die Stoiker nennen ihn
Apathie, gemeint ist aber in beiden Fällen letztlich daselbe,
nämlich Abwesenheit von Affekten wie Furcht, Trauer, Begierde
u.ä., d.h. von Zuständen seelischer Spannung und Erregung. Die
entsprechende positive Charakterisierung wird vorwiegend
metaphorisch versucht, und zwar mit Hilfe der Zustände des
Wassers. Für die Epikureer und die Pyrrhoneer besteht die
Eudämonie in der völligen "Meeresstille" (galéne) des Gemüts,
während die Stoiker sie definieren als "Wohlfluß des Lebens"
(eúroia bíou). Auch hier liegt im wesentlichen dieselbe
Vorstellung zugrunde, wenn man der Metapher nachgeht und
fragt, wann ein Fluß "wohl fließt", - er tut es dann, wenn er
ungehindert dahinströmt, ohne daß sich Strudel und Wellen
bilden, so daß auch hier das tertium comparationis, wie bei
der Meeresstille, die glatte und sanfte Obrfläche ist. Sie
137
wird zur Metapher für das, was die Glückseligkeit positiv ist:
die vollkommene Ruhe und Ausgeglichenheit des Gemüts, der
innere Frieden.
Für den Charakter der verschiedenen philosophischen Systeme
ist es dann wichtig, worin die Gefahren für die innere Ruhe
bzw die Ursachen der Erregung zu sehen sind. Aus ihnen ergeben
sich die Mittel und Wege, die zur Erreichung und Sicherung der
Eudämonie empfohlen werden.
Die hellenistischen Schulen sind einhellig der Überzeugung,
daß der innere Frieden dann bedroht ist, wenn man sein Herz an
Unverfügbares hängt, d.h. wenn man Bedürfnisse ausbildet, die
man nicht selbst aus eigener Kraft und jederzeit befriedigen
kann. Man darf also nur das begehren, von dem man sicher sein
kann, daß man es auch erreicht, weil es von einem selbst
abhängt, allem übrigen gegenüber muß man sich gleichgültig
verhalten. Tut man das nicht, so ist das Glück dahin, weil der
tatsächliche oder bloß mögliche Mißerfolg eine Fülle von
Affekten erzeugt, die den Seelenfrieden zerstören. So
beunruhigt z.B. das Streben nach Besitz nicht nur, solange es
tatsächlich erfolglos bleibt, sondern auch der Besitzende wird
gepeinigt von der Furcht vor dem möglichen Verlust, eben weil
Besitz etwas ist, das man gegen seinen Willen einbüßen kann.
Das praktische Grundprinzip ist also, nur solche Bedürfnisse
anzuerkennen, deren Befriedigung ganz in der eigenen Macht
steht. Für die Interpretation der Welt ergibt sich daraus die
Aufgabe, sie so zu erklären, daß allein das als wahrer Wert
erscheint, was jederzeit verfügbar ist, alles Unverfügbare
aber sich als wertfrei, als gleichgültig herausstellt.
(Total anders ist die Glückslehre des Christentums: Kein Auge
hat es geschaut und kein Ohr hat es gehört, was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben. Allerdings wurde die antike
Apathie-Lehre auch von Kirchenvätern übernommen, die dann das
Problem hatten, daß in der Bibel dem lieben Gott so manche
Affekte nachgesagt werden, von Zorn bis Erbarmen.)
Die Unterschiede der Schulen ergeben sich nur aus der
unterschiedlichen Konsequenz und Radikalität, mit der dieses
Programm verfolgt wird. Die Richtung ist die gleiche. Übrigens
die entgegengesetzte gegenüber der neuzeitlichen Tendenz. Denn
wo immer Bedürfnisbefriedigung ein Ziel des Handelns ist, gibt
es zwei Wege, dieses Ziel zu erreichen: Man kann versuchen,
entweder möglichst viel Befriedigung, oder möglichst wenig
Bedürfnisse zu haben. Die Neuzeit hat den ersteren Weg
beschritten, über die Beherrschung der Außenwelt, der
Hellenismus den zweiten, über die Beherrschung der Innenwelt.
Und da sich heute gegen die Richtigkeit des ersten Bedenken
erheben und viele in ihm eine Widersprüchlichkeit erkennen,
weil die technische Unterwerfung der Natur einerseits die
Möglichkeit einer höheren Lebensqualität eröffne, die sie
andererseits wieder zerstöre, kommt der antiken Glückslehre
138
neue Aktualität zu. Sie ist auf dem negativen Weg schon sehr
weit vorgedrungen, so daß eine Beschäftigung mit ihr dazu
beitragen
könnte,
die
Vorteile
und
Nachteile
besser
abzuschätzen und vielleicht den einen oder anderen Umweg, als
heute erledigt, einzusparen.
Zum Verständnis der hellenistischen Eudämonielehre müßte man
bei den klassischen Philosophen anknüpfen: Platon hat am Ende
des ersten Buchs der Politeia Sokrates fragen lassen, was das
Gerechte ist, ob es eine Tugend ist und ob der, dem sie
innewohnt, glücklich ist. Gerechtigkeit als Grundfrage der
Politik ist Leitmotiv der Politeia, und es ist typisch für
Sokrates, daß er Glück und Tugend im Zusammenhang sieht; auch,
daß er Tugend für lehrbar hält, so daß es einen Bildungsweg
zum Glück gibt. Komplizierter wird es dadurch, daß Platon
Staats-,
Individualund
Völkerpsychologie
und
-ethik
miteinander in Verbindung setzt. So wie der Staat wird auch
die Seele als dreigeteilt vorgestellt (Vernunft - logistikón /
philomathés / philósophon; das Begehrliche - tò epithymetikón;
dazwischen das Mutartige - tò thymoeidés); hinter den
ethischen Intellektualismus des frühen Plato wird also vom
späteren ein Fragezeichen gesetzt.
Die Verknüpfung von Glück und Ethik, von Ethik für den
einzelnen und Staatsethik sind also schon platonisch. Es ist
zu vermuten, daß es ein breit diskutierter Themenkomplex ist,
der nicht nur im Hauptwerk Platons eine bedeutende Rolle
spielte, sondern auch im Lehrbetrieb der Akademie. Die
folgende Argumentation kann man sich sehr gut als schon
akademische vorstellen:
Das worauf es eigentlich ankommt, was allem Denken und Tun
letztlich Sinn verleiht, kann nicht das Glück des Staates oder
der Gemeinschaft, sondern nur das Glück des einzelnen sein.
Denn so, wie man sich keinen Staat und keine Gemeinschaft ohne
Individuen, wohl aber Individuen ohne Staat oder Gemeinschaft
denken kann, ebenso absurd ist es, von einem glücklichen Staat
oder einer glücklichen Gemeinschaft zu sprechen, wenn ihre
Mitglieder unglücklich sind, wohl aber läßt sich umgekehrt
vorstellen, daß in einem glücklosen Staat oder einer
glücklosen Gemeinschaft glückliche Individuen leben. Folglich
wird man den Sinn jeder Gemeinschaft im Individuum sehen
müssen, zu dessen Glück sie Mittel ist. Das wäre eine
Antithese zu Aristoteles' These, der Mensch sei zoon politikón
und könne nur als solches glücklich werden.
Um die Aktualität solcher Gedanken zu erfassen, braucht man
nur die Reden Vaclav Havels lesen136
Die Ethik des Aristoteles ist als ganze eine Theorie des
Václav Havel, Angst vor der Freiheit.
Staatspräsidenten. Reinbek bei Hamburg 1991.
136
Reden
des
139
Glücks, für welche das Glück nicht nur faktisch letztes Ziel
menschlichen Strebens, sondern auch Richtschnur praktischer
Orientierung und kritischer Beurteilung des Handelns ist. In
der Frage, ob Ethik mit Glück zu tun habe, ist Aristoteles der
Gegenpol zu Kant. Kant hat den Glücksgedanken aus der Ethik
verwiesen. Zur Beantwortung der Frage, "Was soll ich tun?"
(KrV, B 833) trägt die Orientierung am Glück nichts bei. Ja,
sie wird von Kant zum "geraden Widerspiel" der Sittlichkeit
erklärt (KpV, A 61).
Nicht nur ist der Glücksbegriff als Handlungsbegriff zu
unbestimmt (GMS, B 46f.); würde das Glück, als letzter
Gegenstand des Wollens, zu dessen Bestimmungsgrund, so würde
dies zudem die menschliche Autonomie aufheben und Moralität
verunmöglichen (KpV, A 59; vgl. KU,
83). Nur durch seine
Form, nicht durch seinen Gegenstand soll der gute Wille
bestimmt sein. Unbestimmtheit und Heteronomie machen die
Orientierung am Glück für die Bestimmung sittlichen Handelns
unnütz, ja unzulässig.
Man hat diesen Gegensatz als Gegensatz von Sollens- und
Wollensethik, Pflicht- und Glücksethik, oder auch von
deontologischer
und
teleologischer
Ethik
beschrieben.
(Dahinter liegt ein tiefgreifender historischer Wandel. Kants
Theorie
artikuliert
sowohl
einen
verschärften
Begründungsanspruch wie einen der Antike unbekannten Begriff
von Subjektivität. Daß dieser Schritt für eine neuzeitliche
Reflexion - so auch für jede Erneuerung der Glücksethik nicht rückgängig zu machen ist, bedeutet allerdings nicht
schon die Unangreifbarkeit der Kantischen Eudämonismuskritik.
Bei Aristoteles ist nun ein Anknüpfungspunkt die Frage, in
welchem Sinn das Glück überhaupt Gegenstand des Wollens sein
kann. Die Sprache markiert hier einen deutlichen Unterschied.
Ich wünsche, glücklich zu sein; "mich aber dafür entscheiden,
glücklich zu sein, das geht nicht an" (EN 1111 b 28). Denn, so
Aristoteles' Argument, Glück steht nicht in meiner Macht.
Auch wenn wir die Zweideutigkeit des Wortes "Glück" durch die
Unterscheidung von fortuna und beatitudo, eutychía und
eudaimonía, oder von Glück-Haben und Glücklich-Sein beheben,
so bleibt auch die eudaimonia ganz offensichtlich mit einem
Moment von Unverfügbarkeit behaftet.
In welchem Sinn ist dann aber Glück überhaupt Gegenstand
unseres
Wollens?
Nach
Aristoteles
ist
es
als
das
schlechthinnige Endziel allen Tuns und Könnens definiert, d.h.
als jenes Ziel, das schlechthin nur um seiner selbst willen
angestrebt wird und für das es keinen anderen möglichen Zweck
gibt. (EN I. 5). Daß es ein solches Letztes geben muß, gründet
anch ihm in der Unmöglichkeit des unendlichen Regresses: Würde
alles wieder um eines anderen willen getan, so würde sich die
Richtung des Wollens selber verlieren und alles wäre Mittel,
140
nichts mehr Zweck (Met. II. 2).
In der Beschreibung dieses letzten Ziels schwankt Aristoteles
zwischen zwei Modellen: dem Modell des in einer Hierarchie von
Zweck-Mittel-Verknüpfungen letzten Ziels - das höchste Gut als
Gegenstand der Politik, die an der Spitze der Künste und
Wissenschaften steht - und dem Modell des umfassenden, andere
Zwecke einbegreifenden Ziels - wonach das einzelne um seiner
selbst
willen
Erstrebte
eine
besondere
Art
ist,
das
Allgemeine, das Glück zu realisieren.
Als letztmöglicher Zweck ist Glück leichter beschreibbar.
Glück ist dann jene letzte Antwort auf die Frage nach unserem
Wollen, wo das Was und Warum zusammenfallen, oder anders
gesagt: jene Antwort, die keiner weiteren Begründung fähig
noch bedürftig ist. Es markiert die Nichtwiederholbarkeit der
Wozu-Frage. Wer fragt, warum wir glücklich sein wollen, hat
das Wort "Glück" nicht verstanden. Dieser begründungslogischformalen und negativen Bestimmung entspricht positiv etwa die
Umschreibung, daß Glück dasjenige sei, was wir "eigentlich",
letzten Endes und im Ganzen wollen.
R.Spaemann137 sieht im ursprünglichen Glücksbegriff zwei
Schwerpunkte, die später auseinandertreten und zum Teil
gegeneinander artikuliert werden: Autarkie und Erfüllung. Das
erste Moment betont die Seite der Selbstbehauptung und
Selbständigkeit und ist z.T. ausdrücklich gegen Erfüllung
gewendet: Unabhängigkeit gründet dann in Erfüllungs-, ja
Wollensverzicht. So wird die Beständigkeit des Glücks gegen
die
Instabilität
äußerer
Glücksgüter
gesichert.
Die
Minimalisierung
der
Erwartungen,
die
Bedürfnislosigkeit
erscheint als Schutz des Weisen gegen das Unglück, als Basis
seines Glücks. Fraglos kann eine solche "asketische" Haltung
ernstzunehmende Aspekte von Glückserfahrung enthalten; die
stoische Apathie oder epikureische Ataraxie sind Varianten
ihrer Ausformulierung. Dennoch scheint sie als ganze mit dem,
was wir spontanerweise Glück nennen, nur in paradoxer Weise
vereinbar.
(Diesem gleichsam defensiven läßt sich ein positiver Begriff
von Autarkie gegenüberstellen, der auf Freiheit, d.h. - so
Aristoteles Met. 982 b 26 - auf das "um seiner selbst und
nicht um eines andern willen" Leben abzielt, oder der dann im
modernen Sinn mit einem emphatischen Begriff von Selbstsein
oder ausgebildeter Individualität verknüpft wird.)
Das Komplementärmoment zur Autarkie, die Erfüllung, ist im
Glücksbegriff
vielleicht
noch
ursprünglicher
verankert.
"Plerosis" ist schon bei Platon Stichwort - Fülle als
Gegensatz zum Mangel und Behebung einer Leere, zuallererst als
R.Spaemann, Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben,
in: G.Bien, Hg., Die Frage nach dem Glück, 1978, S.15.
137
141
Realisierung von Intentionen, Wünschen und Absichten. Daneben
meint die Metapher der Fülle Überfluß. Sie kann zum Gegenpol
jenes Selbstbezugs werden, für den der Titel Autarkie steht bis zum Aufgehen-im-anderen, zur Selbstvergessenheit, ja
Selbstauslöschung. Auch dies sind bekanntlich Bilder vom
Glück.
Das Alleswerden, das zugleich Selbstauslöschung ist, ist das
Gegenbild
zur
Selbstbehauptung
ohne
Erfüllung.
Der
hellenistische Erfüllungsverzicht scheint wohl mit Freiheit,
doch
nur
paradoxerweise
mit
Glück
vereinbar;
beim
Selbstverzicht, etwa im Neuplatonismus, verhält es sich
umgekehrt: er scheint wohl mit Glück, aber nur paradoxerweise
mit Freiheit vereinbar.
Wir müssen nun ausdrücklich die Frage stellen, was denn diese
ganze Eudämonie-Problematik mit Religionsphilosophie zu tun
hat.
Sie hat mit der Wirklichkeit des Menschen zu tun, mit seiner
Selbstverwirklichung, mit seiner letzten Zielsetzung und den
Fragen um Willensfreiheit und Autarkie. Um den Sinn des
Lebens. O.Marquard hat das Aufkommen der sogenannten Sinnfrage
geradezu
als
Pseudonymisierung
der
Glücksthematik
bezeichnet.138
Der Sinnbegriff entspricht der Struktur des Selbstzwecks: Wenn
die Sinnfrage die ist, die nach Camus letztlich lautet, ob es
sich lohnt oder nicht, zu leben, so entspricht dies der Frage
nach dem Selbstzweck des Lebens.
Welcher Begriff in der christlichen Theologie entspricht am
ehesten dem philosophischen Glücksbegriff? - Das "Heil"? Der
"Segen"
Gottes?
Die
"Erlösung"?
Wer
diese
Begriffe
reflektiert, wird unweigerlich mit den gleichen Fragen nach
der Verwirklichung des Menschseins, nach Freiheit, Autarkie
des Individuums konfrontiert.
Es verdient Beachtung, daß sowohl der erste Psalm der Bibel
mit "Glücklich" beginnt als auch die sog. Seligpreisungen der
Bergpredigt mit dem normalen Wort "Glücklich" zu übersetzen
sind. Es handelt sich um eine provokante Glückslehre.
Es braucht uns daher nicht zu verwundern, daß die frühen
christlichen Theologen, denen die antike Bildung noch voll zur
Verfügung
stand,
höchst
sensibilisiert
waren
für
die
Behandlung der Glücksthematik in der heidnischen Philosophie.
Wenn Epikur bzw. die Dialogpartner in Ciceros Buch De natura
deorum über das Glück der Götter und Menschen sprechen, so tun
sie
das
in
einem
allgemeinen
Kontext,
den
ich
im
Vorangegangenen zu entfalten versucht habe. Sie tun es aber
auch
in
einem
ganz
speziellen
religionsphilosophischen
Kontext, den ich noch ansprechen muß:
O.Marquard, Wider die allzulaute Klage vom Sinnverlust. Philosophische
Bemerkungen und eine Fürsprache fürs Unsensationelle, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 31.Okt.1983, 9f.
138
142
Aristoteles bestimmt in seiner Nikomachischen Ethik - wie
schon vorher Platon (Symp. 205 a) - das Glück als Besitz des
Gutes, das um seiner selbst, nicht um eines anderen willen
erstrebt wird, ein Gut, das mithin Ziel und Sinnerfüllung des
menschlichen Lebens ist, nicht vorübergehend und flüchtig,
sondern beständig und bleibend. So gesehen ist das Glück der
primäre Beweggrund allen menschlichen Handelns. Glück besitzt
der Mensch in dem Maß, als sich sein eigentliches Selbst, d.h.
die ihm eigene Geistnatur verwirklicht. Dies geschieht in den
praktischen und - vor allem - kontemplativen Tugenden. Somit
gilt: "Wer hindert uns, glücklich denjenigen zu nennen, der
gemäß vollendeter Tugend wirkt und über die äußeren Güter in
ausreichender Weise verfügt, nicht eine flüchtige Zeit,
sondern ein ganzes Leben" (1101 a).
Aristoteles betont ausdrücklich, "daß, wenn irgend etwas ein
Geschenk
der
Götter
an
die
Menschen
ist,
dann
die
Glückseligkeit..., und zwar umso mehr, als sie von den
menschlichen Gütern das beste ist" (1099 b). Aber er
beschränkt sich doch ausdrücklich auf das unvollkommene, durch
menschliche Praxis erreichbare Glück (1097 a), das den
Menschen "als Menschen" glücklich macht (ebd.; 1102 a). Die
"theologische"
Dimension
des
Glücks
wird
mithin
bei
Aristoteles nicht geleugnet, die Untersuchung aber außerhalb
dieser Fragestellung angesiedelt.
Das damit gegebene Problem der Ausklammerung spitzt sich
freilich
v.a.
hinsichtlich
des
Glücks
kontemplativphilosophischen Lebens (im Gegenüber zum Glück des praktischbürgerlichen Lebens) zu: Das Glück der theoría verhält sich
für Aristoteles zum Glück der sittlichen Praxis wie eine
göttliche zu einer bloß menschlichen Möglichkeit (1177 b).
Erst in der Betrachtung des Göttlichen findet der Mensch sein
volles Glück/Heil und nimmt, soweit es ihm möglich ist, am
spezifisch Göttlichen, an der Unsterblichkeit teil. Jedoch:
Wenn dies das Endziel des Menschen ist (1176), so stellt sich
das Problem, ob und wie weit er es in diesem Leben erlangen
und folglich ganz glücklich werden kann. Diese Frage findet
bei Aristoteles keine letzte Antwort mehr. Darauf wird später
Thomas von Aquin ausdrücklich hinweisen.139
Thomas
v.Aquin,
Summe
gegen
die
Heiden,
Buch
III,
Kap.48
(hrsg.u.übers.v.Karl Allgaier. Lat.Text besorgt u.mit Anm.vers.v.Leo
Gerken. Darmstadt 1990. Bd.3,1, S.193):
"Wenn also die letzte menschliche Glückseligkeit, wie oben dargelegt wurde
(III 38ff.), nicht in einer Gotteserkenntnis besteht, durch welche Gott
gemeinsam von allen oder mehreren gemäß einer unsicheren Meinung erkannt
wird; noch weiterhin in einer Gotteserkenntnis, durch welche er auf dem
Wege eines Beweisverfahrens in den betrachtenden Wissenschaften erkannt
wird; auch nicht in einer Gotteserkenntnis, in welcher er durch den
Glauben erkannt wird, - es ist aber nicht möglich, in diesem Leben zu
einer höheren Erkenntnis zu gelangen, so daß er in seiner Wesenheit
erkannt werde, oder auch nur so, daß man andere getrennte Substanzen
139
143
Von diesem offenen Problem her gesehen findet sich nun aber
bei Aristoteles - trotz sachlicher Identität von Glück und
Heil - doch ein Differenzierungs-Ansatz, nämlich zwischen
irdisch-realisierbarem unvollkommenem "Glück" und göttlichgeschenktem vollkommenem "Heil". Des letzteren kann die
(praktische) Philosophie zwar noch ansichtig werden, aber zu
finden ist es allein im Bereich des Religiösen. (Das ist auch
der Grund, weshalb der griechische Begriff der sotería in
besonderer Weise im religiösen Kult zu Hause ist: nur die
"Götter" können vom Tod erretten - wie auch von den Launen
unberechenbaren Geschicks.)
Das
kontemplative
Ideal
des
Aristoteles
ist
mit
der
Vorstellung verbunden, daß der Geist etwas Göttliches sei
(1177 a 15-16; 177 b 28 u.ö.) und sich der Mensch im Umgang
mit
dem
Göttlichen
"seiner
eigenen
Unsterblichkeit
vergewissert". Sofern der Geist als göttlich angesehen wird,
scheint das Leben gemäß dem Geiste die eigentlich menschlichen
Möglichkeiten zu überschreiten (1177 b 26-31). Ja, man ist
geneigt zu sagen, daß der "Mensch so nicht leben kann,
insofern er Mensch ist, sondern nur, insofern er etwas
Göttliches in sich hat" (1177 b 28-29). Anderseits gilt jedoch
auch, daß der Mensch vor allen Lebewesen dadurch ausgezeichnet
ist, daß er über Geist verfügt: Geist ist ihm eigentümlich
(oikeîon 1178 a 5-6); der Mensch ist - was auch immer er sonst
noch sein mag - vor allem Geist (1178 a 7). Ja, es liegt sogar
nahe, vom Geist als dem eigentlichen Selbst des Menschen zu
sprechen (1178 a 2).
Analoge Vorstellungen finden sich im Spätwerk Platons.
Namentlich der Timaios ist aufschlußreich. Die Vorstellung,
daß der Intellekt das wahre Selbst des Menschen sei, findet
sich auch im Alcibiades maior, und zwar im Zusammenhang der
Frage nach der Referenz des Ausdrucks "(wir) selbst" (130 a 10
sqq., bes. 133 b 5-7).
Bei Plato ist wichtigstes Lehrstück und wichtigster Gegenstand
philosophischer Erfahrung die Idee des Guten (510 b), die den
Gegenständen
der
Erkenntnis
Wahrheit
und
Erkennbarkeit
verleiht (508 e - 509 b); die dem erkennenden Subjekt die
Möglichkeit der Erkennntis dieser Gegenstände gewährt (508 e);
die den Gegenständen der Erkenntnis Sein (tò eînai) und
Seiendheit (ousía) verleiht (509 b); und die selbst nicht mit
Seiendheit identisch ist, sondern an Würde und Bedeutung noch
über Seiendheit hinausragt (509 b). Zum Begrifflichen kommt
erkenne, so daß aus diesen Gott wie aus größerer Nähe erkannt werden
könnte, wie bereits dargelegt wurde (III 45), doch muß in irgendeiner
Gotteserkenntnis die letzte Glückseligkeit bestehen, wie vorhin erwiesen
wurde (III 37)-: dann ist es unmöglich, daß in diesem Leben die äußerste
Glückseligkeit des Menschen sei."
144
aber hier offensichtlich eine emotionale Erfahrung: In der
Lichtmetaphorik des Sonnengleichnisses erscheint die Idee des
Guten als das "Glänzendste" (518 b); es handelt sich um eine
Sache von "unvorstellbarer Schönheit" (509 a). Weitere
Hinweise auf den Bereich unvorstellbarer Schönheit gibt die
mythische Beschreibung des locus intelligibilis im Phaidros:
der "überhimmlische Ort" birgt "farblose, formlose und
stofflose Wesenheit, die wirklich ist" (247 d); hier gibt es
herrlich anzusehende Schönheit" (250 b 5-6), die aus "jenem"
(i.e.
den
anderen
Ideen)
als
wirkliche
Schönheit
hervorleuchtet" (250 c 8 - d 1). Entsprechend kennen die
erotischen Mysterien, von denen Diotima im "Gastmahl" zu
berichten weiß (210 e 4-5), "das Schöne selbst", das "lauter,
rein und unvermischt anzusehen ist" (211 e 1) und als
"göttliches Schönes" gilt (211 e 3).
Die Freude, die mit der Betrachtung des Seienden verbunden
ist, kann freilich nur der Philosoph kosten (582 c 7-9). Das
philosophische Leben erfüllt sich im Umgang mit den reinen
Urgestalten, den Ideen. Und so wie Platon diese Urgestalten
als göttlich bezeichnete, so betrachtete er die Abwendung der
Seele vom abbildhaften Bereich des Leiblichen und die
Hinwendung zum Bereich der urbildhaften Ideen sogar als
Versuch einer "Angleichung an Gott" (Theaet 176 b 1: homoíosis
theô).
Obschon dies für die spätere Tradition wichtige Motiv der
Angleichung an Gott bei Platon unterschiedliche Ausprägungen
findet140, scheint der religiöse Kern dieser Vorstellung an die
Gewißheit gebunden, daß der Bereich der Ideen zugleich die
Heimat der unsterblichen Seele ist und daß sich diese als
"innerer Mensch" begriffene Seele im Jenseits für alle die in
dieser Welt begangenen Handlungen verantworten muß.
Freilich lassen sich die eigentlich religiösen Momente nur
schwer dechiffrieren. Sooft in den platonischen Schriften auch
von Gott, Göttern und Göttlichem die Rede ist, so wenig füllen
sich die Worte mit konkretem Gehalt. Sicher kannte Plato
keinen persönlichen Gott. Auch läßt die Ideenphilosophie einer
wie immer gearteten Gottes-Vorstellung keinen eigentlichen
Raum. Und so gewinnt man am Ende den Eindruck, daß es sich bei
den platonischen Reden über Götter und Göttliches um eine der
dichterischen Sprache angeglichene Ausdrucksweise handelt:
Zwar rekurriert der Schriftsteller Plato auf wohlbekannte
Vorstellungen; doch meint der Philosoph de facto anderes. Denn
Gegenstand seiner Religiosität waren die unvergänglichen
Ideen.
60 - 124: Kritik der epikureischen Theologie
140
cf. Tim.90 a; Phaedo 82 a; Respubl.500 c; 613 a; Phaedr.248 a.
145
Die Kritik der epikureischen Theologie in I 60-124, die über
die kurze Darstellung durch Velleius hinausgeht, führt in
ihren grundsätzlichen Aussagen bis auf Karneades zurück;
Parallelen dazu aus Karneades bringt Sextus Empiricus Adv.
math. IX, und Cicero selbst weist im Vorwort I 4 ausdrücklich
auf Karneades hin. Offen bleibt, ob wir den Vermittler der
Karneadischen Kritik in Kleitomachos (so Praechter I 473) oder
in Ciceros Lehrer Philon (so Philippson) zu suchen haben. Als
Quelle für den Schluß der Kritik (123-124) wird von Cicero
selber Poseidonios (Perì theôn, Buch V) genannt, wobei
ebenfalls
offen
bleibt,
ob
er
das
Zitat
unmittelbar
Poseidonios oder einem jüngeren Stoiker entnahm.
4.2.3 Darstellung der stoischen Theologie durch Balbus
(Zweites Buch)
1-3
4-12
Einleitung und Disposition
Die Existenz der Götter; Beweise aus der
römischen
Geschichte,
den
Auspizien
und
Haruspizien
13-38
Die Göttlichkeit des Kosmos
39-58
Die Göttlichkeit der Gestirne
59-72
Das Wesen der einzelnen Götter
73-153
Beweisführung für die Leitung des Kosmos durch
die Götter
73-80
Erster Beweis: Die leitende Vorsehung der Götter
81-90
Zweiter Beweis: Alles ist von einem beseelten
Anfang gezeugt
91-153 Dritter Beweis: Die wunderbare Einrichtung der
himmlischen und irdischen Dinge
91-101
Die Erde
102-117 Der Himmel
118-119 Die Gestirne
120-133 Pflanzen und Tiere
134-146 Der menschliche Körper
147-153 Sinne und Vernunft
154-167 Die göttliche Fürsorge für den Menschen
154-161 Die Welt ist der Götter und Menschen wegen
geschaffen
162-167 Die Götter sorgen für das Menschengeschlecht im
ganzen wie im einzelnen
168
Schlußwort
Nach Usener (Epic. LXVII f.) wurde von Cicero für das zweite
Buch neben Poseidonios' Schrift Perì theôn ein Handbuch des
Karneades benutzt. Der einheitliche Charakter der Darstellung
gerade der stoischen Theologie legt jedoch die Annahme einer
einzigen Vorlage nahe, bei der sich Wendland (Posidonius' Werk
146
Perì theon, Arch.f.Gesch.d.Philos. I <1888>, 200-210) für
Poseidonios und Pohlenz (Gött.gel.Anz. 1922, 168) für
Panaitios entschied. Philippson (RE VII A 1, 1154-55) vertritt
ebenfalls die Entscheidung für eine einzige Vorlage, sobald
der in II 115 neu eingeführte Begriff der stabilitas der von
II 91 an für den Beweis der göttlichen Weltregierung
charakteristischen admirabilitas untergeordnet (vgl. dazu II
121.124-125.139.141.146) und kein neuer Beweisgrund sein soll.
Daß in II 85 und 118 die Entscheidung darüber, ob die
stabilitas mundi wirklich sempiterna ist (Panaitios) oder nur
perdiuturna sein kann (Altstoa und Poseidonios in Hinblick auf
die
ekpyrosis)
offenbleibt,
weist
auf
eine
Kompromißbereitschaft des Verfassers hin, der bei einem
Vergleich der ganzen Rede mit Paralleldarstellungen (Sextus,
Diogenes Laertius, Aetios, Theon und Areios Didymos) ein
stoisches Handbuch benutzt zu haben scheint. Die Abfassung der
Quelle nach Panaitios und die Annahme, daß auch Gedankengut
des Poseidonios verarbeitet wurde, legt nach Philippson die
Annahme nahe, daß der Verfasser ein Zeitgenosse Ciceros war.
Wir beschränken uns im Folgenden auf einige Aspekte:
Existenz Gottes
Die Systematik der stoischen Theorie wird von Balbus bereits
im Vorgespräch (II 3) angegeben:
"Im allgemeinen teilen die Vertreter unserer Lehre diese ganze
Untersuchung über die unsterblichen Götter in vier Teile.
Zuerst beweisen sie die Existenz der Götter, dann ihre
Eigenschaften, drittens daß die Welt von ihnen geleitet wird,
und schließlich, daß sie sich der menschlichen Angelegenheiten
annehmen. In unserem Gespräch hier will ich aber nur die
beiden ersten Punkte behandeln; der dritte und vierte dagegen
sollte meiner Meinung nach auf einen anderen Zeitpunkt
verschoben werden, weil sie zu umfangreich sind."
(Primum docent esse deos, deinde quales sint, tum mundum ab
his administrari, postremo consulere eos rebus humanis.)
Nach den Beweisen aus der römischen Geschichte kommt in II
12f. die wichtige Aussage:
"Daher steht bei allen Menschen auf der ganzen Welt die
Hauptsache fest; allen ist ja angeboren und gleichsam in die
Seele gemeißelt: es gibt Götter. Über ihr Wesen gehen die
Meinungen auseinander; ihre Existenz wird von niemandem
geleugnet. Unser Kleanthes behauptet nun, es seien vier
Gründe, aus denen sich die Vorstellungen <von der Existenz>
der Götter in der menschlichen Seele gebildet haben. Als
ersten nennt er den, den ich eben dargestellt habe und den er
aus der Vorahnung der kommenden Dinge erstanden wissen will;
der zweite Grund liegt nach ihm in der Größe der Vorteile, die
147
aus der zweckmäßigen Beschaffenheit des Klimas, aus der
Fruchtbarkeit der Erde und aus der Fülle mehrerer anderer
Annehmlichkeiten gewonnen werden; als dritten Grund nennt er
den Schrecken, der die Herzen durch Blitze, Unwetter,
Wolkenbrüche, Schneestürme, Hagel, Verwüstungen, Seuchen,
Erdbeben, häufiges unterirdisches Dröhnen, Steinregen und eine
Art Blutregen erfüllt, aber auch durch Erdstürze und
plötzliche Spaltungen der Erde, ferner durch widernatürliche
Mißgeburten bei Mensch und Vieh, dazu durch Erscheinungen von
brennenden Fackeln am Himmel, ebenso durch die Sterne, die die
Griechen kometai und wir Haarsterne nennen, die vor kurzem im
Feldzug des Octavius Vorboten eines großen Unglücks gewesen
sind, ferner durch Zwillingssonnen, eine Erscheinung, die sich
nach der Erzählung meines Vaters einmal unter dem Konsulat des
Tuditanus und Aquilius gezeigt hatte, in dem Jahre also, in
dem
unsere
andere
Sonne,
Publius
Africanus,
erlosch,
Vorzeichen also, die die Menschen in Schrecken versetzten und
somit ahnen ließen, daß eine bestimmte himmlische und
göttliche Macht existiere; der vierte, und zwar der bei weitem
wichtigste Grund aber soll in der immer gleichbleibenden
Bewegung und Umdrehung des Himmels, der Sonne und des Mondes
und in den gesonderten Bahnen, dem Nutzen, der Schönheit und
der Ordnung aller Gestirne beruhen, in Erscheinungen, deren
Anblick allein schon hineichend beweise, daß ihr Dasein nicht
einem blinden Zufall zu verdanken sei; denn käme z.B. jemand
in ein Haus, in ein Gymnasium oder auf ein Forum und sähe dort
die allen Dingen zugrunde liegende planvolle Berechnung,
Gesetzmäßigkeit und Ordnung, dann könnte er nicht sagen, dies
geschehe ohne Ursache, sondern müßte erkennen, es sei
irgendein leitendes Wesen da, dem man zu gehorchen habe; noch
viel mehr muß er dann bei so großen Bewegungen und
Veränderungen und bei den geordneten Bahnen so vieler und so
riesiger Körper, die sich trotz ihres unermeßlichen und
unendlichen Alters niemals irgendwie getäuscht haben, erst
recht annehmen, daß derartige gewaltige Vorgänge innerhalb der
Natur durch eine denkende Kraft gelenkt werden."
Die vier Gründe des Kleanthes sind also:
1. Orakel erweisen ein wissendes Verfügen Gottes über die
Zukunft.
2. Wir verdanken unsere Existenz Ursachen, die als Wirkung des
Himmels erkennbar sind; z.B. Fruchtbarkeit des Bodens,
günstiges Klima usw.
3. Überlegene Naturgewalten schrecken uns
4. Schönheit und Ordnung im Gleichmaß der Gestirnbahnen usw.
Daran schließt sich der Beweisgang des Chrysippos (II 16f.)
Die aus den vier Gründen des Kleanthes erwachsende prólepsis
einer natürlichen Gotteserkenntnis läßt sich nicht in Reinheit
148
aufrechterhalten und bedarf der Klärung und Absicherung durch
die Philosophie.
Drei
Beweise
der
Existenz
Gottes,
die
zurückgeführt werden, haben sich erhalten:
auf
Chrysipp
1. Cicero De natura deorum 3, 10, 25 und 2, 6, 16 (= II
1011f.)
2. Sextus Empiricus adv.math. 9, 77 (= II 1020)
3. Themistius paraphr. in Aristot. analyt. post.: Comm. in
Aristot. Gr. 5, 1, 49, 21/6 (= II 1019).
Der erste Syllogismus lautet:
* Wenn es etwas gibt, was der Mensch nicht hervorbringen kann,
so ist derjenige, der es zu bewirken vermag, besser als der
Mensch.
* Wer anders aber als Gott könnte dem Menschen überlegen sein?
* Nun gibt es aber etwas, das Menschen nicht hervorzubringen
vermögen.
* Also existiert die Gottheit.
Der zweite Beweis ist der kosmologische Gottesbeweis:
* Aus der Schönheit der Welt und der Himmelserscheinungen sind
wir gezwungen zu schließen, daß die Welt als Heimat der
Götter errichtet wurde.
Der dritte Beweis ist empirisch:
* Da es eine Verehrung der Götter im Kult gibt, gibt es auch
eine Gottheit.
Wir wollen die Stringenz bzw. Nichtstringenz dieser Beweise
hier nicht analysieren, sondern nur die Tatsache würdigen, daß
rationale Gotteserkenntnis von den Stoikern zum Thema gemacht
worden ist. Und wir wollen überlegen, welche Wege zur
Gotteserkenntnis grundsätzlich in Erwägung gezogen worden
sind.
Gotteserkenntnis - Sein (Wesen) Gottes
Die theologische Reflexion der späteren Antike, insbesondere
die Reflexion, die vom Platonismus ausging, machte sich das
stoische Axiom zu eigen, der Mensch sei vermöge des ihm
innewohnenden Logos der Gottheit verwandt. Nun aber wurde mit
Logos nicht mehr der Wesenskern der immanenten Gottheit
bezeichnet,
sondern
nun
wird
Logos
als
die
Funktion
verstanden, kraft welcher die die Welt transzendierende
Gottheit wirkt. Diese Neuwendung wird bereits in dem einzigen
wörtlichen Zitat aus den Schriften des Thrasyllos, des
Hofastronomen und Beraters am Hofe des Kaisers Tiberius,
149
Von nun an ist Logos die entscheidende
Funktion, durch welche die die Welt transzendierende Gottheit
alles Erschaffene lenkt.
Unbestritten blieb das Axiom, daß
die Gottheit durch eine an den Logos gebundene Erkenntnis,
nämlich logismô kaì dianoía, begriffen werden müsse. Damit
wurde das Postulat aufgestellt, die Erkenntnis Gottes als der
eigentlichen Substanz (ousía) müsse mit den Methoden der
philosophischen Begriffsbildung erfolgen.
Hierzu wurden drei Wege angeboten, die zum Ziel der
Gotteserkenntnis führen:
ausgesprochen141.
(1) Die via analogiae. Man stellt eine Analogie her, welche
das Göttliche in Vergleich rückt zu allem, was in dieser Welt
hervorragt, z.B. zum König, zur Sonne. In diesem Zusammenhang
ist Platons Sonnengleichnis (resp. 6, 509 b) wieder und wieder
herangezogen
worden.
Dieser
Weg
war
philosophischer
Propädeutik vorbehalten; darum bedient sich Kelsos dieser
Beweisführung (vgl. Orig. c.Cels. 7, 42). Diese Methode führt
nicht zur Begrifflichkeit; sie arbeitet mit Vergleichen.
(2) Die via eminentiae. Nach dieser Methode wird gelehrt, daß
die Gottheit als die eigentliche Substanz alle übrigen Werte
übertrifft. Als locus classicus wurde die Rede der Diotima
(Plat. conv. 210 a/d) angeführt: Unter Diotimas Anleitung
vollzieht Sokrates den Aufstieg in der Welt der Werte, bis er
zur Anschauung des Schönen an sich gelangt. Dieses Lehrstück
hat Augustinus conf. 4,20 nachvollzogen. Einen besonders
wichtigen Beitrag verdankt die Theologie des späteren
Platonismus den Überlegungen, die Aristoteles (metaph. 11, 9,
1074 b 15 / 1075 a 10) über dasjenige Wesen anstellt, das im
höchsten Sinne Noûs ist; damit nahm Aristoteles eine
Beweisführung wieder auf, die er bereits in Perì philosophías
frg. 16 Ross (= frg. 16 Rose) vorgetragen hatte. Diese
Argumentation, von Philon und von Albinos mit wörtlichen
Anklängen wiederholt, ist so recht zum beispielhaften
Lehrstück für die Anwendung dieser Methode geworden.
(3) Die via negationis ging aus von dem Axiom, daß über die
Gottheit keine positive oder konkrete Aussage gemacht werden
kann. Insofern stellt die via negationis eine Art Fortsetzung
der via eminentiae dar: Wer auf der Grundlage des ersteren
Nachweises einen Einblick in die Transzendenz des Göttlichen
gewinnt, stößt endlich zu der Erkennntis durch, daß keine
Aussage, aber auch keine Erkenntnis bis an die Gottheit
heranreicht. Denn diese transzendiert sogar die Aussage "sie
ist". Als Stütze für den Satz, daß die Gottheit jenseits des
Seins und jenseits des Denkens ihren 'Ort' habe, wurde Platons
Porph. in Ptol. Math. harm.: 12, 21/8 Düring; H.Dörrie: Festschr. P.
Trouillard. Vgl. Philo Alexandrinus: Gleichsetzung des stoischen lógos mit
dem schöpferischen Wort (dabar) Gottes in der Bibel.
141
150
Parmenides und vor allem das Sonnengleichnis (resp. 6, 509
a/c) herangezogen. Einen letzten Schritt tat Plotin: ihm war
es gegeben, den jenseitigen, höchsten Gott in der unio mystica
zu erfahren142; auch diese Erfahrung entzog sich der rationalen
Mitteilbarkeit.
Gerade weil sie unlösbar war, ist die Frage nach dem Wesen
Gottes (tì tò theîon) als ungemein brennend empfunden worden.
Denn Erkenntnis bewirkt Kommunikation, Kommunikation bewirkt
Teilhabe. In diesem Punkt war die Stoa 'seelsorgerlich' allen
übrigen Schulen überlegen; denn nach stoischer Lehre hat ein
jeder an dem Logos als einer göttlichen Kraft teil. Aber die
Stoa konnte nichts über die éschata, über ein individuelles
Weiterleben nach dem Tode, verheißen. Der heiße Wunsch, die
Gottheit, sei es erkennend, sei es im Mysterium, zu erfahren,
hat das Bedürfnis nach sotería, nach Erhaltung der Existenz
über den Tod hinaus zur Voraussetzung. Es bestand also ein
geradezu dringendes Bedürfnis, es möge auf die Frage: tì tò
theîon; – Was ist das Göttliche? - eine Antwort gegeben
werden.
Alle
Bemühungen
um
die
Erkenntnis
Gottes
wurden
als
heilbringend gewertet. Denn jede Erkenntnis setzt eine
Gleichartigkeit des Erkennenden mit dem Erkannten voraus,
stellt also die heilbringende Teilhabe her. Es war daher viel
zu wenig (denn es entsprach dem lebhaft empfundenen Bedürfnis
nicht), wenn kaiserzeitliche Philosophie eine schrittweise
Annäherung an Gott soweit möglich (homoíosis theô katà tò
dynatón:
Plat.Theaet.
176
b)
verhieß.
Es
muß
tiefe
Enttäuschung bewirkt haben, daß die Philosophen außerstande
waren, einen Gottesbegriff auf rationaler Grundlage und mit
nachvollziehbaren Argumentationen beizusteuern. Denn wem es
etwa gelungen wäre, den Seienden zu erkennen, der wäre kraft
der damit gewonnenen Teilhabe selbst zum Sein gelangt und
somit der Vergänglichkeit entrückt worden. Keine Philosophie
konnte diese Chance nutzen. Damit ist einer der Gründe
(vielleicht der stärkste Grund) bezeichnet, welcher der sog.
Gnosis zu nachhaltiger Wirkung verhalf. Denn hier wurde ja
eben das versprochen, was keine Philosophie zu leisten
vermochte, nämlich gnôsis theoû – Erkenntnis Gottes - in dem
doppelten Sinne:
a) als Erkenntnis Gottes (wobei Gott der Gegenstand der
Erkenntnis ist),
b) als das von Gott Erkannt-sein (wobei Gott Subjekt des
Erkennens ist). Denn der, den Gott kennt, kann nicht
zugrunde gehen.
Bezeichnenderweise
bedient
sich
die
Gnosis
in
dem
verhältnismäßig späten Stadium, aus dem schriftliche Zeugnisse
142
Vgl. Porphyr. vit. Plot. 23, 7 ff. und R.Harder im Komm. zSt.
151
vorliegen, einer der philosophischen Fachsprache angenäherten
Terminologie; sie ist aus einer Gott-Suche hervorgegangen,
durch die man eben das aufzufinden unternahm, was die
Philosophen zu verweigern schienen.143
'Gottesbeweis', Gewißheit, Glauben:
Der Gottesbeweis, d.h. der Versuch, sich der Existenz Gottes
durch einen Beweis zu versichern, ist für die Griechen in
seiner Denkbarkeit an mehrere Vorbedingungen geknüpft:
(1) Das Wissen muß selbst zuvor in seinen ermöglichenden
Bedingungen erkannt sein.
(2) Das Dasein Gottes muß in einer Weise fraglich geworden
sein, daß das Bedürfnis nach dem erkenntnissichernden
Beweisverfahren übermächtig wird und die natürliche Scheu
vor dem 'arcanum' der Gottheit dahinter zurücktritt.
Beide Bedingungen sind in Griechenland erst im 5./4.Jh. v.Chr.
erfüllt. Die durch die Aufklärung, insonderheit durch die
Sophistik, ferner durch die großen Katastrophen des 5./4.Jh.
heraufgeführten politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen
erschütterten auch den altüberkommenen Götterglauben der
Hellenen und ermöglichten damit erstmals die Frage nach der
Existenz des Gottes sowie die Suche nach ihrem Beweis.
Spätestens nach den Analytiken des Aristoteles liegt dem
antiken Denken ein Begriff von Wissen und Wissenschaftlichkeit
vor, der den Gottesbeweis möglich, ja sogar notwendig werden
ließ.
Der Gedanke eines Beweises, der Stringenz des Logos im 'theologeîn' hängt eng zusammen mit dessen psychischem Korrelat,
der Zustimmung. Zustimmung ist ein Konstitutivum von Glauben.
Darüber hat im 19. Jahrhundert John Henry Newman (On a Grammar
of Assent) Wichtiges geschrieben. Es ist aber nicht so, wie
das oft und oft dargestellt worden ist, daß die Griechen sich
in ihrer Philosophie um Erkenntnis und Wissen bemüht hätten
und daß dazu dann von außen der biblische Begriff des Glaubens
getreten sei; und seither - seit dieser Verbindung zweier
Denktraditionen durch die Kirchenväter - hätten wir den
typischen abendländischen Gegensatz von Wissen und Glauben.
Das stimmt so nicht. Ein Indiz dafür ist die Tatsache, daß die
Stoiker von ihrem Weisheitsideal, dem sophós, behaupteten, er
sei "gläubig". Das (u.a.) hat die Stoiker den Juden und
Literatur: E.R.Dodds, The Greeks and the Irrational (Berkeley 1951);
H.Dörrie, Die Frage nach dem Transzendenten im Mittelplatonismus:
Entr.Fond.Hardt 5 (1957) 193/223; H.Merki, Homoíosis theo. Von der
platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa
= Paradosis 7 (Freiburg/Schw. 1952).
Zum Motiv des Erkanntseins von Gott: vgl. Paulus 1 Kor 13,12: „Jetzt
erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so
wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.“
143
152
Christen besonders sympathisch gemacht. Nun könnte man
einwenden, die Stoiker seien eben schon semitisch beeinflußt,
und bedeutende Stoa-Forscher wie Max Pohlenz haben das auch
hervorgehoben, (besonders zu einer Zeit, als rassistisches
Denken politisch favorisiert war). Es empfiehlt sich aber, den
Terminus "glauben" im griechischen Denken zurückzuverfolgen.
a) Vorsokratik
Da
ist
zunächst
zu
verweisen
auf
frühes
naturwissenschaftliches Forschen. Es bereitete nämlich nicht
nur das Glauben an den Mythos den frühen griechischen Denkern
Schwierigkeiten, sondern die selbe Schwierigkeit betraf auch
naturphilosophische Lehren. (Sie wurden übrigens anfangs wie
der Mythos in feierlicher, dichterischer Form vorgetragen.)
Unter den neuen naturwissenschaftlichen Gedanken nahm der
Atomgedanke und damit die Annahme des Leeren als eines inneren
Aufbaumoments der Körperwelt eine besonders hervorragende
Stelle ein, da er einen radikalen Bruch mit der 'natürlichen'
Anschauung bedeutete. 'Hinter' der Welt der 'natürlichen'
Erfahrung tut sich eine zweite, wahre Welt der Atome auf. Die
Sinneswahrnehmung – aísthesis - steht gleichsam an der Grenze
zwischen diesen beiden Welten. Die Grundannahme der alleinigen
Wirklichkeit der Atome und ihrer Bewegung durch das Leere läßt
den Gehalt der sinnlichen Wahrnehmung nur als Schein gelten.
Aber dieser Schein ist zugleich das Wahre, wie es sich zeigt.
(Vgl. den Satz in Goethes 'Natürliche Tochter': "Das Wesen,
wär' es, wenn es nicht erschiene?")
So dürfte es zu verstehen sein, daß Demokrit seine kritische
Einschränkung der Wahrheit der Sinneswahrnehmung durch die
"Antikritik" der Sinne an dem Tun des Verstandes ergänzt.144
Die písteis, von denen Demokrit redet, sind offenbar
einerseits Gewißheiten von äußeren Sachverhalten, anderseits
ein
Vertrauensverhältnis
zwischen
Sinneswahrnehmung
und
Denken. Die Gewißheiten von Sachverhalten sind in der Weise
problematisch, daß das Vertrauensverhältnis zwischen Denken
und Sinneswahrnehmung zum Problem geworden ist. Einer
erwogenen Verwerfung der aisthéseis folgt bei Demokrit die
Besinnung auf deren fundierenden Charakter. Es wäre sozusagen
nicht nur ein Abbrechen von Brücken, sondern ein Wegziehen des
Bodens, auf dem die Theorie fußt. Niemand konnte das besser
wissen als eben derjenige, der darauf gebaut hatte. In diesem
Sinn lobt Demokrit den Anaxagoras für dessen Satz: ópsis
adélon tà phainómena. - "Schau des Unanschaulichen sind die
Erscheinungen".145
Die wahre Welt ist zwar eine Welt der ádela, eine Welt dessen,
was nicht unmittelbar am Tag liegt, aber, so sagt nun
144
145
Demokrit B 125 (II 168, 8) D 8.
Sextus Empiricus VII 140; 59 B 21 a D 8.
153
Anaxagoras, das Erscheinende ist nicht nur irgend ein Aspekt
des Verborgenen, der Schein ist vielmehr das Wahre, wie es
sich zeigt. Es muß daher auch ein Verfahren geben, sich vom
Erscheinenden her einen Weg zu bahnen zu der zugrunde
liegenden Welt.
Die pístis naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist gebunden an
die aísthesis. Die Zustimmung zu ihr wird im Satz des
Anaxagoras postuliert, eben weil sie problematisch ist.
Der philosophische Gemeinplatz des pisteúein toîs phainoménois
– den Phänomenen vertrauen - hat hier seine Wurzel, wo mittels
des Terminus pístis die Zwiespältigkeit der Phänomene in ihrer
Fragwürdigkeit und Fragwürdigkeit thematisiert worden ist.
b) Sophistik
Es ist noch auf eine andere Denktradition der Griechen zu
verweisen:
neben
der
naturphilosophischen
auf
die
sophistische.
Gegen diejenigen Philosophen, die wie Heraklit, Parmenides
usw. - etwas vereinfacht gesagt - behaupteten, die Ansichten
der 'Menschen', d.h. der Menschen im allgemeinen seien
sämtlich falsch und die Wahrheit sei von ihnen völlig
verschieden, wendet sich der Sophist Protagoras. Seine
Verteidigung der 'natürlichen' Ansichten des 'einfachen' oder
'gemeinen' Mannes gegen die Ansprüche der Philosophen und
Wissenschaftler
scheint
nicht
nur
für
Protagoras
charakteristisch gewesen zu sein, sondern für die Sophisten
des 5.Jh. übrhaupt. Diese Haltung darf wohl nicht als
reaktionär, sondern als begründet in dem neu entdeckten
Problem der Sophisten ausgelegt werden, das sich hier als eng
verschlungen mit der naturwissenschaftlichen Problemstellung
erweist: das Problem des Eigenlebens des Logos, der Macht der
Rede. Gorgias hat es vielleicht am eindrucksvollsten gesagt:
Der Logos ist ein dynástes mégas, ein großer Herrscher. Er
vermag die Seele zu übermächtigen, durch peíthein (überreden),
ja apatân (täuschen), und dies, obwohl er doch weder durch
Größe
(smikrotáto
sómati)
noch
durch
sonstige
Erscheinungsqualitäten
(aphanestáto)
die
Sinnesorgane
beeinflussen kann. Und doch vollbringt er wahrhaft göttliche
Werke. Wie macht er das? Er hat, bzw. ist selbst eine zweite
Erfahrungsquelle, nämlich durch die Affekte (phóbon ... lýpen
... charán ... éleon). Der Weg vom logos zur doxa führt also
nicht über die Sinne, sondern ist physiologisch verankert: wie
Heilmittel und Gifte sympathetisch auf den Körper wirken, so
'vergiften' die lógoi die Seele und bewirken die Affekte.
Der
allmählich
aus
dem
Polis-Leben
heraus
sich
differenzierende Stand der sophistischen Redner (heute würde
man
sagen:
Bildungsfunktionäre
in
freier
Trägerschaft)
154
relativierte durch seine eigene Erfahrung von dem Eigenleben
der logoi die allein am Vorstellungsschema orientierten
zeitgenössischen naturphilosophischen Lehren. Die logoi, so
weiß Isokrates (3, 5-9; vgl. 15, 253-257) sind das, wodurch
sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Sie sind die Ursache
der meisten Güter, denn ohne die Kunst der Überredung hätten
die Menschen sich nicht zusammentun und Städte gründen können,
sie hätten keine Gesetze geben und téchnai erfinden können.
Der logos ist Voraussetzung zur Unterscheidung von Gut und
Schlecht, zur Erziehung der Unvernünftigen und zum Erkennen
der Vernünftigen. Mit dem lógos streiten wir über das
Zweifelhafte und suchen Klarheit über Unklares, denn wir
gebrauchen, wenn wir in einer Rede andere überzeugen,
dieselben Argumente (písteis), die uns zu Gebote stehen, wenn
wir mit uns selbst zu Rate gehen. Kurz, der lógos ist Führer
in allem Denken und Tun, und nichts Vernünftiges geschieht
ohne ihn (Isokr. 4, 47-50).
Das Wesen des lógos ist pístis, zugleich das 'Argument', der
Beweis (in untechnischem Sinn), und dessen Effekt, die
vertrauensvolle Zustimmung, die 'Gewißheit', beide vermittelt
durch peíthein; darauf beruht seine geschilderte Kraft.
Die Vertrautheit mit der Rednersituation, Menschen überzeugen
zu müssen, hat mithin den Geist als 'innere Geselligkeit'
verstehen gelehrt, eine dem lógos eigene Differenziertheit.
Die Frage nach der Wahrheit in diesem inneren Verhältnis des
lógos ist allerdings hier bei Isokrates vorgängig, unter
Hinweis auf die Erfordernisse der Praxis, abgebogen auf die
Empirie.146
Das griechische Denken hatte, wie ich zu zeigen versuchte,
bereits tiefe Blicke in beide Labyrinthe der Philosophie getan
(um mit Erich Heintel bzw. Leibniz zu reden): in das Labyrinth
des Kontinuums und in das der Freiheit.147
c) Plato
Eine wichtige dritte Denktradition der Griechen bezüglich
"Glauben", und die, die das christliche Denken entscheidend
Isocr. 15 296: empeiría, héper málista poiei dynasthai légein...
"Es gibt zwei Labyrinthe für den menschlichen Geist: das eine betrifft
die Zusammensetzung des Kontinuums, das andere das wesen der Freiheit. das
eine wie das andere aber entspringt aus derselben Quelle, nämlich aus dem
Begriff des Unendlichen... <Denn> man muß vor allem wissen, daß alle
Geschöpfe einen Stempel der göttlichen Unendlichkeit in sich tragen, und
daß dies der Ursprung der vielen wundersamen Dinge ist, die den
menschlichen Geist in Staunen setzen. (Leibniz, Über die Freiheit, II 499
und Theodizee, Vorrede IV 7). Vgl. E.Heintel, Die beiden Labyrinthe der
Philosophie, Bd.1, Wien 1968.
146
147
155
mitgeprägt hat, geht auf Plato zurück. Plato fingiert in
seinem Dialog Gorgias ein Streitgespräch zwischen dem
Sophisten
Gorgias und Sokrates. Darin werden auf Vorschlag
des Sokrates zwei Arten der Überredung angesetzt, die eine,
welche Glauben hervorbringt ohne Wissen, die andere aber,
welche Erkenntnis hervorbringt. (Plat. Gorg. 454 e 1 ff.).
Gorgias muß zugeben, daß die peithó, welche die Rhetorik
bewirkt, nur Glauben ohne Wissen impliziert.
Wenn pístis der máthesis oder der epistéme (Erkennntis) als
Kontrast gegenübergestellt wird, so kann das nur im Hinblick
auf ihre Zwiespältigkeit geschehen. Sie ist dann eine Art dóxa
(Meinung), wie sie ja auch im Liniengleichnis der Politeia
eine Unterabteilung der dóxa bildet. Tut Sokrates dem Gorgias
Unrecht, indem er listig zweierlei Gewißheiten einführt, von
denen die eine, die der epistéme, undiskutiert bleibt, während
an der anderen allein ihr negativer Aspekt betrachtet werden
soll? Insofern Gorgias die Unterscheidung von zwei Weisen der
Gewißheit offenbar neu ist, ja. Denn Gorgias hatte dadurch
eine ganz andere Problematik im Auge. Ihm ging es nicht um
eine Analyse der Gewißheit als solcher, sondern um die
empirisch erfaßten Möglichkeiten, sie hervorzurufen. Daher
kann das Berechtigte an seiner Methode in der von Sokrates
aufoktroyierten Differenzierung nicht zur Geltung kommen. Denn
von diesem Stand des Problembewußtseins bei Sokrates gibt es
kein Zurück zur Auffassung einer einheitlichen 'Überzeugung',
er kann nur durch weitere Differenzierung überboten werden.
Gorgias hätte fragen können, inwiefern es denn sinnvoll sei,
von peithó zu reden, welche einer angenommenen episteme
zukomme, wenn diese ohnehin nur wahr sein könne. Er hätte auch
fragen können, ob pístis, die ja nicht nur falsch, sondern
auch wahr sein könne, in letzterem Fall nicht der episteme
gleichzusetzen sei. Fragen also, die Plato in späteren
Dialogen noch beschäftigen sollten.
Die enge Beziehung und doch Differenz zwischen Erkenntnis und
richtiger Ansicht ist eine platonische Konstante.148
Plato hat also eine nicht näher erläuterte 'Gewißheit',
'Überzeugtheit', also eine glaubensartige Haltung, in seinem
Begriff der epistéme enthalten sein lassen.
John Gould149 charakterisiert die epistéme als "an inward and
decisively personal conviction (analogous perhaps, though we
must beware of being misled by the connotations of the word,
to the Christian 'faith')."
Diesem Erkenntnisbegriff setzt Plato einen Glaubensbegriff
entgegen, dem er zwar dieselbe peithó zuschreibt, aber eben
nur diese, kein eidénai. pístis und epistéme haben also etwas
Meno 97 c 4 ff., Symp. 202 a 5 ff., Politic. 309 c 5 ff., Phileb. 11 b
8, Tim. 37 b-c, Theaet. 201 c-d, Sophist. 233 c 10 f.
149 John Gould, The Development in Plato's Ethics, Cambridge 1955, S.24
148
156
gemeinsam, die peithó, sie sind hinsichtlich ihrer peithó
identisch, hinsichtlich der alétheia aber verschieden.
Diese Identität in Differenz veranschaulicht er in den
Verhältnisbestimmungen des Liniengleichnisses. Dort gibt er
der pístis auch ihre Funktion in einem Prozeß des Aufstiegs
zur Erkenntnis. Und das ist letztlich die Voraussetzung dafür,
daß in der Stoa die pístis als notwendig zur Weisheit gehörig
betrachtet wird. Die platonische Kunst der Unterscheidung, die
Dialektik, hat bereits die Griechen zu sehen gelehrt, daß
beides - Wissen und Glauben - in sich problematisch ist, daß
sie zusammen gehören und nur im Zusammenhang eines Prozesses,
eines
Denkweges
verständlich
sind.
(Den
Gedanken
des
Denkweges, der méthodos hatte schon Parmenides entfaltet.)
Eine Konsequenz daraus zog Aristoteles mit seinem Organon, der
großartigen
Entfaltung
der
Wissenschaften
vom
Logos
(Analytiken, Topik, Rhetorik, Hermeneutik) - er sagte sich:
man kann etwas unwillkürlich tun, aber auch hodô, methodisch;
alles, was man unwillkürlich tut, kann man im Prinzip auch
methodisch, wissenschaftlich betreiben.
Die Stoiker waren in vielem nur die Fortsetzer dieser
wissenschaftlichen Grundhaltung. es ist ihnen z.B. gelungen,
die aristotelische Logik entscheidend weiterzuentwickeln.150
Eine andere Konsequenz zogen die Skeptiker: Sie sagten sich,
wir müssen zwar im großen und ganzen so leben wie alle
anderen, die glauben, definitiv zu wissen, aber wir tun es mit
dem ständigen Vorbehalt, daß wir eines besseren belehrt werden
könnten.
Und eine andere Konsequenz - oder besser: die Konsequenz aus
all
dem
zogen
die
Kirchenväter,
die
das
erkenntnistheoretische Problem der griechischen Philosophie
erstens als ein theologisches adaptierten (und darin waren
ihnen Leute wie Cicero vorangegangen), und die das erreichte
Problembewußtsein überboten, indem sie es in den Horizont der
Eschatologie stellten. D.h. die epoché des Skeptikers ist
unentbehrlich angesichts der Hoffnung des "Kein Auge hat es je
gesehen und kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben". Die Dialektik ist unentbehrlich
angesichts der Notwendigkeit, aus geschichtlicher Erkenntnis
Folgerungen, die zugleich Prämissen des weiteren Glaubens sein
können, zu ziehen.
Auswirkungen philosophischer Theologie auf das Christentum
Es hat einige Zeit gedauert, bis das Christentum, das sich in
Literatur zur stoischen Logik: B.Mates, Stoic Logic, Berkeley 1953.
J.Mau, Stoische Logik. Ihre Stellung gegenüber der Aristotelischen
Syllogistik u. dem modernen Aussagenkalkül. In: Hermes 85 (1957) 147-58.
M.Frede, Die stoische Logik. Gött.1974
150
157
den ersten Jahrhunderten vor allem in den Kreisen verbreitet
hatte, deren religiöse Bedürfnisse bisher von den griechischen
Mysterien und den gnostischen Mythologemen der verschiedenen
östlichen Religionsströmungen befriedigt worden war, vom
dritten Jahrhundert an mit einigen führenden Vertretern und
bevorzugten Bildungskreisen, vom vierten Jahrhundert an mit
den großen Massen der neu gewonnenen Anhängerschaft in die
sozialen Schichten emporgedrungen ist, deren Weltbild bisher
die - in vieler Hinsicht zur Religion gewordene - griechische
Philosophie der Spätzeit bestimmt hatte. Damit wird die
Auseinandersetzung zwischen den Grundgedanken der christlichen
Religion und den wesentlichen Elementen der griechischen
Philosophie zum wichtigsten Problem der Geistesgeschichte der
folgenden
Jahrhunderte
sowohl
vom
Standpunkt
der
theologischen Entfaltung und philosophischen Formulierung der
christlichen Lehre, als auch von dem des Fortlebens der
griechischen Philosophie. Denn einerseits ist dem nunmehr im
christlichen Geistesleben erwachten philosophischen Bedürfnis
gegenüber
eine
solche
philosophische
Ausprägung
des
christlichen Grundgehalts notwendig geworden, andererseits
kann in der nunmehr christlich gewordenen Welt die griechische
Philosophie nur in der Synthese mit dem Christlichen
fortleben.
Das Grundmysterium des Christentums ist die Menschwerdung
Gottes, und davon ausgehend, die Menschwerdung des Göttlichen
in der Heiligung des Menschen, und die Vergöttlichung des
Menschen in der Vereinigung des Menschen mit Gott in der
Erlösung.
Das philosophische Problem, das damit verbunden ist: Wie kann
das so gefaßt werden, daß dadurch der Geschöpflichkeitscharakter des Menschen nicht bedroht wird, und das Eigendasein
des
Geschöpfes
nicht
als
etwas
Aufzuhebendes
und
zu
Überwindendes erscheint, sondern vielmehr als etwas, das auch
in der Verbindung mit dem Göttlichen, ja gerade durch sie
seinen eigenen Sinn und Wert hat - die Erweiterung der Lehre
von der Menschwerdung zu einer die ganze Schöpfung umfassenden
Mystik der Gott-Welt-Vereinigung, in der die Schöpfungslehre
erst ihren eigenen Sinn erhält?
Die beiden gegensätzlichen antiken Denkschemen, wonach das
Materielle entweder die letzte, äußerste Seinswelle der aus
dem Göttlichen und Geistigen in stufenweisem Absteigen
emanierenden Seinsflut ist, oder als das prinzipiell Andere,
als "Nichtseiendes" (me on) dem "Seienden", dem Göttlichen und
Geistigen
gegenüber
steht
die
aber
beide
darin
übereinstimmen, daß in der Vervollkommnung des GeistigMenschlichen und seiner Erhebung zum Göttlichen das Materielle
gemieden, verflüchtigt, beseitigt oder ins Geistige verwandelt
werden muß, - werden zugunsten einer wesenhaft christlichen
Auffassung des Verhältnisses zwischen Schöpfer und Geschöpf
überwunden, nach dem Prinzip: "Kein Geschöpf Gottes ist
158
verwerflich".
Aber - ist es die mitreißende Konsequenz des origenistischen
Spiritualismus, die sich trotz allem geltend macht, ist es die
antidualistische Scheu, dem Materiellen eine zu große
Bedeutung, eine zu selbständige Rolle neben dem Göttlichen und
Geistigen einzuräumen, wenn man es als etwas betrachtet, das
neben Gott in alle Ewigkeit bestehen bleibt? - jedenfalls kann
man immer wieder ein Abgehen von der Generallinie feststellen,
von der Auffassung vom Menschlichen als dem Bindeglied
zwischen geistiger und leiblicher Welt, aus der Überzeugung
von der Sinnhaftigkeit und Endgültigkeit dieser Verbindung und
aus
der
Vorstellung
des
Durchwirktwerdens
der
ganzen
Schöpfung,
bis
hinunter
zum
Materiellen,
durch
die
vergöttlichende Kraft der Menschwerdung, die zugleich eine
Mitteilung des Göttlichen an das Sichtbare ist, zurück in eine
Erklärung des Ursprungs und Sinnes der leiblichen Natur des
Menschen, die zwar nicht die Materialität als Folge der Sünde
oder als ihren Anlaß betrachtet (d.h.: die Versetzung in die
materielle Welt als Strafe für die Zuwendung der Seele zur
Materie, wie es Origenes erklärt), die aber trotzdem insofern
einen Zusammenhang zwischen Sünde und Materialität annimmt,
als nach dieser Erklärung die Materialität, die "Umkleidung
des
Seelisch-Geistigen
mit
dem
Gewande
des
SichtbarLeiblichen" im Hinblick auf die von Gott vorausgesehene
Versündigung geschehen ist und zu dem Zweck, im Menschen durch
die "Erfahrung" (peira) der Gottferne und den mit dem
leiblichen Leben verbundenen Schmerz, die Sehnsucht nach der
Rückkehr zu Gott erwecken und ihn zur Umkehr bewegen zu
können.151 Das traditionelle Bild für diese Umkleidung - das
aus der Genesis (3,21) bekannte "Fellkleid" (dermatinos
chiton), mit dem Gott Adam und Eva nach dem Sündenfall
bekleidete, - legt aber die Vorstellung nahe, daß diese
"Überkleidung" erst nach dem Sündenfall geschehen ist, und es
liegt in der inneren Konsequenz dieses Gedankengangs, daß bei
der Rückkehr zum ursprünglichen Zustand der Seele diese
Überkleidung wieder verschwindet, was auch gelegentlich gesagt
wird.
Die notwendige Folge aus dieser Haltung der leiblichmateriellen Seite des Menschen gegenüber ist die Tatsache, daß
auch in der Lehre von der Menschwerdung neben der irenäischen
Gregor von Nyssa, M.P.G. 44, 205 A; 44, 181 C; 44, 189 C; 44, 255 B;
45, 33 D - 37 C; 46, 57 C; 46, 372 C; 46, 512 A; 46, 521 C - 524 B. Die
zuletzt angeführte Stelle lautet: "Wenn wir wären, wie wir ursprünglich
geschaffen wurden, hätten wir das fellene Gewand nicht nötig gehabt...
Nachdem aber... der Mensch freiwillig den Trieb zum Tierischen und
Unvernünftigen genommen hatte, so fand die Weisheit Gottes, damit sowohl
die Freiheit der Natur bleibe, als auch das Böse verschwinde, den Ausweg,
den Menschen darin zu belassen, wohin er sich gewünscht hatte, damit er,
die Übel kostend, die er angestrebt hatte, und durch Erfahrung lernend,
was er statt wessen eingetauscht hatte, mit seinem Streben freiwillig
wiederum den Lauf zur früheren Seligkeit nehme."
151
159
Linie, die darin eine Versöhnung und Verbindung des Göttlichen
mit dem Materiellen sieht, eine andere Auffassung nebenher
geht, die von einer Verwandlung des Menschlichen zum
Göttlichen in Christus redet, von einem Aufgehen des endlichen
Menschlichen im unendlichen Göttlichen, wie ein Tropfen Essig
in der Wassermenge des Meeres aufgehen würde.152
Überwunden wird - v.a. dank der denkerischen Leistung der
Kappadokier - das neuplatonisch-arianische Konstruieren der
Welt
aus
Gott,
die
origenistisch-neuplatonische
Präexistenzlehre, der origenistische Kyklos, und vor allem die
platonische Lehre von der ursprünglichen und wesenhaften
Göttlichkeit
der
Seele;
der
eigentliche
und
tiefste
Grundgedanke des Platonismus dagegen - die Kontinuität
zwischen dem natürlichen, wesenhaften Sein der Seele und ihrer
übernatürlichen Bestimmung, die seinsmäßige Hinordnung der
Seele auf ihr übernatürliches Ziel - ist durch die Kappadokier
in das christliche Denken herübergenommen und eingebaut
worden, und zu einem Grundmotiv des Denkens der Ostkirche
geworden.
Aber die Kehrseite des platonisch-neuplatonischen Gedankens
von der Emanation der Schöpfung aus Gott, wonach das
geschöpfliche Dasein als ein depotenziertes und "gefallenes"
Göttliches betrachtet werden muß, ist noch nicht überwunden:
die Auffassung nämlich, daß die Vollendung des Geschöpflichen
in dem völligen Aufhören seiner eigenen geschöpflichen
Seinsweise und im Wiederaufgehen im Göttlichen, in einem
Verwandeltwerden in das Göttliche zu suchen sei.
Der eigentliche, ursprüngliche Sinn des Gedankens vom
Wiederaufgehen im Göttlichen und vom seinsmäßigen Einswerden
ist
ja
darin zu suchen, daß
er die Umkehrung und
Wiederaufhebung des Hervorgehens aus Gott und der seinsmäßigen
Absonderung von ihm - also des "Falls" der geistigen Wesen aus
der Ureinheit in Gott bedeutet. Und von diesem Motiv haben
sich auch die Kappadokier nicht ganz frei machen können. Nicht
als ob sie nicht ernstlich bestrebt wären, das (irenäischmethodianische) Motiv der Verknüpfung und Versöhnung des
Materiell-Geschöpflichen mit dem Geistig-Göttlichen in der
Lehre
von
der
Menschwerdung
und
der
Erlösung
dem
origenistischen Spiritualismus gegenüber zur Geltung zu
bringen; aber es besteht doch immer eine gewisse Tendenz, an
die Stelle der Verklärung der Schöpfung durch Gott und in Gott
"Wenn jemand einen Tropfen Essig ins Meer schüttet, wird auch der
Tropfen zu Meerwasser, in die Beschaffenheit des Meerwassers verwandelt",
45, 1221 D. "Wenn das Fleisch in das Meer der Unsterblichkeit verwandelt
wird...", 45, 1224 A. "Die menschliche Natur in Christus, vom Körperlichen
und Geformten zum Unkörperlichen verwandelt", 45, 1253 B/C "wird das, was
die Gottheit ist", 45, 1276 C. "Die ganze Menschheit hat Er mit seinem
eigenen Lichte durchdrungen, durch die Verbindung mit ihm selbst sie zu
dem machend, was er selbst ist", 46, 1021 D.
152
160
eine Absorbierung des Geschöpflichen durch das Göttliche zu
setzen und die "Vergöttlichung" des Menschen in der Erlösung
nicht als eine Erhebung des Menschen zu Gott, sondern als ein
Verschwinden und Ausgelöschtwerden des Menschlichen vor dem
Göttlichen aufzufassen. Diese Spannung zwischen einer dem
Platonismus
entspringenden,
einseitig
spiritualistischen
Haltung
und
der
orthodox-christlichen
Beurteilung
des
Geschöpflichen im Sinne der irenäischen Formulierung und, als
Folge
davon,
ein
gewisses
"Überhängen"
nach
der
"monophysitischen" Seite haben sie, die Begründer der
orthodoxen Theologie, an das östliche Denken weitergegeben.
Alle theologischen Ansätze der griechischen Philosophie hatten
in den ersten Jahrhunderten der christlichen Ära durch den
Härtetest der Christologie zu gehen.
Nehmen wir als Beispiel die Lehre des Theodor von Mopsuestia
von den zwei Personen in Christus, die zwar durch Einwohnung
und "dem Wohlgefallen nach" eins werden, aber doch so, daß
dabei
die
vollkommene
göttliche
und
die
vollkommene
menschliche Person voneinander wesentlich getrennt bleiben.
Christus, der Mensch, hat mit seiner völligen Sündelosigkeit,
mit der Vollkommenheit seines sittlichen Wollens verdient, daß
der göttliche Logos, die zweite göttliche Person, in so
vollkommener Weise in ihm wohnt und sein ganzes Sein
durchdringt,153 daß sie als eins betrachtet werden können, so
wie die Gnade Gottes und die Berufung zum ewigen Leben alle
die erhalten, von denen Gott voraussieht, daß ihr sittliches
Wollen es verdienen wird. (Danach ist das "Wohlgefallen wie am
Sohne" nur die vollkommenste und höchste Form der Gegenwart
Gottes im Menschen durch die Gnade, was Theodor übrigens auch
ganz offen ausspricht. (M.P.G. 66, 976 B/C.)
Der Grundgedanke bei Theodor und bei Paulus von Samosata ist
derselbe: Christus, der Mensch, in dem der Logos wohnt, nicht
wesenhaft, sondern durch Wissen und Teilhaben, ist mit der
Gottheit des Logos vereinigt dadurch, daß sein Wille ganz mit
dem göttlichen Willen übereinstimmt, ganz in göttlichem Willen
ruht.
Die Auffassung von der menschlichen Natur, die uns hier
entgegentritt, ist stoisch: daß sie in ihrem gegenwärtigen
empirischen Zustand, in ihrer jetzigen katástasis ein in sich
ruhendes, sinnvolles Ganzes ist, nicht das Ergebnis eines
"Abfalls" von einem höheren Zustand, einer Entstellung und
Verschlechterung eines ursprünglich besseren geistigeren
Über den sittlichen Willen, die próthesis (den Vorsatz) des Menschen
Christus, unabhängig von der Gnade und von der göttlichen Einwohnung,
handelt Theodor, M.P.G. 66, 976 D, 977 B, 986 A/B und 989 D, und 66, 986 B
sagt er sogar: "Gemäß dem, daß er im voraus wußte, wie er sittlich
beschaffen sein werde, einigte sich der göttliche Logos mit ihm (dem
Menschen Christus) gleich bei der Geburt".
153
161
Daseins, daß die Neigung zur Sünde und die Sterblichkeit nicht
als
Strafe
für
diesen
Abfall,
als
Anzeichen
der
Widernatürlichkeit (im höheren Sinn) des jetzigen Zustands zu
betrachten sind, sondern sich notwendig und sinnvoll aus dem
Wesen des menschlichen "Compositum", der Verbindung eines
geistigen mit einem materiellen Wesensteil ergeben. Diese
Auffassung ist ganz aristotelisch. Und ebenso aristotelisch
ist der Gedanke, daß das "Göttliche", das "Unsterbliche" nicht
in einem "ganz Anderen" besteht, zu dem das Menschliche aus
seiner Erniedrigung (in die irdische, sichtbare Welt) erst
emporgehoben werden müßte, sondern daß es dann schon gegeben
wäre, wenn die Beherrschung des materiellen Teiles im Menschen
durch den geistigen (sowohl im Sinne der formgebenden Kraft
der Seele gegenüber den auseinander - und auf den physischen
Verfall
des
Organismus
hin
strebenden
Kräften
des
materiellen Substrats, als auch im Sinn der sittlichen Kraft
des Geistes gegenüber den von den niederen Seelenteilen
stammenden Widerständen gegen das Vernunftgemäße) vollkommen
und dauernd werden könnte. Wenn Aristoteles als das (nie ganz
zu verwirklichende) Ziel des menschlichen Daseins das
Unsterblichsein,
soweit
dies
Menschen
möglich
ist",
154
bezeichnet , so meint er nicht einen prinzipiell über dem
menschlichen liegenden Zustand, sondern das menschliche
Wirken, insofern im Menschen etwas Göttliches gelegen ist155,
das ungehinderte Wirken des Geistes in der Beherrschung des
Leiblichen, der Ordnung des Sittlichen, und vor allem (denn
das ist das letzte Ziel, zu dessen Verwirklichung leibliches
Leben und sittliche Ordnung eigentlich da sind) in der
Erkenntnis, der theoria. Diese ist nichts prinzipiell über der
Sphäre des menschlichen Geistes Stehendes, setzt keine
mystische
Erhebung
zu
einer
dem
menschlichen
Denken
normalerweise unerreichbaren Sphäre voraus, sondern besteht in
der rationalen Erkenntnis und der denkenden Erfassung der
vollkommenen Ordnung der Welt, und der einfachen, rein
"seienden", in höchster begrifflicher Exaktheit zu erfassenden
Natur ihres ersten Bewegers, der obersten Substanz, des
absoluten Seins, des reinen Denkens der nóesis noéseos.
Könnten wir diese theoria, diese völlige rationale Erfassung
des ganzen geordneten Kosmos (die die Erfassung des Ursprungs
seiner Ordnung, des ersten Bewegers, in sich schließt) in
einem alles umfassenden noetischen Akte vollkommen und ständig
verwirklichen, dann wäre unser Erkennen, dann wäre unser
Dasein göttlich.156
"Nach Unsterblichkeit streben, so weit es möglich ist". Eth. Nic. X, 7,
1177b 33.
155 "Wirken, insofern etwas Göttliches in ihm ist", ebenda, 1177b 28.
156
Im berühmten XII. Buch der Metaphysik sagt Aristoteles von der
Betrachtung des ersten Bewegers, die ihm die eudaimonia verleiht: "Wenn
nun der Gott immer so selig ist, wie wir nur auf Augenblicke, so möchte
das schon etwas Wunderbares sein", Met., XII, 7, 1072b 24. Die
154
162
Prinzipiell ist also das Göttliche mit den Mitteln des
Geistigen, die in unserer eigenen, menschlichen Natur gegeben
sind, zu erreichen und zu verwirklichen. Daß es tatsächlich
nicht möglich ist, liegt nur an der gegenwärtigen Katastasis,
an
dem
faktischen
Zustande
des
leiblich-geistigen
"Compositums", der eine völlige Beherrschung des Materiellen
durch das Geistige im allgemeinen nicht ermöglicht. Aber man
muß immer danach streben, immer die völlige Beherrschung des
Materiellen durch das Geistige als Ziel im Auge zu behalten,
und darf sich nicht mit der Berufung auf die Unmöglichkeit der
vollkommenen Verwirklichung dieser Beherrschung dem Streben
nach ihrer Durchführung entziehen. Das ist die Denkweise, die
Aristoteles "menschlich gesinnt sein" anthrópina phroneîn,
1177a 32, nennt, im Gegensatz zum athanatízein, dem Streben
nach der völligen Herrschaft des Geistes. Wenn aber einmal
diese Herrschaft verwirklicht zu sein scheint durch eine
Tugend,
die
das
Maß
des
menschlicherweise
Normalen
überschreitet, in einer so vollkommenen Beherrschung der
niedrigen Triebe durch den Geist, wie sie unter den Menschen
im allgemeinen nicht vorzukommen pflegt, dann kann eine solche
Tugend übermenschlich, heroisch und göttlich (Eth. Nic. VII,
1, 1145a 19) genannt werden. Nicht als ob selbst diese Tugend
etwas prinzipiell Anderes, nicht mehr Menschliches wäre,
sondern weil eine solche Vorherrschaft des Geistes, eine
solche Vollkommenheit faktisch unter Menschen nicht vorkommt wenn sie auch an und für sich erst die wahre Verwirklichung
der im Menschlichen angelegten, dem Menschlichen immanenten
Seinsform ist, die in allem und jederzeit die Vorherrschaft
des Geistes und die Lenkung der niedrigeren Kräfte durch den
Verstand verlangt und als wesensgemäß voraussetzt. Denn das
"Göttlichkeit" der menschlichen theoria ist in dem Prinzip enthalten:
"Wenn die Vernunft etwas Göttliches im Vergleich zum Menschen ist, so ist
auch das ihr gemäße Leben göttlich im Vergleich zum Menschlichen", 1177b
31. Daß aber Aristoteles mit dieser "Göttlichkeit" des nous ihn keineswegs
der menschlichen Sphäre entrücken will, sondern nur die Verwandtschaft des
Höchsten im Menschen mit dem Göttlichen ausdrückt (im Sinne von 1177 a 15
- es ist vom "Besten" im Menschen die Rede -: "ob es nun selbst etwas
Göttliches ist, oder das Göttlichste in uns..." und 1179a 26: "Das Beste
und den Göttern Verwandteste, was also in uns die Vernunft wäre..."), das
beweist
die
an
das
Kapitel
VII
angefügte
Schlußbemerkung
(ein
offensichtlicher Nachtrag): "Es scheint ein jeder eigentlich und zutiefst
das zu sein, was in ihm das Höchste und Beste ist. Es wäre also unsinnig,
wenn er nicht das ihm eigene Leben erwählte, sondern das eines anderen
Wesens... denn was einem eigentümlich ist, das ist einem jeden von Natur
das Liebste und Erfreulichste, dem Menschen also das vernunftgemäße Leben,
wenn die Vernunft der eigentliche Mensch ist". Es soll die Immanenz des
nous und der auf seiner Tätigkeit begründeten eudaimonia betont werden,
damit man nicht in dem nous, wenn er auch "göttlich" und das "Göttliche im
Menschen" genannt wird, etwas vom Menschen Verschiedenes, über dem
Menschlichen Stehendes sehe - wenn auch die ständige Wirksamkeit und die
unbeschränkte Herrschaft des nous nur den Göttern zugeschrieben werden
kann.
163
vollkommene Menschliche ist das Göttliche, und "göttlich",
"übermenschlich" nennen wir es nur deshalb, weil die Menschen
selbst das Menschliche in seiner wesensgemäßen Vollkommenheit
nicht zu verwirklichen pflegen; darum ist uns der Mensch, der
die volle Tugend besitzt, die Herrschaft des Nous ganz
verwirklicht, "göttlich" (1145a 27-29); so kann man sagen:
"Aus Menschen werden Götter durch das Übermaß der Tugend"
(1145a 23), d.h. aus eigener, sittlicher Kraft, bloß dadurch,
daß sie als einzige die wahre, sittliche Aufgabe und die
innere Seinsbestimmung des Menschen ganz erfüllen.
Das ist im christlichen Kontext die Auffassung, daß Christus
durch seine einzigartige, sittliche Vollkommenheit (die Gott
voraussah) es verdient hat, Gottes Sohn zu werden und den
höchsten Grad des göttlichen Wohlgefallens zu erlangen (auf
diese Voraussicht ist dann die Einwohnung schon vom Augenblick
der Geburt an zurückzuführen).
Stoisch
ist
bei
vielen
Kirchenvätern
die
stärkere
Hervorkehrung des Sittlichen, dem Erkenntnismäßigen der
theoria gegenüber (das ist aber eine Wendung, die auch der
spätere Peripatos mitgemacht hat), stoisch ist vor allem der
Gedanke, daß die sittliche Vollkommenheit in der vollkommenen
Übereinstimmung des sittlichen Wollens mit dem Willen Gottes
(mit dem Weltgesetz, würde der Stoiker sagen), in dem
vollkommenen Ruhen in diesem Willen, in der synkatáthesis
besteht, wie der stoische Ausdruck lautet. Er "hatte mit Gott
einen Willen", war bei Paulus von Samosata die Formel für die
Vereinigung des Menschen Christus mit der Gottheit überhaupt,
und Theodor von Mopsuestia sagt: "Er war ihm durch die
Gleichheit des Willens verbunden."157 Der stoische "Weise" ist
eben derjenige, der einsieht und erkennt, daß alles nach dem
obersten Weltgesetz in unwandelbarer Notwendigkeit geschieht,
und der seinen Willen ganz dieser Notwendigkeit unterordnet,
das Weltgesetz ohne jedes Widerstreben und ohne jeden
Eigenwillen in sein eigenes Wollen aufnimmt, dadurch aber
selbst sein eigenes Wollen mit dem Göttlichen vereinigt und
"göttlich" wird, soweit dies eben in der Natur des menschlichGeistigen liegt, wenn es seine Aufgabe in der Welt und seine
ihm zugewiesene Rolle vollkommen erfüllt.
Hans Urs von Balthasar sah darin die größte christliche
Versuchung: "Zwei Richtungen also bedrohen vor allem die
christliche Endlehre: der vulgäre wie gelehrte Chiliasmus maßt
sich einen innergeschichtlichen Absolutheitsstandpunkt an,
zieht den Himmel auf die Erde herab, die naturalistische
Gnosis
stellt
den
Menschen
auf
den
jenseitigen
Absolutheitsstandpunkt, hebt ohne Sprung die Erde in den
Theodor v. Mopsuestia, in ep. S.Pauli comm. ed Swete, II, 311, ähnlich
M.P.G. 66, 989 D und 66, 992 C.
157
164
Himmel."158
Die
christliche
Häresie,
in
der
diese
Denkrichtung
159
vorherrschend wird, ist der Nestorianismus.
Diese
für
Antiochia
typische
Häresie
hängt
mit
der
aristotelisch-stoischen Denkweise eng zusammen.
(Daß dann der Nestorianismus gerade zur spezifischen Häresie
der ostsyrischen, dem Perserreich unterstehenden christlichen
Kirche wurde, hat seinen Grund in äußeren, geschichtlichen
Ereignissen. Die Rezeption des Aristotelismus im Syrertum hat
im übrigen auch die Fundamente gelegt für den syrischarabischen Aristotelismus, der später dem Westen die ersten
entscheidenden Impulse zur Rezeption des Aristotelismus in das
abendländische Geistesleben mitgeteilt hat, und lange Zeit die
Quelle war, aus der der Westen die aristotelischen Hauptwerke
kennen lernte, bevor sie noch unmittelbar aus dem Griechischen
übersetzt wurden.)
Die andere große
Monophysitismus160.
Häresie der Kirchenväterzeit ist der
Er
ist
aus
dem
alexandrinischen
Hans Urs von Balthasar, Apokalypse der deutschen Seele. Studie zu einer
Lehre von letzten Haltungen. Bd.I. Der deutsche Idealismus. SalzburgLeipzig 1937. S.26.
159 Nach Nestorios, 5.Jh.n.Chr., persischer Herkunft, 428 bis 431 Patriarch
von Konstantinopel, durch das Konzil von Ephesus auf Betreiben Kyrills von
Alexandreia abgesetzt; seine Lehre von den zwei Naturen in Christus wurde
von der Kirche für ketzerisch erklärt. Bruchstücke seiner (griechischen)
Schriften sind meist in lateinischer, syrischer, armenischer Übersetzung
erhalten. Die von ihm ins Leben gerufene kirchliche Bewegung der
Nestorianer lebt noch heute fort. Text: Fr.Loofs, Nestoriana, 1905.
160 Monophysitismus (aus móne physis = eine Natur) ist die Lehre von der
"einen Natur" in Christus, wie sie in der Diskussion und Reflexion über
das Verhältnis von Gottheit und Menschheit in Christus vom 4. bis zum 6.
Jh. von vorwiegend alexandrinischen Voraussetzungen aus entwickelt worden
ist. Der Ausgangspunkt ist das Kerygma über den Jesus, den einen
menschgewordenen Sohn Gottes, oder das Bekenntnis zur wahren Gottheit und
wahren Menschheit des einen Christus. Die theologische Reflexion will das
Wie dieser Einheit in Verschiedenheit erklären. Der Monophysitismus
betont, besonders dann im Gegensatz zu Nestorius, die Einheit unter
Beeinträchtigung der Verschiedenheit in Christus.
Die bekannteste Form des Monophysitismus ist der Arianismus und
Apollinarismus, wonach Christus nach dem streng verstandenen Logos-SarxSchema vertanden wird, d.h. Christus ist Logos und Sarx (Fleisch, Leib)
ohne menschliche (höhere) Seele, und zwar so, daß der Logos (bei den
Arianern ein höheres, aber geschöpfliches Wesen, bei den Apollinaristen
streng nizänisch als Gott verstanden) die Stelle der "(Geist-)Seele"
einnimmt und zum Lebensprinzip des Fleisches Christi und zur Quelle aller
geistigen, leiblichen Akte wird. Logos und Fleisch bilen zusammen die
"eine Natur (Physis, Hypostase) des fleischgewordenen Logos".
Einheit und Vrschiedenheit in Christus werden erst später mit Hilfe der
Unterscheidung von Person und Natur erklärt. - Klassische Definition von
"Person" nach Boethius (um 480-524), dem letzten Philosophen stoischen
Gepräges in der Antike, der großen Einfluß auf die mittelalterliche
Scholastik hatte: "Die Person ist die individuelle Substanz einer
158
165
Neuplatonismus herzuleiten. Es ist die Auffassung, die in der
Menschwerdung
Christi
nicht
eine
Verbindung
zwischen
Göttlichem und Menschlichem sieht, in der beide Elemente zwar
untrennbar, aber ohne Vermischung und Verwandlung verbunden
sind, so daß jedes der beiden seine eigenartige Natur
bewahrt,161 sondern die Menschwerdung als ein Aufgehen, ein
Aufgesogen- und Verwandeltwerden des in die Vereinigung
aufgenommenen Menschlichen in das aufnehmende Göttliche
betrachtet. Letzten Endes stammt das aus dem neuplatonischen
Spiritualismus und aus dem platonischen Mißtrauen gegen das
Materielle und das Menschliche.162
Denn die eigentliche
Konsequenz dieser Auffassung von der Menschwerdung ist ja der
Gedanke, daß auch das Werk der Erlösung nicht auf eine
Verbindung des Menschlichen mit dem Göttlichen, auf ein
"Überkleidetwerden" des Irdischen und Geschöpflichen mit dem
Gewand der Gnade und der Unsterblichkeit, sondern auf ein
Aufgesogenwerden des Geschöpflichen in das Göttliche hinzielt,
auf ein Ausgelöschtwerden des Irdischen durch das Göttliche,
da das Irdische, als dem Göttlichen wesenhaft entgegengesetzt,
in der Vereinigung mit ihm vor dem Göttlichen nicht mehr
bestehen
kann,
sondern
notwendigerweise
seiner
eigenen
Wesenheit "entkleidet" und in das Göttliche verwandelt werden
muß. Diese letzte logische Konsequenz aus der alexandrinischen
Geisteshaltung hat ja der Origenismus tatsächlich gezogen, und
eine "Heimholung" des Alls der geistigen Wesen (durch deren
Entfernung von Gott die materielle Welt erst entstanden ist),
ein Wiederaufgehen aller in die Einheit des Logos gelehrt, wie
sie "monistischer" selbst ein Plotin nicht vertreten hat.
Eutyches hat - nach dem Zeugnis des Theodoret im "Eranistes"
(M.P.G.
83,
153
D)
ausdrücklich
von
einem
"Aufgesogenwerden" (katapothenai) der Menschheit durch die
Gottheit
(theotes)
gesprochen,
das
nicht
ein
"Vernichtetwerden" (aphanismos), sondern eine Verwandlung ins
Wesen der Gottheit ist (ebendort, 157 A) und es kehrt sogar
der Vergleich des Tropfens im Meere wieder (153 D), worauf ihm
der "Orthodoxe" des Theodoret nicht unzutreffend antwortet:
"Das sind hellenische (d.h. heidnische) und manichäische
rationalen Natur". Damit ist ein Begriff dafür gefunden, daß das
Individuum nicht etwas bloß Akzidentelles, sondern etwas Substantielles
sein soll.
"Unvermischt, unverwandelt, ungetrennt, ungeschieden... jede Natur in
ihrer Eigenart verharrend", sagt das Chalcedonense.
162 "Sehr schlecht machst du, Gastfreund, das Menschengeschlecht", sagt
Megillos in den Gesetzen (804 B) zum athenischen Gast (=Platon) und in der
Politeia (515 A) sagt Sokrates, als er das Höhlengleichnis zu erzählen
beginnt, und ihm der Einwand gemacht wird: "ein sonderbares Bild
gebrauchst du, und sonderbare Gefangene schilderst du uns", zur Antwort
nur: "Solche, wie wir eben sind." Es ist überflüssig, noch viel bekanntere
Stellen wie das soma-sema-Motiv, den Sturz der Seele aus der himmlischen
in die irdische Sphäre oder die plotinische "Flucht des Einsamen zum
Einsamen" anzuführen.
161
166
Märchen" (ebenda).
Es ist die alte orphische, platonische und neuplatonische
Überzeugung, daß das Menschsein ein Abgefallensein von einem
höheren, geistigen Zustand bedeutet, das aufgehoben werden
muß, wenn sich das im Menschen lebende Geistige mit dem
Göttlichen vereinigen soll, weil das Menschliche, als solches,
ein Widergöttliches ist. Antik gedacht, kann man das
Verhältnis Geist-Materie und überhaupt Absolutum-Welt wirklich
nur
entweder
monistisch
fassen
und
das
Endliche
im
pantheistischen
Sinn
als
Manifestation
des
Unendlichen
betrachten - oder man faßt es als Dualität und betrachtet das
Materielle,
das
Endliche,
ja
das
Für-sich-sein
des
Geschöpflichen überhaupt als einen Abfall, der durch ein
völliges Aufgehen des Geschöpfes in ihm, ein Umgestaltetwerden
ins Göttliche aufgehoben werden muß.
Der christliche Begriff vom Geschöpf, das neben Gott steht,
nicht aus seinem Wesen ist und deshalb doch nicht etwas
wesenhaft Widergöttliches ist, sondern zu Gott emporgehoben,
von Gott durch seine Gnade verklärt werden kann, - das ist das
prinzipiell Neue am Christentum; Irenäus hat diesen Begriff
zum erstenmal in theologisch befriedigender Weise formuliert aber noch ohne das Rüstzeug der antiken Philosophie dazu zu
verwenden. Mit der Übernahme der antiken Philosophie ist dann
der christliche Seinsbegriff entscheidend bedroht worden - und
der Höhepunkt dieser Bedrohung ist eben der Monophysitismus.
In ihm hat sich - nachdem die geistigen Grundlagen für die
Überwindung dieser antiken Denkweise (mit Beibehaltung des
Wahrheitsgehaltes des Platonismus) durch die kappadokischen
Väter schon gelegt worden waren - der antike Seinsbegriff noch
einmal zu machtvollem Widerstand gegen die christliche
Auffassung vom geschöpflichen Sein erhoben und drohte, von
innen her das christliche Geistesleben zu zersetzen. Erst aus
dem siegreichen Kampf gegen diese Gefahr ist die eigentliche
orthodoxe Theologie hervorgegangen. Erst dort, wo die
irenäische163 Konzeption der Verbindung des Göttlichen mit dem
Geschöpflichen, der Verklärung des Geschöpflichen durch das
Göttliche sich gegenüber dem monophysitischen Aufgehen des
Geschöpflichen im Göttlichen durchgesetzt hat, kann man von
einer orthodoxen Theologie sprechen, die die innere Bedrohung
durch den hellenischen Seinsbegriff überwunden und die
Eirenaios, lat. Irenaeus, 2.Jh.n.Chr., aus Kleinasien, Bischof von Lyon
seit 178, bedeutender griechischer Kirchenschrift-steller. Von dem
Hauptwerk "Prüfung und Widerlegung der falschen Gnosis ("Adversus
haereses" genannt) sind im Original nur Bruchstücke erhalten, größere
zusammenhängende Teile in einer alten lateinischen Übersetzung; es will
zeigen, daß die wahre Lehre der Kirche von der Zeit der Apostel her sich
rein fortgepflanzt hat, dagegen von den Gnostikern verfälscht wurde, und
ist als Quelle unserer Kenntnis der Gnosis und als Zeugnis der
Kirchengeschichte von größtem Wert. Text: W.Harvey, 1957. - Übers.: H.Haid
I.II, 1872.73.
163
167
hellenische Philosophie zum Ausdrucksmittel des christlichen
Weltgefühls gemacht hat. Man kann, von diesem Gesichtspunkt
her gesehen, die geistesgeschichtliche Bedeutung der Worte:
"unvermischt und unverändert", mit denen das Chalzedonense die
Form der Vereinigung des Menschlichen mit dem Göttlichen
umschreibt, gar nicht hoch genug veranschlagen.164
Göttliche Vorsehung (Kausalität, Freiheit)
Zu 154-167: Die göttliche Fürsorge für den Menschen
mit den zwei Thesen des Balbus:
154-161: Die Welt ist der Götter und Menschen wegen
geschaffen.
162-167: Die Götter sorgen für das Menschengeschlecht im
ganzen wie im einzelnen.
omnia hominum causa facta (II 154) - diesen stoischen Gedanken
bringt Cicero auch Fin. III 67: Praeclare Chrysippus cetera
nata esse hominum causa et deorum, eos autem communitatis et
societatis suae ("Sehr treffend sagt Chrysipp, alles übrige
sei um der Menschen und Götter willen geschaffen, diese
<selbst> aber zu ihrer gegenseitigen Gemeinschaft und
Verbundenheit.") Auch Off. I 22: Ut placet Stoicis, quae in
terris gignantur, ad usum hominum omnia creari ("...wie die
Stoiker glauben, daß alles, was auf Erden entsteht, zum Nutzen
der Menschen geschaffen werde.") Er klingt noch bei Laktanz
an, vgl. De ira 14: Vera est sententia Stoicorum, qui aiunt
nostra causa mundum esse constructum: omnia enim, quibus
constat mundus, ad utilitatem hominis accomodata sunt
("Richtig ist die Meinung der Stoiker, die die Behauptung
aufstellen, die Welt sei unsertwillen geschaffen worden: denn
alles, woraus die Welt besteht, sei dem Nutzen des Menschen
angepaßt.") Noch heute sprechen Naturwissenschafter vom sog.
"anthropischen Prinzip" in unserem Kosmos.
mundus communis deorum atque hominum domus (ebd.): Im Weisen
ist dieselbe Vernunft, die in der Natur liegt, zur
vollkommenen
Entfaltung
gelangt;
durch
sie
ist
die
Gemeinschaft mit den Göttern gegeben, so daß beide in der
Gemeinschaft des Rechts stehen und das All als der gemeinsame,
unter der Herrschaft des höchsten Gottes stehende Staat der
Götter und Menschen anzusehen ist. Ausführlich wird der
Gedanke Fin. III 62 abgehandelt: "Von Natur aus sind wir
veranlagt zu Vereinigung, Gesellschaft und Staatsgemeinschaft.
Das Weltganze aber, lehren die Stoiker, wird regiert durch den
Willen der Götter, und dieses ist gleichsam die umfassende
Endre von Ivánka, Hellenisches und Christliches im frühbyzantinischen
Geistesleben. Wien 1948, 97f.
164
168
Stadt- und Staatsgemeinschaft der Menschen und der Götter, und
jeder einzelne von uns ist ein Teil dieses Weltganzen. Daraus
leitet sich von Natur die bekannte Verpflichtung her, daß wir
das
Interesse
der
Gemeinschaft
unserem
Privatinteresse
überordnen."
Die stoische These: mundus deorum hominumque causa...inventa
sunt (ebenso die globale Aussage II 80: nihil nec maius nec
melius mundo) wird angegriffen und stark in Zweifel gestellt
bei Lukrez (V 195-221); besonders gilt das für V 195-199:
Quod<si> iam rerum ignorem primordia quae sint,
hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim
confirmare aliisque ex rebus reddere multis,
nequaquam nobis divinitus esse paratam
naturam rerum; tanta stat praedita culpa;
Wenn ich die Natur ursprünglicher Stoffe nicht kennte,
würd' ich mir doch getraun, aus des Himmels Beschaffenheit
selber dreist zu behaupten und noch aus mehreren anderen
Gründen, dieser Dinge Natur, mit so großen Mängeln
behaftet,
sei kein göttliches Werk, allein für den
Menschen bereitet.
Cicero selbst läßt im dritten Buch De natura deorum Cotta
ausführlich Gegengründe ausbreiten. Zunächst (20-64) gegen die
Göttlichkeit des Kosmos:
20-28
Die
Göttlichkeit
des
Kosmos
ist
aus
seiner
Vollkommenheit nicht zu beweisen; die Stoiker verwechseln
Naturkraft und Vernunft.
29-34 Ein körperliches, lebendes und äußeren Eindrücken
unterworfenes Wesen
kann nicht ewig, mithin auch nicht
göttlich sein.
35-37 Das stoische pyr technikón kann nicht unvergänglich,
also auch nicht göttlich sein.
38-39 Der Begriff der Tugend ist unvereinbar mit dem Wesen
Gottes.
40-64 Die Fragwürdigkeit der Ansichten über das Wesen der
Götter vom stoischen Gottesbegriff bis zu den falschen
Vorstellungen über das Wesen der Volksgötter.
Danach wird die göttliche Fürsorge für den Menschen widerlegt:
65-78 Das Denkvermögen kann nicht als eine gute Gabe der
Götter angesehen werden.
79-88
Die
göttliche
Fürsorge
für
die
Menschen
ist
unzureichend, denn
80-81 Die Götter sorgen nicht für das Wohl der Guten;
82-84 die Götter treten dem Bösen in der Welt nicht
entgegen;
85 das Gewissen regiert den Menschen unabhängig vom
göttlichen Willen;
169
86 der Mensch vermißt die göttliche Gerechtigkeit auch
in den wichtigsten Dingen;
87-88 das Glück der Schlechten widerlegt die Macht der
Götter über den Menschen.
89-92 Die göttliche Vorsehung kennt ihre Macht nicht oder
kümmert sich nicht um den Menschen oder vermag nicht zu
erkennen, was das Beste ist.
93
Die
angeblich
von
den
Göttern
geschickten
Träume
widersprechen der stoischen Behauptung, die Götter kümmerten
sich nicht um den Einzelnen.
Zum besseren Verständnis der Thematik empfiehlt es sich, ein
Originaldokument stoischer Religiosität heranzuziehen, nämlich
den Zeushymnus des Kleanthes. Zeus wird hier mit polyónyme
(„vielnamiger“) angesprochen. Aristotels hatte gesagt. Tò òn
pollachôs légetai.165 Gott hat wie das Seiende viele Namen.
Einer seiner Namen ist ja: ho ón (vgl. die Szene mit Moses und
dem brennenden Dornbusch in der Septuaginta-Übersetzung). Für
den Stoiker ist Gott das aktive geistige Prinzip, das die
Materie durchdringt, belebt und bewußt gestaltet. Gott ist die
schöpferische Urkraft, die erste Ursache alles Seins. Er ist
der Logos, der die vernünftigen Keimkräfte aller Dinge in sich
trägt. Gott ist mit der Materie unlöslich verbunden und kann
ebenso feuriger Geist wie denkendes Feuer genannt werden. Er
ist der Welt immanent, ist ihre Seele. Er ist das Pneuma, das
alles durchdringt und selbst im niedrigsten Stoff gegenwärtig
ist. Lauter Namen Gottes.
Die Identifikation Kosmos/Gott ist ganz griechisch, dieses
Staunen, diese fromme Verehrung für die Welt, wie sie sich dem
Schauenden darbietet, dieses weltfromme Gefühl, das in der
deutschen Klassik so treffend nachgefühlt worden ist, etwa in
den Worten des Lynkeus bei Goethe: "Zum Sehen geboren, zum
Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt.
... Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehn, es sei wie es
wolle, es war doch so schön."
Eine Konsequenz ist, daß Theologie zur Kosmologie wird. Und es
deutet sich schon an, was später zum Durchbruch kommen wird:
Anthropologie als dritte im Bunde. Denn bei den Stoikern ist
der Mensch in Theologie und Kosmologie schon immer mit im
Spiel - durch den Logos.
Im Neuplatonismus kommt dann der platonische Abbildgedanke
hinzu, d.h. der menschliche Logos wird als Abbild des
göttlichen
begriffen,
womit
die
Grundkozeption
der
christlichen theologischen Anthropologie harmoniert, die es
erlaubt, jeweils die Steigerung der Transzendenz mit der
Steigerung der Immanenz zu koppeln; zugleich liegt darin der
Systemkonflikt zwischen Transzendenz und Rationalität, der die
Vgl. Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung
Aristoteles, Freiburg i.Br. 1862, ND Darmstadt 1970.
165
des
Seienden
nach
170
Geschichte der mittelalterlichen Scholastik durchzieht. (Sie
stand
einerseits
unter
dem
Motiv
der
Steigerung
der
Transzendenz Gottes, war anderseits auf die Durchführung des
Programms
der
Gottesbeweise
und
der
natürlichen
Gotteserkenntnis festgelegt.) Der Abbildgedanke wird überhöht
durch die geheimnisvolle Einheit von creator und creatura in
der hypostatischen Union, die sich aus der Inkarnation, aus
dem Logos sarx ergibt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Wir haben es hier bei Cicero mit einer weiteren Konsequenz der
stoischen
Auffassung
zu
tun:
mit
Kausalbestimmtheit,
Zielbestimmtheit,
Determination
einerseits,
Freiheit
anderseits.
Die Vernunft ist sich selbst der letzte Zweck, d.h. sie strebt
danach, sich selbst möglichst vollkommen zu verwirklichen und
zu erhalten. (Selbsterhaltung - oikeíosis kommt auch in dieser
Hinsicht zur Geltung). Nun ist sie in der Welt am
vollkommensten realisiert in der persönlichen Vernunft der
vernunftbegabten Wesen, und um diese zu erhalten und zu
mehren, ist alles übrige organisiert. Die persönliche
Vernunft, die sich in den einzelnen Seelen entwickelt, ist
also der höchste Zweck der Welt, ganz im Sinn des
hellenistischen Individualismus.
Konsequenterweise faßten die Stoiker auch die Weltvernunft als
persönliche Vernunft auf, woraus sich erklärt, daß sie sie als
Gott ansprachen und mit Zeus identifizierten und daß sie die
Welt als ganze nach dem Muster des Menschen zu einem mit einer
vernünftigen Seele begabten Lebewesen machten.
Daraus läßt sich vielleicht verstehen, was zur Ausbildung der
stoischen Lehre von der göttlichen "Vorsehung", der prónoia,
geführt hat. Ich glaube, daß von daher der Anthropozentrismus
dieser Vorsehungslehre verständlich wird. Anthropozentrismus
meint: die Welt ist um der vernünftigen Wesen, der Götter und
Menschen, willen da, und zu ihrem Besten ist alles
eingerichtet. Das wurde mit vielen Argumenten zu belegen
versucht. Sie haben das beinhart durchgezogen, ohne Angst vor
Lächerlichkeiten (was sich übrigens in der europäischen
Aufklärung wiederholt hat): Chrysipp wußte sogar, daß auch die
Schädlinge dem Menschen dienen, denn die Wanzen verhindern
z.B., daß wir zu lange schlafen, und die Mäuse, daß wir unsere
Sachen nachlässig verwahren...
Man berief sich z.T. auch auf den Gottesbegriff. Weil die
Venunft als weltgestaltendes Prinzip auch persönliche Gottheit
ist, kann man argumentieren, daß eine Gottheit, die nicht
zweckmäßig und vorsorgend handelt, nicht denkbar sei. (SVF II,
1106 sqq.).
Die Welt wird also durch göttliche Vorsehung regiert, und zwar
171
gibt es nur einen Gott, eben die in allen Dingen wirkende und
formende
Vernunft.
Trotzdem
wollten
die
Stoiker
die
Volksreligion mit ihrem Polytheismus keineswegs angreifen,
sondern sie versuchten, sie mit ihrem Pantheismus in Einklang
zu bringen, indem sie die griechischen Götter allegorisch
erklärten als verschiedene Erscheinungsweisen der einen und
selben Vernunftgottheit, die fälschlich für selbständige
Götter gehalten wurden.
Reformismus ist den Stoikern ferngelegen. Der stoische Weise
folgt wie jeder normale Bürger den religiösen Riten und
Gebräuchen seines Landes, nur daß er tiefer blickt und ihr
wahres Wesen durchschaut. (SVF II, 1008 sqq.).
In der Neuzeit wurde die antike Geistspekulation in der
Subjektivitätsphilosophie von Descartes bis Kant und Fichte
überhöht. In Kants Kritik der praktischen Vernunft (1788) hat
das Vernunftethos der Stoa den konsequentesten Ausdruck
gefunden. Aber niemnd hat so entschieden, so großartigeinseitig wie G.W.F.Hegel (1770-1831) die Intellekt-Struktur,
die Geistbestimmtheit des Menschen, die für die Stoa zentral
war, wiederzufinden vermeint in den logischen Strukturen der
Wirklichkeit überhaupt, in der Kulturgeschichte der Menschheit
und im Wesen und Wirken des Gott-Geistes selber. Noch auf den
Kopf gestellt im Diamat hat der Glaube an die logischen
Strukturen der Wirklichkeit bzw. deren Behauptung als
Machtposition seine ungeheure Wirkung gehabt. Es wurden ihm
nicht weniger Hekatomben Menschenopfer dargebracht als im von
den Nationalsozialisten angezettelten Weltkrieg umgekommen
sind. (Ich erwähne das nur, weil durch diesen Zusammenhang
deutlich wird, wie auch der schrulligste Philosoph in seiner
Studierstube, ohne es zu wollen und ohne es zu ahnen, das
Weltgeschehen mitbestimmt. Insofern haben die Stoiker doch
recht gehabt.
Wenn die Vernunft das wirkende und formende Prinzip ist, das
allein irgendwelche Schranken setzen kann, dürfen diese
Schranken nicht von außen, etwa vom Stoff auferlegt werden,
sondern müssen in ihr selbst liegen. So kann man sich denken,
daß die Stoiker zur Vorstellung von der Vernunft als einer
gesetzmäßig wirkenden Kraft kamen; sie kann bei ihrem Schaffen
nicht beliebig verfahren, sondern ist in allen ihren
Handlungen an unveränderliche Gesetzmäßigkeiten gebunden.
Übrigens ist diese Theorie nicht von heute auf morgen
entstanden, sondern hat Wurzeln zumindest bis zu Heraklits
Wort: "Es nähren sich alle menschlichen Gesetze von dem einen
göttlichen" (frgm. 114); vgl. auch Platons Verteidigung des
nómos - er ist physei, und Plato erhebt ihn zur Gottheit, vgl.
Ep VIII 354 e.
Die
Vorstellung
der
Gesetzmäßigkeit
war
für
die
Stoiker
172
verbunden mit dem Begriff der Heimarmene, des Schicksals, in
dem sich der griechische Glaube ausdrückt, daß alles Geschehen
in der Welt genau vorherbestimmt und unentrinnbar sei. Dieser
Glaube ließ sich durch die Annahme der Gesetzmäßigkeit der
Natur stützen, denn wenn alle Vorgänge nach strengen,
unabänderlichen Gesetzen verlaufen, dann sind durch die
Ereignisse zu einem beliebigen Zeitpunkt die Ereignisse zu
jedem anderen Zeitpunkt genau festgelegt. Ein Zufall ist
ausgeschlossen, unter diesem Namen verbirgt sich nur unsere
Unkenntnis der Gesetzmäßigkeiten. (Spinoza: von Zufall kann
nur die Rede sein respectu defectus nostrae cognitionis).
Gesetzmäßigkeit wird von den Stoikern mit dem Begriff der
Kausalität gefaßt. Und Kausalität ist als eine Funktion zu
interpretieren: Ursache ist das, durch das die Wirkung
entsteht. Und das ist dann der Fall, wenn es unmöglich ist,
daß die Ursache gegeben ist, die Wirkung aber nicht eintritt.
Im Begriff der Ursache wird also eine notwendige Verknüpfung
der Dinge gedacht, so daß auf das eine unausbleiblich das
andere folgt. Wenn nun die Vernunft in all ihrem gestaltenden
Schaffen an eine solche Ordnung gebunden ist, so daß nichts
ohne Ursache geschieht, dann ergibt sich, daß alle Dinge in
einer unausweichlichen Verflechtung zusammenhängen, indem für
alle Zeiten festliegt, was auf was folgt.
Infolgedessen
nannten
die
Stoiker
die
Heimarmene
die
"unverbrüchliche Reihe der Ursachen" (wobei sie das Wort von
heirmós, "Reihe", ableiteten.) Dafür hatten sie v.a. zwei
Begründungen: Sie verwiesen erstens auf die Mantik, deren
Möglichkeiten
sie
offenbar
als
Erfahrungstatsache
akzeptierten, und zweitens beriefen sie sich auf den logischen
Grundsatz vom ausgeschlossenen Dritten. - Da jede Aussage
entweder wahr oder falsch ist, so auch eine Aussage über die
Zukunft. Das sei aber nur denkbar, wenn heute schon feststehe,
was morgen geschehe.166
Durch ihre Auffassung von der kausalen Determiniertheit des
Weltgeschehens (Kausal-Determinismus) haben die Stoiker ihren
ethischen Grundsatz abgesichert, daß die äußeren Dinge
unverfügbar seien, weil der Determinismus die Möglichkeiten
der Vernunft band. Darüber hinaus ergab sich daraus ein
willkommenes Argument für die Theodizee. Denn natürlich blieb
der Glaube an die Zweckmäßigkeit der Welt, in der alles zum
Besten
des
Menschen
eingerichtet
sein
sollte,
nicht
unwidersprochen. Man brauchte ja nur den Blickwinkel leicht zu
ändern, um die Welt als höchst unzweckmäßig und ihren Schöpfer
als Schwachsinnigen oder Stümper erscheinen zu lassen. Die
Gnostiker, für die das in besonderem Maß zutrifft, haben den
SVF I, 176. II, 965 sqq. I, 89. II, 1000. 945 sqq. 917 sqq. 939 sqq.
952 sqq.
166
173
demiurgós konsequent als böses Prinzip aufgefaßt.
Die Stoiker hatten zwar mit den äußeren Übeln keine
Schwierigkeiten, weil diese in ihren Augen keine Übel, sondern
adiáphora waren. Aber sie konnten natürlich den Mangel an
Tugend, das Vorhandensein der Untugenden, den Mangel an
sittlicher Einsicht nicht leugnen, sonst wäre ja auch ihr
eigenes Streben, die Menschen durch Philosophie erst zum Guten
zu bekehren, überflüssig gewesen. Der platonische Ausweg, die
Schuld dem Stoff anzulasten, dessentwegen eine makellose Welt
nicht realisierbar sei, war ihnen versperrt, denn das hätte
bedeutet, daß der Stoff nicht vollkommen eigenschaftslos und
die Vernunft nicht das allein bestimmende Prinzip wäre. Das
Übel mußte also seinen Ursprung schon in der Vernunft haben.
Und hier bot der Determinismus Hilfe.
Wenn die Vernunft gesetzmäßig handelt und die Gesetze aus ihr
selbst stammen müssen, dann sind diese die Gesetze des
vernünftigen Denkens, wie sie die Logik entwickelt. Nun ist es
ein logisches Gesetz, daß der Begriff des Guten nicht ohne den
des Übels möglich ist, ebenso wenig wie das Wahre ohne das
Falsche gedacht werden kann. Folglich, da die Vernunft die
Welt schafft, muß es das Übel geben.
Was steckt darin für ein Denkfehler? Offenbar wird ein
logisches
Prinzip
mit
einem
ontologischen
durcheinandergebracht. Man muß sie aber in Schutz nehmen, denn
für sie ist das keine naive Verwechslung, sondern durchaus
konsequent, da sie ja in der Vernunft die allein formgebende
Kraft sahen; denn dann ist, was logisch notwendig ist, auch
ontologisch notwendig.
Der Kausal-Determinismus hat aber einen großen Nachteil. Er
verträgt sich eigentlich nicht mit der teleologischen
Weltdeutung, weil er die Freiheit, die Voraussetzung jeder
Zwecksetzung, undenkbar macht.
Diese Schwierigkeit wird von den Stoikern nicht thematisiert.
Sie waren sich zwar darüber im Klaren, daß, wenn alles
Geschehen
durch
vorhergehende
Ursachen
vollständig
determiniert ist, kein Raum für die freie Entscheidung bleibt,
aber sie haben sich nicht Rechenschaft darüber abgelegt, daß
die
Entscheidungsfreiheit
im
Begriff
der
Zwecksetzung
impliziert ist, so daß von einer teleologischen Struktur
sinnvoll nur in einer Welt gesprochen werden kann, in der auch
Freiheit, und zwar nicht so, wie sie sie interpretieren,
sondern
wirkliche,
völlig
undeterminierte
Wahlfreiheit
zwischen Alternativen, möglich ist.
Für die Stoiker waren prónoia und heimarméne, zwecktätige
Vorsorge und kausale Determination, nur verschiedene Aspekte
174
ein und der selben Struktur (SVF I, 176. 160.)
Die Stoiker sind hier ihrem ethischen Bedürfnis gefolgt:
Einerseits wollten sie, daß die zwecksetzende Vernunft als das
herrschende Prinzip in der Natur dargestellt wird, anderseits
wollten sie, daß die Unverfügbarkeit des Naturgeschehens
verständlich bleibt. Diese Annahme führte ja zur Auffassung,
daß der einzelne nur dann glücklich wird, wenn er sich in der
Natur keine Zwecke setzt, so daß sich das Paradoxon ergab, daß
der einzige Zweck, den man sich setzen soll, der ist, daß man
sich keine Zwecke setzen soll.
Darin liegt der Grund, weshalb die Stoiker den Determinismus
trotz aller Schwierigkeiten so konsequent durchzuhalten
suchten und den Fatalismus so weit trieben, daß auch sämtliche
Handlungen der vernunftbegabten Wesen vorherbestimmt seien.
Die aus heutiger Sicht mangelhafte Argumentation der Stoiker
hat - das muß man zu ihrer Ehrenrettung auch sagen - etwas für
sich, und das ist die Nähe zum Phänomen. Das Phänomen des
Glücks ist so ein paradoxer Tatbestand: Es soll dem Wunsch und
Willen entsprechen und doch durch den Willen nicht erreichbar
sein. Paradox wie die tachistische Malerei, in der das
Unwillkürliche als Mittel zur Freisetzung der Kunst dient.
Paradox wie das interesselose Wohlgefallen, wie die "GratisTat", die einmal jemanden (in einem Roman des ausgehenden 19.
Jh.) so fasziniert hat, daß er damit experimentierte, und z.B.
jemand
Wildfremden
auf
der
Straße
gleichzeitig
einen
Tausendfranc-Schein in die Hand drückte und gleichzeitig eine
Ohrfeige herunterhaute.167
Ich
verweise
nur
noch
darauf,
daß
an
der
Kausalitätsproblematik die Annahme eines ersten Bewegers des
Kosmos hängt. Für die Stoiker ist das die Weltvernunft, die
dem ganzen Kosmos, dem auch alle Menschen angehören, einwohnt
und seine Zwecke bestimmt. Und zweitens, daß daran das Problem
der Willensfreiheit des Menschen hängt. Die Stoiker standen
vor dem Problem, sie zu retten, da sie ja in ihrem Weltbild
ausgeschlossen zu sein schien. Sie mußten sie aber unter allen
Umständen sichern, denn für sie bestand doch das Glück in der
Erreichung der Zwecke, die man sich selbst gesetzt hat. Es
durfte nicht denkunmöglich werden, daß der Mensch sich
überhaupt eigene Zwecke setzen kann. Sie haben das Problem
unter dem Begriff des eph' hemîn („bei uns“, d.h. in unserer
Macht liegend) verhandelt. D.h. die entscheidende Frage
lautete: Gibt es etwas, das "an uns" liegt? Nun, viel weiter
als bis zu dieser Frage sind sie auch nicht gekommen. Aber
schließlich ist das Freiheitsproblem hier im Hellenismus zum
Joris Karl Huysmans, A rebours, 1884. Deutsche Übers.: Gegen
Strich. (Übers.v.Hans Jacob). Berlin (Benjamin Harz Verlag) 1903.
167
den
175
ersten Mal bewußt geworden. (Bild von der Walze, deren eigene
Beschaffenheit verursacht, daß sie, gestoßen, rollt; Bild vom
Hund, der an einen Wagen gebunden, seinen eigenen Willen mit
dem Zwang verbindet, mitzulaufen, sonst würde er eben nur
gezogen. D.h. der Stoiker denkt die Freiheit um: sie falle in
Wirklichkeit mit der Notwendigkeit zusammen. Damit wir können,
was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können...
Schopenhauer hat in seiner berühmten Preisschrift "Über die
Freiheit des menschlichen Willens" die Behauptung aufgestellt,
die Alten hätten eines der "tiefsten und bedenklichsten
Probleme der neueren Philosophie" - gemeint ist die Frage nach
der freien Entscheidung - "noch nicht zum deutlichen
Bewußtsein gebracht". Diese Feststellung mag zutreffend sein,
wenn der antiken Betrachtung die kaum übersehbare, verästelte
Problemanalyse der Gegenwart gegenübergestellt wird. Eine in
unseren Augen auch nur annähernd erschöpfende Behandlung der
Willensfreiheit in ihren komplexen Bezügen zu Psychologie,
Ethik, Metaphysik und Religion fehlt dem Altertum tatsächlich.
Die Schopenhauersche Behauptung ist aber kaum haltbar, wenn
wir nach dem Problembewußtsein fragen. Hier läßt sich leicht
zeigen, daß die grundsätzliche Frage schon in der Antike mit
aller
Dringlichkeit
gestellt
und
bedacht
worden
ist;
wesentlich ist, daß die Frage überhaupt entdeckt worden ist.
Diese Entdeckung ist nicht schon in den Anfängen der
Philosophie zu suchen. Das Problem hat sich erst später
ergeben, als eine unvorhergesehene Konsequenz, nachdem andere
Probleme der Philosophie scheinbar bewältigt worden waren. Es
hat
sich
eine
Kluft
aufgetan,
als
man
verschiedene
Themenbereiche zu einer Einheit zusammenfassen wollte.
Es
ist
eine Aporie, in die der Mensch durch sein
Grundverhalten kommt, wenn er die Welt bewältigen will. Als
erkennendes Wesen ist er darauf angewiesen, Gesetzmäßigkeiten
zu finden, er will Ordnung schaffen, im Chaos den Kosmos
sehen; als tätiges Wesen aber soll er seiner spezifischen
Natur entsprechend freie Entscheidungen treffen - und eines
Tages entdeckt er, daß die Forderung nach einer irgendwie
geordneten Welt seinem ebenso primären Anliegen, frei zu
handeln, widerstreitet, weil auch seine Handlungen der
gesuchten Ordnung verfallen müssen.
Zwei
elementare
Voraussetzungen
geraten
miteinander
in
Konflikt: das Axiom des bíos theoretikós stellt die Basis des
bíos praktikós in Frage und umgekehrt; und je reicher die
beiden Bereiche entwickelt sind, um so größer wird das
Dilemma, so daß alles Bemühen darauf gerichtet sein muß, die
Kluft zu überbrücken. Dieses Ringen hat etwas Unheimliches,
weil es plötzlich wieder an den Anfang zurück wirft und alles
bisher
Erreichte
als
nichtig
erscheinen
läßt.
Die
Philosophiegeschichte erweist sich denn auch unter diesem
Gesichtspunkt als nicht abreißende Kette von Versuchen, den
176
Graben zu schließen, ohne daß das Anliegen je etwas von seiner
Dringlichkeit verloren hätte. (Das Dilemma gipfelt in der
negativen Dialektik Adornos, die man auf den trivialen Punkt
bringen kann: "Wie man's macht, ist's falsch.")
Werfen wir einen Blick auf die Neuzeit: Die Freiheit ist das
Programm der neuzeitlichen Humanität. Befreiung des Menschen
vom Aberglauben und politischem Zwang begründet und fordert
Spinoza mit Leidenschaft in der ersten großen Freiheitsschrift
der Neuzeit, im "Theologisch-politischen Traktat" von 1670. In
diesem Traktat übt Spinoza eine fundamentale Bibel- und
Religionskritik wie auch eine Staatskritik, deren Grundzüge
bis heute gültig sind. Er nimmt sich selber die libertas
philosophandi, die er der Obrigkeit abfordert, und zeigt, daß
die Freiheit weder den Staat noch Glauben und Religion
beeinträchtigt, daß vielmehr die Anerkennung der Freiheit
beide in Wahrheit ermöglicht. Seither ist Freiheit ein
zentrales Thema der Philosophie wie der Politik. Gleichwohl
ist sie alles andere als selbstverständlich gewesen. Überall
muß Freiheit begründet und überall muß sie erkämpft werden.
Die Reflexion des Begründungszusammenhangs wie auch der
revolutionäre Kampf dauern fort. Aber sie halten ihrerseits
einen Fallstrick für die Freiheit bereit; denn durch die
Begründung, wenn sie schlüssig sein soll, wird ein System der
Notwendigkeit konstituiert, das zwar dem Aberglauben keinen
Raum mehr läßt, aber auch die Freiheit in Frage stellt.
Freiheit, die sich als notwendig begründet, restringiert sich
selbst und beschränkt sich schließlich auf ein Anerkennen der
Notwendigkeit. Der revolutionäre Kampf um die Freiheit aber
kann nicht umhin, Zwang und Gewalt auszuüben, und nicht selten
endete dieser Kampf mit der Errichtung eines neuen, vielfach
radikalisierten Zwangssystems. Beides aber, die Anerkennung
eines Systems der Notwendigkeit wie auch die Hinnahme eines
neuen Systems des politischen Zwangs, widerspricht der
Freiheit. Die Vernunft gerät mit ihrem unbedingten Streben
nach Freiheit mit sich selbst in theoretischen und praktischpolitischen Widerspruch. Gerade Systeme der Notwendigkeit wie
die
Mathematik
und
die
Metaphysik,
aber
auch
die
Wissenschaften von der Natur oder die historisch überkommenen
und unerschütterlich erscheinenden Ordnungen der Sitte und der
Gesellschaft, nicht zuletzt die politische Macht des absoluten
Monarchen oder des totalitären Staates haben ie Freiheit
herausgefordert und sind durch die Forderung nach Freiheit in
Frage
gestellt
worden.
Die
Neuzeit,
die
Epoche
der
Selbstbefreiung des Menschen, ist durch einen bisher nicht
aufgehobenen Widerspruch gekennzeichnet.
In der Antike ist eine erste Periode vornehmlich dem Erkennen
einer kosmischen Ordnung hingegeben, da ist es einleuchtend,
daß die Frage nach der Willensfreiheit noch nicht auftaucht.
177
Erst die Zeit der Sophisten und des Sokrates, die menschliches
Tun zum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung macht, legt
die Grundlagen zur Erfassung der Willensfreiheit. Allerdings
bleibt
die
Diskussion
im
Bereich
der
ethischen
und
psychologischen, d.h. der Wahlfreiheit stehen. Dasselbe gilt
auch für Aristoteles, welcher der Wahlfreiheit die bekannten
Kapitel in der Nikomachischen Ethik widmet, ohne aber zur
metaphysischen Freiheitsfrage vorzustoßen. (Da hätte er
nämlich fragen müssen, wie sie sich mit seinem sonstigen
Weltdeterminismus vereinbaren läßt.) Bei Plato, v.a. im
Schlußmythos der Politeia, ist eine gewisse metaphysische
Verankerung zu finden, in dem Sinn, daß eine präexistentielle
Lebenswahl postuliert wird, auf die dann eine dem Zwang
verfallene
Daseinsform
folgt.
Es
war
aber
erst
der
Neuplatonismus, der den Mythos im Sinn einer bewußten Antwort
auf die Willensfreiheitsfrage gedeutet hat. Bei Platon bleibt
es noch unausdrücklich, aber daß er die freie Entscheidung in
irgendeiner Form voraussetzt, gehört zum Wesen seiner
Philosophie.
In ihrer ganzen Schwere ist die Problematik, ob der Mensch in
seinen Entscheidungen wirklich frei sei, erst von der Stoa
erfaßt worden, wobei v.a. durch die Kontroversen mit den
übrigen
Schulen,
den
skeptischen
Akademikern
und
den
Epikureern, die Schwierigkeit ins volle Bewußtsein rückte.
Einerseits
können
ja
die
Stoiker
nicht
genug
die
Zwangsläufigkeit des Weltgeschehens betonen, in dem - mit
Ausschluß des Zufalls - eine unverbrüchliche Kausalität
herrschen soll, anderseits ist die Bestimmung des Menschen als
eines sittlich, d.h. frei handelnden Wesens eines ihrer
dringlichsten Anliegen, und die Gegner haben denn auch den
Widerspruch, der sich aus den zwei Postulaten ergibt, mit
Vehemenz herausgestellt, was natürlich die Stoiker veranlaßte,
mit größtem Aufwand an Scharfsinn die Vereinbarkeit beweisen
zu wollen. Allerdings konnten sie in der Freiheit nicht mehr
als die innere Zustimmung / synkatáthesis zum äußeren
Geschehen fassen. Bekannt ist diese stoische Lehre von der
synkatáthesis für uns v.a. in jener überspitzten Sentenz des
seneca: ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Die Schwierigkeit der stoischen Verteidigung war besonders
groß, weil das vorausgesetzte Weltbild die Vereinbarkeit der
beiden Forderungen fragwürdig erscheinen ließ. Einmal galt es,
die Freiheit des sittlichen Wesens gegen die series causarum,
zusammengefaßt in der heimarméne, dem fatum, sicherzustellen.
Sie halfen sich mit der Unterscheidung von Haupt- und
Nebenursachen, die dem Menschen das Mitspielen im Kausalgefüge
ermöglichen sollten, während Epikur, um die Freiheit zu
retten, die er als unmittelbare Erfahrungstatsache ansah, in
seinem System das feste Kausalgefüge opferte und dem
178
ursachelosen Zufall eine Stelle einräumte, populär geworden in
seiner von den Gegnern verspotteten Theorie der Deklination
der Atome aus der geraden Fallrichtung.
Das stoische Weltbild erschöpft sich aber nicht nur in einem
Kausalgefüge. Die im fatum vereinten Kausalreihen sind
gleichzeitig Ausdruck einer zweckgerichteten, planvollen
Schöpfung der göttlichen prónoia, der providentia. Im
stoischen Weltbild steht kausales Geschehen im Dienst eines
finalen. Im kausalen Naturzusammenhang fassen wir auch Gott.
Damit brechen zwei neue Schwierigkeiten auf. Nach dem
consensus gentium ist Gott, sofern man sein Wesen analog dem
unseren
in
einen
bíos
praktikós
und
theoretikós
auseinandelegt, allmächtig und allwissend. Diese beiden
Eigenschaften
Gottes
aber
stehen
im
Widerspruch
zur
Willensfreiheit. Ein Gott, der alles ordnet, und nach einem
festen Plan prädestiniert, schließt eine autonome Entscheidung
des Menschen aus. Hier bricht zudem das aufregende Problem der
Theodizee auf: Gott trägt, wenn der Mensch in seinem Handeln
unfrei ist, auch die Verantwortung für das Böse unseres Tuns.
Nicht minder aber ist die Freiheit der Entscheidung durch
Gottes Allwissen gefährdet, zu dem, soll es vollkommen sein,
selbstverständlich auch das Wissen um die Zukunft gehört.
Damit aber wird wiederum unsere Freiheit zur bloßen Fiktion,
weiß doch Gott zum voraus, wie unsere Entscheidungen ausfallen
werden. Die Diskussion hat sich vor allem bei der Erörterung
der Mantik ergeben, denn durch Zeichen und Orakel kann der
allwissende Gott auch dem Menschen einen Blick in die Zukunft
verstatten. (Ein heute noch weit verbreiteter Glaube, denn
viele Zeitungen widmen ihm täglich eine Spalte.)
Aus der Verschlingung der Probleme des fatum (das den Zufall
negiert) und der providentia hat sich im Altertum unsere Frage
nicht mehr zu lösen vermocht, auf Kosten natürlich der anderen
Bezüge, die wir heute mitzusehen gewohnt sind. (Wesentliche
Bestimmungen der Freiheit sind: die Freiheit von Zwang oder
Nötigung; der Spontaneität, der Indifferenz, des Urteils, zum
Guten; als Selbstursächlichkeit - liber est causa sui.)
Das gilt für die Anfänge des christlichen Denkens, gilt aber
auch für die gesamte spätere heidnische Philosophie. Immer
wieder wird unter dem Titel heimarméne oder prónoia auch das
eph' hemîn miterörtert; so lautet griechisch der bei den
Stoikern zum Fachausdruck gewordene Terminus, den wir
lateinisch mit liberum arbitrium wiederzugeben gewohnt sind.
Einen Ausschnitt aus dem Ringen der Spätantike um die Rettung
der Willensfreiheit bietet die Consolatio philosophiae des
Boethius.168 Der Philosoph sieht hier sein persönliches
168
Ernst Gegenschatz, Die Freiheit der Entscheidung in der "Consolatio
179
Schicksal als Opfer einer iniusta confusio.
"Minus etenim mirarer, si misceri omnia fortuitis casibus
crederem. Nunc stuporem meum deus rector exaggerat." (IV 5,5:
"Weniger würde ich mich nämlich wundern, wenn ich glaubte,
alles verkehre sich in blinden Zufällen; jetzt erhöht mein
Staunen, daß Gott der Lenker ist.")
Boethius weist dann die Vereinbarkeit von praescientia und
Freiheit nach. Die Vereinbarkeit von praedestinatio und
arbitrii libertas bleibt bei ihm aber offen. Immerhin, in dem
Punkt, auf den er sich konzentriert hat, ist er zur Klärung
gelangt; das ist schon sehr viel, denn, um es mit Malebranche
(1638-1715) zu sagen: La liberté, c'est un mystère.
Hans Jonas hat in unserer Zeit (nach Auschwitz!) die
Problematik
erneut
aufgegriffen.
Von
den
vier
Denkmöglichkeiten169:
(1) Gott kann und will die Übel dieser Welt verhindern
(aber die Übel sind offensichtlich da);
(2) Gott kann weder noch will er sie verhindern
(aber inwiefern wäre er dann noch Gott?);
(3) Gott kann zwar, will aber nicht
(inwiefern wäre er dann aber noch allgütig?)
(4) Gott will zwar, kann aber nicht
(inwiefern wäre er dann aber noch allmächtig?)
entscheidet sich Jonas für die letztere - Gott ist nicht
allmächtig; er hat einen Teil seiner Macht an niedrigere
Instanzen abgegeben. Sein Gedanke vom leidenden, werdenden,
sich sorgenden Gott - ein menschlich berührendes Zeugnis der
Frömmigkeit in unserer Zeit.170 "Verzichtend auf seine eigene
Philosophiae" des Boethius. Museum Helveticum 15 (1958), S.110-129, sowie
Wege der Forschung Bd. 483, Darmstadt 1984.
169 vgl. Lactantius De ira 13,20f: "Deus aut vult tollere mala et non
potest, aut potest et non vult, aut neque vult neque potest, aut vult et
potest." - als "argumentum Epicuri" vielleicht zu den Fragmenten aus
Nat.deor. III gehörend.
170 Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. In:
ders., Gedanken über Gott. Frankfurt am Main, 1994. "Nur mit der Schöpfung
aus dem Nichts haben wir die Einheit des göttlichen Prinzips zusammen mit
seiner Selbstbeschränkung, die Raum gibt für die Existenz und Autonomie
einer Welt. Die Schöpfung war der Akt der absoluten Souveränität, mit dem
sie um des Daseins selbstbestimmender Endlichkeit willen einwilligte,
nicht
länger
absolut
zu
sein
ein
Akt
also
der
göttlichen
Selbstentäußerung.
Und da erinnern wir uns, daß auch die jüdische Überlieferung nicht gar so
monolithisch in Dingen der göttlichen Souveränität ist, wie die offizielle
Lehre es erscheinen läßt. Die mächtige Unterströmung der Kabbala, die in
unsern Tagen von Gershom Scholem neu ans Licht gezogen wurde, weiß von
einem Schicksal Gottes, dem er sich mit der Weltwerdung unterzog. Dort
gibt es hochoriginelle und sehr unorthodoxe Spekulationen, unter denen
meine nicht so gänzlich allein stehen würde. Zum Beispiel radikalisiert
mein Mythos im Grunde nur die Idee des Zimzum, diesen kosmogonischen
Zentralbegriff der Lurianischen Kabbala. Zimzum bedeutet Kontraktion,
Rückzug, Selbsteinschränkung. Um Raum zu machen für die Welt, mußte der
180
Unverletzlichkeit, erlaubte der ewige Grund der Welt, zu sein.
Dieser Selbstverneinung schuldet alle Kreatur ihr Dasein und
hat mit ihm empfangen, was es vom Jenseits zu empfangen gab.
Nachdem er sich ganz in die werdende Welt hineingab, hat Gott
nichts mehr zu geben: Jetzt ist es am Menschen, ihm zu geben.
Und er kann dies tun, indem er in den Wegen seines Lebens
darauf sieht, daß es nicht geschehe oder nicht zu oft
geschehe, und nicht seinetwegen, daß es Gott um das
Werdenlassen der Welt gereuen muß. Dies könnte wohl das
Geheimnis der unbekannten 'sechsunddreißig Gerechten' sein,
die nach jüdischer Lehre der Welt zu ihrem Fortbestand niemals
mangeln sollen und zu deren Zahl in unserer Zeit manche der
erwähnten 'Gerechten aus den Völkern' gehört haben möchten:
daß kraft der Überwertigkeit des Guten über das Böse, die wir
der nichtkausalen Logik der dortigen Dinge zutrauen, ihre
verborgene Heiligkeit es vermag, zahllose Schuld aufzuwiegen,
die Rechnung einer Generation gleichzustellen und den Frieden
des unsichtbaren Reiches zu retten." (S.48f.)
4.2.4 Zum Schluß des Buches:
Im letzten Satz des Buchs teilt Cicero mit, daß ihm die
Erörterung des Balbus wahrscheinlicher vorkam und daß Velleius
mehr durch die Ausführung Cottas überzeugt worden war. Die
Komparative verior und propensior zeigen, daß nur die Reden
des Balbus und des Cotta miteinander verglichen werden.
Cicero will durch dieses Ergebnis die Waage im Gleichgewicht
halten, ohne dadurch der Wahrheit und seinem Gewissen Gewalt
anzutun.
Das erreichte Gleichgewicht ergibt ein weiteres Argument gegen
die Meinung, daß Cicero einen Sieg der akademischen Lehre
wünschte. Dann wäre es ja nicht gerade richtig gewesen, die
Ausführungen Cottas ausgerechnet den Beifall des Epikureers
Velleius gewinnen zu lassen und sich selbst an die Seite des
Stoikers zu stellen; diese Schlußfolgerung gilt natürlich ganz
abgesehen von der Frage, ob es ihm mit dieser Wahl ernst war.
Es ist nun merkwürdig, daß die eine Seite, die mit der anderen
in einen Gleichgewichtszustand gebracht werden soll, aus der
akademischen Lehre besteht, die selbst beansprucht neutral zu
sein. Hier wird aber die Ausführung Cottas der positiven
Götterlehre
entgegengesetzt
und
daher,
infolge
der
Kontrastwirkung, in eine gewisse Negation gedrängt. Gerade das
En-Ssof des Anfangs, der Unendliche, sich in sich selbst zusammenziehen
und so außer sich die Leere, das Nichts entstehen lassen, in dem und aus
dem er die Welt schaffen konnte. Ohne diese Rücknahme in sich selbst
könnte es kein anderes außerhalb Gottes geben, und nur sein weiteres
Zurückhalten bewahrt die endlichen Dinge davor, ihr Eigensein wieder ins
göttliche 'alles in allem' zu verlieren." (S.47f.)
181
aber wird Cicero nun nicht gewollt haben, so daß er als
Akademiker, der nicht unmittelbar an der Debatte beteiligt
war, den gleichen Endstand, auf den seine Schule soviel Wert
legte, herbeiführen konnte. Er vermied dadurch den Eindruck oder wenigstens machte er den Versuch dazu -, daß die Akademie
"doch eigentlich atheistisch" war, einen Eindruck, den die
gegen die Götterlehre gerichtete Erörterung Cottas auf einen
nicht allzu kritischen Leser machen könnte. Wir meinen aber
andererseits, daß diese Aussage Ciceros keineswegs im
Widerspruch mit seiner wirklichen Meinung gewesen zu sein
braucht. Als Akademiker konnte er, wenn er auch die These
seiner Schule: "daß nichts (auch in theologicis) sicher ist",
ungeschwächt
aufrechterhielt,
doch
sehr
gut
die
Wahrscheinlichkeit (ad veritatis similitudinem propensior sagt
er in III, 95) der stoischen Lehre gelten lassen und
anerkennen. Das wird Cicero auf dem Gebiet der Götterlehre als
richtiger Römer besonders gern getan haben.
Ciceros Schlußfolgerung in III, 95 kann sehr gut seine wahre
Überzeugung wiedergeben - natürlich mit der Einschränkung, die
er selbst in I, 10 macht: Qui autem requirunt quid quaque de
re ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse est ff.
Das wichtigste Motiv für die Abgabe seiner Stimme so wie er es
getan hat, wird somit wohl in dem Bedürfnis zu finden sein,
ein akademisches Gleichgewicht zustande zu bringen, und nicht
in dem Wunsch, seine persönliche Meinung für die Nachwelt
festzulegen.171
5. Zum Nachwirken der Schrift De natura deorum
Literatur:
Zielinski, Th., Cicero im Wandel der Jahrhunderte, 4.Aufl.
Leipzig-Berlin 1929.
Grunwald, G., Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis
zum Ausgang der Hochscholastik (Beiträge zur Geschichte des
Mittelalters VI 3) 1907
Price, J.V., Theists in Cicero and Hume, in: Texas Studies in
Literature and Language 5 (1963), 255ff.
Price, J.V., Sceptics in Cicero and Hume, in Journal of the
History of Ideas 25 (1964), 97-106.
Als das Christentum nach dem Ende der Verfolgung zu den ersten
literarischen
Versuchen
einer
Verteidigung
und
Selbstdarstellung ansetzte, wurde der Heide Cicero mit einem
Teil seiner philosophischen Schriften zum "Bannerträger im
Kampf um das Erbe der alten Welt" (Zielinski). Das gilt für
Ebenso Kleywegt, Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der
Schrift De natura deorum. Groningen (J.B.Wolters) 1961. S.219 ff.
171
182
die Bücher "De officiis", die für Ambrosius die Grundlage
seiner christlichen Pflichtenlehre ("De officiis ministrorum")
bilden, und in noch weit stärkerem Maße für "De natura
deorum", weil gerade diese Schrift dazu geschaffen schien, daß
mit ihren Aussagen der Angriff auf das Heidentum und die
Beweisführung für die Richtigkeit der christlichen Lehre
gewagt werden konnte.
Minucius Felix
Das geschah zum ersten Mal im "Octavius" des Minucius Felix,
der
"Jungfernrede
des
lateinischen
Christentums,
ciceronianisch
in
der
Inszenierung
und
Ökonomie,
ciceronianisch endlich in Gedankeninhalt und Redeweise"
(Zielinski).
Dionysios von Alexandreia
Beim christlichen Kampf gegen die griechisch-lateinische
Atomistik, der mit dem Origenes-Schüler Dionysios (248-265
Bischof von Alexandreia) und seiner Schrift Perì physeos (von
Eusebios in seiner "Praeparatio evangelica" zitiert) beginnt,
kann man Ciceros Einfluß vermuten.
Arnobius
Die sieben Bücher "Adversus nationes" ("Gegen die Heiden") des
Nordafrikaners Arnobius sind nicht nur eine unerschöpfliche
Fundgrube für alle Belange der heidnischen Kulte und
Religionen seiner Zeit, sondern auch mehrfacher Beleg dafür,
daß Ciceros "De natura deorum" zum Kampf gegen die heidnischen
Religionen verwendet wurde.
Laktanz
Laktanz, der Schüler des Arnobius, lehnt sich in seinen
Schriften "De opificio" und "De ira Dei" so sehr an das zweite
Buch von De natura deorum an, daß Hieronymos (Ep. 70,5) sie
eine "Epitome der ciceronianischen Dialoge" nennen konnte.
Augustinus
In der "Civitas Dei" wird Cicero - "ein würdiger Mann, aber
ein schlechter Philosoph" (II 27), "dieser Akademiker, dem
alles als ungewiß gilt" (IV 30) - von Augustinus in doppelter
Absicht
benutzt:
einmal,
um
die
eigenen
geschichtstheologischen Grundgedanken (v.a. im fünften Buch)
durch ihn zu erhärten, zum anderen um ihn anhand seiner
"Natura deorum" theologisch ad absurdum zu führen. Civ.Dei V 9
bringt die große Auseinandersetzung Augustins mit Ciceros
Lehre von der Willensfreiheit. Die volle Willensfreiheit des
Menschen, wie sie uns bei Cicero gerade auch Nat.deor. III 86
in dem stolzen Ausspruch "virtutem nemo umquam acceptam deo
rettulit" begegnet oder in seiner Schrift über das Fatum
ausgesprochen wird - "Sed haec ex naturalibus causis vitia
183
nasci possunt, exstirpari autem et funditus tolli, ut is ipse,
qui ad ea propensus fuerit, a tantis vitiis avocetur, non est
id positum in naturalibus causis, sed in voluntate studio
disciplina"172 -, diese Willensfreiheit war die Basis, auf der
Cicero seine Ethik aufbaute. Pelagius war ihm darin gefolgt
und hatte dem Menschen trotz des Sündenfalles durch die
ungebrochene Willensfreiheit (liberum arbitrium) die Fähigkeit
zur Tugend zugesprochen, der die Gnade Gottes dann nach dem
Maße der Verdienste gegeben wird. Dagegen kämpft Augustinus,
und
gegen
Ciceros
"verabscheuenswürdige
Erörterung"
(disputatio detestabilis) in der fragmentarischen Schrift "De
fato", in der die göttliche Praeszienz aufgegeben wird, um
damit die Freiheit des menschlichen Willens zu retten, richtet
sich
vor
allem
Civ.Dei
V
8-9,
wo
Augustinus
die
Willensfreiheit des Menschen durch die frei waltende Gnade
Gottes ersetzt.
Die
Schrift
Augustins:
"De
diversis
quaestionibus
ad
Simplicianum" soll uns den Entwicklungsgang veranschaulichen,
den Augustinus im Lauf seines Lebens bezüglich dieses
Themenkomplexes genommen hat.173
Die Gebildeten der spätantiken Welt gingen, wenn sie nicht
Skeptiker waren, davon aus, der Mensch sei Herr seiner
Handlungen. Auch wenn sie die Natur als eine allumfassende
Gottheit verehrten und ihrem Gang eiserne Notwendigkeit
zuschrieben, priesen sie die menschliche Selbstgestaltung.
Cicero und Seneca waren von der Schwäche des Menschen
überzeugt; sie sahen ihn umgeben von einem Meer der Bosheit.
Aber sie hielten ihn für fähig, das Ziel aller Dinge zu
erfassen; sie dachten, er sei mächtig, sich dem Andrang all
des Überflüssigen zu entziehen, das ihm die Gesellschaft
zuträgt. Er sollte sich selbst ein Maß setzen, genug, nicht zu
viel zu haben. Er sollte seine Angelegenheiten ordnen, vor
allem seine Affekte.174 Durch vernünftige Lebensführung und
freie Entscheidung sollte er sich ein seliges Leben (vita
beata) sichern. Daß der Mensch dies könne, daß er dazu seine
Vernunft bekommen habe und daß alle Philosophie diesem Ziel
diene - dies war eine allgemeine Überzeugung der spätantiken
Welt.
De Fato 11. "Solche Fehler können aus natürlichen Ursachen erwachsen;
daß sie aber ausgerottet und von Grund auf ausgemerzt werden, so daß
selbst der, der zu ihnen hinneigte, sich völlig von solchen Lastern
zurückhält, das liegt nicht in natürlichen Ursachen begründet, sondern im
Willen, im Streben, in der Zucht."
173 Nach: Logik des Schreckens. Augustinus von Hippo, Die Gnadenlehre von
397, Lat.-Deutsch, Hrsg.u.erkl.v.Kurt Flasch. Deutsche Erstübersetzung
v.Walter Schäfer. Mainz 1990.
174 Seneca, Epistolae morales, Ep. I 9,17. Philosophische Schriften, Bd.3,
ed. M.Rosenbach, Darmstadt 1980, S.58: suo arbitrio res suas ordinare.
172
184
In ihr wuchs auch Augustin auf. Er berichtet in den
Bekenntnissen, welch einen Durchbruch zu sich selbst anno 373
die Lektüre Ciceros für ihn gebracht hatte. Weisheit und damit
Herrschaft über die bloße Natur in uns war erreichbar; beim
Lesen Ciceros erfaßte er diese Weisheit als den Sinn seines
Lebens. Die Seele galt Cicero wie vielen in der Antike als
göttlich. Lassen wir sie ihre natürliche Tätigkeit entfalten,
dann sind wir frei. Wir überwinden so die Irrungen der
Menschen und kehren zurück zur Sternenheimat der Seelen.
Dieses Lebenskonzept muß Augustin bald brüchig erschienen
sein, denn er schloß sich einer Gruppe radikaler Christen an,
den
sogenannten
Manichäern.
Sie
nannten
als
ihre
Grunderfahrung den Zwang, der auf ihnen lastete - auf ihnen,
insofern sie der sichtbaren Welt zugehörten. Daß wir nicht tun
können, was wir als vernünftig ansehen und wollen, dies hatte
nach ihrer Philosophie seinen Grund in der Herrschaft des
bösen Prinzips über die sichtbare Welt. Freiheit gab es für
sie nur durch die Befreiung aus dem Gefängnis der Körperwelt,
nicht durch Selbstgestaltung des vernünftigen Willens. Etwa
neun Jahre lang gehörte Augustin den Manichäern an. Dann, 386,
entdeckte er mit Hilfe der platonischen Bücher die Einheit des
göttlichen
Prinzips.
Dies
bedeutete
zugleich
die
Wiederentdeckung der freien Entscheidungskraft des Menschen.
Die selbsttätige Beziehung der menschlichen Vernunft auf ein
glückseliges Leben trat wieder in Kraft. Als Augustin sich
Ostern 387 taufen ließ, bejahte er das chistliche Credo, weil
es
der
Aufstiegsbewegung
des
menschlichen
Geistes
Durchsetzungskraft
gebe
in
der
sichtbaren
Welt:
Die
Menschwerdung des weltbegründenden Logos, die die sichtbaren
Glaubensmysterien und die kirchliche Predigt deuteten ihm
darauf hin, daß wir nicht die Gefangenen dieser Weltmaschine
sind. Weil er das Christentum so verstand, konnte er das
spätantike, vor allem das neuplatonische Denken - mit wenigen
Veränderungen - wieder aufgreifen und weitergeben. Die
Botschaft der Kirche verlieh der freien Selbstgestaltung neue
Motivationskraft; ihre Organisation gab der Wahrheit eine
starke Außenseite. Diese Wahrheit hatten nach Augustin die
antiken Philosophen, besonders die Schüler Platons, erkannt;
das Christentum sollte bewirken, daß sie die Massen erfaßte,
also nicht mehr nur wenigen Intellektuellen vorbehalten blieb;
jetzt wurde sie dem gesamten Volk zugänglich, wenn auch in
Stufen.
Wie es seine Art war, behielt Augustin seine Entdeckungen
nicht für sich. Er schrieb sofort ein Buch über das
glückselige Leben. Noch im Jahr der Taufe schrieb er über die
Unsterblichkeit der Seele. Im Jahr darauf, 388, begann er sein
Buch über den freien Willen. Die Absage an die Manichäer war
eine Rückkehr zur Freiheit des menschlichen Wollens, und
185
Augustin sprach dies nachdrücklich aus. Wie die Neuplatoniker
ließ Augustin alles Sein und Leben von einem obersten Prinzip
abhängen; wie die Neuplatoniker erklärte er die menschliche
Wahrheitserkenntnis als Teilhabe am göttlichen Licht. Wenn die
Bibel von Erleuchtung und Begnadung sprach, deutete Augustin
diese Worte in diesem allgemeinen neuplatonischen Rahmen.
Danach hatte die Sünde Adams die Menschen geschwächt, nicht
aber um ihren freien Willen gebracht. Die Menschheit litt
unter den Folgen der Adamssünde, aber sie war nicht schuldig
geworden mit Adam, denn, so argumentierte Augustin in seinem
neugewonnenen Freiheitskonzept, Sünde und Schuld setzen
voraus, daß ich wissentlich und willentlich beteiligt bin.
Aber daß wir willentlich und wissentlich mit Adam gesündigt
hätten, davon konnte nach dem Augustin der Jahre 386 bis 395
keine Rede sein. Die Erbsünde konnte die wesentliche
Bestimmung des Menschen zu Weisheit und zu glückseligem Leben
also erschweren, aber nicht außer Kraft setzen. Der Mensch,
der sich dem Guten zuwendete, konnte mit der Hilfe Gottes
rechnen. Hatte er sich einmal kraft seines freien Willens
entschlossen, den Glauben anzunehmen und die Taufe zu
empfangen, trat er in einen neuen Lebenszusammenhang mit Gott:
Der Heilige Geist selbst wurde über ihn ausgegossen und wirkte
mit Zustimmung des Begnadeten in ihm seine Werke.175
Im Rahmen dieser Entwicklung sind Augustins Verschiedene
Probleme, an Simplician zu lesen. Die Entstehung dieses Werks
ist wahrscheinlich im Jahr 397 anzusetzen. Das bedeutet: Etwa
10 Jahre nach seiner endgültigen Abkehr vom Manichäismus, nach
der Beschäftigung mit den platonischen Büchern und nach der
Taufe revidierte Augustin seine Auffassung des Christentums an
entscheidenden Punkten. Man hat darüber geurteilt: Augustins
bislang überlagerter Manichäismus breche wieder durch; jetzt
gebe er das gegen die Manichäer erkämpfte Freiheitsbewußtsein
wieder preis. Vielleicht urteilt man so zu voreilig, indem man
die Argumente übergeht, die er für sich anführen konnte. Was
ist hier neu?
Wenn es einen Text gibt, der dabei auslösend wichtig war, dann
war es der Satz aus dem 1.Korintherbrief 4,7: "Was hast du,
das du nicht empfangen hättest?"
Gegen die Entscheidung Gottes gibt es keine Appellation. Sie
in Diskussion zu ziehen, wird 397 für Augustin zum Inbegriff
der Unsittlichkeit, nämlich zum Stolz. Der Mensch kann sich
jetzt nicht mehr für seine wesentlichen Lebensinteressen, also
für sein ewiges Los, auf allgemeine Kriterien wie zum Beispiel
Gerechtigkeit
berufen.
Schon
die
Absicht,
daran
zu
Vgl.A.Pincherle, La formazione teologica di S.Agostino, Rom 1947;
P.Brown,
Augustine
of
Hippo.
A
Biography,
Berkeley
1967,
dt.
Frankfurt/Main 1973, bes. die Kapitel 9-11; K.Flasch, Augustin. Einführung
in sein Denken, Stuttgart 1980, S.55-155; A.Pincherle, Vita di S.Agostino,
Bari 1980, bes. S.70-118.
175
186
appellieren, nennt Augustin schlicht: Unverschämtheit.
Der Anfang des Glaubens liegt nicht mehr in unserer Hand.
Hatte Augustin vor 397 diesen ersten Schritt dem Menschen
zuerkannt, so streitet er ihm nun ausdrücklich die Kompetenz
zu diesem Beschluß ab. Denn sonst hinge von uns, nicht von
Gott ab, wie es mit uns weitergeht. Der Gedanke einer Art von
Wechselspiel zwischen göttlicher Gnade und menschlichem
Entschluß, den Glauben anzustreben und anzunehmen, erscheint
Augustin jetzt unerträglich. Der Mensch kann - in allem, was
wichtig ist - keinen neuen Anfang setzen.
Ausdrücklich verwirft Augustin jede Art göttlicher Reaktion
auf gutes sittliches Handeln: Nicht nur geht das Glaubenwollen
nicht mehr dem Glauben voraus, nicht nur begründet das
sittliche Wollen und Handeln nicht mehr die Begnadung; auch
das göttliche Vorherwissen künftigen guten Handelns darf nicht
mehr als Grund der Zuwendung Gottes gelten. Wäre das
Vorherwissen
künftigen
menschlichen
Handelns
ein
Entscheidungsgrund Gottes, dann hingen - nach dieser neuen
Betrachtungsweise - der göttliche Wille und der Endausgang
menschlichen Lebens vom Menschen ab. Vor 397 hatte Augustin
das nicht gestört. In jenem Stadium war die spätantike
Wertetafel insofern berücksichtigt, als das göttliche Urteil
sich
auf
sie
bezog.
Jetzt
zerschlägt
Augustin
diese
Wertetafel.
Ausdrücklich lehnt Augustin jetzt ab, eine Initiative auch nur
teilweise auf den Menschen zurückzuführen. Er verwirft die
Vorstellung von einem gemeinsamen Wirken von Mensch und Gott.
Augustins neue Gnadenlehre von 397 überläßt das wesentliche
Interesse der Menschen dem souverän wählenden und verwerfenden
Gott. Wenn es nicht nach guten Absichten und Handlungen, nicht
nach Wahrheitssehnsucht und Glaubensbereitschaft der Menschen
und auch nicht nach dem göttlichen Vorherwissen all dieser
menschlichen
Qualitäten
geht,
dann
liegen
dem
realen
Weltgeschehen reine Willensbeschlüsse zugrunde. Es sind
Entscheidungen, gegen die an keine Regeln appelliert werden
darf. Wir dürfen uns von ihnen keine humanitär aufgeweichten
Vorstellungen bilden. Es sind die Beschlüsse eines Wesens, das
von Zwillingen vor ihrer Geburt sagt, daß es den einen liebt,
den anderen haßt - Jakob und Esau, Genesis 25-27! Und gerade
darauf, daß dies vor ihrer Geburt gilt, daß sie selbst nichts
dazu getan haben konnten, legte Augustin 397 den Nachdruck.
Der Gott Platons und Plotins, der ihm 386 die Überwindung des
Manichäismus ermöglicht hatte, verhielt sich vorbehaltslos als
reine Güte. Er teilte sich neidlos mit.176 Der Gott der antiken
Philosophen zürnte nicht und forderte keine Menschenopfer. Für
die
Schriftauslegung
ergab
sich
daher
der
176
Vgl. bes. Platon, Timaios 29 a-e.
187
religionsphilosophische und hermeneutische Grundsatz: Alle
Bilder und Erzählungen von Gottheiten sind nach dem Maßstab
des schlechthin Guten und Neidlosen zu deuten. Sie sind also
in der Regel zu korrigieren, zu sublimieren, d.h. auf die
Würde eines allumfassenden, schlechthin guten Wesens zu
beziehen.
Daraus
folgte
die
Religionskritik
und
Dichterauslegung
der
antiken
Philosophen.
In
diese
Deutungsweise war Augustin in der Auseinandersetzung mit den
Manichäern hineingewachsen; jetzt, 397, entzieht er sich ihr
zugunsten
unerforschlicher
Gottesbeschlüsse.
Diese
Weltverdüsterung und diese Entmächtigung des Menschen müssen
Gründe haben. Wir müssen mit einer Vielzahl von Gründen
rechnen, in die uns Augustin nur teilweise Einblick gibt. Er
stellt als sein Hauptmotiv die Intention des Apostels Paulus
im Römerbrief voran: Niemand soll sich der eigenen Leistungen
rühmen dürfen (Röm 9).
Augustin hat mit dieser, merkwürdigerweise bis zu unserer
Ausgabe von 1990 unübersetzten Schrift die "Todesurkunde des
Gottes
der
Philosophen",
die
"Gründungsurkunde
des
Augustinismus"177 geschrieben. Hier finden wir einen Augustin
ohne Glättungen, einen Denker tiefsinniger Schroffheiten
jenseits großkirchlicher Kompromisse. Dieser Text illustriert
die Geschichte des Terrors in Europa; er wirft Licht auf die
Geschichte
des
westlichen
Christentums,
bis
hin
zum
Tugendfanatismus
Robespierres
und
zu
Säuberungen
des
20.Jahrhunderts.
Zugleich
liegt
hier
paradoxerweise
ein
Dokument
menschlicher Selbstbehauptung vor. Am Schluß der Schrift De
diversis quaestionibus ad Simplicianum I 2 sagt Augustin:
"Und doch: WAS WERDEN WIR NUN SAGEN? IST ETWA BEI GOTT
UNGERECHTIGKEIT, der eintreibt, von wem er will, und schenkt,
wem er will, der keineswegs Ungeschuldetes eintreibt oder
fremdes Gut schenkt? IST ETWA BEI GOTT UNGERECHTIGKEIT? DAS
SEI FERNE! Aber warum dann bei dem einen so, bei dem anderen
anders? O MENSCH, WER BIST DU DENN? Wenn du Geschuldetes nicht
zurückzahlst, hast du Grund, freudig zu danken; wenn du
zurückzahlst, hast du keinen Grund zur Klage. Glauben wir also
einfach, auch wenn wir es nicht zu fassen vermögen. Denn der,
der die ganze geistige und leibliche Schöpfung hervorgebracht
und begründet hat, er hat alles nach Zahl, Maß und Gewicht
wohlgeordnet. Aber unerforschlich sind seine Ratschlüsse und
unaufspürbar seine Wege. Rufen wir Alleluja und singen wir
sein Loblied! Fragen wir nicht: Was soll das oder was soll
jenes? Denn alles ist zur rechten Zeit erschaffen."
177
K.Flasch, l.c. 10 und 51.
188
Ist hier nicht bereits der dialektische nächste Schritt
erahnbar: der Vernunft den Glauben nicht als die Zumutung
ihrer Selbstopferung anzubieten, sondern als die Eröffnung der
Möglichkeit ihrer Selbsterfüllung?178 Daraus ergeben sich
ungeheure Konsequenzen ethischer Art. Zunächst gibt es die
Erfahrung eines Ordnungsschwundes, des Zweifels an einer auf
den Menschen beziehbaren Struktur der Wirklichkeit (symbolisch
steht dafür die Erkenntnis des heliozentrischen Systems).
Diese
Erfahrung
ist
Voraussetzung
für
eine
generelle
Konzeption des menschlichen Handelns, die in den Gegebenheiten
nichts
mehr
von
der
Verbindlichkeit
des
antiken
und
mittelalterlichen Kosmos wahrnimmt und sie deshalb prinzipiell
für verfügbar hält. Der Ordnungsschwund ist mit einem neuen
Begriff der menschlichen Freiheit verbunden. Aber die Last,
die diesmal dem Menschen zufällt, ist anderer Natur als die
ihm von Augustin auferlegte: sie ist "Verantwortung für den
Zustand der Welt als zukunftsbezogene Forderung, nicht als
vergangene Urschuld."179
Die Zerstörung des Weltvertrauens hat den Menschen erst zum
schöpferisch handelnden Wesen gemacht, hat ihn von einer
verhängnisvollen Beruhigung seiner Aktivität befreit.
Charles Taylor hat die These formuliert:
"In dem Maße, wie im modernen Zeitalter das Gefühl schwindet,
in eine kosmische Ordnung von Ideen hineingestellt zu sein,
und
die
theologische
Perspektive
aufhört,
unmittelbar
zugänglich zu sein oder den anerkannten Hintergrund unseres
Lebens zu bilden, wächst das Gefühl, daß die Aufgabe, das
Leben zu bejahen und eine Quelle inneren Wertes zu finden, uns
selbst zufällt. Diese Bejahung hängt entscheidend von der
Anerkennung durch den Menschen ab. Es liegt an uns, zu sehen,
daß das Dasein gut ist."180
(Zu glauben, daß es nicht gut ist, ist die gnostische
Versuchung, die die Kirche von Anfang an begleitet.)
Die Frage an die christlichen Kirchen, die sich daraus ergibt,
lautet: Kann ein christlicher Antihumanismus authentisch sein?
Mittelalter
Nach Augustinus verliert Cicero an Bedeutung. Die geistige
Elite der Christen braucht ihn nicht mehr, um für eine
Apologie der neuen Lehre oder für eine Polemik gegen das
Vgl. Hans Blumenberg, Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner.
Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe von "Die Legitimität der Neuzeit",
vierter Teil. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1982; v.a. S.34ff.
179 Hans Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und
überarbeitete Neuausgabe von "Die Legitimität der Neuzeit", erster und
zweiter Teil. 2.Aufl. Frankfurt am Main 1983. S.158.
180 Charles Taylor, Humanismus und moderne Identität. In: Der Mensch in den
modernen Wissenschaften. Castelgandolfo-Gespräche 1983. Hrsg. v. Krzysztof
Michalski. Klett-Cotta Stuttgart 1985. S.117-166. S.162.
178
189
Heidentum aus den religionsphilosophischen Schriften Aussagen
zu entlehnen. Das angehende Mittelalter kann auf den
heidnischen Philosophen verzichten. Dafür steigen Livius und
Sallust in der Gunst der folgenden Jahrhunderte, oder Vergil,
der mit seiner vierten Ekloge, in der man eine Huldigung an
die Geburt des Erlösers zu erkennen glaubte, so sympathisch
christlich anmutende Gedankengänge anklingen ließ.
Candidus
An der Schwelle zur Scholastik steht der Alkuinschüler
Candidus (Brun), der von Fulda zur Klosterschule Tours, dann
an den Hof Karls des Großen gekommen und von da zurück nach
Fulda gegangen war, um hier als Nachfolger des Hrabanus Maurus
die Leitung der Klosterschule zu übernehmen. Ihm zugeschrieben
werden die "Dicta de imagine Dei" (Manuscrits de SaintGermain-des-Prés num. 1334), in denen u.a. auch ein stoischer
Gedankengang aus der "Natura deorum" zu einem ersten Versuch
eines Gottesbeweises im Mittelalter herangezogen wird. In der
dreifachen Stufenreihe alles Seienden, alles Lebenden und
alles Erkennenden steht der Mensch infolge seines Intellekts
zwar obenan, ist aber keineswegs allmächtig, da seinem Wollen
Grenzen gesetzt sind. Folglich muß es über dem Menschen eine
höhere und bessere Macht geben, von der sein eigenes Sein
abhängt, eine höhere und allmächtige Macht, die über alle
Dinge herrscht, die da sind, leben und erkennen - eben Gott.
Das ist eine Paraphrase des Chrysipp-Beweises aus Nat.deor. II
16: "Si est aliquid in rerum natura, quod hominis mens, quod
ratio, quod vis, quod potestas humana efficere non possit, est
certe id, quod illud efficit, homine melius... id autem quid
potius dixeris quam deum?"
Humanismus
Als Petrarca zur Welt kommt, waren Briefe und Reden und alle
rhetorischen und philosophischen Schriften Ciceros beinahe
vergessen, und Petrarcas Bedeutung beruht ja darin, daß er als
"der anerkannte Führer der Humanisten, der ersten rein
weltlichen
Intelligenz
des
neuen
Europas"
(Zielinski)
anzusehen ist, dem wiederum der durch ihn zu neuem Leben
erweckte Cicero zum geistigen Führer wurde. Petrarca lebt von
Jugend auf mit Cicero, dem er bis zu seinem Tode eine sich
immer mehr steigernde Verehrung entgegenbringt. "Si mirari
Ciceronem hoc est Ciceronianum esse," bekennt er am Ende
seines Lebens, "Ciceronianus sum. At ubi de religione, idem de
summa veritate et de vera felicitate deque aeterna salute
cogitandum incidit aut loquendum, non Ciceronianus certe aut
Platonicus, sed Christianus sum, quippe cum certus mihi
videar, quod Cicero ipse Christianus fuisset, si vel Christum
videre vel Christi doctrinam percipere potuisset".181
181
Petrarca, De ignorantia 1162, 46 - 1163, 2. Diese 1337-38 verfaßte
190
Luther
Bei Martin Luther finden wir eine fast liebevolle Zuneigung zu
Cicero, die - in scharfem Gegensatz zu der schroffen,
unversöhnlichen Denkungsart Calvins - so weit geht, daß er
hofft, "unser Herrgott werde ihm und seinesgleichen gnädig
sein" (Tischreden 73,4). Keiner der antiken Autoren wird in
seinen Schriften häufiger erwähnt, weniger anhand von Zitaten
als in allgemeinen Urteilen über den Wert der von ihm
entwickelten Gedanken.
"Cicero übertrifft Aristotelem weit in Philosophia und mit
Lehren. Officia Ciceronis sind viel besser denn Ethica
Aristotelis. Und nachdem Cicero in großen Sorgen, im Regiment
gesteckt ist und große Bürde, Mühe und Arbeit auf ihm gehabt
hat, doch ist er weit überlegen Aristoteli, dem müßigen Esel,
der Geld und Gut und gute faule Tage genug hatte."
"Aristoteles ist zwar ein guter und listiger Dialecticus
gewest, der den Methodum und richtigen ordentlichen Weg im
Lehren gehalten hat; aber die Sachen und den rechten Kern hat
er
nicht
gelehrt
wie
Cicero.
Wer
die
rechtschaffene
Philosophie lernen will, der lese Ciceronem."
"Cicero ist ein sehr weiser Mann gewest, hat mehr geschrieben
denn alle Philosophi, und alle Bücher der Griechen durchlesen.
Mich wundert, daß der Mensch, in so viel großen Geschäften und
Händeln, so viel hat können lesen und schreiben" (73,4).
Cicero hat die feinsten und besten Quaestiones in der
Philosophie gehandelt: Ob ein Gott sei? Was Gott sei? Ob er
sich auch menschlicher Händel annehme oder nicht? Und es müsse
ein ewig Gemüte sein usw." (73,4). - Das ist die Disposition
der schulgerechten stoischen Abhandlung in Nat.deor. II 3:
"dividunt nostri totam istam de dis immortalibus quaestionem
in partes quattuor. Primum docent esse deos, deinde quales
sint, tum mundum ab his administrari, postremo consulere eos
rebus humanis"; und mit dem "ewig Gemüte" ist die alles
durchdringende, über allem waltende ewige Weltseele gemeint.
In
unserem
Zusammenhang
zu
nennen
sind
auch
Philipp
Melanchthon (1497-1565), Johannes Calvin, Michel Eyquem
Seigneur de Montaigne (1533-92), auf die ich aber nicht
Altersschrift (genauer Titel: De sui ipsius et multorum ignorantia")
enthält eine scharfe Kritik an den auf Aristoteles fußenden Averroisten
seiner zeit. Er bekämpft sie mit dem in Nat.deor. entwickelten stoischen
Weltbild, er benutzt Cottas Widerlegung der epikureischen Theologie und
fällt im Hinblick darauf über Cicero das Urteil, "ut interdum non paganum
philosophum, sed apostolum loqui putes, quale est illud in primo <libro>
contra Velleium, Epicureae sententiae defensorem" (1151, 41-43). Viermal
wird hier der Titel der Ciceroschrift ausdrücklich zitiert.
191
eingehe.
Der europäische Deismus
Wie die Renaissance als das Zeitalter der freien Entfaltung
der Persönlichkeit ohne den wiederentdeckten Cicero unmöglich
gewesen wäre, so geht die zuerst in England aufkommende Lehre
von der "natürlichen Religion" oder das philosophische Gebäude
des Deismus in seinen elementaren Begriffen auf Cicero zurück.
Ohne Ciceros "Natura deorum" kein europäischer Deismus.
Um die Existenz Gottes zu beweisen, bedurfte es zum mindesten
zweier natürlicher Beweise - eines intuitiv-empirischen und
eines kosmologisch-teleologischen -, die wir beide - einmal
aus epikureischer und stoischer (I 43.44 und II 12) und einmal
nur aus stoischer Sicht (II 15) - in "Nat.deor." finden.
Einmal:
"<Epicurus> vidit esse deos, quod in omnium animis eorum
notionem inpressisset ipsa natura. Quae est enim gens aut quod
genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem
quandam deorum, quam appellat prolepsin Epicurus, id est
anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec
intellegi quicquam nec quaeri nec disputari potest"182
Mit dem bekannten kosmologisch-teleologischen Beweis befinden
wir uns dagegen auf rein stoischem Boden, weil hier aus der
Einmaligkeit des Kosmos gefolgert wird,
"ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum
venerit, cum videat omnium rerum rationem modum disciplinam,
non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse aliquem
intellegat, qui praesit et cui pareatur, multo magis in tantis
motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum
atque tantarum ordinibus, in quibus nihil umquam immensa et
infinita vetustas mentita sit, statuat necesse est ab aliqua
mente tantos naturae motus gubernari".183
Nat.deor.I 43 - "Er <Epikur> nämlich hat allein erkannt, daß erstens
einmal Götter existieren, weil die Natur selbst in den Seelen aller
Menschen den Begriff davon eingeprägt hat. Denn wo gibt es ein Volk oder
eine menschenart, die nicht auch ohne eine Belehrung einen bestimmten
Vorbegriff von den Göttern besäße, den Epikur prólepsis d.h. eine
bestimmte, in der Seele vorauserfaßte Vorstellung von einer Sache nennt,
ohne die man etwas weder erfassen noch untersuchen noch diskutieren kann?"
Vgl.I 44;II 12.
183 Nat.deor. II 15 - "denn käme z.B. jemand in ein Haus, in ein Gymnasium
oder auf ein Forum und sähe dort die allen Dingen zugrunde liegende
planvolle Berechnung, Gesetzmäßigkeit und Ordnung, dann könnte er nicht
sagen, dies geschehe ohne Ursache, sondern müßte erkennen, es sei
irgendein leitendes Wesen da, dem man zu gehorchen habe; noch viel mehr
muß er dann bei so großen Bewegungen und Veränderungen und bei den
geordneten Bahnen so vieler und so riesiger Körper, die sich trotz ihres
unermeßlichen und unendlichen Alters niemals irgendwie getäuscht haben,
erst recht annehmen, daß derartige gewaltige Vorgänge innerhalb der Natur
durch eine denkende Kraft gelenkt werden."
182
192
David Hume184
Für das Nachwirken von Ciceros religionsphilosophischer
Hauptschrift ist David Hume (1711-1776) das schönste Beispiel.
Das gilt für das Nachwirken der epikureischen Theorie über die
natürliche
Gotteserkenntnis
als
solche
wie
für
deren
Konfrontation mit der stoischen und der skeptischen Theorie,
wie sie Cicero in De natura deorum vorgenommen hat. Die
entscheidende Schrift Humes heißt "Dialogues
concerning
Natural Religion“, posthum veröffentlicht im Jahr 1779.
Hume hat die natürliche Religion nicht in ihrem ganzen Umfang
diskutiert, sondern ein einzelnes Problem
herausgegriffen,
allerdings ein fundamentales Problem: die Bestimmung unseres
Begriffs vom höchsten Wesen durch die Prädikate Geist, Denken,
Intelligenz, oder (in der Ausdrucksweise Kants) den Übergang
von der Weltursache zum Welturheber, vom Deismus zum Theismus.
(Vgl. Kritk d. reinen Vernunft B 659).
Hume hatte von seiner Jugend an ein enges Verhältnis zu
Cicero, "der den Skeptizismus in der theoretischen Philosophie
mit dem Stoizismus in der praktischen zu einer eigenartigen
Synthese verband" (Gawlick). Er ist selbst als ein Cicero
redivivus bezeichnet worden.
Aus gutem Grund hat Hume dem Werk die Form eines Dialogs
gegeben: Nur so werden die verschiedenen Aspekte des Problems
lebendig und glaubhaft dargestellt, nur so tritt jenes Ganze
in Erscheinung, das die Wahrheit ist. (Vgl. Cicero De
nat.deor. I 12 - Non enim sumus ii quibus nihil verum esse
videatur sed ii qui omnibus veris falsa quaedam adiuncta esse
dicamus tanta similitudine ut in ... nulla insit certa
iudicandi et adsentiendi nota.)
Die Rolle, die bei Cicero der Stoiker Balbus spielt, nimmt bei
Hume Cleanthes ein: die des Theisten, der das höchste Dasein
durch Begriffe zu bestimmen sucht, die von der Natur des
Menschen hergenommen sind, und der das Recht hierzu aus der
Ähnlichkeit ableitet, die er zwischen den Werken der Natur und
den Erzeugnissen menschlicher Kunst feststellt.
Es ist bezeichnend, daß Hume seinem Theisten den Namen
Cleanthes gegeben hat, denn der historische Kleanthes (331-233
v.Chr.) war einer der Väter der stoischen Lehre. Der Skeptiker
heißt bei Hume Philo, weil Philo von Larissa (um 90 v.Chr.)
Lehrer Ciceros war in der skeptischen Philosophie.
Offensichtlich ist auch das Schlußurteil des Pamphilus bei
Hume über die vorgetragenen Ansichten mit dem Schlußurteil
Ciceros in seinem Buch in Übereinstimmung: Pamphilus sagt,
Philos Grundsätze seien wahrscheinlicher als die Demeas, die
David Hume, Dialoge über natürliche Religion. Neu bearbeitet und
herausgegeben von Günter Gawlick. Hamburg 1980. Handout: S.36f. (Schluß
des Dritten Teils).
184
193
des Cleanthes aber kämen der Wahrheit näher. (Cicero hat am
Schluß gesagt, dem Epikureer seien die Ausführungen des
Skeptikers wahrer vorgekommen, ihm selber aber schienen die
des Stoikers größere Wahrscheinlichkeit zu besitzen.)
Im Fall Ciceros ist es der Verfasser selbst, der den Rahmen
des Gesprächs absteckt und das abschließende Urteil fällt, im
Fall Humes ist es eine vom Verfasser erfundene Figur, von der
nicht ohne weiteres angenommen werden darf, daß sie für den
Verfasser spricht. Bei Cicero leuchtet das abschließende
Urteil in etwa ein; wir finden es verständlich, wenn Cicero im
Epilog die Ansicht des Stoikers in vorsichtiger Weise billigt,
obwohl er sich in der Vorrede zur Akademie und ihrer Skepsis
bekannt hat. Das ist deshalb kein Widerspruch, weil Cicero die
praktische Bedeutung der natürlichen Religion im Auge hat. In
der theoretischen Philosophie war er Skeptiker und zwar vor
allem deshalb, weil ihm die theoretische Philosophie der
Stoiker durch den Dogmatismus verhängnisvolle Folgen für die
praktische Philosophie zu haben schien: Ihr Determinismus
macht seiner Überzeugung nach die Freiheit des Menschen und
damit die Grundlage der Moral zunichte.
Bei Hume macht der skeptische Philo im letzten Teil der
Unterredung seinem Partner Cleanthes Zugeständnisse, die seine
frühere Kritik an dessen Position weitgehend aufzuheben
scheinen. Es könnte scheinen, daß der Wunsch nach endlicher
Versöhnung des Widerspruchs Vater des Gedankens wird, oder daß
der Autor den negativen Eindruck, den der Leser gewonnen haben
könnte, durch einen konzilianten Schluß abschwächen will.
Seine Kritik hatte sich gegen die Argumentation, nämlich die
Analogieschlüsse, des Theisten gerichtet. Er hält sogar den
Skeptizismus für die einzig mögliche Grundlage des Theismus.
Der Philo Humes fürchtet also, die Kritik an den Argumenten
für den Theismus würde ihm als Kritik am Theismus selbst
ausgelegt werden, und darum präzisiert er im letzten Teil
seine Überzeugungen und legt eine Art Glaubensbekenntnis ab:
Niemand habe einen "tieferen religiösen Sinn" oder bringe "dem
göttlichen
Wesen,
wie
es
sich
die
Vernunft
in
dem
unerklärlichen Plan und Kunstwerk der Natur offenbart,
innigere Verehrung" entgegen als er selbst. Dem Eindruck von
Zweck, Absicht oder Plan in der Natur könne sich selbst der
oberflächlichste und stumpfsinnigste Denker nicht entziehen;
fast alle Wissenschaften führten zu der Anerkennung eines
intelligenten Urhebers der Natur, und diese Tatsache habe umso
größeres Gewicht, als die Wissenschaften nicht direkt auf
dieses Ergebnis ausgingen.
Humes
Dialogues
haben
Johann
Georg
Hamann
(1730-1788)185
Unter Berufung auf Hume, der nicht die Macht der analytischen Vernunft,
sondern ihre Anfälligkeit gegenüber Irrtümern und Selbstzerstörung zeige,
lehnte Hamann die Konstruktion einer Vernunftreligion ebenso ab wie Kants
Konzeption der "reinen Vernunft". Vernunft sei nicht zu trennen von
185
194
beeinflußt, der sie sogar übersetzt hat und u.a. Immanuel Kant
(1724-1804) darauf aufmerksam machte, der die Bedeutung der
Dialogues für die Kritk an der dogmatischen Metaphysik
erkannte.
In den "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik", die
im Frühjahr 1783 erschienen, setzte Kant sich eingehend mit
den Dialogen auseinander:
So schwach Humes Einwände gegen den Deismus sind, so stark
sind seine Einwände gegen den Theismus. Er greift den
Anthropomorphismus an, der allen Versuchen anhaftet, das
Urwesen mit Prädikaten zu bezeichnen, die vom Menschen
hergenommen sind, und meint, der Anthropomorphismus könne vom
Theismus nicht abgetrennt werden, weil sonst nur ein Deismus
übrigbliebe, "aus dem man nichts machen, der uns zu nichts
nützen und zu gar keinen Fundamenten der Religion und Sitten
dienen kann."
Es gilt jedoch, den dogmatischen Anthropomorphismus vom
symbolischen zu unterscheiden: Jener ist zwar schädlich, aber
vermeidbar; dieser ist unvermeidbar, aber unschädlich. Wer die
Welt so ansieht, als ob sie das Werk eines höchsten Verstandes
und Willens wäre, der bestimmt das höchste Wesen nicht an sich
selbst, sondern in bezug auf die Welt, deren Teil er selber
ist. Dies ist Erkenntnis durch Analogie.
Hume
gebraucht
das
Wort
Analogie
wiederholt
so,
als
bezeichnete es eine "unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge";
es bezeichnet aber eine "vollkommene Ähnlichkeit zweier
Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen."
Auf das Problem der Dialoge angewendet heißt das: Es geht in
Wirklichkeit nicht um die Frage, ob die Welt den Erzeugnissen
menschlicher Kunst gleicht, und wir folglich schließen dürfen,
daß sie eine ähnliche Ursache wie diese hat, sondern es geht
um die Frage, ob die Welt sich so zum höchsten Wesen verhält,
wie sich die Erzeugnisse menschlicher Kunst zum menschlichen
Verstand verhalten. Wer diese Proportion aufstellt, - und
niemand kann vermeiden, sie aufzustellen - , der sagt nichts
unmittelbar vom höchsten Wesen aus, sondern bestimmt es nur
"respektiv auf die Welt", vermeidet also den dogmatischen
Anthropomorphismus,
der
der
Kritik
nicht
standhält.
(Prolegomena
57 f.)
6. Zum Schluß
Nach Ciceros Absicht sollten die Schriften "De divinatione"
Verstehen, Intuition und historischer Erfahrung und bedürfe des Fundaments
der Religion. Echtes Wissen könne nur Glaubensgewißheit sein.
195
und "De fato" die Schrift "De natura deorum" ergänzen und
somit den die "Theologie" betreffenden Fragenkomplex abrunden.
Darauf brauchen wir nicht näher einzugehen, denn für unsere
Zwecke ist Vollständigkeit nicht erforderlich.
Ciceros
religionsphilosophische
Hauptschrift
"De
natura
deorum" ist für uns ein Demonstrationsobjekt für das
Kennenlernen religionsphilosophischer Gedankengänge. Wenn im
Lauf der Lektüre mehr als ein Kennenlernen daraus geworden
sein sollte, nämlich ein Gespräch über viele Jahrhunderte
hinweg, um so besser. Vielleicht gibt es dann und wann ein
Wiedersehen mit einem alten Bekannten.
Cicero spricht nie explizit von der theologia tripertita (der
"dreigeteilten Theologie"), wie sie der Pontifex maximus
Q.Mucius Scaevola (82 v.Chr. ermordet) in Rom vielleicht
bekannt gemacht (Augustin, Civ.Dei 4,27), Varro in seinen
"Antiquitates rerum divinarum" der Nachwelt vermittelt hat.
(Theologia fabulosa der Dichter, theologia naturalis der
Philosophen und theologia civilis der Staatsmänner.) Trotzdem
dürfte er mit ihr vertraut gewesen sein. Jedenfalls ist er
deutlich darauf bedacht, allen philosophischen Vorbehalten zum
Trotz die das staatliche Leben festigende und regelnde
theologia civilis zu retten. Mit der theologia fabulosa und
der naturalis mochte es letztlich jeder halten, wie er wollte.
Was hingegen den religiösen Rückhalt des Staates anbelangt, so
war Cicero auch im Jahr 44 v.Chr. zu keinen Kompromissen
bereit: er konnte sich die Dinge nur so vorstellen, wie er sie
zu sehen gewohnt war. Reinigung der ererbten Religion von
dunklem, lastendem Aberglauben - ja; von ihm muß man sich
befreien, um einer geläuterten, auf Naturerkenntnis beruhenden
Religiosität willen. Jedenfalls aber darf aus Gründen der
Opportunität die theologia civilis nicht preisgegeben werden.
Bis zu diesem Punkt vermag seine "Aufklärung" offenbar
gedanklich
vorzudringen.
Gut
nachvollziehbar
ist
das
Bekenntnis zur akademischen Skepsis, deren Tugend es sei, zum
einen die Argumente beider Seiten anzuhören und zu prüfen, zum
andern
nicht
Urteile
zu
fällen,
sondern
nach
der
Wahrscheinlichkeit zu fragen und somit dem Urteilsvermögen der
Hörer oder Leser keinen Zwang anzutun.186 Seine eigene
Auffassung bleibt in ein gewisses Dunkel gehüllt. Sein
Philosophieren scheint uns zuweilen dadurch gekennzeichnet,
daß ein "erwünschter Glaube" und "rationale Gewißheit" nicht
völlig zum Ausgleich gelangen.
Nach den brillanten Vorträgen des Akademikers Cotta, zumal
nach demjenigen gegen die Stoiker im 3.Buch, meint man, es sei
nun wirklich skeptische Zurückhaltung im Urteilen geboten.
Trotzdem billigt Cicero am Ende (3,95) der stoischen
Götterlehre - im Grunde also einer bestimmten Ausprägung der
Auch Origenes, De principiis I 6,1 leitet den Abschnitt über das Ende
der Welt und ihre Vollendung als Gottes Schöpfung mit der Bemerkung ein,
zu diskutieren biete einen besseren Zugang zum Thema als zu definieren.
186
196
philosophischen theologia naturalis - hohe Wahrscheinlichkeit
zu.
Ciceros Schriften haben einen bedeutenden Beitrag zur
europäischen Aufklärung geleistet. Sie können vielleicht auch
einen Beitrag leisten zur Selbstkritik der Aufklärung.
Der Dialog zwischen Philosophie und Religion, der im Gange
ist, seit die Philosophie entstand, und der bei Cicero in so
vorbildlicher, respektvoller Weise geführt wird, der bei
Augustinus so dramatisch, ja explosiv wird, hat in der Neuzeit
eine
ungeheure
Verschärfung,
aber
auch
eine
große
Variationsbreite gegenseitiger Beeinflussung erfahren. Zuletzt
sei beispielhaft auf zwei Akteure der Gegenwart hingewiesen:
Jürgen Habermas und Johann Baptist Metz.
Jürgen Habermas.
In den theologischen Diskussionen der Gegenwart nimmt der 1994
emeritierte Frankfurter Sozialphilosoph Jürgen Habermas seit
langem einen festen Platz ein. Jüngere und systematische
Studien greifen mit schöner Regelmäßigkeit auf Kategorien
seiner Kommunikationstheorie zurück, so daß Habermas, der sich
selbst als methodischer Atheist bezeichnet, allmählich in den
Rang eines anonymen Kirchenvaters aufzurücken scheint.187
Der frühe Habermas zeigte sich noch evolutionstheoretisch
davon überzeugt, daß das Phänomen der Religion prinzipiell
einer historisch überholten Entwicklungsstufe der Menschheit
angehört, so daß von den religiös-metaphysischen Weltbildern
in
den
universalgeschichtlichen
Modernisierungsprozessen
letztlich "nicht viel mehr als der Kernbestand einer
universalistischen Moral"188 übrigbleiben werde. Diese These
vom Obsoletwerden der Religion schwächt er in seinen jüngeren
Arbeiten jedoch deutlich ab. Heute fragt er eher vorsichtig,
"ob denn von den religiösen Wahrheiten, nachdem die religiösen
Weltbilder zerfallen sind, nicht mehr und nicht anderes als
nur
die
profanen
Grundsätze
einer
universalistischen
Verantwortungs-ethik gerettet - und d.h.: mit guten Gründen,
aus Einsicht, übernommen werden können".189 Im Unterschied zu
seinem älteren Anspruch, ein in religiöse Hermeneutik
eingebettetes Ethos in eine von seiner "erlösungsreligiösen
Grundlage entkoppelte kommunikative Ethik"190 aufzulösen und
diskursethisch zu beerben, hält Habermas es heute nicht mehr
für ausgeschlossen, "daß die monotheistischen Traditionen über
Hermann-Josef Große Kracht, Konkurrenz oder Komplementarität? Habermas
und die Religion. Orientierung 61 (1997), S.111-113.
188 J.Habermas, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus (1976),
Frankfurt 5.Aufl. 1990, S.101.
189
Ders., Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V
(1985), Frankfurt 1986, S.52.
190 Ders., Theorie des kommunikativen Handelns I (1981), 3., durchges.
Aufl., Frankfurt 1985, S.331.
187
197
eine Sprache mit einem noch unabgegoltenen semantischen
Potential verfügen, das sich in weltaufschließender und
identitätsbildender
Kraft,
in
Erneuerungsfähigkeit,
Differenzierung und Reichweite als überlegen erweist".191
Deshalb schlägt er heute statt philosophischer Überwindungsund Beerbungsversuche eher eine friedliche Koexistenz von
religiöser Rede und philosophischer Reflexion vor und
konstatiert: "Solange die religiöse Sprache inspirierende, ja
unaufgebbare semantische Gehalte mit sich führt, die sich der
Ausdruckskraft in einer philosophischen Sprache (vorerst?)
entziehen und der Übersetzung in begründende Diskurse noch
harren, wird Philosophie auch in ihrer nachmetaphysischen
Gestalt Religion weder ersetzen noch verdrängen können."192 Für
Habermas kann gegenwärtig eine nachidealistische Philosophie,
die nicht in Literatur und metaphorischer Rede aufgehen,
sondern sich im Modus rationaler Begründung nach wie vor
"frontal
an
Wahrheitsansprüchen"193
orientieren
will,
jedenfalls nicht ohne weiteres "jene in der Sprache der
jüdisch-christlichen Heilsgeschichte artikulierten Erfahrungen
von Erlösung, universaler Bundesgenossenschaft, unvertretbarer
Individualität unverstümmelt, ohne Abstriche an der Fülle
ihrer spezifischen Bedeutungen rational einholen".194 Deshalb
können und sollen kommunikative Vernunft, "solange sie im
Medium begründender Rede für das, was Religion sagen kann,
keine besseren Worte findet, ... mit dieser, ohne sie zu
stützen oder zu bekämpfen, enthaltsam koexistieren".195
Johann Baptist Metz
Sein Name ist verbunden mit einer neuen Konzeption und Phase
der sog. Politischen Theologie; mit beachtlichen Auswirkungen
auf die Politik in der Dritten Welt, insbesondere in
Lateinamerika; mit erheblichen innerkirchlichen Turbulenzen
als Begleiterscheinung. Im Vorwort zur 5.Auflage von: „Glaube
in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen
Fundamentaltheologie“ (Mainz 1992) gibt Metz Rechenschaft
davon. Worum geht es der neuen Politischen Theologie?
Sie will letztlich nichts anderes sein als dies: Theologie,
Rede von Gott in dieser Zeit. Sie hat eingesetzt als eine Art
Korrektiv, als Korrektiv gegenüber einer situationsfreien
Theologie, gegenüber allen idealistisch geschlossenen oder
immer wieder sich schließenden theologischen Systemen. Sie
betrachtet sich in diesem Sinn als „nachidealistisch“. Sie
nährt sich aus einer gewissen Beunruhigung, ja aus einem
Ders., Texte und Kontexte. Frankfurt 1991, S.131.
Ebd., S.141f.
193 Ebd., S.136.
194 Ebd., S.135.
195
Ders., Nachmetaphysisches Denken. Philosoph. Aufsätze.
S.185.
191
192
Frankfurt
1988,
198
von
gewissen
Erschrecken,
aus
einer
Erfahrung
„Nichtidentität“.
Die „Situation“, die in den Logos der Theologie eingehen soll,
läßt sich durch eine Triade kennzeichnen: einmal die
unabgegoltene
Auseinandersetzung
mit
den
Prozessen
der
Aufklärung, dann die Erfahrung der Katastrophe von Auschwitz
und schließlich die Vergegenwärtigung der nichteuropäischen,
der Dritten Welt in der „Welt der Theologie“.
Metz gibt zu bedenken: „Wo die Theologie in ihren Aussagen
nicht nur eine postmoderne Religion der psychologischästhetischen
Seelenverzauberung
vertreten
will,
wo
sie
Religion nicht nur als Kompensation für verlorene Transzendenz
anbieten will, wo sie vielmehr immer noch auf der Rede von
Gott beharrt, wie sie ihr die biblische Tradition auferlegt,
gerät sie wissens- und wissenschaftstheoretisch allemal in
eine prekäre Situation. In dieser Situation habe ich versucht,
auf die Kategorie des (von anamnetischer Vernunft gestützten)
Vermissungswissens
aufmerksam
zu
machen.
Dieses
Vermissungswissen ist theologisch vor allem in den Traditionen
negativer Theologie beheimatet. Für mich ist es aus jenem
Erschrecken genährt, von dem eingangs die Rede war, dem
Erschrecken darüber, daß man
der christlichen Gottesrede
üblicherweise die himmelschreiende Leidensgeschichte der
Schöpfung so wenig ansieht und anhört. Kein Hauch von
Unversöhntheit liegt über der Theologie! Keine Erfahrung von
Nichtidentität, in der die ach so gewisse Rede über Gott in
die ratlose Rede zu Gott umschlägt! Ich weiß, solche negative
Theologie widerstrebt dem verbreiteten Postmodernismus unserer
Herzen mit seinem Hang zur unmittelbaren Affirmation und mit
seiner Provinzialisierung der Problemwelten. Aber ohne dieses
Erschrecken, ohne den Schmerz über die Widersprüche in der
Schöpfung läßt sich der Grundimpuls der hier vorgelegten
Theologie schwerlich nachvollziehen. Sie ist von einer
besonderen Theodizee-Empfindlichkeit geprägt.196 Und sie weiß
sich in allen Aussagen über Gott, seinen Christus und die Welt
einer Eschatologie verpflichtet, der die Vision von der
befristeten Zeit noch nicht abhanden gekommen ist – weder
durch
einen
wissenschaftlich-zivilisatorisch
gespeisten
Evolutionismus
noch
durch
die
Inthronisierung
der
unbefristeten Zeit als Majestät des Seins wie bei Friedrich
Nietzsche.“
Metz verlangt von den Theologen eine Art „metaphysischer
Zivilcourage“197, „ihre sperrigen Vermissungen
am Heute
198
ressentimentfrei zu formulieren“,
und von uns allen eine
Theodizee ist hier nicht verstanden im Sinn einer rationalen
Rechtfertigung Gottes, sondern im Sinn der Frage, wie überhaupt von Gott
zu reden sei angesichts der Leidensgeschichte der Welt, „seiner“ Welt.
197 Ausdruck von G.Anders geprägt. Vgl. Johannes Paul II., Fides et ratio.
198 J.B.Metz, Gotteskrise. Versuch zur ‚geistigen Situation der Zeit’. In:
Diagnosen zur Zeit. Mit Beiträgen von J.B.Metz, G.B.Ginzel, P.Glotz,
J.Habermas, D.Sölle. Düsseldorf 1994. 92.
196
199
„anamnetische
Kultur“.199
Inhalt
Vorbemerkung
1.
1.1
Religionsphilosophie - was ist das?
Vielfalt der Zugänge. Sichtung ausgewählter
Einführungen in die Religionsphilosophie
1.2
Begriff der Religion
1.3
Zur Geschichte der Religionsphilosophie
20
1.3.1
Religionsphilosophie der griechischen und
jüdischen Aufklärung am Beginn der europäischen
Geschichte
1.3.2
Statt eines vollständigen Abrisses der Geschichte
der Religionsphilosophie: eine Leseliste der
Primärliteratur
1.3.3
Einige Beispiele (Anselm v.Canterbury, Nikolaus
von Kues, Spinoza, Lessing, Wittgenstein)
30
1.4
Zur gegenwärtigen Situation der Religionsphilosophie
1.5
Wozu treibt man heute Religionsphilosophie?
1.6
Nachbardisziplinen
1) Religionsgeschichte
2) Religionssoziologie
3) Religionspsychologie
4) Religionsphänomenologie
5) Historisch-philologische Wissenschaften
(zu Cicero: Klass.Altertumswiss., Judaistik,
Orientalistik, Gnosis- u. Qumranforschung)
1.7
Unser Paradigma für Religionsphilosophie:
Gr. anámnesis = Erinnerung. Gemeint ist jenes „Leidensgedächtnis“, in
dem der Name Gottes als rettender Name, als anstehendes Ende der Zeit
erzählt und bezeugt wird. Vgl. J.B.Metz, Gott und Zeit. Theologie und
Metaphysik an den Grenzen der Moderne. In: K.Dethloff, L.Nagl, F.Wolfram
(Hrsg.), Religion, Moderne, Postmoderne. Philosophisch-theologische
Erkundungen. Berlin 2002. 63-78.
199
1
14
20
28
38
44
47
49
50
51
52
54
Warum gerade Cicero?
2.
200
57
58
2.1
Cicero: Mensch - Politiker Schriftsteller - Philosoph
Der Mensch Cicero - Grundzüge seines Wesens.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Ciceros Gedankenwelt als exemplum humanitatis
Anspruch und Anerkennung des Geistes in Rom
Beredsamkeit und Weisheit bei Cicero
Ciceros Freude an der Philosophie
Ist bei Ciceros Philosophie Neues zu erkennen?
Bemerkungen zur Philosophie der Römer
Cicero - Mittel zum Zweck
58
71
73
79
86
89
91
Ciceros philosophisches Schrifttum im Überblick
Consolatio und Hortensius
Akademische Untersuchungen
De finibus bonorum et malorum
Tusculanae disputationes
De natura deorum
De divinatione und De fato
Die kleinen ethischen Schriften Cato maior und
Laelius
De officiis
94
94
95
96
99
99
100
103
103
103
106
108
114
114
4.2.4
De natura deorum
Einleitung
Zur Religion und Religiosität des Volkes der Römer
Philologisches zum Werk De natura deorum
Der philosophiegeschichtliche Hintergrund
Kommentar
Zur Einleitung
Darstellung der epikureischen Theologie
durch Velleius
Epikur - Christentum
Die Glückseligkeit der Götter - u.d.Menschen
Kritik der epikureischen Theologie
Darstellung der stoischen Theologie durch Balbus
Existenz Gottes
Gotteserkenntnis - Sein (Wesen) Gottes
"Gottesbeweis", Gewißheit, Glauben
a) Vorsokratik
b) Sophistik
c) Plato
Auswirkungen philosophischer Theologie
auf das Christentum
Göttliche Vorsehung (Kausalität, Freiheit)
Zum Schluß des Buches
5.
Zum Nachwirken der Schrift De natura deorum
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
101
102
117
130
130
142
142
143
146
148
149
150
152
154
164
177
178
6.
Augustinus
David Hume
201
179
188
Zum Schluß
J.Habermas
J.B.Metz
191
192
194