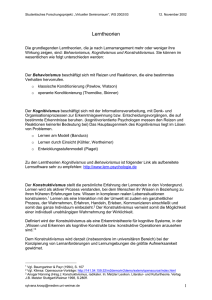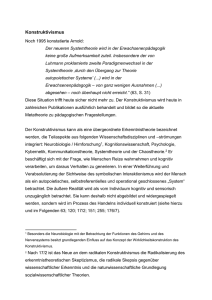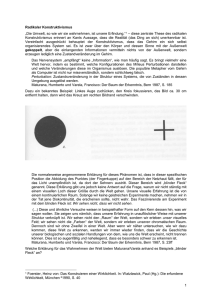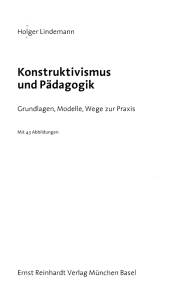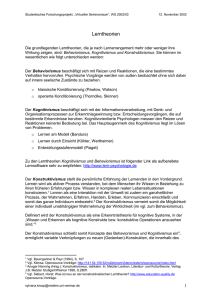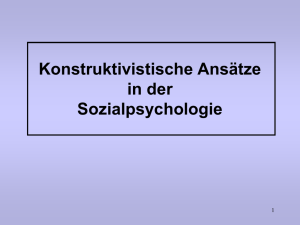3. Konsequenzen für die Lerntheorie und Didaktik
Werbung
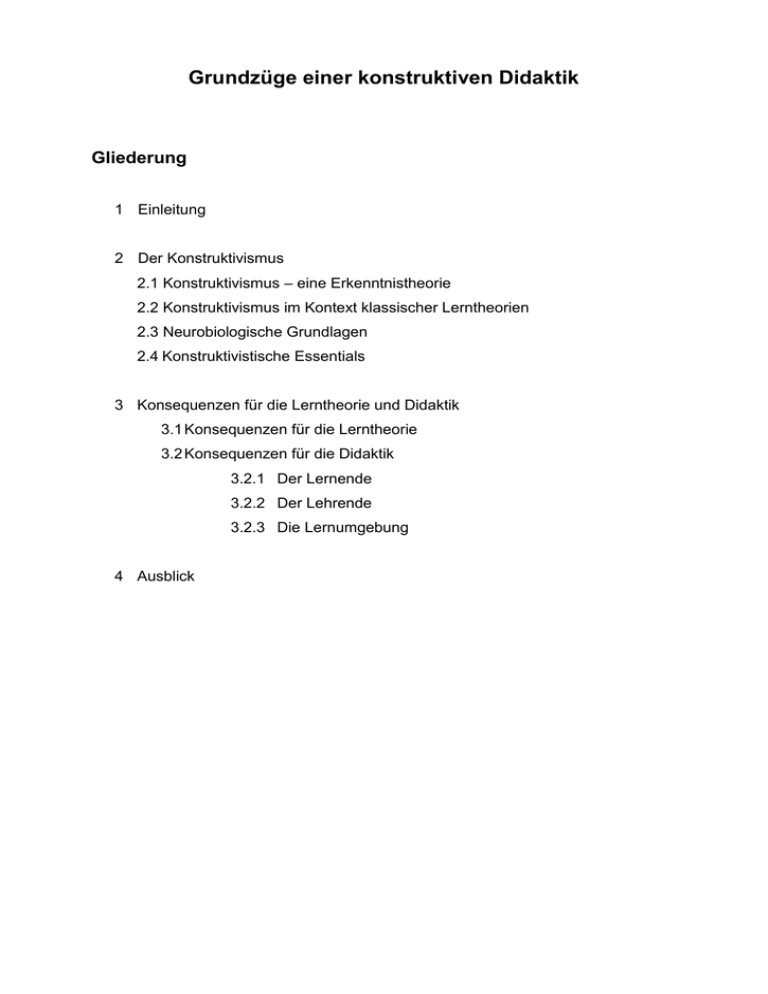
Grundzüge einer konstruktiven Didaktik Gliederung 1 Einleitung 2 Der Konstruktivismus 2.1 Konstruktivismus – eine Erkenntnistheorie 2.2 Konstruktivismus im Kontext klassischer Lerntheorien 2.3 Neurobiologische Grundlagen 2.4 Konstruktivistische Essentials 3 Konsequenzen für die Lerntheorie und Didaktik 3.1 Konsequenzen für die Lerntheorie 3.2 Konsequenzen für die Didaktik 3.2.1 Der Lernende 3.2.2 Der Lehrende 3.2.3 Die Lernumgebung 4 Ausblick 1. Einleitung Der Begriff „Konstruktivismus“ hat Hochkonjunktur. Was zunächst Anfang der 80er Jahre in kleinen „In-Groups“ begann verbreitete sich seit Beginn der 90er Jahre in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, rasant. Die Gedanken des Konstruktivismus sind nicht neu. Jedoch ist der genaue „Geburtszeitpunkt“ nicht auszumachen. Bereits die „Kopernikanische Wende“ im 18.Jh. hat an der Bildung des Theoriegebäudes des Konstruktivismus gewirkt. Der radikale Konstruktivismus geht u.a. zurück auf Ergebnisse der Kognitionspsychologie sowie Forschungsergebnisse der Neurobiologie. Der konstruktivistische Diskurs, an dem Wissenschaftler verschiedener Disziplinen beteiligt sind, hat zur breiten Popularisierung beigetragen und ist z.Zt. sehr aktuell. Er hat u.a. zu Kernaussagen (Essentials) in erkenntnistheoretischer, lerntheoretischer aber auch bildungstheoretischer Hinsicht geführt. Ich werden nachfolgend das Thema „Grundzüge des Konstruktivismus“ behandeln, indem ich zunächst den erkenntnistheoretischen Ansatz des Konstruktivismus erläutere, Grundsätze klassischer Lerntheorien sowie relevante neurobiologische Grundlagen skizziere, konstruktivistische Essentials darstelle und Konsequenzen für die Lerntheorie sowie Didaktik ableite. 2. Konstruktivismus 2.1 Konstruktivismus - eine Erkenntnistheorie Der Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie. Im Gegensatz zur Ontologie, die Aussagen über das Wesen der Welt und absoluten Wahrheit macht, beschäftigt sich die Epistemologie (Erkenntnistheorie) mit den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Wahrnehmens und Erkennens. Die epistemologische Kernthese lautet, dass unser Erkenntnisapparat die außersubjektive Realität nicht wahrheitsgetreu abbilden kann – dazu fehlen die gehirnphysiologischen Voraussetzungen -, sondern unsere Wahrnehmungen, Kognitionen und Emotionen konstruieren eine eigene Art von Wirklichkeit. (Siebert, S.6) Die Entwicklung des Konstruktivismus geprägt haben u.a. Heinz v. Foerster, Humberto Maturana, Ernst v. Glasersfeld, der insbesondere die Arbeit von Jean Piaget weiterentwickelt hat, Gerhard Roth und Paul Watzlawik.. Dabei fließen 2 Erkenntnisse aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen ein: Neurobiologie, Hirnforschung, Kognitionspsychologie, Informatik, Linguistik. Mit dem „Diskurs des Konstruktivismus“ haben sich mittlerweile mehrere Positionen des radikalen Konstruktivismus, sozusagen Konstruktivismen, gebildet. Ernst v. Glasersfeld bezieht sich auf ein kybernetisches Modell der Wahrnehmung, was von William T.Powers ausgearbeitet worden ist. Das Grundmodell besteht darin, dass Wahrnehmungen sowie alle darauf aufbauenden höheren Erkenntnisfunktionen als Konstruktion von Invarianten zu verstehen sind. Auf der untersten Ebene handelt es sich um eine Homöostase, die nach dem Prinzip eines Thermostats funktioniert: die zu regelnde Umweltgröße (Temperatur) wird gemessen, im Apparat (Gehirn) mit gespeicherten Richtwerten verglichen und aufgrund dessen eine Einwirkung auf die Umwelt (Heizung) veranlasst. Das Resultat beinhaltet, dass nicht vorgegebene Eigenheiten aus der Umwelt in den Organismus aufgenommen werden, sondern umgekehrt, dass in der Umwelt nichts anderes ist, als das, was durch interne Bedürfnisse festgelegt ist. Dieses Modell hat zunächst noch nichts mit Erkenntnis zu tun. Durch Rückkoppelungsschleifen entstehen homöostatische Kreisläufe, die Prozesse initiieren, die sich nicht mehr auf einfache Größen, sondern auf zunehmend abstrakte Gegenstände wie Sinnqualitäten, Prozessabläufe bis zu organisierten Systemen beziehen. Die Staffelung bewirkt dabei eine zunehmende Abkopplung von der Umwelt. Dies ist die Begründung dafür, dass das, was wir im allgemeinen für eine objektive Welt halten, in Wahrheit eine Konstruktion unseres Erkenntnisapparates ist. Humberto Maturanas erkenntnistheoretischen Überlegungen ergeben sich aus dem biologischen Konzept der Autopoiese (gr. Autos u. poiein = Selbstgestaltung), das er gemeinsam mit F.J.Varela entwickelt hat. Sie verstehen dabei Lebewesen als Systeme, die sich vollständig selbst herstellen. Die Organisation der Systeme ist darauf abgestellt, diese Organisation selbst aufrechtzuerhalten bzw. ständig zu erneuern. Dadurch wird der Zusammenhalt der Systemelemente gesichert. Es handelt sich um einen Kreisprozess, in dem Wahrnehmungen als äußere Einwirkungen nur den Status von Unterbrechungen haben, die den reibungslosen Ablauf der Autopoiesis stören. Sie lösen beim Organismus ein Verhalten aus, das die Störung beseitigt und den Normalzustand wiederherstellt. Es sind jedoch lediglich Strategien zur Störungsbeseitigung zu erlernen, keine umweltbezogenen Kenntnisse. 3 Insofern kann das, was ein Organismus lernt bzw. der Mensch erlebt, nicht anderes sein als das Produkt der autopoietischen Operation des Systems selbst. Die Erkenntnisleistung ist eine Konstruktion: Das Bild entsteht im Auge des Betrachters, und dieser ist für seine Weltsicht, die eine mögliche Konstruktion unter vielen“. (Overmann, 2002, Allefeld, 1997). Heinz v. Foersters Konstruktivismus orientiert sich an verschiedenen Gedanken, die sich nicht zu einer Theorie zusammenschließen lassen. Einen Schwerpunkt legt er auf das Konzept der Kybernetik. Die Grundfigur seiner Untersuchung ist die Rückwendung einer Operation auf sich selbst mit immer wieder neuen Variationsformen, z.B. Lernen lernen, Verstehen verstehen, Erkennen erkennen usw. Es ist als Kybernetik 2. Ordnung bezeichnet, die ihrerseits Beobachtungen durchführen: als Beobachtung von Beobachtungen. Die ursprünglich eingegebenen Werte rücken im fortlaufenden Operationen mehr und mehr in den Hintergrund, sie werden „vergessen“. Die erkenntnistheoretische Relevanz dieser Einsicht: die beobachteten Eigenschaften des Gegenstandes führen die geistige Koordination des Verhaltens eines Individuums, die wiederum die beobachteten Eigenschaften verändern und die ihrerseits zu anderem Verhalten führt. Das Resultat der Beobachtung entsteht aus den konstruktiven Eigenschaften des Beobachtungsprozesses und entspricht nicht der Abbildung einer objektiven Welt. (Allefeld, 1997) Gerhard Roth unterteilt die Wirklichkeit in drei Bereiche: „Die Welt der mentalen Zustände und des Ich, die Welt des Körpers und die Außenwelt. Diese drei Bereiche sind Aufgliederungen der phänomenalen Welt, der Wirklichkeit. Dieser Wirklichkeit wird gedanklich einer transphänomenalen Welt gegenübergestellt, die unerfahrbar ist....“ Das bedeutet, dass alle Erlebnisse sowohl zwischen mir und meinem Körper als auch zwischen mir und der Außenwelt laufen innerhalb der Wirklichkeit ab. (Roth, 1995, S.280) Erkennen bedeutet kein bewusstes Erleben, sondern dass neuronale Prozesse in den Sinnesorganen und im Gehirn so ablaufen, dass der Organismus mit seinem Verhalten auf sie reagiert und das Überleben sichert. Roth hat sich intensiv mit der Hirnforschung beschäftigt und Kognition als eine Funktion des Gehirns dargestellt. (s.a. Pt. 2.3) (Overmann, 2002) 4 Einer wichtiger Vorläufer des Konstruktivismus war Jean Piaget. Ihn interessierte das Problem des Werdens der menschlichen Erkenntnistätigkeit. Er ging damit in einen Bereich, der bislang der Philosophiewissenschaft zugeordnet war. Er erkannte, dass Erkenntnis kein Abbild der Wirklichkeit ist, sondern „....dass der Mensch seine Wirklichkeit durch seine Assimilationsschemata hindurch erfährt. Er erfasst von ihr nur soviel, als diese hergeben .. Nur dann, wenn er über das entsprechende Schema verfügt..“. Reichen die vorhandenen Schemata nicht aus, um sich den Erfordernissen der Umwelt anzupassen, müssen vorhandene Denkschemata differenziert oder umgebildet werden. (s.a. Pt.(Dichanz, Eubel, Schwittmann, 1983, S.153 ). Das Ergebnis der Weiterentwicklung des Theorieansatzes ist die Radikalität des Ansatzes, das beinhaltet, dass jedes Wissen ist eine Konstruktion, weil das wissende Subjekt keine Möglichkeit hat, sein Wissen jenseits seiner Erfahrungswelt zu verifizieren.(Käser, 2002) Der Konstruktivismus ist keine kohärente Theorie, d. h. es besteht keine Deckungsgleichheit in den theoretischen Ansätzen der verschiedenen Autoren. Jedoch lehnen alle konstruktivistischen Grundpositionen übereinstimmend die Unterscheidung von Subjekt und Objekt ab, da sich die Wirklichkeit aus der kognitiven Konstruktion unseres Gehirns ergibt. Die Umwelt wird immer als Objekt eines Subjekts wahrgenommen. (Overmann, S.5) 2.2 Konstruktivismus im Kontext klassischer Lerntheorien Die Kognitionswissenschaft befasst sich mit dem Erwerb von Wissen und den Einsatz von Wissen bei der Verhaltenssteuerung. Sie ist wissenschafts-geschichtlich mit der Einführung des Informationsverarbeitungsbegriffs in Verbindung mit Entwicklung von Computern entstanden, wo die Informationsverarbeitungsschritte gegliedert sind in Input (Eingabe, Wahrnehmungsreize) – Verarbeitung (= Denk- und Gedächtnisprozesse) – Output (Reaktion, Verhalten). (vgl. Grubitsch, 1998) 5 Innerhalb der Lerntheorien gibt es zwei wesentliche Gegensätze: 1. Die behavioristischen Lerntheorien 2. die Kognitive Entwicklungstheorie von Jean Piaget. Die behavioristische Lerntheorien Zu den behavioristischen Lerntheorien gehören im Wesentlichen die Die klassische Konditionierung (Ivan Pawlow) Die operante (instrumentelle )Konditionierung (Burrhus Frederic Skinner) Es handelt sich bei beiden Ansätzen um die Reiz-Reaktions-Schema. Die klassische Konditionierung ist eine Form des Lernens, bei der der Organismus eine neue Assoziation zwischen zwei Reizen (Stimuli) lernt: einem neutralen und einem, der bereits eine Reflexreaktion (physiologisch) auslöst. Beim instrumentellen Konditionieren soll gelernt werden die Beziehung zwischen Verhalten und ihren Konsequenzen, nicht die zwischen Reizereignissen (wie beim klassischen Konditionieren). Das Verhalten stellt das Instrument (Mittel) dar für bestimmte wünschenswerte oder belohnende Umweltveränderungen; zur erlernter Gewohnheit wird es erst durch Wiederholungen. Bei den behavioristischen Lerntheorien wird der Lerner selbst beschrieben als weißes Blatt / Black Box , der durch Reize aus der Umwelt und steuerbaren Stimuli zu Verhaltensänderungen determiniert wird. Der eigentliche Lernvorgang, d.h. „was im Kopf mit den Reizen passiert“, interessiert nicht und wird außer acht gelassen. 6 Die kognitive Entwicklungstheorie von Jean Piaget Die kognitive Entwicklungstheorie von Jean Piaget beschreibt das Lernen als einen dynamischen intra-personellen Konstruktionsprozess. Die Umwelt wird dabei als Anregung benutzt, d.h. Reize werden aufgenommen und verarbeitet. Die Impulse gehen jedoch vom Lernenden selber aus, in dem er aktiv nach dem sucht, was ihm in seiner Umwelt problematisch erscheint. Mit der Lösung des Problems wird Erkenntnis aufgebaut. Entscheidende Einflussfaktoren auf die kognitive Entwicklung haben Reifung, aktive Erfahrung, soziale Interaktion und Streben nach Gleichgewicht (Äquilibration) durch Adaption. Bei den Anpassungsvorgängen ist zu unterscheiden zwischen Assimilation und Akkommodation. Bei der Assimilation wird die Information, die das Individuum aufnimmt so verändert, dass sie sich in ein vorhandenes Schema (s.u.) einfügt. Das bedeutet, das Bestehende wird erweitert. Bei der Akkommodation werden die Schemata selbst verändert, damit sie nicht zu der Gesamtstruktur im Widerspruch steht. Ein Schema ist als ein Grundbaustein des Wissens zu sehen, sozusagen als ein Wissens- und Verhaltensmuster vergleichbar mit „Karteikarten“. Beispielsweise fiele unter die Karteikarte „Blumen“ z.B. Rose, Tulpe, Nelke etc.. Der Vorteil dieser „Strukturierung“ oder auch Kategorisierung ist, dass man sich nicht an jede Situation/Gegenstand neu gewöhnen muss. Die Schemata entwickeln sich durch Differenzierung des Wissens (= Akkommodation), d.h. die vorhandenen kognitiven Strukturen verändern sich selbst. Beispiel: Ein Kind erhält zum ersten mal ein Eis am Stiel. Dieser Vorgang aktiviert vorhandene Erfahrungsschemata, um Informationen durch aktive Organisations- und Verarbeitungsleistungen an bisheriges Wissen anzugleichen. Das kann in diesem Fall bedeuten, dass das Kind bereits Erfahrungen mit einem Bonbon-Lutscher gemacht hat. Dieser sieht dem Eis am Stiel am ähnlichsten von allen anderen Süßigkeiten, die das Kind bisher kennengelernt hat. Das Subjekt (Kind) organisiert und aktiviert dieses Erfahrungsschema und handelt, d.h. es beginnt am Eis zu lutschen wie zuvor am Bonbon-Lutscher. Das Kind merkt, dass das Eislutschen sich anders anfühlt wie ein Bonbon lutschen: das Eis ist kälter und weicher, es schmilzt und tropft weg. Das bedeutet, es kommt im Erlebnisfeld des Subjekts zu einer kognitiven Widersprüchlichkeit. Das Subjekt wird nach einem Gleichgewicht streben und nach Ausgleich suchen. Es handelt sich um eine Assimilation, wenn das Eislutschen ähnlich wie das Bonbonlutschen wäre. Da aber das Eis im Gegensatz 7 zum Bonbon einen großen Unterschied in der Konsistenz aufweist, genügt die Assimilation nicht, um die Situation zu bewältigen. Das Kind muss in diesem Fall akkommodieren, d.h. das Schema „Süßigkeit“ verändern: Veränderung der Karteikarte „Süßigkeit: weich, kalt, schmelzend“. Der Ausgleichsprozess wird auch als Äquilibration bezeichnet. Er kennzeichnet das Bemühen des Organismus’, aktiv neue Erfahrungen, Informationen, Zusammenhänge in schon bestehende strukturelle Rahmen einzuordnen oder diese zu verändern. (Quelle: URL:http//arbeitsblaetter.stangltaaller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/default.stml, S.3) 2.3 Neurobiologische Grundlagen Die Fortschritte der Hirnforschung haben u.a. dazu geführt, dass sie mittlerweile in Phänomenbereiche eindringt, die traditionell der Philosophie, Psychologie u.a. 8 Geisteswissenschaften vorbehalten waren, z.B. Untersuchungen von Bewusstseinszuständen, bewusstem und unbewusstem Wahrnehmen und Lernen, Gedächtnis, Erinnerung und Vorstellung, Sprache, Intelligenz, Handlungsplanung und Handlungskontrollen aber auch moralisch-ethische sowie religiöse Vorstellungen.(vgl. Roth, 2002, S, 2f). G. Roth geht davon aus, dass die Erregungsimpulse in den Nervenbahnen, die von den Sinnesorganen ausgehen, einer unspezifischen oder undifferenzierten Codierung unterliegen. Neuronale Erregungen sind abhängig von der Reizstärke, z.B. schwaches Licht erzeugt seltene Impulse an der Netzhaut des Auges, starkes Licht häufige. Von Bedeutung sind lediglich die Frequenzen und nicht die Modalität, z.B. Hörimpulse, Sehimpulse und auch nicht die Qualität, z.B. die Farbe, hoher oder tiefer Ton. Die Sinnqualitäten werden erst in den Zentren der Hirnrinde erzeugt und interpretiert. Wichtig ist, das die entsprechenden Aufnahmeorgane an die entprechenden Hirnarealen über neuronale Verbindungen angeschlossen sind, z.B. Netzhaut über den Sehnerv mit dem Sehzentrum im Hinterhauptslappen des Großhirns. Verschiedene Arten von Sinneseindrücken können gemeinsam verarbeitet werden. Über eine Vielzahl an Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Gehirns ergeben sich auch unterschiedliche Kontaktbereiche zur Umwelt, wodurch eine für das Subjekt einheitliche Welt konstruiert wird. Kognition ist als Funktion des Gehirns ein selbstreferentielles System: Es beschreibt ein von der Umwelt abgeschlossenes System, das sich selbst regelt (autonom arbeitet). Es ist dabei zwar auf äußere Einflüsse aus der Umwelt angewiesen, wird von ihr beeinflusst, jedoch nicht gesteuert. Die eingehenden Daten werden nach ihm eigenen Regeln ausgewertet. Nur so ist das das Gehrin in der Lage, sinnliche Eindrücke zu verarbeiten und daraus Verhalten zu generieren, das erfolgreiche Selbsterhaltung zu sichern. Ein umweltoffenes System dagegen würde Reize sofort in Reaktionen umwandeln, z.B. physiologische Reflexe. Auf diese Art würde zwar Überleben gesichert werden können, aber keine Wahrnehmungs- und Erkennensleistungen möglich. Die Frage ist, was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Didaktik beitragen? Nach H.Schirp (2003) gibt es bis heute nur wenige systematische Initiativen, Ergebnisse der Kognitions- und Lernwissenschaften in professionsbezogene 9 Wissens- und Handlungsmodelle von Lehrenden zu überführen, da zwischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik zwischen 2 Wahrnehmungsmustern gibt: 1. keine wirklich gesicherten lernbiologischen Forschungsergebnisse über unsere Gehirnfunktionen, woraus sich Gestaltungshinweise für Lehrund Lernprozesse ableiten lassen 2. alles, was bisher aus Neurobiologischen Ergebnissen auf Lernen beziehen lässt, nur das bestätigt, was längst über Unterricht bekannt ist. Die Neurobiologen selbst weisen daraufhin, dass sie bei dem Versuch das Gehirn zu verstehen, sie immer noch am Anfang stehen. Weitere Fragen ergeben sich: Was muss ich über Denk- u. Speichervorgänge wissen? Wie geschieht Lernen? Welche Strukturen sind beteiligt? Kann ich als Lehrender darauf Einfluss nehmen, wenn ja, wie? Nach Schirp (ebd.) sind folgende 3 Bereiche aus den Ergebnissen der Neurobiologie und Gehirnforschung für die Weiterentwicklung unterrichtlichter Lehr- und Lernprozesse von Bedeutung: 1. Muster und Mustererkennung 2. Sinn, Relevanz und Bedeutung 3. Emotion und Kognition Muster und Mustererkennung 1. Muster und Mustererkennung Im neuronalen Netzwerk des Gehirns ist alles gespeichert, was wir an Verhaltens, Denk- u. Handlungsmustern benötigen „Neuronales Universum“ in unserem Kopf: ca. 80 – 100 Mrd. Neuronen, die wiederum mit bis zu 10.000 anderen Neuronen verbunden bilden dieses neuronale Netzwerk. Bei der Geburt: die allermeisten Neurone sind noch unspezifisch und noch nicht strukturdeterminiert. Mit jedem Wahrnehmungs- und Verarbeitungsvorgang entstehen in den jeweils beteiligten neuronalen Strukturen Ladungsprozesse. Entwicklung von neuronalen Mustern / Clustern: Gleiche Inputs und Verarbeitungsprozesse bewirken die Ansprechbarkeit und Entwicklung gleicher Zellverbände Bei Regelmäßigkeit und Musterhaftigkeit stellen sich Neurone immer besser auf bestimmte Inputsignale ein. Wichtig ist die Häufigkeit. 10 Einzelne Neurone und neuronale Netzwerke beginnen sich zu spezialisieren Häufig auftretende und wahrgenommene Muster führen dabei zu ähnlichen neuronalen Mustererkennungs-Prozessen und zu quantitativ gehäuften Repräsentanzstellen (neuronale Landkarten im Gehirn) Entstehung von Clustern von ähnlichen Mustern Spezialisierte Neuronen bilden selbst wieder größere Gruppen und Verbände von einfachen bis zu hochkomplexen Wahrnehmungsmustern Damit können wir alles verarbeiten, was wir zur Bewältigung unserer Lebenswirklichkeit brauchen Das neuronale Potential nimmt mit zunehmenden Alter quantitativ ab. Es wird dafür strukturierter, konturierter und funktionaler. Das bedeutet, unser Gehirn erhält seine Konturen dadurch, dass wegfällt, was nicht gebraucht wird. Konsequenzen für gehirngerechtes Lernen: 1. je häufiger bestimmte ähnliche Muster angeboten werden u.a. Signale im Gehirn aufgenommen u. verarbeitet werden, desto größer und intensiver wird die neuronale Repräsentanz Deshalb gilt: Übungen häufig u. kurz anlegen 2. je intensiver die Inputs – auch in leichter Varianz – angeboten werden, desto größer werden die entsprechenden Repräsentanzflächen und die musterbezogene Speicherkapazität im Gehirn. Für Übungen wäre wichtig, dass sie zwar in gleichen Mustern aber in leicht abgewandelt Form durchgeführt werden, damit sich eine möglichst breite Repräsentanzfläche entwickeln kann. 3. Regeln und Muster werden nicht als einzelne Regeln u. Muster gelernt, sondern aus wiederkehrenden Beispielen und modellhafte Situationen. Für das Lernen gilt: das Regelhafte als neuronales Muster durch entsprechende Beispiele und Wiederholungen aufbauen. 4. wenn ein Lerngegenstand mehrere spezifische Muster beinhalten, z.B. sozialkommunikative, fachbezogen, emotionale usw., führt das auch zu einer Ausweitung der Repräsentanz. Der Lerngegenstand wird mit seinen unterschiedlichen Aspekten in unterschiedliche Muster an unterschiedlichen Stellen im Gehirn verarbeitet. Für Verstehens- und Übungszwecke ist es wichtig, Lerngegenstände in unterschiedlichen Kontexten zu stellen. 5. Neuronale Muster bauen häufig aufeinander auf und bilden Abfolgen von einfach zu komplex werdenden Mustern. Hören, Verstehen, Akzeptieren und 11 entsprechendes Handeln sind jeweils eigenständige Muster. Sie müssen als eigenständiger Prozess angesehen und im Lerngeschehen entsprechend verankert werden. Die Übergange zu den jeweils komplexeren Mustern müssen ebenfalls intensiv eingeübt werden, damit die nächst höhere und komplexere Leistung überhaupt erbracht werden kann. 6. Für die Lerngestaltung ist wichtig, implizite und explizite Lernvorgänge zu berücksichtigen: Explizite und bewusst erwerben wir unser Fachwissen (lesen, TV-Sendungen, Unterricht, Implizit: unbewusstes Lernen, Wahrnehmungen, motorische Verhaltensweisen, soziale Einstellungen, emotionale Reaktionen. Wir übernehmen Muster von den uns umgebenden Personen und Gruppen im Alltag, weil wir sie als erfolgreich, alltagstauglich und viabel erfahren. Wir nehmen solche Muster unbewusst als Modelle wahr und übernehmen sie oft unreflektiert als eigene Orientierungsmuster. Das gilt z.B. für pro-soziales Verhalten, Einstellungen, Motivationen. Implizite Muster sind häufig sehr stabil, weil sie auf eine lange Entwicklung basieren und entsprechend breit neuronal präsentiert sind. Achtung: wenn es um Wertorientierung und um ein soziales Verhaltens geht, dann bleiben alle dazu gehaltenen Unterrichtsstunden umsonst, wenn die Werte, die als wichtig dargestellt werden, nicht auch von allen in der Schule arbeitenden Personen und Gruppen respektiert werden. Hier bestätigt sich das, was in einem anderen Beschreibungsparadigma „geheimer Lehrplan“ genannt wird. 12 2. Sinn, Relevanz und Bedeutung: Unser Gehirn kann zwar nicht alles, was er an Inputs erhält verarbeiten und speichern und zu jedem gewünschten Zeitpunkt wieder abgerufen werden – wie z.B. ein Computer. Dafür kann das Gehirn nach Kategorien von „Sinn“, „Relevanz“ und „Bedeutung“ unterscheiden und arbeiten und aufgenommene Eindrücke eigenständig verarbeiten, auch unabhängig von Außeneindrücken in parallel ablaufenden unterschiedlichen Verfahren neue Eindrücke und bereits verarbeitete Eindrücke miteinander vernetzen und mit verarbeiteten Erfahrungen in Beziehung zu bringen. Das heißt: Wir lernen und behalten eigentlich nur das, was Sinn macht, was wichtig für uns ist und was für uns Bedeutung hat. Zentrale Stelle im Gehirn: Hypocampus: - Er ist die Nabe, um die sich alles dreht. Er bildet die Schaltzentrale von überragender Bedeutung für unsere Lern- und Verarbeitungsprozesse. - Als Neuigkeitendetektor unterscheidet er zwischen alt, bekannt, unwichtig, unbedeutend, uninteressant, neu, unbekannt, wichtig, bedeutsam, etc.. - Er sorgt dafür, dass Sinnesreize, die zuerst in der Großhirnrinde bearbeitet werden, eine besondere Bedeutung zugewiesen bekommt. - Er initiiert den Prozess, dass Fakten, Ereignisse, Situationen und Neuigkeiten auch tatsächlich bewusst wahrgenommen und intensiver verarbeitet werden können. - Er verfügt offensichtlich auch über die Fähigkeit, nicht vollständige Informationen zu „vervollständigen“: indem er sie mit bereits existierenden Repräsentationen vergleicht und sie stimmig macht, wo dies sinnvoll erscheint. - Der Hypocampus sorgt dafür, dass wichtige Ereignisse in langfristige Speicherstrukturen überführt werden: = Steuerung bzw. Einfluss auf Speicher- und Erinnerungsprozesse. Der Hypocampus hat ein kleines Speichervermögen, lernt dafür neue wichtige Einzelheiten, Ereignisse usw. schnell. Der Cortex hat ein großes Speichervermögen, lernt dafür sehr langsam (Veränderung des neuronalen Potentials) und 13 eigentlich nur dadurch, dass bestimmte Informationen und Muster immer wieder, auch in neuen Zusammenhängen und unterschiedlichen Kontexten angeboten und verarbeitet werden. Diesen Prozess steuert der Hippocampus. Er leitet deshalb bei entsprechender Wichtigkeit oder Wiederholung die Impulse an das Großhirn weiter, wo sich die neurale Präsenz bildet – u.z. Tag und Nacht, also auch im Schlaf: Der Hippocampus gilt als Trainer und Lehrer des Großhirns - Unser Gehirn ist auf diese Art zu 90% mit sich selbst beschäftigt; nur 10% mit der Informationsverarbeitung aus der Umwelt Gedächtnisse: - Unterscheidung nach der zeitlichen Dimension: Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis - Unterscheidung nach Inhalt: deklaratives Gedächtnis (explizites Wissen) und nicht-deklaratives Gedächtnis (implizites Können) Das spezifische an unserem Gedächtnis ist jedoch, dass wir das Wahrgenommene nicht einfach pur aufnehmen, abspeichern, behalten und genauso erinnern. Es ist vielmehr so, dass immer dann, wenn wir uns an Ereignisse und Situationen erinnern, wir nicht auf das „eigentliche“ Ereignis in Reinkultur zurückgreifen können, sondern nur auf die von unserem Gehirn gespeicherte Formen der Verarbeitung. D.h. die zu speichernde Situation ist bereits mit einer Vielzahl von kontextuellen Bezügen in Beziehung gesetzt und entsprechend in komplexer Form abgespeichert worden. Das bedeutet: wenn man sich erinnert, erinnert man sich nicht an die Sache selbst, sondern nur an das letzte Mal, wo man sich an sie erinnert hat. Diese Art der Abspeicherung ist höchst ökonomisch: die vielfältigen Vernetzungen sorgen nämlich dafür, dass der Rückgriff auf abgespeicherte Inhalte auf vielfältige Art und Weise möglich ist. Es gibt sozusagen mehrere „Schlüssel“ für Erinnerungszugänge, um Erfahrenes und Gelerntes wieder zu erschließen zu können. 14 Für das Lernsituationen bedeutet diese Erkenntnis: 1. Lehr- und Lerngegenstände mit individuellen Erfahrungen der SchülerInnen verbinden 2. Lehr- und Lerngegenstände sollte vielfältige Zugänge aufweisen sowie mehrkanalige, kognitive und emotionale Verarbeitungsformen miteinander kombinieren, z.B. Sachinformationen mit Geschichten verbinden, Einbeziehen der SchülerInnen, 3. Aufmerksamkeit erregen: Lernangebote mit hohem Neuigkeitswert, überraschende Darstellungen, Rätseln, kognitive Widerstände etc. anbieten. Nur wenn der Hippocampus angeregt wird, leistet er seinen ersten Beitrag für eine erste Speicherung 4. Angebot an lernspezifische Strukturierungsangebote: sie erleichtern die Übertragbarkeit stabiler Repräsentations- und Behaltensmuster in das Langzeitgedächtnis: mind-maps, Kernsätze, Kurz-Memos. 3. Emotionalität und Kognition Emotionale Zugänge sind für unsere Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsprozesse bedeutsam Emotionale Zugänge laufen messbar schneller ab, als kognitive. D.h. bevor wir selbst uns entscheiden, etwas zu wollen, haben die für unsere Emotionen zuständigen neuronalen Strukturen die Situation schon „bewertet“ und entsprechende Aktionspotentiale aufgebaut. Emotionale Erregungszustände können sich sowohl positiv wie negativ auf Lernen, auf Behaltensleistungen, auf die Aktualisierung von deklarativen Gedächtnisinhalten und Leistungspotenzialen auswirken: In angstbesetzten Situationen, unter Leistungsdruck oder in Überforderungssituationen verschlechtern z.B. Stresshormone nachweislich die Leistungsfähigkeit vieler neuronaler Funktionen und wirken leistungsmindernd auf den Hippocampus. Wir können zwar immer noch einfache Aufgaben lösen, jedoch sind blockiert, wenn es um das Lösen kreativer, assoziativer Aufgaben oder divergentes Denken geht. Emotionale Intelligenz: mit Hilfe unserer Emotionen können wir neue und tragfähige Zugänge zum Verstehen von Situationen herstellen und damit häufig schnelle und sinnvolle Verstehensprozesse organisieren. 15 Gefühle sind nicht auf Lerngegenstände sondern auf Lernkontexte bezogen. Eine auf Wertschätzung individueller Fähigkeiten und Anstrengungen angelegt Lernatmosphäre und ein gutes soziales Klima sind Schlüsselvariablen für erfolgreiches Lernen und Leisten. Wenn schulische und unterrichtliche Konzepte dabei helfen, über eigene und fremde Gefühle nachzudenken und sich ihrer bewusst zu werden, dann leisten sie eine wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines vernünftigen Selbst-Bewusstseins. Folgende Lernarrangements eignen sich: 1. Gestalten von Lernsituationen, die individuelle Lernverfahren und selbstständige Lernprozesse unterstützen 2. Gestalten von Lernsituationen, die positive Bedeutung der Lernprozesse und –ergebnisse vermitteln. 3. Variationsreiche Formen von Übungen, Leistungsförderung und Leistungsdarstellungen. Es ist dabei auf Entwicklungsstand und emotionale Selbstkonzepte der SchülerInnen achten: Nicht alle müssen alles zur gleichen Zeit können! Die jetzigen Formen von Leistungsförderung und – bewertung sind nicht lerntheoretisch oder neurobiologisch begründet, sondern lediglich formal-organisatorisch. 4. Einsatz von kooperativen und sozialen Lernarrangement: dabei sind emotionale Erfahrungen der Lernenden mit einzubeziehen. 5. gegenseitiges Wertschätzen von Anstrengungen und Ergebnissen. 6. Gefühle und darauf bezogenen Verhaltensweisen müssen auch in Unterricht und Schulleben Thema sein, reflektiert werden. Ziel ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt, das Erlernen von angemessener Kontrolle über eigene Gefühle und der verantwortungsvolle Umgang mit Gefühlen anderer. Dazu gehört auch, dass Schüler lernen, mit Leistungs-, Prüfungs- u. Versagensängsten umzugehen. 7. Als Methode kommen hier auch in Betracht: Bewegungs- und Entspannungsformen sowie kreative und musisch orientierte Lernzugänge. 16 Konstruktivistische Essentials Aus den Erkenntnissen der kognitiven Lerntheorie und der Neurobiologie sowie der Hirnforschung haben sich Hauptpunkte für den Konstruktivismus ergeben, die sich in folgenden Essentials niederschlagen (vgl. Overmann): 1. Es gibt keine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit. Denken und Erkennen sind nicht vom demjenigen zu trennen, der denkt und erkennt 2. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit als Subjekt selbst. Danach ist das Objekt immer nur Objekt eines Subjekts. 3. Wir erkennen die Dinge nicht so wie sie sind, sondern nur so, wie sie uns erscheinen 4. Die Realität ist prinzipiell unerkennbar 5. Die Umwelt, wie wir sie empfangen ist unsere Empfindung 6. Die menschliche Wahrnehmung ist, ähnlich wie bei den kognitiven Verhaltenstheorien, ein neuronaler Konstruktionsprozess im Gehirn, der über die Sinnesorgane ausgelöst wird. 7. Der Mensch filtert als beobachtendes System die ihn perturbierenden wahrgenommenen Phänomene auf seine individuelle einzigartige Art und Weise und konstruiert seine ihm eigene kognitive Wirklichkeit durch die Fähigkeit zur Selbstorganisation. 8. der Aufbau von Wissen ist immer an die kognitiven Funktionen des Beobachters gekoppelt 9. Wahrnehmung und Erkenntnis können von außen nicht steuernd beeinflusst werden 10. Der Mensch ist ein autonomer, selbststeuernder, zu bereits vorhandenen Werten zurückgehender, organisierter und strukturdeterminierter denkender Organismus (=Autopoiese), d.h. dass sich das Gehirn selbst herstellt, sich selbst konstruiert. 11. Im Sinne des radikalen Konstruktivismus steht der Mensch als von der Umwelt abgeschlossenes, selbsterhaltendes System nicht in einer Ursache-WirkungsBeziehung zur Umwelt (selbstreferentielles System) 17 3. Konsequenzen für die Lerntheorie und Didaktik 3.1 Konsequenzen für die Lerntheorie Nach dem konstruktivistischen Ansatz ist Lernen kein passives Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen und Reizen aus der Umwelt, sondern ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion. Wahrnehmung und Erkennen stellen mentale Operationsprozesse dar, die der Lernende ganz individuell auf Basis seines Vorwissens realisiert. Wissen ist zudem in soziale Bezüge konstruiert und unabgeschlossen. Dem Sinn des „autopoietischen Systems“ zufolge, konstruiert sich das Subjekt immer nur mögliche Bilder von Welten aufgrund von Reizen aus der Umwelt. Offen bleibt, wie weit dieselben Reize von verschiedenen Subjekten als gleich erlebt werden. Aus neurobiologischer Sicht entsteht die subjektive Wirklichkeit durch Eigenaktivität des Gehirns, das durch unspezifische Impulse (Hörwellen, Lichtwellen usw.) der Umwelt gereizt wird. Je nachdem wo die Impulse im Gehirn landen, werden sie als Melodie oder als Bild interpretiert. Der Lehrende kann lediglich den Transport von Energie auslösen, welche die Gehirnaktivitäten anregen, jedoch niemals bedeutungstragende Informationen. Kann es denn nach der konstruktivistischen Sichtweise gar keine Beeinflussung im Sinne von Wissensvermittlung geben? Beeinflussungen nach konstruktivistischer Sichtweise werden als Perturbationen (Störungen, Verwirrung) bezeichnet. Sie sind nicht inhaltsbestimmend. Der Lerner muss sie willentlich zulassen und „offen“ sein dafür, dass äußere Faktoren assimiliert werden können. Erst dann können elektrische Aktivitäten der Rezeptorzellen in subjektbestimmte Vorstellungen gestaltet werden. Dieser Vorgang der Perturbation wird vom Individuum unterschiedlich äquilibriert. Daraus kann gefolgert werden: jeder Lernende in Lernsituationen benötigt unterschiedliche Zeiten für das Lernen (Perturbation und Äquilibration) jeder Lernende erarbeitet unterschiedliche Bedeutungen es ist nicht möglich, einem Schüler etwas gegen seinen Willen beizubringen es ist demzufolge unsinnig, konkrete Lernziele zu formulieren 18 eine Lernzielkontrolle z.B. in Form einer Klassenarbeit, in der alle Schüler zur gleichen Zeit das gleiche Wissen wiedergeben müssen steht den o.g. Erkenntnissen im Widerspruch die Bewertung einer subjektiven Leistung objektiv für alle Schüler gleich nach festgelegten Leistungskriterien scheint ebenso widersinnig: der Lehrende bewertet nicht das, was der Lernende mental assimiliert hat, sondern zeigt Defizite auf, die der Lerner möglicherweise nicht assimilieren wollte. Geprüft wird, was der Lernende auswendig gelernt hat, jedoch keine Flexibilität. Eine traditionelle gute oder schlechte Bewertung einer Klassenarbeit sagt höchstens aus, ob der Lehrende den Lernenden gut oder schlecht zum Lernen hat motivieren können. Besteht eine Differenz in der Anpassungsfähigkeit zwischen Lehr- und Lernersystem (Lernumwelt und dem autopoietischen System des Schülers) bewertet der Lehrende eher seine eigene Methodenkompetenz Wie muss demnach das Lernsystem gestaltet sein, um diesen Erkenntnissen gerecht zu werden? Für den Lehrenden ist von Bedeutung zu wissen, dass Wissensvermittlung im Sinne einer Übertragung nicht möglich ist, die Unterrichtsgestaltung möglichst wenig Außensteuerung beinhaltet und Unterrichtsergebnisse nicht vorhersehbar sind. Es müssen neue schulische und unterrichtliche Modelle entwickelt werden, die sich an den Bedingungen und Möglichkeiten des Lernprozesses der Lernenden orientiert. Vorrangiges Ziel von Unterricht sollte darin bestehen, das autopoietische System der jeweils Lernenden zu perturbieren. Der Lehrende ist aufgefordert, seine Rolle als instruierender Wissensvermittler zu überdenken, statt Antworten zu geben, Fragen stellen und Paradoxien herstellen. Da der Lernende nur begreift, wenn ihn etwas „ergreift“. Der Lernende muss neugierig, kritikwillig, fragend, verwirrt, sein. (Overmann) 19 3.2 Konsequenzen für die Didaktik 3.2.1 Der Lernende Voraussetzung für Wissenskonstruktionen sind Freiheit und Komplexität der Lernsituationen. Wenn der Lernende den Nutzen des Lerngegenstandes für seine Weltkonstruktion erkennt, wird er sich auf eine Lernreise einlassen mitsamt seinen Erfolgs-, Misserfolgserlebnissen, Anstrengungen und Überraschungen. Im einzelnen bedeutet das für den Lernenden: soll aus der Spezialität einer Realsituation durch Abstraktion und Verallgemeinerung die zugrundeliegenden allgemeinen Aussagen, Regeln und Strukturen herausarbeiten Die erworbenen Strategien sind in verwandten Situationen anzuwenden und zu übertragen auf unbekannte neue Situationen Der Lernende muss sein Wissen über den Lerngegenstand und seine Bedeutung selbständig herstellen und aufgrund seiner eigenen Erfahrungen konstruieren. Bei der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ist es wichtig, dass der Lernende möglichst verschiedene Betrachtungsweisen einnimmt, in dem er die Vielfalt der Bezüge und die Bedeutung des Lerngegenstandes erfassen kann. Beispielsweise ist der Unterrichtgegenstand „Verbandwechsel“ innerhalb der Kranken- und Gesundheitspflegeausbildung aus möglichst umfassenden Perspektiven zu beleuchten, angefangen bei der Berücksichtigung des Patientenzustandes, seiner Wunde, Wirkweisen von Verbandsmaterialien, Kontraindikationen, hygienische Aspekte aber auch wirtschaftliche Aspekte usw. bis zur Durchführung der kompetenten Wundversorgung. Auf diese Weise wird vernetztes Denken und auch soziale Verantwortlichkeit gefördert. 20 3.2.2 Der Lehrende: Der Lehrende erzeugt nicht mehr das Wissen in den Köpfen der Schüler, sondern er ermöglicht den Prozess des selbständigen Lernens und damit die Bildung neuer oder veränderter kognitiver Strukturen. Demzufolge kann die Wissensvermittlung Unterricht nicht ergebnis- sondern nur prozessorientiert sein und bleibt immer vorläufig . Der Lehrer muss sich von seiner Funktionalität als Wissensvermittler verabschieden und sich ganzheitlich dem Lernenden zuwenden mitsamt seinen Fehlern und wirklichen Interessen und Emotionen. Das bedeutet auch, dass der Lehrende sich selbst eingestehen muss, dass er Mängel hat. Seine Hauptaufgabe ist die Begleitung des Lernprozesses als Manager, Regisseur, Gesprächspartner, Berater. Die Aufgaben des Lehrenden beinhalten: Strukturierung und Organisation der Lernumgebung und der Lerninhalte Der Unterrichtsgegenstand sollte in einem realen und persönlichen Sinnbezug zum Lerner stehen, d.h. er muss den Lernenden in seinen Problemen, Bedürfnissen und seinen sozialen Interaktionen direkt tangieren. Beachten von Vorwissen: der Informationsgehalt muss im Kontext zum Vorwissen stehen. Integrativer Unterricht, d.h. gemeinsamer Lerngegenstand, den alle Kinder auf ihrem individuellem Niveau lernen können. Das bedeutet auch Orientierung an subjektiven Biographien der Kinder Auch das Lernen von Fakten ist wichtig. Jedoch machen Einzelheiten nur im Zusammenhang Sinn. Das Allgemeine wird nicht dadurch gelernt, dass der Lernende allgemeine Regeln lernt, sondern viele gute Beispiele verarbeitet und aus diesen Beispielen die Regeln selbst produziert (induktiv) Unterstützung bei der Ursachenforschung bei Auftreten von Lernschwierigkeiten Hilfe bei der Bewältigung von Lernschwierigkeiten, z.B. durch Anregen, Lösungswege zu gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Lerntechniken und Lernstrategien des Schülers in einem authentischen Sachbezug mit Interesse am Lerngegenstand stehen Den Lernenden anregen, beraten, seine Konstruktion überprüfen, bestätigen oder verwerfen und vorzutragen 21 Richtige Fragen im Lerner wecken, denn dadurch setzt sich der Lernprozess von selbst in Gang. Mit den Fragen beginnt das Verstehen. Kein Angebot an Lösungen präsentieren, sondern allenfalls den Weg dorthin entwerfen Wahl geeigneter Methoden, die konstruktivem Wissenserwerb fördern, z.B. Projektunterricht, selbständiges Experimentieren, Lernwerkstatt, Planspiel, Szenisches Spiel usw. 3.2.3 Die Lernumgebung Als Lernumgebung ist der gesamte unterrichtliche Kontext gemeint: das Klassenzimmer, die Unterrichtsmaterialien, der Einsatz von Medien. Die Lernumgebung soll die Realität widerspiegeln, d.h. sie soll authentisch sein. Nur in einer realistischen, komplexen Situation kann sich der Lernende mit vielen Informationen versorgen. Sie räumen seinem Wissenserwerb die Chance ein Strategien entwickeln zu können, die dazu führen, sie auch in künftigen Realsituationen anwenden zu können. Der Einsatz von Lernprogramme ist dann effektiv, wenn der Lerner eine Welt vorfindet, in der er sich bewegen kann, die zu Fragen anregen und ihm helfen Antworten zu finden. Es ist eher ein Mittel zur Reflektion als zur Wissensvermittlung. Möglichkeiten gibt es z.B. bei Simulationen und Planspielen. Von Bedeutung ist auch das Lernen in einer freundlichen Lernumgebung mit entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten. Die Beziehungen der Lernenden untereinander und zu Lehrenden stellen einen wesentlichen Bestandteil der Lehrund Lernsituationen dar. 22 4. Ausblick Der Ist-Zustand in den Schulen ist derart, dass alle Schüler zur gleichen Zeit mit der gleichen Methode im 45-Minuten-Takt das gleiche abfragbare Wissen erwerben. Auf individuelle Neigungen und Interessen aber auch Launen wird dabei keine Rücksicht genommen. Spätestens mit Kenntnis über den konstruktivistischen Ansatz – und der ist ja nicht neu – ist klar, das wir mit unserem Unterricht keine 20 – 25 individuelle Lernprozesse synchron mitziehen können. Wir wissen, dass die vielfach angewandte „Nürnberger-Trichter-Didaktik“ keine Wissensvermittlung im eigentlichen Sinne ist, sondern dass hier täglich in den Schulen vorwiegend abfragbares, auswendig gelerntes Wissen produziert wird, was jedoch zum großen Teil im Alltag nicht mehr benötigt und vergessen wird. Was macht es denn so schwierig, die Erkenntnisse, die sich aus dem Konstruktivismus ergeben in die didaktischen Überlegungen zu integrieren und im Unterrichtsalltag umzusetzen? Folgende Überlegungen sind meiner Meinung nach zu bedenken: 1. Lehrplan: - konstruktivistische Lehrpläne können keine strikten Zeit- und Zielerreichungsvorgaben beinhalten. - Selbstgesteuertes Lernen benötigt – individuell unterschiedlich – mehr Zeit als instruktives Vorgehen, nicht zuletzt auch deswegen, weil korrektiv-kreatives Verhalten zeitlich nicht genau planbar ist. - Instruktives Vorgehen ermöglicht dem Lehrer durch höhere Strukturiertheit schneller informative Inhalte zu vermitteln. - Demgegenüber stehen die konstruktiv selbsterarbeiteten Inhalte vom Lernenden, die besser verarbeitet, behalten und effektiver genutzt werden. 2. Methodenwahl: Im Schulalltag scheitert häufig die Methodenwahl an defizitäre Rahmenbedingungen, die Auswirkung darauf hat, dass authentische Situationen nur bedingt oder gar nicht hergestellt werden können: - Räumlichkeiten: zu wenig, zu klein, unzureichende Ausstattung, sodass z.B. Lernen in Gruppen oder Experimentieren unter defizitären Bedingungen angeboten werden kann. 23 - Medien: Die Schulausstattungen sind qualitativ und quantitativ unterschiedlich ausgestattet - Materialen für den Unterricht, z.B. Computer - Unterschiedlicher Zeitaufwand bei Anwendung bestimmter Methoden 3. Bewertung: (Lernzielkontrollen) Gruppenleistungen erschweren die Evaluierung von Einzelleistungen, Selbstbeurteilung, Beurteilung durch ein anderes Gruppenmitglied. Die Bewertung erfolgt in der Regel anhand von Beurteilungskriterien, die sich an Lernziele orientieren. Nach dem Konstruktivismus müsste sich die Bewertung danach richten, wie der Schüler zu welchem Ergebnis gekommen ist. Der Sinn der traditionellen Bewertung müsste sorgfältig überdacht werden. 4. Ausbildung der Lehrer: die Lehrerausbildung orientiert sich daran, dass politische Bildungspläne und Lehrpläne umgesetzt werden können. Das Manfred Bönisch zufolge muss jede Art von Schule eigentlich 3 Curricula verfolgen: 1. das Curriculum der Unterrichtsinhalte 2. das Curriculum sozialer Kompetenzen 3. das Curriculum der Selbstkompetenzen. Während das erste Curriculum selbstverständlich ist, wird das zweite schon weniger und das dritte meist gar nicht in seiner Bedeutung erkannt. Für die Verfolgung einer konstruktivistischen Didaktik muss die Selbstkompetenzentwicklung (s.a. Übersicht Folie) als Basis in sämtliche Lehrpläne eingehen. Ich möchte mit den Schlusssatz von M.Bönsch abschließen: „Es ist immer gut, wenn viel Gutes auf den Tisch kommt. Aber was auf den Tisch kommt, soll ja jemand essen. Essen muss schon jeder selbst. Man lässt sich gern einladen, man hat aber seine Vorlieben und Geschmacksrichtungen. So lässt man sich gerne auf Fremdes ein, möchte dann aber immer wieder selbst entscheidenn können. Beim Lernen ist es nicht anders. 24 Literatur: 1. Allefeld, C.: Radikaler Konstruktivismus, Diskussionskreis am 3.Dezember 1997, URL: http//www.murfit.de/radkon.html 2. Bubenhofer, N.(1999): Kreative Konstruktion – Einführung in den Konstruktivismus. URL: http://www.bubenhofer.com/publikationen/1999krekon/konstruktivismus.html 3. Bönisch, M. (2005): Kommunikatives und offenes Lernen – Lernarrangement statt Lehrgänge, in Pflegepädagogik / PrinterNet 01/05 4. Dichanz, H., K.D.Eubel, D.Schwittmann (1983): Einführung in didaktisches Denken und Handeln, Vierfachkurseinheit, Kurs 3050-8-01-S1, FernUniversität Hagen 5. Käser, U., Referenten: A.Delija, U.Langenscheidt: (2002): Konstruktivismus, M7-Pädagogische Psychologie, Uni Bonn URL: http:psychologie.uni-bonn.de/entpaed/Download/ss2002/m7-1.pdf. 6. Köck, P., H.Ott (1997): Wörterbuch für Erziehung und Unterricht, 6. mehrfach überarbeite und aktualisierte Auflage, Auer Verlag GmbH, Donauwörth 7. Lück, E. (1987): Einführung in die Psychologie sozialer Prozesse, Kurs 3050, FernUniversität Hagen 8. Overmann, M.(2002): Konstruktivistische Prinzipien der Lerntheorie und ihre didaktischen Implikationen. URL:http://www1.ub.unisiegen.de/ext/overmann/baf5/5e.htm von 01.02.2005 9. Roth, G. (2002): Hirnforschung als Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften“, http://stabi.hsbremerhaven.de/lfi/html_fachartikel/2002_Roth_Hirnforschung.htm 10. Schirp, H. (2003): Neurowissenschaften und Lernen. Was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Unterrichtsgestaltung beitragen?, in „Die Deutsche Schule“, 3/2003, S.304 – 316 11. Siebert, H. (2005): Bildung und Mündigkeit – Perspektiven einer konstruktivistischen Pädagogik, in Pflegepädagogik / PrinterNet 01/05, S. 5 ff 25 12. Stangl, W.: Die konstruktivistischen Lerntheorien. URL: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/LerntheorienKonstruktive.shtml 13. Stangl, W.: Der erkenntnistheoretischer Ansatz Piagets, URL: http://arbeitsblaetter.stangltaller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/AkkAssModell.html 14. Thissen, F.: Das Lernen neu erfinden – konstruktivistische Grundlagen einer Multimedia-Didaktik in Beck, U., W.Sommer (Hrsg.) (1997): LEARNTEC 97, Europäischer Kongress für Bildungstechnologie und betriebliche Bildung, Tagungsband, Karlsruhe, S.69 – 79 URL: http://www.frank-thissen.de/lt97.pdf 15. Zimbardo (1995): Psychologie, 6.Auflage, Springer Verlag 26 Grundzüge einer konstruktiven Didaktik 1 Einleitung 2 Der Konstruktivismus 2.1 Konstruktivismus – eine Erkenntnistheorie 2.2 Konstruktivismus im Kontext klassischer Lerntheorien 2.3 Neurobiologische Grundlagen 2.3 Konstruktivistische Essentials 3 Konsequenzen für die Lerntheorie und Didaktik 3.1 Konsequenzen für die Lerntheorie 3.2 Konsequenzen für die Didaktik 4 3.2.1 Der Lernende 3.2.2 Der Lehrende 3.2.3 Die Lernumgebung Ausblick 27 Konstruktivismus – eine Erkenntnistheorie Epistemologische (erkenntnistheoretische Kernthese: Unser Erkenntnisapparat kann die außersubjektive Realität nicht wahrheitsgetreu abbilden. Unsere Wahrnehmungen, Kognitionen und Emotionen konstruieren eine eigene Wirklichkeit An der Entwicklung des Konstruktivismus sind u.a. namentlich beteiligt: Ernst v. Glasersfeld: Kybernetisches Modell der Wahrnehmung Humberto Maturana/F.J. Varela: Biologisches Konzept der Autopoiese Heinz v. Foerster: orientiert sich an verschiedenen Gedanken, z.B. auch der Kybernetik 2.Ordnung Jean Piaget: als Vorläufer des Konstrukitvismus 28 Konstruktivistischer Diskurs Der Begriff „Konstruktivismus“ hat zur Zeit Hochkonjunktur An der Popularisierung sind Wissenschaftler verschiedener Disziplinen beteiligt, u.a.: - Neurobiologie - Hirnforschung - Kognitionspsychologie - Informatik, u.a. Ergebnisse haben zu Kernaussagen (Essentials) geführt in erkenntnis-, lern-, u. bildungstheoretischer Hinsicht Es besteht keine Kohärenz in den unterschiedlichen Ansätzen Gemeinsamkeit: - Ablehnung der Unterscheidung „Subjekt“ – „Objekt“ - Wirklichkeit konstruiert das Gehirn 29 Konstruktivismus im Kontext klassischer Lerntheorien 2 Gegensätze: 1. Behavioristische Lerntheorien 2. Kognitive Lerntheorien Kognitive Entwicklungstheorie v. Jean Piaget: Lernen ist ein dynamischer inter-personeller Konstruktionsprozess Lernender verarbeitet aktiv aus der Umwelt aufgenommene Reize Erkenntnis entsteht durch Lösung von Problemen Einflussfaktoren bei diesem Prozess: - Reifung - Aktive Erfahrung - Soziale Interaktion - Streben nach Gleichgewicht (Äquilibration) Anpassung (Adaption) in Schemata durch: - Assimilation - Akkommodation 30 Neurobiologische Grundlagen Gerhard Roth: Sinneserregungen sind unspezifische, undifferenzierte Codierungen u. abhängig von der Reizstärke Sinnqualitäten werden erst im Gehirn erzeugt und interpretiert Verschiedene Arten von Sinneseindrücken können gemeinsam verarbeitet werden Über die individuellen Verknüpfungen ergeben sich unterschiedliche Konstruktionen Erkennen ist ein Ergebnis neuronaler Prozesse im Gehirn Kognition: = Funktion des Gehirns als selbstreferentielles System 31 Heinz Schirp: 3 Bereiche aus der neurobiologischen und Gehirnforschung sind für Lehr- u. Lernprozesse von Bedeutung: 1. Muster und Mustererkennung 2. Sinn, Relevanz und Bedeutung 3. Emotion und Kognition Viele methodische und didaktische Ansätze werden durch Erkenntnisse der Neurowissenschaft bestätigt. 32 Konstruktivistische Essentials 1. Es gibt keine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit 2. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit als Subjekt selbst 3. Das Objekt ist immer nur Objekt eines Subjekts. 4. Wir erkennen die Dinge nicht so wie sie sind, sondern nur so, wie sie uns erscheinen 5. Die Realität ist prinzipiell unerkennbar 6. Die Umwelt, wie wir sie empfangen ist unsere Empfindung 7. Die menschliche Wahrnehmung ist ein neuronaler Konstruktionsprozess im Gehirn, der über die Sinnesorgane ausgelöst wird. 33 8. Der Mensch filtert die ihn perturbierenden wahrgenommenen Phänomene auf seine individuelle einzigartige Art und Weise 9. Aufbau von Wissen ist immer an die kognitiven Funktionen des Beobachters gekoppelt 10. Wahrnehmung und Erkenntnis können von außen nicht steuernd beeinflusst werden 11. Der Mensch ist ein autonomer, selbststeuernder Organismus (Autopoiese) d.h. dass sich das Gehirn selbst herstellt 12. Als selbstreferentielles System ist der Mensch selbstbestimmend, selbsterhaltend und autonom; er ist von der Umwelt abgeschlossen 34 Konsequenzen für die Lerntheorie Wissen ist nicht vermittelbar Lernen ist ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion Jeder Lernende benötigt unterschiedliche Zeiten für sein Lernen Jeder Lernende erarbeitet unterschiedliche Bedeutungen Es ist unmöglich, einem Lernenden etwas gegen seinen Willen beizubringen Konkrete Lernziele sind unsinnig Lernzielkontrollen sind widersinnig Traditionelle Bewertungskriterien sind zu reflektieren und zu überprüfen 35 Konstruktivistische Didaktik: Der Lernende Der Lernende Gestaltet seine Lernprozesse in einer realen, authentischen Situation individuell selbst Soll erworbene Strategien in verwandte Situationen anwenden Arbeitet von speziellen Situationen allgemeine Aussagen und Regeln heraus Sein Wissenserwerb baut sich auf bereits vorhandenes Wissen auf 36 Konstruktivistische Didaktik: Der Lehrende Rolle des Lehrers: Begleiter, Berater Aufgaben: Strukturierung und Organisation der Lernumgebung und Lerninhalte Beachten von Vorwissen des Lernenden Integrativer Unterricht Anregung, Beratung, Überprüfung der Konstruktion, Bestätigung, Anregen zum Vortragen Richtige Fragen im Lerner wecken, denn mit den Fragen kommt das Verstehen Hilfe bei Lernschwierigkeiten: Lösungswege suchen Keine Lösungen anbieten Wahl geeigneter Methoden: - Projektarbeit - Selbständiges Experimentieren - Lernwerkstatt - Planspiel 37 Konstruktivistische Didaktik: Die Lernumgebung Zur Lernumgebung gehören: Schulgebäude Klassenzimmer mit Möglichkeiten zum Experimentieren, Arbeiten in Gruppen etc. Unterrichtsmaterialien Medien Effektive Lernprogramme (Planspiele, Simulationen) Die Lernumgebung sollte Authentisch u. realistisch gestaltbar sei Eine freundliche Atmosphäre mit entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten Möglichkeiten bieten, die verschiedenen Methoden anwenden zu können. 38 39 41 Ordnung muss sein: In den ersten beiden Lebensjahren bildet sich eine große Anzahl an Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn aus – wesentlich mehr, als später benötigt werden. Danach wird ausgelichtet: Nur die Kontakte bleiben erhalten und verstärken sich, die immer wieder benötigt werden; die anderen verkümmern. Mit der Pubertät ist dieser Prozess im Wesentlichen abgeschlossen: Dem Erwachsenen steht ein gut eingefahrenes, aber auch weniger anpassungsfähiges Nervennetz zur Verfügung. Quelle: Gerhard Friedrich, Gerhard Preiss: Lernen mit Köpfchen, in Gehirn & Geist, Spektrum Der Wissenschaft, Nr.4/2002, S.68 42 Piagets theoretisches Modell 43 (Quelle: URL:http//arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOGNITIVEENTWICKLUNG/default.stml, S.3) 44 45