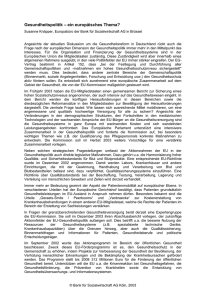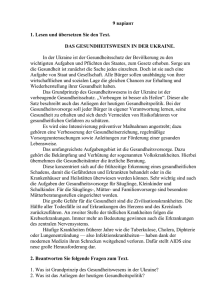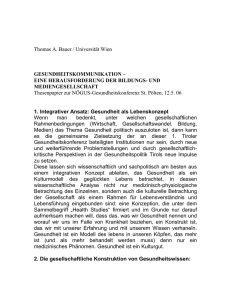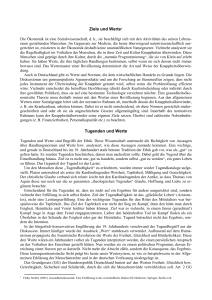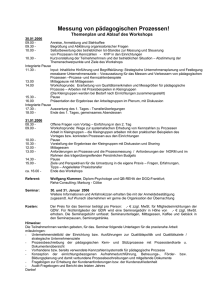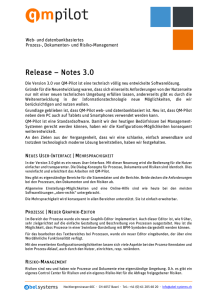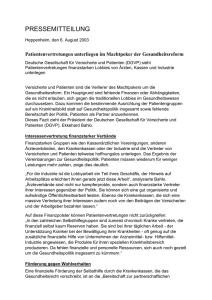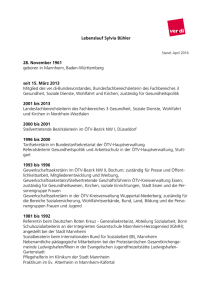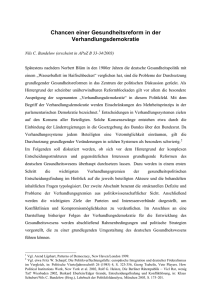zu erscheinen
Werbung
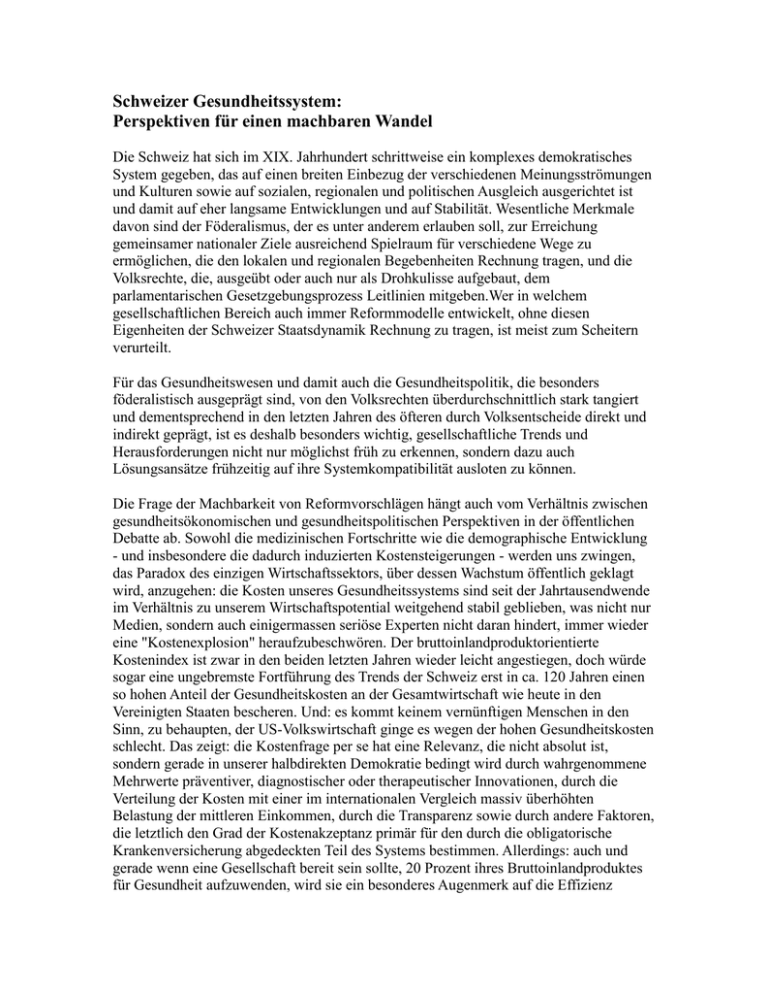
Schweizer Gesundheitssystem: Perspektiven für einen machbaren Wandel Die Schweiz hat sich im XIX. Jahrhundert schrittweise ein komplexes demokratisches System gegeben, das auf einen breiten Einbezug der verschiedenen Meinungsströmungen und Kulturen sowie auf sozialen, regionalen und politischen Ausgleich ausgerichtet ist und damit auf eher langsame Entwicklungen und auf Stabilität. Wesentliche Merkmale davon sind der Föderalismus, der es unter anderem erlauben soll, zur Erreichung gemeinsamer nationaler Ziele ausreichend Spielraum für verschiedene Wege zu ermöglichen, die den lokalen und regionalen Begebenheiten Rechnung tragen, und die Volksrechte, die, ausgeübt oder auch nur als Drohkulisse aufgebaut, dem parlamentarischen Gesetzgebungsprozess Leitlinien mitgeben.Wer in welchem gesellschaftlichen Bereich auch immer Reformmodelle entwickelt, ohne diesen Eigenheiten der Schweizer Staatsdynamik Rechnung zu tragen, ist meist zum Scheitern verurteilt. Für das Gesundheitswesen und damit auch die Gesundheitspolitik, die besonders föderalistisch ausgeprägt sind, von den Volksrechten überdurchschnittlich stark tangiert und dementsprechend in den letzten Jahren des öfteren durch Volksentscheide direkt und indirekt geprägt, ist es deshalb besonders wichtig, gesellschaftliche Trends und Herausforderungen nicht nur möglichst früh zu erkennen, sondern dazu auch Lösungsansätze frühzeitig auf ihre Systemkompatibilität ausloten zu können. Die Frage der Machbarkeit von Reformvorschlägen hängt auch vom Verhältnis zwischen gesundheitsökonomischen und gesundheitspolitischen Perspektiven in der öffentlichen Debatte ab. Sowohl die medizinischen Fortschritte wie die demographische Entwicklung - und insbesondere die dadurch induzierten Kostensteigerungen - werden uns zwingen, das Paradox des einzigen Wirtschaftssektors, über dessen Wachstum öffentlich geklagt wird, anzugehen: die Kosten unseres Gesundheitssystems sind seit der Jahrtausendwende im Verhältnis zu unserem Wirtschaftspotential weitgehend stabil geblieben, was nicht nur Medien, sondern auch einigermassen seriöse Experten nicht daran hindert, immer wieder eine "Kostenexplosion" heraufzubeschwören. Der bruttoinlandproduktorientierte Kostenindex ist zwar in den beiden letzten Jahren wieder leicht angestiegen, doch würde sogar eine ungebremste Fortführung des Trends der Schweiz erst in ca. 120 Jahren einen so hohen Anteil der Gesundheitskosten an der Gesamtwirtschaft wie heute in den Vereinigten Staaten bescheren. Und: es kommt keinem vernünftigen Menschen in den Sinn, zu behaupten, der US-Volkswirtschaft ginge es wegen der hohen Gesundheitskosten schlecht. Das zeigt: die Kostenfrage per se hat eine Relevanz, die nicht absolut ist, sondern gerade in unserer halbdirekten Demokratie bedingt wird durch wahrgenommene Mehrwerte präventiver, diagnostischer oder therapeutischer Innovationen, durch die Verteilung der Kosten mit einer im internationalen Vergleich massiv überhöhten Belastung der mittleren Einkommen, durch die Transparenz sowie durch andere Faktoren, die letztlich den Grad der Kostenakzeptanz primär für den durch die obligatorische Krankenversicherung abgedeckten Teil des Systems bestimmen. Allerdings: auch und gerade wenn eine Gesellschaft bereit sein sollte, 20 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes für Gesundheit aufzuwenden, wird sie ein besonderes Augenmerk auf die Effizienz richten. In dieser Perspektive hat die Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik beschlossen, zu ihrem 40jährigen Bestehen 2016 eine Delphi-Studie mit Einschätzungen von zahlreichen Expertinnen und Experten aller relevanter Träger des Systems zu den Perspektiven des Schweizer Gesundheitswesens im Jahr 2030 und entsprechender gesundheitspolitischer Massnahmen zu organisieren - als Anregung für die öffentliche gesundheitspolitische Debatte, aber auch für das eigene Wirken. Bei den Resultaten fällt auf, dass die meistgenannten Bereiche für Reformen - Qualität, E-health, Transparenz, Organisation der Versorgungsstrukturen - zwar in den Positionspapieren der meisten politischen Parteien irgendwo auftauchen, in den letzten Jahren in den entscheidenden politischen Prozessen aber entweder untergegangen oder auf Sparflamme umgesetzt worden sind, wie dies beispielsweise beim elektronischen Patientendossier der Fall war. Ähnliches gilt für die Prävention, wo eine sehr klare Mehrheit auch nach dem Scheitern des Präventionsgesetzes im Parlament für eine deutliche Erhöhung der Investitionen in die Prävention mit dem Hauptziel einer verbesserten Lebensqualität ausspricht. In einem Rechtsstaat hat selbstverständlich der Gesetzgeber grundsätzlich Recht - doch wenn politische Prozesse und nahezu übereinstimmende Einschätzungen von Experten aller Schattierungen und Interessenvertretungen allzu stark auseinanderklaffen, ist die Reformfähigkeit und damit auch die Qualität des Systems in Frage gestellt und verlangt nach sachorientierten Prozessen der Vertrauensbildung, um über ideologische und parteipolitische Grabenkämpfe hinweg Wege zur dynamischen Anpassung des Gesundheitswesens an die gesellschaftliche Entwicklung zu finden. In diese Richtung weist auch die von verschiedenster Seite geforderte Stärkung der Interessenvertretung der Patientinnen und Patienten in den systemrelevanten politischen und organisatorischen Prozessen im Sinn einer in ausländischen reformorientierten Systemen oft bereits umgesetzten, vertrauensbildenden Massnahme. Dass auch in der Schweiz der Reformglaube der Expertinnen und Experten nicht verloren gegangen ist, belegt die Tatsache, dass nach wie vor die meisten unter ihnen von einer tragbaren Kostenentwicklung dank geeigneter Rationalisierungsmassnahmen ausgehen. Dies setzt allerdings neben Mehrheiten für entsprechende Massnahmen auch einen gesellschaftlichen Konsens über das Ausmass tragbarer Gesundheitskosten sowie über deren Verteilung zwischen den Kostenträgern voraus. Der SGGP werden die Themen für ihre Hauptaufgabe der Förderung reformorientierter Kräfte und Ideen im Schweizer Gesundheitswesen offensichtlich nicht ausgehen. Aus den Einschätzungen und Trends der Delphi-Studie wird sie auch in den kommenden Jahren der schweizerischen Gesundheitspolitik mit ihren Publikationen und Tagungen Impulse geben. Dafür danke ich allen Teilnehmenden, die ihre Erfahrungen und Kompetenzen in die Studie eingebracht haben - und ganz besonders den Mitgliedern der für die Studie verantwortlichen Arbeitsgruppe der SGGP sowie dem Projektverantwortlichen Philippe Lehmann - und wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, anregende Momente mit der vorliegenden Delphi-Studie.