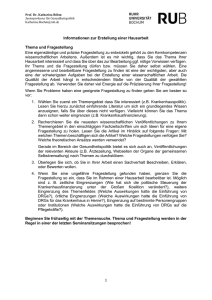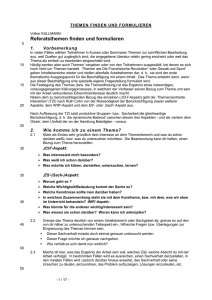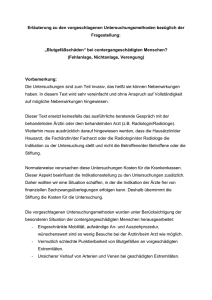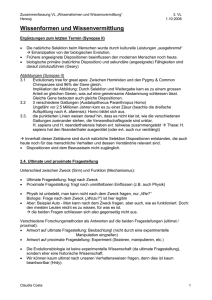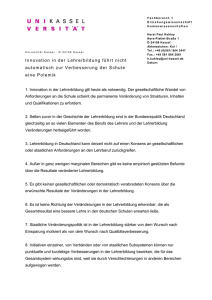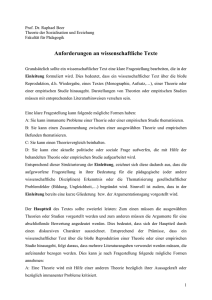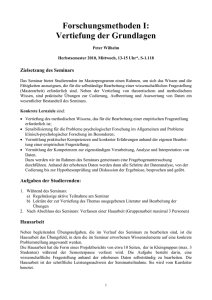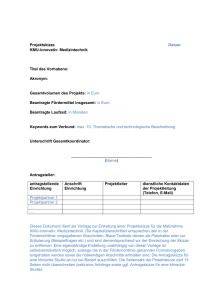Nachrichten
Werbung
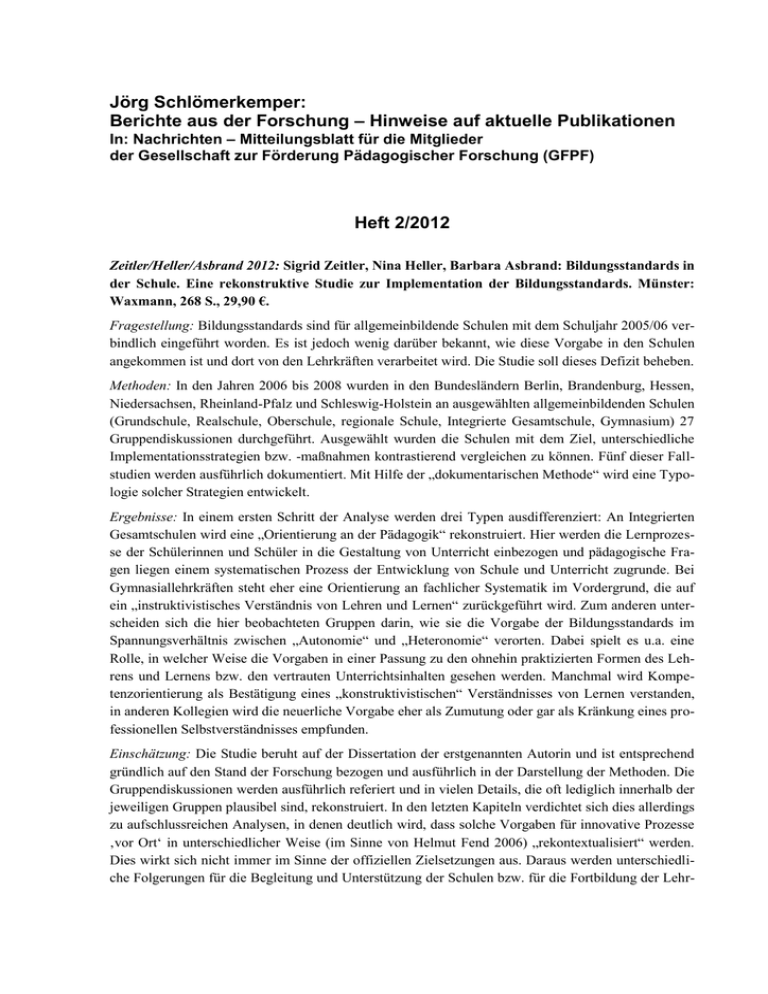
Jörg Schlömerkemper: Berichte aus der Forschung – Hinweise auf aktuelle Publikationen In: Nachrichten – Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung (GFPF) Heft 2/2012 Zeitler/Heller/Asbrand 2012: Sigrid Zeitler, Nina Heller, Barbara Asbrand: Bildungsstandards in der Schule. Eine rekonstruktive Studie zur Implementation der Bildungsstandards. Münster: Waxmann, 268 S., 29,90 €. Fragestellung: Bildungsstandards sind für allgemeinbildende Schulen mit dem Schuljahr 2005/06 verbindlich eingeführt worden. Es ist jedoch wenig darüber bekannt, wie diese Vorgabe in den Schulen angekommen ist und dort von den Lehrkräften verarbeitet wird. Die Studie soll dieses Defizit beheben. Methoden: In den Jahren 2006 bis 2008 wurden in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein an ausgewählten allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule, Oberschule, regionale Schule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium) 27 Gruppendiskussionen durchgeführt. Ausgewählt wurden die Schulen mit dem Ziel, unterschiedliche Implementationsstrategien bzw. -maßnahmen kontrastierend vergleichen zu können. Fünf dieser Fallstudien werden ausführlich dokumentiert. Mit Hilfe der „dokumentarischen Methode“ wird eine Typologie solcher Strategien entwickelt. Ergebnisse: In einem ersten Schritt der Analyse werden drei Typen ausdifferenziert: An Integrierten Gesamtschulen wird eine „Orientierung an der Pädagogik“ rekonstruiert. Hier werden die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler in die Gestaltung von Unterricht einbezogen und pädagogische Fragen liegen einem systematischen Prozess der Entwicklung von Schule und Unterricht zugrunde. Bei Gymnasiallehrkräften steht eher eine Orientierung an fachlicher Systematik im Vordergrund, die auf ein „instruktivistisches Verständnis von Lehren und Lernen“ zurückgeführt wird. Zum anderen unterscheiden sich die hier beobachteten Gruppen darin, wie sie die Vorgabe der Bildungsstandards im Spannungsverhältnis zwischen „Autonomie“ und „Heteronomie“ verorten. Dabei spielt es u.a. eine Rolle, in welcher Weise die Vorgaben in einer Passung zu den ohnehin praktizierten Formen des Lehrens und Lernens bzw. den vertrauten Unterrichtsinhalten gesehen werden. Manchmal wird Kompetenzorientierung als Bestätigung eines „konstruktivistischen“ Verständnisses von Lernen verstanden, in anderen Kollegien wird die neuerliche Vorgabe eher als Zumutung oder gar als Kränkung eines professionellen Selbstverständnisses empfunden. Einschätzung: Die Studie beruht auf der Dissertation der erstgenannten Autorin und ist entsprechend gründlich auf den Stand der Forschung bezogen und ausführlich in der Darstellung der Methoden. Die Gruppendiskussionen werden ausführlich referiert und in vielen Details, die oft lediglich innerhalb der jeweiligen Gruppen plausibel sind, rekonstruiert. In den letzten Kapiteln verdichtet sich dies allerdings zu aufschlussreichen Analysen, in denen deutlich wird, dass solche Vorgaben für innovative Prozesse ‚vor Ort‘ in unterschiedlicher Weise (im Sinne von Helmut Fend 2006) „rekontextualisiert“ werden. Dies wirkt sich nicht immer im Sinne der offiziellen Zielsetzungen aus. Daraus werden unterschiedliche Folgerungen für die Begleitung und Unterstützung der Schulen bzw. für die Fortbildung der Lehr- – Seite 2 (von 23) – kräfte abgeleitet, die sich auf die jeweiligen Konstellationen beziehen sollten, um wirksam werden zu können. Hörner 2011: Frank Hörner: Leiten oder leiden? – Transformationen des Schulleitungshandelns. Eine qualitative Studie zum Umgang von Schulleiterinnen und Schulleitern bayerischer Grund- und Hauptschulen mit dienstlichen Beurteilungen. Würzburg: Ergon, 253 S., 32,00 €. Fragestellung: Die Rektoren der bayerischen Volksschulen müssen seit 2005 regelmäßig die Lehrkräfte ihrer Schulen im Unterricht besuchen und sie dienstlich beurteilen – eine Aufgabe, für die bis dahin die Schulaufsicht zuständig gewesen war. Es soll herausgearbeitet werden, in welcher Form diese „Transformation“ gestaltet wird und welchen Stellenwert sie im Rahmen des Schulleitungshandelns einnimmt. Dies soll auch im Kontext des Konzepts einer „autonomen Schule“ beurteilt werden, um aufzuklären, wie sich „Interdependenzen“ zwischen den AkteurInnen auf den verschiedenen Ebenen des Systems Schule verändern. Schließlich soll erkundet werden, wie die Rektorinnen und Rektoren diese Veränderungen einschätzen und bewältigen. Daraus sollen Schlüsse für die Weiterentwicklung des Schulsystems insgesamt gezogen werden. Methoden: In einer „empirisch-qualitativen Studie“ wurden 21 Schulleiterinnen und Schulleiter in ausführlichen Interviews befragt und zwar von reinen Grundschulen, von kombinierten Grund- und Hauptschulen sowie von reinen Hauptschulen. Zugrunde gelegt wurde ein vom Autor der Studie entwickelter Leitfaden. Es wurde um möglichst konkrete und detaillierte Aussagen zu den relevanten Themen gebeten. Die Interviewdaten wurden durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Ergebnisse: Die befragten Schulleiter haben sich mit der für sie neuen Dienstaufgabe „nicht nur organisatorisch und inhaltlich-methodisch, sondern auch emotional überraschend gut arrangiert“. Entgegen der naheliegenden Erwartung, dass diese zusätzliche Aufgabe als nicht zumutbare Belastung bewertet werden würde, waren negative Reaktionen nur gering ausgeprägt. Das Verhältnis zum Kollegium einerseits und den zuständigen Schulräten andererseits ist offenbar durch die veränderte Position der Schulleitung nicht belastet worden. Das gegenseitige Verhältnis wird als kooperativ und professionell bezeichnet. Kritisiert wird dagegen, dass diese Aufgabe den Schulleitern mehr Arbeit aufbürdet, dass ihnen aber im Zuge dieser Veränderung keineswegs zusätzliche Entscheidungsbefugnisse im Sinne einer „autonomen Schule“ zukommen. Dies drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass die dienstlichen Beurteilungen – quasi als Entwurf – der Schulaufsicht vorgelegt werden müssen und erst dort unterschrieben werden. Auch die vorgeschriebene Quotierung der Beurteilung wird problematisiert. Das Verhältnis zur Regierung und zum Kultusministerium wird durchaus als „schlecht“ beschrieben. Gewünscht wird eine Novellierung der Richtlinie, die den Schulleitungen einen stärkeren Status als Dienstvorgesetzte bringen solle. Einschätzung: Die Studie konzentriert sich auf eine vergleichsweise spezielle Fragestellung, in der umso mehr quasi an einer Nahtstelle des Systems verdeutlicht wird, wie schwierig es ist, die Schule im Sinne von Eigenverantwortlichkeit neu zu gestalten, wenn sozusagen lediglich die administrativen Zuständigkeiten auf eine untere Ebene verlagert werden. In welchem Maße dies nicht nur für besondere Verhältnisse in Bayern gilt, wäre gegebenenfalls in Untersuchungen in weiteren Bundesländern zu klären. Dafür gibt diese Studie vielfältige Anregungen. – Seite 3 (von 23) – Blömer 2011: Daniel Blömer: Topographie der Gesamtschule. Zum Zusammenhang von Pädagogik und Raum. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 240 S., 32,00 €. Fragestellung: Mit dem Beginn der Gesamtschulversuche in den 1960er und 1970er Jahren, also in einer Zeit, in der neuer Schulraum geschaffen werden musste und finanzielle Mittel dafür zur Verfügung standen, wurde versucht, die Ideen dieser Schulform auch in ihrer architektonischen Gestaltung umzusetzen. Die Studie will der Frage nachgehen, wie welche pädagogischen Überlegungen die Planung, Einrichtung und Gestaltung beeinflusst haben. Welche Möglichkeiten und Grenzen wurden dadurch bedingt? Und lassen sich aus diesen Erfahrungen Folgerungen für künftige räumliche Strukturen von Schulbauten ableiten? Methoden: Dem Autor waren die Planungsunterlagen von drei Gesamtschulen in Braunschweig zugänglich. Diese werden im Sinne eines hermeneutischen Vorgehens analysiert und gedeutet. Dazu werden zunächst einleitend Zielsetzungen und das damalige Verständnis der Gesamtschule als „demokratischer Leistungsschulen“ herausgearbeitet. An den Fallbeispielen kann herausgearbeitet werden, welche Bedingungen bei einem Neubau bzw. beim Umbau eines vorhandenen Gebäudes gegeben sind und was dies für die alltägliche Arbeit bedeutet. Ergebnisse: Die Analyse macht deutlich, wie wichtig es war und ist, für jene, die als Lehrende und als Lernende über eine längere Zeit in und mit einem Gebäude leben müssen, förderliche und anregende Bedingungen bereitzustellen. Dabei sollte die Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben werden. Diese Bedeutung der „Nutzerbeteiligung“ hat sich im Laufe der Zeit verändert. Was im Grunde die „pädagogische Brauchbarkeit“ eines Gebäudes ausmacht, wird immer wieder neu zu diskutieren sein. Der „heimliche Lehrplan“ ist dabei keineswegs immer transparent und selbst einem dynamischen Prozess unterworfen. Einschätzung: Die Studie bezieht sich zwar auf lokale besondere Bedingungen, es wird aber daran in allgemeinem Sinne deutlich, wie „Pädagogik und Raum“ zusammenhängen. Ob man das dann gleich als „Topographie“ bezeichnen muss, scheint mir fraglich und tendenziell irritierend. Die Frage nach dem Zusammenhang von Pädagogik und Raum gilt zudem wohl nicht nur für Gesamtschulen. König/Wagner/Valtin 2011: Johannes König, Christine Wagner, Renate Valtin: Jugend – Schule – Zukunft. Psychosoziale Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung. Ergebnisse der Längsschnittstudie AIDA. Münster: Waxmann, 466 S., 29,90 €. Fragestellung: Anders als in den zahlreichen Studien, die sich mit Schulleistung beschäftigen, soll in diesem Projekt mit dem Titel „Adaptation in der Adoleszenz“ (kurz AIDA) die psychosoziale Entwicklung von Jugendlichen im Zentrum stehen. Herausgearbeitet werden soll, wie diese mit den für ihre Altersgruppe typischen Entwicklungsaufgaben umgehen, ob sich dies im Zeitverlauf verändert, welche Unterschiede sich gegebenenfalls zwischen verschiedenen Gruppen von Jugendlichen beobachten lassen. Methoden: Diese Längsschnittstudie bezieht sich auf eine Begleitung über 8 Jahre von über 3000 Schülerinnen und Schülern in Berlin. Vom 2. bis zum 9. Schuljahr konnten Schülerinnen und Schüler begleitet und befragt werden. Der Kern des Berichts bezieht sich auf Erhebungen von der 7. bis zur 9. Klasse. Im theoretischen Konzept geht es um Beziehungen zwischen Prädiktoren, Mediatoren und Erträgen. Erhoben wurden der Bildungs- und Berufsstatus der Eltern, das Klassenklima und Merkmale der „sozialen Stützsysteme Familie und Freunde“. Als zentrale Dimensionen der schulbezogenen Per- – Seite 4 (von 23) – sönlichkeitsentwicklung und als „Mediatoren“ im Entwicklungsmodell wurden die Ich-Stärke und das Leistungsselbstvertrauen gewählt. Als Merkmale für die „Bewältigung von Entwicklungsaufgaben“ – die sog. „Erträge“ – wurden Schulnoten, Schulfreude, Geschlechtsrollenorientierung, Selbstständigkeit und die berufliche Orientierung erfasst. – Zur statistischen Auswertung wurden neben deskriptiven Verfahren (Häufigkeitsverteilungen und Mittelwertdifferenzen) Kennwerte der Effektgröße berechnet und komplexe hierarchische Mediator-Modelle geprüft. Ergebnisse: Die Befunde werden außerordentlich differenziert referiert. Zwischen den drei Erhebungszeitpunkten zeigen sich in den Mittelwerten nur geringe Veränderungen. Deutlicher treten Differenzen hervor, wenn Schülergruppen gebildet und miteinander verglichen werden. So zeigt sich zum Beispiel, dass vier unterschiedliche Ausprägung von Schulfreude (von „hohe Schulfreude“ bis „Schulverdrossenheit“) mit den Merkmalen des sozialen Kontextes einerseits und dem Schulerfolg andererseits in Beziehung stehen. Allerdings sind diese Beziehungen keineswegs für alle Schülerinnen und Schüler identisch und die Interpretation der Ergebnisse ist keineswegs einfach. Gruppen mit unterschiedlicher sozialer Einbettung („Sozialkapital-Typen“) lassen erkennen, dass ein „Mehr“ an sozialen Ressourcen sich positiv auf die Ich-Stärke auswirkt. Dabei können sich Heranwachsende offenbar stärker auf das familiäre Stützsystem verlassen als auf ein entsprechendes Engagement der Lehrenden. Welche Bedeutung diese Dimension für die Erträge hat, ist wiederum keineswegs eindeutig. Unterschieden werden drei Typen, mit denen sich die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben beschreiben lässt: Es gebe eine „gelingende“, eine „diffuse“ und eine „risikobehaftete“ Bewältigung dieser Aufgaben. Dies korreliert deutlich mit den erreichten Schulnoten und der Schulfreude und zwar in der zu erwartenden Richtung: Die Jugendlichen mit „risikohafter Bewältigung“ haben schlechtere Schulnoten, sind überwiegend schulverdrossen, vertreten am stärksten traditionelle Geschlechtsrollenorientierungen. Im Resümee werden die Befunde zu 13 Thesen verdichtet bzw. weitergeführt. Es sei möglich, Ich-Stärke und Leistungsvertrauen empirisch zu erfassen, diese Merkmale fungierten als zentrale Mediatoren bei der Persönlichkeitsentwicklung, Heranwachsende hätten komplexe Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, das Lehrerengagement könne als wichtiges soziales Stützsystem in der Schule verstärkt werden, MitschülerInnen haben eine „eigene mehrschichtige Funktion im Klassenverband“, die Notengebung hat „pädagogisch bedenkliche Nebeneffekte“, Noten wirken sich auf Ich-Stärke und Leistungsvertrauen bei männlichen und weiblichen Jugendlichen differenziert aus, Schulformen bieten differenzielle Lern- und Entwicklungsmilieus, Eltern sollten „Geborgenheit geben, aber auch hohe Leistungsanforderungen stellen“, „Freunde sind wichtig, haben aber auch Nebenwirkungen“, zwischen Jugendlichen aus Ost- und West-Berlin gibt es nur geringe Unterschiede, weibliche und männliche Jugendliche „sind nicht gleichermaßen gut auf das Leben vorbereitet“ und schließlich: „Bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben gibt es Gewinner und Verlierer“. Einschätzung: Es ist fraglos begrüßenswert, die in der Öffentlichkeit viel beachteten Leistungsstudien durch die Untersuchung der psychosozialen Entwicklung zu ergänzen. Dabei bestätigen allerdings die Befunde überwiegend Ergebnisse früherer Teilstudien und sie entsprechen weitgehend dem, was man erwarten würde. Dass die Verhältnisse so sind, wie sie schon immer sind, wird geradezu emotionslos konstatiert. Die Frage nach den Ursachen und nach Ansätzen, die daran etwas ändern könnten oder sollten, stand nicht im Programm der Studie. Interessant wird es dann, wenn Schülerinnen und Schüler mit besonderen Konstellationen in den Blick genommen werden. Aber auch hier stößt die Analyse rasch an die Grenzen des quantitativ-statistisch Möglichen. Letztlich sollte im professionellen Handeln und in einer Forschung, die dafür hilfreich werden kann, doch wohl die einzelne Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen und zu Wort kommen können. Was die SchülerInnen selbst sagen würden, wird auf – Seite 5 (von 23) – den letzten Seiten immerhin an authentischen Antworten auf zwei offen gestellte Fragen erkennbar: „Ich denke, dass Schlimmste oder das Hemmendste ist für mich, die Angst davor, etwas nicht zu begreifen. Früher in der Grundschule war ich immer die Intelligenteste und alle bewunderten mich wegen meines Allgemeinwissens, jetzt habe ich das Gefühl, nicht mehr aus der Masse herauszutreten. Mittelmäßigkeit ist das Schlimmste, noch schlimmer als die Angst nichts zu begreifen.“ – Wie ließe sich das in den Befunden dieser Studie verorten? Roters 2012: Bianca Roters: Professionalisierung durch Reflexion in der Lehrerbildung. Eine empirische Studie an einer deutschen und einer US-amerikanischen Universität. Münster: Waxmann, 328 S., 34,90 €. Fragestellung: Professionstheoretisch wird davon ausgegangen, dass der Lehrberuf ähnliche Muster aufweist wie der der Ärzte: vor allem eine lange Ausbildungszeit und komplexes Handeln in Unsicherheit. Entscheidungen seien auf rationaler Basis zu treffen und schulische Praxis müsse reflektiert werden, um dieser Unsicherheit zu begegnen. In der Studie soll geprüft werden, in welchem Grad Konzepte der Lehrerbildung und deren Praxis diesen Ansprüchen gerecht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die „konstruktive und systematische Auseinandersetzung mit theoretischem Wissen und praktischen Erfahrungswissen“ bereits in der ersten universitären Ausbildungsphase beginnen sollte. Die zentralen Fragen lauten deshalb: „Welche Rolle spielt das Konstrukt Reflexion auf diskursiver und empirischer Ebene in der Lehrerbildung?“ Und: „Inwieweit begünstigt studentische Forschung Reflexion?“ Methoden: Nachdem die Begrifflichkeiten zum Professionalisierungsdiskurs dargelegt worden sind, werden die entsprechenden Diskurse in Deutschland und den USA ausführlich beschrieben und unter der Fragestellung analysiert. Als Material dienen dabei Dokumente zu Konzepten der Lehrerbildung und Berichte aus der Praxis. Ausbilder und Studierende wurde intensiv interviewt. Ergebnisse: Es zeigt sich, dass in den beiden Ländern der Professionalitätsbegriff unterschiedlich konnotiert wird. Dies wird auf die Rolle des Staates zurückgeführt: In den USA ist im Prozess der Professionalisierung „eine Abgrenzung vom Staat erfolgt, da eigene Interessenvertretungen gebildet werden“. Diese hätten eine „forschende Haltung gegenüber der eigenen Profession“ entwickelt. In Deutschland sei von den Mitgliedern der Berufsgruppen kein gemeinsamer Wissenskanon kodifiziert worden. In einer länderübergreifenden Analyse werden sechs Typen von Studierenden danach unterschieden, in welchem Grad sie eine professionelle reflexive Haltung aufzeigen. Das Spektrum reicht von jenen, bei denen „ausschließlich Generalisierungen und Pauschalisierungen“ zu erkennen sind, über jene, die lediglich „deskriptiv“, „instrumentell“ oder „produktiv“ reflektieren bis zu „reflexiv forschenden Novizen“. Der letztgenannte Typ konnte allerdings in der Stichprobe weder in Deutschland noch in den USA beobachtet werden. Einschätzung: Die Studie geht von sehr anspruchsvollen Konzepten aus und setzt hohe Maßstäbe an die professionelle Reflexivität. Diesen Ansprüchen scheinen die Konzepte und die Praxen der Lehrerbildung in den USA bereits besser gerecht zu werden. Mit dem Ziel des „Reflective Practitioner“ werden praktische Erfahrungen in theoretischer Perspektive aufgearbeitet und in kleinen Forschungsprojekten vertieft. In Deutschland wären solche Aktionsforschungsprojekten durchaus denkbar, es konnte aber nicht beobachtet werden, dass sie von den Studierenden realisiert werden. Eine professionelle Kompetenz, die sich auf eine intensive Auseinandersetzung mit Praxis bezieht, erscheint in Deutschland noch als Desiderat. – Die Studie macht also aufmerksam auf hochschuldidaktischen Entwick- – Seite 6 (von 23) – lungsbedarf und sie legt nahe, die Professionsentwicklung der Lehrerschaft durch eine entsprechende Institutionalisierung als Profession zu fördern. König/Seifert 2012: Johannes König, Andreas Seifert (Hg.): Lehramtsstudierende erwerben pädagogisches Professionswissen. Ergebnisse der Längsschnittstudie LEK zur Wirksamkeit der erziehungswissenschaftlichen Lehrerausbildung. Münster: Waxmann, 314 S., 24,90 €. Fragestellung: Die Lehrerbildung steht zurzeit stark unter Kritik. Durch eine möglichst genaue Analyse der Konzepte und der tatsächlichen Verläufe sollen Grundlagen für eine fundierte Weiterentwicklung der Ausbildung für den Beruf in der Schule gefunden werden. Es geht vor allem um drei Fragestellungen: (1) Wie entwickelt sich das pädagogische Professionswissen im Verlauf der universitären Lehrerausbildung? (2) Welchen Einfluss haben individuelle Lernvoraussetzungen auf das pädagogische Professionswissen zu Beginn und im Verlauf des Lehramtsstudiums? (3) Welchen Einfluss haben Lerngelegenheiten in der universitären Lehrerausbildung und ihre Nutzung durch die Studierenden auf das pädagogische Professionswissen? Methoden: Die Studie bezieht sich auf die Lehrerbildung an den Universitäten in Erfurt, Köln, Paderborn und Passau. Zunächst werden die Konzepte und die Gestaltung der Lehrerbildung an diesen Standorten anhand von Dokumenten analysiert und verglichen. Wesentliche Quelle für die empirischen Analysen sind Befragungen von Studierenden im ersten und vierten Studiensemester. Erhoben wurden Daten zu pädagogischen Vorerfahrungen, zur Berufswahlmotivation sowie zum pädagogischen Professionswissen (anhand der Tests TEDS-M und SPEE). Diese Erhebung wurde nach zwei Jahren wiederholt und ergänzt um Daten zur „Nutzung der Lerngelegenheiten“ in einer erziehungswissenschaftlichen und schulpraktischen Komponente sowie durch eine Selbsteinschätzung der Kompetenz. Ergebnisse: Diese Daten werden für die vier Standorte vergleichend ausgewertet und zudem nach individuellen Voraussetzungen und den Nutzungsmöglichkeiten der Lernangebote differenziert. Es zeigt sich, dass die eingesetzten Instrumente die zu untersuchenden Aspekte valide erfassen können. Die Unterschiede werden überwiegend als statistisch und praktisch bedeutsam eingeschätzt. Generell zeigt sich, dass vom ersten bis zum vierten Studiensemester die professionsbezogenen Kompetenzen zunehmen. Zwischen den verschiedenen Dimensionen der Erhebung werden zum Teil methodisch anspruchsvolle Analysen erstellt. Einschätzung: Die Aussage des Titels, dass „Lehramtsstudierende … pädagogisches Professionswissen (erwerben)“ darf wohl nur eingeschränkt verstanden werden, weil sich die Studie lediglich auf die ersten vier Semester des Studiengangs bezieht. Ob dies auch für den weiteren Studiengang Gültigkeit beanspruchen darf und vor allem, wie sich die in der ersten Ausbildungsphase erworbenen Kompetenzen in der späteren praktischen Tätigkeit bewähren – ob also tatsächlich „professionelle“ Kompetenzen erworben worden sind –, kann auf dieser Basis noch nicht beurteilt werden. Gleichwohl ist anzuerkennen, dass für entsprechende Analysen Forschungsinstrumente entwickelt worden sind und dass diese sich offenbar bewährt haben. Nicht erkennbar wird in der eher beschreibend angelegten Studie, ob die vorliegende Form der Lehrerbildung zur Verbesserung der Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit beitragen kann. – Seite 7 (von 23) – Bertelsmann Stiftung, Institut für Schulentwicklungsforschung (Hg.) 2012: Chancenspiegel. Zur Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der deutschen Schulsysteme. Autoren und Autorin: Nils Berkemeyer, Wilfried Bos, Veronika Manitius. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 190 S., 20,00 € Fragestellung: Die Studie soll eine erste Antwort geben auf die in der Bevölkerung „ausgeprägte Erwartung, dass das Bildungssystem für sozialen Aufstieg sorgt – und für gute Leistungen“. Es solle beides gelingen: „für faire Chancen zu sorgen und für herausragende Leistungen“. Folgende Fragen werden genannt: „Wie stark ist die Kopplung von sozialer Herkunft und Leistung? Wie gelingt es Schulsystemen, alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen zu lassen? Können Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Bildungsbiografie Schulformen so wechseln, dass ihnen höhere Abschlüsse ermöglicht werden? Wie hoch ist der Anteil von Jugendlichen ohne Schulabschluss und demzufolge mit nur geringen Teilhabewahrscheinlichkeiten an beruflichen, kulturellen und politischen Aktivitäten? Methoden: In einer „gerechtigkeitstheoretischen“ Perspektive wird der „Entwurf einer gerechtigkeitstheoretischen Schultheorie“ entwickelt. Dabei werden vier „Gerechtigkeitsdimensionen“ unterschieden und operationalisiert: Integrationskraft (vor allem der Grad der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf), Durchlässigkeit (Übergänge, Schulformwechsel, Klassenwiederholungen, Einmündung in das Berufsbildungssystem), Kompetenzförderung (Lesekompetenz in der Primarstufe und bei Neuntklässlern, Förderung der leistungsschwächsten und der leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler, soziale Herkunft und Kompetenzerwerb in der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe), Zertifikatsvergabe (Anteile der Hochschul- und Fachhochschulreife bzw. Abgänger ohne Abschluss). Ergebnisse: Aus den zu diesen Dimensionen und Kriterien verfügbaren Daten wird im Vergleich für die einzelnen Bundesländer ermittelt, ob sie zum oberen Viertel, zur mittleren Hälfte oder zum unteren Viertel gehören. Es zeigt sich, dass kein Bundesland in mehr als zwei dieser Dimensionen zum oberen Viertel gehört, dass aber ebenso kein Bundesland in mehr als zwei Dimensionen dem unteren Viertel zugeordnet werden muss. Die Verteilung ist in der grafischen Darstellung recht bunt. Einschätzung: Die Studie ist einerseits sehr anspruchsvoll, andererseits wird der Entwurfscharakter betont. Es müsse genauer und auf der Grundlage weiterer Daten erhoben werden können, wie das Schulsystem nach diesen Kriterien beurteilt werden kann. Die Daten werden nach der genannten Gruppierung aufbereitet und präsentiert. Dabei ist es nicht immer ganz leicht nachzuvollziehen, wie die Zuordnungen zustande kommen. Und über die eher vorläufige Bestandsaufnahme hinaus bietet diese Studie wenig Hinweise darauf, was denn in den einzelnen Ländern gegebenenfalls getan werden könnte, um die Situation zu verbessern. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es innerhalb der einzelnen Länder deutliche Unterschiede gibt, die sich in den Durchschnittswerten verständlicherweise nicht abbilden lassen. Handlungsbedarf in einzelnen Schulen war gar nicht Thema der Studie. Also: Further investigation is needed! – Seite 8 (von 23) – Heft 1/2012: Queisser 2010: Ursula Queisser: Zwischen Schule und Beruf. Zur Lebensplanung und Berufsorientierung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 360 S., 36,00 €. Fragestellung: Der Übergang von der Schule in den Beruf wird als eine Entwicklungsaufgabe verstanden, in der die „Identität“ auf eine Probe gestellt wird: Zwischen Kontinuität und Wandel muss ein Selbstbild gefunden werden, das der neuen Situation angemessen ist. Eigene, individuelle Erfahrungen und Vorstellungen müssen mit den ‚neuen‘ Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft abgeglichen werden. Dies stellt für Schülerinnen und Schüler der Hauptschule eine besondere Herausforderung dar, weil die Zertifikate, die ihnen die besuchte Schule mit auf den Weg geben kann, nicht gerade alle Türen der Berufswelt öffnen und weil dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht gerade ‚rosig‘ sind. Wie die Schülerinnen und Schüler mit dieser Entwicklungsaufgabe umgehen, wie sie die Arbeitswelt wahrnehmen und ob es dabei Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt, soll erkundet werden. Um es nicht bei bloßen Zustandsbeschreibungen zu belassen, wurde ein „didaktischer Baustein“ entwickelt und in der Praxis erprobt, mit dem in der Hauptschule die Frage der Lebensplanung und der Berufsorientierung als eine wichtige Aufgaben bearbeitet werden kann. Methoden: Die Studie ist als Triangulation angelegt mit einer teil-standardisierten schriftlichen Befragung, Einzelinterviews und Gruppendiskussionen („Wie stellt ihr euch euer Leben in zehn Jahren vor?“). Ausgewertet wurden die gesammelten Textdokumente nach der sogenannten „dokumentarischen Methode“. Anhand der im Anhang verfügbaren Materialien ist die Auswertung gut nachvollziehbar. Im Hauptteil der Arbeit wird die Interpretation ausführlich dargelegt. Ergebnisse: Es zeigt sich, dass die Jugendlichen sich intensiv mit den anstehenden Übergängen und den damit auf sie zukommenden Entscheidungen beschäftigen. Ihnen ist durchaus deutlich, dass ihre Chancen vergleichsweise problematisch sind. Es ist eine Neigung zu erkennen, diese Entscheidungen durch eine Art „Bildungsmoratorium“ zu verlängern (z.B. durch weiteren Schulbesuch), um eine besser begründete Entscheidung über den nächsten Schritt treffen zu können. Aus den Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler ist zu schließen, dass es bei der Frage nach dem „Übergang“ nicht nur darum geht, eine berufsbezogene (womöglich nur vorläufige) Entscheidung zu treffen, sondern in „biographischer“ Lebensperspektive zu entwerfen, wie das Leben gestaltet werden soll. Insofern greifen das Konzept und die Praxis der Hauptschule zu kurz, wenn diese sich auf Leistungsanforderungen bzw. Kompetenzerwerb beschränkt und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler nicht zu ihren Kernaufgaben zählt. Die Autorin plädiert in diesem Sinn für ein „biographisches Lernen unter subjektbezogener Perspektive“ (S. 396). Einschätzung: Die Studie ist von einem starken pädagogisch begründeten Engagement für die Lebensperspektiven der Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen getragen. Sie macht deren nicht ganz einfache Situation am Ende der Schulzeit bewusst und sucht nach didaktischen Konzepten, mit denen den Jugendlichen bei ihren Entscheidungen über die zukünftige Lebenszeit geholfen werden kann. Dabei – Seite 9 (von 23) – werden die aktuellen Lebenslagen und die unterschiedlichen Perspektiven differenziert transparent gemacht. Stöckli/Stebler 2011: Georg Stöckli, Rita Stebler: Auf dem Weg zu einer neuen Schulform. Unterricht und Entwicklung in der Grundstufe. Münster: Waxmann, 292 S., 39,90 €. Fragestellung: Im Kanton Zürich wurden in einem Versuchsprogramm in der Grundschule altersgemischte Klassen eingerichtet. In einer begleitenden Evaluationsstudie sollte geklärt werden, wie der Unterricht gestaltet wird und ob sich im Laufe der Begleitstudie der Unterricht verändert. U.a. sollte deutlich werden, in welcher Weise die räumlichen Umgebungen gestaltet und genutzt werden, wie sich Plenumsphasen und individuelles Lernen abwechseln, wie Kulturtechniken erworben werden, welche Rolle freies Spielen hat, wie die „Chancen der Altersheterogenität“ genutzt werden und wie die Lehrpersonen bei alledem kooperieren. Methoden: In fünf Grundschulklassen wurden im Verlauf von zwei Schuljahren Unterrichtsprotokolle und Videos erstellt. Die Lehrpersonen wurden mit Leitfadeninterviews eingehen befragt. In zweiten Teil der Studie standen die individuellen Entwicklungen der Kinder im Vordergrund. Deren intellektuelle Fähigkeiten wurden standardisiert erhoben, die SchülerInnen und die Lehrenden wurden intensiv befragt bzw. um Erlebnis-Berichte gebeten. Ergebnisse: Aus den detaillierten Befunden seien folgende notiert: Eine gute Strukturierung ermöglicht eine hohe „Nettolernzeit“ der Kinder. Bei der Gestaltung der Lernmöglichkeiten wurden noch „Unsicherheiten“ beobachtet. Kooperation gelingt nicht immer bzw. erfordert viel Zeit. Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist nötig. Bei den Kindern sind Beziehungen und Emotionen ein wichtiges Thema. Die offenen Lernsituationen eröffnen mehr Fördermöglichkeiten, die individuellen Bedürfnisse der Kinder werden deutlicher wahrgenommen. Vermisst wird eine deutlichere theoretisch-konzeptionelle Fundierung der Arbeit. Dazu wird ein Vorschlag unterbreitet, der sich auf die motivationalen Grundlagen des Lernens (im Sinne von Deci und Ryan) bezieht. Einschätzung: Die Begleitstudie lässt sich sehr detailliert auf den begleiteten Schulversuch ein. Es wird deutlich, wie konkret gearbeitet wurde und welche Probleme zu beobachten waren. Die Darstellung wirkt manchmal etwas umständlich, sie ist dadurch aber gut nachvollziehbar. Als Beispiel für eine kritisch-solidarische Begleitforschung ist sie vorbildlich. Rosch 2011: Jens Rosch: Das Problem des Verstehens im Unterricht. Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft, Monographien, Band 11. Frankfurt: Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 346 S., 24,80 €. Fragestellung: Geprüft werden soll die verbreitete Behauptung, im Unterricht würde lediglich Wissen erworben, das dazu befähigt, „Prüfungsleistungen erwartungsgerecht zu erbringen“. Methoden: Mit einer Methode, die auf die „Erschließung der sozialen Sinnstruktur von Lernen“ zielt, werden drei „Fälle“ aus dem Mathematikunterricht herangezogen und ausführlichst analysiert. Dabei – Seite 10 (von 23) – gilt als wichtigste Interpretationsregel ein „Vollständigkeitsgebot“. Dementsprechend werden Interaktionssequenzen extensiv ausgelegt und nach den ihnen immanenten Bedeutungen befragt. Schritt für Schritt entfaltet der Autor seine Sicht der tieferen, den Akteuren kaum bewussten, aber impliziten Botschaften. Ergebnisse: Den feinsinnig detaillierten, sprachlich äußerst elaborierten Interpretationen („Rekonstruktionen“ heißt das heutzutage) kann man in der hier gebotenen Kürze kaum gerecht werden. Im Grunde lautet der Befund auf die oben genannte Frage: Ja, es ist so. Bildungsmöglichkeiten kommen allenfalls in Andeutung zur Entfaltung, weil sie in den institutionalisierten Formen des Unterrichts, die von den Lehrenden durchgesetzt werden (müssen), auch gegen anderslautende Bekundungen strukturell unterbunden werden. Einschätzung: Die Studie ist begrifflich sehr elaboriert. Man muss sich auf eine umfangreiche Zerlegung der drei Interaktionssequenzen einlassen und entsprechende Geduld aufbringen. Wer sich darauf einlassen kann, durchläuft einen tiefschürfenden Entdeckungsprozess, der allerdings pragmatisch orientierte und theoretisch weiterführende Erwartungen kaum befriedigen kann. Eisnach 2011: Kristina Eisnach: Ganztagsschulentwicklung in einer kommunalen Bildungslandschaft. Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsstrukturen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 238 S., 34,95 €. Fragestellung: Die von der PH Weingarten angenommene Dissertation widmet sich der Frage, ob und wie eine regionale Schulentwicklung durch einen kommunalen, öffentlichen Kommunikationsprozess angeregt und unterstützt werden kann. Welche Strukturen werden dazu entwickelt? Welche Impulse gehen davon aus und wie wirken sich diese – ggf. in Wechselwirkung – auf die einzelnen Schulen – hier Ganztagsschulen – aus? Wie kann dieser Prozess eventuell noch optimiert werden? Methoden: Im Sinne einer Fallstudie wurde die im Jahr 2000 initiierte „Bildungsoffensive Ulm“ eingehend untersucht. Dazu wurden Dokumente aus der administrativen und politischen Diskussion herangezogen, es wurden Experteninterviews mit Vertretern der Verwaltung geführt, Schulleitungen, Eltern, Lehrer und Schüler schriftlich befragt. Diese Materialien werden sorgfältig analysiert und statistisch ausgewertet. Ergebnisse: Es wird deutlich, dass eine bewusst gestaltete politische Offensive, die in einer vielfältigen öffentlichen Bildungslandschaft mündet, wesentlich zur Entwicklung der Schullandschaft beitragen kann. Allerdings sind solche Wirkungen erst langfristig zu erwarten (wobei nicht verschwiegen wird, dass solche Effekte kaum eindeutig, „objektiv“ als Kausalwirkung zu identifizieren sind). Als wichtig erweist es sich, dass eine solche Initiative von den Beteiligten und Betroffenen intentional und in der praktischen Umsetzung nicht nur akzeptiert, sondern bewusst getragen wird. Es muss eine intensive „Aushandlungs- und Beteiligungskultur“ geschaffen werden. Einschätzung: Die Studie zeichnet ein Konzept und dessen Umsetzung an einem Beispiel nach, sie macht Probleme, Prozesse und Lösungen transparent und kommt zu hilfreichen Anregungen und Folgerungen. Andere Kommunen können hier wertvolle Hinweise finden. Der Gang der Argumentation ist differenziert nachzuvollziehen. Alle Schritte werden ausführlich erörtert, erläutert und dokumentiert. – Seite 11 (von 23) – Abels 2011: Simone Abels: LehrerInnen als „Reflective Practitioner“. Reflexionskompetenz für einen demokratieförderlichen Naturwissenschaftsunterricht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 230 S., 39,95 €. Fragestellung: Das Konzept des „reflexiven Praktikers“ (nach Donald Schön 1983) wird in der Diskussion über Lehrerbildung und vor allem über pädagogische Professionalität häufig zitiert und als Zielgröße benannt. Hier soll untersucht werden, was einen Lehrer „ausmacht“, der sich als „reflective practitioner“ versteht. Insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung dies für einen Unterricht hat, der normativ als „demokratieförderlich“ verstanden werden kann. Es soll zunächst versucht werden, das Merkmal der „Reflexionskompetenz“ zu operationalisieren und als empirische Variable verwendbar zu machen. Vermutet wird, dass das berufliche Selbstverständnis, eher ein „Fachexperte“ oder eher ein „Pädagoge“ zu sein, für die pädagogische Haltung im Unterricht bedeutsam ist. Methoden: Die Autorin erläutert ausführlich ihre methodologischen Überlegungen. Angemessen erscheinen ihr nur eine Verbindung verschiedener Ansätze und ein „offener“ Umgang mit diesen. Zentrales Material bilden Reflexionsarbeiten, die Studierende im Rahmen von praxisbezogenen Lehrveranstaltungen verfassen mussten und in denen im Rückblick eigene Unterrichtserfahrungen beschrieben und mit Blick auf didaktisch-methodische Kriterien reflektiert werden sollten. Diese wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Dabei sollten nicht nur vorab gefasste Kategorien „subsumptionslogisch“ angewendet werden. Da es sich um ein bisher wenig empirisch gefasstes Forschungsfeld handelt, war der Autorin eine Offenheit für nicht erwartete Befunde wichtig. Mit Blick auf die Reflexionsfähigkeit der Probanden sollten deren Reflexionen (Ebene 2) über erfahrene Praxis (Ebene 1) als subjekthaft bedeutsam ernst genommen werden. Die eigene Analyse wird einer dritten Ebene (Analyse der Reflexionen) zugeordnet. Für diesen Ansatz schlägt sie den Begriff einer „interpretativen Solidarität“ vor. Damit soll transparent werden, dass ein Forschungsprozess zu diesem Gegenstand nur in wechselseitiger „Verbundenheit“ und einer gleichzeitig prinzipiellen Offenheit zu einem treffenden Ergebnis führen kann. Ergebnisse: Es werden vier Stufen der Reflexionsfähigkeit ermittelt: In einer eher schlichten „sachbezogenen Beschreibung“ werden didaktische Entscheidungen rein deskriptiv, ohne nähere Begründung benannt. In der auch noch konkreten „handlungsbezogene Begründung“ werden zwar Argumente und Erklärungen für Entscheidungen oder Resultate des Unterrichts herangezogen, aber nicht näher erörtert. Bei einer „analytischen Abstraktion“ werden konkrete Ereignisse ‚zurückschreitend‘ analysiert und auf bedingende Faktoren für das Gelingen oder Misslingen befragt. Ein „kritischer Diskurs“ zeichnet sich dadurch aus, dass „multiple Perspektiven“ eingenommen werden und Erfahrungen auf vielfältige Weise gedeutet und differenziert erwogen werden. Beim Versuch, Beziehungen zwischen Berufsidentität und Reflexionskompetenz aufzuzeigen, zeigt sich, dass es kaum einen Unterschied macht, ob sich jemand als „Fachexperte“ oder als „Pädagoge“ versteht. Für einen demokratieförderlichen Unterricht (hier in den Naturwissenschaften) ist vielmehr das Reflexionsniveau bedeutsam: Studierende mit höherem Reflexionsniveau vertreten häufiger normative Vorstellungen eines demokratieförderlichen Unterrichts und sie deuten ihren eigenen Unterricht deutlicher im Lichte dieser Kategorien. Einschätzung: Die Studie wird theoretisch-konzeptionell und methodologisch ausführlich hergeleitet. Die Transparenz dieser Überlegungen ist beeindruckend und kann als vorbildhaft gelten. Auch die – Seite 12 (von 23) – Auswertung der Reflexionsberichte der Studierende ist gut nachvollziehbar, ohne dass diese langatmig referiert würden. Im Anhang sind der Fragebogen zur Berufsidentität, das Beispiel einer Textkodierung und „Ankerbeispiele“ für die entwickelten Stufen der Reflexionskompetenz dokumentiert. Es ist dann konsequent, dass die Autorin am Ende für die Lehrerbildung eine stärkere Orientierung an demokratieförderlichen Konzepten fordert, von denen sie sich eine „Humanisierung des Lernens“ verspricht. Schlicht 2011: Raphaela Schlicht: Determinanten der Bildungsungleichheit. Die Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen im Vergleich der deutschen Bundesländer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 342 S., 39,95 €. Fragestellung: Der Föderalismus in der Bundesrepublik wird immer wieder damit zu rechtfertigen versucht, dass auf regionale Besonderheiten verwiesen wird, die besondere Lösungen erfordern. Es soll geklärt werden, wie sich „Bildungspolitische Institutionen“ zwischen den Ländern unterscheiden und wie sich deren Variation auswirkt. Als ‚abhängige‘ Wirkungs-Variable werden zwei „Arten der sozialen Selektivität“ betrachtet: die sozial bedingte Ungleichheit im Bildungszugang (gemeint ist der Übergang zu Gymnasien) und die soziale Ungleichheit im Bildungsprozess (gemeint sind die unterschiedlichen Chancen bzw. Erfolge beim Kompetenzerwerb). Als möglicherweise bedingende „Institutionen“ der Bildungspolitik (gemeint sind strukturelle Merkmale der jeweiligen Schulsysteme) werden untersucht: die frühkindliche Bildung, der erreichte Ausbau der Ganztagsschule, die durchschnittliche Klassengröße, die Bildungsausgaben, die Gliederung in der Sekundarstufe I sowie die Stärke des Privatschulsektors. Dazu werden Hypothesen zu positiven bzw. negativen Effekten auf die soziale Selektivität formuliert. Methoden: Die Daten, anhand derer diese Fragen beantwortet werden sollen, wurden zum einen bei den Kultusbehörden, statistischen Ämtern etc. erfragt. Der Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler wurde mit den Daten aus PISA 2003 erfasst. Die verschiedenen Variablen werden akribisch dargelegt, die Wahl der Auswertungsmethoden wird ausführlich diskutiert und begründet. Berechnet werden in zweistufigen Mehrebenenanalysen Regressionskoeffizienten, die – wie es üblich geworden ist – kausal interpretiert werden. Es zeigt sich allerdings, dass die vermuteten und teilweise durchaus erkennbaren Effekte kaum eindeutig auf die jeweils betrachtete „Institution“ (s.o.) zurückgeführt werden können, weil andere Merkmale wie z.B. „soziokulturelle Rahmenbedingungen“ mit bedacht werden müssten. (Von pädagogisch-didaktischen Konzepten und deren praktischer Wirkung ist gar nicht die Rede.) Ergebnisse: „Die bildungspolitische Komposition der deutschen Bundesländer beeinflusst das Ausmaß sozialer Bildungsungleichheit.“ (S. 267) Dies bezieht sich u. a. darauf, dass eine intensive frühkindliche Bildung die soziale Selektivität beim Zugang zum Gymnasium mildert, dass dies auch für den Ausbaugrad der Ganztagsschule gilt, dass eine größere durchschnittliche Klassengröße den Zugang zum Gymnasium sozial erschwert, dass eine spätere Aufteilung auf die Schulformen der Sekundarstufe diesen Zugang sozial erleichtert und dass ein größerer Privatschulsektor die sozialen Zugangschancen einschränkt. Für den Erfolg im Prozess (also im Kompetenzerwerb) ergeben sich Effekt auf die Bildungsungleichheit nur bei der frühkindlichen Bildung (verringernd) und bei Vorschulangeboten (verstärkend), bei den anderen „Institutionen“ ist kein unterschiedlicher Effekt zu erkennen. – Seite 13 (von 23) – Wohlgemerkt: Das bezieht sich alles auf Unterschiede zwischen den Ländern, nicht auf die absolute Ausprägung der jeweiligen Merkmale! Wie stark sich z.B. der Ausbau der Ganztagsschule auf die soziale Bildungsungleichheit auswirkt, wird in der vergleichenden Betrachtung nicht deutlich. Einschätzung: Titel und Untertitel wecken hohe Erwartungen. Die Fragestellung ist schlichter: Es werden ausgewählte Merkmale der Bildungssysteme zwischen den Ländern verglichen und auf zwei Aspekte der sozialen Bildungsungleichheit bezogen. Das ist sicher eine wichtige Frage, aber doch wohl nicht die ganze „Leistungsfähigkeit“. Zu dieser Fragestellung wird allerdings ein breites Spektrum der relevanten Literatur verarbeitet, es wird sehr sorgfältig entwickelt, wie die verschiedenen Merkmale definiert werden sollen. Dazu werden die Besonderheiten der Länder vollständig referiert, sodass sich in einigen Punkten fast ein Handbuch des Föderalismus ergibt. Die statistische Auswertung der Daten ist sehr ambitioniert und ohne genauere methodologische Kenntnisse kaum nachvollziehbar. Die Kennwerte, auf denen die Interpretationen und Schlussfolgerungen beruhen, sind sehr abstrakt (und bei Zahlenwerten im Bereich unter 0,00001 zunächst irritierend). Diese politologische Dissertation (Uni Konstanz) ist in dieser Form wohl nur für Leser hilfreich, die zu diesen Fragen weitere Studien erarbeiten wollen. Zur bildungspolitischen Debatte über Föderalismus und die soziale Selektivität trägt sie kaum bei. Bildungspolitische oder gar schulpädagogische Folgerungen sind in dieser Studie nicht Thema gewesen. Gänzlich offen bleibt bei alledem die Frage, wie viel Bildungsungleichheit erwünscht ist bzw. akzeptiert werden soll. Bolland 2011: Angela Bolland: Forschendes und biografisches Lernen. Das Modellprojekt Forschungswerkstatt in der Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 406 S., 36,00 €. Fragestellung: Zentraler Ansatz ist die These, dass Bildung als Selbstbildung verstanden werden muss und dass Lehrerinnen und Lehrer auf ihre berufliche Tätigkeit am besten dadurch vorbereitet werden, dass sie die eigene Biografie zum Gegenstand ihrer Reflexion machen und einen „subjektbezogenen konkreten Handlungsbezug“ finden. Gegebenenfalls soll in der Lehrerbildung ein entsprechendes „handlungsorientiertes praxisrelevantes Lehrangebot“ angeboten werden. Methoden: Für diese Fragestellung erschien der Autorin ein „hypothesenprüfendes Verfahren“ nicht angemessen. Sie wählte stattdessen einen Ansatz nach dem Konzept der „grounded theory“. Damit will sie dem Anspruch gerecht werden, ein innovatives Konzept für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung zu entwerfen. Es werden entsprechende Interviews geführt und auf die Fragestellung hin analysiert. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Studentinnen, deren Erfahrungen ausführlich dokumentiert werden. Herausgearbeitet werden „Denkmuster“ und die damit verbundenen „Erfahrungs- und Reflexionsleistungen“. Ergebnisse: Forschendes Lernen in der Forschungswerkstatt steigert die studentische Reflexionskompetenz. Begleitende Denkmuster werden bewusst und gegebenenfalls überprüft. Die spätere Rolle als Lehrerin und das spätere Handeln im Unterricht werden kritisch(er) und perspektivisch reflektiert. Fragen für die weitere Forschung zu diesem Ansatz werden entwickelt. – Seite 14 (von 23) – Einschätzung: Die Studie entwirft und verfolgt einen hochschuldidaktisch und professionstheoretisch anspruchsvollen Ansatz. Dieser wird methodisch fundiert und durchaus selbstkritisch untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Reflexion auf eigene Erfahrungen im bisherigen Lebensverlauf bedeutsam werden kann für das Selbstverständnis als zukünftige Lehrperson und für die pädagogische Haltung im Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Diese Anregungen sollten in der Lehrerbildung – und zwar in allen Phasen – aufgegriffen werden. Looser 2011: Dölf Looser: Soziale Beziehungen und Leistungsmotivation. Die Bedeutung von Bezugspersonen für die längerfristige Aufrechterhaltung der Lern- und Leistungsmotivation. Opladen: Budrich UniPress, 270 S., 29,90 €. Fragestellung: Welche Bedeutung haben Beziehungen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Bezugspersonen? Wie wirkt sich dies insbesondere auf die Lern- und Leistungsmotivation aus? Nach dem Stand der Forschung ist zu erwarten, dass ein Kind umso eher eine hohe Leistungsmotivation entwickelt, wenn es sich als Person beachtet und wertgeschätzt fühlt. Dieser Zusammenhang soll untersucht werden. Dazu wird unter anderem die Hypothese entwickelt, dass zwischen der Leistungsmotivation im frühen Jugendalter und der beruflichen Leistungs- und Weiterbildungsmotivation im Erwachsenenalter (22 Jahre später) stabile Beziehungen bestehen. Methoden: Zur Beantwortung dieser Frage konnte der Autor auf Daten zurückgreifen, die im Projekt „Lebensverläufe ins frühe Erwachsenenalter“ (Leitung Helmut Fend) über eine Spanne von 22 Jahren erhoben worden sind. Verfügbar ist dadurch eine große Fülle relevanter Variablen. Als „Kontrollvariablen“ werden unter anderem das Geschlecht, die Schulform, verbale Intelligenz, Schicht, Berufsstatus des Vaters und der Mutter etc. einbezogen. Im Zentrum stehen Merkmale der familiären und der außerfamiliären sozialen Erfahrungen. Als Merkmale der erwachsenen Persönlichkeit werden unter anderem Leistungsmotivation, Leistungsangst, Begabungszuschreibung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, schulische Normverletzung, Nikotinkonsum, Bildungsorientierung, berufliche Leistungsmotivation, Weiterbildungsmotivation und berufliche Selbstwirksamkeitsüberzeugung betrachtet. Die zu prüfenden Beziehungen werden statistisch mit Korrelationskoeffizienten und dem Effektstärke-Maß d erfasst. Die Problematik von Veränderungsmessung wird ausführlich diskutiert. Ergebnisse: Die äußerst vielfältigen und differenzierten Befunde sind kaum in kurzen Worten zusammenzufassen. Insgesamt zeigt sich, dass die vermuteten Beziehungen zwischen positiven Erfahrungen in Familie und Schule und der persönlichen bzw. beruflichen Leistungsbereitschaft im Erwachsenenalter bestehen. Dabei werden vor allem männliche Hauptschüler auffallend ungünstiger beeinflusst. Positive Wirkungen werden im Sinne der „Selbstbestimmungstheorie“ interpretiert: Subjektiv erlebte Autonomie, die wahrgenommene eigene Kompetenz und die soziale Eingebundenheit werden als entscheidende Motivationsfaktoren (im Sinne von Deci und Ryan) verstanden. Die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen wird weit ins Erwachsenenalter hinein nachhaltig durch die Schule beeinflusst. In diesem Sinne wird gefolgert, dass es wichtig ist, die motivationale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stärker auf eine längerfristige Perspektive auszurichten. Gemeinschaftsbildung und gute Beziehungsverhältnisse sind Voraussetzungen für eine ganzheitliche und letztlich langfristig wirkende Leistungsmotivation. Einschätzung: Die Studie ist theoretisch und methodisch anspruchsvoll, aber sorgfältig und gut nachvollziehbar dargestellt. Die Fülle der detaillierten Ergebnisse kann verwirren, es gelingt dem Autor – Seite 15 (von 23) – aber immer wieder, das Wesentliche herauszustellen. Die Befunde können zu praktischen Schlussfolgerungen führen. Gerecht 2010: Marius Gerecht: Schul- und Unterrichtsqualität und ihre erzieherischen Wirkungen. Eine Sekundäranalyse auf der Grundlage der Pädagogischen EntwicklungsBilanzen. Münster: Waxmann, 210 S., 24,90 €. Fragestellung: Neben den kognitiven und auf Leistung bezogenen Kriterien für „guten“ Unterricht ist immer auch zu bedenken, wie sich die Art der Gestaltung des Unterrichts auf Einstellungen und Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Es wird untersucht, wie sich Merkmale der „Schulqualität“ (pädagogische Führung, Lehrerkooperation, Kollegialität, Vandalismus) und der „Unterrichtsqualität“ (Strukturiertheit, Unterstützung, kognitive Aktivierung, Schülerorientierung) auf Persönlichkeitsmerkmale der Schülerinnen und Schüler auswirken. Als mögliche bzw. wünschenswerte „Ergebnisse“ dieser Merkmale werden die Lernfreude, soziale Integration, die Akzeptanz von Regeln und das Ausbleiben von Schulabsentismus in den Blick genommen. Methoden: Die Studie verwendet Daten, die im Projekt „Schulentwicklung, Qualitätssicherung und Lehrerarbeit“ (Leitung: Peter Döbrich) am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) zwischen 1998 und 2006 erhoben worden sind. Dabei wurden Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zu den genannten und weiteren Variablen ihrer jeweiligen Schule befragt. Die entsprechenden Skalen werden ausführlich beschrieben. Die Lehrerinnen und Lehrer wurden unter anderem über Zufriedenheit mit der pädagogischen Führung, zu Kommunikation zwischen Schulleitung und Kollegium und zum Zusammenhalt im Kollegium befragt. Die Schülerinnen und Schüler gaben Auskunft über die Strukturiertheit des Unterrichts, ob sie sich durch die Lehrkräfte unterstützt fühlen, ob sie kognitive Aktivierung erleben, ob der Unterricht schülerorientiert ist etc. Zudem wurden individuelle und institutionelle Merkmale erfragt. Die Auswertung der Daten ist methodisch anspruchsvoll. Die Verfahren werden ausführlich erläutert und ihre Auswahl wird begründet. Aus der Struktur der Daten wird gefolgert, dass Mehrebenenanalysen das angezeigte Verfahren sein müssen. Ergebnisse: Die untersuchten Merkmale der erzieherischen Wirkungen haben erwartungsgemäß unterschiedlich starke Bezüge zu den Merkmalen der Schul- und Unterrichtsqualität. Lernfreude wird vor allem positiv durch eine stärkere Schülerorientierung beeinflusst, wobei dies insbesondere für Mädchen zu gelten scheint. Auch die soziale Integration und die Akzeptanz von Regeln werden durch eine stärkere Schülerorientierung deutlich beeinflusst. Keinen erkennbaren Einfluss haben die Schulform, die Lehrerkooperation und der Migrantenanteil. In einer anschließenden „Mediatoranalyse“ wird aufgezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Schülerorientierung und Schulabsentismus, der zunächst als nicht bedeutsam erscheint, vermittelt über das Sozialklima und das Lernklima beeinflusst wird. In der Bilanzierung der Ergebnisse werden methodologische Fragen erörtert, die sich bei dieser Art von Sekundäranalyse stellen. Einschätzung: Beeindruckend ist die sorgfältige Darstellung dieser Arbeit. Die Fragestellung und die Methoden ihrer Bearbeitung werden ausführlich referiert und diskutiert. Es wird deutlich, dass die Daten der „pädagogischen EntwicklungsBilanzen“ nicht nur in der Rückmeldung an die einzelnen Schulen bedeutsam sein können, sondern auch für übergreifende Fragestellungen hilfreich sind. Weitergeführt werden könnte die Studie durch begleitende Längsschnittuntersuchungen an verschiedenen Schulen, um herauszuarbeiten, wie sich Qualitätsmerkmale von Schule und Unterricht konkret auf Persön- – Seite 16 (von 23) – lichkeitsmerkmale der Schülerinnen und Schüler auswirken und wie dies gegebenenfalls deutlicher beeinflusst werden können. Heft 2/2011: Kühn 2010: Svenja Mareike Kühn: Steuerung und Innovation durch Abschlussprüfungen? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 341 S., 39,95 €. Fragestellung: In den herkömmlichen Abiturprüfungen dominierte eine „Prüfungskultur“, in der angeeignetes Wissen reproduziert werden sollte, die sich auf curricular begrenzte The-menbereiche bezog und für deren Bearbeitung eingeübte Lösungswege erforderlich und aus-reichend waren. In der neueren Konzeption der Reifeprüfung sollen dagegen „Kompetenzen“ auf weiterführende Aufgaben und Problemstellungen angewendet werden. Es sollen Anforderungen aus verschiedenen Bereichen herangezogen und vernetzt werden. Dabei sollen unterschiedliche Lösungswege und verschiedene Ergebnisse möglich sein. In der Studie soll erkundet werden, ob bzw. in welchem Maße diese „neuen“ Erwartungen und Anforderungen in den aktuellen Abiturprüfungen umgesetzt worden sind. Insbesondere sollte geklärt werden, ob es Zusammenhänge gibt zwischen länderspezifischen Prüfungsmodalitäten und Prüfungsaufgaben und ob sich dies ggf. bei zentralen und dezentralen Prüfungen darstellt. Weiterhin sollte geprüft werden, ob äußere Faktoren (wie fachdidaktische Diskussionen und Innovationen oder Ergebnisse von Schulleistungsstudien) die Art der Prüfungsaufgaben beeinflusst haben. Und zum dritten sollten Aufgaben aus dem vorangegangenen Unterricht und den dabei eingesetzten Klausuren mit denen der Abiturprüfungen verglichen werden. Inhaltlich sollten die Aufgaben mit den in den EPAs festgelegten Anforderungen verglichen werden. Und schließlich sollten diese Fragen fachspezifisch aufgeschlüsselt werden. Methoden: Im Rahmen eines von der DFG geförderten Projektes über „Bedingungen und Wirkungen zentraler und dezentraler Abschlussprüfungen im naturwissenschaftlichen Unter-richt“ wurden Abituraufgaben dieser Fächer analysiert. Dazu wurde ein eigenes Kategorien-system entwickelt, mit dem bestimmte Aspekte der Aufgaben für die schriftlichen Prüfungen in den drei naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern erfasst werden sollten. Verglichen werden die Abiturprüfungen in vier Bundesländern mit jeweils besonderen Modalitäten (BW, NRW, SL, RP). Für zwei Länder (BW und RP, also Länder mit zentralem bzw. dezentralem Abitur) werden Klausuraufgaben aus der Qualifikationsphase analysiert. In jedem der drei Fächer Biologie, Chemie und Physik wurden in der 4-Länder-Studie etwa 200 Aufgaben analysiert, in der 2-Länder-Studie insgesamt 891 Aufgaben. Zur Kodierung der Aufgaben wurden u.a. die Antwortformate (gebunden oder offen), die „Offenheit“ der Lösungswege und der Ergebnisse, die Art der Aufgaben (ohne Materialbezug, materialgebundene Aufgaben, experimentelle Aufgaben) betrachtet. Weiterhin ging es um die Bedeutung von Experimenten, um Anwendungsbezug, um die fachlichen Inhalte, um curriculare Validität, die angesprochenen Kompetenzbereiche und um Anforderungsbereiche (Reproduktion, Anwendung, Transfer). Alle Kategorien werden anhand von Beispielen erläutert. Ergebnisse: In einem Überblick zur aktuellen Situation werden zunächst die unterschiedli-chen Entwicklungen bzw. die divergierenden Verfahren der Prüfungen herausgestellt. Die Analyse der Aufgaben ergibt u.a. den Befund, dass die Aufgaben mehrheitlich die „Reproduktion und Reorganisation – Seite 17 (von 23) – von Wissen statt komplexer kognitiver Prozesse fokussier(en)“ (S. 303). Damit hat sich die traditionelle Aufgabenkultur kaum verändert. Die zwischen den Ländern vereinbarten Anforderungen werden in den Ländern nach deren jeweiliger Prüfungstradition umgesetzt. Ein einheitlicher Qualitätsstandard werde nicht entwickelt. Äußere Einflussfaktoren (wie fachdidaktische Entwicklungen und ähnliche Herausforderungen) kommen in den zentralen Prüfungsanforderungen „nicht an“, das Innovationspotenzial der Lehrkräfte scheint größer zu sein als das der zentral verantwortlichen Prüfungskommissionen. Geregelt und „gesteuert“ wird also nicht in erster Linie zentral, sondern im Sinne der „Governance“ durch spezifische Übersetzung und Adaptionsprozesse. Lehrkräfte sind also weniger bzw. nicht nur Objekte zentraler Steuerung, sondern selbst entscheidende Akteure, die für die Qualität des Unterrichts und der Anforderungen eine wichtige aktive Rolle spielen. Einschätzung: Die Studie ist außerordentlich differenziert angelegt, methodisch-technisch im Grunde zwar vergleichsweise ‚schlicht‘, aber in der prozentualen Auswertung der kategorial ermittelten Daten äußerst sorgfältig und differenziert. Die Daten werden konsequent auf die Fragestellung bezogen und in diesem Rahmen interpretiert. Folgerungen für die Bildungspolitik und für die weitere Forschung werden formuliert. Hochweber 2010: Jan Hochweber: Was erfassen Mathematiknoten? Korrelate von Mathematik-Zeugniszensuren auf Schüler- und Schulklassenebene in Pri-mar- und Sekundarstufe. Münster: Waxmann, 398 Seiten, broschiert, 25,50 €. Fragestellung: Es wird die weit verbreitete Erfahrung aufgegriffen, dass Zensuren die fachlichen Leistungen der Beurteilten nur begrenzt zutreffend erfassen – jedenfalls dann, wenn man sie mit Daten vergleicht, die mit empirisch-methodisch anspruchsvollen Verfahren erhoben werden. Ob dies immer noch der Fall ist, ob es sich in unterschiedlichen Kontexten different darstellt und von welchen Faktoren es beeinflusst und ggf. beeinflussbar ist, soll geprüft werden. Dazu werden vielfältige Aspekte einbezogen wie z.B.: •fachspezifische Schülerkompetenzen: die in large-scale-Verfahren erhobene Testleistung •leistungsnahe Schülermerkmale: insbesondere „Anstrengung“ •leistungsferne Schülermerkmale: Geschlecht, Herkunft, äußere Erscheinung im Sinne von „Hintergrundmerkmalen“ •Wie „kontextualisieren“ Lehrkräfte die institutionellen Vorgaben zur Leistungsbeurtei-lung und lassen sich Persönlichkeitsmerkmalen identifizieren, die dabei eine ggf. differenzierende Rolle spielen? •Gibt es schulspezifische Einflüsse wie z.B. Formen und Ergebnisse der Kooperation unter-einander bzw. Vorgaben der Schulleitung? •Welche Bedeutungen habe „Überzeugungen, Kompetenzen und Motivationen der Lehrkräfte? •Wie werden Zensuren in der Interaktion mit der Klasse gehandhabt (z.B. als Mittel der Steuerung oder Disziplinierung)? Methoden: Die Studie greift vor allem auf Daten zurück, die in den landesweiten Leistungs-studien in Rheinland-Pfalz (Projekte VERA und MARKUS) zur Verfügung stehen. Diese können für die genannte Fragestellung differenziert ausgewertet werden. Dazu wird ein Mo-dell entwickelt bzw. herangezogen, in dem die relevanten Merkmale den Ebenen der Schule, der Klasse und der einzelnen Schüler als „hierarchisch“ strukturiert zugeordnet werden. Die Fülle der Daten wird mit Hilfe von Faktorenanalysen strukturiert. Und mit Hilfe komplexer Regressionsmodelle und -berechnungen werden Beziehungen zwischen bedingenden Merk-malen und Leistungsurteilen aufgezeigt. – Seite 18 (von 23) – Ergebnisse: Die Analyse der vielfältigen Daten führt zu einer großen Fülle detaillierter Einzelbefunde, die jedoch in einem (mit ca. 80 Seiten) immer noch umfangreichen Kapitel „Ergebnisdarstellung“ und einer (mit ca. 60 Seiten) fast ebenso langen „Ergebnisdiskussion“ bilanziert werden. Einige Ergebnisse entsprechen den Erwartungen, sie werden aber anhand der Daten differenzierter aufgeschlüsselt. Bemerkenswert ist u.a. der Befund, dass der Zusammenhang zwischen Test-Leistungen und Zensuren in der Grundschule hoch und deutlich enger ist als in der Sekundarstufe. Dabei sind die Zensuren tendenziell treffender, wenn die Lehrkraft mit der jeweiligen Klasse vertraut geworden ist. Wenn der Unterricht weniger zielstrebig und leistungsorientiert abläuft bzw. ablaufen kann (z.B. weil er durch Verhaltensprobleme oder geringere Motivation der Schülerinnen und Schüler gestört ist), kommt in Zensuren die tatsächliche, gemessene Leistung weniger treffend zum Ausdruck. Schülermerkmale spielen erwartungsgemäß eine Rolle, aber ebenso erwartungsgemäß ist deren Bedeutung im Einzelnen nicht genau zu bestimmen. So ist z.B. nicht zu klären, ob was bei dem Zusammenhang zwischen Prüfungsangst und Zensuren der auslösende und der abhängige Faktor ist. Dass Einstellungen und Haltungen der Lehrkräfte auch hier bedeutsam sind, zeigt sich u.a. daran, dass jene Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv mit den Leistungsrückmeldungen aus VERA befassen und/oder sich in kollegialer Kooperation über gemeinsame Standards austauschen, die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler treffender beurteilen können. Insgesamt zeigt sich, dass das klasseninterne Bezugssystem bei der Notenvergabe „nach wie vor dominiert“. Für übergreifende Leistungsvergleiche erweisen sich folglich Zensuren als „untauglich“. Dass als eine Folgerung aus dieser Studie abgeleitet wird, dass die übergreifenden Leistungsfeststellungs-Verfahren (wie VERA) weiterhin eingesetzt werden sollten und weitere Untersuchungen wünschenswert oder gar erforderlich sind, dürfte nicht überraschen. Einschätzung: Die Studie ist theoretisch und methodisch sehr ambitioniert angelegt. Die Lektüre erfordert Geduld, weil man sich in der Fülle der angesprochenen Aspekte und vor allem der referierten Daten (manche Text-Passagen bestehen überwiegend aus Daten) verlieren kann. Wer genau und geduldig liest, wird jedoch systematisch geführt. Alles ist transparent dargestellt und die Befunde werden vorsichtig und immer wieder auch selbstkritisch interpretiert und diskutiert. – Nur angedeutet, aber immerhin (aus S. 350) angesprochen, wird dabei, dass die Befunde und mögliche Folgerungen im Kontext der „inneren Widersprüche“ der „Funktionsbestimmung von Zensuren“ im deutschen Bildungssystems erörtert werden müssen. Solche Zusammenhänge scheinen bei der empirischen Forschung zurzeit allerdings noch nicht (wieder) im Blick zu sein. Kessel u.a. 2011: Martina Kessel, Bertram Müller, Tanja Kosubek, Heiner Barz (Hg.): Aufwachsen mit Tanz. Erfahrungen aus Praxis, Schule und Forschung. Beltz, 191 S., 24,95 €. Fragestellung: Dass ästhetische Erfahrungen sich in vielfältiger Weise auf die „ganze“ Persönlichkeit auswirken, wird immer wieder behauptet und oft wiederholt – insbesondere von jenen, die diesem Feld eine größere Bedeutung zukommen lassen möchten. Es gibt allerdings über persönliche Erfahrungen und subjekthafte Erlebnisse hinaus kaum Forschung, in der diese These „belastbar“ geprüft wird (vgl. dazu: Rittelmeyer 2010: Christian Rittelmeyer: Warum und wozu ästhetische Bildung? Über Transferwirkungen künstlerischer Tätigkeiten. Ein Forschungsüberblick. ATHENA, 124 S., 17,50 €). In der vorliegenden Studie soll dieser Mangel bearbeitet werden. – Seite 19 (von 23) – Methoden: Zum einen wurde ein psychologischer Test für 14- bis 18-Jährige entwickelt und eingesetzt, mit dem die Kategorien „emotionale Stabilität“, „soziale Erwünschtheit“, „Antriebsspannung“, „Leistungsmotivation“, „Kontaktverhalten“ und „Aggressivität“ erfasst werden. Damit sind Persönlichkeitsmerkmale gemeint, die für Ausbildung und Beruf von besonderer Bedeutung sind. Zum anderen wurden im Sinne qualitativer Verfahren Jugendliche bei Proben für eine Aufführung beobachtet, nach jeder Probe um spontane Aufzeichnungen ihrer Erlebnisse in einem persönlichen „AudioTagebuch“ gebeten (mit Hilfe eines MP3-Recorders und angeregt durch Leitfragen). Darüber hinaus wurden einzelne Jugendliche interviewt und Lehrende und Eltern befragt. Ergebnisse: Im ersten Teil des Bandes wird zunächst mit vielen Details und beeindruckenden Fotos aus der Praxis des Projektes „Take-off: Junger Tanz. Tanzplatz Düsseldorf“ berichtet. Die Erfahrungen sind beeindruckend, es werden aber auch Schwierigkeiten und Hürden benannt. Im zweiten Teil des Bandes steht die empirische Studie im Mittelpunkt. Auszüge aus den Tagebüchern machen nachvollziehbar, wie die Jugendlichen das Angebot, zu tanzen, aufgenommen haben, welche Vorbehalte (besonders bei den Jungen) bestanden haben und wie diese bearbeitet wurden. Die Testerhebungen zeigen dann für einzelne Jugendliche, dass sich die erhobenen Persönlichkeitsmerkmale in der Regel positiv entwickelt haben. In einer systematischen Zusammenschau werden persönliche und institutionelle Konstellationen/Bedingungen mit möglichen Wirkungen modellartig konfiguriert. Schließlich werden aus den Erfahrungen Empfehlungen für ähnliche Projekte abgeleitet. Einschätzung: Der Band gibt vielfältige Anregungen für die ästhetische Praxis im Rahmen von Schulen und er stellt sich in überzeugender Weise der empirischen Prüfung der damit verbundenen Erwartungen. Heft 1/2011: Trautwein u.a. 2010: Ulrich Trautwein, Marko Neumann, Gabriel Nagy, Oliver Lüdeke, Kai Maaz (Hg.): Schulleistungen von Abiturienten. Die neu geordnete gymnasiale Oberstufe auf dem Prüfstand. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 306 S., 39,95 €. Fragestellung: Die KMK hatte 1999 beschlossen, dass in der Oberstufe der Gymnasien wieder stärker kanonförmige Modelle eingeführt werden können, wie sie vor der »großen« Oberstufenreform von 1972 bestanden hatten. Über die Wirkungen dieser Maßnahmen wird zwar mehr oder weniger heftig und kontrovers gestritten, aber belastbare empirische Befunde sind eher rar. Am Beispiel des Landes Baden-Württemberg soll erkundet werden, ob die mit dieser (Rück-)Neuordnung verbundenen Erwartungen erfüllt werden. Methoden: In der vom MPI für Bildungsforschung durchgeführten Studie „Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren“ (TOSCA) wurden seit 2002 4.730 Abiturientinnen und Abiturienten aus 90 allgemeinbildenden und 59 beruflichen Gymnasien untersucht. Erhoben wurden Kenntnisse in Mathematik, Englisch und den Naturwissenschaften sowie kognitive Grundfähigkeiten, Persönlichkeitseigenschaften, Selbstbilder, Lebensziele und berufliche Interessen. Gefragt wurde auch, wie weit sich die Absolventen auf das Studium vorbereitet fühlen und an welchen Fächern sie sich orientieren. Die Erhebungen wurden 2006 wiederholt, sodass sich auch Entwicklungen darstellen lassen. Die Methoden der Studie werden ausführlich beschrieben. – Seite 20 (von 23) – Ergebnisse: Die Studie bezieht sich zwar auf Baden-Württemberg, hat aber nach Meinung der Autoren auch Bedeutung für andere Bundesländer. Die Lage nach dem Stand von 2006 wird für alle Länder skizziert, für Baden-Württemberg detailliert dargelegt. Analysiert wird zunächst die Entwicklung der Oberstufe von den frühen Konzepten der 1950er Jahre bis zu den jüngsten Änderungen. Verglichen werden mehrfach die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien mit denen der beruflichen Gymnasien, die in Baden-Württemberg von etwa einem Drittel der Abiturienten besucht werden. Letztere beurteilen die Reform der Oberstufe deutlich positiver als jene der »normalen« Gymnasien. Bei den Leistungen in den untersuchten Fächern stellen sich die Entwicklungen von 2002 bis 2006 uneinheitlich, überwiegend aber gemessen an den Erwartungen als eher gering dar. Mögliche Gründe hierfür werden ausführlich diskutiert. Hosenfeld 2010: Annette Hosenfeld: Führt Unterrichtsrückmeldung zu Unterrichtsentwicklung? Die Wirkung von videographischer und schriftlicher Rückmeldung bei Lehrkräften der vierten Jahrgangsstufe. Münster: Waxmann, 250 S., 29,90 €. Fragestellung: Für die Entwicklung professioneller Kompetenzen kann die Fähigkeit zur Kooperation und zur Reflexion über die alltägliche Arbeit im Unterricht als wesentlich vermutet werden. Lehrerinnen und Lehrer sollten Rückmeldungen über ihren Unterricht als Anregung begreifen und produktiv nutzen. In welchem Maße dies der Fall ist bzw. unter welchen Bedingungen die beiden angesprochenen Rückmeldeformen wirksam sind, sollte in dieser Studie untersucht werden. Methoden: Im Rahmen des Projektes „VERA – Gute Unterrichtspraxis“ (Leitung Andreas Helmke) wurden Unterrichtsstunden mit Video dokumentiert und die Leistungen in Mathematik und Deutsch erhoben. Zusätzlich wurden 1050 SchülerInnen und 65 Lehrpersonen schriftlich und mündlich befragt. Die Instrumente dieser Erhebungen sind im Anhang ausführlich dokumentiert. Die Daten wurden mit Mehrebenenanalysen ausgewertet, sodass deutlich werden kann, welche Einflüsse die verschiedenen Formen der Rückmeldung, Merkmale der Lehrerpersönlichkeit etc. auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben. Ergebnisse: Im Vergleich erweisen sich die schriftlichen Rückmeldungen gegenüber den videografierten als wirksamer. Dabei scheinen Lehrpersonen, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit zufriedener sind als andere, sich länger und intensiver mit den erhaltenen Informationen zu beschäftigen. Es konnten drei »Typen« des Umgangs mit Rückmeldungen identifiziert werden. In vielen Fällen sind Lehrkräfte um so mehr bereit, sich mit Rückmeldungen auseinanderzusetzen, wenn sie in ihrer Selbstwahrnehmung relativ sicher sind und die Überzeugung haben, dass sie guten Unterricht machen. Insgesamt erweist es sich aber als schwierig, die Effektivität von Unterricht auf (wenige) Merkmale der Lehrerpersönlichkeit zurückzuführen, was damit erklärt wird, dass Unterricht ein sehr komplexes Geschehen ist, das nicht mit wenigen Dimensionen erfasst werden kann. Videografierte Rückmeldungen entsprechen nur bedingt den Erwartungen der Betrachter. Sie würden erst dann anregend wirken, wenn sie mit gezielten Fragestellungen verbunden werden. Baltruschat 2010: Astrid Baltruschat: Die Dekoration der Institution Schule. Filminterpretationen nach der dokumentarischen Methode. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 390 S., 49,95 €, auch als eBook. – Seite 21 (von 23) – Fragestellung: Im Unterschied zu theoretisch-konzeptionellen Deutungen der Schule wird von den dort handelnden Akteuren vermutet, dass sie über ein implizites Wissen verfügen, das dem tatsächlichen Geschehen besser entspricht und deutlicher zum Ausdruck bringen kann, was dort geschieht und in welcher Weise die Betroffenen in ihrem Verhalten von strukturellen Bedingungen beeinflusst sind. Dieses »implizite Wissen« soll herausgearbeitet werden. Methoden: Es wird im Sinne der »dokumentarischen Methode« unterstellt, dass sich solche Erfahrungen, Einstellungen und Haltungen in Interaktionsprozessen und in Materialien »dokumentieren«, die von den Handelnden produziert werden. Als Material werden ein Schülerfilm und ein Lehrerfilm verwendet. Die Verfahren der Analyse werden ausführlich beschrieben und dann in kleinen Schritten anhand der Filmsequenzen ausführlich nachvollziehbar gemacht. Ergebnisse: In mehrfach variierenden Interpretationen kommt die Autorin zu Befunden, die sie als Ausdruck einer »Paradoxie« interpretiert. Die in der Schule handelnden Personen seien in eine »kontrollierte Autonomie« eingebunden. Es werde von ihnen erwartet, dass sie sich »autonom« darstellen, sie seien aber in eben solchen Darstellungen beschränkt. In einem paradoxen Rollenspiel werde von den eine »unbezahlte zeremonielle Arbeit« und von den anderen »bezahlte zeremonielle Arbeit« verlangt. Dabei werde unterstellt, dass man sich in einer »idealen Sprechsituation« befinde. Diese Deutungen werden in Bezug gesetzt zu einer grundsätzlichen Kritik der Schule und der gängigen Konzepte, mit denen die Prozesse des Lernens und(!) des Lehrens gesteuert und kontrolliert werden sollen. Die damit verbundene Machtausübung und Disziplinierung werde durch Rituale und andere Mittel der »Dekoration« tabuisiert und verdrängt. Der daraus folgende »blinde Fleck« werde in theoretischen und konzeptionellen Überlegungen nicht mehr erkennbar. Einen möglichen Ausweg aus solchen Paradoxien sieht die Autorin in dem Versuch, der nachwachsenden Generation eine »naturwüchsige Teilhabe« an der Gesellschaft zu ermöglichen und den Heranwachsenden die ihrem Alter entsprechenden Kompetenzen zuzuerkennen. Zum anderen solle man auf jene Idealisierungen verzichten, die zu den genannten Paradoxien führen. – Kommer 2010: Sven Kommer: Kompetenter Medienumgang? Eine qualitative Untersuchung zum medialen Habitus und zur Medienkompetenz von SchülerInnen und Lehramtsstudierenden. Opladen: Budrich UniPress, 415 S., 42,00 €. Fragestellung: Mit welchen Einstellungen gehen Schülerinnen und Schüler sowie Lehramtsstudierende mit modernen Medien um und wie wirkt sich dies auf deren Nutzung innerhalb der Schule aus? Der Autor geht dabei von der (auf die Jahre 2004 und 2005 bezogenen) Einschätzung aus, dass die Schule zu wenig für eine »kompetente« Nutzung dieser Medien beiträgt. Zwischen der privaten Nutzung und der Bedeutung in der Schule bestehe bei beiden Gruppen eine erhebliche Differenz. Die sei angesichts der Bedeutung, die der Computer und das Internet in beruflichen und privaten Lebenswelten inzwischen habe, nicht akzeptabel. Methoden: Aus ausführlichen Interviews und der Beobachtung im Umgang mit dem Computer werden jeweils vier Muster herausgearbeitet. Die Analysen orientieren sich an Konzepten des Soziologen Bourdieu. Die Arbeit ist methodisch anspruchsvoll. Nach einer umfassend angelegten Information über den Stand der Diskussion und die ausgewählten Methoden und Instrumente wird der Gang der Analyse ausführlich dargelegt. Kompetenzlevel und Habitusformen werden an Dokumenten aus den Interviews ausführlich erläutert. Mehrfache Zusammenfassungen machen den Gang der Arbeit gut nachvollziehbar. – Seite 22 (von 23) – Ergebnisse: Bei den Schülerinnen und Schülern gibt es vier »Kompetenzlevel«: Es gibt »Verunsicherte«, »Delegierer«, »Pragmatiker« und »Bastler«. Keine dieser Gruppe weist einen wirklich kompetenten Umgang mit den Medien auf. Die einen lehnen die Nutzung eher emotional begründet ab, die anderen überlassen sich bei ersten Schwierigkeiten rasch anderen, die dritte Gruppe versteht einigermaßen, was unmittelbar nötig ist, und die letzte Gruppe geht eher spielerisch mit den Möglichkeiten um, ohne sich ein vertiefendes Expertenwissen anzueignen. Für die Studierenden werden vier »Habitusformen« erkannt: Es gibt »ambivalente Bürgerliche«, »überforderte Bürgerliche«, »hedonistische Pragmatiker« und »kompetent Medienaffine«. Die beiden ersten Gruppen können ihre in »bildungsbürgerlicher« Erziehung erworbenen kulturellen Ansprüche nicht mit ihrer Wahrnehmung bzw. ihrer eigenen, mit schlechtem Gewissen verknüpften Nutzung des Fernsehens in Einklang bringen. Die dritte Gruppe nutzt Medien vor allem zur Unterhaltung, ohne dies mit höheren Bildungs-Ansprüchen zu verbinden. Nur die vierte Gruppe lässt einen anspruchsvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Medien erkennen. Für die meisten Personen dieser Stichprobe ergibt sich aus diesen Konstellationen, dass sie eine mögliche Nutzung der Medien innerhalb der Schule und des Unterrichts nicht mit positiver Einschätzung sehen. Allenfalls könne man diese pragmatisch nutzen, um Informationen abzurufen oder auch nur sich unterhalten zu lassen. Eine kritische Auseinandersetzung wird eher abgelehnt, weil sie die private Art der Nutzung problematisieren könnte. Dass die meisten Befragten die Bedeutung der Medien in der Schule kritisch-distanziert betrachten, lässt also erkennen, dass Schule und Alltag verschiedene Lebenswelten mit differenten Maßstäben sind. Aus seinem Befund leitet der Autor ab, dass es in der Lehrerbildung nicht ausreicht, Kenntnisse im Sinne technischen Wissens und praktischer Fertigkeiten zu vermitteln. Es müsse vielmehr und darüber hinaus an den Einstellungen gearbeitet werden, um positive Haltungen zu entwickeln, die für einen intensiven und zugleich kritisch-reflektierten Umgang mit den neuen Medien erforderlich sind. Die Studie gibt viele Anstöße zum Nachdenken über die eigene »Haltung« im Umgang mit den Medien. Bos/Klieme/Köller 2010: Wilfried Bos, Eckhard Klieme, Olaf Köller (Hg.): Schulische Lerngelegenheiten und Kompetenzentwicklung. Münster: Waxmann, 338 S., 39,90 €. Fragestellung: Das thematische Spektrum dieser Festschrift für Jürgen Baumert ist sehr breit: Zu Ehren ihres Lehrers ziehen seine »Schülerinnen und Schüler« zu vier Komplexen Bilanz: Mit welchen Methoden gelingt es der empirischen Forschung, Dimensionen des Lehrens und Lernens zu erfassen, Prozesse aufzudecken und mögliche Folgerungen zu benennen. Betrachtet werden zunächst psychosoziale Erfahrungen in der Lerngruppe, Motivation und Interessen. Im zweiten Teil geht es um Leistungen, deren Förderung durch »Metakognition« und die Prädiktoren der Lesekompetenz. In vier Beiträgen werden Lehr-Lern-Prozesse analysiert und schließlich nehmen drei Beiträge »Bildungsverläufe in institutionellen Settings« in den Blick. Methoden: Erwartungsgemäß geht es vor allem um empirische Methoden im engeren Sinne, die sich an Konzepten der psychometrischen Forschung und Statistik orientieren. In den Beiträgen wird sorgfältig referiert, auf welchen Stand der Forschung und auf welche theoretischen Konzepte man sich bezieht, es wird daraus abgeleitet, welche Fragestellung untersucht werden soll, und es wird erläutert, wie die untersuchten Variablen definiert und entsprechende Daten erhoben werden. Die Befunde wer- – Seite 23 (von 23) – den differenziert dargelegt und in der Regel vorsichtig interpretiert. Wie es bei solcher Forschung gängig ist, werden Aufgaben für die weitere Forschung formuliert. Ergebnisse: Es geht in diesen Berichten nicht direkt um Probleme der Praxis oder gar deren Lösung. Demonstriert wird vielmehr, wie Persönlichkeitsmerkmale empirisch erfasst werden können und dass sich aus differenzierten Analysen der Daten durchaus nachvollziehbare und erklärungskräftige Deutungen entwickeln lassen. Die Befunde zeigen Dimensionen auf, die sich in der empirischen Forschung bewährt haben, weil sich Beobachtungen und Daten in solchen Modellen konsistent und plausibel darstellen lassen. So haben sich z.B. für die Analyse »guten Unterrichts« drei Dimensionen als bedeutsam durchgesetzt: kognitive Aktivierung, strukturierte Klassenführung und individuelle Lernbegleitung. Das ist vielleicht nicht alles, aber doch wohl wesentlich im Sinne einer auf Lernerfolg zielenden Lehre. Für eine erfolgreiche Lehrtätigkeit werden neben dem Fachwissen, einer »konstruktivistischen Überzeugung« und »Unterrichts-Enthusiasmus« zusätzlich für das emotionale Wohlbefinden der Lehrpersonen »selbstregulative Fähigkeiten« für wichtig gehalten. Wenn man auf dieser Grundlage nach dem »kompetenten Lehrer« sucht, können auf der Grundlage entsprechender Daten drei Typen identifiziert werden: Als »Problemlehrer« werden jene gesehen, die in allen vier Dimension gering ausgeprägte Merkmale erkennen lassen, als »Musterlehrer« werden jene bezeichnet, die in den drei inhaltlich bedeutsamen Dimensionen höhere Werte aufweisen, aber ihre Emotionen nicht gut organisieren können, während die »Selbstregulierer« in diesen Dimensionen nur nahe beim Durchschnitt liegen, sich aber gut »adaptiv selbstregulieren« können.