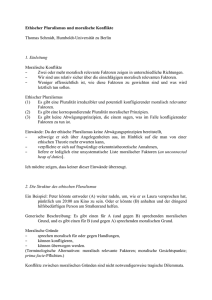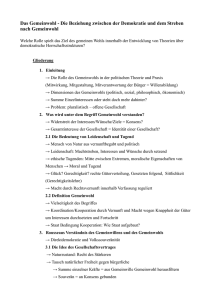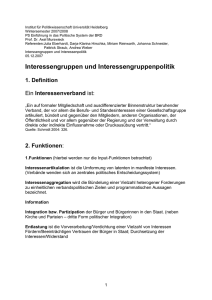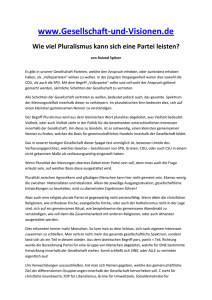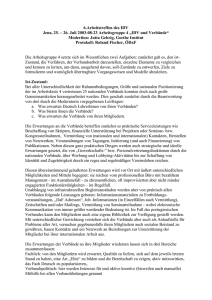Quellensammlung zu der Theorie des „Pluralismus“
Werbung
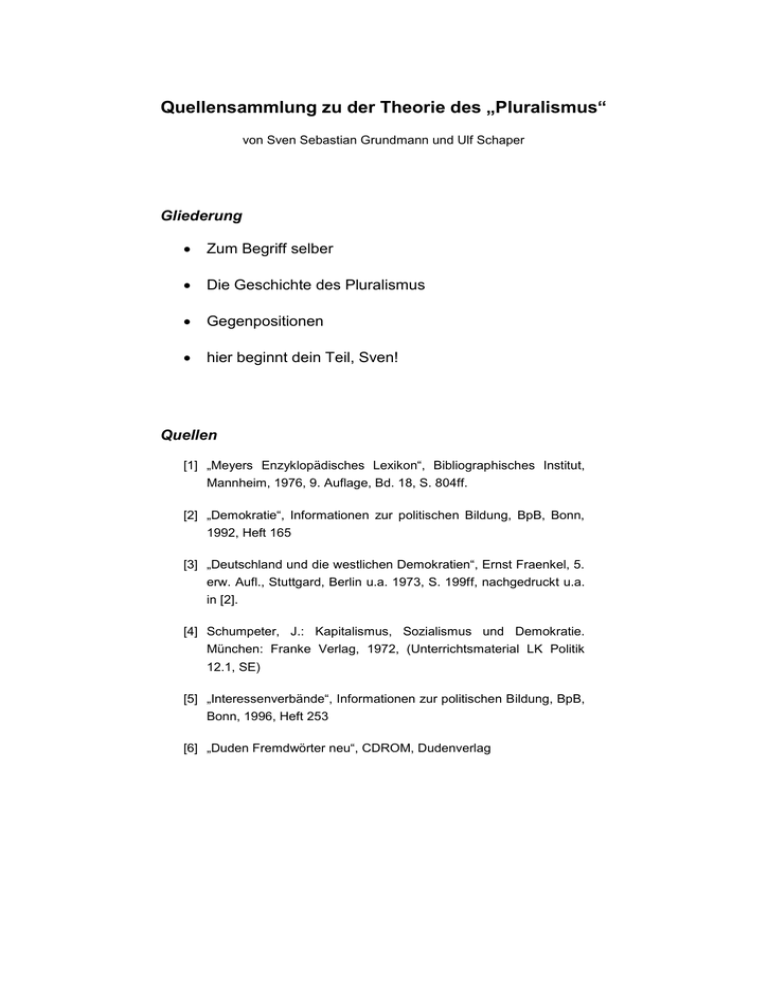
Quellensammlung zu der Theorie des „Pluralismus“ von Sven Sebastian Grundmann und Ulf Schaper Gliederung Zum Begriff selber Die Geschichte des Pluralismus Gegenpositionen hier beginnt dein Teil, Sven! Quellen [1] „Meyers Enzyklopädisches Lexikon“, Bibliographisches Institut, Mannheim, 1976, 9. Auflage, Bd. 18, S. 804ff. [2] „Demokratie“, Informationen zur politischen Bildung, BpB, Bonn, 1992, Heft 165 [3] „Deutschland und die westlichen Demokratien“, Ernst Fraenkel, 5. erw. Aufl., Stuttgard, Berlin u.a. 1973, S. 199ff, nachgedruckt u.a. in [2]. [4] Schumpeter, J.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. München: Franke Verlag, 1972, (Unterrichtsmaterial LK Politik 12.1, SE) [5] „Interessenverbände“, Informationen zur politischen Bildung, BpB, Bonn, 1996, Heft 253 [6] „Duden Fremdwörter neu“, CDROM, Dudenverlag Sven Grundmann, Ulf Schaper: Pluralismus 2/6 Zum Begriff selber Der Begriff „Pluralismus“ stammt aus dem lateinischen und kann mit „Vielfalt“ übersetzt werden [6]. Man kann ihn auf Entscheidungsprozesse beziehen: „Eine Beratungssituation, [in der] kein Argument von vornherein […] aus der Diskussion ausgeschaltet ist (Argumente-Pluralismus) [oder] die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises die Vertretung aller […] berührten Interessen sichert (InteressenPluralismus).“ [1] Oder aber, man bezieht ihn auf eine Gesellschaft: „Gesellschaften, in denen eine Vielzahl […] von vom Staat autonomen Interessengruppen […] um politischen und gesellschaftlichen Einfluss ringen.“ [1] Letzterer Definition schließt sich der Theoretiker Schumpeter an: „Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmung des Volkes erwerben.“ [4] Bei Ernst Fraenkel klingt dies wie folgt: „Der Pluralismus beruht vielmehr auf der Hypothese, in einer differenzierten Gesellschaft könne im Bereich der Politik das Gemeinwohl lediglich a posteriori als das Ergebnis eines delikaten Prozesses der divergierenden Ideen und Interessen der Gruppen und Parteien erreicht werden […].“ [3] Der Pluralismus kommt jedoch nicht ganz ohne Voraussetzungen aus. Ernst Fraenkel schreibt weiter: „Eine jede pluralistische Demokratie geht davon aus, dass, um funktionieren zu können, sie nicht nur Verfahrensvorschriften […], sondern auch einen allgemein anerkannten Wertekodex bedarf, der ein Minimum abstrakter regulativer Ideen generellen Charakters enthalten muss; sie glaubt jedoch nicht, dass in politisch relevanten Fällen diese regulativen Ideen ausreichend konkret und genügend substantiiert zu sein vermögen, um für die Lösung aktueller politischer Probleme unmittelbar verwendungsfähig zu sein.“ [3] „Die pluralistische Theorie des Gemeinwohls bestreitet keineswegs, dass es weite Gebiete des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens gibt, über deren Ordnung ein consensus omnium vorliegt; ja sie betont mit Nachdruck, dass auf die Dauer ein Staat nicht lebensfähig ist, in dem weder über ein Minimum fundamentaler, noch über zahlreiche detaillierte Fragen […] eine weitgehende Übereinstimmung besteht. Sie nimmt jedoch den Umstand, dass es weite Gebiete des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens gibt, über deren Regelung Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Gruppen existieren, nicht nur mit Gleichmut hin, sondern erachtet dies als unvermeidlich, ja geradezu als ein Indiz eines in Freiheit pulsierenden öffentlichen Lebens. Sie hält es weder für wünschenswert noch für Sven Grundmann, Ulf Schaper: Pluralismus 3/6 möglich, dass in einem freiheitlichen Staatswesen ein einheitlicher Gemeinwille besteht, der die divergierenden Gruppenwillen restlich in sich aufsaugt.“ [3] Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet uns folgendes: „[Die] wesentlichen Aussagen [der Pluralismustheorie kann] man wie folgt zusammenfassen […]: Die in einer Gesellschaft existierenden Interessengegensätze werden akzeptiert. Ein Gemeinwohl lässt sich nicht von vornherein (a priori) feststellen. Das Gemeinwohl ist das Resultat eines nachträglich (a posteriori) zustande gekommenen Kompromisses im politischen Konkurrenzkampf. Der Ausgleich der verschiedenen Interessen ist nur möglich bei einem Minimalkonses über bestimmte Spielregeln (Wertordnung). Das heißt, die politisch handelnden Gruppen müssen fähig und bereit zum Kompromiss sein. Wenn sie Politik als Weltanschauungskampf betreiben und den politischen Gegner als Feind betrachten und bekämpfen, ist einer pluralistischen politischen Ordnung die Grundlage entzogen. Die Rolle des Staates in einer pluralistischen Gesellschaft besteht im Wesentlichen darin, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass dieser Ausgleich stattfinden kann und die Spielregeln eingehalten werden.“ [2] „Ein pluralistisches Idealmodell müsste folgende fünf Minimalbedingungen erfüllen: Alle wesentlichen Interessen der Gesellschaft sind über Verbände und Parteien organisiert. Zwischen diesen verbändemäßig organisierten Machtgleichgewicht und Changegleichheit. Das System ist offen für sich neu artikulierende Interessen. Bei drohender einseitiger Interessendurchsetzung Gegenverbands- und -machtbildung. Es herrscht ein Wettbewerbs.“ [5] Grundkonsens über diese Interessen besteht Spielregeln herrscht ein Garantie der die des pluralistischen Die Geschichte des Pluralismus Der Begriff der Demokratie war nicht immer mit dem des Pluralismus verknüpft: „Auch frühe radikal-demokratische Demokratietheorien, wie die von Jean-Jacques Rousseau, wollten dem ganzheitlichen Volkswillen insgesamt zum Durchbruch Einzelinteressen von Verbänden und Parteien könnten hier nur stören.“ [5] verhelfen. Sven Grundmann, Ulf Schaper: Pluralismus 4/6 „Nur wenige frühe Gesellschaftswissenschaftlicher, wie Otto von Giercke, der von alten Genossenschaftsgedanken ausging, oder Lorenz von Stein, der das Interesse als den ‚Mittelpunkt der Lebenstätigkeit jedes Einzelnen’ und ‚daher als das Prinzip der Gesellschaft’ erkannte, waren im vorherigen Jahrhundert [Anm.: dem 19.] bereit, die Verbände als unverzichtbare Bestandteile von Gesellschaft und Politik anzuerkennen.“ [5] „Der große deutsche Soziologe Max Weber [hatte] 1919 auf dem ersten Deutschen Soziologentag gefordert [..], freiwillige Vereinigungen in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses zu stellen.“ [5] Auch muss man feststellen, dass der Pluralismus keinesfalls der Vorreiter auf seinem Gebiet war: „Der inhaltliche Kern der Konkurrenztheorie deckt sich weitgehend mit der neueren Pluralismustheorie.“ [2] Einer der Vorreiter des Pluralismus war der Brite Laski: „Der politische Begriff Pluralismus wurde zuerst – unter Bezugnahme auf die Lehre Otto von Gierkes von der realen Verbandspersönlichkeit – 1915 von Harold Laski verwendet, der den Staat als Verband unter Verbänden bezeichnete, der von seinen Angehörigen nicht mehr Loyalität verlangen dürfe als andere Verbände auch und diese durch Leistungen zu legitimieren habe. Damit lehnte er eine Souveränität des Staates und seinen mit dem Gewaltmonopol durchsetzbaren Gehorsamsanspruch ab und sah den Staat lediglich als Etappe zur eigenen Aufhebung auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft an.“ [1] Entsprechend aus einer anderen Quelle: „Da es in der Gesellschaft unterschiedliche Interessen gibt, werden diese Interessen durch Verbände organisiert, die miteinander und gegeneinander um die Durchsetzung ihrer Ziele ringen. Dabei geht Laski so weit, diese Gruppenautonomie nicht einzuschränken. Der Staat stehe nicht souverän über den Gruppen, sondern sei ein Verband unter anderen.“ [2] In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Pluralismus abgemildert: „Der Neopluralismus [soll] als regulative Idee das Gemeinwohl deutlich machen und die Grenzen pluralistischer Freiheiten kennzeichnen.“ [2] „Ernst Fraenkel, der den Begriff des ‚Neo-Pluralismus’ prägte, […] [bestritt] im Gegensatz zu Laski […] nicht den Souveränitätsanspruch des Staates, der für die Einhaltung der rechtsstaatlichen Verfahrensweisen und die Garantie Grundrechte zu sorgen habe.“ [1] der sozialen und politischen „[Die] Gründungsbedingungen und [die] innere Organisation [der Verbände] werden zwar rechtlich geregelt, aber nicht staatlich reglementiert. Der wichtigste Unterschied dieser neopluralistischen Demokratietheorie zur Pluralismuskonzeption Laskis liegt darin dass hier ein Gemeinwohl anerkannt wird. Das Gemeinwohl begrenzt als regulative Idee die pluralistische Freiheit. Das pluralistische Kräftespiel wird durch den neutralen Rechtsstaat geregelt.“ [2] Sven Grundmann, Ulf Schaper: Pluralismus 5/6 Gegenpositionen Man kann den Pluralismus an verschiedenen Punkten angreifen. Zuerst lässt sich Kritik am Pluralismus als Situation im Entscheidungsprozess üben: „Es sind z.B. möglich: Konflikte mit an partikularen Interessen ausgerichteten Koalitionsentscheidungen, allgemein akzeptierte Kompromisse sowie Orientierungen am größten empirischen gemeinsamen Nenner.“ [1] Dahinter verbergen sich die Zweifel an der pluralistischen Hypothese, aus vielen Einzelinteressen würde das Gemeinwohl hervorgehen. Auch der Pluralismus als Gesellschaftszusammensetzung (Interessengruppen) lässt sich kritisieren: „Die durch den Pluralismus entstandene Komplexität der gesellschaftlichen Lebensbereiche […] macht die gesellschaftlichen Strukturverhältnisse für den einzelnen unüberschaubar, fördert damit Organisierungs- und Bürokratisierungstendenzen […] und ersetzt damit die […] Herrschaft des Staates durch die Herrschaft verschiedener Gruppen“. [1] Hierhinter erschien 1955 das Werk „Herrschaft der Verbände?“ (von Theodor Eschenburg, [5]). Selbstverständlich hat auch Laskis radikale Pluralismustheorie viele Kritiker auf den Plan gerufen: „[Lasiks] Auffassung wurde in Deutschland vor allem von Carl Schmitt scharf als eine ‚Theorie der Auflösung oder Widerlegung des Staates’ an Hand des Beispiels der Weimarer Republik, in der soziale Machtkomplexe sich zur Befriedigung ihrer Interessen des Staates bemächtigt hätten, kritisiert; er propagierte gleichzeitig das Gegenbild des totalen Staates, der die Gruppeninteressen unter seine Herrschaft zwingen müsse.“ [1] „Gegen [Laskis] weitgehende, die Autorität des Staates in Frage stehenden Auffassung erhob sich Widerspruch, der am schärfsten und nachdrücklichsten von Carl Schmitt, einem der führenden Staatsrechtler der Weimarer Republik, formuliert wurde. Seine Forderung nach dem starken Staat, der das zerstörerische Wirken der Verbände und gesellschaftlichen Gruppen bändigt, erwies sich als sehr folgen- und einflussreich und wirkt als Pluralismuskritik bis heute nach.“ [2] „Noch in den sechziger Jahren hat […] der Staatsrechtler Wilhelm Wertenbruch typisch formuliert: ‚Da auch Verbände dem staatlichen Recht unverworfen und in den Staat eingeordnete Glieder sind, stehen sie nicht auf vergleichbarer Seins- und Wertstufe mit dem Staat und dürfen demgemäß nicht danach trachten, ihr partielles am staatlichen Gemeinwohl gemessen nur unvollkommenes Gemeinwohl an dessen Stelle zu setzen.’“ [5] Antipluralistische Gegenposition der Identitätstheoretiker: Sven Grundmann, Ulf Schaper: Pluralismus 6/6 „Vertreter einer antipluralistischen Staatsauffassung erkennen als demokratische Legitimierung nur Plebiszite […] an und lehnen folglich alle ‚intermediären Gewalten’ wie Parteien und Verbände ab. Sie gelten als Träger (eigensüchtiger) Sonderinteressen, deren Wirken die Einheit von Regierten und Regierenden zerstört.“ [2] Ernst Fraenkel erkennt selber die gesellschaftliche Ablehnung seiner Theorie: „Wer sich zu dem Grundsatz der Inkompatibilität von Gemeinnutz und Eigennutz bekennt, darf auch heute noch auf den Beifall seiner Zuhörer rechnen […].“ [3]