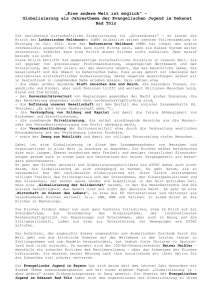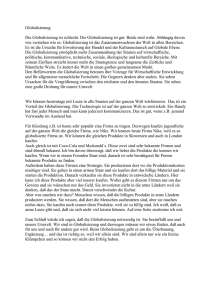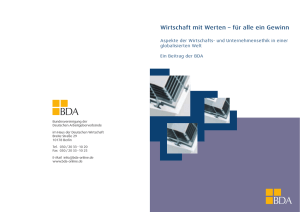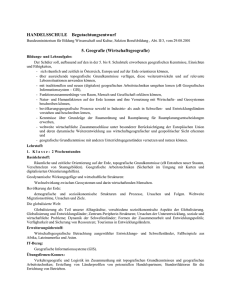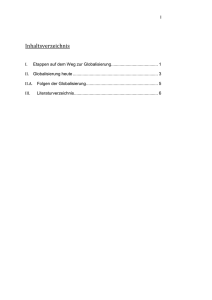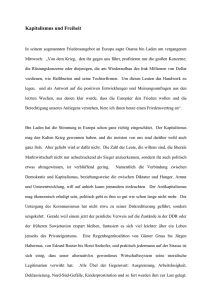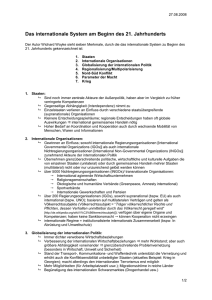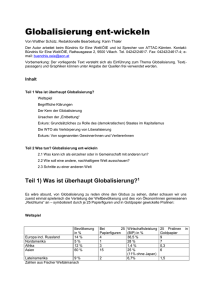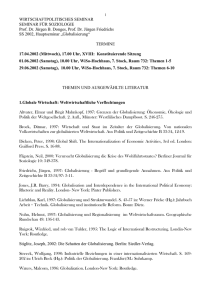Dossier zur Wirtschaft von BpB - Lise-Meitner
Werbung
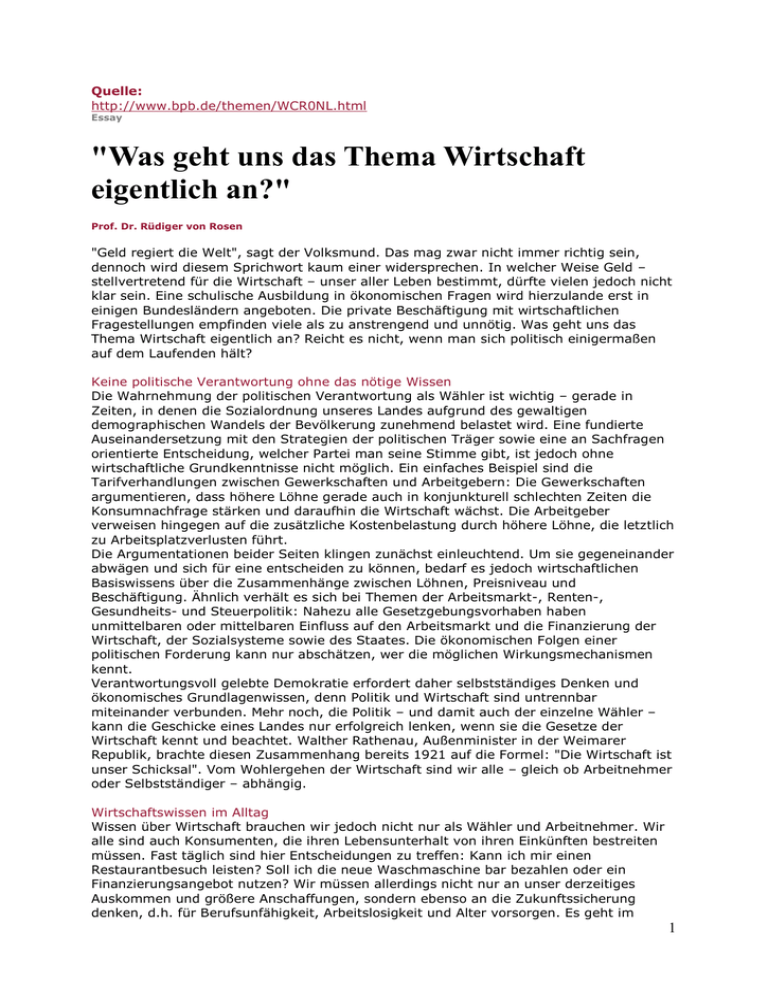
Quelle: http://www.bpb.de/themen/WCR0NL.html Essay "Was geht uns das Thema Wirtschaft eigentlich an?" Prof. Dr. Rüdiger von Rosen "Geld regiert die Welt", sagt der Volksmund. Das mag zwar nicht immer richtig sein, dennoch wird diesem Sprichwort kaum einer widersprechen. In welcher Weise Geld – stellvertretend für die Wirtschaft – unser aller Leben bestimmt, dürfte vielen jedoch nicht klar sein. Eine schulische Ausbildung in ökonomischen Fragen wird hierzulande erst in einigen Bundesländern angeboten. Die private Beschäftigung mit wirtschaftlichen Fragestellungen empfinden viele als zu anstrengend und unnötig. Was geht uns das Thema Wirtschaft eigentlich an? Reicht es nicht, wenn man sich politisch einigermaßen auf dem Laufenden hält? Keine politische Verantwortung ohne das nötige Wissen Die Wahrnehmung der politischen Verantwortung als Wähler ist wichtig – gerade in Zeiten, in denen die Sozialordnung unseres Landes aufgrund des gewaltigen demographischen Wandels der Bevölkerung zunehmend belastet wird. Eine fundierte Auseinandersetzung mit den Strategien der politischen Träger sowie eine an Sachfragen orientierte Entscheidung, welcher Partei man seine Stimme gibt, ist jedoch ohne wirtschaftliche Grundkenntnisse nicht möglich. Ein einfaches Beispiel sind die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern: Die Gewerkschaften argumentieren, dass höhere Löhne gerade auch in konjunkturell schlechten Zeiten die Konsumnachfrage stärken und daraufhin die Wirtschaft wächst. Die Arbeitgeber verweisen hingegen auf die zusätzliche Kostenbelastung durch höhere Löhne, die letztlich zu Arbeitsplatzverlusten führt. Die Argumentationen beider Seiten klingen zunächst einleuchtend. Um sie gegeneinander abwägen und sich für eine entscheiden zu können, bedarf es jedoch wirtschaftlichen Basiswissens über die Zusammenhänge zwischen Löhnen, Preisniveau und Beschäftigung. Ähnlich verhält es sich bei Themen der Arbeitsmarkt-, Renten-, Gesundheits- und Steuerpolitik: Nahezu alle Gesetzgebungsvorhaben haben unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die Finanzierung der Wirtschaft, der Sozialsysteme sowie des Staates. Die ökonomischen Folgen einer politischen Forderung kann nur abschätzen, wer die möglichen Wirkungsmechanismen kennt. Verantwortungsvoll gelebte Demokratie erfordert daher selbstständiges Denken und ökonomisches Grundlagenwissen, denn Politik und Wirtschaft sind untrennbar miteinander verbunden. Mehr noch, die Politik – und damit auch der einzelne Wähler – kann die Geschicke eines Landes nur erfolgreich lenken, wenn sie die Gesetze der Wirtschaft kennt und beachtet. Walther Rathenau, Außenminister in der Weimarer Republik, brachte diesen Zusammenhang bereits 1921 auf die Formel: "Die Wirtschaft ist unser Schicksal". Vom Wohlergehen der Wirtschaft sind wir alle – gleich ob Arbeitnehmer oder Selbstständiger – abhängig. Wirtschaftswissen im Alltag Wissen über Wirtschaft brauchen wir jedoch nicht nur als Wähler und Arbeitnehmer. Wir alle sind auch Konsumenten, die ihren Lebensunterhalt von ihren Einkünften bestreiten müssen. Fast täglich sind hier Entscheidungen zu treffen: Kann ich mir einen Restaurantbesuch leisten? Soll ich die neue Waschmaschine bar bezahlen oder ein Finanzierungsangebot nutzen? Wir müssen allerdings nicht nur an unser derzeitiges Auskommen und größere Anschaffungen, sondern ebenso an die Zukunftssicherung denken, d.h. für Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und Alter vorsorgen. Es geht im 1 täglichen Leben also weniger um gesamtwirtschaftliche Anliegen als um die ureigensten Interessen des Einzelnen. Die Zeiten, in denen ein geregeltes Arbeitsverhältnis automatisch eine lebenslange finanzielle Rundumversorgung durch Arbeitgeber und Staat bedeutete, gehören sicherlich der Vergangenheit an. Der Bürger muss mehr Eigenverantwortung tragen. Ökonomisches Wissen in Geld- und Finanzfragen ist daher unerlässlich, insbesondere für den Vermögensaufbau und die Alterssicherung. Gleichzeitig wird dem Subsidiaritätsprinzip wieder größere Bedeutung beigemessen: Danach ist der Bund für alles zuständig, was "kleinere" Gemeinschaften – also Länder, Kommunen und nicht zuletzt die Familien – nicht aus eigener Kraft sicherstellen können. Erst wenn auf unterer Ebene keine Möglichkeit mehr besteht, ein Problem zu lösen, ist die nächsthöhere Ebene gefordert. Früher – zu Zeiten der bäuerlichen Großfamilie – war dies relativ einfach zu bewerkstelligen. Die heutige Welt ist aber viel komplizierter. Wer Subsidiarität fordert, muss auch die Möglichkeiten hierzu schaffen. Wer z.B. die Mittel und Wege zur Absicherung des eigenen Alters nicht kennt, weil er sie nie gelernt hat, kann gar nicht die Verantwortung für seine Altersvorsorge übernehmen. Ökonomisches Wissen in Geld- und Finanzfragen ist daher unerlässlich, und es dient nicht den Interessen der Unternehmen, sondern jedes Einzelnen, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Fazit Das Thema Wirtschaft geht uns alle an – als Wähler, Arbeitnehmer, Konsumenten, Anleger. Nur wer die ökonomischen Grundlagen und Zusammenhänge kennt, kann fundiert urteilen und entsprechend (eigen-)verantwortlich handeln. Gleichzeitig ist auch der Staat aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Kenntnisse weithin zugänglich sind. Der Weg dahin führt über ein Schulfach Ökonomie, das in allgemeinbildenden Schulen mit ausreichender Stundenanzahl unterrichtet wird. Dass ökonomische Bildung zur Allgemeinbildung gehört, ist mittlerweile unstrittig. Allerdings hat sich die Einsicht, dass es eines eigenen Faches bedarf, noch nicht in allen Bundesländern durchgesetzt. Ökonomische Happen in anderen Fächern sind aber keine Lösung bei der Suche nach einer fundierten ökonomischen Bildung, sondern oftmals nicht mehr als ein Alibi. Gleichzeitig ist eine solche Bildung nur der Anfang. Denn auch wenn wir, in hoffentlich nicht allzuferner Zukunft, in Deutschland an allen allgemeinbildenden Schulen dieses Schulfach "Ökonomie" haben sollten, muss sich doch weiterhin jeder auch privat und lebenslang mit diesem Thema beschäftigen – zum eigenen Vorteil! 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/RLZHEK.html Essay "Wenn ich einmal reich wär" – Die Idee von Eigentum und Reichtum Marc Brost Jeder zweite Deutsche bangt, dass sein Einkommen sinkt und weniger zum Leben bleibt. Jeder Dritte sorgt sich, im Alter zu wenig Geld zu haben. Jeder Fünfte fürchtet, soviel Schulden zu machen, dass er sie nicht mehr zurückzahlen kann. Die Angst lähmt das Land. Mit der Reform der Sozialsysteme, etwa mit der Einführung von Hartz IV, hat der Staat seine Unterstützung so weit wie nie reduziert – und verlangt von seinen Bürgern nun soviel Engagement wie nie. Es ist der Abschied von einem System, das jedem von uns die Sicherheit gab, der eigene Lebensstandard bleibe auf jeden Fall erhalten, ganz gleich, wie lange man auch arbeitslos sei. Nun muss man am besten selbst finanziell vorsorgen. Und plötzlich merken die Menschen, dass sie das nicht können. Warum? Weil die traditionelle Ökonomie von einem falschen Menschenbild ausgeht. Es war der Brite Adam Smith, der mit seinem 1776 veröffentlichen Buch "Wohlstand der Nationen" dieses traditionelle Bild von Mensch und Wirtschaft geprägt hat. So basieren heute alle ökonomischen Gesetze auf der Annahme, dass wir uns wie ein Homo 2 oeconomicus verhalten: Unser Ziel ist es demnach, von allem mehr zu haben – mehr Profit, mehr Geld, mehr Macht. Das Streben nach Reichtum ist das Grundmotiv des wirtschaftlichen Handelns. Der Homo oeconomicus will reich sein, damit schafft er Wachstum, und dieses Wachstum schafft gesellschaftlichen Wohlstand, von dem wiederum alle profitieren. Damit das gelingt, so Smith, sind wir in der Lage, ganz nüchtern und kühl unsere jeweilige Situation zu analysieren. Wir bewerten alle Optionen und entscheiden uns für die beste. Kurz: Wir handeln rational. Aber tun wir das wirklich? So wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir sie empfinden und einordnen, folgen wir eben nicht den rationalen Verhaltensmustern der traditionellen Ökonomie. Statt dessen orientieren wir uns an etwas, dass so ganz und gar nicht dem Bild des Homo oeconomicus entspricht: An Werten etwa. Oder an sozialen Normen. Vor allem aber lassen wir uns sehr leicht täuschen. Deshalb scheitern wir auch immer wieder beim Umgang mit Geld. Und deshalb fühlen wir uns überfordert, wenn der Staat auf einmal finanzielle Eigenverantwortung fordert, wo er doch immer so schön für uns gesorgt hat. Experimentelle Ökonomen, wie der Schweizer Ernst Fehr in Zürich, haben herausgefunden, dass Ungeduld und Willensschwäche unser Handeln beeinflussen. Selbst wenn die Menschen die besten Mittel kennen, sind sie manchmal einfach nicht in der Lage, diese Mittel auch anzuwenden. Ein Beispiel: Zwei Drittel der US-Bürger glauben, dass sie fürs Alter zu wenig vorsorgen. Mehr als ein Drittel will daher mehr sparen. Fragt man jedoch einige Monate später nach, hat kaum jemand mehr Geld auf die Seite gelegt. Wir sind nicht die kühlen Kalkulierer, für die wir uns selbst gerne halten. Dazu schauen wir viel zu gern auf andere: Wie sie leben. Wie sie sich kleiden. Und – vor allem – wie viel Geld sie haben. So passiert es zum Beispiel, dass wir eine Lohnerhöhung bekommen, sagen wir 500 Euro, und uns dennoch ärgern. Eigentlich ist es genau die Summe, die wir haben wollten, eigentlich ist es genau der Betrag, von dem wir gestern noch sagten, es wäre riesig, wenn uns der Chef soviel genehmigen würde. Eigentlich ist es eine Lohnerhöhung, die uns zufrieden stellt. Bis wir erfahren, dass unser Kollege im Büro nebenan 600 Euro bekommen hat. Dann sind wir neidisch. Und unzufrieden. Wer einen Nachbar hat, der gerade im Lotto eine halbe Million gewann, wird selbst anfangen zu tippen – ganz gleich, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, ebenfalls soviel Geld zu gewinnen. Wer einen Arbeitskollegen kennt, der mit sibirischen Ölaktien binnen sechs Monaten aus 10.000 Euro das Fünffache machte und der deshalb noch einmal investiert, wird ebenfalls diese Aktien kaufen – und sich später, wenn von den eigenen 10.000 Euro nur noch 500 übrig sind, grün und blau ärgern. Ungeduld und Willensschwäche verführen uns zu Fehlern. Durch die Reformen am Arbeitsmarkt werden diese Fehler sofort bestraft. Nicht nur, dass das neue Arbeitslosengeld II so niedrig ist, dass jeder Einzelne selbst sehen muss, wo er finanziell bleibt. Auch mit den neuen Unternehmensgründungen lässt sich die Massenarbeitslosigkeit nur dann überwinden, wenn die Menschen unternehmerischer denken – und handeln. Die staatliche Förderung hat zwar für einen wahren Gründerboom bei Ich-AG's gesorgt. Aber nur wenn diese neuen Selbstständigen sich nicht von ihrer Gier und ihrer Willensschwäche leiten lassen, werden sie am Markt langfristig überleben. Damit der Traum vom Reichtum doch noch Wirklichkeit wird, müssen alle umdenken. Die Politik muss erkennen, dass finanzielle Eigenverantwortung nur funktioniert, wenn die Bürger finanziell gebildet sind. Etwa durch ein Schulfach Wirtschaft. Und durch einen offenen Umgang mit dem Thema Geld in der Gesellschaft. Und jeder Einzelne? Wenn die Menschen sich nur endlich bewusst würden, dass Neid und Gier sie zu Fehlern verleiten, wäre schon viel gewonnen. Es gibt keinen Fehler, den man nicht zweimal machen kann. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/6XHIBQ.html 3 Von der lokalen zur globalen Ökonomie Die Rindfleischsuppe von Liebig machte schon zu Kaisers Zeiten weltweit die Runde Hermannus Pfeiffer "Globalisierung ist sicher das am meisten gebrauchte - missbrauchte - und am seltensten definierte, wahrscheinlich missverständlichste, nebulöseste und politisch wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort der letzten, aber auch der kommenden Jahre." Prof. Dr. Ulrich Beck, Soziologe Reisen wir in eine ferne Vergangenheit zurück, lassen "Wirtschaftswunder" und NaziDiktatur einfach hinter uns, ziehen an Weltwirtschaftskrise und dem Großen Krieg 19141918 vorbei, an dem Untergang der Titanic und an Reichskanzler Otto von Bismarck, um an der offiziellen Eröffnungsfeier der deutschen Moderne zu stoppen. Wir schreiben nun das Jahr 1871. Im majestätischen Spiegelsaal von Versailles wird der greise Preußenkönig Wilhelm I. am 18. Januar zum deutschen Kaiser ausgerufen. Die pompöse Kaiserkrönung beendet die deutsche Kleinstaaterei und feuert nach einem halben Jahrhundert politischer Streitereien endlich den Startschuss für eine vereinigte deutsche Volkswirtschaft ab. Lange Zeit mussten Pfeffersäcke von Hamburg nach München bis zu einem Dutzend Zollschranken überwinden. Im Pferdekarren, auf schlechten Wegen und per Lastkahn über enge Flüsse ging die lange und beschwerliche Reise unter anderem durch das Herzogtum Lauenburg, Königreich Hannover, Herzogtum Braunschweig, Kurfürstentum Hessen-Kassel oder die thüringischen Staaten bis ins Königreich Bayern. Nur wenige Kaufleute hatten Lust auf solche Strapazen, zumal sich der Gewinn aufgrund der hohen Zollgebühren in Grenzen hielt. Daher blieb das wirtschaftliche Leben in Deutschland - wie beispielsweise auch in Japan jahrhundertelang vor allem auf die lokale Ökonomie beschränkt, die Bauernfamilie produzierte für sich, nur ein kleiner Teil wurde in der nahen Kleinstadt verkauft. Dort arbeiteten auch Handwerker, Gewerbetreibende und Viehhändler, deren geschäftlicher Horizont meistens nur so weit wie ein halber Tagesmarsch reichte, damit sie Abends wieder rechtzeitig zu Hause waren. Diese Enge konnte selbst der Deutschen Zollverein 1834 nicht aufbrechen, wie der Volksmund wusste: "Bleibe im Lande und nähre dich redlich." Bewegung in die, im internationalen Vergleich, rückständige Wirtschaft brachte nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 die Reichsgründung in Versailles bei Paris. Aus kleinen Fabriken wachsen nun große Aktiengesellschaften, aus provinziellen Privatbankiers entstehen Deutsche, Dresdner und Commerzbank, und neue Technologien revolutionieren die Fabriken. Deutschland wächst endlich zu einer Volkswirtschaft heran, wie sie in England, dem führenden Industriestaat, schon lange existiert. Exportweltmeister Reisen wir an dieser Stelle heim in unsere Gegenwart. Unterbrochen von der Ära der Weltkriege und dem westdeutschen "Wirtschaftswunder" macht seit den 90er Jahren das Schlagwort Globalisierung die Runde. Autos, Chemieprodukte, Werkzeugmaschinen und andere Waren und Dienstleistungen im Wert von 733,5 Milliarden Euro exportierte Deutschland alleine im Jahr 2004 ins Ausland –Exportweltmeister. Umgekehrt kommen zu uns T-Shirts aus China, Computersoftware aus den USA, Containerschiffe aus Südkorea und Apfelsinen aus Israel. Konzerne investieren zudem weltweit. So beteiligte sich die Deutsche Bank 2005 an Finanzfirmen in China und Indien und Siemens beschäftigt heute über 250.000 Menschen im Ausland, in Deutschland sind es nur rund 150.000. "Der Standort Deutschland ist nicht abgeschrieben, aber in einem globalen Unternehmen muss die Wertschöpfung global verteilt werden", verteidigt SiemensAufsichtsrat Heinrich von Pierer den Abschied von der Volkswirtschaft. Doch auch wenn alle ihn verwenden: Der Begriff Globalisierung bleibt schwammig. Klar ist nur, dass er weniger Neuartiges beschreibt, als es zunächst scheint. Denken wir an 4 Justus Liebig. Wen? Justus Liebig! Er dürfte manchem aus dem Filmklassiker "Feuerzangenbowle" bekannt sein, anderen als weltberühmter Wissenschaftler. Der Darmstädter revolutionierte als Chemiker die Landwirtschaft und erfand tatsächlich die gleichnamige Trockensuppe, die heute immer noch ein Markenartikel ist. Vor 150 Jahren benötigte er drei Kilogramm Fleisch, um einen einzigen Liter Brühe herzustellen - und das war entschieden zu teuer. Liebig erfuhr in Gießen, dass im fernen Peru die Rinder geschlachtet wurden, nur um die Häute zu gerben - das Fleisch landete auf dem Müll. Seit 1862 ließ der professorale Unternehmer daher seine Suppenwürfel in Peru und Uruguay, später auch in Deutsch-Südwestafrika produzieren. Von dort verschiffte er seine Suppenpaste nach Europa und in die Kolonien. Dynamischer Welthandel Liebigs Geschichte klingt sehr modern, und sie ist sehr modern. Denn bereits zu Kaisers Zeiten genossen Außenhandel und Auslandsinvestitionen eine überragende volkswirtschaftliche Bedeutung. So wurde mit dem neuen Reich auch die Deutsche Bank gegründet, um das deutsche Exportgeschäft anzukurbeln. Ohne Kredit lief schon damals in Wirtschaft und Handel wenig. In den führenden Industriestaaten stieg der Außenhandel bis auf ein Drittel des Bruttosozialproduktes an, und die Hafenstadt Hamburg unterhält Konsulate in 279 Staaten; in der maritimen Logistikindustrie sprach man spätestens zur Jahrhundertwende 1900 allgemein vom "Welthandel". Also war die Dynamik bereits damals, in der "guten, alten Zeit", atemberaubend. Im jungen Kaiserreich werden Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, werden Dorf oder Kleinstadt in der Altmark und Ostpreußen verlassen, um vor Armut und Not nach Frankfurt, Berlin oder München zu fliehen oder um von Bremen und Hamburg nach Amerika zu segeln. Die revolutionären Technologien Chemie und Elektro werden ganze Berufszweige vernichten. Ökonomen und Wissenschaftler sorgen sich um die Auswirkungen des Weltmarktes und der "Gründerkrach" vernichtet tausende Firmen. Telegrafie, Überseekabel und neue Verkehrssysteme beschleunigen Informationen und Wirtschaftsabläufe in rasende Geschwindigkeitsbereiche, Informationen, die früher mehrere Wochen brauchten, branden nun in Stunden von Kontinent zu Kontinent, von New York nach London und Paris. Die Herausforderungen von damals sind die Herausforderungen von heute, nennen wir sie Globalisierung. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/48YV3C.html Wirtschaftssysteme, die die Welt beweg(t)en Jörg Roesler Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nach der weltweiten Durchsetzung der von ihren Gegnern als Neoliberalismus bezeichneten Angebotsökonomie ist es kaum noch vorstellbar, dass im vorangegangenen Jahrhundert gleich drei Wirtschaftssysteme um die Gunst der Menschen konkurrierten: Der ökonomische Liberalismus, die staatliche Zentralplanwirtschaft und der Keynesianismus. Ursache der Vielfalt war nicht der Gedanke, verschiedene Systeme auszuprobieren und danach die beste Art des Wirtschaftens auszuwählen. Ursache war vielmehr die Enttäuschung über das jeweils herrschende Wirtschaftssystem, das nicht halten konnte, was es versprochen hatte. Die klassische Ökonomie Dabei war man Anfang des 20. Jahrhunderts ganz sicher, mit dem ökonomischen Liberalismus ein Wirtschaftssystem gefunden zu haben, das "immerwährende Prosperität" garantiert. Der Begründer der "klassischen Ökonomie", Adam Smith, hatte Ende des 18. Jahrhunderts die Vorstellungen von einer freien Gesellschaft aus der Politik auf die Ökonomie übertragen. Er vertrat die Idee, dass eine freie Marktwirtschaft, in der 5 nur die Gesetze von Angebot und Nachfrage gelten und der Staat direkte Eingriffe unterlässt, den Wohlstand aller Menschen vermehrt. Das 19. Jahrhundert brachte den Siegeszug des ökonomischen Liberalismus in Europa und Amerika. Doch die Weltwirtschaftskrise 1929-33 beendete die "Grand Prosperity" nicht nur in den USA. Seit dem "Schwarzen Freitag" an der New Yorker Börse sank Jahr für Jahr die Nachfrage. Je weniger abgesetzt werden konnte, desto weniger wurde auch produziert. Die Massenarbeitslosigkeit erreichte bis dahin unvorstellbare Ausmaße. Wie Hohn klang nun in den Ohren der ratlosen Wirtschaftspolitiker der 100 Jahre zuvor vom französischen Ökonomen Jean Baptiste Say, einem Verbreiter der klassischen Lehre, geprägte Satz, dass sich jedes Warenangebot seine Nachfrage auf dem Markt schaffe. Wirtschaftliche Gleichgewichtsstörungen, d.h. Wirtschaftskrisen, konnten demnach, wenn überhaupt, nur teil- bzw. zeitweise auftreten. Mit Keynes aus der Krise Die Weltwirtschaftskrise machte es jedoch deutlich: Nicht um das Angebot, sondern um die Nachfrage drehte sich die Wirtschaft. Auf der Suche nach einem Wirtschaftstheoretiker, der ihm einen Ausweg aus der Krise zeigen könnte, stieß der amerikanische Präsident Roosevelt auf den Briten John Maynard Keynes. Dieser hatte die Weltwirtschaftskrise sorgfältig analysiert. Er kam zu dem Schluss, dass die Selbstheilkräfte des Marktes offensichtlich nicht ausreichten, um das wirtschaftliche Gleichgewicht und damit die Konjunktur wieder herzustellen. Der Staat müsse eingreifen und durch Staatsaufträge und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zusätzliche Nachfrage nach Investitions- und Verbrauchsgütern schaffen. Die Mittel für eine volkswirtschaftliche Steuerung des Konjunkturverlaufs müsse sich der Staat durch Umverteilung von den Begüterten zugunsten der von Krisen am ehesten betroffenen abhängigen Beschäftigten beschaffen. Zum populärsten Instrument des Keynesianismus wurde das "Deficit Spending". Demnach kann sich der Staat, wenn eine Wirtschaftskrise droht, verschulden, sofern er sich in der darauf folgenden Wachstumsphase das geborgte Geld dank der dann wieder reichlich fließenden Abgaben zurückholt. Auch Zusatzsteuern, mit denen in einer Boomphase eine "Überhitzung" der Konjunktur verhindert werden soll, könnten die Kassen dann wieder füllen. Dem Keynesianismus, dem Roosevelt in den 30er Jahren sein Antikrisenprogramm "New Deal" zugrunde legte, folgten nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Wirtschaftspolitiker in Europa, Lateinamerika, Australien und Ostasien. Das Gegenmodell Allerdings war der Keynesianismus nicht das einzige Wirtschaftssystem, das als Antwort auf die Misere des ökonomischen Liberalismus in der Welt Verbreitung fand. In der Sowjetunion wurde unter Stalins Herrschaft seit Ende der 1920er Jahre die staatssozialistische Planwirtschaft entwickelt. Auch sie misstraute dem Markt, schaffte ihn aber im Unterschied zum Keynesianismus mit Ausnahme einer freien Arbeitsplatz- und Konsumgüterwahl innerhalb eng gesetzter Grenzen ganz ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Zentralplanwirtschaft sowjetischen Typs in Osteuropa und auf dem ostasiatischen Festland (Volksrepublik China) durchgesetzt. Nach etwa drei Jahrzehnten traten die Schwächen der Zentralplanwirtschaft bezüglich Wachstum und Modernisierung der Anlagen offen zu Tage. Fast zur gleichen Zeit, in den 1970er Jahren, erreichte auch die zunächst so erfolgreiche keynesianische Steuerung des Konjunkturzyklus ihre Grenzen. Statt Beschäftigungssicherung und konjunkturellem Aufschwung traten immer häufiger Inflation und Stagnation des Wachstums, die so genannte "Stagflation" auf. Der Monetarismus Die "Stagflation" diskreditierte die keynesianische Nachfrageökonomie bald so sehr, dass der zwischenzeitlich insbesondere vom US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman modernisierte, als Monetarismus bezeichnete ökonomische Liberalismus wieder attraktiv wurde. Der amerikanische Präsident Reagan und die britische Premierministerin Thatcher machten ihn in den 80er Jahren zur Grundlage einer Wirtschaftspolitik, in der der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der Rückbau der sozialen 6 Sicherungssysteme Merkmale der wiederbelebten Angebotsökonomie waren. In den 1980er Jahren scheiterten auch die Versuche, die Zentralplanwirtschaft zu reformieren. Danach wurde zu Beginn der 1990er Jahre der von seinen Gegnern als Neoliberalismus bezeichnete Monetarismus nach sechs Jahrzehnten der Dominanz der staatsinterventionistischen Wirtschaftssysteme Keynesianismus und Zentralplanwirtschaft erneut zum weltweit unangefochten herrschenden Wirtschaftssystem. Auf wie lange? Eine Antwort ist zur Zeit noch nicht möglich, doch ist es aus Sicht der historischen Erfahrung wenig wahrscheinlich, dass mit dem 21. Jahrhundert das Ende der Geschichte der Wirtschaftssysteme gekommen ist. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass seit etwa zwei Jahren in Deutschland – zumindest in den Medien – in Zusammenhang mit Zweifeln an der Wirksamkeit der Agenda 2010 und der Steuerreform wieder auf den Keynesianismus Bezug genommen wird. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/0HLPUW.html Verdienen Führungskräfte zu viel? Managervergütungen zwischen Neid, Leistung und Verteilungsgerechtigkeit Dr. Ulrich Thielemann Seit dem Ende der 90er Jahre, als die Finanzgemeinde der Welt Glauben machen wollte, die Bäume würden in den Himmel wachsen, sind die Einkommen der Top-Manager förmlich explodiert. Dies zeigt ein Blick auf die Entwicklung der "CEO-to-Worker-payRatio", die das Verhältnis zwischen der Vergütung der obersten Geschäftsleitung und dem durchschnittlichen Gehalt der Angestellten benennt. Lag diese Rate in den USA und in Deutschland in den 60er Jahren bis Mitte der 90er Jahre noch bei etwa 30-40, so verdienten die amerikanischen Geschäftsführer im Jahre 2000, also zur Hochzeit der New Economy, fünfhunderteinunddreißig Mal mehr als ein gewöhnlicher Angestellter; 2003 lag der Faktor bei 301. Ähnlich verhält es sich bei der Deutschen Bank, wenn auch hier der Anstieg nicht ganz so deutlich ausfiel (31 im Jahre 1992, 286 im Jahre 2000, 240 im Jahre 2003). Dass es sich hierbei durchaus um einen breiten Trend auch in der deutschen Führungslandschaft handelt, zeigt sich etwa darin, dass die Bezüge der Vorstände der 30 DAX-Unternehmen zwischen 1997 und 2003 um mehr als 80 Prozent stiegen, die der Angestellten, soweit sie ihre Anstellung behielten, hingegen um lediglich 15 Prozent. Eine Frage des Neides? Die wachsende Einkommensschere innerhalb der Unternehmen wird gerne mit zwei Argumenten zu rechtfertigen versucht: Der verbreitete Unmut in der Bevölkerung über die hohen Vergütungen der Manager sei letztlich bloß Ausdruck von Neid. Und überdies entspreche die Vergütung der Leistung, die die Manager erbringen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass diese Rechtfertigungen einer kritischen Betrachtung nicht standhalten. Das Neidargument setzt eine Art Dschungeltheorie der Einkommenserzielung voraus. Diese nimmt an, Einkommen würden außersozial, im einsamen Kampf des Einzelnen im Dschungel des anonymen Marktes, erwirtschaftet. Wer leistungsfähig und fleißig ist, der kommt mit einer "fetten Beute" (sprich: mit einem hohen Einkommen) aus dem Dschungel in die Gesellschaft zurück, wer weniger leistungsfähig oder fauler ist, bringt halt weniger mit nach Hause. In die Gesellschaft zurückgekehrt, erwartet die Erfolgreichen jedoch häufig nicht Anerkennung für die von ihnen geschaffenen "Werte". Vielmehr sehen sie sich mit dem Neid der Leistungsschwachen oder Faulen konfrontiert, und sie werden nicht belobigt, sondern zuweilen ganz im Gegenteil gescholten: "Deutschland ist das einzige Land, wo diejenigen, die erfolgreich sind und Werte schaffen, deswegen vor Gericht stehen", 7 beklagte Josef Ackermann, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, bei seinem Auftritt im Mannesmann-Prozess, wo er wegen der Gewährung einer Abfindung an Klaus Esser in Höhe von 30 Millionen Euro der Beihilfe zur Untreue angeklagt war. Die Dschungeltheorie ignoriert den schlichten Umstand, dass Einkommen stets arbeitsteilig erwirtschaftet werden und Anteile an einem Sozialprodukt bilden – volkswirtschaftlich und betrieblich gesehen. Sie übersieht, dass wir, um im Bild zu bleiben, im Dschungel unsere "Beute" mit und gegen eben dieselben Personen erwirtschaften, die wir auch in der Gesellschaft sonst antreffen, also Mitarbeitende, Kapitalgeber, Kunden und auch Konkurrenten, die wir aus dem Rennen geworfen haben. Sie alle zusammen ermöglichen dem einzelnen die Erzielung eines Einkommens – auch dem Vorstandschef. Die hohen und in den letzten Jahren exorbitant gestiegenen Managervergütungen stellen also nicht bloß ein Problem ausgebliebener – und verfehlter – Solidarität dar, sondern werfen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auf, nicht bloß der "Umverteilung": Wie ist die gemeinsame Wertschöpfung auf all diejenigen, die zu ihr beigetragen haben, in fairer Weise zu verteilen? Untiefen des Leistungsbegriffs Hier kommt der Leistungsbegriff ins Spiel. Jeder nach seinen Leistungen – das ist Verteilungsgerechtigkeit, Fairness. Jeder nach seinen Bedürfnissen – das ist Solidarität, "Umverteilung". Aber was ist Leistung? Meinen wir den Einsatz, die Anstrengung, die Fähigkeiten des Einzelnen? Oder meinen wir den Erfolg, das Ergebnis, die Wertschöpfung? Meinen wir den Input oder den Output? In einer komplex-arbeitsteiligen Marktwirtschaft besteht hier keine eindeutige Beziehung. Darum charakterisierte der Ökonom Friedrich August von Hayek den Markt als eine "Mischung von Glücks- und Geschicklichkeitsspiel". Die Glücks- oder Zufallskomponente wird schlagend deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Einkommenssprung der Manager Ende der 90er Jahre fast vollständig auf dem "irrationalen Überschwang" (US-Notenbankchef Alan Greenspan) der Börsen beruhte. Und an die Spitze etwa von Mannesmann, deren Börsenwert im Gleichlauf mit den Konkurrenzunternehmen nach oben schnellte und mit ihm die Managervergütung, hätte man, so prononciert der Hamburger Wirtschaftsrechtler Michael Adams, "auch einen Gorilla setzen können". Den Boom haben die Manager zwar mit angetrieben. Allerdings entsprach er kaum einer nennenswerten realen Wertschöpfung, sondern erwies sich als Blase – eine hoch lukrative Blase für gewisse Kreise. Einige Manager haben durch Einlösen ihrer Aktienoptionen kurz vor dem Niedergang der Börsen still und heimlich Milliarden (kein Druckfehler!) eingestrichen. Ein schöner Erfolg – für die einen. Und ein klarer Verlust für die Anleger, die ihnen die Aktien dann noch abgekauft haben. Ethische Grenzen des Einkommens Schon weil jedem Einkommen ein Moment des Zufalls anhaftet, sind allzu weiten Einkommensdisparitäten deutliche ethische Grenzen gesetzt. Doch selbst wenn wir zwischen Input-Leistung und Output-Leistung einen Zusammenhang annehmen, bleibt klärungsbedürftig, welcher der beiden Seiten wir welches Gewicht einräumen. Mit Blick auf die Input-Leistung dürfte klar sein, dass niemand ein paar hundert Mal mehr an Energie, Fähigkeiten, Einsatz "leisten" kann als ein anderer. Doch was kann der Einzelne mit seinem mehr oder minder bescheidenen Einsatz bewirken (OutputLeistung)? Einige Manager, wie etwa der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Siemens, Heinrich von Pierer, scheinen anzunehmen, dass letztlich sie es sind, die die Wertschöpfung erwirtschaftet haben. Die Einkommen der Siemens-Mitarbeiter, aus dem diese schließlich "fast drei Milliarden Euro an Lohn- und Einkommenssteuern" zahlten, fallen nicht etwa "vom Himmel", so Pierer, "sondern unsere Mitarbeiter bekommen es vorher von uns." "Wir", das sind Pierer und die kleine Riege von Top-Managern aus seinem Umkreis. Diese haben die milliardenschwere Wertschöpfung der Siemens AG offenbar bewirkt. Sie sind es, die "Werte schaffen". Die Mitarbeiter sind dabei bestenfalls Komparsen, schlechtestenfalls eher lästige Kostenfaktoren, die "unseren" Erfolg nur schmälern. 8 Integrität – und Millionenvergütungen? Es ist die im Anspruch, Millionen im faktischen und moralischen Sinne zu verdienen zum Ausdruck kommende Selbstüberschätzung, die den Ruf der Manager in den letzten Jahren deutlich beschädigt hat. Vorstandsvergütungen mehrere hundert Mal so hoch wie das Gehalt der übrigen Belegschaft passen nicht zum Bild eines integren Managers, dem es letztlich nicht um die Maximierung des Shareholder Value und erst recht nicht um die Maximierung seines eigenen Kontostands geht, sondern um eine ganzheitlich gute Entwicklung des Unternehmens, dem er vorsteht. Es dürfte kein Zufall sein, dass diejenigen Manager, die für sich Millionengagen reklamieren – und dabei erfolgreich sind –, zugleich auch Meister im Entlassen, Outsourcen und im nominellen Verlagern von Gewinnen in Steueroasen sind. Es ist zu hoffen, dass diese Art der "Leistung", die im Wesentlichen darin besteht, den Aufsichtsrat zum eigenen Freundeskreis zu machen, nicht mehr als eine Leistung zählt, die es verdient, honoriert zu werden. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/0B7VJ7.html Deutschland - (K)ein Freizeitvolk Markus Sievers "Samstags gehört der Vati mir" – mit dieser Parole feierte die Metallergewerkschaft in den 50er Jahren Erfolge. Mehr Freizeit forderte sie für ihre Leute, mehr Freiraum für die Familie. Möglich machte dies die steigende Produktivität der Arbeit. Die wachsende Effizienz steigerte nicht nur die Kaufkraft, sondern erhöhte auch die Zahl der Stunden, über die die Menschen selbst verfügen und bestimmen konnten. Zehn Jahre später sorgte die 40-Stunden-Woche dafür, dass der Chef am ganzen Wochenende auf seinen Angestellten verzichten musste. Gleichzeitig wuchsen die Urlaubsansprüche. Mit zwölf Tagen wie noch 1950 wollte und musste sich der Wohlstandsbürger nicht zufrieden geben. 1980 umfasste die schönste Zeit des Jahres für den Durchschnittsarbeitnehmer schon 27 Tage, bis 1990 kletterte dieser Wert auf über 31 Tage. Auch die Wochenarbeitszeiten sanken mit der schrittweisen Einführung der 35-Stunden-Woche weiter. Wieviel Freizeit kann sich Deutschland leisten? Dann aber begann der Wirtschaftsriese Deutschland zu schwächeln. Mit Wachstumsflaute, dem verschärften internationalen Wettbewerb durch Öffnung der europäischen Grenzen, mit Globalisierung und der Krise des Standortes D wuchsen die Zweifel, ob sich die Deutschen so viel Freizeit noch leisten können. "Wir haben die kürzesten Wochenarbeitszeiten, den längsten Urlaub und eine hohe Zahl von Feiertagen", meint Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt. "Diesen Luxus können wir uns auf Dauer nicht leisten." Handwerkspräsident Dieter Philipp verlangt die 42-StundenWoche. Das sei kein Opfer, sondern eine Chance, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen. "Die 42-Stunden-Woche, wie sie in der Schweiz etwa Normalität ist, würde auch bei uns viele Arbeitsplätze retten", glaubt Philipp. "Wir müssen künftig wieder mehr arbeiten bei gleichem Gehalt." Besser als der Ruf Doch sind die Bundesbürger wirklich so viel weniger im Betrieb präsent als beispielsweise Franzosen, Briten oder US-Amerikaner? Zweifel an diesem Bild meldet das Institut zur Erforschung sozialer Chancen (ISO) in Köln an. Es befragte über 4.000 Arbeitnehmer und fand heraus: Die Deutschen arbeiten mehr, als sie selbst von sich glauben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Institut Arbeit und Technik (IAT) in Wuppertal. "Die tatsächlichen Arbeitszeiten entsprechen dem EU-Durchschnitt", heißt es in einer IAT- 9 Untersuchung. Und: "Die faktische Normalarbeitszeit abhängig beschäftigter Vollzeitarbeitskräfte in beiden Teilen Deutschlands ist im Durchschnitt die 40-StundenWoche." Wie ist das möglich im Land der 35-Stunden-Woche? Erstens bleiben viele Arbeitnehmer so lange im Betrieb, bis die Arbeit geschafft ist. Sie beharren also nicht auf den Tarifstandard und lassen nicht um Punkt 16.00 Uhr den Kugelschreiber oder den Pinsel fallen. Zweitens schließen die Erhebungen häufig die Teilzeitkräfte mit ein – die aber senken den Durchschnitt. "Deshalb sollten die Arbeitszeitvergleiche seriöserweise auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Vollzeitbeschäftigung beschränkt werden", fordert das IAT. Drittens galt die 35-Stunden-Woche selbst auf ihrem Höhepunkt nur in Teilbereichen der Industrie und nie flächendeckend. Mehr Arbeit, für weniger Geld Wer jedoch Handwerkspräsident Dieter Philipp genau zuhört, kann das eigentliche Interesse der Unternehmen an längeren Arbeitszeiten heraushören: Für sie ist die Ausweitung ein Vehikel, um die Arbeitskosten zu senken. "Die absoluten Einkommen ließen sich in Deutschland nicht beschneiden", meint auch Arbeitgeberpräsident Hundt, wohl aber die Stundenlöhne. Daher sei es eine "gute Lösung", wenn die Beschäftigten der Firma ein wenig länger zur Verfügung stünden. Auf Geld müsse so keiner verzichten. Dass die Freizeit geringfügig kleiner ausfalle, tue aber niemanden weh. Diese Position findet in weiten Teilen des politischen Spektrums Anhänger. So haben sich unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Edmund Stoiber wiederholt für Mehrarbeit ausgesprochen. Viele Politiker, gerade aus den Reihen der Sozialdemokraten oder Grünen, melden jedoch Bedenken an. Sie fürchten von längeren Arbeitszeiten eher mehr als weniger Arbeitslose. Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle Parteien und auch die Wirtschaftsverbände verständigen können, sind "flexible Betriebsregelungen". Das könnte in bestimmten Branchen und Unternehmen auch kürzere Arbeitszeiten bedeuten. Der Nutzen der Freizeit Auf einen meist unterbelichteten Aspekt hat der US-Wissenschaftler Olivier Blanchard hingewiesen. Er erinnerte daran, dass freie Zeit ihren Wert hat - Ökonomen würden "Nutzen" sagen. Seiner Analyse zufolge dürfen sich die US-Amerikaner zwar über mehr wirtschaftlichen Wohlstand freuen als die Europäer. Doch dafür zahlen sie einen hohen Preis: Sie verzichten auf selbstbestimmte, auf freie Zeit. Der überwiegende Teil des Wohlstandsgefälles zwischen den Vereinigten Staaten und den Euro-Ländern geht laut Blanchard auf eine bewusste Entscheidung der Deutschen, Italiener oder Franzosen zurück: Sie haben ihren Urlaub verlängert und die Wochenarbeitszeiten verkürzt, weil ihnen mit wachsendem Wohlstand die Stunden zu Hause oder im Sportverein wichtiger wurden als mehr Geld für Geländewagen oder Anzüge. 01. Dezember 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/JTMDJR.html Wirtschaftswachstum ohne Jobs Ein steigendes Bruttoinlandsprodukt ist zu wenig, um das Problem der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen Hermannus Pfeiffer "Wir wollen uns jederzeit daran messen lassen, in welchem Maße wir zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beitragen." Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner ersten Regierungserklärung im November 1998 vor dem Deutschen Bundestag 10 Die Ampel für die Wirtschaft steht auf "grün", doch keiner gibt Gas und es fehlt an Jobs. 2004 wuchs die deutsche Volkswirtschaft um 1,6 Prozent, für eine entwickelte Ökonomie durchaus ein respektabler Wert, und trotzdem verschärfte sich das Problem der Arbeitslosigkeit. 2005 waren es dann nur noch 0,9 Prozent. Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass erst ab einem Wachstum von zwei Prozent plus X die Arbeitslosigkeit dauerhaft sinken könnte. Unter Kanzler Helmut Schmidt übersprang 1981 die Zahl der Erwerbslosen in der Bundesrepublik erstmals dauerhaft die Millionen-Marke. Seither mangelt es grundsätzlich an bezahlter Beschäftigung. Während beispielsweise mehr als 75 Prozent der Dänen zwischen Schule und Rente ihr Geld mit einer bezahlten Tätigkeit verdienen, sind es hierzulande nur etwa 65 Prozent. Aber immerhin, zuletzt zählte das Statistische Bundesamt 38.777 Millionen abhängige und selbständige Erwerbstätige, vom Full-TimeJob bis zur geringfügigen Beschäftigung. Für eine tatsächliche Vollbeschäftigung fehlen allerdings mindestens fünf Millionen volle Stellen in Wirtschaft und Verwaltung. Das Arbeitsloch würde selbst eine anziehende wirtschaftliche Entwicklung nicht stopfen können, da sind Sachverständigenrat und Nürnberger Arbeitsverwaltung einer Meinung. Erst ab zwei Prozent Wirtschaftswachstum sei an Job-Wachstum zu denken. Auch die Konjunkturexperten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zeichnen ein tristes Zukunftsbild. "Für mehr Jobs benötigen wir ein jährliches Wirtschaftswachstum von ungefähr zwei Prozent", heißt es beim Berliner DIW. Diese Zahl ergebe sich aus den Erfahrungen der Konjunkturforscher und spiegle den Produktivitätsfortschritt plus die steigenden Preise wider. Da sich an diesen beiden Punkten ebenfalls die Gewerkschaften mit ihren Lohnforderungen orientieren, ergebe sich bei zwei Prozent ein Null-SummenSpiel am so genannten Arbeitsmarkt. DIW und Sachverständigenrat appellieren daher an die Gewerkschaften, "den Produktivitätsspielraum nicht voll auszunutzen". Selbst fünf Prozent Wachstum schafft kaum neue Arbeit Selbst wer einen solchen Verzicht für politisch realistisch oder ökonomisch wünschenswert hält - was die Memorandums-Gruppe um Rudolf Hickel, die jährlich das Gegengutachten zum Sachverständigenrat erstellt, bestreitet, die Massenarbeitslosigkeit wird sich auf diesem Wege jedenfalls nicht beseitigen lassen. DIW-Experte Victor Steiner rechnet vor, dass wir drei Jahre lang ein Wirtschaftswachstum von vier bis fünf Prozent benötigen, um wenigstens die "konjunkturelle" Lücke von 500.000 bis 800.000 Arbeitslosen zu schließen. Millionen Menschen würden dann trotzdem weiterhin vergeblich nach Arbeit suchen, und die nächste Konjunkturdelle kommt bestimmt. Seit dem Ende des "Wirtschaftswunders" in den Sechzigerjahren, mit einem preisbereinigten Wachstum im Jahresdurchschnitt von acht Prozent sind forsche Anstiege des Bruttoinlandsproduktes rar geworden, in den Achtzigern reichte es nur noch zu rund zwei Prozent, und nach dem Ende des zwischenzeitlichen Vereinigungs-Booms ist der Schnitt weiter deutlich gesunken - und eine grundlegende Wende ist realistischerweise nicht zu erwarten. So wird in der Studie "Deutschland 2020", die von der renommierten Prognos AG erstellt wurde, ein durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsproduktes bis 2020 von 1,9 Prozent im Jahr erwartet. Schön wär's, aber doch zu wenig, um neue Jobs zu schaffen. Für die Kluft zwischen Wachstum und Arbeit gibt es eine Reihe von Gründen. Zunächst, "Arbeitslosigkeit" ist nicht deckungsgleich mit "Beschäftigung". Hier spielen - sehen wir von den aktuellen Hartz-IV-Arbeitslosen einmal ab - vor allem demografische Entwicklungen eine Rolle. Aber auch die "Beschäftigung" läuft nicht parallel zur Wirtschaftsentwicklung. Schuld daran ist der technische Fortschritt und damit die zunehmende Produktivität im Lande, mit immer weniger Menschen können immer mehr Waren (oder Dienstleistungen) produziert werden. Die Konsequenz ist bitter. Realistischerweise kann ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von mehr als zwei Prozent nicht erwartet werden, die Politik darf also bei ihrer Arbeitsmarktpolitik nicht allein auf den nächsten Konjunkturaufschwung hoffen. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte Erfolg oder Misserfolg seiner Regierung an die Entwicklung der Arbeitslosigkeit geknüpft. Insofern sind die Ideen hinter den Arbeitsmarktreformen "Hartz" nachvollziehbar. Aber: Die Job-Vermittlung zu verbessern, schafft noch keine neuen Jobs. Daran werden auch die sozialpolitisch heiklen Ein-Euro- 11 Jobs und die neuen Ich-AG's nicht wirklich etwas ändern. Wirtschaftswissenschaftler fordern daher - je nach wirtschaftspolitischer Orientierung eine weitere Liberalisierung des Arbeitsmarktes sowie mehr Billigjobs, nach britischem Vorbild, oder staatliche, keynesianische Konjunkturprogramme, die notfalls auch per Kredit finanziert werden, wie es die USA vormachen. "Ich hinterlasse meinen Kindern dann nicht nur Schulden, sondern auch ein fertiges Haus", hält Starökonom Wilhelm Hankel einen weiteren Schuldenberg für tragbar. Chancen auf ein Job-Plus sehen fast alle Ökonomen in neuen Innovationen. BestsellerAutor Jeremy Rifkin empfiehlt zudem, den größten internen Markt der Welt schnell zu vereinheitlichen: Europa könne Deutschlands "goldene Gans" werden. Ansonsten heilt auch in diesem Fall die Zeit manche Wunde: Die Arbeitslosigkeit wird aufgrund der Veralterung sinken. Heute sind weniger als ein Drittel der Bürger älter als 65 Jahre, in 20 Jahren werden es schon fast 40 Prozent sein. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/6LLA8B.html Gewerkschaften heute: Alte Interessen und neue Wege Peter Laudenbach Die Lage der deutschen Gewerkschaften ist so schwierig wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. "Wir haben den neokonservativen Mainstream gegen uns. Wir haben Reallohnverluste. Und wir haben in vielen Branchen klassische Formen von Lohnverzicht", konstatiert der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. Seine Stellvertreterin Ursula EngelenKefer diagnostiziert, dass "der Handlungsspielraum kleiner geworden ist. In der Offensive sind diejenigen, die auf den Kapitalmärkten spielen. Das Machtungleichgewicht ist zugunsten der Unternehmer gewachsen." Dazu kommen selbst verursachte Probleme: Im Sommer 2005 beschädigte der Skandal um korrupte Betriebsräte im Volkswagenkonzern das Ansehen der Gewerkschaften massiv. Nach einer Allensbach-Umfrage leiden hauptberufliche Gewerkschaftsfunktionäre zudem unter einem ausgesprochenen Negativ-Image: Sie genießen von allen Berufsgruppen das geringste Ansehen. Für den liberalen Wirtschaftswissenschaftler HansWerner Sinn sind Gewerkschaften schlicht ein rücksichtsloses "Kartell" zur Durchsetzung höherer Gehälter, das durch künstlich verteuerte Arbeit für erhöhten Rationalisierungsdruck und Verlagerung von Produktionsstätten in Billiglohn-Länder verantwortlich ist. Wozu gibt es Gewerkschaften? Solchen Frontalangriffen zum Trotz verfügen die deutschen Gewerkschaften nach wie vor über erhebliche politische und wirtschaftliche Macht. In ihnen organisieren ca. acht Millionen Arbeitnehmer ihre Interessen. Größte Einzelgewerkschaften sind die IG Metall (2,6 Mio. Mitglieder) und die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di (2,7 Mio. Mitglieder). Wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften ist es, in Tarif-Auseinandersetzungen mit der Arbeitgeberseite die abhängig Beschäftigten zu vertreten. Stärkstes, aber nur selten genutztes Kampfmittel ist dabei der Streik. Die im Betriebsverfassungsgesetz geregelte Mitbestimmung stärkt die innerbetriebliche Demokratie: Vertretern der Kapital-Seite sitzen in Aufsichtsräten großer Unternehmen Arbeitnehmervertreter gegenüber. Die weitreichenden Einflussmöglichkeiten der Gewerkschaften haben über viele Jahrzehnte zum Erfolg der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik beigetragen. Der institutionell abgesicherte Zwang zum Konsens in der Sozialpartnerschaft hat nicht nur die Teilhabe der abhängig Beschäftigten am erwirtschafteten Wohlstand gesichert. Er hat auch dafür gesorgt, dass Interessenskonflikte moderater als in vergleichbaren 12 Volkswirtschaften ausgetragen werden. Nach einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarktforschung und Berufsbildung wurde in Deutschland zwischen 1991 und 2000 deutlich weniger gestreikt als in anderen Industriestaaten: 9,3 Streiktage pro Jahr und 1.000 Beschäftigte. Nur in Österreich, Japan und der Schweiz (1,5 Tage), also ähnlich konsens-orientierten Ländern, kam es zu noch weniger Streiks. Goldene Zeiten vorbei? Seit den Neunzigerjahren stehen die Gewerkschaften unter massivem Druck. Die durch die Globalisierung verschärfte Standortkonkurrenz hat ihre Handlungsspielräume eingeschränkt. "Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit sind wir erpressbar geworden", stellt der DGB-Vorsitzende Sommer fest. "Die Drohung, Produktionsstätten in Billiglohnländer zu verlagern, hat uns bittere Niederlagen beschert in Bereichen, in denen wir uns eigentlich stark wähnten: Siemens, VW, Opel." Als Antwort auf die Globalisierung versuchen die deutschen Gewerkschaften ihre Zusammenarbeit mit osteuropäischen Gewerkschaften zu intensivieren. "Man kann nicht auf der einen Seite sagen, dass man gegen den Lohn-Dumping-Wettbewerb ist und von den Kollegen aus Osteuropa verlangen, dass sie sich am Lohn-Dumping nicht beteiligen – und sie gleichzeitig aussperren", meint Sommer. Auf die Rezession reagieren Betriebsräte in zahlreichen Betrieben, indem sie Öffnungsklauseln und Haustarifverträgen zustimmen. Das höhlt die Flächentarifverträge aus und verschlechtert Bezahlung und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, sichert aber Arbeitsplätze und stabilisiert notleidende Unternehmen. Gesetzesänderungen, die solche Haustarifverträge auch gegen den Willen der Gewerkschaften erheblich erleichtern, werden immer wieder von Union und FDP ins Programm genommen – so auch im Bundestagswahlkampf 2005. Gegen solche Pläne haben die Gewerkschaften ihren massiven Widerstand angekündigt. Die Gewerkschaften versuchen, die Deregulierung am Arbeitsmarkt zu verhindern und ihr die gemeinsam mit Unternehmensleitungen entwickelten, flexiblen Arbeitszeitmodelle entgegenzusetzen. Beispielhaft dafür ist das vom damaligen Personalvorstand der Volkswagen AG, Peter Hartz, zusammen mit Betriebsräten entwickelte Modell der Vier-Tage-Woche (28,8 Stunden), die, je nach Auftragslage, jederzeit ausgedehnt werden kann. Mehrarbeit wird dabei auf Zeitkonten gutgeschrieben. Nachwuchs fehlt Nicht nur Globalisierung und schwaches Wirtschaftswachstum schwächen jedoch die Gewerkschaften. Waren 1990 noch 35 Prozent der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert, sind es zwölf Jahre später gerade noch 25 Prozent. Von knapp zwölf Millionen DGB-Mitgliedern im Jahr 1991 sind 2005 noch sieben Millionen übrig geblieben. Die Ursachen für den Mitgliederschwund sind vielfältig: So ist es den Gewerkschaften kaum gelungen, Belegschaften in den Unternehmen der Wissensgesellschaft und der New Economy zu organisieren. "Wir haben damals beim Platzen der Blase eine Chance versäumt", räumt der DGB-Vorsitzende Sommer ein. Die Gewerkschaften müssten noch lernen, welche kollektive Dienstleistung beispielsweise ein Mitarbeiter von SAP braucht und welche nicht. Mit einer klassischen einfachen Beraterleistung könne man da nicht kommen. Zusätzlich erschwert wird die Lage der Gewerkschaften durch die Erosion der sozialversicherungspflichtigen Normalarbeitsverhältnisse. Wer nicht festangestellt arbeitet, ist für Gewerkschaften schwer erreichbar. Scheinselbstständige und prekär Beschäftigte sind gleichzeitig ungeschützter und schwerer gewerkschaftlich zu organisieren als industrielle Kernbelegschaften – und die schrumpfen. Inzwischen versuchen die Gewerkschaften auf diese Defizite zu reagieren. Der DGB-Vorsitzende Sommer nennt ein Beispiel: "Wir haben die Leiharbeit aus der Schmuddelecke herausgeholt und sie gesetzlich und tarifvertraglich normiert. Das war ein große Erfolg. Noch vor fünf Jahren haben die deutschen Gewerkschaften gesagt, Leiharbeit ist Sklavenarbeit. Aber ich kann ja nicht die Menschen verurteilen, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und leben." Die Gewerkschaften befinden sich in einem Lernprozess. Entgegen anders lautenden Parolen sehen sie ihre Aufgabe nicht darin, notwendige Reformen zu blockieren, sondern 13 darin, sie mitzugestalten. Gelingt ihnen das nicht, werden sie weiter an Einfluss verlieren. Das wäre weder im Interesse der Beschäftigten noch im Interesse einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/67D9G6.html Wer hat Angst vor Heuschrecken? Tilo Barz Als abwertendes Synonym für Finanzinvestoren war die Metapher aus Franz Münteferings Arsenal ein politischer Volltreffer: Perfekt bedient sie antikapitalistische Ressentiments beim Publikum, perfekt passte sie auch zu ganz realen Negativschlagzeilen aus der Welt der Firmenjäger. Aber wie schlimm sind die "Heuschrecken" wirklich? Objektive Antworten sind nicht leicht zu finden. Während die Kritiker Finanzinvestoren zu skrupellosen Wertvernichtern erklären, verfolgen die Verteidiger eine kaum weniger pauschale Strategie unter dem Motto "Gut aus Gier". Ihr Credo: Wer Renditen maximiert, macht Unternehmen und ganze Volkswirtschaften effizienter, und das nutzt am Ende allen. Beide Seiten können eindrückliche Belege für ihre jeweilige Position anführen. Da ist der Fall Grohe: Ein durchaus profitabler Armaturenhersteller wird von zwei Finanzinvestoren nacheinander übernommen. Beide plündern die Kasse, so dass nun ein riesiger Schuldenberg auf dem Unternehmen lastet. Beide verlangen hohe Gewinne, die nur mit Produktionsverlagerung ins billigere Ausland zu erreichen sind. Und am Ende steht sogar das Überleben des traurigen Restes auf dem Spiel, weil die Kundschaft vielleicht ohne "Made in Germany" keine Grohe-Preise mehr zahlen will. Auf der anderen Seite steht der Fall Wincor-Nixdorf: Ein lahmender Geldautomatenhersteller wird von zwei Finanzinvestoren übernommen und auf Trab gebracht. In wenigen Jahren entstehen Tausende neue Jobs, das Unternehmen kommt erfolgreich an die Börse. Es gibt nur Gewinner: Die Finanzinvestoren ernten ein Vielfaches ihres Einsatzes. Die neuen Mitarbeiter freuen sich über ihre Arbeitsplätze. Und auch die Aktionäre jubeln – weil das Wachstum weitergeht, hat sich der Kurs seit dem Börsengang vor anderthalb Jahren mehr als verdoppelt. Wer einfache Wahrheiten sucht, wird also auch in Sachen "Heuschrecken" enttäuscht. Kompliziertere Wahrheiten beanspruchen aber etwas mehr Detailkenntnis. Also schauen wir einmal genauer hin. Was ist eigentlich eine "Heuschrecke"? Stein des Anstoßes sind die so genannten "Private-Equity-Fonds" (PE-Fonds), die in den vergangenen Jahren einen zweistelligen Milliardenbetrag in Deutschland investiert haben. Sie heißen Apax, Blackstone, KKR oder Permira, und haben zusammen in Deutschland schon weit über 5.000 Firmen mit mehr als 400.000 Mitarbeitern unter Kontrolle. Erfunden wurde Private Equity in den Siebzigerjahren in den USA. Aber erst seit den Neunzigern tummelt sich die Spezies auch flächendeckend in Europa. Zum Begriff: "Equity" steht für Unternehmensbeteiligung. "Private" heißt in diesem Fall "nicht öffentlich", also nicht börsennotiert. Verwandt, aber nicht zu verwechseln sind sie übrigens mit "Hedgefonds" - einer Sammelbezeichnung für Finanzinvestoren, die zumeist kurzfristig an den Märkten spekulieren. Wie tickt eine "Heuschrecke"? Ein Private-Equity-Fonds ist eher mittel- bis langfristig ausgerichtet. Er sammelt bei Kapitalanlegern gewaltige Geldsummen ein und investiert diese gezielt in wenige Unternehmen, mit Vorliebe in Mehrheitsbeteiligungen und zu zwei Dritteln auf Kredit. Mit großer Akribie suchen die Fondsmanager dafür Gesellschaften aus, in denen möglichst große Reserven schlummern. Um diese zu mobilisieren, setzen sie anschließend Himmel 14 und Hölle in Bewegung. Die Unternehmen müssen profitabler werden und meist parallel noch den Kredit abbezahlen, der zu ihrem Kauf aufgenommen wurde. Wenn das alles geschafft ist, werden die Unternehmen wieder verkauft, am liebsten mit hohem Gewinn. Dieser Gewinn wird an die Kapitalanleger ausgeschüttet. Üblicherweise laufen Private-Equity-Fonds fünf Jahre oder länger und erwirtschaften in dieser Zeit jährliche Renditen von bis zu 20 Prozent. Natürlich nicht alle und nicht immer. Denn das Geschäft hat auch Risiken: Mal wird zu teuer eingekauft, mal scheitert der Versuch, eine Beteiligung profitabler zu machen, mal klemmt es beim abschließenden Verkauf. Eine beliebte Variante für den Verkauf ist der Börsengang. Käufer sind in diesem Fall alle, die die neue Aktie zeichnen – wie beim Fernsehsender Premiere und beim Triebwerkshersteller MTU. Hier konnten die Verkäufer Permira und KKR ihre Preisvorstellungen weitgehend durchsetzen, weil die Börsenstimmung gerade relativ gut war. Anders im Jahr 2003: Weil damals niemand Aktien haben wollte, gelang in Deutschland kein einziger Börsengang. Dieser "Exit" für Finanzinvestoren war also verstopft. Zu Risiken und Nebenwirkungen ... Die nach Ansicht der Kritiker unanständig hohen Renditen sind also auch eine Entschädigung für die langfristige Bindung des investierten Geldes und für das eingegangene Risiko. Fatalerweise ist dieses Risiko allerdings um so geringer, je skrupelloser der Investor agiert. Schafft er es beispielsweise, so viel Kapital aus der Gesellschaft abzuziehen, dass er damit den Kaufpreis nachträglich abbezahlen kann, dann ist das Verlustrisiko gleich Null – aber die Pleitegefahr dafür um so größer. Doch auch wenn der größte anzunehmende Betriebsunfall ausbleibt, sind unangenehme Nebeneffekte gewiss: Drastische Lohnsenkungen, extremer Leistungsdruck, Entlassungswellen. Während sich der klassische mittelständische Unternehmer mit seiner Firma identifiziert, viele Mitarbeiter schon seit Jahren kennt und ihre Bedürfnisse respektiert, kennt der Finanzinvestor kein anderes Ziel als die höchstmögliche Rendite. Kritiker wie der Management-Guru Fredmund Malik unterstellen der gesamten PEBranche, dass sie das kurzfristige Gewinnstreben systematisch überzieht und deshalb volkswirtschaftlichen Schaden in großem Ausmaß anrichtet. Immerhin: Dieses kompromisslose Gewinnstreben macht den Finanzinvestor berechenbar, anders als einen alternden Patriarchen, eine zerstrittene Eigentümerfamilie oder einen ineffizienten, verlotterten Großkonzern. Außerdem ist es keineswegs ausgemacht, dass das "Ausschlachten" am Ende wirklich die renditeträchtigste Strategie für den Umgang mit aufgekauften Unternehmen ist. Ist genug Substanz und Potenzial vorhanden, kann eine "Fitnesskur" mit anschließendem Verkauf die Gewinne viel höher treiben Argumente und Fakten bleiben also zwiespältig. Fest steht aber: Ob nun gut oder schlecht, ist Private Equity derzeit statistisch gesehen die mit Abstand lukrativste Anlageform überhaupt. Wollen Deutsche draußen bleiben? So gesehen zeigt sich aus deutscher Sicht ein ganz anderes Problem - dass sich nämlich die PE-Investoren weltweit eine goldene Nase verdienen, hiesiges Kapital aber kaum an diesen Erträgen teil hat. Die einschlägigen Investitionen erreichten 2004 erst 0,17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während es beispielsweise in Schweden und Großbritannien bereits 0,59 bzw. 1,10 Prozent waren. Der Grund: Vielen deutschen Großanlegern wie den Lebensversicherungen ist die schillernde neue Anlageform noch zu riskant. Kleinanleger haben erst seit kurzem sehr begrenzte Möglichkeiten, über Zertifikate oder kleinere geschlossene Dachfonds in Private Equity zu investieren. Dagegen sind reiche Privatleute wie die Quandt-Familie seit Jahren groß im Geschäft, an dem ansonsten vor allem US-Pensionsfonds, britische Versicherer und die "Oberen Zehntausend" verdienen. Ob die "Heuschrecken" durch "global koordinierte Maßnahmen" zu stoppen wären, sei dahingestellt – Politiker, die so etwas fordern, sollten aber auch bei den Realisierungschancen ehrlich bleiben. Immerhin hat ausgerechnet die rot-grüne 15 Bundesregierung eine ganze Kollektion ihres Tafelsilbers vom Dualen System bis zu Tank&Rast an die später so geschmähten Heuschrecken verkauft, weil sie keine anderen risikofreudigen Interessenten fand. Die Richtung ist klar, und die Aufgabe damit auch: Rahmenbedingungen zu schaffen, die einerseits Private-Equity-Kapital anziehen, aber andererseits seine negativen Auswüchse einschränken. Und auf der anderen Seite alles Nötige zu tun, um den Bereich für deutsches Kapital jeder Größenordnung weiter zu öffnen. Denn auch am globalisierten Finanzmarkt gilt: Wer mitspielt, kann verlieren. Wer nicht mitspielt, hat schon verloren. 04. Oktober 2005 Quelle: http://www.bpb.de/themen/4DDNTH.html Globalisierung ordnungspolitisch gestalten: Die internationale Finanzarchitektur nach den Finanzkrisen Das Volumen und die rasche Beweglichkeit globaler Finanztransaktionen können selbst gesunde Ökonomien oder auch einzelne Unternehmen gefährden. Um Finanzkrisen in Zukunft zu vermeiden, muss die internationale Finanzarchitektur auf sicherere Fundamente gestellt werden. Auszug aus: Globalisierung, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 05/2003) Dieter, Heribert I. Warum benötigen Finanzmärkte eine andere Ordnung? Die Finanzkrisen der vergangenen acht Jahre haben zu einer Debatte über eine neue internationale Finanzarchitektur geführt. Seit der Mexiko-Krise in den Jahren 1994 und 1995 sind die Finanzmärkte immer wieder von Krisen geschüttelt worden. In keinem Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg hat es so viele Finanzkrisen gegeben wie in den neunziger Jahren. Davon betroffen waren auch solche Länder, die jahrelang als Musterländer galten. Für Entwicklungs- und Schwellenländer ist besonders problematisch, dass die Kapitalströme sehr beweglich, volatil geworden sind. Während im Jahr 1996 noch privates Kapital in Höhe von 234 Mrd. US-Dollar (netto) in die Entwicklungs- und Schwellenländer floss, war im Jahr 2000 lediglich ein Nettozufluss von 0,5 Mrd. US-Dollar zu verzeichnen. Noch problematischer ist die Lage bei privaten Bankkrediten: Während 1996 noch neue Kredite in Höhe von 26,7 Mrd. US-Dollar (netto) an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben wurden, zogen Banken im Jahr 2000 in großem Maßstab Kapital aus den Entwicklungs- und Schwellenländern ab: Diese Ökonomien mussten nun per Saldo die Rückzahlung von Krediten in Höhe von 148,3 Mrd. US-Dollar verkraften (vgl. Tabelle 1). Diese Entwicklungen überraschen: Die Befürworter einer weitgehenden Liberalisierung von Finanzmärkten hatten eine andere Entwicklung prognostiziert. Von der Liberalisierung der Kapitalmärkte wurden nennenswerte Vorteile erwartet. Die Finanzierungskosten für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern sollten durch den Rückgriff auf ausländische Ersparnisse sinken und damit die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen steigen. Stattdessen wurden Phasen größerer Effizienz rasch abgelöst von schweren Finanzkrisen. Per Saldo sind die Kosten des gegenwärtigen Systems für Entwicklungs- und Schwellenländer höher als der Nutzen. Notwendig ist aber eine Differenzierung nach Art der Kapitalflüsse: Während ausländische Kredite, insbesondere solche mit kurzer Laufzeit, mit hohen Risiken verbunden sind, 16 haben sich langfristige Kredite mit Laufzeiten von mehreren Jahren und ausländische Direktinvestitionen als wesentlich unproblematischer erwiesen.[1] Die im Folgenden erörterten Vorschläge zur Neuordnung verfolgen das Ziel der Schaffung einer globalen Ordnungs- und Strukturpolitik auf den internationalen Finanzmärkten. Diese brauchen einen soliden ordnungspolitischen Rahmen. Im nationalen Raum ist dies seit langem verwirklicht: Sämtliche nationalen Finanzmärkte der OECD-Länder sind hochgradig reguliert. So gibt es beispielsweise festgelegte Verfahren für den Fall eines Konkurses. Kein Gläubiger kann sich seiner angemessenen Beteiligung an der Überwindung eines Konkurses entziehen. In nationalen Finanzsystemen der Industrieländer gibt es einen mächtigen "Gläubiger der letzten Instanz", die Zentralbank. In Krisenfällen sorgt diese für die Bereitstellung von zusätzlicher Liquidität. Die heutige internationale Finanzordnung ist also unvollständig. Die Schaffung eines globalen Kapitalmarktes wurde bisher nicht begleitet von "global governance"Strukturen. Die Forderung nach der Schaffung eines internationalen "Gläubigers der letzten Instanz" und eines Insolvenzverfahrens für souveräne Schuldner ist letztlich die konsequente Fortsetzung des bisher verfolgten Weges der Globalisierung. Es ist wahrscheinlich, dass sich Entwicklungs- und Schwellenländer von den globalen Finanzmärkten zurückziehen würden, falls diese Institutionen und Verfahren nicht geschaffen werden sollten. Drei Ziele stehen im Mittelpunkt der hier diskutierten Einzelmaßnahmen: a) Die Häufigkeit und Schärfe von Währungs- und Finanzkrisen muss reduziert werden; b) Gläubiger müssen systematisch an der Krisenprävention und Krisenlösung beteiligt werden; c) die Finanzsektoren der Entwicklungs- und Schwellenländer müssen gestärkt werden, um mittel- und langfristig den Verzicht auf Kreditaufnahme im Ausland zu ermöglichen. Die Erreichung dieser Ziele würde dazu beitragen, die Weltwirtschaft stabiler zu gestalten. Unterbleibt diese Stabilisierung, könnte die heutige liberale Weltwirtschaftsordnung in Gefahr geraten. Ähnlich wie in der Großen Depression könnte weit mehr als nur die Finanzmärkte in Gefahr geraten: Die partielle Abschottung zahlreicher Ökonomien vom Weltmarkt und der Zusammenbruch der multilateralen Handelsordnung könnte die Folge von weiterhin ungenügend regulierten globalen Finanzmärkten sein.[2] In diesem Beitrag beschäftige ich mich zunächst mit der Frage, inwieweit eine Devisenumsatzsteuer die Finanzmärkte zu stabilisieren vermag. Anschließend betrachte ich Ansätze für "global governance". Ein internationales Insolvenzverfahren und ein "Gläubiger der letzten Instanz" könnten die zentralen Bausteine einer neuen internationalen Finanzarchitektur werden. Scheitern diese Ansätze, gibt es auf der Ebene des Nationalstaates allerdings Alternativen: Entwicklungs- und Schwellenländer können sich durch sog. Roll-over-Optionen und Beschränkungen des Kapitalverkehrs vor den negativen Konsequenzen deregulierter Finanzmärkte selbst schützen. II. Tobin-Steuer und Spahn-Steuer: Wundermittel oder Holzwege? Besonderes Interesse hat in jüngster Zeit ein Vorschlag des amerikanischen Ökonomen James Tobin zu einer weltweit einzuführenden Devisenumsatzsteuer hervorgerufen. Zahlreiche Kritiker der Globalisierung erhoffen sich von einer Tobin-Steuer die Stabilisierung von Devisenmärkten sowie eine ergiebige Quelle zur Finanzierung von entwicklungspolitischen Projekten. Tobin hatte nach dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods eine geringfügige Steuer auf Devisentransaktionen gefordert. Die Idee war, die Währungsspekulation durch Erhöhung der Transaktionskosten unattraktiver zu machen. Tobins Vorschlag geht auf Überlegungen von John Maynard Keynes zurück, der durch steuerliche Maßnahmen Spekulationen auf Finanzmärkten dämpfen wollte. Viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs), z. B. WEED und Attac, haben die Einführung einer Tobin-Steuer zur zentralen Forderung erhoben. Nach genauer Prüfung bleiben aber erhebliche Zweifel an den Erfolgsaussichten dieser Steuer. Die zentrale Schwachstelle der Tobin-Steuer ist, dass sie alle internationalen Kapitalströme implizit als problematisch bewertet. Tausende von nützlichen und vollkommen ungefährlichen Transaktionen werden mit den wirklich destruktiven und spekulativen Kapitalströmen in einen Topf 17 geworfen.[3] Dies ist falsch und führt zur unnötigen Verteuerung beispielsweise des internationalen Handels. Weiterhin ist zu fragen, ob die Tobin-Steuer ihr vorrangiges Ziel erreichen kann: Leistet sie einen nennenswerten Beitrag zur Vermeidung schwerer Währungskrisen? Die Antwort ist, dass Spekulanten, die einen festen Wechselkurs attackieren wollen, von einer Steuer in Höhe von 0,1 bis 0,25 Prozent des Umsatzes nicht abgeschreckt werden können. Wenn Profite von 30 Prozent und mehr locken, ist mit einer derartig geringfügigen Steuer kaum etwas auszurichten.[4] Zu diesem Ergebnis kommen auch zwei neue Studien der Europäischen Kommission und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): Das eigentliche Ziel, die Stabilisierung von Wechselkursen und die Verhinderung von spekulativen Attacken gegen einzelne Währungen, wird durch eine Tobin-Steuer nicht erreicht werden.[5] Zudem ist unklar, ob die Erhöhung der Transaktionskosten grundsätzlich ein Erfolg versprechendes Mittel gegen Spekulation ist. Es gibt keinen empirischen Befund, der diese Einschätzung stützt.[6] Auch Wertpapiermärkte mit höheren Transaktionskosten weisen keine geringere Volatilität auf als solche mit geringeren Transaktionskosten.[7] Ein Beispiel für eine Börse mit vergleichsweise hohen Transaktionskosten ist überraschenderweise die London Stock Exchange. Dort wird immerhin seit 1694 eine "stamp duty" erhoben. Diese Steuer ist heute die älteste in England erhobene Steuer; sie beträgt 0,5 Prozent des Umsatzes, die vom Käufer einer Aktie zu tragen sind. Die Einnahmen aus dieser Steuer sind beträchtlich: 1999 - 2000 nahm der britische Finanzminister mehr als fünf Mrd. Euro aus dieser Steuer ein, mehr als das Vierfache der Einnahmen des Fiskaljahres 1994 - 1995. Gleichwohl hat sich die Londoner Börse nicht weniger volatil gezeigt als andere Börsenplätze auch. Die Steuerungsfunktion einer Börsenumsatzsteuer, d. h. die Dämpfung spekulativer Tendenzen, kann am Londoner Beispiel nicht nachgewiesen werden. Schaden würde die Tobin-Steuer denjenigen, die auf kleine Ausschläge der Wechselkurse wetten. Aber diese kleinen Ausschläge sind kein Problem. Diese Arbitrage-Funktion sichert einheitliche Preise und sorgt für liquide Märkte. Eine geringfügige Steuer könnte daher sogar destabilisierende Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben. Eine Senkung des Liquiditätsniveaus durch die Reduzierung der Umsätze kann also dazu führen, dass die Volatilität der Wechselkurse steigt.[8] Dies gilt insbesondere bei Währungen von Entwicklungs- und Schwellenländern, bei denen die Liquidität und die Umsätze ohnehin recht niedrig sind.[9] Ein aktuelles Beispiel für die negativen Konsequenzen der Verknappung von Liquidität in Devisenmärkten liefert Südafrika: Dort wurden im Oktober 2001 Maßnahmen zur Beschränkungen des Devisenhandels verfügt, die zum Einbrechen des Wechselkurses beitrugen.[10] Eine Tobin-Steuer, die auf Dauer erhoben werden soll, erfordert einen multilateralen Ansatz und die Bereitschaft, die Steuer zumindest auf den wichtigsten Finanzplätzen zu erheben.[11] Deshalb erscheint es nicht übertrieben pragmatisch, wenn man die Frage stellt, ob in absehbarer Zeit mit der Unterstützung eines solchen Konzeptes durch die amerikanische Regierung zu rechnen sein wird. Ohne die Amerikaner wird dieses Konzept keine durchschlagende Wirkung erzielen. Obwohl es also eine Reihe von konzeptionellen und politischen Gründen gibt, die TobinSteuer als wenig hilfreich zu betrachten, ist die Debatte darüber nützlich. Regierungen haben eine Verantwortung für die Gestaltung der Globalisierung, und es bestehen Chancen für die Gestaltung von Finanzmärkten. Die Globalisierung hat nicht zu machtlosen Regierungen geführt. Vielmehr haben Politiker lange ihre Verantwortung für die Gestaltung der Märkte ignoriert und auf deren Selbstregulierung vertraut. Der wachsende Widerstand gegenüber deregulierten und liberalisierten Finanzmärkten und auch die Debatte um die Tobin-Steuer ermuntern möglicherweise die Regierungen der OECD-Länder, die politischen und ökonomischen Vorteile verbesserter Regulierung sorgfältig zu prüfen. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass die Debatte um die Tobin-Steuer auch den genau entgegengesetzten Effekt haben kann: Von den eigentlichen Problemen der internationalen Finanzmärkte wird abgelenkt, und die Neigung, sich mit komplexen 18 ökonomischen Zusammenhängen zu beschäftigen, wird gedämpft.[12] Sowohl in der Politik als auch bei Kritikern der Globalisierung ist diese Gefahr erkennbar. Die Verlockung erscheint groß: Mittels eines vermeintlichen Wundermittels sollen sowohl die Finanzmärkte stabilisiert als auch eine ergiebige Quelle zur Finanzierung von Entwicklungspolitik erschlossen werden. Weder das eine noch das andere wird aber mit der Tobin-Steuer erreicht werden können. Andere Steuern, z. B. auf Flugbenzin, sind zur Finanzierung von entwicklungs- und umweltpolitischen Projekten weitaus geeigneter als die Tobin-Steuer.[13] Angesichts der eklatanten Schwächen der Tobin-Steuer wird inzwischen über modifizierte Varianten nachgedacht. Der Frankfurter Ökonom und Gutachter des BMZ, Paul Bernd Spahn, hat eine zweistufige Steuer vorgeschlagen. Die erste Stufe erfasst alle Wechselkurstransaktionen und gleicht hier der Tobin-Steuer. Allerdings soll der Steuersatz sehr niedrig sein und sich zwischen 0,005 Prozent und 0,02 Prozent bewegen. Damit würden Wechselkurse nicht stabilisiert, aber Steuern eingenommen. Die Stabilisierung der Wechselkurse soll durch eine zweite Stufe erfolgen. Die Idee von Spahn ist, dass ein Land den Wechselkurs der Währung innerhalb einer Bandbreite festlegt. Um den administrativ festgelegten Wechselkurs herum können die Kurse innerhalb einer Bandbreite von beispielsweise ± drei Prozent frei schwanken. Außerhalb des Wechselkurskorridors würde aber eine hohe Steuer von zwischen 50 und 100 Prozent greifen.[14] Diese Spahn-Steuer sollte unilateral von Transformations-, Schwellen- und Entwicklungsländern sowie von außerhalb der großen Währungsräume gelegenen Industrieländern eingeführt werden.[15] Die Spahn-Steuer verspricht umfassende Vorteile: Entwicklungs- und Schwellenländer müssen nur noch zwei Instrumente implementieren - die Wechselkurszielzone und die Spahn-Steuer. Von der Steuer betroffen sind ausschließlich die als schädlich betrachteten spekulativen Attacken außerhalb der Zielzone. Der Warenhandel und der zur Bereitstellung von Liquidität notwendige Arbitragehandel werden nicht belastet. Der Arbitragehandel nutzt Kursdifferenzen an verschiedenen Börsenplätzen aus. Arbitrageure versuchen, am jeweils billigsten Markt zu kaufen und zugleich am teuersten Markt zu verkaufen. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, dass Spahn ein überzeugendes Konzept vorgelegt hat. Bei etwas genauerer Betrachtung wird hingegen deutlich, dass die SpahnSteuer nicht funktionieren kann. Das Problem ist ihre Reichweite: Die Währung eines Landes wird nicht nur an den Finanzplätzen des eigenen Staates, sondern auch an anderen Finanzplätzen und, dies ist besonders wichtig, an Offshore-Finanzplätzen gehandelt. Um nun zu verhindern, dass spekulative Attacken gegen eine Währung stattfinden, muss der Handel auf die landeseigenen Finanzplätze beschränkt werden. Nur dort kann die Spahn-Steuer erhoben werden, nicht jedoch auf anderen Finanzplätzen und schon gar nicht an unregulierten Offshore-Finanzplätzen. Die Spahn-Steuer funktioniert also nur mit Kapitalverkehrskontrollen. Wenn aber ein Land Kapitalverkehrskontrollen erlässt, braucht es keine Spahn-Steuer, da dann ohnehin nicht gegen die Währung des Landes spekuliert werden kann. Mit anderen Worten: Ohne Kapitalverkehrskontrollen funktioniert die Spahn-Steuer nicht, mit Kapitalverkehrskontrollen braucht man sie nicht. III. Insolvenzverfahren und Anleiheklauseln 1. Internationales Insolvenzrecht Die Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs wurde bislang nicht begleitet vom Aufbau jener Strukturen, die in nationalen Finanzmärkten als völlig selbstverständlich betrachtet werden. Dazu gehört ein Insolvenzrecht, um den Konkurs eines staatlichen Schuldners abwickeln zu können. Die Idee für ein solches internationales Insolvenzrecht ist keineswegs neu. Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde vorgeschlagen, nationales Insolvenzrecht auf die internationale Ebene zu übertragen.[16] Amerikanische Regulierungen können hier als Vorlage genutzt werden. In den USA können sich Gebietskörperschaften nach Artikel 9 des amerikanischen Konkursrechts für zahlungsunfähig erklären. Voraussetzung ist, dass die Absicht besteht, die vorhandenen Schulden zu bedienen, dies jedoch die finanziellen Möglichkeiten nicht zulassen. Zudem muss entweder die Bereitschaft sämtlicher Gläubiger zur Umschuldung vorliegen, oder es muss ohne Erfolg versucht worden sein, die Gläubiger zu einer Umschuldung zu 19 bewegen.[17] Im internationalen Kontext könnte ein neutrales Gericht zur Lösung der Insolvenz berufen werden. Die Mitglieder des Gerichts sollten zu gleichen Teilen von beiden Parteien benannt werden. Aus diesen Reihen sollte dann ein Vorsitzender gewählt werden, um durch ungerade Stimmenzahl eine Mehrheitsbildung zu ermöglichen.[18] Ziel des Insolvenzverfahrens ist es, dem Schuldner einen wirtschaftlichen Neuanfang zu ermöglichen. Durch die in der Regel erfolgende teilweise Entschuldung soll ein Schuldenstand erreicht werden, der es ermöglicht, Zins und Tilgung zu leisten. Gewiss kann man einwenden, dass dieses Verfahren heute von erheblich geringerer Bedeutung als in der Vergangenheit ist, da staatliche Verschuldung nur noch eine geringe Rolle spielt. Dieses Argument ist aber nur teilweise stichhaltig. Zum einen gibt es noch eine Reihe von Fällen, bei denen Staaten überschuldet sind. Zahlreiche afrikanische Länder fallen genauso unter diese Kategorie wie Argentinien. Zum anderen hat die Existenz eines internationalen Insolvenzrechts disziplinierende Wirkung auf Kreditgeber, die bisher davon ausgehen konnten, dass es kein Konkursverfahren für überschuldete Staaten gibt. Ende November 2001 überraschte die stellvertretende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Anne Krueger, mit einem Vorschlag zur Schaffung eines Insolvenzverfahrens unter Führung des IWF. In ungewöhnlich deutlichen Worten wurde von Krueger Kritik an Gläubigern geübt, die sich mit aggressiven juristischen Strategien Vorteile verschafften. Krueger geißelte ein Unternehmen als Geier-Firma (vulture company). Dieses Unternehmen, Elliott Associates, hatte auf dem Sekundärmarkt - dem Markt für bereits im Umlauf befindliche Wertpapiere - Anfang 1997 Forderungen an Peru zum Preis von 20,7 Mio. US-Dollar erworben. Im Oktober 1995 hatte Peru eine Umschuldung von Altschulden im Rahmen eines vom IWF unterstützten Programms erklärt. Im Zuge der Umschuldung Perus sollten diese Verbindlichkeiten in sog. Brady Bonds umgetauscht werden.[19] Elliott Associates verklagte Peru aber auf Zahlung des vollen Nennwertes von 56 Mio. US-Dollar und beantragte einen Vollstreckungstitel zur Beschlagnahme peruanischer Aktiva in den USA sowie in Belgien. Die peruanische Regierung hatte nicht genügend Zeit, um gegen die bereits erwirkten Vollstreckungstitel gerichtlich vorzugehen. Vor diesem Hintergrund zahlte Peru.[20] Die Vorschläge von Krueger, von der Financial Times zu Recht als Paukenschlag bezeichnet, folgen der Idee eines internationalen Insolvenzverfahrens. Überschuldete Länder sollen demnach in Absprache mit dem IWF für mehrere Monate die Zahlung von Zinsen und Tilgung einstellen können. In der Zeit dieses Zahlungsstillstandes (standstill) sollten die Länder zur Verhinderung von Kapitalflucht auch Kapitalverkehrskontrollen erlassen können. Anne Krueger verspricht sich davon eine disziplinierende Wirkung auf Gläubiger. Bereits die Existenz eines Mechanismus zur Regelung staatlicher Insolvenz könnte zu einem Rückgang der Kapitalströme in Entwicklungs- und Schwellenländer führen: Dies wäre aber nach Ansicht Kruegers ein willkommener Nebeneffekt, insbesondere dann, wenn eine genauere Risikoprüfung die Ursache sinkender Kapitalzuflüsse wäre.[21] Der Vorstoß des IWF in der Frage der Gläubigereinbindung ist ebenso überraschend wie begrüßenswert. Nach langem Zögern hat der IWF akzeptiert, dass Maßnahmen zur geregelten Einbindung des privaten Sektors zur Überwindung von Schuldenkrisen nötig sind. Dies ist jedoch nur der erste Schritt. Folgende Punkte bedürfen der Beachtung: - Das von Krueger vorgeschlagene Verfahren funktioniert nur, wenn es in nationales Recht der Mitgliedstaaten übertragen wird. Dies ist keine kleine Hürde. - Zu klären ist, welche Form das Insolvenzgericht haben soll. Krueger sieht den IWF in der besten Position, aber nicht jedes Land mag eine derartige Ausweitung des Tätigkeitsfeldes des Fonds begrüßen. - Die Festlegung von Kriterien, die zur Erklärung der Zahlungsunfähigkeit erfüllt sein müssen, dürfte für einige Diskussionen sorgen. Sollte hier ein einheitlicher Katalog gewählt werden oder vertraut man eher auf eine fallweise Feststellung der Zahlungsunfähigkeit? - Schließlich müssen während des Schuldenmoratoriums Maßnahmen getroffen werden, die eine Wiederholung der prekären Situation verhindern. Welche Wirtschaftspolitik ist geeignet, eine neuerliche Schuldenkrise zu verhindern? Die Entwicklung in den kommenden Jahren wird zeigen, ob dieser Vorschlag realisiert werden wird. Anne Krueger betrachtet es zu Recht als ungewiss, ob die Mitgliedsstaaten 20 des Fonds bereit sein werden, die Rechte ihrer Bürger, gegen eine ausländische Regierung vor eigenen Gerichten zu klagen, zu beschränken. Die Einschränkung wäre, so Krueger, der Preis für eine stabilere und daher wohlhabendere Weltwirtschaft.[22] 2. Anleiheklauseln Im Vergleich zum internationalen Insolvenzverfahren weniger radikal wäre die Einführung von Mehrheitsklauseln in Anleiheverträgen. Im internationalen Finanzierungsgeschäft haben Anleihen gegenüber Bankkrediten an Bedeutung gewonnen. Vor den Schuldenkrisen der achtziger Jahre wurden an staatliche Schuldner in Entwicklungs- und Schwellenländern vor allem Kredite mittlerer Laufzeit vergeben, die von Bankkonsortien bereitgestellt wurden. 1980 machten diese Kredite nahezu 100 Prozent der Neuverschuldung von staatlichen Schuldnern auf internationalen Finanzmärkten aus. Ende der neunziger Jahre fiel dieser Anteil auf weniger als 20 Prozent, während Anleihen souveräner Schuldner entsprechend an Bedeutung gewannen.[23] Die wachsende Präferenz für Anleihen basierte auch auf der Überlegung, dass diese Schuldentitel nur sehr schwer umzuschulden sind und souveräne Schuldner daher alles tun würden, eine Umschuldung zu vermeiden.[24] Nach den Anleihen staatlicher Schuldner gewannen in den neunziger Jahren auch private Anleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern an Bedeutung. Diese Verschiebung hin zu Anleihen führte zu neuen Problemen bei der Bewältigung von Schuldenkrisen. Gläubiger sind heute in der Regel Tausende von Anleihebesitzern, deren Entscheidungen nur schwer koordiniert werden könnten. Deshalb ist es wichtig, auch Anleiheverträge krisenfester zu machen. Notwendig sind Klauseln in Anleiheverträgen, die Mehrheitsentscheidungen ermöglichen. Durch Mehrheitsentscheidungen der Halter von Anleihen - statt, wie bisher, Einstimmigkeit - kann die Umschuldung im Krisenfall, häufig verbunden mit Forderungsverzicht, deutlich erleichtert werden.[25] Eine diesbezügliche Regelung gibt es bereits in Großbritannien. Bei dort emittierten Anleihen können Schuldennachlässe beschlossen werden, wenn mindestens 70 Prozent der Anleihebesitzer der Umschuldungsvereinbarung zustimmen. Auch Luxemburg verfügt schon über "collective action clauses". Zu Kollektivklauseln haben sich der IWF, aber auch die amerikanische Regierung bereits unterstützend geäußert.[26] IV. Warum einen "lender of last resort"? Beim Management von Finanzkrisen sollte aber vor der Umschuldung und Restrukturierung versucht werden, den Ausbruch einer Krise zu vermeiden. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Bereitstellung von Liquidität. Soll der IWF in künftigen Finanzkrisen Liquidität schneller und großzügiger bereitstellen? Nach der Asienkrise hat der IWF neue Instrumente entwickelt, um schneller auf Liquiditätskrisen reagieren zu können. 1997 wurde die Supplemental Reserve Facility (SRF) geschaffen, 1999 folgte das Instrument der Contingent Credit Lines (CCL). SRF sind Kredite, die an Mitgliedsländer vergeben werden, die wegen eines plötzlichen Verlustes von Vertrauen der Finanzmärkte in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten sind. Die CCL sollen als finanzielles Schutzschild vor der Gefahr von so genannten Ansteckungseffekten dienen. Bei Finanzkrisen in Nachbarländern soll Liquidität vorsorglich bereitgestellt werden. Der Hintergrund dieser Fragen ist, dass zumindest einige der jüngsten Finanzkrisen durch Liquiditätsengpässe verursacht wurden. Die betroffenen Volkswirtschaften waren temporär illiquide, aber nicht insolvent, wie beispielsweise Südkorea. Nach der Bereitstellung von Liquidität erholte sich die Ökonomie sehr schnell. In derartigen Fällen führt die verzögerte Bereitstellung von frischer Liquidität zu einer vermeidbaren Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Teilt man die Einschätzung, dass Liquidität rascher als bisher bereitgestellt werden sollte, muss die Form einer solchen Hilfe genauer festgelegt werden. Drei Optionen stehen zur Verfügung: a) Der IWF könnte, wie in der Vergangenheit, Liquidität in begrenztem Umfang und nur in Verbindung mit Auflagen bereitstellen; b) alternativ könnten sich Länder vorab für ebenfalls begrenzte Liquiditätshilfen qualifizieren. Dies ist der für die CCL gewählte Ansatz; allerdings hat sich noch kein Land dafür beworben; c) schließlich ist es denkbar, dass der IWF zu einem "Gläubiger der letzten Instanz"[27] 21 weiterentwickelt wird. Dies würde bedeuten, dass sich IWF-Mitgliedsländer ohne Auflagen beim Fonds unbeschränkt mit Liquidität versorgen können.[28] Die dritte Option ist sowohl die radikalste als auch die einfachste. Sie schafft im internationalen Raum das, was in nationalen Finanzmärkten in Form der Zentralbanken existiert. Walter Bagehot, englischer Ökonom und langjähriger Herausgeber des "Economist", hat im 19. Jahrhundert die Bedingungen für einen "lender of last resort" formuliert. Dieser sollte großzügig, zu hohen Zinsen und gegen gute Sicherheiten Kredite vergeben.[29] Volkswirtschaften würden Zugang zu Liquidität bekommen, wenn sie bereit wären, Zinsen oberhalb der jeweiligen Marktzinssätze zu bezahlen und angemessene Sicherheiten leisten könnten. Stanley Fischer, bis zum Sommer 2001 Vize-Chef des IWF, hat in dieser Debatte auf die Eigendynamik einer Finanzkrise hingewiesen. Die nationale Notenbank kann die vom Privatsektor und von der öffentlichen Hand benötigten Devisen nicht bereitstellen, da sie nicht über unbegrenzte Devisenreserven verfügt. In dieser Situation hilft nur ein internationaler "Gläubiger der letzten Instanz". Fischer begründet die Forderung nach einem internationalen "Gläubiger der letzten Instanz" damit, dass internationale Kapitalströme sehr beweglich sind und dass diese Volatilität ansteckend ist. Die den Finanzmärkten innewohnende Instabilität kann durch einen internationalen "Gläubiger der letzten Instanz" möglicherweise schon im Ansatz unterbunden werden.[30] Die Umsetzung dieses Vorschlages stößt aber sowohl auf konzeptionelle als auch auf politische Hemmnisse. Relativ unproblematisch ist die Findung eines angemessenen Zinssatzes. Dieser müsste höher sein als in Nicht-Krisenzeiten, aber niedriger als die von Geschäftsbanken in der Krise verlangten Sätze. Schwierig hingegen ist die Bereitstellung angemessener Sicherheiten. Hier ist eine Unterscheidung zwischen einer temporären Liquiditätskrise und einer Solvenzkrise zu machen. Für einen Kreditgeber ist es in einer Krisensituation sehr schwer, die künftigen Deviseneinnahmen zu beurteilen. Am leichtesten fällt dies noch bei Rohstoffexporten.[31] Bei anderen Exporten sind Sicherheiten weniger leicht auszumachen. Selbst wenn es gelänge, in ausreichendem Maß Sicherheiten bereitzustellen, müsste zudem noch geklärt werden, wie verfahren werden soll, falls die Liquiditätshilfen nicht ausreichen und das Land in eine Solvenzkrise geraten sollte. Dem "Gläubiger der letzten Instanz" müsste dann die Möglichkeit eingeräumt werden, auf diese Sicherheiten zurückzugreifen. Dazu ist ein internationales Insolvenzgericht oder ein anderes geordnetes Verfahren vonnöten.[32] Jenseits dieser konzeptionellen Probleme wären zudem erhebliche politische Hemmnisse zu überwinden. Der Einfluss der OECD-Länder würde erheblich sinken, weil Kredite des IWF nicht mehr zur Erlangung von politischen Konzessionen genutzt werden könnten. Der Fonds würde in erster Linie ein Instrument, auf das seine Mitgliedsländer in Notfällen zurückgreifen können, ohne sich dem Fonds unterwerfen zu müssen. Fraglos besteht gegenwärtig eine größere Bereitschaft, die internationalen Finanzbeziehungen gerechter zu gestalten. Die Weiterentwicklung des IWF zu einem globalen "lender of last resort" übersteigt aber die Bereitschaft der meisten Akteure zu weit reichenden Reformen. Dennoch ist die Forderung nach einem internationalen "Gläubiger der letzten Instanz" letztlich nur konsequent: Wenn globale Finanzmärkte geschaffen werden, verlieren nationale Notenbanken wichtige Instrumente, die dann auf globaler Ebene bereitgestellt werden müssen. Umgekehrt heißt dies: Solange der globale "lender of last resort" fehlt, ist die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen gefährlich. Zugleich wird immer deutlicher, dass der Verzicht auf den Ausbau des IWF zu einem "Gläubiger der letzten Instanz" Ländergruppen dazu zwingt, eigene Systeme zur Sicherung der Liquidität zu entwickeln. Besondere Anstrengungen werden hier in Ostasien unternommen. Ostasiens Volkswirtschaften, deren Zentralbanken Währungsreserven von 1 200 Mrd. US-Dollar halten, bauen gegenwärtig ein Netzwerk von Vereinbarungen auf, um sich in kommenden Krisen gegenseitig zu helfen. Dies reduziert natürlich die Bedeutung des IWF. Aus Sicht der Betroffenen ist das aber zweitrangig, denn zunächst ist für diese Länder wichtig, dass ein regionaler "Gläubiger der letzten Instanz" einen Ersatz für einen globalen "Gläubiger der letzten Instanz" bieten kann. 22 V. Rollover-Optionen und Beschränkungen des internationalen Kapitalverkehrs 1. Rollover-Optionen Bei einigen Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit haben sich Finanz- und Währungskrisen gegenseitig verstärkt. Die Aufkündigung von Kreditverträgen führte zu Kapitalabflüssen und damit zu einem Druck auf den Wechselkurs. Erst bei Eintritt einer Finanzkrise über die Einbindung von Kreditgebern zu verhandeln, ist ordnungspolitisch falsch. Sinnvoll sind vielmehr Maßnahmen, die den Schuldnern selbst die Möglichkeit geben, auf Stabilisatoren zurückzugreifen. Zwei britische Ökonomen haben dazu 1999 einen Vorschlag gemacht: "Universal Debt-Rollover Options with a Penalty" (UDROP). Die Idee ist recht simpel: Schuldner können sich entscheiden, einen Kredit bei Fälligkeit um drei oder sechs Monate zu verlängern. Der Preis für diese Umschuldung (penalty) wird bereits bei Abschluss des Kreditvertrages festgesetzt. Das Ziel der UDROP ist, durch Panik verursachte Liquiditätskrisen zu verhindern.[33] Erreicht werden soll, dass Schuldner bis zur Erreichung geordneter Marktverhältnisse von der Schuldenrückzahlung befreit sind, die Schuld also gestundet wird.[34] UDROP sollen für alle in Fremdwährung denominierten Kredite gelten. Erfasst werden sollen sowohl private als auch staatliche Kreditaufnahmen mit kurzer und langer Laufzeit. Überziehungskredite sind ebenso zu berücksichtigen.[35] Dieses Konzept weist eine Reihe von Vorzügen auf. Erstens sind UDROP-Maßnahmen klassische Ordnungspolitik: Der Staat legt Rahmenbedingungen fest und überwacht ihre Einhaltung, ist aber in die Umsetzung nicht eingeschaltet. Zweitens würden UDROP sehr rasch zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Liquiditätskrisen beitragen. Drittens haben UDROP auch einen positiven, stabilisierenden Einfluss auf Wechselkurse. Insbesondere bei flexiblen Kursen kann ein deutlicher Abfluss von Devisen zur Bedienung von plötzlich fällig gestellten ausländischen Krediten für einen erheblichen Druck auf den Wechselkurs sorgen.[36] Darüber hinaus ist die Notwendigkeit, bereits bei Abschluss des Vertrages einen Preis für die Umschuldungsoption zu finden, ein positiver Nebeneffekt. Dies zwingt Schuldner und Gläubiger, die Risiken eines Kredits zu bewerten. In der Vergangenheit haben Gläubiger zu oft die Risiken einer Kreditvergabe ignoriert - häufig in der Annahme, dass es im Falle einer Kreditkrise zu öffentlichen Hilfen kommen würde. Mit der Einführung von UDROP könnte deutlich gemacht werden, dass staatliche Hilfen nicht gewährt werden würden, mithin eine angemessene Risikoprüfung durch die Gläubiger notwendig ist. Gleichwohl haben auch Rollover-Optionen nennenswerte Nachteile: Möglicherweise steigen die Kosten für Auslandskredite.[37] Dies ist allerdings nicht nur negativ zu bewerten, da damit Kreditaufnahmen im Inland - relativ zu Auslandskrediten -billiger werden. Inlandskredite in eigener Währung sind naturgemäß wesentlich weniger riskant als Fremdwährungskredite. Insgesamt erscheinen die Vorteile von UDROP die Nachteile erheblich zu übersteigen. Gewiss ist dieses Konzept kein AIlzweckmittel zur Verhinderung von Finanzkrisen, aber es trägt zur Stabilisierung von Finanzmärkten bei, ohne den Akteuren auf Finanzmärkten inakzeptable Lasten aufzubürden. 2. Kapitalverkehrskontrollen zur Krisenprävention Der langsame Fortschritt bei der Entwicklung stabilerer internationaler Finanzmärkte unterstreicht die Bedeutung von auf nationaler Ebene implementierbaren Maßnahmen zur Krisenprävention. Als Paradebeispiel werden hierbei immer wieder die Maßnahmen Chiles genannt.[38] Das Ziel dieser Maßnahmen ist die Beschränkung des Zuflusses von nur kurzfristig gebundenem Kapital. Durch die Förderung von langfristiger Anlage soll das Risiko eines panikartigen Abzugs von Kapital reduziert werden. Chile hat nach den Erfahrungen der schweren Finanzkrisen in den siebziger und achtziger Jahren 1991 eine umfassende Bardepotpflicht eingeführt. Zunächst 20, später 30 Prozent einer Kreditaufnahme im Ausland oder einer im Ausland aufgenommenen Anleihe mussten zinslos bei der Zentralbank hinterlegt werden. Damit wurden zum einen Kapitalzuflüsse verstetigt und zum anderen der inländische Finanzsektor gestärkt. Eine Bardepotpflicht wirkt wie eine effiziente Steuer auf Kreditaufnahmen im Ausland (vgl. Tab. 2). Die Ergebnisse des chilenischen Ansatzes sind überzeugend. Zunächst fällt auf, dass es in den neunziger Jahren in Chile keine Finanzkrise gab, trotz schwerer Turbulenzen in der 23 Region. Ein wesentlicher Grund für diese Stabilität ist die veränderte Komposition der Kapitalzuflüsse. Während 1989 nur fünf Prozent der im Ausland aufgenommenen Kredite eine Laufzeit von mehr als zwölf Monaten hatten, war dieser Anteil acht Jahre später auf 97,2 Prozent gewachsen. Dies wurde erreicht, ohne Chile von den internationalen Finanzmärkten abzukoppeln. Die Kapitalzuflüsse wuchsen vielmehr von 1,52 Mrd. USDollar im Jahr 1989 auf 2,89 Mrd. US-Dollar im Jahr 1997.[39] Die Bardepotpflicht in Chile begünstigt langfristige Kredite, da nach einem Jahr das Bardepot erstattet wird. Je länger die Laufzeit eines Kredits, desto geringer ist also die Belastung durch die Bardepotpflicht. Der Umfang der Bardepotpflicht war geringer, als man dies auf den ersten Blick erwarten könnte. Erfasst wurden lediglich 40 Prozent der Kapitalzuflüsse. Dies liegt zum einen an der Freistellung bestimmter Zuflüsse, z. B. von ausländischen Direktinvestitionen, zum anderen an Lücken in der Regulierung.[40] Die Anwendbarkeit von Importkontrollen sollte jedoch nicht überschätzt werden. Sie funktionieren in Ökonomien mit solider Geld- und Fiskalpolitik. Aber in Volkswirtschaften mit einer insgesamt instabilen und hektischen Wirtschaftspolitik kann auch eine Bardepotpflicht nicht für Stabilität sorgen. 3. Kapitalverkehrskontrollen in einer Finanzkrise Kapitalzuflusskontrollen werden inzwischen von vielen Beobachtern als wichtiges Mittel zur Krisenprävention, d. h. vor allem zur Stabilisierung der Finanzmärkte in Entwicklungs- und Schwellenländern, akzeptiert. Kein Konsens besteht aber hinsichtlich der Nutzung von Kapitalverkehrskontrollen zur Bekämpfung von Finanzkrisen. Von vielen Beobachtern wird unterstellt, dass die Einführung von Beschränkungen des Kapitalverkehrs inmitten einer Krise eher krisenverschärfend wirkt. Hier ist es hilfreich, die Erfahrungen Malaysias im Jahre 1998 genauer zu betrachten. Die Regierung Malaysias erließ am l. September 1998 umfassende Kapitalverkehrskontrollen, also mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Asienkrise. Daher findet sich oft die Einschätzung, Malaysias Kapitalverkehrskontrollen seien zu spät eingeführt worden, die Krise sei ohnehin schon nahezu überwunden gewesen und das Nachbarland Thailand habe sich auch ohne diese Maßnahmen rasch und dauerhaft erholt. Eine neuere Untersuchung kommt hingegen zu einem anderen Ergebnis. Zunächst wurde die Situation Malaysias vor Einführung der Kapitalverkehrskontrollen untersucht und gefragt, ob die Krise tatsächlich schon überwunden war. Im Gegensatz zur geläufigen Annahme stellen die Autoren eine Zunahme der Instabilität in den ersten acht Monaten des Jahres 1998 fest. Insbesondere stiegen die Zinsen für Kredite in Offshore-Märkten für malaysische Ringgit von sechs Prozent im Januar 1998 auf 23 Prozent im August 1998.[41] Vor diesem Hintergrund, also der messbaren Zunahme von Instabilitäten auf den Finanzmärkten vor Erlass der Kapitalverkehrskontrollen, ist das Ergebnis der Maßnahmen Malaysias sehr positiv. Der Wechselkurs wurde stabilisiert und das inländische Zinsniveau konnte weit genug sinken, um inländische Investitionstätigkeit anzuregen. Zudem wurden die Kapitalverkehrskontrollen so gestaltet, dass weder ausländische Direktinvestitionen noch der Außenhandel davon betroffen waren.[42] Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass die Kapitalverkehrskontrollen nur vorübergehend angewendet wurden. Anders als dies der IWF angenommen hatte, führten die Maßnahmen nicht dazu, dass Malaysia auf Jahre hinaus von den Akteuren auf internationalen Finanzmärkten gemieden wurde. Bereits im Mai 1999, also weniger als ein Jahr nach Beginn der Kontrollen, platzierte Malaysia erfolgreich eine Anleihe im Umfang von 1,0 Milliarden US-Dollar. Es zeigt sich also, dass vernünftig implementierte Kapitalverkehrskontrollen einen bedeutenden Beitrag zur Überwindung einer Finanzkrise leisten können. Dies ist eine wichtige Lektion für den IWF, der in den Fällen, wo er aktiv an der Formulierung eines Maßnahmenpakets beteiligt war, stets auf Austeritätspolitik setzte und Kapitalverkehrskontrollen als schädlich ansah. VI. Die ordnungspolitische Gestaltung der Globalisierung tut Not Lange Zeit verhallte der Ruf nach einer Stärkung der Regulierung von Märkten ungehört. In nahezu allen OECD-Ländern genoss Deregulierung und Liberalisierung den höchsten Stellenwert. Insbesondere die Finanzmärkte wurden dabei zu sehr sich selbst überlassen. 24 Die logische Folge der Internationalisierung der Finanzmärkte ist aber die Übertragung bestimmter Strukturen aus dem nationalen Raum auf die globale Ebene. Hierzu gehören die Schaffung eines internationalen Gläubigers der letzten Instanz ebenso wie die Schaffung von regelgebundenen Strukturen zur Einbeziehung von Kreditgebern in die Lösung von Finanzkrisen. Die Gestaltung der Globalisierung ist eine politische Aufgabe. Es ist unrealistisch, von Märkten eine vollständige Selbstregulierung zu erwarten. Die Regierungen der Europäischen Union sollten sich dieser Verantwortung stellen und sich nachdrücklich für eine ordnungspolitische Initiative einsetzen. Europa könnte eine führende Rolle bei der Neuordnung der internationalen Finanzmärkte spielen. Nach der erfolgreichen Einführung des Euro fällt das Fehlen einer gemeinsamen auswärtigen Finanzpolitik der EU auf. Während die EU auf dem Gebiet der Handelspolitik seit Jahren mit einer Stimme spricht, gibt es auf dem Gebiet der auswärtigen Finanzpolitik einen vielstimmigen Chor. Zu fragen ist, welches Interesse die EU an einer stabileren Weltfinanzordnung haben könnte. Zwei Gründe sind zu nennen: Erstens ist die EU der Welt größte Handelsmacht und leidet mehr als jeder andere Akteur unter von Finanzkrisen verursachten Turbulenzen im Welthandel. Stabile Finanzmärkte und nur wenig schwankende Wechselkurse begünstigen internationalen Warenhandel. Zweitens wächst mit der Osterweiterung der EU die Gefahr von Finanzkrisen in der Union selbst. Ein ordnungspolitischer Rahmen, der Finanzkrisen zu verhindern hilft, liegt im Interesse der EU. Bislang war Europa nicht willens, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die USA stehen Vorschlägen zur Re-Regulierung der Finanzmärkte auch nach dem 11. September eher kritisch gegenüber. Zwar sind einige neue Töne aus Washington zu hören. Diese beziehen sich allerdings meist auf Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, einem sehr kleinen Bereich. Die USA verfügen zudem über die aggressivsten und wettbewerbfähigsten Akteure auf den Finanzmärkten. Es erscheint unrealistisch, gerade von den USA eine Initiative zur Neuordnung der Finanzmärkte zu erwarten. Politisch brisant ist ein solches Vorhaben fraglos. Die Widerstände gegen eine Regulierung und gegen eine stärkere Kontrolle der Finanzmärkte sind ohne Zweifel erheblich. Die in den letzten Jahren sprunghaft gewachsene Finanzwirtschaft würde der Beschränkung ihrer Operationsfelder energischen Widerstand entgegensetzen. Gleichwohl würden sehr viele Menschen von stabileren internationalen Finanzmärkten profitieren, und zwar nicht nur die unmittelbar von Finanzkrisen betroffene Bevölkerung. Eine ordnungspolitisch gestaltete Globalisierung eröffnet der großen Mehrheit der Weltbevölkerung die Chance auf mehr Wohlstand. Fußnoten 1 Vgl. hierzu Stephany Griffith-Jones, Global Capital Flows: Should they be regulated?, Houndmills 1998, S. 38 f. Vgl. Harold James, The End of Globalization, Cambridge, Mass. 2001. Vgl. Heiner Flassbeck/Claus Noé, Abkehr vom Unilateralismus, in: BIätter für deutsche und internationale Politik, (2001) 11, S. 1367. 2 3 4 Vgl. Michael Frenkel/Lukas Menkhoff, Stabile Weltfinanzen. Die Debatte um eine neue internationale Finanzarchitektur, Berlin - Heidelberg 2000, S. 66. 5 Vgl. Commission of the European Communities, Responses to the Challenges of Globalization: A Study on the International Monetary and Financial System and on Financing for Development. Working document from the Commission Services, Brüssel, 13. Februar 2002, DOC/02/04, S. 44; Paul Bernd Spahn, Zur Durchführbarkeit einer Devisentransaktionssteuer, Gutachten im Auftrag des BMZ, Frankfurt/M., Februar 2002, S. 4. 6 Vgl. Robert Shiller, Irrational Exuberance, Princeton 2000, S. 227. 7 Vgl. ebd. 8 Vgl. Karl-Heinz Paqué, Kein Bedarf an Sand im Getriebe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. 10. 2001. Vgl. Commission of the European Communities (Anm. 5), S. 44. 10 Der Wechselkurs des Rand sank von acht Rand pro Dollar im Juli 2001 auf zwölf Rand pro Dollar im Dezember 2001. 11 Vgl. Commission of the European Communities (Anm. 5), S. 91. 25 Vgl. H. Flassbeck/C. Noé (Anm. 3), S. 1368. Vgl. Commission of the European Communities (Anm. 5), S. 91. Vgl. P. B. Spahn (Anm. 5), S. 21-28. Vgl. ebd., S. 27. 12 13 14 15 16 Vgl. Kunibert Raffer, Applying Chapter 9 Insolvency to International Debts: An Economically Efficient Solution with a Human Face, in: World Development, (1990) 2, S. 301-311. Vgl. ebd., S. 302. Vgl. ebd., S. 304. 17 18 19 Brady Bonds wurden 1989 entwickelt. Sie entstanden aus restrukturierten Bankkrediten: Diese wurden in Wertpapiere umgewandelt, also verbrieft. Die Brady Bonds verdanken ihren Namen Nicholas Brady, dem damaligen USFinanzminister. Brady Bonds haben meist lange Laufzeiten und die verschiedensten Arten der Zinsausschüttung. Vgl. Anne Krueger, International Financial Architecture for 2002: A New Approach to Sovereign Debt Restructuring. Address given at the American Enterprise Institute, 26. 11. 2001 (www.imf.org/extemal/np/speeches/2001/112601.htm). Vgl. ebd. Vgl. ebd. Vgl. Gabrielle Lipworth/Jens Nystedt, Crisis Resolution and Private Sector Adaptation, in: Finance and Development, (June 2001). Vgl. ebd. 20 21 22 23 24 25 Vgl. Stanley Fischer, On the Need for an International Lender of Last Resort. Essays in International Finance, No. 220 (November 2000), Department of Economics, Princeton University, S. 22. Vgl. ebd. 26 27 Im engeren Sinn kann es auf globaler Ebene natürlich keinen "lender of last resort" geben, da dies an die Fähigkeit zur Geldschöpfung gebunden ist. Solange es kein einheitliches Geld auf der ganzen Welt gibt, wird auch ein sehr gut ausgestatteter IWF immer nur ein "quasi-lender of last resort" sein können. In der Praxis dürfte diese Unterscheidung unerheblich sein. Vgl. S. Fischer (Anm. 25). Bagehot sprach von "lend freely, at penalty rates, against good collateral"; vgl. ebd., S. 9. Vgl. ebd., S. 16. 28 29 30 26 So haben die USA 1995 Mexiko großzügig Kredite bereitgestellt, sich aber die Einnahmen aus den künftigen Erdölexporten vertraglich gesichert. Vgl. den Vorschlag von IWF-Vize Anne Krueger. 31 32 33 Vgl. Willem Buiter/Anne Sibert, UDROP - A Small Contribution to the New International Financial Architecture. Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, Working Paper, Mai 1999. Vgl. ebd., S. 3. Vgl. ebd. 34 35 36 Dies gilt natürlich analog auch für feste Wechselkurse. Eine Zentralbank kann bei hoher Auslandsverschuldung rasch an die Grenzen ihrer Devisenreserven geraten, wenn infolge einer Panik auf den Märkten Devisen in erheblichem Umfang zur Bedienung der Außenschulden benötigt werden. 37 Langfristig können die Finanzierungskosten allerdings auch sinken, da das Finanzsystem stabilisiert wird und damit die Risikoaufschläge abnehmen können. Slowenien ist ein weiteres, aber weniger bekanntes Beispiel. 38 39 Vgl. Sebastian Edwards, Exchange Rate Regimes, Capital Flows and Crisis Prevention. Paper prepared for the National Bureau of Economic Research Conference on Economic and Financial Crises in Emerging Market Economies, Woodstock, Oktober 2000. 40 Vgl. Carlos Massad, The Liberalization of the Capital Account: Chile in the 1990s, Essays in International Finance, No. 207, Mai 1998, S. 34-46. Vgl. Ethan Kaplan/Dani Rodrik, Did the Malaysian Capital Controls Work?, NBER working paper 8142; im Internet: www.nber.org/papers/w8142.pdf. Vgl. ebd., S. 11. 41 42 Quelle: http://www.bpb.de/themen/PTTFHY.html Weltwirtschaft und internationale Arbeitsteilung Gefördert durch die Idee des Wirtschaftsliberalismus weitete sich im 19. Jahrhundert der Welthandel aus. Nach dem 2. Weltkieg wurden mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1948) die Voraussetzungen für eine zunehmende Liberalisierung des Welthandels geschaffen. Auszug aus: Globalisierung, Informationen zur politischen Bildung (Heft 280) Georg Koopmann / Fritz Franzmeyer Einleitung Grundlage modernen Wirtschaftens ist die Arbeitsteilung. Sie führt zu Tausch oder - in 27 der Geldwirtschaft - zu Handel. Reger Handel ist daher Ausdruck hoch entwickelter Arbeitsteilung. Dabei bringt internationale Arbeitsteilung insgesamt bessere Ergebnisse hervor als eine Arbeitsteilung, die nur im nationalen Rahmen stattfindet. Nach diesem Konzept spezialisiert sich nämlich diejenige Wirtschaftskraft auf die Produktion eines Gutes bzw. einer Dienstleistung, die dies aus ökonomischer Sicht relativ am besten kann, das heißt zu den geringsten Produktionskosten. Kern der Globalisierung ist die Ausweitung internationaler Arbeitsteilung. Dabei bilden sich weltweite Märkte heraus, auf denen Waren und Dienstleistungen gehandelt, Investitionen getätigt, Technologien übertragen und Informationen ausgetauscht werden. Internationale Arbeitsteilung ermöglicht es den einzelnen Ländern, ihre unterschiedlichen Stärken auszuspielen und dadurch Einkommensgewinne zu erzielen. Allerdings kennt die Globalisierung nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. In den Ländern, die relativ reichlich mit Kapital und qualifizierten Arbeitskräften ausgestattet sind, steigen die Kapitaleinkommen tendenziell stärker als die Arbeitseinkommen, und die Spreizung der Löhne zwischen einfacher und qualifizierter Arbeit nimmt zu. Hieraus können Spannungen in den einzelnen Ländern und zwischen ihnen entstehen, die den Sozialstaat westlicher Prägung in ein Dilemma stürzen. Denn bei dem Versuch, die Einkommensverteilung zu Lasten der Arbeitnehmerschaft, die sich aus der Globalisierung ergeben kann, wieder zu korrigieren, sind dem Staat gerade wegen der Globalisierung die Hände gebunden. Eine schärfere Besteuerung von Kapitaleinkommen könnte zum Beispiel das Kapital dazu veranlassen, in andere Länder abzuwandern, und damit den Handlungsspielraum für die Lohnpolitik so stark einengen, dass am Ende die angestrebte Korrektur nicht zu Stande kommt und die Regierung in der "Globalisierungsfalle" gefangen ist. Tatsächlich ist der Anteil von Kapital- und Vermögenssteuern am gesamten Steueraufkommen in fast allen Industrieländern deutlich gesunken. Auch hat die Spreizung der Einkommen in den Industrieländern zugenommen. Dies ist allerdings faktisch weniger der Globalisierung anzulasten als technologischen Entwicklungen, die gering qualifizierte Arbeitskräfte benachteiligen. Entwicklungsländer werden durch die Globalisierung in die Lage versetzt, sich auf die Herstellung arbeitsintensiver Produkte wie zum Beispiel Bekleidungserzeugnisse zu spezialisieren, dabei die Löhne zu erhöhen und die Einkommensverteilung zu verbessern. Tatsächlich haben Länder, die sich wirtschaftlich geöffnet haben, meist ein höheres Wachstum erreicht und die Armut stärker reduziert als Länder, die sich der Öffnung verweigert haben. Das Problem für alle am Globalisierungsprozess beteiligten Staaten ist, dass sie sich stets aufs Neue wechselnden Bedingungen anpassen müssen und sich dabei vielfach überfordert fühlen. Historische Erfahrungen Voraussetzung für internationale Arbeitsteilung ist die unterschiedliche Ausstattung der Länder mit Energieträgern, Rohstoffen, Boden, Kapital und Arbeitskraft (Produktionsfaktoren). Daraus resultieren von Land zu Land verschiedene Preisverhältnisse zwischen den mit den Produktionsfaktoren hergestellten Erzeugnissen wenn die Grenzen geschlossen sind. Wenn die Grenzen geöffnet werden, spezialisieren sich die Staaten auf die Produktion derjenigen Güter, die sie preiswerter anbieten können als andere Länder. Dies ist die Quelle der Wohlfahrtsgewinne, die aus internationaler Arbeitsteilung entstehen; sie gründen auf Unterschieden in den relativen Preisen und komparativen Kosten zwischen den an ihr beteiligten Ländern. Geschlossene Volkswirtschaften hat es kaum je gegeben. Bereits in der Antike wurde innerhalb der zugänglichen Welt mit Gewürzen, orientalischen Stoffen, Gold, Silber und Edelsteinen gehandelt. Die einzelnen Volkwirtschaften sind allerdings niemals völlig, sondern immer nur mehr oder weniger offen für internationalen Handel. Der Grad der Offenheit ist abhängig von der jeweiligen Wirtschaftsphilosophie, von den inneren Konflikten und dem internationalen Spannungsreichtum der Zeit. Im 17. und 18. Jahrhundert war der Merkantilismus weit verbreitet. Als Merkantilismus werden die wirtschaftspolitischen Lenkungsmaßnahmen bezeichnet, die die Staaten in jener Zeit zur Steigerung der nationalen Wirtschafts- und Handelskraft unternahmen. Vor allem England, Frankreich, Preußen und Spanien setzten alles daran, Gold und Geld im 28 Lande zu mehren, indem sie möglichst viele Güter selbst herstellten und exportierten, aber möglichst wenige importierten. Andere Länder wurden so daran gehindert, ihrerseits zu exportieren, Fremdwährung zu verdienen und sie in Importe umzusetzen. Insgesamt konnte sich der internationale Handel deshalb nicht entfalten; Gold und Geld flossen spärlicher, als die Merkantilisten es sich gedacht hatten. Der Merkantilismus wurde im 19. Jahrhundert durch den Liberalismus abgelöst. Die Theorie des Wirtschaftsliberalismus, der Arbeitsteilung und des Freihandels, die den Merkantilismus schließlich auch in der wirtschaftspolitischen Realität überwand, geht auf die britischen Nationalökonomen Adam Smith (1723-1790) und David Ricardo (17721823) zurück. Grundlegend war das Theorem der "komparativen Kosten". Danach sind internationaler Handel und internationale Arbeitsteilung selbst für solche Länder von Vorteil, die alle Güter zu geringeren Kosten erzeugen können als das Ausland. Sie müssen sich nur auf die Produktion jener Güter spezialisieren, die sie relativ (komparativ) am günstigsten herstellen können. Das hieraus abgeleitete Freihandelspostulat wurde von dem deutschen Nationalökonomen Friedrich List (1789-1846) allerdings durch das "Schutzzollargument" relativiert. Danach gibt es gute Gründe dafür, schwächere Länder in ihrer frühen Entwicklungsphase noch nicht massiv dem harten internationalen Wettbewerb auszusetzen. Vor allem junge Industrien (infant industries) sollten auch dann geschützt werden dürfen, wenn die Handelspartner ihre eigenen Grenzen bereits weit für Importe geöffnet haben. Mit der Idee des Liberalismus begann das Zeitalter der wirtschaftlichen Globalisierung. Eine erste Blüte erreichte der internationale Handel nach den napoleonischen Kriegen und besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit dem deutschen Zollverein, der handelspolitischen Einigung deutscher Staaten zur Herstellung einer deutschen Wirtschaftseinheit ab 1834, waren - bei wenigen Ausnahmen - im gesamten späteren Reich die wesentlichen Handelshemmnisse beseitigt worden. Die Rahmenbedingungen waren stabil; im Großen und Ganzen herrschte Frieden. Neue Techniken begünstigten eine sowohl umfangreichere als auch arbeitsteiligere Produktion. Transporte auf große Distanz wurden schneller, billiger und sicherer. Die Handelsnationen verständigten sich auf das Gold als Fundament für den internationalen Zahlungsverkehr (Goldstandard). Diese Tendenz zur außenwirtschaftlichen Liberalisierung wurde durch restaurative Kräfte (Bismarcks Schutzzollpolitik) insgesamt nur wenig beeinträchtigt. Die Zeit von der Gründung des Deutschen Reiches 1871 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 gilt als die Phase des Aufstiegs der Handelsglobalisierung und die Schlussetappe dieser Phase (1895-1914) als das "Goldene Zeitalter" des Freihandels. Der Außenhandel (gemessen als Durchschnitt aus Export und Import) stieg auf bis zu einem Drittel des Bruttosozialproduktes der einzelnen Länder an. Der Aufschwung des Welthandels wurde durch den Ersten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, die mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse im Oktober 1929 begann, und den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Liberalisierung nach 1945 Die Renaissance der Handelsglobalisierung begann in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Schon während der Schlussphase des letzten Weltkriegs wurden die Weichen für einen beispiellosen Abbau internationaler Handelshemmnisse in der Nachkriegszeit gestellt. 1944 wurden in Bretton Woods in New Hampshire, USA, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank gegründet. Der Marshall-Plan schob seit 1947 den Wiederaufbau des zerstörten Europa an. 1948 wurde das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) in Kraft gesetzt, in dessen Rahmen seitdem in acht multilateralen Liberalisierungsrunden die mengenmäßigen Handelsbeschränkungen (Kontingente) und die tarifären Handelshemmnisse (Zölle) weitgehend beseitigt wurden. Die Importzölle auf Industrieprodukte in Industrieländern zum Beispiel sind durchschnittlich von etwa 40 Prozent auf weniger als fünf Prozent gefallen. Quellentext 29 Internationaler Währungsfonds und Weltbank [...] Zu den einflussreichsten Akteuren der Globalisierung gehören zweifellos die Internationalen Finanzinstitutionen (IFI) und die ihnen assoziierten Organisationen, die in jüngerer Zeit zugleich den Charakter von Institutionen globaler Reichweite gewonnen haben. [...] Aus der Neuordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank nach Überwindung des Ost-WestKonflikts nahezu universale Mitgliedschaft erreicht. [...] Ein gutes halbes Jahrhundert nach Ratifizierung der Articles of Agreement hat sich der Kreis der ursprünglich 29 unterzeichnenden Mitglieder des IWF auf 184 Länder erweitert; die anfänglich 38 Mitgliedsstaaten der Weltbank sind auf über 180 angewachsen. Mit zusammen 600 Milliarden Dollar Einlagen leiden Weltbank und IWF nicht unter der notorischen Mittelknappheit anderer UN-Organisationen, sondern können in Krisenzeiten mit Quotenerhöhungen und Sonderzuweisungen rechnen. [...] Nicht zufällig polarisieren sich die Lager der Globalisierungskontroverse an gegensätzlichen Einschätzungen der IFIs. Den einen gelten sie als die mächtigsten, mit Anreizen und Sanktionskraft ausgestatteten Institutionen, die die entfesselte Welt der Globalisierung gestalten könnten. [...] Tatsächlich haben die IFIs in den letzten Jahren zahlreiche Aufgaben von weniger durchsetzungsfähigen UN-Institutionen übernommen und spielen heute in die Umwelt-, Bevölkerungs-, Bildungs-, Sozial- und Gleichstellungspolitik hinein. Die Chancen der Globalisierung aktiv nutzen und ihre Risiken begrenzen - so lautet die neue Programmformel, der freilich auch die Erkenntnis zugrunde liegt, dass die Überwindung von Armut der Schlüssel für den Frieden im 21. Jahrhundert bleibt. Den anderen dagegen erscheinen die IFIs und die WTO gerade angesichts der ungleich verteilten Früchte der Globalisierung nicht als Problemlösung, sondern als neoliberales Instrument zur Sicherung der westlichen Vormachtstellung zu Lasten fremder Kulturen und alternativer Entwürfe, auf Kosten der Natur und um den Preis dramatisch verschärfter Ungleichheiten [...]. Die nach Kapitaleinlagen gewichtete Stimmverteilung zwischen den Mitgliedsländern, die Unterrepräsentation ganzer Weltregionen und eine durch ihren Sitz in der Hauptstadt der USA geprägte Organisationskultur nähren den Verdacht einer ganz auf die Interessen der Industrieländer zugeschnittenen Agenda. [...] Der IWF war als multilaterale Institution zur Errichtung eines Währungssystems mit stabilen Wechselkursen und zur Hilfe bei der Überwindung von Zahlungsbilanzdefiziten konzipiert. Zu diesem Zweck schienen begrenzte Eingriffe in die Souveränität der Mitgliedsstaaten durchaus legitim. Die in der Zwischenkriegszeit unternommenen Versuche einzelner Länder, sich durch Abwertungen, das heißt die relative Verbilligung ihrer Exporte, Handelsvorteile auf Kosten ihrer Nachbarn zu verschaffen, hatten lediglich Abwertungswettläufe eingeleitet, in deren Folge der Welthandel zwischen Januar 1929 und Februar 1933 um 70 Prozent geschrumpft war (Kindleberger 1986). Um solche kompetitiven Abwertungen zu verhindern, sollten Wechselkursänderungen jetzt nur noch nach Konsultation mit dem IWF und zur Korrektur fundamentaler Ungleichgewichte möglich sein. Kurzfristige Störungen sollten dagegen durch Devisen aus einem gemeinsamen Fonds aufgefangen werden, an dem alle Mitgliedsstaaten gemäß der von ihnen eingezahlten Quote (Reservetranche) beteiligt sind. Kredite über diese Quote hinaus (Kredittranchen) waren und sind allerdings mit Zinskosten und wirtschaftspolitischen Auflagen verknüpft, die das betroffene Land auf den Pfad außenwirtschaftlicher Stabilität zurückführen sollen. [...] Kennzeichnend für das erweiterte Tätigkeitsfeld des IWF seit den achtziger Jahren ist, dass er nicht allein mit der Herstellung einer liberalen Weltwirtschaft beschäftigt war, sondern sich zunehmend mit den Folgeproblemen von Liberalisierung und Globalisierung konfrontiert sah. Erstes Resultat der jüngsten Globalisierungswelle war die Weltschuldenkrise seit den achtziger Jahren, die eine bis in die Gegenwart ungelöste Problematik aufwarf. Erst die Liberalisierung der Kapitalmärkte gab den neu industrialisierten Ländern die Möglichkeit, ihre oft überzogenen Entwicklungsprojekte durch Kreditaufnahme zu finanzieren - um sogleich die Erfahrung steigender Zinssätze, sinkender Rohstoffpreise und erratischer Wechselkurse zu machen. [...] 30 Das neue Kapitel der Wirkungsgeschichte des IWF bestand daher in einem Schuldenmanagement, das geordnete Umschuldungen und neue Kredite mit Auflagen im Sinne marktorientierter Reformen verknüpfte, das heißt die Schuldenkrise zugleich als Hebel für eine weitergehende Öffnung der verschuldeten Länder nutzte. Neuartig an der "Strukturanpassung", der ersten weltweit geltend gemachten wirtschaftspolitischen Programmatik, war, dass sie die politische Durchsetzung von Reformen ins Zentrum rückte und damit entgegen der deklarierten Nichteinmischung in innere Angelegenheiten tief in die Innenpolitik ihrer Klienten eingriff: Veränderte Steuern, Preise und Eigentumsformen sollten die nötige Anpassungsbereitschaft von Individuen und Interessengruppen herbeiführen. [...] Die zunehmenden entwicklungspolitischen Aktivitäten des IWF sind insofern erstaunlich, als seine Rolle zunächst auf Währungsangelegenheiten bechränkt war und keine Unterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern vorsah. [...] Entwicklungsaufgaben lagen dagegen von vornherein im Aufgabenfeld der Weltbank und ihrer Tochterorganisationen. Die Weltbank war als Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ursprünglich dazu gedacht, die Rekonstruktion der Nachkriegsökonomien durch projektbezogene langfristige Kredite vornehmlich im Bereich der Infrastruktur zu fördern. Ihr tatsächlicher Wirkungskreis verschob sich jedoch auf Entwicklungsprojekte in den ehemaligen Kolonien. Ihre Geschäftsgrundlage sind die Kapitaleinlagen ihrer Mitgliedsländer, die als Sicherheiten für an den Kapitalmärkten aufgenommene Kredite fungieren. Weltbankkredite sollen in erster Linie den Devisenbedarf für die Finanzierung von aussichtsreichen Entwicklungsprojekten abdecken, für die private Gelder allenfalls mit hohen Risikoaufschlägen mobilisierbar wären. Indem die Weltbank die von ihr aufgenommenen Mittel zu relativ günstigen Bedingungen an die Empfängerländer weiter vergibt, kommt ihr jedoch zugleich eine Signalfunktion für weitere Investitionen des privaten Sektors zu. Die sachgemäße Verwendung von Weltbankgeldern soll durch eingehende Länderstudien vorbereitet und in Kreditabkommen mit den Empfängerländern kodifiziert werden. Ihre Nettogewinne überweist die Weltbank an die International Development Association (IDA), die als ihr entwicklungspolitischer Arm fungiert und langfristige zinslose Kredite mit hohem Schenkungsanteil an gering entwickelte Länder vergibt, deren Industrialisierungspläne zu den üblichen WeltbankKonditionen nicht finanzierbar wären. Auch die Weltbank hat seit den achtziger Jahren im Kontext der Strukturanpassungsprogramme und im Zuge der Globalisierung neue Aufgaben für sich in Anspruch genommen, die über ihr traditionelles Ressort hinausgreifen, nämlich allgemeine Expertisen über "marktfreundliche Reformen" des öffentlichen Sektors und der Sozialsysteme vorzulegen. [...] Kraft ihres intellektuellen und organisatorischen Kapitals hat die Weltbank die Meinungsführerschaft in entwicklungstheoretischen Fragen übernommen und ist in der bemerkenswerten Lage, entwicklungspolitische Kurswechsel initiieren zu können. [...] Der jährlich herausgegebene Weltentwicklungsbericht besitzt aufgrund seiner Verknüpfung problembezogener Theorie und vergleichender Empirie besondere Relevanz, zumal seine Ergebnisse oft den marktorthodoxen Konzepten des IWF widersprechen und auf Differenzen innerhalb der Weltbank selbst verweisen. [...] Klaus Müller, Globalisierung, Bonn 2002, S. 86 ff. Seit 1952 gibt es Bestrebungen zur wirtschaftlichen Vereinigung Europas mit nach innen vollständig verwirklichter Handelsfreiheit. Die 1958 von zunächst sechs Gründungsländern (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux-Staaten) errichtete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde zur Europäischen Union (EU) weiterentwickelt, deren wichtigster Baustein die Europäische Währungsunion (EWU) ist. Die EU wurde zudem in mehreren Etappen auf heute 15 Mitgliedstaaten ausgeweitet; am 1. Mai 2004 werden zehn weitere Mitglieder hinzu kommen, neben Malta und Zypern acht mittel- und osteuropäische Länder (Polen, Tschechien, die Slowakische Republik, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen). Zahlreiche Entwicklungsländer sind der EU "assoziiert" und genießen weitgehende Zollfreiheit für ihre Exporte dorthin. Seit März 2001 können Produkte aus den 49 ärmsten 31 Entwicklungsländern frei von Zöllen und Quoten in die EU exportiert werden. Einige "sensible" Produkte (Bananen, Reis und Zucker) sind aus dieser "Alles-außer-Waffen"Initiative allerdings vorerst ausgeklammert. Den übrigen Entwicklungsländern räumt die EU - ähnlich wie die USA, Japan und weitere Industrieländer - Zollvorteile ein (Allgemeine Handelspräferenzen). Mit den anderen westeuropäischen und einigen nichteuropäischen Ländern (wie zum Beispiel Chile und Mexiko) hat sie Freihandel vereinbart. Die Europäische Gemeinschaft wurde als Zollunion und Wirtschaftsgemeinschaft zum Vorbild für zahlreiche regionale Zusammenschlüsse in anderen Teilen der Welt. Auch mit diesen Regionalzusammenschlüssen wie etwa dem von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gebildeten Mercosur (Mercado Comœn del Sur) in Südamerika strebt die EU eine auf Freihandel basierende wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Die letzte Runde des GATT, die so genannte Uruguay-Runde (1986-1994), brachte eine gravierende Ausweitung der Handelsfreiheit. Die Liberalisierung erfasste erstmals auch den traditionell geschützten Handel mit Agrarerzeugnissen und mit Textilien/Bekleidung sowie den Dienstleistungshandel. Es wurden Regelungen für einen besseren Schutz geistiger Eigentumsrechte (zum Beispiel Schutz vor Plagiaten) und zugunsten ausländischer Investitionen getroffen. So wurde es etwa verboten, den Investoren vorzuschreiben, Vorprodukte im Gastland einzukaufen (oder herzustellen) oder eine ausgeglichene Handelsbilanz zu präsentieren. Als weiteres Resultat der Uruguay-Runde wurde 1995 das GATT durch die Welthandelsorganisation (World Trade Organization - WTO) abgelöst. Insbesondere die Entwicklungsländer sehen ihre spezifischen Anliegen bei ihr besser aufgehoben als beim GATT, das sie eher als eine Interessengemeinschaft der Industrieländer betrachteten. Die WTO mit Sitz in Genf ist eine eigenständige internationale Organisation mit einem transparenten und wirksamen Streitschlichtungsverfahren, bei dem sich der Stärkere nicht automatisch durchsetzt. Unter ihrer Ägide wurde im November 2001 in Doha, der Hauptstadt Katars, die neunte Welthandelsrunde eingeleitet. Die Doha-Runde soll die Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungssektors weiter vorantreiben, das multilaterale Regelwerk verbessern und ausbauen sowie insbesondere Fairness gegenüber Entwicklungsländern gewährleisten. Quellentext Institutionen der Weltwirtschaft G 8 - Great Eight (engl.: die acht Großen). Aus der Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G 7: Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, USA), die regelmäßige Weltwirtschaftsgipfeltreffen durchführen, entstand 1997 die G 8 durch die Umwandlung des Beobachterstatus Russlands in eine Vollmitgliedschaft. An den Gipfeltreffen nimmt neben den acht Regierungschefs auch der Präsident der EU -Kommission teil. OECD - Organization for Economic Cooperation and Development/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.Die OECD mit Sitz in Paris wurde 1961 als Nachfolgeorganisation der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) gegründet. Die Hauptaufgaben der OECD sind: Sicherung der Währungsstabilität, Förderung des Welthandels, Planung und Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und Koordination der Wirtschaftshilfe für die Entwicklungsländer. Hierzu veröffentlicht die OECD, der 30 Mitglieder angehören, eine Anzahl regelmäßig erscheinender Länder -, Wirtschafts - und statistischer Berichte. GATT - General Agreement on Tariffs and Trade/Allgemeines Zoll - und Handelsabkommen.Vorläufer (bis 1995) der Welthandelsorganisation (WTO) mit dem Ziel, den weltweiten Handel durch Senkung der Zölle und Beseitigung anderer Außenhandelsbeschränkungen zu fördern. Im Mittelpunkt der handelspolitischen Vereinbarungen stand die Meistbegünstigung (d.h. Zollvergünstigungen eines Landes müssen gegenüber allen Handelspartnern gelten) und die Nichtdiskriminierung (d.h. erlaubte Ausnahmen vom Verbot der Mengenbeschränkung müssen für alle Teilnehmer gelten). Das GATT wurde 1947 von 23 Staaten geschlossen und verzeichnete zuletzt 123 Vollmitglieder. 32 WTO - World Trade Organization/Welthandelsorganisation. Die WTO wurde 1995 als Nachfolgeorganisation des Allgemeinen Zoll - und Handelsabkommens (GATT) gegründet; Sitz ist Genf. Die WTO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hat derzeit 146 Mitglieder und ist neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank die wichtigste Institution zur Behandlung internationaler Wirtschaftsprobleme. Wichtigste Aufgaben der WTO sind: die weitere Liberalisierung des Welthandels, Senkung der Zölle, Überwachung internationaler Handels - und Dienstleistungsregelungen, Abkommen über Eigentumsrechte, Patente etc. Zusammengestellt nach: Klaus Schubert, Martina Klein, Das Politiklexikon, Bonn 2001. Die Liberalisierung der Rahmenbedingungen für den regionalen wie für den Welthandel spiegelt sich eindrucksvoll in den Statistiken des internationalen Güteraustauschs wider. Im Jahre 2002 war das Volumen der Weltexporte mehr als zehnmal so groß wie 1960. In der gleichen Zeit hat sich die binnenwirtschaftliche Produktion, aus der die Exportgüter stammen, insgesamt nur gut vervierfacht. Die Differenz ist Ausdruck intensivierter internationaler Arbeitsteilung und damit zunehmender Globalisierung. Diese schritt, von konjunkturellen Einbrüchen in den Jahren 1974/75, 1981/82, 1992/93 und zuletzt 2001/2002 abgesehen, relativ stetig voran. Sie wurde auch durch die scharfe Zäsur in der Nachkriegsentwicklung, die 1973 das Ende der "goldenen Jahre" hoher Wachstumsraten herbeiführte, kaum beeinträchtigt. Wesentliche Merkmale der "neuen" Globalisierung, die seit den achtziger Jahren immer deutlicher hervortreten, sind die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, die verstärkte Herausbildung globaler Unternehmen und Produktionsnetzwerke, die beschleunigte Internationalisierung der Finanzmärkte sowie die Deregulierung und Privatisierung zentraler Dienstleistungsbereiche und "Netzsektoren" wie Telekommunikation, Post/Logistik, Transport und Energie. Außerdem haben zahlreiche Entwicklungsländer, namentlich in Südostasien und Lateinamerika, einseitig Importbarrieren abgebaut und Restriktionen gegenüber ausländischen Investoren gelockert. Dies geschah parallel zur multilateralen Liberalisierung und meist im Rahmen einer Neuausrichtung der gesamten Wirtschaftspolitik an marktwirtschaftlichen Grundsätzen, die seit Mitte der achtziger Jahre in immer mehr Entwicklungsländern zu beobachten ist. Merkmale des internationalen Handels Die Struktur der internationalen Arbeitsteilung ist in der aktuellen Globalisierungsetappe weitreichenden Veränderungen unterworfen. Der "klassische" Außenhandel mit Waren wird zunehmend durch den Handel mit Dienstleistungen ergänzt, der mit wachsender Produktkomplexität und -differenzierung immer wichtiger wird. Durch die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie, die in größerem Maße als bisher eine räumliche Trennung zwischen der Bereitstellung und dem Konsum von Dienstleistungen erlaubt, werden Dienstleistungen verstärkt international "handelbar". Von 1980 bis 2002 ist der weltweite Dienstleistungshandel um mehr als das Vierfache gewachsen, nämlich von 364 auf 1538 Milliarden US-Dollar. Damit ist er deutlich stärker als der Weltwarenhandel angestiegen, der sich um mehr als das Dreifache erhöht hat, nämlich von 2034 auf 6424 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend ist der Dienstleistungsanteil am Welthandel von 15 Prozent auf fast 20 Prozent gewachsen. 33 Die Verwendung dieser Grafik ist honorarpflichtig. Funktionale Netzwerke Dienstleistungen erfüllen vielfach eine Unterstützungsfunktion für den Warenverkehr. Je anspruchsvoller die zu vermarktenden Produkte sind, desto wichtiger wird es für ihren Absatzerfolg fern der heimischen Basis, dass sich das Unternehmen vor Ort auch um Werbung, Beratung, Finanzierung, Versicherung, Anlieferung, Reparaturservice und Entsorgung kümmert. Dies alles bindet erhebliche Investitionen. Darüber hinaus bilden Dienstleistungen - und die Möglichkeit, sie grenzüberschreitend bereit zu stellen - eine wichtige Voraussetzung für die Ausweitung internationaler Wertschöpfungsketten in und zwischen Unternehmen. Ganze Unternehmensfunktionen (wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung oder Produktion) und einzelne Unterfunktionen (wie zum Beispiel Herstellung von Vorprodukten und Montage der Endprodukte) werden dabei in verschiedenen Ländern durchgeführt; die Wertschöpfungskette wird international "aufgespalten". Derartige Produktions-, Leistungs- und Wissensverbünde (funktionale Netzwerke) sind ein wesentliches Strukturelement der "neuen" internationalen Arbeitsteilung. Regionale Verdichtung Im Welthandel bilden sich neben funktionalen zunehmend auch regionale Netzwerke heraus (Grafik "Inter- und intraregionale Handelsverflechtung 2001). Der Globalisierungsprozess bedeutet daher nicht nur eine weltweite Verflechtung der Volkswirtschaften, sondern auch eine räumliche Konzentration der Wirtschaftsaktivität (Clusterbildung). Die drei Großregionen Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik (Triade) dominieren den Welthandel; sie liefern mehr als 80 Prozent der globalen Warenexporte. Europa ist mit über 40 Prozent der weltweit größte Warenexporteur, obwohl sein Anteil gesunken ist. Es folgen Asien-Pazifik mit 25 Prozent und Nordamerika mit über 15 Prozent; diese Regionen konnten ihren Anteil ausbauen. Die "peripheren" Cluster Afrika, Lateinamerika und übriges Asien liegen weit hinter der Triade. Während Lateinamerika aber aufgeholt hat, ist Afrika im Welthandel weiter zurückgefallen. 34 Die Handelsbeziehungen konzentrieren sich zudem auf eine kleine Anzahl von Staaten. Etwa die Hälfte der weltweiten Warenexporte wird von acht Ländern abgewickelt; die Spitzengruppe bilden die USA, Deutschland und Japan. Besonders auffällig ist daneben die starke Expansion des chinesischen Außenhandels, der seit Beginn der neunziger Jahre mehr als doppelt so schnell gewachsen ist wie der globale Handel insgesamt. Damit ist China inzwischen der fünftgrößte Warenexporteur in der Welt (Grafik "Führende Länder in der Weltwirtschaft"). Blickt man auf den Warenhandel zwischen diesen Ländern, die bilateralen Ströme, so zeigt sich ebenfalls ein Muster der Handelsverdichtung. Zum Beispiel liefert Japan fast ein Drittel, China ein Fünftel seiner Warenexporte in die USA, die wiederum ein Fünftel ihrer Exporte in Kanada absetzen. Auch die enge deutsch-französische Handelsverflechtung belegt die Verdichtung im Welthandel: Mehr als ein Zehntel der deutschen Exporte geht nach Frankreich und umgekehrt etwa ein Sechstel der französischen nach Deutschland. Insgesamt sind regionale und bilaterale Konzentrationen damit ein hervorstechendes Charakteristikum des Welthandels. Intraregionale Handelsströme haben stark an Bedeutung gewonnen. Der intraregionale Warenaustausch lag in den fünfziger Jahren bei einem Drittel des Welthandels, 1980 bei über 40 Prozent und macht heute bereits mehr als die Hälfte aus. Der mit Abstand größte intraregionale Handelsstrom ist in Europa zu verzeichnen. Allerdings nimmt der Anteil des innereuropäischen Handels am Welthandel nicht mehr zu, sondern stagniert auf hohem Niveau. Demgegenüber expandiert der Handel in Nordamerika und in der asiatisch-pazifischen Region erheblich schneller als der Welthandel. In Lateinamerika und Afrika wiederum spielt der intraregionale Handel nur eine geringe Rolle und wächst im Übrigen in ähnlichem Tempo wie der Welthandel. Die Länder der Triade beherrschen auch den interregionalen Handel. Die größten Handelsströme verlaufen zwischen Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik. In diesem "Dreieck" ist der transpazifische Handel zwischen Nordamerika und der asiatischpazifischen Region der weitaus gewichtigste interregionale Warenstrom, gefolgt vom transatlantischen Handel zwischen Nordamerika und Europa und dem euro-asiatischen Handel zwischen Asien-Pazifik und Europa. In Regionen wie Afrika und Lateinamerika 35 dominiert dagegen klar der interregionale Handel mit Industrieländern - ihre Haupthandelspartner sind in diesem Falle Europa bzw. die Vereinigten Staaten. Es zeigt sich also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bedeutungszuwachs des intraregionalen Handels und einer wachsenden Handelsverflechtung in der Triade einerseits und der Abhängigkeit weniger entwickelter Regionen vom interregionalen Handel mit den TriadeStaaten andererseits. Wandel der Warenstruktur Auch in sektoraler Hinsicht hat sich die Struktur des internationalen Handels erheblich gewandelt. Das Vordringen des Dienstleistungshandels wurde bereits erwähnt. Im Warensektor ist der ehemals dominierende Agrarhandel von annähernd 50 Prozent (1950) auf einen Anteil von weniger als zehn Prozent (2001) des gesamten Handels geschrumpft. Der Handel mit Bergbauprodukten und Energieträgern, der von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas geprägt wird, ging in den achtziger Jahren stark zurück. Darin zeigen sich die Folgen der Erdölpreiskrise von 1979/80: die Energiesparmaßnahmen, die stärkere Nutzung nichtfossiler Energieträger und die beschleunigte Erschließung heimischer Energiequellen. Diese Trends bestehen zwar weiterhin, aber in abgeschwächter Form. Dementsprechend hat sich der Handel mit Energieträgern bei etwa einem Zehntel des globalen Warenhandels stabilisiert. Das dynamische Element in diesem Sektor ist hingegen der Handel mit Industriegütern. Innerhalb des Industriegüterhandels haben sich die Gewichte deutlich zugunsten der Informations- und Nachrichtentechnik verschoben. Die Produkte dieser Branche zeichnen sich durch ständige Erneuerung (Innovation) aus, die aus einem hohen Einsatz von Forschung und Entwicklung (Technologie) im Wertschöpfungsprozess resultiert. Auch der Anteil chemischer und pharmazeutischer - ebenfalls wertschöpfungs- und technologieintensiver - Produkte am Industriegüterhandel ist (leicht) gestiegen, während andere - eher kapital- und arbeitsintensive - Bereiche wie der Handel mit Eisen und Stahl, Automobilen, Textil- und Bekleidungserzeugnissen stagnieren oder an Gewicht verloren haben. Dies bedeutet allerdings nur, dass sie langsamer als der insgesamt florierende Industriegüterhandel gewachsen sind. Den weltweiten Entwicklungen liegen unterschiedliche regionale Trends zugrunde. Die Entwicklungsländer Afrikas, des Mittleren Ostens und Lateinamerikas und die "Transformationsländer" (Länder im Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft) Mittelund Osteuropas sind noch in relativ hohem Maße (und teilweise zunehmend) vom Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen abhängig. Führend in diesem traditionellen Sektor des internationalen Warenhandels sind allerdings Nordamerika und Westeuropa, was hauptsächlich durch eine künstliche Verbilligung der Erzeugung - und des Exports - von Agrargütern durch Subventionen zu erklären ist. Im Bereich Bergbau und Energie fließen hingegen die Handelsströme überwiegend aus Entwicklungs- und Transformationsländern in die industrialisierte Welt, wobei der Mittlere Osten mit seinen riesigen Ölexporten herausragt. Bei Industriegütern wiederum hängt die Arbeitsteilung zwischen den Ländern wesentlich von der Art der gehandelten Produkte bzw. ihrer sektoralen Zuordnung ab. Die Grundregel dabei ist, dass gleich entwickelte Länder eher intraindustriellen Handel (zum Beispiel Maschinen gegen andere Maschinen), ungleich entwickelte dagegen stärker interindustriellen Handel (zum Beispiel Maschinen gegen Bekleidung) treiben. Aus diesem Grunde ist der Handel zwischen Industrieländern (Nord-Nord-Handel) in hohem Maße intraindustriell und damit auch weitgehend substitutiv: Ausländische Produkte ersetzen inländische Erzeugnisse der gleichen Kategorie. Insgesamt ist der Anteil des intraindustriellen Handels am gesamten Industriegüterhandel kräftig gewachsen. Berechnungen zufolge lag er zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei etwa 50 Prozent und erreicht heute bereits mehr als 80 Prozent. In der Angebotspalette der Entwicklungsländer spielt die Produktdifferenzierung noch eine relativ geringe Rolle. Sie handeln deshalb bei Industriegütern überwiegend auf interindustrieller/komplementärer Basis und mit Industrieländern (Nord-Süd-Handel). Dabei werden arbeits- und rohstoffreich produzierte Waren gegen technologie- und humankapitalintensive Produkte getauscht. Hierin spiegeln sich die unterschiedlichen Kostenstrukturen der Länder und ihre unter-schiedliche Ausstattung mit Produktionsfaktoren wider. In den Industrieländern sind die Lohnkosten hoch, 36 qualifizierte Arbeitskräfte ("Humankapital") und Technologie sind vergleichsweise reichlich und Naturressourcen oft eher spärlich verfügbar, während es sich in Entwicklungsländern häufig umgekehrt verhält. Industrieländer sind daher weitgehend auf hochwertige Erzeugnisse spezialisiert und importieren hauptsächlich einfache Produkte aus Entwicklungsländern. Allerdings kommt dieses traditionelle Muster mehr und mehr ins Wanken. Viele "Industrieländer der zweiten und dritten Generation" (Schwellenländer) fächern ihr Angebot auf (diversifizieren) und stoßen dabei in den Bereich der Technologiegüter vor. Damit verbessern sich nicht nur die Chancen für mehr Handel der Entwicklungsländer untereinander (Süd-Süd-Handel). Diese Länder dringen vielmehr auch in die Domänen der Industrieländer ein. Das beste Beispiel für einen solchen Prozess ist das heutige Hochtechnologieland Japan, das noch vor wenigen Jahrzehnten den Status eines Entwicklungslandes hatte. Aktuellere Beispiele sind die Erfolge etwa Südkoreas bei Unterhaltungselektronik und Automobilen sowie Indiens und Israels bei Softwareprodukten. Dabei verändert sich das überkommene Muster des Nord-Süd-Handels. Unternehmen aus Entwicklungsländern treten verstärkt als Konkurrenten auf Industrieländermärkten in Erscheinung und umgekehrt. Gleichzeitig werden Entwicklungsländerstandorte immer häufiger in Produktionsnetzwerke international tätiger, zumeist aus Industrieländern stammender Unternehmen einbezogen. In diesem grenzüberschreitenden arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozess übernehmen sie in der Regel Teilfertigungen, bei denen in relativ hohem Maße (importiertes) Sachkapital und (mehr oder weniger qualifizierte) Arbeitskraft eingesetzt wird. Humankapital- und technologieintensive Prozesse finden dagegen eher in Industrieländern statt. Ein gutes Beispiel für diese komplementären Beziehungen innerhalb von Wertschöpfungsketten ist der Handel mit Produkten der Informations- und Nachrichtentechnik. Sein Anteil am Nord-Süd-Handel und auch am Süd-Süd-Handel mit Industriegütern ist stark gewachsen und bildet hier bereits den größten Posten. Dies liegt aber nicht so sehr daran, dass Entwicklungsländer selbstständig - "integriert" Hochtechnologiegüter in diesem Sektor produzieren und exportieren, sondern erklärt sich eher durch die Auslagerung einzelner Produktionsstufen in den "Süden". Dort werden nämlich hauptsächlich importierte Vorprodukte (wie zum Beispiel Mikrochips), die bereits viel Technologie enthalten, mit relativ geringem Technologieeinsatz zu Endprodukten (wie zum Beispiel PCs) zusammengesetzt. Aus diesem Grunde schlägt sich auch der wachsende Entwicklungsländeranteil am Handel mit Technologiegütern nicht in einem entsprechenden Einkommenszuwachs in Entwicklungsländern nieder; die "einkommensträchtigen" Wertschöpfungsabschnitte werden bislang eher in Industrieländern durchgeführt. Grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten Im Zuge der Globalisierung hat die Bedeutung von Unternehmen, die nicht nur im Außenhandel tätig sind, sondern auch jenseits ihrer nationalen Grenzen Waren produzieren und Dienstleistungen erbringen (multinationale oder transnationale Unternehmen - MNU/TNU), rapide zugenommen. Gab es zu Beginn der neunziger Jahre circa 7000 MNU, so existieren heute bereits etwa 65000 Muttergesellschaften und 850000 dazugehörige ausländische Tochtergesellschaften, die in allen Ländern der Welt Güter erstellen und vermarkten, Forschung und Entwicklung betreiben und mit Unternehmen der Gastgeberländer oder anderen ausländischen Unternehmen kooperieren. Die jährlichen Umsätze der Auslandstöchter werden auf annähernd 20 Billionen US-Dollar geschätzt. Sie sind deutlich stärker als der internationale Handel expandiert und übersteigen inzwischen den Weltexport von Waren und Dienstleistungen, der sich auf weniger als acht Billionen US-Dollar beläuft, um ein Mehrfaches. Gleichzeitig dominieren MNU im Welthandel. Auf sie entfallen etwa zwei Drittel der internationalen Warenströme, wobei allein ein Drittel Intrafirmenhandel darstellt, das heißt Handel der Muttergesellschaften mit ihren Auslandstöchtern und der Auslandstöchter untereinander (Schwestergesellschaften). 37 Zur vorherrschenden Form der multinationalen Unternehmensexpansion haben sich Fusionen und Übernahmen, im Unterschied zu Neugründungen im Ausland, entwickelt. So ist zum Beispiel der britische Telekommunikationskonzern Vodafone durch die Übernahme des deutschen Konkurrenten Mannesmann im Jahr 2000 zum - gemessen an den Kapitalanlagen im Ausland - größten transnationalen Unternehmen in der Welt (außerhalb des Finanzsektors) aufgestiegen. Im folgenden Jahr wurde der kontinuierliche und progressive Anstieg der grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen allerdings jäh unterbrochen. Im Jahr 2001 sank auch, erstmals wieder seit 1982, das reale Volumen des weltweiten Warenhandels. Aus diesen Entwicklungen sollte jedoch noch nicht auf ein "Ende der Globalisierung" geschlossen werden; es handelt sich eher um ein konjunkturell bedingtes Einhalten. Obgleich das Bild der MNU durch "Giganten" wie Exxon Mobil, General Motors oder DaimlerChrysler geprägt wird, deren Unternehmenswert das Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie Peru oder Ungarn übertrifft, stellen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zahlenmäßig das weitaus größte Kontingent. Die multinationalen KMU investieren aber vorzugsweise in benachbarten Ländern und präferieren zwischenbetriebliche Kooperationen und Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) mit ausländischen Partnern. Für sie ist es nämlich grundsätzlich schwieriger, jenseits der Grenzen zu operieren. Neben höheren Informationskosten haben die KMU auch in der immer wichtiger werdenden Finanzierungssphäre eindeutige Nachteile gegenüber den Großkonzernen. Strategien multinationaler Unternehmen Die Globalisierungsstrategien der MNU lassen sich insgesamt in vier Kategorien unterteilen: Ressourcenstrategien, Marktstrategien, Effizienzstrategien, 38 Wertstrategien. Die Erschließung von Rohstoffquellen zur Sicherung der Versorgung mit natürlichen Ressourcen (Ressourcenstrategie - Resource-Seeking) ist das "klassische" Investitionsmotiv international tätiger Unternehmen. Es ist auch weiterhin bedeutend, aber in dieser Form nicht mehr dominant. Das Hauptmotiv der multinationalen Unternehmen ist vielmehr die bessere Durchdringung der Auslandsmärkte, das heißt die Sicherung und Ausweitung des Absatzes im Ausland (Marktstrategie - Market-Seeking). Dieses Motiv ist umso wichtiger, je größer der betreffende Markt ist. China, Indien und einige große lateinamerikanische Länder sind daher bevorzugte Zielregionen für absatzorientierte Direktinvestitionen. Liberale Einfuhrregelungen zwischen kleinen Ländern einer wirtschaftlich expandierenden Region sind ein weiteres, annähernd gleichrangiges Investitionsmotiv. Aus diesem Grunde haben Belgien, Irland, Neuseeland und die Niederlande in den neunziger Jahren die höchsten Direktinvestitionsbestände (im Verhältnis zum Sozialprodukt) unter allen OECD-Gastgeberländern verzeichnet. Von wachsender Bedeutung sind Effizienzstrategien (Efficiency-Seeking), bei denen Kostensenkung das entscheidende Motiv ist. Westliche Investoren in den mittel- und osteuropäischen Ländern nutzen beispielsweise die Tatsache, dass dort das Lohnniveau, zu Wechselkursen umgerechnet, deutlich niedriger als im Heimatland liegt, zur billigen Herstellung von Vorleistungen für den eigenen Produktionsprozess oder auch zur Endmontage mit anschließendem Export. Immer häufiger betreiben multinationale Unternehmen im Ausland Fabriken, die auf bestimmte Fertigungen spezialisiert sind und jeweils für den gesamten Weltmarkt (beziehungsweise große - meist regionale - Segmente des Weltmarktes) oder für den weltweiten Bedarf des Unternehmens selbst (respektive des Unternehmensnetzwerkes, dem es angehört) produzieren. Ein Beispiel ist die Montage von Farbfernsehgeräten im Norden Mexikos, nahe der Grenze zu den USA, durch amerikanische und japanische Konzerne. Bei diesen Produkten ist Mexiko heute der weltweit größte Exporteur. Niedrige Löhne, Zoll- und Steuervergünstigungen, eine starke Kostenminderung durch hohe Stückzahlen und die Vorteile, die aus einer räumlichen Ballung verwandter industrieller Aktivitäten herrühren (Agglomerationsvorteile), sind wesentliche Ursachen dieser Entwicklung. Immer wichtiger werden Wertstrategien (Asset-Seeking), die zusammen mit den Bemühungen um mehr Effizienz die "neuen" - auch als "Netzwerkstrategien" bezeichneten - Globalisierungsmaßnahmen der Unternehmen darstellen. Ziel ist die Steigerung des Unternehmenswertes durch Nutzung strategischer Ressourcen (Strategic Assets) des Auslandes. Konkret geht es hauptsächlich um den Zugang zu ausländischen Wissensquellen (Knowledge-Seeking) und speziell zu lokal gebundenem Wissen (Tacit Knowledge), das nicht international handelbar ist, sondern durch persönlichen Kontakt am Arbeitsplatz weitergegeben wird. Außer der Produktion führen multinationale Unternehmen deshalb verstärkt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Ausland durch, häufig in Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen vor Ort, wie zum Beispiel Universitäten, die auf dem betreffenden Gebiet tonangebend sind. Internationale Direktinvestitionen Das Hauptinstrument multinationaler Unternehmenstätigkeit sind grenzüberschreitende Direktinvestitionen. Im Unterschied zu anderen Formen der Auslandsinvestition, wie zum Beispiel Anlagen in ausländischen Wertpapieren (Portfolioinvestitionen), werden Direktinvestitionen in der Absicht vorgenommen, einen entscheidenden Einfluss auf die Führung des neu gegründeten oder erworbenen Unternehmens im Ausland auszuüben. Weltweit haben sie wesentlich schneller zugenommen als die internationalen Handelsströme: Die globalen Bestandswerte der Direktinvestitionen im Ausland sind zwischen 1980 und 2001 viermal so schnell gestiegen wie die Warenexporte und dreimal so schnell, wie der internationale Dienstleistungshandel gewachsen ist. 39 Direktinvestitionen stammen weiterhin hauptsächlich aus Industrieländern. Allerdings treten immer häufiger auch Unternehmen aus "Schwellenländern" wie China, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Brasilien, Mexiko und Südafrika als multinationale Akteure in Erscheinung. In Industrieländern werden auch die meisten Direktinvestitionen getätigt, doch ist ihr Anteil an den weltweit eingeflossenen Direktinvestitionen seit 1990 von etwa drei Vierteln auf ungefähr zwei Drittel gesunken. Umgekehrt ziehen Entwicklungs- und Transformationsländer verstärkt Direktinvestitionen an. Mit der Umstrukturierung ihrer Volkswirtschaften haben vor allem China und die Länder Mittelund Osteuropas in den letzten Jahren als Investitionsstandorte erheblich an Bedeutung gewonnen. Dabei hat China inzwischen traditionelle Empfängerländer wie Brasilien und Mexiko übertroffen. Zwischen den Industrieländern fallen insbesondere die unterschiedlichen Entwicklungen in Westeuropa und Nordamerika auf. Während sich in Westeuropa die Schere zwischen aus- und einfließenden Direktinvestitionen immer weiter geöffnet hat, haben sich die Investitionsströme in Nordamerika zunehmend angeglichen. Von 1980 bis 2001 ist der Anteil Westeuropas an den weltweit im Ausland getätigten Direktinvestitionen von 45 auf 57 Prozent gestiegen, während der Anteil Nordamerikas von 46 auf 25 Prozent gefallen ist. Bei den aus dem Ausland empfangenen Direktinvestitionen sind dagegen die Anteile weitgehend stabil geblieben, bei etwa 40 Prozent im Falle Westeuropas und 25 Prozent im Falle Nordamerikas. In sektoraler Hinsicht ist bei Direktinvestitionen, stärker noch als im Außenhandel, ein Trend zum tertiären Sektor (Dienstleistungen) zu erkennen, insbesondere zu Finanzdienstleistungen und Handelsunternehmen, während der Primärsektor (Rohstoffe) weiter schrumpft und nunmehr auch der sekundäre Sektor (Industrieprodukte) insgesamt Anteile einbüßt. Innerhalb des Industriesektors sind jedoch Direktinvestitionen in wissensintensiven Branchen wie der Chemie-, Pharmazie-, Automobil-, Elektronik- und Datenverarbeitungsindustrie ähnlich expansiv wie Dienstleistungsinvestitionen. Direktinvestitionen sind auch ein Indikator für die Attraktivität und Qualität eines Produktionsstandortes. Vom Zu- oder Abfluss derartiger Kapitalinvestitionen hängt es ab, ob gewerbliche Arbeitsplätze entstehen oder fortfallen und ob die Produktion am Standort wächst oder schrumpft. Allerdings wäre es falsch, von einem Überschuss abfließender über zufließende Direktinvestitionen auf Standortmängel zu schließen. Direktinvestitionen im Ausland dienen nämlich nicht zuletzt auch der Abstützung des Exports. Unternehmensbefragungen in vielen Industrieländern zeigen, dass die Exportbegleitung, also etwa der Aufbau eines kundennahen Vertriebs- und Servicenetzes im Ausland, eines der wichtigsten Direktinvestitionsmotive ist. Auswirkungen auf die Empfängerländer 40 Für Entwicklungsländer können die Firmennetzwerke große Wachstumschancen bedeuten, da über solche Kanäle enorme Wissensströme laufen und das Know-how der ausländischen Tochtergesellschaften auf die Wirtschaft des Gastgeberlandes überspringen kann (Spillover-Effekt). Ermöglicht wird der Technologietransfer durch die dramatischen Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnik. Zugleich haben die Unternehmen in den Aufnahmeländern Südostasiens oder Lateinamerikas meist eine hohe Lernbereitschaft der heimischen Bevölkerung vorgefunden. Obwohl multinationale Unternehmen in vielen Branchen, etwa in der Elektronik-, Nahrungsmittel-, Glas- und Kunststoffindustrie, in Entwicklungsländern vor allem die Niedriglohnkomponenten ihrer Erzeugnisse herstellen, bieten sie dort doch zahlreiche und im Vergleich zur heimischen Wirtschaft gut bezahlte, gesicherte und mit sozialen Leistungen verbundene Arbeitsplätze. Alles in allem ist die Tätigkeit multinationaler Unternehmen in Entwicklungsländern damit eine gute Grundlage für deren weltwirtschaftlichen Aufholprozess. Mit zunehmendem Entwicklungsstand eines Landes emanzipieren sich zudem immer mehr heimische Firmen und übernehmen als Lizenznehmer oder Kooperationspartner Produktions- oder Dienstleistungsfunktionen vom ursprünglichen Direktinvestor. Die positiven Impulse für Beschäftigung und Einkommen vor Ort haben bewirkt, dass multinationale Unternehmen von den Ländern der Dritten Welt als Direktinvestoren umworben werden. Allerdings gibt es in Industrieländern Unternehmen, etwa in der chemischen Industrie und in der Metallerzeugung, die einen hohen Verbrauch an Umweltressourcen haben und niedrige Umweltstandards in Entwicklungsländern nutzen, um Investitionskosten zu sparen. Auch gibt es Investoren, die sich undemokratischer und die Menschenrechte missachtender Regime bedienen, um billige Arbeitskräfte besser ausbeuten zu können. Die Verletzung von Umwelt- und Sozialstandards ist allerdings keine zwingende Begleiterscheinung der Expansion multinationaler Unternehmen. Empirische Studien zeigen eher ein gegenteiliges Bild. Staaten mit einem relativ niedrigen Niveau sozialer Regelwerke erhalten danach nur geringe Investitionszuströme, während Länder, in denen relativ hohe Sozialstandards vorherrschen, auch aus diesem Grunde stärkere Zugänge verzeichnen. Multinationale Unternehmen, die im Heimatland angesichts strenger Auflagen bereits Erfahrungen im betrieblichen Umweltschutz gesammelt haben, transferieren außerdem in beträchtlichem Umfang "saubere" Technologien und umwelttechnisches Know-how in Entwicklungsländer. Umweltstandards wie die Norm ISO 14001, mit der Betriebe zertifiziert werden, die ihre Prozesse umweltschonend ausgerichtet haben (zum Beispiel in der Abfallentsorgung), finden auch in Entwicklungsländern mit hohen Direktinvestitionen vermehrt Akzeptanz. Ausgewählte Wirtschaftsbereiche Die Unternehmen sind den Einflüssen der Globalisierung unterschiedlich stark ausgesetzt. Auch die jeweils eigenen Möglichkeiten, die Globalisierung aktiv zu nutzen, sind von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Bevor dies hier anhand konkreter Beispiele gezeigt wird, sei es kurz in allgemeiner Form und in den Kategorien der Handelstheorie und Industrieökonomik skizziert. Die Unterschiede ergeben sich vor allem aus der Standortgebundenheit des Unternehmens (Rohstoffbasis, Transportkosten, Qualifikation des Arbeitskräfteangebots), den Faktoranforderungen und Faktorintensitäten (Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Wissen) in der Produktion, den Möglichkeiten, die Produktion arbeitsteilig zu gestalten (räumliche Zerlegbarkeit der "Wertschöpfungskette"), den Produktionskostenverläufen in Abhängigkeit von der hergestellten Stückzahl, das heißt je mehr produziert wird, desto geringer sind die Durchschnittskosten pro Stück (Skalenerträge), den Eigenschaften der Produkte (Homogenitätsgrad, Nachahmbarkeit, Austauschbarkeit, Veraltensgeschwindigkeit) und 41 den Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten ("Bestreitbarkeit" der Märkte, Bedeutung technologischer Marktzutrittsschranken). Wichtig ist auch, ob der Staat als Regulierer, Eigentümer, handelspolitischer Akteur, Auftrags- oder Subventionsgeber ein besonderes strategisches, strukturelles oder soziales Interesse ins Spiel bringt. Energiewirtschaft Steinkohle bestimmter Güte ist ein "homogenes", das heißt wegen seiner weitestgehenden Gleichartigkeit gegenseitig austauschbares Produkt, bei dem der Abnehmer kaum Vorlieben für bestimmte Anbieter hat, so dass der Preis zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal wird. Demzufolge ist die teure deutsche Ruhrkohle im Prinzip stark der überseeischen Konkurrenz ausgesetzt. Die Produktionskosten etwa in Südafrika oder Australien sind zwar erheblich niedriger als in Deutschland, doch bilden die hohen Transportkosten einen begrenzten natürlichen Einfuhrschutz. Nach der Öffnung Ostmitteleuropas ist nun mit der oberschlesischen Kohle eine transportkostengünstigere Konkurrentin hinzugekommen. Außerdem kann Steinkohle in vielen Fällen leicht durch billigeres Erdöl oder Erdgas ersetzt (substituiert) werden. Nun bewirkte ein strategisches Interesse des Staates an der "energiewirtschaftlichen Versorgungssicherheit" - kein Stromausfall und kein Fahrverbot bei einem Lieferboykott der Erdöl produzierenden Staaten - und an der "sozialpolitischen Abfederung des Strukturwandels" - vor allem Verhinderung regional konzentrierter Massenarbeitslosigkeit bei massierten Zechenstilllegungen - die Zahlung hoher Produktionsbeihilfen (Subventionen). Diese wurden jedoch im EU-Rahmen wettbewerbsrechtlich für unzulässig befunden. Deshalb soll die Steinkohlenbeihilfe aus dem Bundeshaushalt von umgerechnet etwa 3,5 Milliarden Euro im Jahre 1998 auf weniger als zwei Milliarden Euro im Jahre 2005 zurückgeführt werden. Außerdem ist geplant, die Steinkohle-Subventionen in Nordrhein-Westfalen von 2006 bis 2012 jährlich um 40 Millionen Euro zu kürzen. Weil aber die deutsche Steinkohlenproduktion wegen der ungünstigen Flözlagen und der hohen Lohnkosten auf gleichbleibend hohe Subventionen angewiesen wäre, um mit der Importkohle preislich konkurrieren zu können, und weil in Anbetracht des regional wie nach Energieträgern beachtlich diversifizierten (aufgefächerten) Energieangebots auch das Versorgungsargument nicht mehr greift, sind die Tage des deutschen Steinkohlenbergbaus gezählt; das Ruhrrevier muss noch stärker umstrukturiert werden als bisher. Erdöl ist ein Musterbeispiel für den Einfluss der Gobalisierung auf die nationalen Volkswirtschaften. Es dient als Vorprodukt für zahlreiche Güter und ist eine zentrale Energiequelle für Haushalte, Industrieunternehmen und den Verkehrssektor. Der weltweit bedeutendste Energierohstoff ist zugleich eines der am meisten gehandelten Produkte. Dabei wird das Angebot weitgehend von der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC) kontrolliert, die regelmäßig die Fördermengen ihrer Mitgliedsstaaten festsetzt. Da diese circa 60 Prozent des insgesamt geförderten Öls liefern, übt das OPEC-Kartell entscheidenden Einfluss auf den Preis des Produktes aus, von dessen Entwicklung wiederum der Gang der Weltwirtschaft mitbestimmt wird. Im Krieg um den erdölreichen Irak im Frühjahr 2003 war der Ölpreis den stärksten Schwankungen seit langer Zeit ausgesetzt. Der Preis der Sorte Brent stieg von circa 23 US-Dollar pro Fass/Barrel (ein Barrel entspricht 159 Litern) im November 2002 auf über 34 US-Dollar Anfang März 2003, bevor er Anfang April nach Kriegsende - wieder auf knapp 25 US-Dollar zurückfiel. Textilindustrie Bekleidungsgegenstände sind arbeitsintensive Güter, die teils auf geringe, teils auf ausgeprägte Vorlieben der Verbraucher treffen. Die Hochlohnländer mit ihren anspruchsvollen Käufern überlassen folglich die Produktion der austauschbaren "Stapelware" den Entwicklungsländern, da sie mit deren niedrigen Löhnen nicht konkurrieren können und auch die Transportkosten gering sind. Sie besetzen aber den Teil des Marktes, in dem durch Einsatz von hochwertigen Dienstleistungen (Design, Materialveredelung, Markenpflege) hoch differenzierte und prestigebesetzte Ansprüche bedient werden und die Zahlungsbereitschaft der Käuferschaft groß ist. Da die Produkte 42 aber relativ leicht imitiert werden können und der Urheberschutz bzw. dessen Kontrolle international trotz WTO immer noch zu wünschen übrig lässt, sind die Erzeuger immer wieder darauf angewiesen, neue Produkte mit frischem Prestigewert herauszubringen. Der Wettbewerbsdruck wird durch Handelsliberalisierung verschärft: Es ist vorgesehen, den Textilsektor, der als einziger Industriesektor bislang von den multilateralen Handelsregeln ausgenommen war, bis Ende 2004 in die WTO-Disziplin "einzubinden". Dies bedeutet, dass die zahlreichen mengenmäßigen Handelsbeschränkungen (Quoten) bei Textil- und Bekleidungserzeugnissen, die noch immer vor allem den Export der Entwicklungsländer in Industrieländer stark behindern, dann beseitigt sein sollen. In der laufenden WTO-Verhandlungsrunde (DohaRunde) sollen außerdem die relativ hohen Zölle im Textilsektor deutlich reduziert werden. Beides zusammen (Quotenabbau und Zollsenkung) wird auf der einen Seite zu beträchtlichen Wohlfahrtsgewinnen in der Welt führen - die Rede ist von über 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr -, aber auch in einzelnen Ländern und Regionen erhöhte Arbeitslosigkeit hervorrufen und eine Beschleunigung des Strukturwandels erzwingen. Information und Kommunikation Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind Teil der Neuen Ökonomie (New Economy), die sich in den neunziger Jahren immer stärker herausgebildet hat. Die Neue Ökonomie schließt auch die Mikroelektronik, Bio- und Gentechnologie ein. Sie bildet das Gegenstück zu den traditionellen Wirtschaftszweigen der Alten Ökonomie wie zum Beispiel Textil, Kohle und Stahl. Information gilt als Rohstoff der New Economy. Motor des raschen Wachstums im IKT-Sektor sind technologische Entwicklungsschübe. Dadurch sind zum Beispiel die Kosten der Speicherung, Analyse und Verbreitung von Daten/Informationen in den letzten Jahren kräftig gesunken. Der Informationsfluss im World Wide Web (Internet) wird kaum mehr durch nationale Grenzen gehemmt. Dementsprechend schreitet die Globalisierung des IKT-Sektors schnell voran. Weltweit wächst der Handel mit IKT-Gütern fast doppelt so schnell wie der gesamte Güterhandel. Die rapide Entwicklung der IKT-Branche verzeichnet jedoch nicht nur Gewinner. Während die Informationstechnologie für Schwellenländer wie zum Beispiel Mexiko neue Wachstumschancen eröffnet, fehlt in Entwicklungsländern wie einer Reihe afrikanischer Staaten noch die Infrastruktur für moderne Kommunikation. In den ökonomisch stärksten Ländern, mit weniger als einem Sechstel der Weltbevölkerung, leben mehr als drei Viertel der Internetnutzenden. Auch innerhalb einzelner Staaten droht die Entstehung einer digitalen Kluft (Digital Divide), wie das Beispiel Bangalore zeigt - der technologische Übersprung von dieser Softwaremetropole Indiens auf die übrige Wirtschaft des Landes ist bisher anscheinend ausgeblieben. Gleichzeitig besteht in Entwicklungsländern aber die Möglichkeit einer relativ kostengünstigen IKT-Einführung, 43 da technische Entwicklungsstufen übersprungen werden können. Auf diese Weise könnte der Wissens- und Bildungsrückstand in diesen Ländern deutlich verringert werden. Forschung und Entwicklung Einen immer größeren Raum im Wirtschaftsgeschehen nehmen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ein. Forschung und Entwicklung (FuE) ist ein Schlüsselfaktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen und die technologische Leistungsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften. Dieser "Querschnitts-Sektor", der ähnlich wie der IKT-Sektor Unternehmens- und Branchengrenzen übersteigt und in erheblichem Umfang externe Effekte erzeugt (und damit Nutzen für die Allgemeinheit stiftet), erhält deshalb auch starke staatliche Unterstützung. So ist der Staat etwa als Betreiber und Finanzier von Grundlagenforschung tätig, fördert anwendungsorientierte Forschung und technologische Entwicklung/Innovation und setzt Impulse auf Technologiefeldern, die besonders zukunftsträchtig erscheinen und ein breites Anwendungsspektrum verheißen (Beispiele: Nanotechnologie, Biotechnologie oder Mikrosystemtechnik). Außerdem ist er Wegbereiter für technologische Kooperation zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen (durch Förderung von "Verbundprojekten") oder Veranstalter technologischer "Schönheitswettbewerbe" (Beispiel: "BioRegio" zwischen Regionen in Deutschland). Neuerdings zieht sich jedoch der Staat in den meisten Industrieländern angesichts steigender Defizite in den öffentlichen Kassen mehr und mehr aus der Finanzierung privater FuE-Aktivitäten zurück, während das FuEEngagement von Seiten der Wirtschaft zunimmt. FuE-intensive Industriezweige (zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, Nachrichten- und Computertechnik) und Dienstleistungsbranchen mit hohem Wissensanteil (zum Beispiel Nachrichtenübermittlung, Datenverarbeitung oder Softwareentwicklung) expandieren deutlich stärker als technologisch weniger anspruchsvolle Tätigkeiten. In den technologieintensiven Bereichen schreitet auch die internationale Arbeitsteilung schneller voran als in der übrigen Wirtschaft. Dies ist zum einen am wachsenden Gewicht FuE-intensiver Produkte im Welthandel zu erkennen. Dabei zeigen Erzeugnisse der Spitzentechnologie (Beispiele: Elektronische Bauelemente, Datenverarbeitungsgeräte, Prozesssteuerungsanlagen, pharmazeutische Substanzen) die stärkste Dynamik: Ihr Anteil am Welthandel ist von rund 15 Prozent gegen Ende der achtziger Jahre auf gegenwärtig etwa 25 Prozent angestiegen, während das Segment technologisch einfacher Produkte kontinuierlich geschrumpft ist. Zum anderen findet eine immer stärkere Vernetzung technologischer Aktivitäten in der Welt statt. Immer öfter vergeben Unternehmen FuE-Aufträge an ausländische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um Entwicklungs- und Innovationszeiten zu verkürzen und Zugang zu spezifischem und komplementärem Wissen zu gewinnen, das intern nicht verfügbar ist. Darüber hinaus investieren die Unternehmen in zunehmendem 44 Maße selbst im ausländischen FuE-Sektor. Die chemisch-pharmazeutische Industrie, die am stärksten internationalisierte Branche der deutschen Wirtschaft, tätigt bereits etwa ein Drittel ihrer FuE-Ausgaben im westlichen Ausland. Häufiges Motiv der FuE bei ausländischen Tochtergesellschaften inländischer Unternehmen ist die Anpassung im Heimatland entwickelter Produkte an die lokalen Gegebenheiten im Gastgeberland (Anpassungsentwicklung). Verstärkt entwickeln die Auslandstöchter der Unternehmen aber auch eigenständig neue Produkte (Innovationsentwicklung), die weltweit vermarktet werden, und führen grundlegende Entwicklungsaufgaben für das gesamte Unternehmen oder den Gesamtmarkt einzelner Geschäftsbereiche des Unternehmens durch. Voraussetzung hierfür ist die Erschließung ausländischer Technologiequellen. Deshalb unterhalten zum Beispiel zahlreiche deutsche Unternehmen eigene Forschungszentren in der Nähe führender amerikanischer Universitäten. Dies zeigt, dass die Nutzung komparativer Vorteile des Forschungsstandortes ein wichtiges Motiv bei den FuEAktivitäten deutscher Unternehmen in den USA ist. Weitere Motive kommen hinzu. So bevorzugen einige deutsche Pharma- und Nahrungsmittelunternehmen für ihre Forschungsabteilungen US-amerikanische Standorte, weil sie dort weniger strengen gentechnologischen Rechtsbestimmungen unterworfen sind und leichteren Zugang zu den einschlägigen Forschungszentren haben. Bauwirtschaft Die Bauwirtschaft galt bis vor kurzem als einer der Produktionsbereiche, die der Globalisierung am wenigsten ausgesetzt sind. Hohe Transportkosten für Baustoffe, Immobilität des Endprodukts, überwiegend handwerkliche Bautechnik, Regionalität des Facharbeitermarktes, nationale Bauvorschriften und Zugangsbeschränkungen (öffentliches Vergabewesen) schützten sie vor internationaler Konkurrenz. Dies hat sich radikal geändert: Immer mehr Teile werden fabrikmäßig vorgefertigt (Elementbauweise, Fertighäuser), sodass sowohl die Transportkosten, bezogen auf die Wertschöpfung, als auch in der Produktion die Stückkosten in Abhängigkeit von der produzierten Menge sinken. Für größere öffentliche Projekte besteht Ausschreibungspflicht, und die Auftraggeber dürfen heimische Anbieter dabei nicht mehr in ähnlichem Maße wie früher bevorzugen. Entsprechend diesen Veränderungen hat sich auch die Marktstruktur internationalisiert. Wenige Großunternehmen beherrschen den Markt für Großprojekte. Sie können ihre gesamte Baulogistik international organisieren und sich die preiswertesten Zulieferer aussuchen. Damit verweisen sie die traditionell mittelständische Bauwirtschaft mehr und mehr auf die regionale und lokale Nischenproduktion in Form von Eigenheimen, begrenzten Tiefbauarbeiten und Instandsetzungen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, setzen kleine und mittlere Unternehmen vielfach auch preiswerte Arbeitskräfte aus dem Ausland ein. Unter diesen Bedingungen werden kurzfristig nach Tarif bezahlte Bauwerker immer häufiger arbeitslos; mittelfristig geraten auch die Tariflöhne unter Druck. Um einer solchen Entwicklung entgegenzutreten, wurden in der Europäischen Union "Entsenderegelungen" eingeführt. Das deutsche Arbeitnehmer-Entsendegesetz etwa bestimmt, dass für ausländische Arbeiter auf deutschen Baustellen der im Tarifvertrag für die deutsche Bauwirtschaft festgelegte Mindestlohn gilt. Langfristig wird jedoch der Beruf des Bauarbeiters von den Einkommenschancen her weniger attraktiv. Es sei denn, die heimischen Interessenten bilden sich besser aus und besetzen das - wachsende - obere Segment der bauwirtschaftsbezogenen Berufe. Dienstleistungen Besonders geschützt bzw. national zersplittert waren bis vor kurzem auch die Dienstleistungsmärkte. Dies gilt für viele Sparten auch heute noch, so vor allem für Handwerk, Reinigung, Gesundheits- und Hygienedienste, aber auch für öffentliche und soziale Dienstleistungen im weiteren Sinne. Dagegen sind die - auch oder ausschließlich unternehmensnahen Dienste heute einerseits stark der internationalen Konkurrenz ausgesetzt und können andererseits selber Auslandsmärkte besetzen oder mit ausländischen Partnern kooperieren. Oft ist die Globalisierung hier sogar extrem ausgeprägt. Elektronische Dienste sind überhaupt nicht mehr standortgebunden. Die großen Banken sind allgegenwärtig. Versicherungspolicen können europaweit vertrieben 45 werden. Auch Unternehmen aus Drittländern können sich niederlassen und haben dann die gleichen Rechte. Die großen Anwaltskanzleien, Steuer- und Unternehmensberatungsbüros sind in angelsächsischem wie in deutschem und französischem Recht gleichermaßen zu Hause. Allerdings handelt es sich hier vielfach um Aktivitäten, bei denen das Vertrauen der Kundschaft eine besondere Rolle spielt. Sie bevorzugt deshalb meist bewährte heimische Anbieter. Doch längst haben diese mit ausländischen Partnern Allianzen gebildet oder mehr noch - ausländische Firmen übernommen, um deren standortgebundenes Vertrauenskapital zu nutzen. Diese Tendenz ist mittlerweile im Dienstleistungssektor ausgeprägter als in der Industrie und unter den Dienstleistungsbranchen besonders stark bei den Finanzdiensten und den unternehmensnahen Diensten. Allerdings wird die Internationalisierung des Dienstleistungssektors noch vielfach durch staatliche Interventionen erheblich beeinträchtigt. Nicht Zölle und Quoten (Grenzschranken), wie in der Industrie, sondern Regulierungen im Inneren der Länder (Inlandsschranken) bilden im Dienstleistungssektor das Haupthindernis gegen mehr internationale Arbeitsteilung. Vorschriften, Auflagen und Beschränkungen unterschiedlichster Art erschweren hier den Marktzugang ausländischer Anbieter und diskriminieren diese gegenüber inländischen Unternehmen. Verbreitet sind ebenfalls Diskriminierungen zwischen ausländischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern. In der Uruguay-Runde des GATT wurde mit dem Allgemeinen Dienstleistungsabkommen (General Agreement on Trade in Services - GATS) die Grundlage für den Abbau der Zugangshindernisse und Diskriminierungen geschaffen, und in zwei sektoralen Abkommen (Telekommunikation und Finanzdienstleistungen) wurden bereits erste Liberalisierungserfolge erzielt. Die laufende Doha-Runde der WTO soll das Regulierungsdickicht weiter lichten und mehr Marktzugang, Gleichbehandlung in- und ausländischer Unternehmen (National Treatment) und Meistbegünstigung (Gleichbehandlung ausländischer Anbieter) gewährleisten. Dabei wird es in einigen "sensiblen" Bereichen zu harten Auseinandersetzungen kommen, etwa im Bereich öffentlicher Versorgungsleistungen (Gesundheitswesen, soziale Dienstleistungen, Bildung) oder bei audiovisuellen Dienstleistungen. Die Europäische Union will zum Beispiel, entgegen den Forderungen der USA, die Bevorzugung europäischer audiovisueller Produktionen (in Fernsehprogrammen und bei der Filmförderung) beibehalten und macht hier - im Verein mit mächtigen Interessengruppen - die "kulturelle Ausnahme" geltend. Danach würde das Gut "Wahrung kultureller Vielfalt" über das Gut "Freihandel" gestellt. Von besonderem Interesse für Entwicklungsländer ist eine Liberalisierung bei der Freizügigkeit der Arbeitskräfte. Einige Industrieländer möchten diese verhindern, weil sie negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt fürchten, die eine "vorübergehende Einreise natürlicher Personen zur Erbringung von Dienstleistungen" haben könnte. Quellentext Wachstumssektor Dienstleistungen In deutschen Programmkinos bekommt das "sehr geehrte Publikum" dieser Tage einen irritierenden Spot zu sehen. "Der angekündigte Film musste leider aus dem Programm genommen werden", steht da in weißer Schrift auf schwarzer Leinwand. Schnitt. "Er wurde mit Hilfe öffentlicher Filmförderung finanziert." Schnitt. "Das bedeutet einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien des freien Welthandels." Schnitt. Verstoß gegen den freien Welthandel? So bestimme es, erklärt das Schriftband in den Kinos weiter, das General Agreement on Trade in Services, kurz GATS, das "am 1. 1. 2005 in Kraft getreten" sei. Die Zukunftsvision des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac endet lakonisch: "Sie sehen statt dessen einen aktuellen Blockbuster." Denn Hollywood-Produktionen rechnen sich von allein. "Gute Unterhaltung. Ihre WTO." [...] Reine Panikmache oder reale Perspektive? Anfang dieser Woche (erste Aprilwoche 2003 - Anm. d. Red.) hat jedenfalls die heiße Phase bei einem der umstrittensten Themen der laufenden Welthandelsrunde begonnen. Bei der WTO trudeln seit dem 31. 46 März die Liberalisierungsangebote und -forderungen für den Dienstleistungssektor ein, die Regierungen aus aller Welt an andere Länder gerichtet haben. Bis zum Herbst wird um Kompromisse gerungen, im September müssen die Minister im mexikanischen Cancœn verhandeln, und spätestens 2005 soll der neue GATS-Vertrag unterschrieben sein. [...] Dienstleistungen sind ein Riesengeschäft. Allein im vergangenen Jahr wurden mit dem Service an Mensch, Maschine und Umwelt weltweit 1,34 Billionen Dollar umgesetzt. In den OECD-Ländern erwirtschaftet dieser Sektor inzwischen 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, er beschäftigt zwei von drei Arbeitnehmern. Schon jetzt exportiert Europa jährlich Services im Wert von 300 Milliarden Dollar; die Reinigung von Abwasser, den Verkauf von Versicherungen oder den Betrieb von Telefonnetzen. Doch noch beschränkt sich der Anteil der Dienstleistungen auf nur ein Fünftel des gesamten Welthandels, noch hemmen Zölle und nationale Auflagen das Wachstum. Würden sie abgebaut, könnten laut einer OECD-Studie jährlich Wohlfahrtsgewinne von 130 Milliarden Dollar entstehen. Kein Wunder, dass in den Blütenträumen der Liberalisierungsfans alle Handelshemmnisse schnell aus dem Weg geräumt werden. [...] So fordert der Vertrag, der als Teil des Welthandelsabkommens 1995 in Marrakesch von der Bundesregierung und mehr als 140 weiteren Ländern unterzeichnet wurde, die "fortschreitende Liberalisierung" sämtlicher Dienstleistungsmärkte. Kontinuierlich soll der globale Handel mit Planung und Kompetenz, Versicherungen und Sozialleistungen ausgeweitet werden, in immer mehr Ländern, auf zwölf Feldern vom Transport bis zum Tourismus, von Post- und Kurierdiensten bis zur Energieversorgung. [...] Die empfindlichsten Bereiche Bildung, Gesundheit und audiovisuelle Dienstleistungen hingegen sind ausdrücklich ausgeklammert. Also keine schwarzen Leinwände [...]. Nichtregierungsorganisationen fürchten, dass GATS ganz unterschiedlichen Ländern die gleichen Technologien, gleichen Systeme, gleichen Entwicklungswege aufdrängt. Zudem ohne Rückfahrkarte, wenn sich die Strategie nicht bewähren sollte. Denn wer sich beim GATS einmal zur Marktöffnung verpflichtet hat, der muss bei einer Umkehr hohe Kompensationen bezahlen. [...] "Die WTO wird niemanden zwingen, seine Dienstleistungsmärkte für ausländische Konkurrenten zu öffnen", beschwichtigt WTO-Chef Supachai Panitchpaktdi. [...] Die Realität jedoch, wissen Beobachter von Handlungsrunden, entsteht am Ende unter Druck, nach dem Motto: gibst du mir, geb ich dir. [...] Starke Länder sind in der Lage, die Liberalisierung zu steuern und zu ihrem Vorteil zu nutzen. Doch die Ärmeren? [...] 23 Staaten, darunter viele Schwellenländer, haben bislang GATS-Forderungen an die Europäische Union gerichtet - während diese in 109 Ländern Liberalisierungsschritte fordert. Dies zeigt, wer an dieser Entwicklungsrunde das größte Interesse hat. [...] "Während sie ihre Versprechen nicht erfüllen, drängen sie uns ihre Interessen auf", sagt Aileen Kwa. Die Wissenschaftlerin aus Bangkok zieht in einer Studie für die DritteWelt-Organisation Focus on the Global South eine traurige Bilanz: "Viele Entwicklungsländer sind sehr nervös, dass ihre kleinen Dienstleistungsindustrien demnächst der Konkurrenz aus dem Norden ausgeliefert werden." Sie fürchteten zudem, dass neue Regeln zum Schutz von ausländischen Direktinvestitionen und neue internationale Wettbewerbsregeln ihren Spielraum weiter einschränken. Hinzu kommt, dass die Interessen der armen Staaten bei der WTO in Genf nicht so gut vertreten werden wie jene der Reichen. Oft können sich Entwicklungsländer nur einen Vertreter leisten, und der sieht sich dann einer Phalanx von gut ausgebildeten Handelsjuristen aus Washington und Brüssel gegenüber. Wer würde da nicht kapitulieren. [...] Christian Grefe, Petra Pinzler, "Immer fair, sagt die Katze zu den Mäusen", in: Die Zeit Nr. 15 vom 3. April 2003. Finanzmärkte Nirgendwo hat sich die Globalisierung so deutlich beschleunigt wie in der Finanzsphäre. Die Mobilisierungskosten sind hier besonders gering. Seit in der EU, in der OECD und auch weltweit nicht mehr oder kaum noch Kapitalverkehrsbeschränkungen existieren, können Anleger minutenschnell ihr Geldvermögen (Portefeuille) international umschichten oder ihr flüssiges Geld in den verschiedensten Währungen anlegen. Die 47 Schwankungen der Devisenmärkte (Volatilität) waren ein Grund für die politisch Verantwortlichen, den Europäischen Binnenmarkt, zu dem wesentlich auch die Kapitalverkehrsfreiheit gehört, durch eine Währungsunion zu "krönen". Denn dadurch wird die durch Volatilität verursachte Unsicherheit bei grenzüberschreitenden Transaktionen in Europa ausgeschaltet. Auf der Grundlage wechselseitig verflochtener (integrierter) Märkte und sich angleichender (konvergenter) Wirtschaftspolitik wurden die nationalen Währungen durch die Einheitswährung "Euro" ersetzt. Voraussetzung dafür war, dass die zwölf Teilnehmerländer - es fehlen Großbritannien, Dänemark und Schweden - die so genannten Konvergenzkriterien erfüllten: Sie mussten ihre Preise erfolgreich stabilisiert haben, ihr Zinsniveau durfte nicht wesentlich von dem der preisstabilsten Mitgliedstaaten abweichen, ihre laufende Staatsverschuldung durfte und darf künftig nicht die Marke von drei Prozent, die ihres gesamten öffentlichen Schuldenstandes nicht die Marke von 60 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes überschreiten. Der Schritt zur Währungsunion bringt für die Mitglieder einige Vorteile mit sich, wie zum Beispiel die Verminderung von Unsicherheit und eine Vereinfachung ökonomischer Transaktionen. Er bedeutet für sie aber zugleich ein weiteres Stück Globalisierung bzw. Regionalisierung, da er alle anderen Systemelemente, vor allem die nationalen Löhne, unter verstärkten Anpassungsdruck setzt. Denn bei einer Einheitswährung kann sich ein beteiligtes Land dem Kostenwettbewerb nicht mehr einfach durch eine Währungsabwertung entziehen. Der Markt wird durchsichtiger und der Wettbewerb noch härter. Der Handel an den Devisenmärkten konzentriert sich seit der Einführung des Euro auf das Währungsdreieck US-Dollar - Euro - Yen. Daneben haben auch das Britische Pfund und der Schweizer Franken erhebliches Gewicht. Hauptakteure sind neben den beteiligten Notenbanken die "institutionellen Anleger", also "Kapitalsammelstellen" wie Versicherungen, Pensions- und Investmentfonds. Sie geben die Richtung vor, an der sich die kleinen Anleger orientieren. Der Euro beeinflusst in hohem Maße das Marktverhalten der Anleger. In Europa zählt nun nicht mehr das Länderrisiko, sondern nur noch das Branchen- oder das individuelle Unternehmensrisiko. Entkoppelung der Finanz- und Warenmärkte Tagtäglich werden kaum vorstellbare Beträge an Finanzkapital "um den Globus gejagt". Ziel ist es, Ertragsdifferenzen - zum Beispiel Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Währungsräumen - auszunutzen (Arbitrage). Solche Differenzen ergeben sich vor allem aus von den Marktteilnehmern erwarteten Wechselkursänderungen. Diese sind nach wie vor auch Ausdruck von Unterschieden in den so genannten Fundamentaldaten: Wenn die Preissteigerungsraten in den einzelnen Ländern, ausgedrückt in der jeweiligen Landeswährung, zu unterschiedlich sind, entsprechen die Umrechnungskurse bald nicht mehr der gegenseitigen "Kaufkraftparität" und müssen daher angepasst werden. Ähnliches gilt, wenn ein Land auf Dauer mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert und nicht länger in der Lage ist, zum Ausgleich ausländisches Kapital - zum Beispiel in Form von Aktien - anzuziehen. Dann wird zur Begleichung der entsprechenden Rechnungen die Währung dieses Landes am Devisenmarkt andauernd stark angeboten und schwach nachgefragt, so dass der Wechselkurs fällt. Diese Veränderung der "relativen Preise" im Außenhandel bremst den Importanstieg und fördert den Export des Landes und sorgt damit für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage auch auf den Gütermärkten. Eine Währungsabwertung gilt jedoch als Ausdruck wirtschaftlicher Schwäche eines Landes. Deshalb ist sie politisch oft nicht erwünscht. Hinzu kommt, dass ständige Kursschwankungen ein Unsicherheitsmoment in die internationalen Geschäftsbeziehungen hineintragen. Daher interveniert die Notenbank eines Landes oft mit Stützungskäufen bzw. -verkäufen am Devisenmarkt, oder sie erhöht das Zinsniveau, um Kapitalabflüsse größeren Ausmaßes zu verhindern. Das kann sie natürlich nur in engen Grenzen durchhalten, weil sich mit zunehmender Intervention ihre Devisenreserven erschöpfen und weil ein zu hoher Zins der Konjunktur im Lande schadet. Früher oder später muss der aufgestaute Anpassungsbedarf daher in eine Wechselkurskorrektur münden. 48 Bei einem Wechselkursregime der "Stufenflexibilität" wie im Europäischen Währungssystem (EWS) bildet sich der Wechselkurs nicht ausschließlich durch privates Devisenangebot und private Devisennachfrage. Vielmehr bestimmen auch Regierungsentscheidungen, an die die beteiligten Notenbanken in ihrem Devisenmarktverhalten gebunden sind, die Kursentwicklung. Durch Wechselkurskorrekturen wurden deshalb zuweilen enorme Ertragssprünge realisiert. Dies hat dazu geführt, dass zumindest auf kürzere Sicht immer weniger die zu Grunde liegenden Handelsgeschäfte und die Fundamentaldaten als vielmehr die davon abgelöste Spekulation oder Arbitrage den Kurs bestimmen und andere Devisenmarktteilnehmer verunsichern. Weil es in Anbetracht der immensen Transaktionssummen den Notenbanken kaum noch möglich war, die Spekulation durch Kursstützung zu entmutigen, wurde 1993 in der EU das EWS faktisch außer Kraft gesetzt, indem die vereinbarten höchstzulässigen wechselseitigen Kursschwankungen der Teilnahmewährungen von ±2,25 Prozent auf ±15 Prozent erweitert wurden. Derivatenhandel Die Schwankungen der Devisen- und Finanzmärkte haben seit den achtziger Jahren neue Finanzinstrumente hervorgebracht, die vom Basisgeschäft abgeleitet sind und deswegen Derivate heißen. Hierzu gehören in erster Linie Terminkontrakte (Futures, Forwards, Options). Diese beinhalten die Pflicht bzw. das Recht zum Kauf/ Verkauf beispielsweise von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen und Rohstoffen. Dabei wird zum Beispiel für einen bestimmten Rohstoff, der erst später geliefert werden soll, schon zu Beginn des Geschäfts der Kaufpreis festgelegt. Das Geschäft wird also gegen Schwankungen des Preises für diesen Rohstoff zwischen Vertragsabschluss und Lieferung abgesichert. Mit Derivaten wird am Terminmarkt gehandelt. Derivate bilden nicht per se eine Gefahr für das internationale Finanzsystem. Doch kann mit ihnen auch spekuliert werden. Die Volatilität der Devisen- und Finanzmärkte, die das Derivatgeschäft ja erst hervorgebracht hat, könnte hierdurch noch gesteigert und dadurch die Stabilität des internationalen Finanzsystems erschüttert werden. Wenn sich Finanzinstitute verspekulieren und zusammenbrechen, kann es zu Kettenreaktionen kommen (Domino-Effekt), da die Institute häufig untereinander verschuldet sind oder ihr Geld gemeinsam in Großprojekte investiert haben. Dann nehmen auch die Einleger Schaden. Großes Aufsehen erregte im Februar 1995 in diesem Zusammenhang der Kollaps der 232 Jahre alten britischen Handelsbank Barings: Ein in Singapur tätiger Devisen- und Derivatenhändler von "Baring Futures Singapore" hatte unkontrolliert auf Kurssteigerungen für eine bestimmte Gruppe japanischer Aktien spekuliert. Doch die Kursentwicklung verlief anhaltend genau seinen Erwartungen entgegengesetzt, er musste sich zu den Fälligkeitsterminen jeweils teuer eindecken und verspielte fast 1,4 Milliarden Dollar. Nicht nur das Singapurer Tochterunternehmen, auch die britische Muttergesellschaft brach daraufhin zusammen. Finanzinstitute und staatliche Aufsichtsbehörden sind deshalb nunmehr bemüht, dem Marktgeschehen und insbesondere dem Handel mit Derivaten Grenzen zu setzen. Eine Möglichkeit wäre, Devisengeschäfte durch eine Steuer wie zum Beispiel die Tobin-Steuer zu verteuern - dies träfe freilich auch die "normale" Risikoabsicherung. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, den Handlungsspielraum der Akteure dadurch einzuschränken, dass ihre Engagements an den Devisenmärkten strenger an die Ausstattung mit Eigenmitteln gebunden werden. Die Institute selber setzen mehr auf innere Transparenz und Professionalisierung des Risikomanagements. Die Entwicklung eines internationalen Ordnungsrahmens für die Finanzmärkte steckt noch in den Anfängen. 49