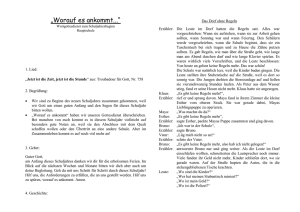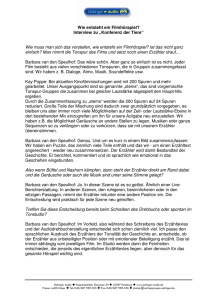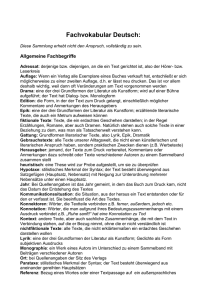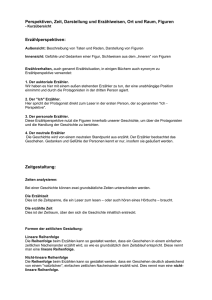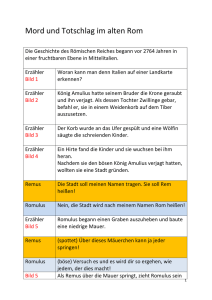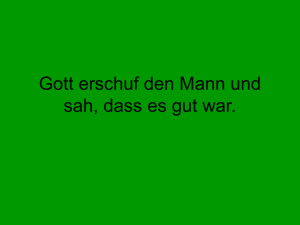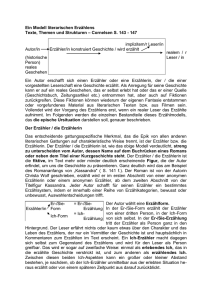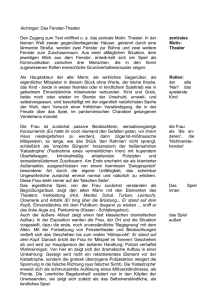eine zwischenbemerkung über die angst
Werbung

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TEXTE UND ARBEITSHILFEN TEKSTAI, UŽDUOTYS, PAAIŠKINIMAI MOKOMOJI KNYGA Antrasis pataisytas leidimas V šĮŠ ia u liųu n iv e rsite tole id y k la 2 0 0 3 Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tarybos patvirtinta kaip mokomoji knyga vokiečių filologijos/kalbos studijų programų studentams. Sudarė Jadzė Šapalienė Recenzavo Vilniaus pedagoginio universiteto docentė dr. Asta Beniulienė, Šiaulių universiteto doktorantė Reda Toleikienė ISBN 9986-38-432-X © Jadzė Šapalienė, 2003 © VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003 2 Ši mokomoji knyga skiriama aukštesnių kursų studentams germanistams. Ji taip pat gali būti naudojama kaip papildoma medžiaga dirbant pagal vadovėlį Literaturkurs Deutsch (sudarytojas Ulrich Häussermann). Leidinį sudaro trys dalys: tekstai analizei ir interpretavimui, tekstai pranešimams, referavimui ir interpretavimui, teorinė medžiaga, aiškinamasis interpretacijos ir analizės terminų žodynėlis. Pirmojoje dalyje pateikiami vokiečių, austrų ir šveicarų autorių įvairių žanrų bei stilių tekstai su užduotimis, orientuotomis į tekstų analizę ir interpretavimą bei leksinių ir gramatinių struktūrų įtvirtinimą. Antrojoje dalyje yra informacinio pobūdžio tekstų, pagal kuriuos rekomenduojama parengti trumpus pranešimus, o literatūrinius tekstus analizuoti ar interpretuoti laisvai pasirinktais aspektais. Trečiojoje dalyje rasite teorinės medžiagos santraukas apie romano, novelės, trumpos istorijos, pasakojimo, dramos, pasakos žanrų bruožus, reikalavimus kai kurioms tekstų rūšims (pvz. charakteristikai, pranešimui, referatui) rašyti, aiškinamąjį interpretacijos ir analizės terminų žodynėlį ir pan. Tai jums palengvins atlikti užduotis. Šis leidinys taip pat gali būti naudingas perkvalifikavimo kursų klausytojams, mokantiems vokiečių kalbą aukštesniu lygiu ir besidomintiems literatūrinio teksto analize. Be to, tekstai yra įvairaus sudėtingumo, todėl su kai kuriais gali dirbti ir žemesnių kursų studentai, nors jiems dar neskaitytas stilistikos kursas. Užduotyse ir III dalyje pritaikytos reformuotos vokiečių kalbos rašybos taisyklės. Nuoširdžiai dėkoju padėjusiems parengti šią knygą leidybai, recenzentėms ir visiems, patarusiems ar kitaip prisidėjusiems. Sudarytoja 3 INHALT TEIL I. Texte zur Analyse und Interpretation ................................................. 6 Thomas Mann. Buddenbrooks (Auszug) ............................................................... 7 Heinrich Mann. Der Untertan (Auszug).............................................................. 12 Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz (Text 1, 2) ................................................ 16 Max Frisch. Geschichte von Isidor (Auszug)...................................................... 24 Friedrich Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker (Auszug) .......................... 30 Renate Welsh. Johanna (Auszug) ........................................................................ 34 Gottfried Keller. Kleider machen Leute (Auszug) .............................................. 37 Thomas Mann. Tonio Kröger (Text 1, 2, 3) ........................................................ 41 Siegfried Lenz. Eine Liebesgeschichte ................................................................ 51 Siegfried Lenz. Autobiographische Skizze .......................................................... 54 Gabriele Wohmann. Käme doch Schnee ............................................................. 59 Gabriele Wohmann. Wer kommt in mein Häuschen ........................................... 61 Peter Bichsel. Die Tochter .................................................................................. 65 Peter Bichsel. November .................................................................................... 67 Wolfgang Borchert. Nachts schlafen die Ratten doch ......................................... 70 Ilse Aichinger. Das Fenster-Theater .................................................................... 74 Heinrich Böll. Unberechenbare Gäste ................................................................. 78 Heinrich Böll. Die Botschaft ............................................................................... 85 Johannes Bobrowski. Brief aus Amerika ............................................................ 90 Peter Handke. Als ich fünfzehn war (Auszug) ................................................... 93 Ödön von Horváth. Geschichte einer kleinen Liebe............................................ 96 Hermann Hesse. Märchen vom Korbstuhl .......................................................... 99 Bertolt Brecht. Wenn die Haifische Menschen wären....................................... 104 Kurt Tucholsky. Ratschläge für einen schlechten Redner ................................ 107 Kurt Tucholsky. Die Kunst, falsch zu reisen ..................................................... 111 TEIL II. Texte zum Berichten, Referieren und Interpretieren /Analysieren116 Sprache (von Hermann Hesse) .......................................................................... 116 Entstehung und Entwicklung des Wortes theodiscus/deutsch (von Hugo Moser) (Text 1) ............................................................................... 118 Die deutsche Sprache (Text 2) .......................................................................... 120 Die deutsche Sprache (Text 3) .......................................................................... 123 Hochsprache, Umgangssprache, Dialekt (Text 4) ............................................. 125 Die Sprachen in der Sprache (Text 5) ............................................................... 129 Germanen und Romanen. Ein Capriccio (von Werner Ross) ............................ 136 Was macht die Deutschen zu Deutschen? ........................................................ 139 Wer war Eulenspiegel? ..................................................................................... 142 Es war einmal… Die Brüder Grimm ................................................................. 147 Der Vater der deutschen Rechtschreibung. Konrad Duden ............................... 149 “Friedensdolmetsch aller Welt” (G. Sauerwein) ............................................... 151 Die Wege der Quadriga. Das Brandenburger Tor ............................................. 154 Der Boulevard Unter den Linden (von Andrea Hilgenstock) ............................ 156 Die Loreley soll sich möglichst natürlich präsentieren (von Margit Fehlinger) 158 4 Eine Ausstellung zur Geschichte des Marzipans in Lübeck (von Franz Lerchenmüller) .................................................................................................. 160 Feste in Stichworten (von Werner Jost) ............................................................ 162 Feste und Bräuche in der Schweiz .................................................................... 167 Festspiele in Österreich ..................................................................................... 169 Mythen und Sagen aus Österreich (von Käthe Recheis) ................................... 170 Die Crux helvetica (von Georg Kreis) .............................................................. 174 Texte zur Analyse bzw. Interpretation .......................................................... 178 Thomas Bernhard. Mildtätig ............................................................................. 179 Umgekehrt ................................................................................. 179 Ludwig Fels. Das Haus ..................................................................................... 180 Peter Handke. Eine Zwischenbemerkung über die Angst ................................. 181 Franz Hohler. Die drei Beobachter ................................................................... 183 Information................................................................................ 183 Hugo Loetscher. Wenn der Liebe Gott Schweizer wäre ................................... 185 Kurt Marti. Meine Angst lässt grüßen .............................................................. 188 Gerold Späth. Johann Heinrich Allemann ........................................................ 189 King........................................................................................... 190 Robert Walser. Fabelhaft .................................................................................. 191 Lüge auf die Bühne ................................................................... 192 Bedenkliche Geschichte ............................................................ 193 TEIL III. Arbeitshilfen ................................................................................... 195 Die Erlebniserzählung (der Aufsatz) ................................................................. 196 Die Inhaltsangabe.............................................................................................. 196 Die Charakteristik (die Personenbeschreibung) ................................................ 197 Die literarische Charakteristik ........................................................................... 197 Der Bericht ........................................................................................................ 198 Das Interview .................................................................................................... 198 Die Erörterung .................................................................................................. 199 Sprache in der Erörterung ................................................................................. 200 Die Seminararbeit (das Referat) ........................................................................ 203 Das Referat ....................................................................................................... 205 Wendungen für Textzusammenfassungen ......................................................... 206 Schwerpunkte einer vereinfachten Textanalyse ................................................ 208 Kategorien der Analyse epischer Texte............................................................. 210 Arbeitshinweise für die Analyse von Gedichten ............................................... 211 Aspekte der Textinterpretation .......................................................................... 214 Der Roman ........................................................................................................ 215 Merkmale des Dramas ...................................................................................... 216 Märchen, Sage, Legende ................................................................................... 217 Novelle und Kurzgeschichte ............................................................................. 217 Erzählung, Novelle, Kurzgeschichte (ein schematischer Vergleich)................. 219 Glossar: Begriffe für die Texterschließung ....................................................... 220 Literaturverzeichnis .......................................................................................... 231 5 TEIL I. Texte zur Analyse und Interpretation Von den vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus dem eigenen Geist erschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte. (Hermann Hesse) … Lesen, das ist die Beschäftigung mit der Menschenseele. (Thomas Mann) Die Texte erklären nicht mich, sondern an mir ein Stück unseres Lebens. (Hartmut von Hentig) Methodisches Interpretieren ist in der Regel ein mehr oder weniger kontrolliertes “Hin-und-Her” (Sartre) zwischen kritischer Verständigung über den Wahrheitsgehalt und die Wirksamkeit des Textes, analytischer Überprüfung und Begründung der in den Verständigungsakten getroffenen Feststellungen und methodischer Reflexion. (Jürgen Schutte) 6 Thomas Mann BUDDENBROOKS (Auszug) “Was ist das. - Was – ist das…” “Je, den Düwel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!” Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weißlackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt. “Tony!” sagte sie, “ich glaube, daß mich Gott –“ Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, in einem Kleidchen aus ganz leichter changierender Seide, den hübschen Blondkopf ein wenig vom Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Zimmer hinein, wiederholte noch einmal: “Was ist das”, sprach darauf langsam: “Ich glaube, daß mich Gott”, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu: “- geschaffen hat samt allen Kreaturen”, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun, glückstrahlend und unaufhaltsam, den ganzen Artikel daher, getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, anno 1835 unter Genehmigung eines hohen und wohlweisen Senates, neu revidiert herausgegeben war. Wenn man im Gange war, dachte sie, war es ein Gefühl, wie wenn man im Winter auf dem kleinen Handschlitten mit den Brüdern den “Jerusalemsberg” hinunterfuhr: es vergingen einem geradezu die Gedanken dabei, und man konnte nicht einhalten, wenn man auch wollte. “Dazu Kleider und Schuhe”, sprach sie, “Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker und Vieh…” Bei diesen Worten aber brach der alte Monsieur Johann Buddenbrook einfach in Gelächter aus, in sein helles, verkniffenes Kichern, das er heimlich in Bereitschaft gehalten hatte. Er lachte vor Vergnügen, sich über den Katechismus mokieren zu können, und hatte wahrscheinlich nur zu diesem Zwecke das kleine Examen vorgenommen. Er erkundigte sich nach Tonys Acker und Vieh, fragte, wieviel sie für den Sack Weizen nehme, und erbot sich, Geschäfte mit ihr zu machen. Sein rundes, 7 rosig überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, dem er beim besten Willen keinen Ausdruck von Bosheit zu geben vermochte, wurde von schneeweiß gepudertem Haar eingerahmt, und etwas wie ein ganz leise angedeutetes Zöpflein fiel auf den breiten Kragen seines mausgrauen Rockes hinab. Er war, mit seinen siebenzig Jahren, der Mode seiner Jugend nicht untreu geworden; nur auf den Tressenbesatz zwischen den Knöpfen und den großen Taschen hatte er verzichtet, aber niemals im Leben hatte er lange Beinkleider getragen. Sein Kinn ruhte bereit, doppelt und mit einem Ausdruck von Behaglichkeit auf dem weißen Spitzenjabot. Alle hatten in sein Lachen eingestimmt, hauptsächlich aus Ehrerbietung gegen das Familienoberhaupt. Madame Antoinette Buddenbrook, geborene Duchamps, kicherte in genau derselben Weise wie ihr Gatte. Sie war eine korpulente Dame mit dicken weißen Locken über den Ohren, einem schwarz und hellgrau gestreiften Kleide ohne Schmuck, das Einfachheit und Bescheidenheit verriet, und mit noch immer schönen und weißen Händen, in denen sie einen kleinen, sammetnen Pompadour auf dem Schoße hielt. Ihre Gesichtszüge waren im Laufe der Jahre auf wunderliche Weise denjenigen ihres Gatten ähnlich geworden. Nur der Schnitt und die lebhafte Dunkelheit ihrer Augen redeten ein wenig von ihrer halb romanischen Herkunft; sie stammte großväterlicherseits aus einer französisch-schweizerischen Familie und war eine geborene Hamburgerin. Ihre Schwiegertochter, die Konsulin Elisabeth Buddenbrook, eine geborene Kröger, lachte das Krögersche Lachen, das mit einem pruschenden Lippenlaut begann, und bei dem sie das Kinn auf die Brust drückte. Sie war, wie alle Krögers, eine äußerst elegante Erscheinung, und war sie auch keine Schönheit zu nennen, so gab sie doch mit ihrer hellen und besonnenen Stimme, ihren ruhigen, sicheren und sanften Bewegungen aller Welt ein Gefühl von Klarheit und Vertrauen. Ihrem rötlichen Haar, das auf der Höhe des Kopfes zu einer kleinen Krone gewunden und in breiten künstlichen Locken über die Ohren frisiert war, entsprach ein außerordentlich zartweißer Teint mit vereinzelten kleinen Sommersprossen. Das Charakteristische an ihrem Gesicht mit der etwas zu langen Nase und dem kleinen Munde war, daß zwischen Unterlippe und Kinn sich durchaus keine Vertiefung befand. Ihr kurzes Mieder mit 8 hochgepufften Ärmeln, an das sich ein enger Rock aus duftiger, hellgeblümter Seide schloß, ließ einen Hals von vollendeter Schönheit frei, geschmückt mit einem Atlasband, an dem eine Komposition von großen Brillanten flimmerte. Der Konsul beugte sich mit einer etwas nervösen Bewegung im Sessel vornüber. Er trug einen zimmetfarbenen Rock mit breiten Aufschlägen und keulenförmigen Ärmeln, die sich erst unterhalb des Gelenkes eng um die Hand schlossen. Seine anschließenden Beinkleider bestanden aus einem weißen, waschbaren Stoff und waren an den Außenseiten mit schwarzen Streifen versehen. Um die steifen Vatermörder, in die sich sein Kinn schmiegte, war die seidene Krawatte geschlungen, die dick und breit den ganzen Ausschnitt der buntfarbigen Weste ausfüllte… Er hatte die ein wenig tiefliegenden, blauen und aufmerksamen Augen seines Vaters, wenn ihr Ausdruck auch vielleicht träumerisch war; aber seine Gesichtszüge waren ernster und schärfer, seine Nase sprang stark und gebogen hervor, und die Wangen, bis zu deren Mitte blonde, lockige Bartstreifen liefen, waren viel weniger voll als die des Alten. […] Man saß im ‘Landschaftszimmer’, im ersten Stockwerk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnte. Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünne Teppich, der den Fußboden bedeckte, Idylle im Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts, mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten, nett bebänderten Schäferinnen, die reinliche Lämmer am Rande spiegelnden Wassers im Schoße hielten oder sich mit zärtlichen Schäfern küßten… Ein gelblicher Sonnenuntergang herrschte meistens auf diesen Bildern, mit dem der gelbe Überzug der weißlackierten Möbel und die gelbseidenen Gardinen vor den beiden Fenstern übereinstimten. Im Verhältnis zu der Größe des Zimmers waren die Möbel nicht zahlreich. Der runde Tisch mit den dünnen, geraden und leicht mit Gold ornamentierten Beinen stand nicht vor dem Sofa, sondern an der entgegengesetzten Wand, dem kleinen Harmonium gegenüber, auf dessen Deckel ein Flötenbehälter lag. Außer den regelmäßig an den Wänden verteilten, steifen Armstühlen gab es nur noch einen 9 kleinen Nähtisch am Fenster und, dem Sofa gegenüber, einen zerbrechlichen Luxus-Sekretär, bedeckt mit Nippes. Durch eine Glastür, den Fenstern gegenüber, blickte in das Halbdunkel einer Säulenhalle hinaus, während sich linker Hand vom Eintretenden die hohe, weiße Flügeltür zum Speisesaale befand. An der anderen Wand aber knisterte, in einer halbkreisförmigen Nische und hinter einer kunstvoll durchbrochenen Tür aus blankem Schmiedeeisen, der Ofen. Denn es war frühzeitig kalt geworden. Draußen, jenseits der Straße, war schon jetzt, um die Mitte des Oktobers, das Laub der kleinen Linden vergilbt, die den Marienkirchhof umstanden, um die mächtigen gotischen Ecken und Winkel der Kirche pfiff der Wind, und ein feiner, kalter Regen ging hernieder. Madame Buddenbrook, der Älteren, zuliebe hatte man die doppelten Fenster schon eingesetzt. Es war Donnerstag, der Tag, an dem ordnungsmäßig jede zweite Woche die Familie zusammenkam; heute aber hatte man, außer den in der Stadt ansässigen Familiengliedern, auch ein paar gute Hausfreunde auf ein ganz einfaches Mittagbrot gebeten, und man saß nun, gegen vier Uhr nachmittags, in der sinkenden Dämmerung und erwartete die Gäste. Die kleine Antonie hatte sich in ihrer Schlittenfahrt durch den Großvater nicht stören lassen, sondern hatte nur schmollend die immer ein bißchen hervorstehende Oberlippe noch weiter über die untere geschoben. Jetzt war sie am Fuße des ‘Jerusalemsberges’ angelangt; aber unfähig, der glatten Fahrt plötzlich Einhalt zu tun, schoß sie noch ein Stück über das Ziel hinaus… […] Das Glockenspiel von St. Marien setzte mit einem Chorale ein: pang! ping, ping – pung ziemlich taktlos, so daß man nicht zu erkennen vermochte, was es eigentlich sein sollte, aber doch voll Feierlichkeit, und während dann die kleine und die große Glocke fröhlich und würdevoll erzählten, daß es vier Uhr sei, schallte auch drunten die Glocke der Windfangtür gellend über die große Diele, worauf es in der Tat Tom und Christian waren, die ankamen, zusammen mit den ersten Gästen, mit Jean Jacques Hoffstede, dem Dichter, und Doktor Grabow, dem Hausarzt. 10 Thomas Mann (1875–1955) entstammte einer Lübecker Patrizier- und Kaufmannsfamilie. Seit 1893 lebte er meist in München; 1933 Emigration in die Schweiz, USA; 1929 Nobelpreis für Literatur. – Romane: Buddenbrooks (1901), Der Zauberberg (1924), Doktor Faustus (1947) u.a.; Novellen: Tonio Kröger (1903), Der Tod in Venedig (1912) u.a.; Erzählungen: Tristan (1903), Der kleine Herr Friedemann (1848), Mario und der Zauberer (1930) u.a. Textarbeit* 1. Aufgaben zum Wortschatz: a) Führen Sie Vieldeutigkeit und Phraseologie zu folgenden Verben und Substantiven an: der Zug, das Gesicht, der Flügel, reichen. Illustrieren Sie das jeweils in mehreren Sätzen. b) Suchen Sie Synonyme zu den Fremdwörtern. 2. Stellen Sie ausführliche Recherchen zu Leben und Schaffen von Thomas Mann (Persönlichkeit, Thematik und Problematik seiner Werke) auf. 3. Analysieren Sie (mündlich oder schriftlich) den Auszug (1. Kapitel des 1. Teiles) nach folgenden Schwerpunkten: Aufbau (Exposition, Einteilung in Abschnitte, Einführung der handelnden Personen etc.) Erzähler (seine Rolle, Darbietungsweisen) verwendete Mittel zum Ausdruck der Expressivität. * Bedienen Sie sich der Arbeitshilfen (Merkmale des Romans, Schwerpunkte der Textanalyse, Glossar u.a.), die Sie im Teil III dieses Buches finden. 11 Heinrich Mann DER UNTERTAN (Auszug) Diederich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen- und Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn Diederich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst! Oder an der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her! Fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater, und obendrein sollte man ihn lieben. Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis Herr Heßling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm. Jede nicht herausgekommene Untat mischte in Diederichs Ergebenheit und Vertrauen einen Zweifel. Als der Vater mit seinem invaliden Bein die Treppe herunterfiel, klatschte der Sohn wie toll in die Hände – worauf er weglief. Kam er nach der Abstrafung mit gedunsenem Gesicht und unter Geheul an der Werkstätte vorbei, dann lachten die Arbeiter. Sofort aber streckte Diederich nach ihnen die Zunge aus und stampfte. Er war sich bewußt: ‘Ihr wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet. Aber dafür seid ihr viel zuwenig.’ Er bewegte sich zwischen ihnen wie ein launenhafter Pascha; drohte ihnen bald, es dem Vater zu melden, daß sie sich Bier holten, und bald ließ er kokett aus sich die Stunde herausschmeicheln, zu der Herr Heßling zurückkehren sollte. Sie waren auf der Hut vor dem Prinzipal: er kannte sie, er hatte selbst gearbeitet. Er war Büttenschöpfer gewesen in den alten Mühlen, wo jeder Bogen mit der Hand geformt ward; hatte dazwischen alle Kriege mitgemacht und nach dem letzten, als jeder Geld fand, eine Papiermaschine kaufen können. Ein Holländer und eine Schneidemaschine vervollständigten die Einrichtung. Er selbst zählte die Bogen nach. Die von den Lumpen abgetrennten Knöpfe durften ihm nicht entgehen. Sein 12 kleiner Sohn ließ sich oft von den Frauen welche zustecken, dafür, daß er sie nicht angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, daß ihm der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen. Es gelang – aber am Abend kniete Diederich, indes er den letzten Malzzucker zerlutschte, sich ins Bett und betete, angstgeschüttelt, zu dem schrecklichen lieben Gott, er möge das Verbrechen unentdeckt lassen. Er brachte es dennoch an den Tag. Dem Vater, der immer nur methodisch, Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht, den Stock geführt hatte, zuckte diesmal die Hand, und in die Bürste seines silberigen Kaiserbartes lief, über die Runzeln hüpfend, eine Träne. “Mein Sohn hat gestohlen”, sagte er außer Atem, mit dumpfer Stimme, und sah sich das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. “Du betrügst und stiehlst. Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen.” Frau Heßling wollte Diederich nötigen, vor dem Vater hinzufallen und ihn um Verzeihung zu bitten, weil der Vater seinetwegen geweint habe! Aber Diederichs Instinkt sagte ihm, daß dies den Vater nur noch mehr erbost haben würde. Mit der gefühlsseligen Art seiner Frau war Heßling durchaus nicht einverstanden. Sie verdarb das Kind fürs Leben. Übrigens ertappte er sie geradeso auf Lügen wie den Diedel. Kein Wunder, da sie Romane las! Am Sonnabendabend war nicht immer die Wochenarbeit getan, die ihr aufgegeben war. Sie klatschte, anstatt sich zu rühren, mit dem Mädchen… Und Heßling wußte noch nicht einmal, daß seine Frau auch naschte, gerade wie das Kind. Bei Tisch wagte sie sich nicht satt zu essen und schlich nachträglich an den Schrank. Hätte sie sich in die Werkstätte getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben. Sie betete mit dem Kind “aus dem Herzen”, nicht nach Formeln, und bekam dabei gerötete Wangenknochen. Sie schlug es auch, aber Hals über Kopf und verzerrt von Rachsucht. Oft war sie dabei im Unrecht. Dann drohte Diederich, sie beim Vater zu verklagen; tat so, als ginge er ins Kantor, und freute sich irgendwo hinter einer Mauer, daß sie nun Angst hatte. Ihre zärtlichen Stunden nützte er aus; aber er fühlte gar keine Achtung vor seiner Mutter. Ihre Ähnlichkeit mit ihm selbst verbot es ihm. Denn er achtete sich selbst nicht, dafür ging er mit einem zu schlechten Gewissen durch sein Leben, das vor den Augen des Herrn nicht hätte bestehen können. 13 Dennoch hatten die beiden von Gemüt überfließende Dämmerstunden. Aus den Festen preßten sie gemeinsam, vermittelst Gesang, Klavierspiel und Märchenerzählen, den letzten Tropfen Stimmung heraus. Als Diederich am Christkind zu zweifeln anfing, ließ er sich von der Mutter bewegen, noch ein Weilchen zu glauben, und er fühlte sich dadurch erleichtert, treu und gut. Auch an ein Gespenst, droben auf der Burg, glaubte er hartnäckig, und der Vater, der davon nichts hören wollte, schien ihm zu stolz, beinahe strafwürdig. Die Mutter nährte ihn mit Märchen. Sie teilte ihm ihre Angst mit vor den neuen, belebten Straßen und der Pferdebahn, die hindurchfuhr, und führte ihn über den Wall nach der Burg. Dort genossen sie das wohlige Grausen. Ecke der Meisestraße hinwieder mußte man an einem Polizisten vorüber, der, wenn er wollte, ins Gefängnis abführen konnte! Diederichs Herz klopfte beweglich; wie gern hätte er einen weiten Bogen gemacht! Aber dann würde der Polizist sein schlechtes Gewissen erkannt und ihn aufgegriffen haben. Es war vielmehr geboten, zu beweisen, daß man sich rein und ohne Schuld fühlte – und mit zitternder Stimme fragte Diederich den Schutzmann nach der Uhr. Heinrich Mann (1871–1950): Romancier und Novellist, Dramatiker und Essayist; Buchhandellehre, im S.Fischer Verlag tätig; versuchte sich als Maler; lebte in Frankreich, Italien; bis nach dem 1. Weltkrieg hielt er sich in München und Berlin auf; publizistische Tätigkeit; 1931 Präsident der Preußischen Akademie der Künste (1933 ausgeschlossen; seine Bücher verbrannt); Emigration nach Kalifornien; Antifaschist im Exil. – 19 Romane, 55 Novellen, zahlreiche Essays, Dramen: Der Untertan (1911/14), Professor Unrat (1930 verfilmt) u.v.m. Textarbeit 1. Aufgaben zum Wortschatz: a) Führen Sie die Vieldeutigkeit von Bogen, leiden, rein, rühren an. Illustrieren Sie den Gebrauch dieser Wörter durch Sätze oder Wortgruppen. 14 b) c) Erläutern Sie folgende Phraseologismen: auf der Hut sein, Hals über Kopf, etw. an den Tag bringen. Verwenden Sie die Phraseologismen mit dem Substantiv Gedanke in kurzen Situationen: da kam ihm ein (rettender u.Ä.) Gedanke; ein Gedanke verfolgt ihn; j-n auf den Gedanken bringen; sich mit dem Gedanken tragen; sich über etw./j-n Gedanken machen. 2. Suchen Sie ausführliche Informationen zu Heinrich Mann (Leben und Schaffen) und seinem Roman “Der Untertan”. 3. Analysieren Sie den Aufbau des Auszuges. 4. Wie werden die handelnden Personen eingeführt? Welche Informationen über die Personen erfahren wir? 5. Kann man in diesem Auszug Elemente von Humor und Satire bemerken? Welche Ausdrucksmittel beweisen das? Gegen die Infamitäten des Lebens sind die besten Waffen: Tapferkeit, Eigensinn und Geduld. Die Tapferkeit stärkt, der Eigensinn macht Spaß und die Geduld gibt Ruhe. (Hermann Hesse) Wie oft trennt uns das Wort, anstatt zu verbinden. (Carl Jakob Burckhardt) 15 Alfred Döblin BERLIN ALEXANDERPLATZ (Auszug) Text 1 Rumm, rumm wuchtete vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Sie ist ein Stock hoch, und die Schienen haut sie wie nichts in den Boden. Eisige Luft. Februar. Die Menschen gehen in Mänteln. Wer einen Pelz hat, trägt ihn, wer keinen hat, trägt keinen. Die Weiber haben dünne Strümpfe und müssen frieren, aber es sieht hübsch aus. Die Penner haben sich vor Kälte verkrochen. Wenn es warm ist, stecken sie wieder ihre Nasen raus. Inzwischen süffeln sie doppelte Ration Schnaps, aber was für welchen, man möchte nicht als Leiche drin schwimmen. Rumm, rumm haut die Dampframme auf dem Alexanderplatz. Viele Menschen haben Zeit und gucken sich an, wie die Ramme haut. Ein Mann oben zieht immer die Kette, dann pafft es oben, und ratz hat die Stange eins auf dem Kopf. Da stehen die Männer und Frauen und besonders die Jungens und freuen sich, wie das geschmiert geht: ratz kriegt die Stange eins auf den Kopf. Nachher ist sie klein wie eine Fingerspitze, dann kriegt sie aber noch immer eins, da kann sie machen, was sie will. Zuletzt ist sie weg, Donnerwetter, die haben sie fein eingepökelt, man zieht befriedigt ab. Alles ist mit Brettern belegt. Die Berolina stand vor Tietz, eine Hand ausgestreckt, war ein kolossales Weib, die haben sie weggeschleppt. Vielleicht schmelzen sie sie ein und machen Medaillen draus. Wie die Bienen sind sie über den Boden her. Die basteln und murksen zu Hunderten rum den ganzen Tag und die Nacht. Ruller ruller fahren die Elektrischen, gelbe mit Anhängern, über den holzbelegten Alexanderplatz, Abspringen ist gefährlich. Der Bahnhof ist breit freigelegt, Einbahnstraße nach der Königsstraße an Wertheim vorbei. Wer nach dem Osten will, muß hinten rum am Präsidium vorbei durch die Klosterstraße. Die Züge rummeln vom Bahnhof nach der Jannowitzbrücke, die Lokomotive bläst oben Dampf ab, gerade über dem Prälaten steht sie, Schloßbräu, Eingang eine Ecke weiter. 16 Über den Damm, sie legen alles hin, die ganzen Häuser an der Stadtbahn legen sie hin, woher sie das Geld haben, die Stadt Berlin ist reich, und wir bezahlen die Steuern. Loeser und Wolff mit dem Mosaikschild haben sie abgerissen, 20 Meter weiter steht er schon wieder auf, und drüben vor dem Bahnhof steht er nochmal. Loeser und Wolff, Berlin-Elbing, erstklassige Qualitäten in allen Geschmacksrichtungen, Brasil, Havanna, Mexiko, Kleine Trösterin, Liliput, Zigarre Nr.8, das Stück 25 Pfennig, Winterballade, Packung mit 25 Stück, 20 Pfennig, Zigarillos Nr.10, unsortiert, Sumatradecke, eine Spezialleistung in dieser Preislage, in Kisten zu hundert Stück, 10 Pfennig. Ich schlage alles, du schlägst alles, er schlägt alles mit Kisten zu 50 Stück und Kartonpackung zu 10 Stück, Versand nach allen Ländern der Erde, Boyero 25 Pfennig, diese Neuigkeit brachte uns viele Freude, ich schlage alles, du schlägst lang hin. Neben dem Prälaten ist Platz, da stehen die Wagen mit Bananen. Gebt euren Kindern Bananen. Die Banane ist die sauberste Frucht, da sie durch ihre Schale vor Insekten, Würmern sowie Bazillen geschützt ist. Ausgenommen sind solche Insekten, Würmer und Bazillen, die durch die Schale kommen. […] Wind gibt es massenhaft am Alex, an der Ecke von Tietz zieht es lausig. Es gibt Wind, der pustet zwischen die Häuser rein und auf die Baugruben. Man möchte sich in den Kneipen verstecken, aber wer kann das, das bläst durch die Hosentaschen, da merkst du, es geht was vor, es wird nicht gefackelt, man muß lustig sein bei dem Wetter. Frühmorgens kommen die Arbeiter angegondelt, von Reinickendorf, Neukölln, Weißensee. Kalt oder nicht kalt, Wind oder nicht Wind, Kaffeekanne her, pack die Stullen ein, wir müssen schuften, oder sitzen die Drohnen, die schlafen in ihren Federbetten und saugen uns aus. Aschinger hat ein großes Café und Restaurant. Wer keinen Bauch hat, kann einen kriegen, wer einen hat, kann ihn beliebig vergrößern. Die Natur läßt sich nicht betrügen! Wer glaubt, aus entwertetem Weißmehl hergestellte Brote und Backwaren durch künstliche Zusätze verbessern zu können, der täuscht sich und die Verbraucher. Die Natur hat ihre Lebensgesetze und rächt jeden Mißbrauch. Der erschütterte Gesundheitszustand fast aller Kulturvölker der Gegenwart hat seine Ursache im Genuß entwerteter 17 und künstlich verfeinerter Nahrung. Feine Wurstwaren auch außer dem Haus, Leberwurst und Blutwurst billig. Das hochinteressante “Magazin” statt eine Mark bloß 20 Pfennig, die “Ehe” hochinteressant und pikant bloß 20 Pfennig. Der Ausrufer pafft Zigaretten, hat eine Schiffermütze auf, ich schlage alles. Vom Osten her, Weißensee, Lichtenberg, Friedrichshain, Frankfurter Allee, türmen die gelben Elektrischen auf den Platz durch die Landsberger Straße. Die 65 kommt vom Zentralviehhof, der Große Ring Weddingplatz, Luisenplatz, die 76 Hundekehle über Hubertusallee. An der Ecke Landsberger Straße haben sie Friedrich Hahn, ehemals Kaufhaus, ausverkauft, hergemacht und werden es zu den Vätern versammeln. Da halten die Elektrischen und der Autobus 19 Turmstraße. Wo Jürgens war, das Papiergeschäft, haben sie das Haus abgerissen und dafür einen Bauzaun hingesetzt. Da sitzt ein alter Mann mit einer Arztwaage: Kontrollieren Sie Ihr Gewicht, 5 Pfennig. O liebe Brüder und Schwestern, die Ihr über den Alex wimmelt, gönnt euch diesen Augenblick, seht durch die Lücke neben der Arztwaage auf diesen Schuttplatz, wo einmal Jürgens florierte, und da steht noch das Kaufhaus Hahn, leergemacht, ausgeräumt und ausgeweidet, daß nur die roten Fetzen noch an den Schaufenstern kleben. Ein Müllhaufen liegt vor uns. Von Erde bist du gekommen, zu Erde sollst du wieder werden, wir haben gebauet ein herrliches Haus, nun geht hier kein Mensch weder rein noch raus. So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal, Cäsar, alles kaputt, oh, denkt daran. Erstens habe ich dazu zu bemerken, daß man diese Städte jetzt wieder ausgräbt, wie die Abbildungen in der letzten Sonntagsausgabe zeigen, und zweitens haben diese Städte ihren Zweck erfüllt, und man kann nun wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind, du kaufst neue, davon lebt die Welt. Die Schupo beherrscht gewaltig den Platz. Sie steht in mehreren Exemplaren auf dem Platz. Jedes Exemplar wirft Kennerblicke nach zwei Seiten und weiß die Verkehrsregeln auswendig. Es hat Wickelgamaschen an den Beinen, ein Gummiknüppel hängt ihm an der rechten Seite, die Arme schwenkt es horizontal von Westen nach Osten, da kann Norden, Süden nicht weiter, und der Osten ergießt sich nach Westen, der Westen nach 18 Osten. Dann schaltet sich das Exemplar selbsttätig um: Der Norden ergießt sich nach Süden, der Süden nach Norden. Scharf ist der Schupo auf Taille gearbeitet. Auf seinen erfolgten Ruck laufen über den Platz in Richtung Königsstraße etwa 30 private Personen, sie halten zum Teil auf der Schutzinsel, ein Teil erreicht glatt die Gegenseite und wandert auf Holz weiter. Ebenso viele haben sich nach Osten aufgemacht, sie sind den andern entgegengeschwommen, es ist ihnen ebenso ergangen, aber keinem ist was passiert. Es sind Männer, Frauen und Kinder, die letzteren meist an der Hand von Frauen. Sie alle aufzuzählen und ihr Schicksal zu beschreiben, ist schwer möglich, es könnte nur bei einigen gelingen. Der Wind wirft gleichmäßig Häcksel über alle. Das Gesicht der Ostwanderer ist in nichts unterschieden von dem der West-, Süd- und Nordwanderer, sie vertauschen auch ihre Rollen, und die jetzt über den Platz zu Aschinger gehen, kann man nach einer Stunde vor dem leeren Kaufhaus Hahn finden. Und ebenso mischen sich die, die von der Brunnenstraße kommen und zur Jannowitzbrücke wollen, mit den umgekehrt Gerichteten. Ja, viele biegen auch seitlich um, von Süden nach Osten, von Süden nach Westen, von Norden nach Osten. Sie sind so gleichmäßig wie die, die im Autobus, in den Elektrischen sitzen. Die sitzen alle in verschiedenen Haltungen da und machen so das außen angeschriebene Gewicht des Wagens schwerer. Was in ihnen vorgeht, wer kann das ermitteln, ein ungeheures Kapitel. Und wenn man es täte, wem diente es? Neue Bücher? Schon die alten gehen nicht, und im Jahre 27 ist der Buchabsatz gegen 26 um soundsoviel Prozent zurückgegangen. Man nehme die Leute einfach als Privatpersonen, die 20 Pfennig bezahlt haben, mit Ausnahme der Besitzer von Monatskarten und der Schüler, die nur 10 Pfennig zahlen, und da fahren sie nun mit ihrem Gewicht von einem Zentner bis zwei Zentner, in ihren Kleidern, mit Taschen, Paketen, Schüsseln, Hüten, künstlichen Gebissen, Bruchbändern über den Alexanderplatz und bewahren die geheimnisvollen langen Zettel auf, auf denen steht: Linie 12 Siemensstraße DA, Gotzkowskisstraße C, B, Oranienburger Tor C, C, Kottbuser Tor A, geheimnisvollen Zeichen, wer kann es raten, wer kann es nennen und wer bekennen, drei Worte nenn ich dir inhaltschwer, und die Zettel sind viermal an bestimmten Stellen gelocht, und auf den Zetteln steht in demselben Deutsch, mit dem die Bibel geschrieben ist und das Bürgerliche Gesetzbuch: Gültig zur 19 Erreichung des Reiseziels auf kürzestem Wege, keine Gewähr für die Anschlußbahn. Sie lesen Zeitungen verschiedener Richtungen, bewahren vermittels ihres Ohrlabyrints das Gleichgewicht, nehmen Sauerstoff auf, dösen sich an, haben Schmerzen, haben keine Schmerzen, denken, denken nicht, sind glücklich, sind unglücklich, sind weder glücklich noch unglücklich. Rumm, rumm ratscht die Ramme nieder, ich schlage alles, noch eine Schiene. Es surrt über den Platz vom Präsidium her, da nieten sie, da schmeißt eine Zementmaschine ihre Ladung um. Herr Adolf Kraun, Hausdiener sieht zu, das Umkippen der Wagen fesselt ihn enorm, du schlägst alles, er schlägt alles. Er lauert immer gespannt, wie die Lore mit Sand auf der einen Seite hochgeht, da kommt die Höhe, bums, und nun dreht sie sich. Man möchte nicht so aus dem Bett geschmissen sein, Beine hoch, runter mit dem Kopf, da liegst du, kann einem was passieren, aber die machen das egalweg. Alex: in Berlin übliche Kurzform für Alexanderplatz, Berolina: weibliche Statue als Sinnbild Berlins Alfred Döblin (1878–1957), der bedeutendste Erzähler der Zeit des Expressionismus; geboren im preußischen Stettin, stammte aus jüdischer Kaufmannsfamilie, übersiedelte 1888 mit seinen Eltern nach Berlin, wo er aufwuchs, studierte Medizin, arbeitete in der Irrenanstalt und als Kassenarzt in Berlin-Ost. 1933 floh er in die Schweiz, wurde 1936 französischer Staatsbürger, kehrte 1945 nach Deutschland zurück. Er hat als Romancier Weltruhm erlangt. Textarbeit 1. Bestimmen Sie thematische Reihen und/oder Wortfelder und gruppieren Sie danach das entsprechende Wortmaterial. 2. Erklären Sie die Homonymie des Substantivs Schild. Führen Sie mehrere Beispiele der deutschen Homonyme an. 3. Finden Sie expressive Verben und äußern Sie Ihre Meinung über die Rolle des bildlichen Ausdrucks. 20 4. Erzählen Sie (mündlich oder schriftlich) über eine Stadt/das Leben einer Stadt etc., indem Sie eine der Darbietungsweisen verwenden (z.B. die Beschreibung, den Bericht u.a.). 5. Analysieren Sie den Auszug nach folgenden Aspekten: Komposition (Sujet, Handlungsverlauf etc.), Darstellung der Epoche, Personen, Erzählperspektive (Erzählhaltung), Zeit-/Raumgestaltung, lexikalische Stilmittel, syntaktische Stilmittel. BERLIN ALEXANDERPLATZ (Auszug) Text 2 Wir sind am Ende dieser Geschichte. Sie ist lang geworden, aber sie mußte sich dehnen und immer mehr dehnen, bis sie jenen Höhepunkt erreichte, den Umschlagspunkt, von dem erst Licht auf das Ganze fällt. Wir sind eine dunkle Allee gegangen, keine Laterne brannte zuerst, man wußte nur, hier geht es lang, allmählich wird es heller und heller, zuletzt hängt da die Laterne, und dann liest man endlich unter ihr das Straßenschild. Es war ein Enthüllungsprozeß besonderer Art. Franz Biberkopf ging nicht die Straße wie wir. Er rannte drauflos, diese dunkle Straße, er stieß sich an Bäume, und je mehr er ins Laufen kam, um so mehr stieß er an Bäume. Es war schon dunkel, und wie er an Bäume stieß, preßte er entsetzt die Augen zu. Und je mehr er sich stieß, immer entsetzter klemmte er die Augen zu. Mit zerlöchertem Kopf, kaum noch bei Sinnen, kam er schließlich doch an. Wie er hinfiel, machte er die Augen auf. Da brannte die Laterne hell über ihm, und das Schild war zu lesen. Er steht zum Schluß als Hilfsportier in einer mittleren Fabrik. Er steht nicht mehr allein am Alexanderplatz. Es sind welche rechts von ihm und links von ihm, und vor ihm gehen welche, und hinter ihm gehen welche. Viel Unglück kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist es schon anders. Man muß sich gewöhnen, auf andere zu hören, denn was andere sagen, geht mich auch an. Da 21 merke ich, wer ich bin und was ich mir vornehmen kann. Es wird überall herum um mich meine Schlacht geschlagen, ich muß aufpassen, ehe ich es merke, komm ich ran. Er ist Hilfsportier in einer Fabrik. Was ist denn das Schicksal? Eins ist stärker als ich. Wenn wir zwei sind, ist es schon schwerer, stärker zu sein als ich. Wenn wir zehn sind, noch schwerer. Und wenn wir tausend sind und eine Million, dann ist es ganz schwer. Aber es ist auch schöner und besser, mit andern zu sein. Da fühle ich und weiß ich alles noch einmal so gut. Ein Schiff liegt nicht fest ohne großen Anker, und ein Mensch kann nicht sein ohne viele andere Menschen. Was wahr und falsch ist, werd ich jetzt besser wissen. Ich bin schon einmal auf ein Wort reingefallen, ich habe es bitter bezahlen müssen, nochmal passiert das dem Biberkopf nicht. Da rollen die Worte auf einen an, man muss sich vorsehen, daß man nicht überfahren wird, paßt du nicht auf auf den Autobus, fährt er dich zu Appelmus. Ich schwör sobald auf nichts in der Welt. Lieb Vaterland, kannst ruhig sein, ich hab die Augen auf und fall so bald nicht rein. Sie marschieren oft mit Fahnen und Musik und Gesang an seinem Fenster vorbei, Biberkopf sieht kühl zu seiner Türe raus und bleibt noch lange ruhig zu Haus. Halt das Maul und fasse Schritt, marschiere mit uns andern mit. Wenn ich marschieren soll, muß ich das nachher mit dem Kopf bezahlen, was andere sich ausgedacht haben. Darum rechne ich erst alles nach, und wenn es so weit ist und mir paßt, werde ich mich danach richten. Dem Mensch ist gegeben die Vernunft, die Ochsen bilden statt dessen eine Zunft. Biberkopf tut seine Arbeit als Hilfsportier, nimmt die Nummern ab, kontrolliert Wagen, sieht, wer rein- und rauskommt. Wach sein, wach sein, es geht was vor in der Welt. Die Welt ist nicht aus Zucker gemacht. Wenn sie Gasbomben werfen, muß ich ersticken, man weiß nicht, warum sie geschmissen haben, aber darauf kommt nichts an, man hat Zeit gehabt, sich drum zu kümmern. Wenn Krieg ist, und sie ziehen mich ein, und ich weiß nicht warum, und der Krieg ist auch ohne mich da, so bin ich schuld, und mir geschieht recht. Wach sein, wach sein, man ist nicht allein. Die Luft kann hageln und regnen, dagegen kann man sich nicht wehren, aber gegen vieles andere kann man sich wehren. Da werde ich nicht mehr schrein wie früher: das Schicksal, das Schicksal. Das muß man 22 nicht als Schicksal verehren, man muß es ansehen, anfassen und zerstören. Wach sein, Augen auf, aufgepaßt, tausend gehören zusammen, wer nicht aufmacht, wird ausgelacht oder zur Strecke gebracht. Die Trommel wirbelt hinter ihm. Marschieren, marschieren. Wir ziehen in den Krieg mit festem Schritt, es gehen mit uns hundert Spielleute mit, Morgenrot, Abendrot, leuchtest uns zum frühen Tod. Biberkopf ist ein kleiner Arbeiter. Wir wissen, was wir wissen, wir habens teuer bezahlen müssen. Textarbeit Analysieren Sie den Auszug nach folgenden Schwerpunkten: Zeit- und Raumgestaltung, Gebrauch von verschiedenen Darbietungsweisen, Franz Biberkopf, die Hauptperson des Romans. Starke Menschen bleiben ihrer Natur treu, mag das Schicksal sie auch in schlechte Lebenslagen bringen. Ihr Wesen verändert sich nicht, ob sie im Glück oder im Unglück sind. Ihr Charakter bleibt fest und ihr Sinn wird niemals schwankend. Über solche Menschen kann das Schicksal keine Macht bekommen. (Machiavelli) 23 Max Frisch GESCHICHTE VON ISIDOR (Auszug aus dem Roman “Stiller”) Ich werde ihr die kleine Geschichte von Isidor erzählen. Eine wahre Geschichte! Isidor war Apotheker, ein gewissenhafter Mensch also, der dabei nicht übel verdiente, Vater von etlichen Kindern und Mann im besten Mannesalter, und es braucht nicht betont zu werden, daß Isidor ein getreuer Ehemann war. Trotzdem vertrug er es nicht, immer befragt zu werden, wo er gewesen wäre. Darüber konnte er rasend werden, äußerlich ließ er sich nichts anmerken. Es lohnte keinen Streit, denn im Grunde, wie gesagt, war es eine glückliche Ehe. Eines schönen Sommers unternahmen sie, wie es damals gerade Mode war, eine Reise nach Mallorca, und abgesehen von ihrer steten Fragerei, die ihn im stillen ärgerte, ging alles in bester Ordnung. Isidor konnte ausgesprochen zärtlich sein, sobald er Ferien hatte. Das schöne Avignon entzückte sie beide; sie gingen Arm in Arm. Isidor und seine Frau, die man sich als eine sehr liebenswerte Frau vorzustellen hat, waren genau neun Jahre verheiratet, als sie in Marseille ankamen. Das Mittelmeer leuchtete wie auf einem Plakat. Zum stillen Ärger seiner Gattin, die bereits auf dem MallorcaDampfer stand, hatte Isidor noch im letzten Moment irgendeine Zeitung kaufen müssen. Ein wenig, mag sein, tat er es aus purem Trotz gegen ihre Fragerei, wohin er denn ginge. Weiß Gott, er hatte es nicht gewußt; er war einfach, da ihr Dampfer noch nicht fuhr, nach Männerart ein wenig geschlendert. Aus purem Trotz, wie gesagt, vertiefte er sich in eine französische Zeitung, und während seine Gattin tatsächlich nach dem malerischen Mallorca reiste, fand sich Isidor, als er endlich von einem dröhnenden Tuten erschreckt aus seiner Zeitung aufblickte, nicht an der Stelle seiner Gattin, sondern auf einem ziemlich dreckigen Frachter, der, übervoll beladen mit lauter Männern in gelber Uniform, ebenfalls unter Dampf stand. Und eben wurden die großen Taue gelöst. Isidor sah nur noch, wie die Mole sich entfernte. Ob es die hundföttische Hitze oder der Kinnhaken eines französischen Sergeanten gewesen, was ihm kurz darauf das Bewußtsein nahm, kann ich nicht sagen; hingegen wage ich mit Bestimmtheit zu behaupten, daß Isidor, der Apotheker, in der Fremdenlegion ein härteres Leben hatte als zuvor. An Flucht war 24 nicht zu denken. Das gelbe Fort, wo Isidor zum Mann erzogen wurde, stand einsam in der Wüste, deren Sonnenuntergänge er schätzen lernte. Gewiß dachte er zuweilen an seine Gattin, wenn er nicht einfach zu müde war, und hätte ihr wohl auch geschrieben; doch Schreiben war nicht gestattet. Frankreich kämpfte noch immer gegen den Verlust seiner Kolonien, so daß Isidor bald genug in der Welt herumkam, wie er sich nie hätte träumen lassen. Er vergaß seine Apotheke, versteht sich, wie andere ihre kriminelle Vergangenheit. Mit der Zeit verlor Isidor sogar das Heimweh nach dem Land, das seine Heimat zu sein den schriftlichen Anspruch stellte, und es war – viele Jahre später – eine pure Anständigkeit von Isidor, als er eines schönen Morgens durch das Gartentor trat, bärtig, hager wie er nun war, den Tropenhelm unter dem Arm, damit die Nachbarn seines Eigenheims, die den Apotheker längstens zu den Toten rechneten, nicht in Aufregung gerieten über seine immerhin ungewohnte Tracht; selbstverständlich trug er auch einen Gürtel mit Revolver. Es war ein Sonntagmorgen, Geburtstag seiner Gattin, die er, wie schon erwähnt, liebte, auch wenn er in all den Jahren nie eine Karte geschrieben hatte. Einen Atemzug lang, das unveränderte Eigenheim vor Augen, die Hand noch an dem Gartentor, das ungeschmiert war und girrte wie je, zögerte er. Fünf Kinder, alle nicht ohne Ähnlichkeit mit ihm, aber alle um sieben Jahre gewachsen, so daß ihre Erscheinung ihn befremdete, schrien schon von weitem: Der Papi! Es gab kein Zurück. Und Isidor schritt weiter als Mann, der er in harten Kämpfen geworden war, und in der Hoffnung, daß seine liebe Gattin, sofern sie zu Hause war, ihn nicht zur Rede stellen würde. Er schlenderte den Rasen hinauf, als käme er wie gewöhnlich aus seiner Apotheke, nicht aber aus Afrika und Indochina. Die Gattin saß sprachlos unter einem neuen Sonnenschirm. Auch den köstlichen Morgenrock, den sie trug, hatte Isidor noch nie gesehen. Ein Dienstmädchen, ebenfalls eine Neuheit, holte sogleich eine weitere Tasse für den bärtigen Herrn, den sie ohne Zweifel, aber auch ohne Mißbilligung als den neuen Hausfreund betrachtete. Kühl sei es hierzulande, meinte Isidor, indem er sich die gekrempelten Hemdärmel wieder herunter machte. Die Kinder waren selig, mit dem Tropenhelm spielen zu dürfen, was natürlich nicht ohne Zank ging, und als der frische Kaffee kam, war es eine vollendete Idylle, Sonntagmorgen mit Glockenläuten und Geburtstagstorte. Was wollte Isidor mehr! Ohne jede Rücksicht auf 25 das neue Dienstmädchen, das gerade noch das Besteck hinlegte, griff Isidor nach seiner Gattin. “Isidor!” sagte sie und war außerstande, den Kaffee einzugießen, so daß der bärtige Gast es selber machen mußte. “Was denn?” fragte er zärtlich, indem er auch ihre Tasse füllte. “Isidor!” sagte sie und war dem Weinen nahe. Er umarmte sie. “Isidor!” fragte sie, “wo bist du so lange gewesen?” Der Mann, einen Augenblick lang wie betäubt, setzte seine Tasse nieder; er war es einfach nicht mehr gewohnt, verheiratet zu sein, und stellte sich vor einen Rosenstock, die Hände in den Hosentaschen. “Warum hast du nie auch nur eine Karte geschrieben?” fragte sie. Darauf nahm er den verdutzten Kindern wortlos den Tropenhelm weg, setzte ihn mit dem knappen Schwung der Routine auf seinen eigenen Kopf, was den Kindern einen für die Dauer ihres Lebens unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben soll, Papi mit Tropenhelm und Revolvertasche, alles nicht bloß echt, sondern sichtlich vom Gebrauche etwas abgenutzt, und als die Gattin sagte: “Weißt du, Isidor, das hättest du wirklich nicht tun dürfen!” war es für Isidor genug der trauten Heimkehr, er zog (wieder mit dem knappen Schwung der Routine, denke ich) den Revolver aus dem Gurt, gab drei Schüsse mitten in die weiche, bisher noch unberührte und mit Zuckerschaum verzierte Torte, was, wie man sich wohl vorstellen kann, eine erhebliche Schweinerei verursachte. “Also Isidor!” schrie die Gattin, denn ihr Morgenrock war über und über von Schlagrahm verspritzt, ja, und wären nicht die unschuldigen Kinder als Augenzeugen gewesen, hätte sie jenen ganzen Besuch, der übrigens kaum zehn Minuten gedauert haben dürfte, für eine Halluzination gehalten. Von ihren fünf Kindern umringt, einer Niobe ähnlich, sah sie nur noch, wie Isidor, der Unverantwortliche, mit gelassenen Schritten durch das Gartentor ging, den unmöglichen Tropenhelm auf dem Kopf. Nach jenem Schock konnte die arme Frau nie eine Torte sehen, ohne an Isidor denken zu müssen, ein Zustand, der sie erbarmungswürdig machte, und unter vier Augen, insgesamt etwa unter sechsunddreißig Augen riet man ihr zur Scheidung. Noch aber hoffte die tapfere Frau. Die Schuldfrage war ja wohl klar. Noch aber hoffte sie auf seine Reue, lebte ganz den fünf Kindern, die von Isidor stammten, und wies den jungen Rechtsanwalt, der sie nicht ohne persönliche Teilnahme besuchte und zur Scheidung drängte, ein weiteres Jahr lang ab, einer Penelope ähnlich. Und in der Tat, wieder war’s ihr Geburtstag, kam 26 Isidor nach einem Jahr zurück, setzte sich nach üblicher Begrüßung, krempelte die Hemdärmel herunter und gestattete den Kindern abermals, mit seinem Tropenhelm zu spielen, doch dieses Mal dauerte ihr Vergnügen, einen Papi zu haben, keine drei Minuten. “Isidor!” sagte die Gattin, “wo bist du denn jetzt wieder gewesen?” Er erhob sich, ohne zu schießen, Gott sei Dank, auch ohne den unschuldigen Kindern den Tropenhelm zu entreißen, nein, Isidor erhob sich nur, krempelte seine Hemdärmel wieder herauf und ging durchs Gartentor, um nie wierderzukommen. Die Scheidungsklage unterzeichnete die arme Gattin nicht ohne Tränen, aber es mußte ja wohl sein, zumal sich Isidor innerhalb der gesetzlichen Frist nicht gemeldet hatte, seine Apotheke wurde verkauft, die zweite Ehe in schlichter Zurückhaltung gelebt und nach Ablauf der gesetzlichen Frist auch durch das Standesamt genehmigt, kurzum, alles nahm den Lauf der Ordnung, was ja zumal für die heranwachsenden Kinder so wichtig war. Eine Antwort, wo Papi sich mit dem Rest seines Erdenlebens herumtrieb, kam nie. Nicht einmal eine Ansichtskarte. Mami wollte auch nicht, daß die Kinder danach fragten; sie hatte ja Papi selber nie fragen dürfen… Erläuterungen zum Text: es lohnt kein Streit: es ist kein Streit wert das Schiff stand unter Dampf: das Schiff war abfahrbereit hundföttisch: scheußlich, böse girren: zwitschern, quietschen (meistens von Vögeln gebraucht) zur Rede stellen (idiomatisch): eine Erklärung verlangen aufkrempeln: aufrollen, nach oben schieben (z.B. die Ärmel) traut: lieb, freundlich (alter Ausdruck, hier ironisch gemeint) sie lebte ihren Kindern: sie lebte nur für ihre Kinder zumal: besonders weil … 27 Max Frisch (1911–1991), schweizerischer Dramatiker und Prosaschriftsteller. Frisch, Sohn eines Architekten, studierte Germanistik in Zürich; musste aus finanziellen Gründen das Studium abbrechen und seinen Unterhalt als Journalist verdienen. 1936 Studium der Architektur in Zürich; lange Zeit Doppelberuf als Architekt und Schriftsteller, dann freischaffender Schriftsteller; seit 1945 zahlreiche Reisen; Dr.h.c. der Universität Marburg. M.Frisch gehört zu den hervorragenden deutschsprachigen Schriftstellerpersönlichkeiten. In seinem “Tagebuch 1946-1949” hat er über sich und über die europäische Nachkriegssituation Auskunft gegeben. Der sprachlich virtuose Roman “Stiller” (1945) schildert das menschliche Versagen eines Bildhauers. In “Homo Faber” (1947) ist eine andere, entgegengesetzte Art des Versagens im Prozess, sich eine Persönlichkeit zu schaffen, dargestellt. Eines seiner stärksten Stücke, “Andora” (1961), von M.Frisch selbst als “Modell” (für die Welt) bezeichnet, ist eine bühnenwirksame dichterische Anklage des Antisemitismus und zugleich eine genaue massenpsychologische Studie. Textarbeit 1. Fragen zum Text: 1. Wie kann man Isidors Ehe charakterisieren? 2. Aus welchem Grund fuhr Isidor nicht mit seiner Frau nach Mallorca? 3. Was erlebte er statt dessen? 4. Wie verlief seine Heimkehr? 5. Wie gestaltete sich das weitere Leben seiner Frau? 6. Halten Sie das Verhalten Isidors für richtig? 2. Drücken Sie den Inhalt folgender Sätze mit Worten aus dem Text aus! 1. Isidor zeigte seinen Ärger nicht. 2. Alles war in Ordnung. 3. Das Schiff war abfahrbereit. 4. Er hatte keine Gelegenheit, an Flucht zu denken. 28 3. Aufgaben zur Erweiterung des Wortschatzes und des Ausdrucks. 1. Nennen Sie Ausdrücke, die die Gemütsstimmung eines Menschen beschreiben (Nomen, Adjektive und Verben)! Schildern Sie Ihren eigenen Gemütszustand. 2. Welche häuslichen Tugenden schätzen Sie besonders und welche Untugenden würden Sie ablehnen? 3. Beschreiben Sie das Leben einer idealen Familie, wie Sie sie sich vorstellen! 4. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Endungen! 1. Abgesehen … einige- Regentage-, hatten wir im Urlaub schönes Wetter. 2. Die beiden Eheleute gingen Arm … Arm. 3. … Ärger der Frau ging er eine Zeitung kaufen. 4. Er tat das … pur- Trotz. 5. Niemand dachte … Flucht. 6. Er hat … d- Zeit sein Heimweh vergessen. 7. Er trug den Helm … d- Arm. 8. Man rechnete den Mann schon … d- Toten. 9. Der Mann verließ … gelassen- Schritte- das Haus. 10. Der Anwalt drängte d- Frau … Scheidung. 11. Er hat … d- gesetzlich- Frist nicht mehr gemeldet. 5. Schreiben Sie eine dreiteilige Inhaltsangabe zum Auszug. Es gibt nur ein Mittel, sich wohl zu fühlen: man muß lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. (Theodor Fontane) 29 Friedrich Dürrenmatt DER RICHTER UND SEIN HENKER (Auszug) Beim Kommissär Bärlach, einem erfahrenen und kranken Kriminalisten, arbeiten der begabte Polizist Schmied und ein junger Polizist Tschanz. Schmied kommt auf die Spur eines Verbrechers, namens Gastmann, und versucht ihn zu erwischen. Tschanz erschießt Schmied aus Neid und versucht Gastmann als Schmieds Mörder zu stellen. Die Untersuchung führt Kommissär Bärlach. Dabei hilft ihm Tschanz. Die Untersuchung scheint erfolgreich abgeschlossen zu sein. Doch Bärlach entlarvt Tschanz als Mörder während des Abendessens, das er extra veranstaltet hat. Am selbenTag, punkt acht, betrat Tschanz das Haus des Alten im Altenberg, von ihm dringend für diese Stunde hergebeten. Ein junges Dienstmädchen mit weißer Schürze hatte ihm zu seiner Verwunderung geöffnet, und wie er in den Korridor kam, hörte er aus der Küche das Kochen und Brodeln von Wasser und Speisen, das Klirren von Geschirr. Das Dienstmädchen nahm ihm den Mantel von den Schultern. Er trug den linken Arm in der Schlinge; trotzdem war er in dem Wagen gekommen. Das Mädchen öffnete ihm die Tür zum Eßzimmer, und erstarrt blieb Tschanz stehen: der Tisch war feierlich für zwei Personen gedeckt. In einem Leuchter brannten Kerzen, und an einem Ende des Tisches saß Bärlach in einem Lehnstuhl, von den stillen Flammen rot beschienen, ein unerschütterliches Bild der Ruhe. “Nimm Platz, Tschanz”, rief der Alte seinem Gast entgegen und wies auf einen zweiten Lehnstuhl, der an den Tisch gerückt war. Tschanz setzte sich betäubt. “Ich wußte nicht, daß ich zu einem Essen komme”, – sagte er endlich. “Wir müssen deinen Sieg feiern”, antwortete der Alte ruhig und schob den Leuchter etwas auf die Seite, so daß sie sich voll ins Gesicht sahen. Dann klatschte er in die Hände. Die Tür öffnete sich, und eine stattliche, rundliche Frau brachte eine Platte, die bis zum Rande überhäuft war mit Sardinen, Krebsen, Salaten von Gurken, Tomaten, Erbsen, besetzt mit Bergen von Mayonnaise und Eiern, dazwischen kalter Aufschnitt, Hühnerfleisch und Lachs. Der Alte nahm von allem. Tschanz, der sah, was für eine Riesenportion der Magenkranke aufschichtete, ließ sich in seiner Verwunderung nur etwas Kartoffelsalat geben. “Was wollen wir trinken?” fragte Bärlach. “Ligerzer?” 30 “Gut, Ligerzer”, antwortete Tschanz wie träumend. Das Dienstmädchen kam und schenkte ein. Bärlach fing an zu essen, nahm dazu Brot, verschlang den Lachs, die Sardinen, das Fleisch der roten Krebse, den Aufschnitt, die Salate, die Mayonnaise und den kalten Braten, klatschte in die Hände, verlangte noch einmal. Tschanz, wie starr, war noch nicht mit seinem Kartoffelsalat fertig. Bärlach ließ sich das Glas zum dritten Mal füllen. “Nun Pasteten und den roten Neuenburger”, rief er. Die Teller wurden gewechselt, Bärlach ließ sich drei Pasteten auf den Teller legen, gefüllt mit Gänseleber, Schweinefleisch und Trüffeln. “Sie sind doch krank, Kommissär”, sagte Tschanz endlich zögernd. “Heute nicht, Tschanz, heute nicht. Ich feiere, daß ich Schmieds Mörder endlich gestellt habe!“ Er trank das zweite Glas Roten aus und fing die dritte Pastete an, pausenlos essend, gierig die Speisen dieser Welt in sich hineinschlingend, zwischen den Kiefern zermalmend, ein Dämon, der einen unendlichen Hunger stillte. An der Wand zeichnete sich, zweimal vergrößert, in wilden Schatten seine Gestalt ab, die kräftigen Bewegungen der Arme, das Senken des Kopfes, gleich dem Tanz eines triumphierenden Negerhäuptlings. Tschanz sah voll Entsetzen nach diesem unheimlichen Schauspiel, das der Todkranke bot. Unbeweglich saß er da, ohne zu essen, ohne den geringsten Bissen zu sich zu nehmen, nicht einmal am Glas nippte er. Bärlach ließ sich Kalbskoteletts, Reis, Pommes frites und grünen Salat bringen, dazu Champagner. Tschanz zitterte. “Sie verstellen sich”, keuchte er, “Sie sind nicht krank!“ Der andere antwortete nicht sofort. Zuerst lachte er, und dann beschäftigte er sich mit dem Salat, jedes Blatt einzeln genießend. Tschanz wagte nicht den grauenvollen Alten ein zweites Mal zu fragen. „Ja, Tschanz“, sagte Bärlach endlich, und seine Augen funkelten wild, „ich habe mich verstellt. Ich war nie krank“, und er schob sich ein Stück Kalbfleisch in den Mund, aß weiter, unaufhörlich, unersättlich. Da begriff Tschanz, daß er in eine heimtückische Falle geraten war, deren Türe nun hinter ihm ins Schloß schnappte. Kalter Schweiß brach aus seinen Poren. Das Entsetzen umklammerte ihn mit immer 31 stärkeren Armen. Die Erkenntnis seiner Lage kam zu spät, es gab keine Rettung mehr. „Sie wissen es, Kommissär“, sagte er leise. „Ja, Tschanz, ich weiß es“ sagte Bärlach fest und ruhig, aber ohne dabei die Stimme zu heben, als spräche er von etwas Gleichgültigem. „Du bist Schmieds Mörder“. Dann griff er nach dem Glas Champagner und leerte es in einem Zug. „Ich habe es immer geahnt, daß Sie es wissen“, stöhnte der andere fast unhörbar. Der Alte verzog keine Miene. Es war, als ob ihn nichts mehr interessiere als dieses Essen; unbarmherzig häufte er sich den Teller zum zweiten Mal voll mit Reis, goß Sauce darüber, türmte ein Kalbskotelett obenauf. Noch einmal versuchte sich Tschanz zu retten, sich gegen den teuflischen Esser zur Wehr zu setzen. „Die Kugel stammt aus dem Revolver, den man beim Diener gefunden hat“, stellte er trotzig fest. Aber seine Stimme klang verzagt. In Bärlachs zusammengekniffenen Augen wetterleuchtete es verächtlich. „Unsinn, Tschanz. Du weißt genau, daß es dein Revolver ist, den der Diener in der Hand hielt, als man ihn fand. Du selbst hast ihn dem Toten in die Hand gedrückt. Nur die Entdeckung, daß Gastmann ein Verbrecher war, verhinderte dein Spiel zu durchschauen“. „Das werden Sie mir nie beweisen können“, lehnte sich Tschanz verzweifelt auf. Der Alte reckte sich in seinem Stuhl, nun nicht mehr krank und zerfallen, sondern mächtig und gelassen, das Bild einer übermenschlichen Überlegenheit, ein Tiger, der mit seinem Opfer spielt, und trank den Rest Champagners aus. Dann ließ er sich von der unaufhörlich kommenden und gehenden Bedienerin Käse servieren; dazu aß er Radieschen, Salzgurken und Perlzwiebeln. Immer neue Speisen nahm er nun noch einmal, zum letzten Male das, was die Erde dem Menschen bietet. “Hast du es immer noch nicht begriffen, Tschanz”, sagte er endlich, “daß du mir deine Tat schon lange bewiesen hast? Der Revolver stammt von dir; denn Gastmanns Hund, den du erschossen hast, mich zu retten, wies eine Kugel vor, die von der Waffe stammen mußte, die Schmied den Tod brachte: von deiner Waffe. Du selbst 32 brachtest die Indizien herbei, die ich brauchte. Du hast dich verraten, als du mir das Leben rettetest.” Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), schweizerischer Schriftsteller, gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Bühnen- und Hörspielautoren der Gegenwart. Er studierte Theologie, Philosophie und Germanistik, wollte aber eigentlich Maler werden. Zunächst arbeitete er als Graphiker, Journalist und Kabaretttexter, bis er nach dem Erfolg seiner Theaterstücke als freier Schriftsteller leben konnte. Seit 1952 wohnte er mit seiner Familie zurückgezogen in Neuchâtel. – Romane, Hörspiele, Kriminalgeschichten. Textarbeit 1. Charakterisieren Sie den Kommissär Bärlach und Tschanz. 2. Äußern Sie Ihre Meinung Essgewohnheiten. zu den im Auszug beschriebenen 3. Diskutieren Sie in Gruppen oder im Plenum über die richtige/falsche Ernährung. Es gibt zwei wunderbare Dinge auf der Welt: das Geistige und Sinnliche – und ihre Einheit. (Hugo von Hofmannsthal) 33 Renate Welsh JOHANNA (Auszug aus dem Roman) Der Spätherbst war sonnig und warm. Die Äpfel, die der Hagel nicht heruntergeschlagen hatte, wurden süßer als sonst. Das Kraut hatte sich erholt und riesige Köpfe gebildet. Jeden Morgen kroch der Nebel aus dem Tal herauf, gegen acht Uhr strahlte die Sonne. “Wenn’s so bleibt, lassen wir die Burgunder noch”, sagte der Bauer. “Dann kommen wir wenigstens mit dem Futter durch den Winter”. Der Frost kam ganz plötzlich. Eines Morgens waren die Felder weiß. Johanna und Ferdl wurden sofort auf den Acker geschickt, die anderen sollten später nachkommen. “Aber beeilt euch, bis am Abend muß alles drin sein. Die Blätter können wir dann hier abschneiden.” Johanna riß Rüben aus, den ganzen Tag. Ein Schritt, bücken, ausreißen, Rübe auf den Haufen werfen, ausreißen, Rübe auf den Haufen werfen, wieder ein Schritt, bücken, ausreißen. “Anderswo gibt’s dafür Maschinen”, sagte Ferdl. “Aber wir kosten weniger”. Die Rüben hatten lange Wurzeln, die sich im Boden festzukrallen schienen. Nach kurzer Zeit tat Johanna der Rücken weh. Als Maria mit der Jause aufs Feld kam, konnte sie sich kaum mehr aufrichten. Gustl half eine Stunde lang oder etwas länger mit, dann verschwand er im Wald. Ferdl und Johanna arbeiteten weiter, Reihe für Reihe. Johanna bemühte sich, mit Ferdl Schritt zu halten, aber ihm schienen die Burgunder in die Hand zu gleiten, während sie mit jeder Rübe kämpfen mußte. Mittags brachte Gustl einen Topf Suppe aufs Feld. “Die Mutter sagt, es ist keine Zeit, daß ihr heimgeht”. [...] Maria, die Bäuerin und alle drei Buben kamen nach dem Essen. Der Bauer war wieder einmal bei einer seiner Sitzungen. Josef begann bald zu maulen, aber die Bäuerin fuhr ihn an: “Einmal wirst du doch auch etwas tun können. Wenn ich denke, was ich in deinem Alter schon alles gearbeitet habe...” Nach Sonnenuntergang richtete sich die Bäuerin auf. “Ich geh’ kochen. Ihr macht da fertig. So lang bleibt es schon noch hell.” 34 Im Weggehen zog sie zwei Rüben aus, die Johanna übersehen hatte. “Du mußt schon besser aufpassen.” Es war fast dunkel, als sie mit dem vollen Wagen heimfuhren. Während Ferdl das Pferd versorgte, versuchte Johanna vergeblich, ihre Hände sauberzuwaschen. Nach dem Abendessen mußten die Rüben noch vom ärgsten Schmutz befreit und die Blätter abgeschnitten werden. Gegen halb zehn schickte die Bäuerin die zwei jüngeren Buben ins Bett. Johannas Hände waren längst aufgesprungen; der scharfe Saft, der aus den Rüben floß, brannte. Sie war froh, wenn sie einen Korb voll Rüben in die Futterkammer tragen konnte, obwohl auch die Henkel in ihre Handflächen einschnitten. Einmal stand sie auf und hielt die Hände in den Wassertrog in der Milchkammer. Das tat gut. “Was ist los?” fragte die Bäuerin. “Meine Hände sind ganz blutig.” Die Bäuerin stand auf, ging ins Haus. Als sie zurückkam, reichte sie Johanna einen halben Kochlöffel voll Schmalz. “Da, reib das ein, aber beeil dich.” Das Schmalz half nur für kurze Zeit, dann drang der Rübensaft wieder in die offenen Wunden. Johanna liefen die Tränen über die Wangen, während sie Blätter abschnitt und Rüben in den Henkelkorb kollerte. Das gab jedesmal einen dumpfen Ton. Es war nach elf Uhr, als Ferdl die letzten Rüben in die Futterkammer trug. Die Schrunden in Johannas Händen waren so tief, daß man Zündhölzer hätte hineinlegen können. Beim Händewaschen stöhnte sie, obwohl sie die Lippen zusammenbiß. “Kannst noch einmal Schmalz drauftun”, sagte die Bäuerin. “Aber nimm nicht zu viel, es ist schade drum.” Renate Welsh (geb. 1937), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin; während der Schulzeit bekam sie ein Stipendium und war ein Jahr als Austauschstudentin in Portland. Nach dem Abitur begann sie an der Universität Wien Englisch, Spanisch und Staatswissenschaften zu studieren. Mit neunzehn heiratete sie und brach ihr Studium ab. Sie bekam drei Söhne und lebte mit ihrer Familie in Wien. Beruflich war sie als Übersetzerin im Bereich der 35 Medizin und Psychologie tätig und übersetzte später auch Romane. 1969 entstand ihr erstes Buch, und seitdem hat sie zahlreiche Kinder- und Jugendbücher verfasst. Textarbeit 1. Erläutern Sie folgende Wörter: der Hagel, das Kraut, der Burgunder. 2. Welche Informationen über handelnde Personen bekommt man aus diesem Auszug? 3. Was erfahren Sie über ihr Leben und ihre Arbeit auf dem Bauernhof? 4. Vergleichen Sie diese Szene mit einer ähnlichen in einem litauischen Dorf. 5. Wie stellen Sie sich den Spätherbst/Frühherbst vor? Welche Stichworte würden Sie für Ihre Beschreibung der Herbstnatur verwenden? 6. Schreiben Sie einen Aufsatz über den Herbst (nach dem u.g. Schema). Mein Aufsatz über den Herbst Ich sitze hier im Zimmer/draußen und soll etwas über den Herbst schreiben. Ich sehe mich um/schaue aus dem Fenster. Wie ist der Herbst heute? Ich denke nach. Ich sehe … Ich höre … Ich rieche … Ich schmecke … Das alles schreibe ich auf. Und dann lese ich durch, was ich geschrieben habe. Ich denke … 36 Gottfried Keller KLEIDER MACHEN LEUTE (Auszug) An einem unfreundlichen Novembertag wanderte ein armes Schneiderlein auf der Landstraße nach Goldach, einer kleinen, reichen Stadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla entfernt ist. Der Schneider trug in seiner Tasche nichts als einen Fingerhut, welchen er, in Ermangelung irgendeiner Münze, unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er der Kälte wegen die Hände in die Hosen steckte, und die Finger schmerzten ihn ordentlich von diesem Drehen und Reiben. Denn er hatte wegen des Falliments irgendeines Seldwyler Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern müssen. Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste Mittagbrot herwachsen sollte. Das Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten, dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal dessen lange, schwarze Haare und Schnurrbärtchen sorgfältig gepflegt waren und sich blasser, aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute. Solcher Habitus war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne daß er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei im Schilde führte; vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im stillen seine Arbeit verrichten ließ; aber lieber wäre er verhungert, als daß er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er ebenfalls mit großem Anstand zu tragen wußte. Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel; wenn er wanderte und keine Ersparnisse mitführte, geriet er in die größte Not. Näherte er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde und erwarteten eher alles andere, als daß er betteln würde; so erstarben ihm, da er überdies nicht beredt war, die Worte im Munde, also daß er der Märtyrer seines Mantels war und Hunger litt, so schwarz wie des letztern Sammetfutter. Als er bekümmert und geschwächt eine Anhöhe hinauf ging, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein 37 herrschaftlicher Kutscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herren überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf einem gemieteten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäckes versehen und schien deswegen schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden, und als er, oben angekommen, den Bock wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle. Denn es fing eben an zu regnen, und er hatte mit einem Blicke gesehen, daß der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug. Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen Stunde stattlich und donnernd durch den Torbogen von Goldach fuhr. Vor dem ersten Gasthofe, zur Waage genannt, hielt das vornehme Fuhrwerk plötzlich, und alsogleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, daß der Draht beinahe entzweiging. Da stürzten Wirt und Leute herunter und rissen den Schlag auf; Kinder und Nachbaren umringten schon den prächtigen Wagen, neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthülsen werde, und als der verdutzte Schneider endlich hervorsprang in seinem Mantel, blaß und schön und schwermütig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein, den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen – er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinan geleiten und bemerkte seine neue, seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Mantel dienstfertig abgenommen wurde. “Der Herr wünscht zu speisen?” hieß es, “gleich wird serviert werden, es ist eben gekocht!” Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Waagwirt in die Küche und rief: “Ins drei Teufels Namen! Nun haben wir nichts als Rindfleisch und die Hammelskeule! Die Rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist. So geht es! Den einzigen Tag, wo wir keinen Gast 38 erwarten und nichts da ist, muß ein solcher Herr kommen! Und der Kutscher hat ein Wappen auf den Knöpfen, und der Wagen ist wie der eines Herzogs! Und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit!” Erläuterungen zum Text Goldach: eine sprechende Ortsbezeichnung dieser kleinen, reichen Stadt; -ach: von mhd. “Fluss”, häufig in Flussnamen und danach benannten Ortschaften. Seldwyla: abgeleitet von mhd. “saelde” < Glück, Seeligkeit > und “wîle” < Zeit >, wobei der zweite Wortteil an reale Schweizer Ortsnamen angepasst ist. Seldwyla ist das fiktive, titelgebende Zentrum für den gesamten Novellenzyklus “Die Leute von Seldwyla”. Falliment (ital.): Zahlungseinstellung, Bankrott. Habitus (lat.): das gesamte Erscheinungsbild eines Menschen in Aussehen und Verhalten. Gottfried Keller (1819–1890), schweizerischer Schriftsteller; erlernte die Kunstmalerei in Zürich; erste literarische Versuche als Verfasser antiklerikaler und politischer Gedichte; von 1861 bis 1876 arbeitete er als Staatsschreiber des Kantons Zürich; Ehrendoktor der Universität Zürich; von 1876 an bis zu seinem Tod als freier Schriftsteller in Zürich. Werke: Novellenzyklus “Die Leute von Seldwyla”, Roman “Der grüne Heinrich”, “Züricher Novellen” u.a. Textarbeit 1. Aufgaben zum Wortschatz: a) Definieren Sie verschiedene Bedeutungen der Verben (sich) erfreuen, versehen, wissen, scheinen; b) Führen Sie Synonyme zum Verb essen an; gruppieren Sie sie nach verschiedener Stilfärbung; 39 c) Wählen Sie die Wörter aus, die die thematische Reihe der Kleidung/ Schneiderei bilden. 2. Was (welche Handlung) erwarten Sie, wenn Sie den Titel lesen? 3. Sammeln Sie die ersten Eindrücke – was ist Ihnen aufgefallen? Stimmen Ihre Erwartungen, die Sie nach dem Lesen der Überschrift hatten? 4. Geben Sie mit wenigen Sätzen den Inhalt dieses Novellenanfangs wieder. 5. Zur Gestaltung: Untersuchen Sie, wie G.Keller uns in das Geschehen (Ausgangssituation) hineinführt. Welche Konfliktsituation wird in der Exposition bereits angedeutet? Wie wird der Text aufgebaut? Wie beschreibt der Erzähler den Schneider? (Wortwahl) Wie ergänzt der Erzähler das Bild vom Schneider? (Erzählkommentare) Wie schildert der Erzähler Begegnungen des Schneiders mit Goldacher Bürgern? Welche Besonderheiten des Satzbaus und der lexikalischen Stilmittel können Sie feststellen? 40 Thomas Mann TONIO KRÖGER (Auszug) Text 1 Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt. Naß und zugig war’s in den giebeligen Gassen, und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee. Die Schule war aus. Über den gepflasterten Hof und heraus aus der Gatterpforte strömten die Scharen der Befreiten, teilten sich und enteilten nach rechts und links. Große Schüler hielten mit Würde ihre Bücherpäckchen hoch gegen die linke Schulter gedrückt, indem sie mit dem rechten Arm wider den Wind dem Mittagessen entgegenruderten; kleines Volk setzte sich lustig in Trab, daß der Eisbrei umherspritzte und die Siebensachen der Wissenschaft in den Seehundsränzeln klapperten. Aber hie und da riß alles mit frommen Augen die Mützen herunter vor dem Wotanshut und dem Jupiterbart eines gemessen hinschreitenden Oberlehrers… “Kommst du endlich, Hans?” sagte Tonio Kröger, der lange auf dem Fahrdamm gewartet hatte; lächelnd trat er dem Freunde entgegen, der im Gespräch mit anderen Kameraden aus der Pforte kam und schon im Begriffe war, mit ihnen davonzugehen… “Wieso?” fragte er und sah Tonio an… “Ja, das ist wahr! Nun gehen wir noch ein bißchen.” Tonio verstummte, und seine Augen trübten sich. Hatte Hans es vergessen, fiel es ihm erst jetzt wieder ein, daß sie heute mittag ein wenig zusammen spazierengehen wollten? Und er selbst hatte sich seit der Verabredung beinahe unausgesetzt darauf gefreut! „Ja, adieu, ihr!” sagte Hans Hansen zu den Kameraden. “dann gehe ich noch ein bißchen mit Kröger.” – Und die beiden wandten sich nach links, indes die anderen nach rechts schlenderten. Hans und Tonio hatten Zeit, nach der Schule spazierenzugehen, weil sie beide Häusern angehörten, in denen erst um vier Uhr zu Mittag gegessen wurde. Ihre Väter waren große Kaufleute, die öffentliche Ämter bekleideten und mächtig waren in der Stadt. Den Hansens gehörten schon seit manchem Menschenalter die weitläufigen Holzlagerplätze drunten am Fluß, wo gewaltige Sägemaschinen unter Fauchen und Zischen die Stämme zerlegten. 41 Aber Tonio war Konsul Krögers Sohn, dessen Getreidesäcke mit dem breiten schwarzen Firmendruck man Tag für Tag durch die Straßen kutschieren sah; und seiner Vorfahren großes altes Haus war das herrschaftlichste der ganzen Stadt… Beständig mußten die Freunde, der vielen Bekannten wegen, die Mützen herunternehmen, ja, von manchen Leuten wurden die Vierzehnjährigen zuerst gegrüßt… Beide hatten die Schulmappen über die Schultern gehängt, und beide waren sie gut und warm gekleidet; Hans in eine kurze Seemannsüberjacke, über welcher auf Schultern und Rücken der breite, blaue Kragen seines Marineanzuges lag, und Tonio in einen grauen Gurtpaletot. Hans trug eine dänische Matrosenmütze mit kurzen Bändern, unter der ein Schopf seines bastblonden Haares hervorquoll. Er war außerordentlich hübsch und wohlgestaltet, breit in den Schultern und schmal in den Hüften, mit freiliegenden und scharfblickenden stahlblauen Augen. Aber unter Tonios runder Pelzmütze blickten aus einem brünetten und ganz südlich scharfgeschnittenen Gesicht dunkle und zart umschattete Augen mit schweren Lidern träumerisch und ein wenig zaghaft hervor… Mund und Kinn waren ihm ungewöhnlich weich gebildet. Er ging nachlässig und ungleichmäßig, während Hansens schlanke Beine in den schwarzen Strümpfen so elastisch und taktfest einherschritten… Tonio sprach nicht. Er empfand Schmerz. Indem er seine etwas schrägstehenden Brauen zusammenzog und die Lippen zum Pfeifen gerundet hielt, blickte er seitwärts geneigten Kopfes ins Weite. Diese Haltung und Miene war ihm eigentümlich. Plötzlich schob Hans seinen Arm unter den Tonios und sah ihn dabei von der Seite an, denn er begriff sehr wohl, um was es sich handelte. Und obgleich Tonio auch bei den nächsten Schritten noch schwieg, so ward er doch auf einmal sehr weich gestimmt. “Ich hatte es nämlich nicht vergessen, Tonio”, sagte Hans und blickte vor sich nieder auf das Trottoir, “sondern ich dachte nur, daß heute doch wohl nichts daraus werden könnte, weil es ja so naß und windig ist. Aber mir macht das gar nichts, und ich finde es famos, da du trotzdem auf mich gewartet hast. Ich glaube schon, du seist nach Hause gegangen, und ärgerte mich…” Alles in Tonio geriet in eine hüpfende und jubelnde Bewegung bei diesen Worten. 42 “Ja, wir gehen nun also über die Wälle!” sagte er mit bewegter Stimme. “Über den Mühlenwall und den Holstenwall, und so bringe ich dich nach Hause, Hans… Bewahre, das schadet gar nichts, daß ich dann meinen Heimweg allein mache; das nächste Mal begleitest du mich.” Im Grunde glaubte er nicht sehr fest an das, was Hans gesagt hatte, und fühlte genau, daß jener nur halb soviel Gewicht auf diesen Spaziergang zu zweien legte wie er. Aber er sah doch, daß Hans seine Vergeßlichkeit bereute und es sich angelegen sein ließ, ihn zu versöhnen. Und er war weit von der Absicht entfernt, die Versöhnung hintanzuhalten… […] Der Weg über die Wälle nahm nicht so viel Zeit in Anspruch. Sie hielten ihre Mützen und beugten die Köpfe vor dem starken, feuchten Wind, der in dem kahlen Geäst der Bäume knarrte und stöhnte. Und Hans Hansen sprach, während Tonio nur dann und wann ein künstliches Ach und Jaja einfließen ließ, ohne Freude darüber, daß Hans ihn im Eifer wieder untergefaßt hatte, denn das war nur eine scheinbare Annäherung, ohne Bedeutung. Dann verließen sie die Wallanlagen unfern des Bahnhofes, sahen einen Zug mit plumper Eilfertigkeit vorüberpuffen, zählten zum Zeitvertreib die Wagen und winkten dem Manne zu, der in seinem Pelz vermummt zuhöchst auf dem allerletzten saß. Und am Lindenplatze, vor Großhändler Hansens Villa, blieben sie stehen, und Hans zeigte ausführlich, wie amüsant es sei, sich unten auf die Gartenpforte zu stellen und sich in den Angeln hin und her zu schlenkern, daß es nur so kreischte. Aber hierauf verabschiedete er sich. “Ja, nun muß ich hinein”, sagte er. “Adieu, Tonio. Das nächste Mal begleite ich dich nach Hause, sei sicher.” “Adieu, Hans”, sagte Tonio, “es war nett, spazierenzugehen.” Ihre Hände, die sich drückten, waren ganz naß und rostig von der Gartenpforte. Als aber Hans in Tonios Augen sah, entstand etwas wie reuiges Besinnen in seinem hübschen Gesicht. “Übrigens werde ich nächstens ‘Don Carlos’ lesen!” sagte er rasch. “Das mit dem König im Kabinett muß famos sein!” Dann nahm er seine Mappe unter den Arm und lief durch den Vorgarten. Bevor er im Hause verschwand, nickte er noch einmal zurück. 43 Und Tonio Kröger ging ganz verklärt und beschwingt von dannen. Der Wind trug ihn von hinten, aber es war nicht darum allein, daß er so leicht von der Stelle kam. Hans würde “Don Carlos” lesen, und dann würden sie etwas miteinander haben, worüber weder Jimmerthal noch irgendein anderer mitreden könnte! Wie gut sie einander verstanden! Wer wußte, - vielleicht brachte er ihn noch dazu, ebenfalls Verse zu schreiben?… Nein, nein, das wollte er nicht! Hans sollte nicht werden wie Tonio, sondern bleiben, wie er war, so hell und stark, wie alle ihn liebten und Tonio am meisten! Aber daß er „Don Carlos“ las, würde trotzdem nicht schaden... Und Tonio ging durch das alte, untersetzte Tor, ging am Hafen entlang und die steile, zugige und nasse Giebelgasse hinauf zum Haus seiner Eltern. Damals lebte sein Herz; Sehnsucht war darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit. Textarbeit 1. Finden Sie Wortpaare und Funktionsverbgefüge, und verwenden Sie dieses Wortmaterial in einer Erlebniserzählung. 2. Führen Sie die Vieldeutigkeit des Verbs reißen an und illustrieren Sie deren Gebrauch durch Sätze. 3. Analysieren Sie die Personenrede des Auszuges. TONIO KRÖGER (Auszug) Text 2 Er ging den Weg, den er gehen mußte, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich pfeifend, mit seitwärts geneigtem Kopfe ins Weite blickend, und wenn er irreging, so geschah es, weil es für etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht gibt. Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, denn er pflegte zu sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß er die Möglichkeiten zu tausend Daseinsformen in sich trage, zusammen mit dem heimlichen Bewußtsein, daß es im Grunde lauter Unmöglichkeiten seien... 44 Schon bevor er von der engen Vaterstadt schied, hatten sich leise die Klammern und Fäden gelöst, mit denen sie ihn hielt. Die alte Familie der Kröger war nach und nach in einen Zustand des Abbröckelns und der Zersetzung geraten, und die Leute hatten Grund, Tonio Kröger eigenes Sein und Wesen ebenfalls zu den Merkmalen dieses Zustandes zu rechnen. Seines Vaters Mutter war gestorben, das Haupt des Geschlechtes, und nicht lange darauf, so folgte sein Vater, der lange, sinnende, sorgfältig gekleidete Herr mit der Feldblume im Knopfloch, ihr im Tode nach. Das große Krögersche Haus stand mitsamt seiner würdigen Geschichte zum Verkaufe, und die Firma war ausgelöscht. Tonios Mutter jedoch, seine schöne, feurige Mutter, die so wunderbar den Flügel und die Mandoline spielte und der alles ganz einerlei war, vermählte sich nach Jahresfrist aufs neue, und zwar mit einem Musiker, einem Virtuosen mit italienischem Namen, dem sie in blaue Fernen folgte. Tonio Kröger fand dies ein wenig liederlich; aber war er berufen, es ihr zu wehren? Er schrieb Verse und konnte nicht einmal beantworten, was in aller Welt er zu werden gedachte… Und er verließ die winklige Heimatstadt, um deren Giebel der feuchte Wind pfiff, verließ den Springbrunnen und den alten Walnußbaum im Garten, die Vertrauten seiner Jugend, verließ auch das Meer, das er so sehr liebte, und empfand keinen Schmerz dabei. Denn er war groß und klug geworden, hatte begriffen, was für eine Bewandtnis es mit ihm hatte, und war voller Spott für das plumpe und niedrige Dasein, das ihn so lange in seiner Mitte gehalten hatte. Er ergab sich ganz der Macht, die ihm als die erhabendste auf Erden erschien, zu deren Dienst er sich berufen fühlte, und die ihm Hoheit und Ehren versprach, der Macht des Geistes und Wortes, die lächelnd über dem unbewußten und stummen Leben thront. Mit seiner jungen Leidenschaft ergab er sich ihr, und sie lohnte ihm mit allem, was sie zu schenken hat, und nahm ihm unerbittlich all das, was sie als Entgelt dafür zu nehmen pflegt. Sie schärfte seinen Blick und ließ ihn und die großen Wörter durchschauen, die der Menschen Busen blähen, sie erschloß ihm der Menschen Seelen und seine eigene, machte ihn hellsehend und zeigte ihm das Innere der Welt und alles Letzte, was hinter den Worten und Taten ist. Was er aber sah, war dies: Komik und Elend – Komik und Elend. 45 Da kam, mit der Qual und dem Hochmut der Erkenntnis, die Einsamkeit, weil es ihn im Kreise der Harmlosen mit dem frōhlich dunklen Sinn nicht litt und das Mal an seiner Stirn sie verstörte. Aber mehr und mehr versüßte sich ihm auch die Lust am Worte und der Form, denn er pflegte zu sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß die Kenntnis der Seele allein unfehlbar trübsinnig machen würde, wenn nicht die Vergnügungen des Ausdrucks uns wach und munter erhielten… Er lebte in großen Städten und im Süden, von dessen Sonne er sich ein üppiges Reifen seiner Kunst versprach; und vielleicht war es das Blut seiner Mutter, welches ihn dorthin zog. Aber da sein Herz tot und ohne Liebe war, so geriet er in Abenteuer des Fleisches, stieg tief hinab in Wollust und heiße Schuld und litt unsäglich dabei. Vielleicht war es das Erbteil seines Vaters in ihm, des langen, sinnenden, reinlich gekleideten Mannes mit der Feldblume im Knopfloch, das ihn dort unten so leiden machte und manchmal eine schwache, sehnsüchtige Erinnerung in ihm sich regen ließ an eine Lust der Seele, die erstmals sein eigen gewesen war, und die er in allem Lüsten nicht wiederfand. Ein Ekel und Haß gegen die Sinne erfaßte ihn und ein Lechzen nach Reinheit und wohlständigem Frieden, während er doch die Luft der Kunst atmete, die laue und süße, duftgeschwängerte Luft eines beständigen Frühlings, in der es treibt und braut und keimt in heimlicher Zeugungswonne. So kam er nur dahin, daß er, haltlos zwischen krassen Extremen, zwischen eisiger Geistigkeit und verzehrender Sinnenglut hin und her geworfen, unter Gewissensnöten ein erschöpfendes Leben führte, ein ausbündiges, ausschweifendes und außerordentliches Leben, das er, Tonio Kröger, im Grunde verabscheute. Welch Irrgang! dachte er zuweilen. Wie war es nur möglich, daß ich in alle diese exzentrischen Abenteuer geriet? Ich bin doch kein Zigeuner im grünen Wagen, von Hause aus… Aber in dem Maße, wie seine Gesundheit geschwächt ward, verschärfte sich seine Künstlerschaft, ward wählerisch, erlesen, kostbar, fein, reizbar gegen das Banale und aufs höchste empfindlich in Fragen des Taktes und Geschmacks. Als er zum ersten Male hervortrat, wurde unter denen, die es anging, viel Beifall und Freude laut, denn es war ein wertvoll gearbeitetes Ding, was er geliefert hatte, voll Humor und Kenntnis des Leidens. Und schnell ward sein 46 Name, derselbe, mit dem ihn einst seine Lehrer scheltend gerufen hatten, derselbe, mit dem er seine ersten Reime an den Walnußbaum, den Springbrunnen und das Meer unterzeichnet hatte, dieser aus Süd und Nord zusammengesetzte Klang, dieser exotisch angehauchte Bürgersname zu einer Formel, die Vortreffliches bezeichnete; denn der schmerzlichen Gründlichkeit seiner Erfahrungen gesellte sich ein seltener, zäh ausharrender und ehrsüchtiger Fleiß, der im Kampf mit der wählerischen Reizbarkeit seines Geschmacks unter heftigen Qualen ungewöhnliche Werke entstehen ließ. Er arbeitete nicht wie jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern einer, der nichts will als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts achtet, nur als Schaffender in Betracht zu kommen wünscht und im übrigen grau und unauffällig umhergeht, wie ein abgeschminkter Schauspieler, der nichts ist, solange er nichts darzustellen hat. Er arbeitet stumm, abgeschlossen, unsichtbar und voller Verachtung für jene Kleinen, denen das Talent ein geselliger Schmuck war, die, ob sie nun arm oder reich waren, wild und abgerissen einhergingen oder mit persönlichen Krawatten Luxus trieben, in erster Linie glücklich, liebenswürdig und künstlerisch zu leben bedacht waren, unwissend darüber, daß gute Werke nur unter dem Druck eines schlimmen Lebens entstehen, daß, wer lebt, nicht arbeitet, und daß man gestorben sein muß, um ganz ein Schaffender zu sein. Textarbeit 1. Führen Sie Synonyme zum Verb gehen an und gruppieren Sie sie nach der Stilfärbung. Bilden Sie 3 Situationen oder längere Sätze, indem Sie Verben von verschiedenen stilistischen Schattierungen gebrauchen. 2. Analysieren Sie syntaktische Stilmittel und ihre Rolle im Text. 47 TONIO KRÖGER (Auszug) Text 3 Tonio Kröger saß im Norden und schrieb an Lisaweta Iwanowna, seine Freundin, wie er es ihr versprochen hatte. Liebe Lisaweta dort unten in Arkadien, wohin ich bald zurückkehren werde, schrieb er. Hier ist nun also etwas wie ein Brief, aber er wird Sie wohl enttäuschen, denn ich denke, ihn ein wenig allgemein zu halten. Nicht, daß ich so gar nichts zu erzählen, auf meine Weise nicht dies und das erlebt hätte. Zu Hause, in meiner Vaterstadt, wollte man mich sogar verhaften ... aber davon sollen Sie mündlich hören. Ich habe jetzt manchmal Tage, an denen ich es vorziehe, auf gute Art etwas Allgemeines zu sagen, anstatt Geschichten zu erzählen. Wissen Sie wohl noch, Lisaweta, daß Sie mich einmal einen Bürger, einen verirrten Bürger nannten? Sie nannten mich so in einer Stunde, da ich Ihnen, verführt durch andere Geständnisse, die ich mir vorher hatte entschlüpfen lassen, meine Liebe zu dem gestand, was ich das ‚Leben’ nenne; und ich frage mich, ob Sie wohl wußten, wie sehr Sie damit die Wahrheit trafen, wie sehr mein Bürgertum und meine Liebe zum ‚Leben’ eins und dasselbe ist. Diese Reise hat mir Veranlassung gegeben, darüber nachzudenken ... Mein Vater, wissen Sie, war ein nordisches Temperament: betrachtsam, gründlich, korrekt aus Puritanismus und zur Wehmut geneigt; meine Mutter von unbestimmt exotischem Blut, schön, sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und leidenschaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit. Ganz ohne Zweifel war dies eine Mischung, die außerordentliche Gefahren in sich schloß. Was herauskam, war dies: ein Bürger, der sich in die Kunst verirrte, ein Bohemien mit Heimweh nach der guten Kinderstube, ein Künstler mit schlechtem Gewissen. Denn mein bürgerliches Gewissen ist es ja, was mich in allem Künstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie etwas tief Zweideutiges, tief Anrüchiges, tief Zweifelhaftes erblicken läßt, was mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple, Treuherzige und Angenehm-Normale, das Ungeniale und Anständige erfüllt. Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe es infolgedessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich einen 48 Bürger, und die Bürger sind versucht, mich zu verhaften ... ich weiß nicht, was von beiden mich bitterer kränkt. Die Bürger sind dumm; ihr Anbeter der Schönheit aber, die ihr mich phlegmatisch und ohne Sehnsucht heißt, solltet bedenken, daß es ein Künstlertum gibt, so tief, so von Anbeginn und Schicksals wegen, daß keine Sehnsucht ihm süßer und empfindenswerter erscheint als die nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit. Alle Wärme, alle Güte, aller Humor kommt aus ihr, und fast will mir scheinen, als sei sie jene Liebe selbst, von der geschrieben steht, daß einer mit Menschen- und Engelszungen reden könne und ohne sie doch nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle sei. Was ich getan habe, ist nichts, nicht viel, so gut wie nichts. Ich werde Besseres machen, Lisaweta, – dies ist ein Versprechen. Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf, und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will, ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, daß ich sie banne und erlöse: tragische und lächerliche und solche, die beides zugleich sind, – und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den Blonden und Blauäugigen, den hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen. Schelten Sie diese Liebe nicht, Lisaweta; sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit. Textarbeit 1. Schlagen Sie Erläuterungen des Begriffs Bürger/Bürgertum nach. Führen Sie Vieldeutigkeit und Wortfamilien der Verben führen und lassen an. Illustrieren Sie den Gebrauch des Modalverbs lassen in Sätzen. 2. Lesen Sie Notizen, die sie zu Leben und Schaffen von Thomas Mann früher gemacht haben, noch einmal durch. 3. Schlagen Sie Materialien nach zu einem der Hauptthemen in Th. Manns Erzählungen, und zwar: Gegensätze zwischen Kunst und Leben/die Frage nach der Aufgabe und Stellung des Künstlers (Künstler und Bürger). 49 4. Wiederholen Sie Prinzipien (Merkmale) der Novelle und bedienen Sie sich deren bei der Textanalyse bzw. Interpretation. 5. Analysieren Sie die Auszüge nach verschiedenen Aspekten, z.B.: Komposition (Aufbau, Hauptgedanke, Motive); Erzählsituation (Erzähler, Blickrichtung); Zeit- und Raumgestaltung; Personen (Darstellung, Charakteristik); Darbietungsweisen (innerer Monolog etc.); sprachliche Wirkungs- und Gestaltungsmittel. 6. Vergleichen Sie Auszüge aus der Novelle „Tonio Kröger“ und aus dem Roman „Buddenbrooks“ nach einem Schwerpunkt (wahlweise). Die Zeit ist ein kostbares Geschenk, uns gegeben, damit wir in ihr klüger, reifer, vollkommener werden. Sie ist der Friede selbst, und Krieg ist nichts als das wilde Verschmähen der Zeit, der Ausbruch aus ihr in sinnlose Ungeduld. (Thomas Mann) 50 Siegfried Lenz EINE LIEBESGESCHICHTE Text 1 Joseph Waldemar Gritzan, ein großer, schweigsamer Holzfäller, wurde heimgesucht von der Liebe. Und zwar hatte er nicht bloß so ein mageres Pfeilchen im Rücken sitzen, sondern, gleichsam seiner Branche angemessen, eine ausgewachsene Rundaxt. Empfangen hatte er diese Axt in dem Augenblick, als er Katharina Knack, ein ausnehmend gesundes, rosiges Mädchen, beim Spülen der Wäsche zu Gesicht bekam. Sie hatte auf ihren ansehnlichen Knien am Flüßchen gelegen, den Körper gebeugt, ein paar Härchen im roten Gesicht, während ihre beträchtlichen Arme herrlich mit der Wäsche hantierten. In diesem Augenblick, wie gesagt, ging Joseph Gritzan vorbei, und ehe er sich’s versah, hatte er auch schon die Wunde im Rücken. Demgemäß ging er nicht in den Wald, sondern fand sich, etwa um fünf Uhr morgens, beim Pfarrer von Suleyken ein, trommelte den Mann Gottes aus seinem Bett und sagte: “Mir ist es”, sagte er, “Herr Pastor, in den Sinn gekommen zu heiraten. Deshalb möchte ich bitten um einen Taufschein.” Der Pastor, aus mildem Traum geschreckt, besah sich den Joseph Gritzan ungnädig und sagte: “Mein Sohn, wenn dich die Liebe schon nicht schlafen läßt, dann nimm zumindest Rücksicht auf andere Menschen. Komm später nach dem Frühstück. Aber wenn du Zeit hast, kannst du mir ein bißchen den Garten umgraben. Der Spaten steht im Stall.” Der Holzfäller sah einmal zum Stall hinüber und sprach: “Wenn der Garten umgegraben ist, darf ich dann bitten um den Taufschein?” “Es wird alles genehmigt wie eh und je”, sagte der Pfarrer und empfahl sich. Joseph Gritzan, beglückt über solche Auskunft, begann dergestalt den Spaten zu gebrauchen, daß der Garten schon nach kurzer Zeit umgegraben war. Dann zog er, nach Rücksprache mit dem Pfarrer, den Schweinen Drahtringe durch die Nasen, melkte eine Kuh, erntete zwei Johannisbeerbüsche ab, schlachtete eine Gans und hackte einen Berg Brennholz. Als er sich gerade daran machte, den Schuppen auszubessern, rief der Pfarrer ihn zu sich, füllte den 51 Taufschein aus und übergab ihn mit sanften Ermahnungen Joseph Waldemar Gritzan. Na, der faltete das Dokument mit umständlicher Sorgfalt zusammen, wickelte es in eine Seite des Masuren-Kalenders und verwahrte es irgendwo in der weitläufigen Gegend seiner Brust. Bedankte sich natürlich, wie man erwartet hat, und machte sich auf der Stelle am Flüßchen, wo die liebliche Axt Amoros ihn getroffen hatte. Katharina Knack, sie wußte noch nicht von seinem Zustand, und ebensowenig wußte sie, was alles er bereits in die heimlichen Wege geleitet hatte. Sie kniete singend am Flüßchen, walkte und knetete die Wäsche und erlaubte sich in kurzen Pausen, ihr gesundes Gesicht zu betrachten, was im Flüßchen möglich war. Joseph umfing die rosige Gestalt – mit den Blicken, versteht sich –, rang ziemlich nach Luft, schluckte und würgte ein Weilchen, und nachdem er sich ausgeschluckt hatte, ging er an die Klattkä, das ist: ein Steg, heran. Er hatte sich heftig und lange überlegt, welche Worte er sprechen sollte, und als er jetzt neben ihr stand, sprach er so: “Rutsch zur Seite”. Das war, ohne Zweifel, ein unmißverständlicher Satz. Katharina machte ihm denn auch schnell Platz auf der Klattkä, und er setzte sich, ohne ein weiteres Wort, neben sie. Sie saßen so – wie lange mag es gewesen sein? – ein halbes Stündchen vielleicht und schwiegen sich gehörig aneinander heran. Sie betrachteten das Flüßchen, das jenseitige Waldufer, sahen zu, wie kleine Gringel in den Grund stießen und kleine Schlammwolken emporrissen, und zuweilen verfolgten sie auch das Treiben der Enten. Plötzlich aber sprach Joseph Gritzan: “Bald sind die Erdbeeren soweit. Und schon gar nicht zu reden von den Blaubeeren im Wald”. Das Mädchen, unvorbereitet auf seine Rede, schrak zusammen und antwortete: “Ja”. So, und jetzt saßen sie stumm wie Hühner nebeneinander, äugten über die Wiese, äugten zum Wald hinüber, guckten manchmal auch in die Sonne oder kratzten sich am Fuß oder am Hals. Dann, nach angemessener Weile, erfolgte wieder etwas Ungewöhnliches: Joseph Gritzan langte in die Tasche, zog etwas Eingewickeltes heraus und sprach zu dem Mädchen Katharina Knack: “Willst”, sprach er, “Lakritz?” Sie nickte, und der Holzfäller wickelte zwei Lakritzstangen aus, gab ihr eine und sah zu, wie sie aß und lutschte. Es schien ihr gut zu 52 schmecken. Sie wurde übermütig – wenn auch nicht so, daß sie zu reden begonnen hätte -, ließ ihre Beine ins Wasser baumeln, machte kleine Wellen und sah hin und wieder in sein Gesicht. Er zog sich nicht die Schuhe aus. Soweit nahm alles einen ordungsgemäßen Verlauf. Aber auf einmal… wie es zu gehen pflegt in solchen Lagen – rief die alte Guschke, trat vors Häuschen und rief: “Katinka, wo bleibt die Wäsch’!” Worauf das Mädchen verdattert aufsprang, den Eimer anfaßte und mir nichts dir nichts, als ob die Lakritzstange gar nichts gewesen wäre, verschwinden wollte. Doch, Gott sei Dank, hatte Joseph Gritzan das weitläufige Gelände seiner Brust bereits durchforscht, hatte auch schon den Taufschein zur Hand, packte ihn sorgsam aus und winkte das Mädchen noch einmal zu sich heran. “Kannst”, sprach er, “lesen?” Sie nickte hastig. Er reichte ihr den Taufschein und erhob sich. Er beobachtete, während sie las, ihr Gesicht und zitterte am ganzen Körper. “Katinka!” schrie die alte Guschke. “Katinka, haben die Enten die Wäsch’ gefressen?” “Lies zu Ende”, sagte der Holzfäller drohend. Er versperrte ihr, weiß Gott, schon den Weg, dieser Mensch. Katharina Knack vertiefte sich immer mehr in den Taufschein, vergaß Welt und Wäsche und stand da, sagen wir mal: wie ein träumendes Kälbchen, so stand sie da. “Die Wäsch’, die Wäsch’”, keifte die alte Guschke von neuem. “Lies zu Ende”, drohte Joseph Gritzan, und er war so erregt, daß er sich nicht einmal wunderte über seine Geschwätzigkeit. Plötzlich schoß die alte Guschke zwischen den Stachelbeeren hervor und heran, trat ganz dicht neben Katharina Knack und rief: “Die Wäsch’, Katinka!” Und mit einem tatarischen Blick auf den Holzfäller: “ Hier geht vor die Wäsch’, Cholera!” O Wunder der Liebe, insbesondere der masurischen; das Mädchen, das träumende, rosige, hob seinen Kopf, zeigte der alten Guschke den Taufschein und sprach: “Es ist”, sprach es, “besiegelt und beschlossen. Was für ein schöner Taufschein. Ich werde heiraten.” 53 Die alte Guschke, sie war zuerst wie vor den Kopf getreten, aber dann lachte sie und sprach: “Nein, nein”, sprach sie, “was die Wäsch’ alles mit sich bringt. Beim Einweichen haben wir noch nichts gewußt. Und beim Plätten ist es schon soweit.” Währenddessen hatte Joseph Gritzan wiederum etwas aus seiner Tasche gezogen, hielt es dem Mädchen hin und sagte: “Willst noch Lakritz?” AUTOBIOGRAPHISCHE SKIZZE Text 2 Ich wurde am 17. März in Lyck geboren, einer Kleinstadt zwischen zwei Seen, von der die Lycker behaupteten, sie sei die “Perle Masurens”. Die Gesellschaft, die sich an dieser Perle erfreute, bestand aus Arbeitern, Handwerkern, kleinen Geschäftsleuten, Fischern, geschickten Besenbindern und geduldigen Beamten, zu denen auch mein Vater gehörte. Still erfreuen an der matten Schönheit konnte sich allerdings niemand, da die Perle von mehreren Exerzierplätzen eingeschlossen war, auf denen sommers und winters Maschinengewehre hämmerten, Kanonen das Schweigen zerstörten. Sooft ich nach dem bescheidenen Glanz meiner Stadt suche, ziehen Soldaten über die Brücke, schallen Kommandos herüber, sehe ich in Dreck und Schnee leere Patronenhülsen liegen. Zu meiner Stadt gehört außerdem der Triumph der Jahreszeiten. Die Jahreszeiten wurden von allen anerkannt, bereicherten das unaufhörliche Gespräch über Ernten, Beute, Todesfälle und Geburten. Die Jahreszeiten beeinflußten und terrorisierten uns, sie machten Handlungen und Unterlassungen verständlich: in keiner Erzählung durfte die Jahreszeit unerwähnt bleiben. Erinnerung galt viel in Masuren, galt jedenfalls mehr als Erwartung, und was das Gedächtnis unserer Greise bewahrte, das waren vor allem Kriege und Schlachten: leichte sommerliche Scharmützel und solide Umfassungsschlachten im Schnee, Vormärsche und traurige Rückzüge – immer redeten und murmelten sie davon. Auch einige meiner Lehrer sprachen am liebsten über Schlachten, und besonders hartnäckig redeten die Invaliden davon, mein Geschichtslehrer zum Beispiel, der so oft berauscht von Hindenburg sprach, bis er ihm allmählich physiognomisch zu ähneln 54 begann und wir ihn selbst Hindenburg nannten. Außer Geschichte gab er Sport und Singen, und er verschaffte uns die Möglichkeit, miserable Geschichtszensuren oder hoffnungslose Noten im Singen an der Kletterstange aufzubessern; der Bizeps wurde in meiner Schule als Bildungsfaktor anerkannt. Wegen des Schulwegs schwänzte ich selten den Unterricht; denn im Sommer konnte man die Schule im Boot erreichen, im Winter auf Schlittschuhen. Als ein Luftschiff über Lyck erschien, erhielten wir schulfrei, und als ein Mann namens Hitler durch unsere Hauptstraße fuhr, bestand der Unterricht im Winken mit Kornblumen sowie im Jubeln auf Handzeichen. Auch ich stand im Spalier der Schüler. Und bald darauf stand ich wieder am Straßenrand und beobachtete die Soldaten, die diesmal nicht zum Exerzierplatz, sondern zur nahen Grenze marschierten und das Land überfielen, aus dem bis dahin Holzflößer zu uns gekommen waren. Der Geschützdonner regte unsere Greise an, und die Invaliden des ersten Krieges entsannen sich ihrer Taten, nicht ihres Unglücks. In unserer Schule hing eine Gedenktafel für die gefallenen Schüler; sie war nicht ganz voll, sie hatte noch Platz für ein Dutzend Namen, und eines Tages holten sie die älteren Schüler – nicht lange danach wuchs die Gedenkentafel nach unten zu. Der Krieg dauerte bereits einige Jahre, darum eröffneten die Lehrer manchmal den Unterricht mit der Wiederholung einer Sondermeldung. Zur Zeit der Blaubeeren gab es viele Sondermeldungen, und im Frühjahr wurde eine zweite Gedenktafel für gefallene Schüler enthüllt. Als sie mich holten, war bereits alles entschieden. Ich verstärkte ihre Marine auf der Ostsee. Ich wurde Augenzeuge der großen Flucht und des Untergangs vieler Schiffe. Ich bewährte mich bei Schuhappellen, Kleider- und Spindappellen, während im Deck über uns Verwundete starben. Ein wortarmer Stumpfsinn zwang uns, die Kunst der Verstellung zu entwickeln. Dann wurden die Mächtigen machtlos, die Meister der Gewalt büßten ihre Herrschaft ein, und seit damals hat mich dieser Augenblick immer wieder beschäftigt: um selber verstehen zu lernen, was mit einem Menschen geschieht, in denen der Augenblick des “Falls” dargestellt wird. Schreiben ist eine gute Möglichkeit, um Personen, Handlungen und Konflikte verstehen zu lernen. 55 Nach dem Krieg studierte ich Philosophie, Anglistik und Literaturgeschichte in Hamburg. Erfolgreiche Aktionen als Schwarzhändler – Nähnadeln, Zwiebeln, Präperieralkohol – halfen mir, mein Studium zu finanzieren. Später, als meine Quellen versiegten, ging es mir sehr schlecht. Ein Kumpel warb mich als Blutspender, und ich konnte die dringenden Unkosten decken. Um außergewöhnliche Ausgaben zu vermeiden, blieb ich oft im Bett und las. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. In jener Zeit hatte ich mich für den Lehrerberuf entschieden, doch ein Gespräch von einer Stunde genügte, um meine Pläne zu ändern: ich wurde Journalist. Ich redigierte Kulturnachrichten, politische Nachrichten, Nachrichten über gemischte Verbrechen. Ich lernte Streichen. Ich wurde mit den Schwierigkeiten beim Formulieren einer Nachricht vertraut und wunderte mich über die Mitteilungsfreude der Menschen, die ich interviewte. Meine journalistischen Lehrer nahmen sich die Zeit, mich auf meine Fehler und Irrtümer aufmerksam zu machen; dafür bin ich ihnen dankbar. Mein erstes Buch Es waren Habichte in der Luft schrieb ich unter dem Einfluß von Dostojewski und Faulkner. Ich glaube, daß mich unwillkürlich auch andere Schriftsteller beeinflußten, die ich bewunderte; beispielsweise Camus und – in einigen Arbeiten – Hemingway. Um allmählich seine eigenen Bücher schreiben zu können, muß man sich zunächst Klarheit über die vorhandenen fremden Einflüsse verschaffen. Ich versuchte es. Seit 1951 lebe ich als freier Schriftsteller in Hamburg. Ich wüßte nicht, was ich lieber täte als Schreiben, doch was ich ebenso gern tue, das ist Fischen – eine Tätigkeit, bei der es nicht auf die Beute ankommt, sondern auf das Gefühl der Erwartung. Es waren die polnischen Holzflößer, von denen ich das Fischen lernte, und sie brachten mir auch bei, alle Genugtuung in der Erwartung zu finden. Diese Praxis halte ich für übertragbar, und als Schriftsteller habe ich versucht, eine Gewohnheit daraus zu machen. In meinen letzten beiden Romanen und in einer Reihe von Erzählungen variiere ich das Thema vom “Helden”, der sich gegen einen unvermeidlichen Niedergang auflehnt und unterliegt. In anderen Arbeiten kehren die Motive von Flucht und Verfolgung von Gleichgültigkeit, Empörung und verfehlter Lebensgründung wieder. Es sind gewiß nicht “meine” Themen, “meine” Motive. Für mich ist das Schreiben auch eine Art 56 der Selbstbefragung, und in diesem Sinne versuche ich, auf gewisse Herausforderungen mit meinen Möglichkeiten zu antworten. Mitunter ändern sich meine Ansichten über das Schreiben, meine Erwartungen gegenüber dem Schriftsteller jedoch bleiben sich gleich. Ich erwarte von ihm ein gewisses Mitleid, Gerechtigkeit und einen nötigen Protest. DISKRETE AUSKUNFT ÜBER MASUREN Text 3 Im Süden Ostpreußens, zwischen Torfmooren und sandiger Öde, zwischen verborgenen Seen und Kiefernwäldern waren wir Masuren zu Hause – eine Mischung aus pruzzischen Elementen und polnischen, aus brandenburgischen, salzburgischen und russischen. Meine Heimat lag sozusagen im Rücken der Geschichte; sie hat keine berühmten Physiker hervorgebracht, keine Rollschuhmeister oder Präsidenten; was hier vielmehr gefunden wurde, war das unscheinbare Gold der menschlichen Gesellschaft: Holzarbeiter und Bauern, Fischer, Deputatarbeiter, kleine Handwerker und Besenbinder. Gleichgültig und geduldig lebten sie ihre Tage, und wenn sie bei uns miteinander sprachen, so erzählten sie von uralten Neuigkeiten, von der Schafschur und vom Torfstechen, vom Vollmond und seinem Einfluß auf neue Kartoffeln, vom Borkenkäfer oder von der Liebe. Und doch besaßen sie etwas durchaus Originales – ein Psychiater nannte es einmal die “unterschwellige Intelligenz”. Das heißt: eine Intelligenz, die Außenstehenden rätselhaft erscheint, die auf erhabene Weise unbegreiflich ist und sich jeder Beurteilung nach landläufigen Maßstäben versagt. Und sie besaßen eine Seele, zu deren Eigenartigkeiten blitzhafte Schläue gehörte und schwerfällige Tücke, tapsige Zärtlichkeit und rührende Geduld. Die hier vorliegenden Geschichten und Skizzen sind gleichsam kleine Erkundungen der masurischen Seele. Sie stellen keinen schwermütigen Sehnsuchtsgesang dar, im Gegenteil: diese Geschichten sind zwinkernde Liebeserklärungen an mein Land, eine aufgeräumte Huldigung an die Leute von Masuren. Sebstverständlich enthalten sie kein verbindliches Urteil – es ist mein Masuren, mein Dorf Suleyken, das ich hier beschrieben habe. Suleyken, wie es hier vorkommt, hat es natürlich nie und nirgendwo gegeben; es ist eine Erfindung, so wie die Geschichten auch zum größten Teil Erfindung sind. Aber es ist von Wichtigkeit, ob dieses Dörfchen 57 bestand oder nicht? Ist es nicht viel entscheidender, daß es möglich gewesen wäre? Gewiß, das ist zugegeben, wird in diesen Geschichten ein wenig übertrieben – aber immerhin, es wird methodisch übertrieben. Und zwar in der Weise, daß das besonders Eigenartige hervorgehoben wird und das besonders Charakteristische zum Vorschein kommt. Insofern steht das bewährte Mittel der Übertreibung ganz im Dienst der Wahrheitsfindung. Aber das ist, alles in allem, auch von geringer Bedeutung, wenn wir uns nur einig wissen in unserer grübelnden Zärtlichkeit zu Suleyken. (Aus: S.Lenz, So zärtlich war Suleyken. Masurische Geschichten; Fischer Bücherei, 1960) Erläuterungen zum Text: Masuren, Landschaft im S. Ostpreußens, umfasst, ohne geographisch od. historisch abgrenzbar zu sein, einen Teil der End-, Grundmoränen- und Seenlandschaft zw. den Kernsdorfer Höhen (313 m) im SW u. den Seesker Höhen (310 m) im NO. Die Bevölkerung sprach eine poln., mit vielen dtn Lehnwörtern durchsetzte Mundart, ging im 19. und 20. Jh. immer mehr zur dtn Sprache über. – Das Gebiet war bis zum 13. JH. von den baltisch-pruß. Stämmen der Gallinder u. Sudauer schwach besiedelt. Die Sudauer wurden 1278-83 vom Deutschen Orden unterworfen u. nach dem Samland verpflanzt. Im 15./16. Jh. besiedelten der Deutsche Orden u. die preuß. Herzöge das Land v.a. mit masowischen Kolonisten. < Brockhaus, B.11, S.309 > Textarbeit 1. Führen Sie Synonyme zum Verb sehen an. Gruppieren Sie sie nach der Stilfärbung (neutral, gehoben, umgangssprachlich). 2. Welcher Mittel der Ironie bedient sich der Autor? 3. Welche Rolle spielt die Ironie in o.g. Geschichten? 4. Schreiben Sie eine Erlebnisgeschichte (einen Aufsatz) aus Ihrer Heimat/Ihrer Kindheits- oder Jugendzeit / aus Ihrem Elternhaus. 5. Erarbeiten Sie aus dem gegebenen Material einen LexikonArtikel über Siegfried Lenz. 58 Gabriele Wohmann KÄME DOCH SCHNEE Text 1 Der Nebel stockte hinter den Ästen, schneeflockenweiß, die schwarzen Akazienarme hielten ihn mit einer Gebärde, starrer Verzweiflung zurück. Sie bewegte die klammen Zehen, den Strumpf spürte sie, als wäre er naß, auch die Lederhöhle des Schuhs naß – es war zu kalt, um noch auf den Bänken zu sitzen. Breit streckte sich der morschende Mantel abgemähter Felder über die flachen Buckel von Loms – käme doch Schnee, Schnee wie Schlaf, dicker Schlafschnee. - So lang werd ich heut nicht bleiben können, sagte sie. - Warum, fragte er, zu kalt oder was? - Nicht deshalb. - Aber wie wird das überhaupt im Winter? fragte er. Sie spürte ihr gemeinsames Warten: hart, zäh. - Irgendwann mußt du mich doch mal in die Wohnung lassen, sagte er. Plötzlich war der Nebel von fetten schwarzen Flecken gelöchert: stumm fiel die Schar der Rabenkrähen aus dem niedrigen Qualm aufs Feld; sie hörte nur das Flappen der Flügel und meinte, einen sachten Wind zu fühlen, den Windatem der langen Herbstreise. Die großen Vögel hockten in den Stoppeln, steife schwarze Buchstaben irgendwelcher Wörter, fette finstre Zeichen irgendeines Sinns. - Na also, drängte er, wie soll das im Winter werden, im Freien wirds bald nicht mehr gemütlich sein. Er ließ sein Auto immer an der Weggabelung stehn und ging ihr bis zum Wäldchen entgegen, wo der Pfad vom Dorf herauf die Landstraße schnitt, aber von da liefen noch viele Meter weiter bis zu der vergessenen Bank an der Strecke nach Loms, hier kam nie einer hin, den man bei ihr oder bei ihm zu Haus kannte. Sie starrte auf die schwarze Vogelschrift im Feld: was um Himmels willen bedeutete das, sicher sollte jetzt eine Entscheidung kommen, und ehe der Schwarm weggeschoben und alles weggescheucht und weggewischt wäre, müßte sie wissen, was das bedeuten sollte. 59 - Na ja, sagte sie träg vor Angst: sie durfte es nicht verpassen, sie mußte auf der Hut sein, endlich endlich ein Zeichen; na ja, natürlich gehts so nicht weiter. Er müßte sie heiraten. Etwa nicht? Oder den Winter wegbleiben und für immer wegbleiben. - So gehts nicht weiter, sagte sie. Vielleicht müßte sie ihn ansehen und es ihm sagen, während sie sich zugekehrt waren: Es ist wegen Michel. Die Leute hackten auf mir rum: eine Witwe ohne Treu und Herz, das arme arme Kind, Rabenmutter – Rabenkrähen im Feld, irgendeine Schrift. - Michel gehts heut nicht so gut, sagte sie. Sie wollte nicht weg von der Bank, nicht weg von dem steinigen Narbenpfad nach Loms, nicht weg aus dem Nebel hinter den gichtigen, flehend hochgereckten Astarmen der Akazie, wollte keine Wärme unter die Haut, dort bei Michel in dem engen Zimmerviereck kein Mami Mami und Radiogezeter von unten und Licht aus gute Nacht liebes gutes Michelchen. Sie sah ihn an, sein eifriges mürrisches Gesicht war noch rot vom schnellen Laufen durch den Nebel – wen sollte sie denn fragen, um zu wissen, ob sie das wollte: diese Haut, Wärme und Trotz und Freundschaft, heiraten, Michel sag Vater, sieh das ist Vater. Man gewöhnt sich so dran, sagte er langsam in ihr Gesicht hinein, man weiß, es geht nicht so weiter, aber man gewöhnt sich dran. Um fünf Uhr auf der Bank von Loms, um fünf Uhr jeden Tag, das ist wie der Kern in der Kirsche. Sie sah von ihm weg wieder ins Feld: dort ging von den Ausläufern der schwarzen Horde Unruhe aus, ein paar Vögel schlugen plump in die Höhe, fielen zwischen die andern zurück, blieben ungeduldig, aufstörend. Sie holte Atem. Irgendwas wollte sie bestimmt. Vieles wollte sie nicht, das meiste wollte sie nicht, aber es mußte was geben, das sie wollte, einen winzigen verborgenen Wunsch. Sie strengte die Augen an, dehnte die Rippen; die Zehen krümmten sich in den Schuhen. Dieses alles wollte sie nicht verlieren. Was denn? Kalte Füße? Die Bank von Loms? Dann also nicht heiraten? - Wegen Michel, sagte sie lahm; was redete sie da, wollte sie etwa reden? 60 Sie hörte und sah und spürte, daß sein Arm sich zurückzog hinter ihren Schultern, und hörte und sah und spürte, daß er wiederkam und näherkam, dicht dicht – was sagte die flüchtig ins Feld getuschte Schrift; ehe der Abend oder der Nebel oder sonst ein Gegner sie auslöschte, müßte sie den Sinn herausgelesen haben. - Also werden wir heiraten, sagte er mit einer dicken Stimme. Wir werden heiraten. Sieh sieh, das ist Vater. Ein Gelächter zankte durch den Schwarm und hob ihn hoch; plump und fett und hohl jammernd flappten sie niedrig quer übers Feld. Der Nebel klumpte sich, und in die Flockenbündel bohrte der schwarze Keil der Vögel seine Spitze, in die weiche Wolle der Dämmerung – wie Schnee, wie Schlaf, hinter den Astarmen und Zweigfingern; später als die Vogelkörper schluckte der Qualm die keifenden Rufe. Gabriele Wohmann WER KOMMT IN MEIN HÄUSCHEN Text 2 Also gut, dann bleib heut morgen erst nochmal im Bett. Felix beobachtete seine Mutter, seine Spannung ließ nach, sie schnickte die Quecksilbersäule im Fieberthermometer auf diese vertraute Weise abwärts, und er nähme ja gern die ganze Mühe auf sich, das silbrige Zeug wieder bis in die Nähe der Zahl 38 hinaufzuerwärmen. Er fing an, sich wohler zu fühlen. Jetzt käme auch gleich sein Frühstück. Aber irgendwas stimmte nicht so recht. So, wie seine Mutter heute morgen nicht geräuschlos war, kündigte sich Unfriede an. Außerdem merkte er, daß sie ihm nicht wie sonst immer überreichlich zu essen hinstellte – sie stellte den Teller – und sie war dann am Telephon zu irgendeiner Person ausgesprochen muffig. Ach, wie soll’s schon gehen, sagte sie. Felix erfaßte ihr Problem, schon bevor sie ins Telephon schnauzte. Unmöglich, daß ich komme, leider. Ich muß einfach auch mal irgendwann allein sein, nicht mehr und nicht weniger, nur eben: allein. Er stand zum Mittagessen auf. 61 Wie geht’s dir, fragte seine Mutter. Weißt du, wenn es dir einigermaßen gut steht, sollten wir doch überlegen, ob du nicht am Nachmittag zum Training rübertrollst. So gut fühle ich mich nicht, sagte Felix. Ich frage mich nur immer wieder, ob wir nicht doch einen Fehler machen, sagte seine Mutter. Sie aßen Corned beef und Kopfsalat, und es war fast zwei Uhr geworden, bis sie sich dazu aufgerafft hatte, eine Art Mahlzeit herzustellen. Seine Nachspeisen suchte sowieso anschließend jeder sich selber im Süßigkeitenfach oder bei den Milchprodukten im Kühlschrank zusammen. Weißt du, Schätzchen, ich denke oft dran, wie dein Onkel Albrecht verwöhnt wurde, als er ein Kind war. Er war, wie du weißt, ein kleiner Nachkömmling, immer unter Erwachsenen. Hatte auch immer so ungewisse Beschwerden. Jetzt lachte sie komplizenhaft, die gute Mami. Aber Felix genoß es diesmal nicht. Vielleicht hatte er die glückliche Zeitspanne der Häuslichkeit überzogen, bedurfte eines Wechsels. Weshalb aber bereitete es ihm nicht wie sonst, wenn er sich entschloß, in die häßliche Welt der Gleichaltrigen aufzubrechen, dieses stolze Vergnügen, der Mami gegenüber? Lag es daran, daß er ihr Motiv seit heute kannte? Allein zu sein, das wünschte sie, wie wünschte ihn aus dem Haus, nicht um seinetwillen. Das Beste an dem Kummer, der eben gerade aufkam, war eine brutalisierende Ausrüstung im Gemüt. Er machte sich auf den Weg, schlapprig fühlte er sich wirklich, fieberfrei wie er doch war, aber vor den ganzen Jürgen-JochenMichaels fürchtete er sich in diesem Augenblick kaum. Glaub mir, es ist das Vernünftigste, rief sie ihm nach. Da ging sein tapferer guter Körper wegaufwärts und vor ihr weg. Sie fühlte sich gepreßt vom Drang, ihm nachzulaufen. Immer war es das Vernünftigste gewesen, vom Abschieben in den Kindergarten an, immer weg mit ihm, und eines Tages würde – und man mußte sogar denken: wenn er Glück hat, der Un-Glückliche, mein Felix – eine Ehefrau zu ihm “Es ist das Vernünftigste, wenn du gehst” sagen. Ins Büro, Amt, ins irgendwie sowieso feindliche Leben. Sie mußte sich jetzt beeilen, um halb fünf wartete Frau Dressler mit ihren Gelenken auf sie und ihre heilgymnastischen Anwendungen. Sie machte nur noch vier Hausbesuche pro Woche. Am liebsten hatte 62 sie die Hin- und Rückwege. Armbrusterstraße 49. Sie wußte aber schon an der Ecke Linderhofstraße, daß sie die Patientin Dressler sitzen ließe. Sie lief eilig weiter in Richtung Donau-Ufer. Blattläuse und andere winzige weiche Flugtiere schwirrten irrläuferhaft in der schwülen, freiheitlichen Flußluft. Ulm nur mit Einheimischen wäre furchtbar, dachte sie, denn die farbigen Ausländergrüppchen in den Uferwiesen imponierten ihr. Wie lang hatte sie das alles nicht gesehen. Wie eingesperrt man doch lebte. Vor einer kleinen Familienszene wäre sie am liebsten stehengeblieben: eine Frau in ihrem Alter frisierte ihr kleines Kind, ein Mädchen, vor dessen nackten Knien ein noch kleineres Kind hockte, ein Bübchen, dem die Schwester die Haare bürstete. Um diese Tageszeit waren hier die Ausländer fast unter sich. Wie schnell das hohe Wasser floß, sie müßte all diese Wunder dem Felixchen zeigen: Sie fühlte sich schon so weit aus ihrer Enge gerettet, daß sie es auf sich nehmen konnte, den nächsten Abweg zu benutzen und stadteinwärts zurückzukehren, und Frau Dressler wäre nachsichtig mit ihr. Schöner verschleierter graufarbener Fluß! Felix wagte es aber nicht, sich am Ufer niederzulassen. Das Gebiet war nicht sehr sicher. Die andern Kinder könnten jederzeit um irgendeine Ecke biegen. Er ging ziemlich rasch. In einer fremden Sprache rief ihm ein Mädchen etwas, das freundlich klang, zu. Plötzlich passierte dann das mit ihm, was im “Hand aufs Herz” den Helden “bis ins Mark erschrecken” ließe: er erkannte seine Mutter. Sie lief ihm entgegen. Jetzt käme heraus, daß er das Training schwänzte, was gar nicht so schlimm war. Er blieb stehen und dachte: wie festgemeißelt. Am schlimmsten war wohl, daß sie und er einander betrogen. Jetzt weiß ich nicht weiter, dachte er, und er merkte, daß es das gab, lautes Denken, denn er hörte seinen fünf Wörtern hinterher. Stand immer noch still. Da steht er ja, stramm steht er, mein armer kleiner Liebling! Es gibt Schutzengel, fand sie, denn ihrer, offenbar vom heilgymnastischen Fach, der zwang sie in die Knie, sie ließ sich anleiten. Diesen letzten Eindruck, bevor sie sich ganz auf Felix konzentrierte, hielt sie noch fest: eine der fremdländischen Frauen lächelte ihr zu, eins der Kinder klatschte in die Hände. Dann breitete sie die Arme aus, und rief, obwohl sie sich genierte – wirklich, so etwas lag ihr überhaupt nicht – sehr sehr laut: 63 Wer kommt in mein Häuschen!? Sähe uns jemand oben von der Stadtmauer aus zu, dann wären wir ein winziges Spielzeug, zweiteilig, ferngesteuert. Denn Felix fand es merkwürdig, daß er so rannte, aber es war das Glück, wie immer in Portionen dann und wann zu haben. Gabriele Wohmann (Pseud. Guyot) geb. 1932 in Darmstadt; deutsche Schriftstellerin; Tochter eines Pfarrers, arbeitete nach dem Studium der Germanistik und Musikwissenschaft in Frankfurt als Lehrerin; lebt als freie Schriftstellerin; Mitglied der “Gruppe 47” und des PEN. Textarbeit 1. Führen Sie Phraseologismen mit Herz an und erklären Sie deren Bedeutungen in eigenen Worten (Text 2). 2. Erklären Sie die Homonymie des Substantivs Mark (Text 2). 3. Bestimmen Sie mögliche Wortfelder entsprechende Verzeichnisse auf. und stellen Sie 4. Formulieren Sie in Stichworten Hauptgedanken beider Texte. 5. Versuchen Sie die Textanalyse bzw. Interpretation nach folgenden Aspekten: Aufbau / Verlauf der Handlung Personen/Schilderung der Gefühle sprachliche Darstellungsmittel Erzählweisen Erzählperspektiven. 64 Peter Bichsel DIE TOCHTER Text 1 Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in der Stadt, die Bahnverbindungen sind schlecht. Sie, er und seine Frau, saßen am Tisch und warteten auf Monika. Seit sie in der Stadt arbeitete, aßen sie erst um halb acht. Früher hatten sie eine Stunde eher gegessen. Jetzt warteten sie täglich eine Stunde am gedeckten Tisch, an ihren Plätzen, der Vater oben, die Mutter am Stuhl nahe der Küchentür, sie warteten vor dem leeren Platz Monikas. Einige Zeit später auch vor dem dampfenden Kaffee, vor der Butter, dem Brot, der Marmelade. Sie war größer gewachsen als sie, sie war auch blonder und hatte die Haut, die feine Haut der Tante Maria. “Sie war immer ein liebes Kind”, sagte die Mutter während sie warteten. In ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler, und sie brachte oft Platten mit aus der Stadt, und sie wußte, wer darauf sang. Sie hatte auch einen Spiegel und verschiedene Fläschchen und Döschen, einen Hocker aus marokkanischem Leder, eine Schachtel Zigaretten. Der Vater holte sich seine Lohntüte auch bei einem Bürofräulein. Er sah dann die vielen Stempel auf einem Gestell, bestaunte das sanfte Geräusch der Rechenmaschine, die blondierten Haare des Fräuleins, sie sagte freundlich “Bitte schön”, wenn er sich bedankte. Über Mittag blieb Monika in der Stadt, sie aß eine Kleinigkeit, wie sie sagte, in einem Tearoom. Sie war dann ein Fräulein, das in Tearooms lächelnd Zigaretten raucht. Oft fragten sie sie, was sie alles getan habe in der Stadt, im Büro. Sie wußte aber nichts zu sagen. Dann versuchten sie wenigstens, sich genau vorzustellen, wie sie beiläufig in der Bahn ihr rotes Etui mit dem Abonnement aufschlägt und vorweist, wie sie den Bahnsteig entlang geht, wie sie sich auf dem Weg ins Büro angeregt mit den Freundinnen unterhält, wie sie den Gruß eines Herrn lächelnd erwidert. Und dann stellten sie sich mehrmals vor in dieser Stunde, wie sie heimkommt, die Tasche und ein Modejournal unter dem Arm, ihr Parfum; stellten sich vor, wie sie sich an ihren Platz setzt, wie sie dann zusammen essen würden. 65 Bald wird sie sich in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wußten sie, und daß sie dann wieder um halb sieben essen würden, daß es dann kein Zimmer mehr mit Plattenspieler gäbe, keine Stunde des Wartens mehr. Auf dem Schrank stand eine Vase aus blauem schwedischem Glas, eine Vase aus der Stadt, ein Geschenkvorschlag aus dem Modejournal. “Sie ist wie deine Schwester”, sagte die Frau, “sie hat das alles von deiner Schwester. Erinnerst du dich, wie schön deine Schwester singen konnte.” “Andere Mädchen rauchen auch”, sagte die Mutter. “Ja”, sagte er, “Das habe ich auch gesagt.” “Ihre Freundin hat kürzlich geheiratet”, sagte die Mutter. Sie wird auch heiraten, dachte er, sie wird in der Stadt wohnen. Kürzlich hat er Monika gebeten: “Sag mal etwas auf französisch.” – “Ja”, hatte die Mutter wiederholt, “sag mal etwas auf französisch.” Sie wußte aber nichts zu sagen. Stenografieren kann sie auch, dachte er jetzt. “Für uns wäre das zu schwer”, sagten sie oft zueinander. Dann stellte die Mutter den Kaffee auf den Tisch. “Ich habe den Zug gehört”, sagte sie. Peter Bichsel wurde 1935 in Luzern (Schweiz) geboren. Ausbildung zum Primarlehrer am Seminar Solothurn. Winter 1963/64 nimmt er am ersten Literarischen Colloquium in Berlin teil. 1968 gab er den Lehrerberuf auf und arbeitet seither als freier Schriftsteller und Mitarbeiter verschiedener Zeitungen. Peter Bichsel schreibt meistens Kurzprosa, häufig Montagetechnik. Themen: Isolation und Kommunikatiosunfähigkeit des heutigen Menschen. Textarbeit 1. Illustrieren Sie den Gebrauch folgender Wörter: lieb, die Dose, die Tüte, das Gestell. 2. Geben Sie Synonyme zu den Verben bestaunen und erwidern an. Gruppieren Sie diese Synonymenreihen nach der Stilfärbung (z.B.: umgangssprachlich – neutral – gehoben). 3. Wäre ein anderer Titel als der vom Autor gewählte möglich? 66 4. Was wird in dieser Geschichte geschildert? – Fassen Sie den Inhalt zusammen. 5. Wählen Sie Stichworte, die Monikas Interessen, Geschmack, Lebensart, Tagesablauf anzeigen. 6. Warum sind die Beziehungen zu Vater und Mutter gestört? – Äußern Sie Ihre Meinung. Gebrauchen Sie die gewählten Wörter und Wortgruppen in Ihren Aussagen. Alles geben die Götter, die unendlichen, ihren Lieblingen ganz: alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. (Johann Wolfgang von Goethe) Peter Bichsel NOVEMBER Text 2 Er fürchtete sich und wenn er zu jemandem sagte: “Es ist kälter geworden”, erwartete er Trost. “Ja, November”, sagte der andere. “Bald ist Weihnachten”, sagte er. Er hatte Heizöl eingekauft, er besaß einen Wintermantel, er war versorgt für den Winter, aber er fürchtete sich. Im Winter ist man verloren. Im Winter ist alles Schreckliche möglich. Krieg zum Beispiel. Im Winter kann die Stelle gekündigt werden, im Winter erkältet man sich. Man kann sich schützen gegen die Kälte, Halstuch, Mantelkragen, Handschuhe. Aber es könnte noch kälter werden. Es nützt nichts, jetzt “Frühling” zu sagen. Die Schaufenster sind beleuchtet, sie täuschen Wärme vor. Aber die Kirchenglocken klirren. In den Wirtschaften ist es heiß, zu Hause öffnen die Kinder die Fenster und lassen die Wohnungstür offen, im Geschäft vergißt man seinen Hut. 67 Man bemerkt nicht, wie die Bäume Blätter fallen lassen. Plötzlich haben sie keine mehr. Im April haben sie wieder Blätter, im März vielleicht schon. Man wird sehen, wie sie Blätter bekommen. Bevor er das Haus verläßt, zählt er sein Geld nach. Schnee wird es keinen geben, Schnee gibt es nicht mehr. Frierende Frauen sind schön, Frauen sind schön. “Man muß sich an die Kälte gewöhnen”, sagte er, “man muß tiefer atmen und schneller gehen”. – “Was soll ich den Kindern zu Weihnachten kaufen?” fragte er sich. “Man wird sich an die Kälte gewöhnen”, sagte er zum anderen. “Ja, es ist kälter geworden, November”, sagte der andere. Textarbeit 1. Was haben Sie gedacht, gefühlt und “gesehen”, wenn Sie den Text gelesen haben? 2. Was für Assoziationen bewirkte bei Ihnen das Wetter die Umgebung der Mann? 3. Schreiben Sie spontan auf, was Ihnen zu “November” einfällt. Machen Sie Aussagen, die in einen Text mit dem Titel “November” passen könnten. 4. Was ist das für ein Mann? Wie stellen Sie sich ihn vor? Versuchen Sie ihn zu beschreiben. 5. Was finden Sie an dem Mann verständlich, was unverständlich und eigenartig? Begründen Sie Ihre Bewertungen und suchen Sie nach möglichen Erklärungen. 6. Stellen Sie sich den Mann als einen eigenartigen Außenseiter vor oder halten Sie seine Gedanken und Gefühle für typisch? Begründen Sie Ihre Meinung. 68 Das Schwierige an der Wahrheit ist, daß es viele gibt, weil jeder die seine hat. (Günter de Bruyn) Welch ein rätselhaftes, unbeschreibliches, geheimnisreiches, lockendes Ding ist die Zukunft, wenn wir noch nicht in ihr sind – wie schnell und unbegriffen rauscht sie als Gegenwart davon. (Adalbert Stifter) Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind; wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat. (Ebner-Eschenbach) 69 Wolfgang Borchert NACHTS SCHLAFEN DIE RATTEN DOCH Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den steilgereckten Schornscheinresten. Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, daß jemand gekommen war und nun vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich! dachte er. Aber als er ein bißchen blinzelte, sah er nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, daß er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Er hatte ein Messer und einen Korb in der Hand. Und etwas Erde an den Fingerspitzen. Du schläfst hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte: nein, ich schlafe nicht. Ich muß hier aufpassen. Der Mann nickte: so, dafür hast du wohl den großen Stock da? Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. Worauf paßt du denn auf? Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock. Wohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her. Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich. Auf ganz etwas anderes. Na, was denn? Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. Na, denn nicht. Dann ich sage dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig, Kaninchenfutter. Donnerwetter, ja! sagte der Mann verwundert, bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? Neun. Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wieviel drei mal neun sind, wie? 70 Klar, sagte Jürgen, und um Zeit zu gewinnen sagte er noch: Das ist ja ganz leicht. Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch. Dreimal neun, nicht? fragte er noch einmal, siebenundzwanzig. Das wußte ich gleich. Stimmt, sagte der Mann, und genau soviel Kaninchen habe ich. Jürgen machte einen runden Mund. Siebenundzwanzig? Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? Ich kann doch nicht. Ich muß aufpassen, sagte Jürgen unsicher. Immerzu? fragte der Mann, nachts auch? Nachts auch. Immerzu. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon, flüsterte er. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du mußt doch essen. Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. Du rauchst? fragte der Mann, hast du denn eine Pfeife? Jürgen faßte seinen Stock fest an und sagte zaghaft: Ich drehe. Pfeife mag ich nicht. Schade, der Mann bügte sich zu seinem Korb, die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg. Nein, sagte Jürgen traurig, nein, nein. Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf. Na ja, wenn du hier bleiben mußt – schade. Und drehte sich um. Wenn du mich nicht verrätst, sagte Jürgen da schnell, es ist wegen den Ratten. Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück: Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt das? Unser Lehrer. Und du paßt auf die Ratten auf? fragte der Mann. Auf die doch nicht! Und dann sagte er ganz leise: Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch 71 gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muß hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich: Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, daß die Ratten nachts schlafen? Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus, das hat er nicht gesagt. Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird, schon. Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er, alles kleine Betten. Da sagte der Mann (und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei): Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen, und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines oder, was meinst du? Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue. Ich weiß nicht, sagte er leise und sah auf die krummen Beine, wenn sie wirklich nachts schlafen. Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. Natürlich, sagte er von da, euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. Da stand Jürgen auf und fragte: Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen, aber du mußt hier solange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muß deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müßt ihr ja wissen. Ja, rief Jürgen, ich warte. Ich muß ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und er rief: Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter, rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend, und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurchschien, so krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter, das war etwas grau vom Schutt. 72 Wolfgang Borchert wurde 1921 in Hamburg geboren. Der junge Buchhändler kam 1941 als Soldat an die Ostfront. Die Erlebnisse des Krieges und der unmittelbaren Zeit nach dem 2. Weltkrieg bestimmten sein Leben und Werk. 1945 kehrte er chronisch krank in die zerstörte Heimatstadt zurück. Einen Tag vor der Erstaufführung seines Stückes “Draußen vor der Tür” starb Borchert 1947 in Basel. Textarbeit 1. Rekonstruieren Sie die Ausgangssituation für das Gespräch der beiden Figuren der Erzählung. 2. Formulieren Sie in wenigen Sätzen Ihr erstes Textverständnis. Benennen Sie das Problem in einem Satz. 3. Untersuchung der Personen: Wie mag sich der Junge fühlen? Worin sehen Sie die Ursache für sein Verhalten? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Mann und Kind? 4. Zur Gestaltung: Erzählstandort: Wer erzählt die Geschichte? Von wo aus wird das Geschehen gesehen? Blickrichtung: Worauf richtet sich der Blick besonders? Worauf verweilt er? Wörter zur Personifikationen, Metonymien aussuchen; Was bewirken sie beim Leser? Analysieren Sie die sinnverweisende Funktion der Gegenstände; Satzbau; seine Wirkung auf den Leser; auffällige Einzelheiten (z.B.: Wiederholungen, Bedeutung der Überschrift). 5. Fragen Sie sich: Wie hat der Autor was dargestellt und in welcher Wirkungsabsicht? Welche Wirkung hat gerade diese Gestaltung des Inhalts? Erkennen Sie Merkmale der Kurzgeschichte. 73 Ilse Aichinger DAS FENSTER – THEATER Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluß herauf und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick neugieriger Leute, die unersättlich sind. Es hatte ihr noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werden. Außerdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur mehr leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, daß der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb dieses Licht für sich und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende Straßenlaternen unter der Sonne machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen angesteckt, noch ehe die Prozession die Kirche verlassen hat. Die Frau blieb am Fenster. Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand leer und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte leicht den Kopf. Der Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, daß er keinen Hut aufhatte, und verschwand im Innern des Zimmers. Gleich darauf kam er in Hut und Mantel wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und begann zu winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing über die Brüstung, daß man Angst bekam, er würde vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals – einen großen bunten Schal – und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte sich. Sooft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, geflickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. 74 Und während er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie schon drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so daß sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, streifte dann mit einer vagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren abgesprungen, und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu verscheuchen suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür aufbrachen. Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen konnte. Auch in dem Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht die Sekunde. Zwei von ihnen zogen die Stiefel aus und schlichen um die Ecke. Es war inzwischen finster geworden. Sie stießen an einen Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des schmalen Ganges und gingen ihm nach. Die Frau schlich hinter ihnen her. Als die Tür aufflog, stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er jemandem, daß er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer schon knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. Die Werkstatt unterhalb ihr, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die Wohnung oberhalb mußte eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Fenster war ein Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor Jubel. Er lachte, strich mit 75 der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins Gesicht. Ilse Aichinger (geb. 1921), österreichische Schriftstellerin; während des Krieges dienstverpflichtet; nach 1945 Studium der Medizin; Lektorin und Mitarbeiterin an der Ulmer “Hochschule für Gestaltung”; 1953 Heirat des Schriftstellers Günther Eich; Mitglied der “Gruppe 47” und des PENClubs; lebt als freie Schriftstellerin in Bayrisch Gmain. – Erzählungen, Hörspiele, Skizzen. Textarbeit 1. Wie sind die Personen/Personengruppen charakterisiert (Frau, Mann, Kind, Menge, Polizisten)? 2. Wie ist ihr Verhalten zu bewerten? 3. Wie ist die Geschichte aufgebaut (Textbelege)? 4. Wie wirkt der Schluss? 5. Wo wird aus der Perspektive der Frau erzählt, wo scheint die Erzählerin selbst zu sprechen? 6. Was ist die Rolle des ‘Lichts’ in der Geschichte? 7. Wie wirkt der Titel beim ersten Lesen, wie nach Kenntnis der ganzen Geschichte? 8. Was könnte die Erzählabsicht der Verfasserin sein (Beziehung der Menschen zueinander, Auswahl der Figuren, sozialkritische Tendenz, Wertungen, evtl. Aussagen über die Kunst)? 9. Frage zur Diskussion: Ist es sinnvoll, dass Erwachsene spielen? 10. Wie ging es der Frau, dem Mann, dem Kind weiter vor? 11. Entwerfen Sie einen Zeitungsbericht zum Geschehnis im Text. 76 Ich würde nicht sagen, daß die Gesellschaft erbarmungslos ist. Sie ist nur gleichgültig. Und diese Gleichgültigkeit nimmt zu. (Ilse Aichinger) Echte Bildung hilft uns, unserem Leben einen Sinn zu geben, die Vergangenheit zu deuten, der Zukunft in furchtloser Bereitschaft offenzustehen. (Hermann Hesse) Wo das Wort seine Wirklichkeit und Würde hat, da ist Leben, da ist Licht vom Urlicht des ersten Schöpfungstages. (Manfred Hausmann) 77 Heinrich Böll UNBERECHENBARE GÄSTE Text 1 Ich habe nichts gegen Tiere, im Gegenteil: ich mag sie, und ich liebe es, abends das Fell unseres Hundes zu kraulen, während die Katze auf meinem Schoß sitzt. Es macht mir Spaß, den Kindern zuzusehen, die in der Wohnzimmerecke die Schildkröte füttern. Sogar das kleine Nilpferd, das wir in unserer Badewanne halten, ist mir ans Herz gewachsen, und die Kaninchen, die in unserer Wohnung frei herumlaufen, regen mich schon lange nicht mehr auf. Außerdem bin ich gewohnt, abends unerwarteten Besuch vorzufinden: ein piepsendes Küken oder einen herrenlosen Hund, dem meine Frau Unterkunft gewährt hat. Denn meine Frau ist eine gute Frau, sie weist niemanden von der Tür, weder Mensch noch Tier, und schon lange ist dem Abendgebet unserer Kinder die Floskel angehängt: Herr, schicke uns Bettler und Tiere. Schlimmer ist schon, daß meine Frau auch Vertretern und Hausierern gegenüber keinen Widerstand kennt, und so häufen sich bei uns Dinge, die ich für überflüssig halte: Seife, Rasierklingen, Bürsten und Stopfwolle, und in den Schubladen liegen Dokumente herum, die mich beunruhigen: Versicherungs- und Kaufverträge verschiedener Art. Meine Söhne sind in einer Ausbildungs-, meine Töchter in einer Aussteuerversicherung, doch können wir sie bis zur Hochzeit oder bis zur Ablegung des zweiten Staatsexamens weder mit Stopfwolle noch mit Seife füttern, und selbst Rasierklingen sind nur in Ausnahmefällen dem menschlichen Organismus zuträglich. So wird man begreifen, daß ich hin und wieder Anfälle leichter Ungeduld zeige, obwohl ich im allgemeinen als ruhiger Mensch bekannt bin. Oft ertappe ich mich dabei, daß ich neidisch die Kaninchen betrachte, die es sich unter dem Tisch gemütlich machen und seelenruhig an Mohrrüben herumknabbern, und der stupide Blick des Nilpferds, das in unserer Badewanne die Schlammbildung beschleunigt, veranlaßt mich, ihm manchmal die Zunge herauszustrecken. Auch die Schildkröte, die stoisch an Salatblättern herumfrißt, ahnt nicht im geringsten, welche Sorgen mein Herz bewegen: die Sehnsucht nach einem frisch duftenden Kaffee, nach Tabak, Brot und Eiern und der wohligen Wärme, die der Schnaps in 78 den Kehlen sorgenbeladener Menschen hervorruft. Mein einziger Trost ist dann Bello, unser Hund, der vor Hunger gähnt wie ich. Kommen dann noch unerwartete Gäste: Zeitgenossen, die unrasiert sind wie ich, oder Mütter mit Babies, die mit heißer Milch getränkt, mit aufgeweichtem Zwieback gespeist werden, so muß ich an mich halten, um meine Ruhe zu bewahren. Aber ich bewahre sie, weil sie fast mein einziger Besitz geblieben ist. Es kommen Tage, wo der bloße Anblick frischgekochter, gelber Kartoffeln mir das Wasser in den Mund treibt; denn schon lange – dies gebe ich nur zögernd und mit heftigem Erröten zu –, schon lange verdient unsere Küche die Bezeichnung bürgerlich nicht mehr. Von Tieren und von menschlichen Gästen umgeben, nehmen wir nur hin und wieder, stehend, eine improvisierte Mahlzeit ein. Zum Glück ist meine Frau nun für längere Zeit der Ankauf von unnützen Dingen unmöglich gemacht, denn wir besitzen kein Bargeld mehr, meine Gehälter sind auf unbestimmte Zeit gepfändet, und ich selbst bin gezwungen, in einer Verkleidung, die mich unkenntlich macht, in fernen Vororten Rasierklingen, Seife und Knöpfe in den Abendstunden weit unter dem Preis zu verkaufen; denn unsere Lage ist bedenklich geworden. Immerhin besitzen wir einige Zentner Seife, Tausende von Rasierklingen, Knöpfe jeglichen Sortiments, und ich taumele gegen Mitternacht heim, suche Geld aus meinen Taschen zusammen: meine Kinder, meine Tiere, meine Frau umstehen mich mit glänzenden Augen, denn ich habe meistens unterwegs eingekauft: Brot, Äpfel, Fett, Kaffee und Kartoffeln, eine Speise übrigens, nach der Kinder wie Tiere heftig verlangen, und zu nächtlicher Stunde vereinigen wir uns in einem fröhlichen Mahl: zufriedene Tiere, zufriedene Kinder umgeben mich, meine Frau lächelt mir zu, und wir lassen die Tür unseres Wohnzimmers dann offenstehen, damit das Nilpferd sich nicht ausgeschlossen fühlt, und sein fröhliches Grunzen tönt aus dem Badezimmer zu uns herüber. Meistens gesteht mir dann meine Frau, daß sie in der Vorratskammer noch einen zusätzlichen Gast versteckt hält, den man mir erst zeigt, wenn meine Nerven durch eine Mahlzeit gestärkt sind: schüchterne, unrasierte Männer nehmen dann händereibend am Tisch Platz, Frauen drücken sich zwischen unsere Kinder auf die Sitzbank, Milch wird für schreiende Babies erhitzt. Auf diese Weise lerne ich dann auch Tiere kennen, die mir 79 ungeläufig waren: Möwen, Füchse und Schweine, nur einmal war es ein kleines Dromedar. „Ist es nicht süß?“ fragte meine Frau, und ich sagte notgedrungen, ja, es sei süß und beobachtete beunruhigt das unermüdliche Mampfen dieses pantoffelfarbenen Tieres, das uns aus schiefergrauen Augen anblickte. Zum Glück blieb das Dromedar nur eine Woche, und meine Geschäfte gingen gut: die Qualität meiner Ware, meine herabgesetzten Preise hatten sich rundgesprochen, und ich konnte hin und wieder sogar Schnürsenkel verkaufen und Bürsten, Artikel, die sonst nicht sehr gefragt sind. So erlebten wir eine gewisse Scheinblüte, und meine Frau – in völliger Verkennung der ökonomischen Fakten – brachte einen Spruch auf, der mich beunruhigte: „Wir sind auf dem aufsteigenden Ast.“ Ich jedoch sah unsere Seifenvorräte schwinden, die Rasierklingen abnehmen, und nicht einmal der Vorrat an Bürsten und Stopfwolle war mehr erheblich. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo eine seelische Stärkung mir wohlgetan hätte, machte sich eines Abends, während wir friedlich beisammensaßen, eine Erschütterung unseres Hauses bemerkbar, die der eines mittleren Erdbebens glich: die Bilder wackelten, der Tisch bebte und ein Kranz gebratener Blutwurst rollte von meinem Teller. Ich wollte aufspringen, mich nach der Ursache umsehen, als ich unterdrücktes Lachen auf den Mienen meiner Kinder bemerkte. „Was geht hier vor sich?“ schrie ich, und zum erstenmal in meinem abwechslungsreichen Leben war ich wirklich außer Fassung. „Walter“, sagte meine Frau leise und legte die Gabel hin, „es ist ja nur Wollo.“ Sie begann zu weinen, und gegen ihre Tränen bin ich machtlos; denn sie hat mir sieben Kinder geschenkt. „Wer ist Wollo?“ fragte ich müde, und in diesem Augenblick wurde das Haus wieder durch ein Beben erschüttert. „Wollo“, sagte meine jüngste Tochter, „ist der Elefant, den wir jetzt im Keller haben.“ Ich muß gestehen, daß ich verwirrt war, und man wird meine Verwirrung verstehen. Das größte Tier, das wir beherbergt hatten, war das Dromedar gewesen, und ich fand einen Elefanten zu groß für unsere Wohnung, denn wir sind der Segnungen des sozialen Wohnungsbaues noch nicht teilhaftig geworden. 80 Meine Frau und meine Kinder, nicht im geringsten so verwirrt wie ich, gaben Auskunft: von einem bankerotten Zirkusunternehmen war das Tier bei uns sichergesellt worden. Die Rutsche hinunter, auf der wir sonst unsere Kohlen befördern, war es mühelos in den Keller gelangt. „Es rollte sich zusammen wie eine Kugel“, sagte mein ältester Sohn, „wirklich ein intelligentes Tier.“ Ich zweifelte nicht daran, fand mich mit Wollos Anwesenheit ab und wurde im Triumph in den Keller geleitet. Das Tier war nicht übermäßig groß, wackelte mit den Ohren und schien sich bei uns wohlzufühlen, zumal ein Ballen Heu zu seiner Verfügung stand. „Ist er nicht süß?“ fragte meine Frau, aber ich weigerte mich das zu bejahen. Süß schien mir nicht die passende Vokabel zu sein. Überhaupt war die Familie offenbar enttäuscht über den geringen Grad meiner Begeisterung, und meine Frau sagte, als wir den Keller verließen: „Du bist gemein, willst du denn, daß er unter den Hammer kommt?“ „Was heißt hier Hammer“, sagte ich, „und was heißt gemein, es ist übrigens strafbar, Teile einer Konkursmasse zu verbergen.“ „Das ist mir gleich“, sagte meine Frau, „dem Tier darf nichts geschehen.“ Mitten in der Nacht weckte uns der Zirkusbesitzer, ein schüchterner, dunkelhaarger Mann, und fragte, ob wir nicht noch Platz für ein Tier hätten. „Es ist meine ganze Habe, mein letzter Besitz. Nur für eine Nacht. Wie geht es übrigens dem Elefanten?“ „Gut“, sagte meine Frau, „nur seine Verdauung macht mir Kummer.“ „Das gibt sich“, sagte der Zirkusbesitzer. „Es ist nur die Umstellung. Die Tiere sind so sensibel. Wie ist es – nehmen Sie die Katze noch – für eine Nacht?“ Er sah mich an, und meine Frau stieß mich in die Seite und sagte: „Sei doch nicht so hart.“ „Hart“, sagte ich, „nein, hart will ich nicht sein. Meinetwegen leg´ die Katze in die Küche.“ „Ich hab´ sie draußen im Wagen“, sagte der Mann. Ich überließ die Unterbringung der Katze meiner Frau und kroch ins Bett zurück. Meine Frau sah ein wenig blaß aus, als sie ins Bett kam, ich hatte den Eindruck, sie zitterte ein wenig. „Ist dir kalt?“ fragte ich. „Ja“, sagte sie, „mich fröstelt´s so komisch.“ „Das ist nur Müdigkeit.“ 81 „Vielleicht ja“, sagte meine Frau, aber sie sah mich dabei so merkwürdig an. Wir schliefen ruhig, nur sah ich im Traum immer den merkwürdigen Blick meiner Frau auf mich gerichtet und unter einem seltsamen Zwang erwachte ich früher als gewöhnlich. Ich beschloß, mich einmal zu rasieren. Unter unserem Küchentisch lag ein mittelgroßer Löwe; er schlief ganz ruhig, nur sein Schwanz bewegte sich ein wenig und es verursachte ein Geräusch, wie wenn jemand mit einem sehr leichten Ball spielt. Ich seifte mich vorsichtig ein und versuchte, kein Geräusch zu machen, aber als ich mein Gesicht nach rechts drehte, um meine linke Wange zu rasieren, sah ich, daß der Löwe die Augen offenhielt und mir zublickte. „Sie sehen tatsächlich wie Katzen aus“, dachte ich. Was der Löwe dachte, ist mir unbekannt: er beobachtete mich weiter, und ich rasierte mich, ohne mich zu schneiden, muß aber hinzufügen, daß es ein merkwürdiges Gefühl ist, sich in Gegenwart eines Löwen zu rasieren. Meine Erfahrungen im Umgang mit Raubtieren waren minimal, und ich beschränkte mich darauf, den Löwen scharf anzublicken, trocknete mich ab und ging ins Schlafzimmer zurück. Meine Frau war schon wach, sie wollte gerade etwas sagen, aber ich schnitt ihr das Wort ab und rief: „Wozu da noch sprechen!“ Meine Frau fing an zu weinen, und ich legte meine Hand auf ihren Kopf und sagte: „Es ist immerhin ungewöhnlich, das wirst du zugeben.“ „Was ist ungewöhnlich?“ sagte meine Frau, und darauf wußte ich keine Antwort. Inzwischen waren die Kaninchen erwacht, die Kinder lärmten im Badezimmer, das Nilpferd – es hieß Gottlieb – trompetete schon, Bello räkelte sich, nur die Schildkröte schlief noch – sie schläft übrigens fast immer. Ich ließ die Kaninchen in die Küche, wo ihre Futterkiste unter dem Schrank steht: die Kaninchen beschnupperten den Löwen, der Löwe die Kaninchen, und meine Kinder – unbefangen und den Umgang mit Tieren gewöhnt, wie sie sind – waren längst auch in die Küche gekommen. Mir schien fast, als lächle der Löwe; mein drittjüngster Sohn hatte sofort einen Namen für ihn: Bombilus. Dabei blieb es. Einige Tage später wurden Elefant und Löwe abgeholt. Ich muß gestehen, daß ich den Elefanten ohne Bedauern schwinden sah, 82 ich fand ihn albern, während der ruhige, freundliche Ernst des Löwen mein Herz gewonnen hatte, so daß Bombilus´ Weggang mich schmerzte. Ich hatte mich so an ihn gewöhnt; er war eigentlich das erste Tier, das meine volle Sympathie genoß. Erläuterungen zum Text: es ist mir ans Herz gewachsen (idiomatisch): es ist mir lieb geworden die Floskel: Formel, leere Redensart zuträglich: nützlich, bekömmlich jemanden ertappen: jemanden bei etwas (Unerlaubtem oder Falschem) überraschen an sich halten (idiomatisch): sich beherrschen gepfändet (durch Gerichtsbeschluß): beschlagnahmt mampfen: kauen pantoffelfarben: gefärbt wie Hausschuhe (die oft Kamelhaarfarbe haben) die Scheinblüte: nur scheinbare Blüte (vgl. scheintot, scheinheilig) auf dem aufsteigenden Ast sein (idiomatisch): es wird immer besser, es geht aufwärts sozialer Wohnungsbau: Bau von Wohnungen mit staatlicher Beihilfe für bedürftige Familien einer Sache (Gen.) teilhaftig werden: an einer Sache beteiligt sein (hier etwas feierlicher Ausdruck) unter den Hammer kommen (idiomatisch): versteigert werden, zur Auktion kommen Heinrich Böll (1917–1985), Sohn eines Bildhauers und Schreinermeisters, stammt aus einem katholisch geprägten Elternhaus; er arbeitete nach dem Abitur im Buchhandel. 1938/39 begann er nach dem Arbeitsdienst ein Studium, wurde aber im Sommer 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Böll war sechs Jahre lang Soldat. Nach dem Krieg studierte er in Köln Germanistik. Von 1947 an erschienen seine Kurzgeschichten in mehreren Zeitungen, auch schrieb er einige Hörspiele. Seit 1951 freier Schriftsteller. 1972 Nobelpreis für Literatur. Er war Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie des PEN83 Zentrums der BRD. 1987 wurde von seiner Familie eine nach ihm benannte Stiftung gegründet. Werke: Der Zug war pünktlich (Erzählungen), Wanderer, kommst du nach Spa...(Erzählungen); Romane: Und sagte kein einziges Wort, Haus ohne Hüter, Ansichten eines Clowns u.a. Textarbeit 1. Fragen zum Text: 1. Wer sind die unberechenbaren Gäste des geschilderten Haushalts? 2. Welche Folgen hat das Verhalten der Hausfrau für die Familie? 3. Wie versucht der Hausherr, die Lage zu verbessern? 4. Wie kam Wollo ins Haus? 5. Welchen weiteren Gast brachte der Zirkusbesitzer? 6. Halten Sie das Benehmen der Hausfrau für eine Schwäche oder für eine Tugend? Suchen Sie Argumente für beides! 2. Drücken Sie den Inhalt folgender Sätze mit Worten aus dem Text aus! 1. Ich liebe meinen Hund. 2. Ich musste mich beherrschen, um meine Ruhe zu bewahren. 3. Die Qualität unserer Waren ist bekannt geworden. 4. Dieser Artikel findet bei den Kunden kein Interesse mehr. 5. Was ist hier los? 6. Den Gästen gefiel es bei uns. 7. Frierst du? 8. Der Abschied von dem Freund tat mir leid. 3. Aufgaben zur Erweiterung des Wortschatzes und des Ausdrucks. 1. Welche Tierarten kennen Sie? Nennen Sie einige Vertreter dieser Tierarten! 2. Nennen Sie Tierstimmen und die entsprechenden Verben! 3. Nennen Sie Ausdrücke, die zwischenmenschliche Beziehungen beschreiben! 4. Formen Sie die folgenden Sātze in andere Satzkonstruktionen um. Lieben Sie Tiere nicht? 84 Viele ältere Leute lieben lange Haare bei jungen Männern nicht. Lieben Sie Blasmusik nicht? Weil meine Kinder unbefangen sind, spielten sie mit dem Löwen. Unbefangen ... Weil die alte Frau unvorsichtig war, ging sie über die Straße, ohne sich umzusehen. Unvorsichtig ... Weil der Kaufmann verschuldet war, gab er sein Geschäft auf. Verschuldet ... Weil ich ehrlich bin, sage ich immer offen meine Meinung. Ehrlich ... Weil wir arm sind, können wir uns diese Reise nicht leisten. Arm ... Heinrich Böll DIE BOTSCHAFT Text 2 Kennen Sie jene Drecknester, wo man sich vergebens fragt, warum die Eisenbahn dort die Station errichtet hat; wo die Unendlichkeit über ein paar schmutzigen Häusern und einer halbverfallenen Fabrik erstarrt scheint; ringsum Felder, die zur ewigen Unfruchtbarkeit verdammt sind; wo man mit einem Male spürt, daß sie trostlos sind, weil kein Baum und nicht einmal ein Kirchturm zu sehen ist? Der Mann mit der roten Mütze, der den Zug endlich, endlich wieder abfahren läßt, verschwindet unter einem großen Schild mit hochtönendem Namen, und man glaubt, daß er nur bezahlt wird, um zwölf Stunden am Tage mit Langeweile zugedeckt zu schlafen. Ein grauverhangener Horizont über öden Äckern, die niemand bestellt. Trotzdem war ich nicht der einzige, der ausstieg; eine alte Frau mit einem großen braunen Paket entstieg dem Abteil neben mit, aber als ich den kleinen schmuddeligen Bahnhof verlassen hatte, war sie wie von der Erde verschluckt, und ich war einen Augenblick ratlos, denn ich wußte nun nicht, wen ich nach dem Wege fragen sollte. Die 85 wenigen Backsteinhäuser mit ihren toten Fenstern und gelblichgrünen Gardinen sahen aus, als könnten sie unmöglich bewohnt sein, und quer zu dieser Andeutung einer Straße verlief eine schwarze Mauer, die zusammenzubrechen schien. Ich ging auf die finstere Mauer zu, denn ich fürchtete mich, an eins dieser Totenhäuser zu klopfen. Dann bog ich um die Ecke und las gleich neben dem schmierigen und kaum lesbaren Schild “Wirtschaft” deutlich und klar mit weißen Buchstaben auf blauem Grund “Hauptstraße”. Wieder ein paar Häuser, die eine schiefe Front bildeten, zerbröckelnder Verputz, und gegenüber, lang und fensterlos, die düstere Fabrikmauer wie eine Barriere ins Reich der Trostlosigkeit. Einfach meinem Gefühl nach ging ich links herum, aber da war der Ort plötzlich zu Ende; etwa zehn Meter weit lief noch die Mauer, dann begann ein flaches, grauschwarzes Feld mit einem kaum sichtbaren grünen Schimmer, das irgendwo mit dem grauen himmelhohen Horizont zusammenlief, und ich hatte das schreckliche Gefühl, am Ende der Welt wie vor einem unendlichen Abgrund zu stehen, als sei ich verdammt, hineingezogen zu werden in diese unheimlich lockende, schweigende Brandung der völligen Hoffnungslosigkeit. [...] Die grünlichen Läden, deren Anstrich längst verwaschen war, waren fest geschlossen, wie zugeklebt; das niedrige Dach, dessen Traufe ich mit der Hand erreichen konnte, war mit rostigen Blechplatten geflickt. Es war unsagbar still, jene Stunden, wo die Dämmerung noch eine Atempause macht, ehe sie grau und unaufhaltsam über den Rand der Ferne quillt. Ich stockte einen Augenblick lang vor der Haustür, und ich wünschte mir, ich wäre gestorben, damals … anstatt nun hier zu stehen, um in dieses Haus zu treten. Als ich dann die Hand heben wollte, um zu klopfen, hörte ich drinnen ein girrendes Frauenlachen; dieses rätselhafte Lachen, das ungreifbar ist und je nach unserer Stimmung uns erleichtert oder uns das Herz zuschnürt. Jedenfalls konnte so nur eine Frau lachen, die nicht allein war, und wieder stockte ich, und das brennende, zerreißende Verlangen quoll in mir auf, mich hineinstürzen zu lassen in die graue Unendlichkeit des sinkenden Dämmers, die nun über dem weiten Feld hing und mich lockte, lockte… und mit meiner allerletzten Kraft pochte ich heftig gegen die Tür. Erst war Schweigen, dann Flüstern – und Schritte, leise Schritte von Pantoffeln, und dann öffnete sich die Tür, und ich sah eine 86 blonde, rosige Frau, die auf mich wirkte wie eins jener unbeschreiblichen Lichter, die die düsteren Bilder Rembrandts erhellen bis in den letzten Winkel. Golden-rötlich brannte sie wie ein Licht vor mir auf in dieser Ewigkeit von Grau und Schwarz. Sie wich mit einem leisen Schrei zurück und hielt mit zitternden Händen die Tür, aber als ich meine Soldatenmütze abgenommen und mit heiserer Stimme gesagt hatte: „‘n Abend“, löste sich der Krampf des Schreckens aus diesem merkwürdig formlosen Gesicht, und sie lächelte beklommen und sagte „Ja“. Im Hintergrund tauchte eine muskulöse, im Dämmer des kleinen Flures verschwimmende Männergestalt auf. „Ich möchte zu Frau Brink“, sagte ich leise. „Ja“, sagte wieder diese tonlose Stimme, die Frau stieß nervös eine Tür auf. Die Männergestalt verschwand im Dunkeln. Ich betrat eine enge Stube, die mit ärmlichen Möbeln vollgepfropft war und worin der Geruch von schlechtem Essen und sehr guten Zigaretten sich festgesetzt hatte. Ihre weiße Hand huschte zum Schalter, und als nun das Licht auf sie fiel, wirkte sie bleich und zerflossen, fast leichenhaft, nur das helle rötliche Haar war lebendig und warm. Mit immer noch zitternden Händen hielt sie das dunkelrote Kleid über den schweren Brüsten krampfhaft zusammen, obwohl es fest zugeknöpft war – als fürchte sie, ich könne sie erdolchen. Der Blick ihrer wäßrigen blauen Augen war ängstlich und schreckhaft, als stehe sie, eines furchtbaren Unheils gewiß, vor Gericht. Selbst die billigen Drucke an den Wänden, diese süßlichen Bilder, waren wie ausgehängte Anklagen. „Erschrecken Sie nicht“, sagte ich gepreßt, und ich wußte im gleichen Augenblick, daß das der schlechte Anfang war, den ich hatte wählen können, aber bevor ich fortfahren konnte, sagte sie seltsam ruhig: „Ich weiß alles, er ist tot … tot.“ Ich konnte nur nicken. Dann griff ich in meine Tasche, um ihr die letzten Habseligkeiten zu überreichen, aber im Flur rief die brutale Stimme „Gitta!“ Sie blickte mich verzweifelt an, dann riß sie die Tür auf und rief kreischend: „Warte fünf Minuten – verdammt-“, und krachend schlug die Tür wieder zu, und ich glaubte mir vorstellen zu können, wie sich der Mann feige hinter dem Ofen verkroch. Ihre Augen sahen trotzig, fast triumphierend zu mir auf. Ich legte langsam den Trauring, die Uhr und das Soldbuch mit den verschlissenen Fotos auf die grüne samtene Tischdecke. Da 87 schluchzte sie plötzlich wild und schrecklich wie ein Tier. Die Linien ihres Gesichtes waren völlig verwischt, schneckenhaft weich und formlos, und helle, kleine Tränen purzelten zwischen ihren kurzen, fleischigen Fingern hervor. Sie rutschte auf das Sofa und stützte sich mit der Rechten auf den Tisch, während ihre Linke mit den ärmlichen Dingen spielte. Die Erinnerung schien sie wie mit tausend Schwertern zu durchschneiden. Da wußte ich, daß der Krieg niemals zu Ende sein würde, niemals, solange noch irgendwo eine Wunde blutete, die er geschlagen hat. Ich warf alles, Ekel, Furcht und Trostlosigkeit, von mir ab wie eine lächerliche Bürde und legte meine Hand auf die zuckende, üppige Schulter, und als sie nun das erstaunte Gesicht zu mir wandte, sah ich zum ersten Male in ihren Zügen Ähnlichkeit mit jenem Foto eines hübschen, liebevollen Mädchens, das ich wohl viele hiundert Male hatte ansehen müssen, damals …[…] Aber plötzlich war mir, als drohe das Haus über mir zusammenzubrechen, ich stand auf. Sie öffnete mir, ohne ein Wort zu sagen, die Tür und wollte sie mir aufhalten, aber ich wartete beharrlich, bis sie vor mir hinausgegangen war; und als sie mir ihre kleine, etwas feiste Hand gab, sagte sie mit einem trockenen Schluchzen: „Ich wußte es, ich wußte es, als ich ihn damals – es ist fast drei Jahre her – zum Bahnhof brachte“, und dann setzte sie ganz leise hinzu: „Verachten Sie mich nicht.“ Ich erschrak vor diesen Worten bis ins Herz – mein Gott, sah ich denn wie ein Richter aus? Und ehe sie es verhindern konnte, hatt ich diese kleine, weiche Hand geküßt, und es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich einer Frau die Hand küßte. Draußen war es dunkel geworden, und wie in Angst gebannt wartete ich noch einen Augenblick vor der verschlossenen Tür. Da hörte ich sie drinnen schluchzen, laut und wild, sie war an die Haustür gelehnt, nur durch die Decke des Holzes von mir getrennt, und in diesem Augenblick wünschte ich wirklich, daß das Haus über ihr zusammenbrechen und sie begraben möchte. Dann tastete ich mich langsam und unheimlich vorsichtig, denn ich fürchtete jeden Augenblick in einem Abgrund zu versinken, bis zum Bahnhof zurück. Kleine Lichter brannten in den Totenhäusern, und das ganze Nest schien weit, weit vergrößert. Selbst hinter der schwarzen Mauer sah ich kleinen Lampen, die unendlich große Höfe 88 zu beleuchten schienen. Dicht und schwer war der Dämmer geworden, nebelhaft dunstig und durchdringlich. In der zugigen winzigen Wartehalle stand außer mir noch ein älteres Paar, fröstelnd in eine Ecke gedrückt. Ich wartete lange, die Hände in den Taschen und die Mütze über die Ohren gezogen, denn es zog kalt von den Schienen her, und immer, immer tiefer sank die Nacht wie ein ungeheures Gewicht. […] Aber dann wurde die Tür je aufgerissen, und der Mann mit der roten Mütze, diensteifrigen Gesichts, schrie, als ob er es in die Wartehalle eines großen Bahnhofs rufen müsse: „Personenzug nach Köln fünfundneunzig Minuten Verspätung!“ Da war mir, als sei ich für mein ganzes Leben in Gefangenschaft geraten. Textarbeit Analysieren Sie den Text nach folgenden Aspekten: Komposition/Architektonik, Erzählsituation, sprachliche Mittel zur Darstellung der Personen, deren Verhaltens und der Umgebung. Wenn man sich zu lange in engen, kleinen Verhältnissen herumdrückt, so leidet der Geist und Charakter; man wird zuletzt großer Dinge unfähig und hat Mühe sich zu erheben. (Johann Peter Eckermann) 89 Johannes Bobrowski BRIEF AUS AMERIKA Brenn mich, brenn mich, brenn mich, singt die alte Frau und dreht sich dabei, hübsch langsam und bedächtig, und jetzt schleudert sie die Holzpantinen von den Füßen, da fliegen sie im Bogen bis an den Zaun, und sie dreht sich nun noch schneller unter dem Apfelbäumchen. Brenn mich, liebe Sonne, singt sie dazu. Sie hat die Ärmel ihrer Bluse hinaufgeschoben und schwenkt die bloßen Arme, und von den Ästen des Bäumchens fallen kleine, dünne Schatten herab, es ist heller Mittag, und die alte Frau dreht sich mit kleinen Schritten. Brenn mich, brenn mich, brenn mich. Im Haus auf dem Tisch liegt ein Brief. Aus Amerika. Da steht zu lesen: Meine liebe Mutter. Teile Dir mit, daß wir nicht zu Dir reisen werden. Es sind nur ein paar Tage, sag ich zu meiner Frau, dann sind wir dort, und es sind ein paar Tage, sage ich, Alice, dann sind wir wieder zurück. Und es heißt: ehre Vater und Mutter, und wenn der Vater auch gestorben ist, das Grab ist da, und die Mutter ist alt, sage ich, und wenn wir jetzt nicht fahren, fahren wir niemals. Und meine Frau sagt: hör mir zu, John, sie sagt John zu mir, dort ist es schön, das hast du mir erzählt, aber das war früher. Der Mensch ist jung oder alt, sagt sie, und der junge Mensch weiß nicht, wie es sein wird, wenn er alt ist, und der alte Mensch weiß nicht, wie es in der Jugend war. Du bist hier etwas geworden, und du bist nicht mehr dort. Das sagt meine Frau. Sie hat recht. Du weißt, ihr Vater hat uns das Geschäft überschrieben, es geht gut. Du kannst deine Mutter herkommen lassen, sagt sie. Aber Du hast ja geschrieben, Mutter, daß Du nicht kommen kannst, weil einer schon dort bleiben muß, weil alle von uns weg sind. Der Brief ist noch länger. Er kommt aus Amerika. Und wo er zu Ende ist, steht: Dein Sohn Jons. Es ist heller Mittag, und es ist schön. Das Haus ist weiß. An der Seite steht ein Stall. Auch der Stall ist weiß. Und hier ist der Garten. Ein Stückchen den Berg hinunter steht schon das nächste Gehöft, und dann kommt das Dorf, am Fluß entlang, und die Chaussee biegt heran und geht vorbei und noch einmal auf den Fluß zu und wieder zurück und in den Wald. Es ist schön. Und es ist heller Mittag. Unter dem 90 Apfelbäumchen dreht sich die alte Frau. Sie schwenkt die bloßen Arme. Liebe Sonne, brenn mich, brenn mich. In der Stube ist es kühl. Von der Decke baumelt ein Beifußbusch und summt von Fliegen. Die alte Frau nimmt den Brief vom Tisch, faltet ihn zusammen und trägt ihn in die Küche auf den Herd. Sie geht wieder zurück in die Stube. Zwischen den beiden Fenstern hängt der Spiegel, da steckt in der unteren Ecke links, zwischen Rahmen und Glas, ein Bild. Eine Photographie aus Amerika. Die alte Frau nimmt das Bild heraus, sie setzt sich an den Tisch und schreibt auf die Rückseite: Das ist mein Sohn Jons. Und das ist meine Tochter Alice. Und darunter schreibt sie: Erdmuthe Gauptate geborene Attalle. Sie zupft sich die Blusenärmel herunter und streicht sie glatt. Ein schöner weißer Stoff mit kleinen blauen Punkten. Aus Amerika. Sie steht auf, und während sie zum Herd geht, schwenkt sie das Bild ein bißchen durch die Luft. Als der Annus von Tauroggen gekommen ist, damals, und hergeblieben ist, damals: es ist wegen der Arme, hat er gesagt, solche weißen Arme gab es nicht, da oben, wo er herkam, und hier nicht, wo er dann blieb. Und dreißig Jahre hat er davon geredet. Der Annus. Der Mensch ist jung oder alt. Was braucht der alte Mensch denn schon? Das Tageslicht wird dunkler, die Schatten werden heller, die Nacht ist nicht mehr zum Schlafen, die Wege verkürzen sich. Nur noch zwei, drei Wege, zuletzt einer. Sie legt das Bild auf den Herd, neben den zusammengefalteten Brief. Dann holt sie die Streichhölzer aus dem Schaff und legt sie dazu. Werden wir die Milch aufkochen, sagt sie und geht hinaus, Holz holen. Johannes Bobrowski (9.4.1917 Tilsit – 2.2.1965 Berlin), Sohn eines Eisenbahnangestellten; hielt sich als Kind oft bei den Großeltern im deutsch-litauischen Grenzgebiet am Fluß Szeszupe auf; 1928 Übersiedlung nach Königsberg; 1937 wieder in Berlin; Kunstgeschichtestudien; 1945/49 Gefangenschaft in Rußland; Verlagslektor in Berlin; oft beschreibt J.Bobrowski die osteuropäische Landschaft, Kultur und Sprachen.- Werke: Lewins Mühle (Roman 1964), Das Holzhaus über der Wilia, Litauische Claviere (Roman, 1966). 91 Textarbeit 1. Aufgaben zum Wortschatz: a) Nennen Sie Synonyme zum Substantiv Zimmer, und erklären Sie deren Gebrauch. b) Illustrieren Sie die Vieldeutigkeit des Verbs streichen. 2. Stellen Sie eine Gliederung zusammen und benennen Sie diese Teile. 3. Analysieren Sie den Text absatzweise oder der von Ihnen erarbeiteten Gliederung nach, z.B.: das Benehmen der Frau; Beobachtungen des Erzählers; der Blickwechsel zum Brief; vorherrschende Stimmung usw. 4. Welche Rolle spielt der Brief? Äußern Sie Ihre Meinung dazu. 5. Finden Sie mehrere Briefe (in Versen oder Prosa). Vergleichen Sie sie mit dem im J.Bobrowskis Text. Es liegen in der menschlichen Natur wunderbare Kräfte, und eben wenn wir es am wenigsten hoffen, hat sie etwas Gutes für uns in Bereitschaft. (Johann Wolfgang von Goethe) 92 Peter Handke ALS ICH FÜNFZEHN WAR… (Auszug) Das Betragen: Ich stand auf, wenn ein Vorgesetzter den Raum betrat. Ich fehlte nicht unentschuldigt. Wenn ich mich als krank zu Bett legte, zeigte das Thermometer, daß ich berechtigt im Bett lag. Als es in Mode kam, sich mit Kreide Hakenkreuze auf die Handfläche zu zeichnen und damit Nichtsahnenden auf die Schulter zu klopfen, war ich meist der Beklopfte. Die Eisblumen auf den Fenstern im Winter wagte ich nicht während des Unterrichts anzuhauchen. Manchmal las ich unter der Bank. Sooft die Lehrer mich anschauten, versuchte ich ehrlich und offen zurückzuschauen. Auf Befehl konnte ich sofort die Hände auf den Tisch legen. Meist waren meine Schuhbänder so kurz, daß ich sie nicht zubinden konnte. Die Geschichte: Die Geschichte war für mich ein Unterrichtsfach. Ich hatte Freude an den Namen der unzähligen Friedensschlüsse. Von den längst vergangenen Ereignissen wurde in der Gegenwart gesprochen. Die Kriege, so wurde gesagt, brachten unsägliches Leid über die Völker. Marc Aurel war ein Philosoph auf dem Kaiserthron. Die Feldherren waren tapfer, und die Herrscher waren weise. Die Hunnen ritten Fleisch unter den Sätteln weich, hatten grausame Schnurrbärte und wurden mit einem Heuschreckenschwarm verglichen. Im Mittelalter war die Welt noch eine Einheit. Der spätere Papst Pius der Zweite entdeckte als einer der ersten die Vorzüge des Bergsteigens. Zur Veranschaulichung der Geschichte las ich Balladen. In allen Wandelgängen des alten Schlosses, in dem wir uns aufhielten, sollte ich die Spuren der Vergangenheit entdecken. Die Schlacht auf dem Lechfeld jährte sich zum eintausendundzweiten Male. Der heilige Bonifatius schlug mit eigener Hand die Donareiche um und bekehrte auf diese Weise die letzten Heiden im deutschen Gebiet zum Christentum. Die Römer, wenn sie nicht weiteressen konnten, kitzelten sich mit Federn den Gaumen, um erbrechen und weiteressen zu können. Der Aufstand der Ungarn im Jahr zuvor gehörte noch nicht zur Geschichte. Die Sprachen: 93 Die Beschäftigung mit den fremden Grammatiken hielt mich davon ab, mich mit den anderen beschäftigen zu müssen. Ich spielte mit den Abwandlungen von Wörtern. Es wurde mir beigebracht, Sprachen zu verachten und Sprachen zu lieben. Einer Minderheit bei uns, die eine slawische Sprache von Kind auf gelernt hatte, wurde von uns andern geraten, doch in das Land zu gehen, wo die Mehrheit diese Sprache spreche. Weil ich in der griechischen Grammatik allen überlegen war, fühlte ich mich mächtiger als viele. Der Ernst des Lebens: Ich schämte mich oft. Kaum aufgewacht, wünschte ich mir, es wäre schon wieder Abend. Ich wollte mich überallhin verkriechen. Im Bett zog ich mir sofort die Decke über den Kopf. Von einem Foto schnitt ich den Hinterkopf ab, weil er mir peinlich war. Den Stuhl, auf dem ich im Studiersaal saß, zog ich ganz dicht an das Pult heran und schob den Körper möglichst weit unter das Pult. Die Fingernägel waren immer schmutzig. Ich hörte auf, während der Messe mitzusingen, weil ich dabei die eigene Stimme hörte. Ich roch den Wein an den Fingern des Priesters, wenn er mir die Hostie auf die Zunge legte. Viel länger als nötig saß ich auf dem Abort. Ich war froh, daß das Pult einen aufklappbaren Aufbau hatte, in den ich mich in dem großen Saal mit den Augen verkriechen konnte. Mitten in einer Wurfschlacht mit Apfelresten fing ich blöd zu weinen an. Mit dem Weihwasser betupfte ich beim Verlassen der Kirche die Pickel auf der Stirn. Ich bemerkte zum erstenmal, daß ich schwitzte. Von allen Wörtern, die mit schlechten Vorsilben anfingen, fühlte ich mich gemeint. Die Sonne war mir zuwider, aber wenn draußen der Schnee fiel, hatte ich etwas, wo ich hinschauen konnte. Bei schwarzen Schlagzeilen in der Zeitung fiel mir das Wort “Herbst” ein, weil im Herbst davor Israel Ägypten bombardiert hatte: Bomben hatten seitdem für mich die Form von dichten schwarzen Schlagzeilen. Ich fürchtete mich nicht mehr so sehr vor dem Sterben, wie ich es als Kind getan hatte, sondern mehr vor dem Nicht-Sterben und vor dem Gesundsein. Ich erinnerte mich wenig und gebrauchte selten die Vergangenheitsform: Ich dachte meistens voraus. Wenn ich mir damals wünschte, anderen etwas sagen zu können, so meinte ich damit den Wunsch, anderen etwas befehlen zu können: Ich fürchtete und bewunderte die, die auf diese Weise etwas zu sagen hatten. Die Schuhe der Aufseher knarrten hinter einem. Die scheinbare 94 Aussenwelt, in der ich lebte, das Internat, war eigentlich intern, eine äußerlich angewendete Innenwelt, und das eigene Innere war die einzige Möglichkeit, ein wenig an die Aussenwelt zu gelangen. Ich getraute mich nicht, beim Spaziergang die vorgeschriebenen Grenzen zu überschreiten: Ich bemerkte nur Grenzen. Die Angst vor der Kirche war eine Angst vor der Kälte. Obwohl ich noch nie im Ausland gewesen war, war ich doch immer im Ausland. Jede meiner Antworten erschien mir als eine Beichte. Die Äpfel, die in den Wiesen rund um das Internat auf dem Boden lagen, stahl ich. Erst ein Jahr darauf kam es dazu, daß ich, unter dem Vorwand, ich wollte zum Zahnarzt, mit dem Bus in die nahe gelegene Stadt fuhr, wo ich neugierig herumging und neugierig schließlich ein Buch kaufte: Kurz nachdem ich zurück war, wurde es mir weggenommen, aber da hatte ich es schon gelesen. Peter Handke (geb. 1942), österreichischer Schriftsteller; 1961-65 Jurastudium in Graz, nach Annahme seines Romans “Die Hornisten” Abbruch des Studiums; 1996 Auftritt vor der “Gruppe 47” in Prinaton; mehrfach wechselnde Wohnorte: Graz, Düsseldorf, Berlin, Paris, Köln, Frankfurt, Kronberg i.T., in den USA, Salzburg; schreibt u.a. Erzählungen, Romane und Theaterstücke, Hörspiele, Gedichte. Textarbeit 1. Äußern Sie Ihre Meinung / Nehmen Sie Stellung zu den Schwerpunkten von Aussagen des Autors. 2. Schreiben Sie einen Aufsatz zu den Themen des o.g. Textes. An zwei Dingen fehlt es in unserer Welt, und sie stehen zueinander in einem besonderen Verhältnis: am Zutrauen und Geheimnis. (Hugo von Hofmannsthal) 95 Ödön von Horváth GESCHICHTE EINER KLEINEN LIEBE Still wirds im Herbst, unheimlich still. Es ist alles beim alten geblieben, nichts scheint sich verändert zu haben. Weder das Moor noch das Ackerland, weder die Tannen dort auf den Hügeln noch der See. Nichts. Nur, daß der Sommer vorbei. Ende Oktober. Und bereits spät am Nachmittag. In der Ferne heult ein Hund und die Erde duftet nach aufgeweichtem Laub. Es hat lange geregnet während der letzten Wochen, nun wird es bald schneien. Fort ist die Sonne und die Dämmerung schlürft über den harten Boden, es raschelt in den Stoppeln, als schliche wer umher. Und mit den Nebeln kommt die Vergangenheit. Ich sehe Euch wieder, Ihr Berge, Bäume, Straßen – wir sehen uns alle wieder! Auch wir zwei, du und ich. Dein helles Sommerkleidchen strahlt in der Sonne fröhlich und übermütig, als hättest du nichts darunter an. Die Saat wogt, die Erde atmet. Und schwül wars, erinnerst du dich? Die Luft summte, wie ein Heer unsichtbarer Insekten. Im Westen drohte ein Wetter und wir weit vom Dorfe auf schmalem Steig, quer durch das Korn, du vor mir – Doch, was geht das Euch an?! Jawohl, Euch, liebe Leser! Warum soll ich das erzählen? Tut doch nicht so! Wie könnte es Euch denn interessieren, ob zwei Menschen im Kornfeld verschwanden! Und dann gehts Euch auch gar nichts an! Ihr habt andere Sorgen, als Euch um fremde Liebe – und dann war es ja überhaupt keine Liebe! Der Tatbestand war einfach der, daß ich jene junge Frau begehrte, besitzen wollte. Irgendwelche „seelische“ Bande habe ich dabei weiß Gott nicht verspürt! Und sie? Nun, sie scheint so etwas, wie Vertrauen zu mir gefaßt zu haben. Sie erzählte mir viele Geschichten, bunte und graue, aus Büro, Kino und Kindheit, und was es eben dergleichen in jedem Leben noch gibt. Aber all das langweilte mich und ich habe des öfteren gewünscht, sie wäre taubstumm. Ich war ein verrohter Bursche, eitel auf schurkische Leere. Einmal blieb sie ruckartig stehen: „Du“, und ihre Stimme klang scheu und verwundet, „Warum läßt du mich denn nicht in Ruh? Du liebst mich doch nicht, und es gibt ja so viele schönere Frauen.“ 96 „Du gefällst mir eben“, antwortete ich und meine Gemeinheit gefiel mir überallemaßen. Wie gerne hätte ich diese Worte noch einigemale wiederholt! Sie senkte das Haupt. Ich tat gelangweilt, kniff ein Auge etwas zu und betrachtete die Form ihres Kopfes. Ihre Haare waren braun, ein ganz gewöhnliches Braun. Sie trug es in die Stirne gekämmt, so wie sie es den berühmten Weibern abgeguckt hatte, die für Friseure Reklame trommeln. Ja, freilich gibt es Frauen, die bedeutend schöneres Haar haben und auch sonst – Aber ach was! Es ist doch immer dasselbe! Ob das Haar dunkler oder heller, Stirn frei oder nicht – „Du bist ein armer Teufel“, sagte sie plötzlich wie zu sich selbst. Sah mich groß an und gab mir einen leisen Kuß. Und ging. Die Schultern etwas hochgezogen, das Kleid verknüllt – Ich lief ihr nach, so zehn Schritte, und hielt. Machte kehrt und sah mich nicht mehr um. Zehn Schritte lang lebte unsere Liebe, flammte auf, um sogleich wieder zu verlöschen. Es war keine Liebe bis über das Grab, wie etwa Romeo und Julia. Nur zehn Schritte. Aber in jenem Augenblick leuchtete die kleine Liebe, innig und geläutert, in märchenhafter Pracht. Ödon von Horváth (1901–1938), Dramatiker und Erzähler; stammt aus ungarischem Kleinadel, war Sohn eines Diplomaten und einer deutschen Mutter; Studium der Theaterwissenschaft, Philosophie und Germanistik in München; 1934 emigrierte nach Wien; von einem niederstürzenden Baum erschlagen (in Paris); 17 Bühnenstücke, 3 Romane, kleinere Prosaarbeiten und Lyrik; der Nachlass befindet sich im Archiv der Berliner Akademie der Künste. Textarbeit 1. Suchen Sie im Text die Wörter, die zu den folgenden Erklärungen passen: die Tatsache, die Wahrheit 97 eine große Zahl ein schmaler Weg zog ein Gewitter herauf stolz darauf sein, an nichts zu glauben heiß und feucht langsam gehen, ohne die Füße zu heben nicht hören und sprechen können primitiv enttäuscht, beleidigt ein leises Geräusch machen sehr gut gelaunt Beziehungen heimlich gehen Farben, Glanz mehr als alles andere rein, sauber tief der Kopf laut Reklame machen 2. Charakterisieren Sie die Rolle der Naturbeschreibungen im Text. 3. Interpretieren Sie den Schluss der Geschichte. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Glauben an langfristige Prozesse von viel längerer Dauer als ein einzelnes Leben dauert, die keiner Einsicht eines Einzelnen ganz zugänglich sind und in ihrer Gänze nur von Völkern und Zeitaltern, nicht von Personen erlebbar sind. (Hermann Hesse) 98 Hermann Hesse MÄRCHEN VOM KORBSTUHL Ein junger Mensch saß in seiner einsamen Mansarde. Er hatte Lust, ein Maler zu werden; aber da war manches recht Schwierige zu überwinden, und fürs erste wohnte er ruhig in seiner Mansarde, wurde etwas älter und hatte sich daran gewöhnt, stundenlang vor einem kleinen Spiegel zu sitzen und versuchsweise sein Selbstbildnis zu zeichnen. Er hatte schon ein ganzes Heft mit solchen Zeichnungen angefüllt, und einige von diesen Zeichnungen hatten ihn sehr befriedigt. „Dafür, daß ich noch völlig ohne Schulung bin“, sagte er zu sich selbst, „ist dieses Blatt doch eigentlich recht gut gelungen. Und was für eine interessante Falte da neben der Nase. Man sieht, ich habe etwas vom Denker an mir, oder doch so etwas Ähnliches. Ich brauche nur die Mundwinkel ein klein wenig herunterzuziehen, dann gibt es einen so eigenen Ausdruck, direkt schwermütig.“ Nur wenn er die Zeichnungen dann einige Zeit später wieder betrachtete, gefielen sie ihm meistens gar nicht mehr. Das war unangenehm, aber er schloß daraus, daß er Fortschritte mache und immer größere Forderungen an sich selbst stelle. Mit seiner Mansarde und mit den Sachen, die er in seiner Mansarde stehen und liegen hatte, lebte dieser junge Mann nicht ganz im wünschenswertesten und innigsten Verhältnis, doch immerhin auch nicht in einem schlechten. Er tat ihnen nicht mehr und nicht weniger Unrecht an, als die meisten Leute tun, er sah sie kaum und kannte sie schlecht. Wenn ihm wieder ein Selbstbildnis nicht recht gelungen war, dann las er zuweilen in Büchern, aus welchen er erfuhr, wie es anderen Leuten ergangen war, welche gleich ihm als bescheidene und gänzlich unbekannte junge Leute angefangen hatten und dann sehr berühmt geworden waren. Gern las er solche Bücher, und las in ihnen seine eigene Zukunft. So saß er eines Tages wieder etwas mißmutig und bedrückt zu Hause und las über einen sehr berühmten holländischen Maler. Er las, daß dieser Maler von einer wahren Leidenschaft, ja Raserei besessen gewesen sei, ganz und gar beherrscht von dem einen Drang, ein guter Maler zu werden. Der junge Mann fand, daß er mit diesem 99 holländischen Maler manche Ähnlichkeit habe. Im Weiterlesen entdeckte er alsdann mancherlei, was auf ihn selbst weniger paßte. Unter anderem las er, wie jener Holländer bei schlechtem Wetter, wenn man draußen nicht malen konnte, unentwegt und voll Leidenschaft alles, auch das geringste, abgemalt habe, was ihm unter die Augen gekommen sei. So habe er einmal ein altes Paar Holzschuhe gemalt, und ein andermal einen alten, schiefen Stuhl, einen groben, rohen Küchen- und Bauernstuhl aus gewöhnlichem Holz, mit einem aus Stroh geflochtenen, ziemlich zerschlissenen Sitz. Diesen Stuhl, welchen gewiß sonst niemals ein Mensch eines Blickes gewürdigt hätte, habe nun der Maler mit so viel Liebe und Treue, mit so viel Leidenschaft und Hingabe gemalt, daß das eines seiner schönsten Bilder geworden sei. Viele schöne und geradezu rührende Worte fand der Schriftsteller über diesen gemalten Strohstuhl zu sagen. Hier hielt der Lesende inne und besann sich. Da war etwas Neues, was er versuchen mußte. Er beschloß, sofort – denn er war ein junger Mann von äußerst raschen Entschlüssen – das Beispiel dieses großen Meisters nachzuahmen und einmal diesen Weg zur Größe zu probieren. Nun blickte er in seiner Dachstube umher und merkte, daß er die Sachen, zwischen denen er wohnte, eigentlich noch recht wenig angesehen habe. Einen krummen Stuhl mit einem aus Stroh geflochtenen Sitz fand er nirgends, auch keine Holzschuhe standen da, er war darum einen Augenblick betrübt und mutlos und es ging ihm beinahe wieder wie schon so oft, wenn er über dem Lesen vom Leben großer Männer den Mut verloren hatte: er fand dann, daß gerade alle die Kleinigkeiten und Fingerzeige und wunderlichen Fügungen, welche im Leben jener anderen eine so schöne Rolle spielten, bei ihm ausblieben und vergebens auf sich warten ließen. Doch raffte er sich bald wieder auf und sah ein, daß es jetzt erst recht seine Aufgabe sei, hartnäckig seinen schweren Weg zum Ruhm zu verfolgen. Er musterte alle Gegenstände in seinem Stübchen und entdeckte einen Korbstuhl, der ihm recht wohl als Modell dienen könnte. Er zog den Stuhl mit dem Fuß ein wenig näher zu sich, spitzte seinen Künstlerbleistift, nahm das Skizzenbuch auf die Knie und fing an zu zeichnen. Ein paar leise erste Striche schienen ihm die Form 100 genügend anzudeuten, und nun zog er rasch und kräftig aus und hieb mit ein paar Strichen dick die Umrisse hin. Ein tiefer, dreieckiger Schatten in einer Ecke lockte ihn, er gab ihn kraftvoll an, und so fuhr er fort, bis irgend etwas ihn zu stören begann. Er machte noch eine kleine Weile weiter, dann hielt er das Heft von sich weg und sah seine Zeichnung prüfend an. Da sah er, daß der Korbstuhl stark verzeichnet war. Zornig riß er eine neue Linie hinein und heftete dann den Blick grimmig auf den Stuhl. Es stimmte nicht. Das machte ihn böse. „Du Satan von einem Korbstuhl“, rief er heftig, „so ein launisches Vieh habe ich doch noch nie gesehen!“ Der Stuhl knackte ein wenig und sagte gleichmütig: „Ja, sieh mich nur an! Ich bin, wie ich bin, und werde mich nicht mehr ändern.“ Der Maler stieß ihn mit der Fußspitze an. Da wich der Stuhl zurück und sah jetzt wieder ganz anders aus. „Dummer Kerl von einem Stuhl“, rief der Jüngling, „an dir ist ja alles krumm und schief.“ – Der Korbstuhl lächelte ein wenig und sagte sanft: „Das nennt man Perspektive, junger Mann.“ Da sprang der Jüngling auf. „Perspektive!“ schrie er wütend. „Jetzt kommt dieser Bengel von einem Stuhl und will den Schulmeister spielen! Die Perspektive ist meine Angelegenheit, nicht deine, merke dir das!“ Da sagte der Stuhl nichts mehr. Der Maler ging einige Male heftig auf und ab, bis von unten her mit einem Stoch zornig gegen seinen Fußboden geklopft wurde. Dort unten wohnte ein älterer Mann, ein Gelehrter, der keinen Lärm vertrug. Er setzte sich und nahm sein letztes Selbstbildnis wieder vor. Aber es gefiel ihm nicht. Er fand, daß er in Wirklichkeit hübscher und interessanter aussehe, und das war die Wahrheit. Nun wollte er in seinem Buch weiterlesen. Aber da stand noch mehr von jenem holländischen Strohsessel und das ärgerte ihn. Er fand, daß man von jenem Sessel doch wirklich reichlich viel Lärm machte, und überhaupt ... Der junge Mann suchte seinen Künstlerhut und beschloß, ein wenig auszugehen. Er erinnerte sich, daß ihm schon vor längerer Zeit einmal das Unbefriedigende der Malerei aufgefallen war. Man hatte da nichts als Plage und Enttäuschungen, und schließlich konnte ja 101 auch der beste Maler der Welt bloß die simple Oberfläche der Dinge darstellen. Für einen Menschen, der das Tiefe liebte, war das am Ende kein Beruf. Und er faßte wieder, wie schon mehrmals, ernstlich den Gedanken ins Auge, doch noch einer früheren Neigung zu folgen und lieber Schriftsteller zu werden. Der Korbstuhl blieb allein in der Mansarde zurück. Es tat ihm leid, daß sein junger Herr schon gegangen war. Er hatte gehofft, es werde sich nun endlich einmal ein ordentliches Verhältnis zwischen ihnen anspinnen. Er hätte recht gern zuweilen ein Wort gesprochen, und er wußte, daß er einen jungen Menschen wohl manches Wertvolle zu lehren haben würde. Aber es wurde nun leider nichts daraus. Hermann Hesse (1877–1962), 1877 als Sohn eines Missionspredigers geboren, entzog sich dem vorgesehenen Theologiestudium durch die Flucht aus dem Maulbronner Seminar. Danach versuchte er sich in verschiedenen Berufen. Seit 1904 lebte er als freischaffender Schriftsteller. Der entschiedene Pazifist wurde während des 1. Weltkrieges als „Vaterlandsverräter“ verschrien. In der Zeit des Faschismus in Deutschland gehörte er zu den „unerwünschten“ Schriftstellern. Hesse, der seit 1919 in der Schweiz lebte und 1946 den Nobelpreis für Literatur erhielt, starb im Jahre 1962. Hermann Hesses reiches Erzählwerk besaß in der ersten Jahrhunderthälfte große Resonanz bei der fortschrittlichen bürgerlichen Jugend, die in seinen Entwicklungsromanen ein Spiegelbild ihrer Probleme sah. Die Etappen seines Schaffens werden bezeichnet durch den tragischen Schülerroman „Unterm Rad“ (1906), den stark autobiographischen „Steppenwolf“ (1927) und den symbolisch-utopischen Roman „Glasperlenspiel“ (1943). Textarbeit 1. Bestimmen Sie die soziale Herkunft und die Lebensverhältnisse des jungen Malers! 2. Warum ist der junge Maler mit seinen Selbstbildnissen unzufrieden? 102 3. Welche Wirkung hat die Lektüre von Künstlerbiographien auf ihn? 4. Was entnimmt er der Biographie des niederländischen Malers? 5. Warum geht der junge Maler vom Malen von Selbstbildnissen zum Malen von Gegenständen über? 6. Welches Verhältnis hat der junge Maler zu seiner Umwelt? 7. Welche Erfahrungen macht er beim Malen des Korbstuhls? 8. Warum will der junge Mann Schriftsteller werden? 9. Charakterisieren Sie den jungen Mann als Typ! 10. Welche Rolle spielt der Korbstuhl in der Erzählung? 11. Beurteilen Sie die Stellung des Autors zu seinem Helden! 12. Inwiefern nimmt der Autor mit seiner Erzählung Stellung zur Frage des Realismus in der Kunst? 13. Warum nennt der Autor seine Erzählung ein „Märchen“? 14. Welche Rolle spielt für einen Künstler die Beobachtung der Umwelt? 15. Wie beurteilen Sie die schöpferische Unzufriedenheit bei einem Künstler? 16. Äußern Sie ihre Künstlerbiographien. Meinung 103 über den Wert von Bertolt Brecht WENN DIE HAIFISCHE MENSCHEN WÄREN „Wenn die Haifische Menschen wären“, fragte Herrn K. die kleine Tochter seiner Wirtin, „wären sie dann netter zu den kleinen Fischen?“ „Sicher“, sagte er. „Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die kleinen Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch Tierzeug. Sie würden sorgen, daß die Kästen immer frisches Wasser hätten, und sie würden überhaupt allerhand sanitäre Maßnahmen treffen. Wenn zum Beispiel ein Fischlein sich die Flosse verletzen würde, dann würde ihm sogleich ein Verband gemacht, damit es den Haifischen nicht wegstürbe vor der Zeit. Damit die Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu große Wasserfeste; denn lustige Fischlein schmecken besser als trübsinnige. Es gäbe natürlich auch Schulen in den großen Kästen. In diesen Schulen würden die Fischlein lernen, wie man in den Rachen der Haifische schwimmt. Sie würden zum Beispiel Geographie brauchen, damit sie die großen Haifische, die faul irgendwo liegen, finden könnten. Die Hauptsache wäre natürlich die moralische Ausbildung der Fischlein. Sie würden unterrichtet werden, daß es das Größte und Schönste sei, wenn ein Fischlein sich freudig aufopfert, und daß sie alle an die Haifische glauben müßten, vor allem wenn sie sagten, sie würden für eine schöne Zukunft sorgen. Man würde den Fischlein beibringen, daß diese Zukunft nur gesichert sei, wenn sie gehorsam lernten. Vor allen niedrigen, materialistischen, egoistischen und marxistischen Neigungen mußten sich die Fischlein hüten und es sofort den Haifischen melden, wenn eines von ihnen solche Neigungen verriete. Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie natürlich auch untereinander Kriege führen, um fremde Fischkästen und fremde Fischlein zu erobern. Die Kriege würden sie von ihren eigenen Fischlein führen lassen. Sie würden die Fischlein lehren, daß zwischen ihnen und den Fischlein der anderen Haifische ein riesiger Unterschied bestehe. Die Fischlein, würden sie verkünden, sind bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz verschiedenen Sprachen und können einander daher unmöglich verstehen. Jedem Fischlein, das im Kriege ein paar andere Fischlein, feindliche, in anderer Sprache schweigende Fischlein tötete, würden sie einen 104 kleinen Orden anheften und den Titel Held verleihen. Wenn die Haifische Menschen wären, gäbe es bei ihnen natürlich auch eine Kunst. Es gäbe schöne Bilder, auf denen die Zähne der Haifische in prächtigen Farben, ihre Rachen als reine Lustgärten, in denen es sich prächtig tummeln läßt, dargestellt wären. Die Theater auf dem Meeresgrund würden zeigen, wie heldenmütige Fischlein begeistert in die Haifischrachen schwimmen, und die Musik wäre so schön, daß die Fischlein unter ihren Klängen, die Kapelle voran, träumerisch, und in allerangenehmste Gedanken eingelullt, in die Haifischerachen strömten. Auch eine Religion gäbe es da, wenn die Haifische Menschen wären. Sie würden lehren, daß die Fischlein erst im Bauch der Haifische richtig zu leben begännen. Übrigens würde es auch aufhören, wenn die Haifische Menschen wären, daß alle Fischlein, wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von ihnen würden Ämter bekommen und über die anderen gesetzt werden. Die ein wenig größeren dürften sogar die kleineren auffressen. Das wäre für die Haifische nur angenehm, da sie dann selber öfter größere Brocken zu fressen bekämen. Und die größeren, Posten habenden Fischlein würden für die Ordnung unter den Fischlein sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingenieure im Kastenbau usw. werden. Kurz, es gäbe überhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen wären.“ (Aus: Kalendergeschichten) Bertolt Brecht (eig. Berthold Eugen Friedrich Brecht; 1898-1956); war Sohn des Direktors einer Augsburger Papierfabrik. Schon 1914/15 schrieb er Verse und Prosa. 1917/18 studierte er in München Philosophie, dann Medizin; im Herbst 1918 wurde er zum Militärdienst verpflichtet. Ende 1919 bis 1920 schrieb er Theaterkritiken für die Zeitung. 1919-23 setzte er sein Studium in München fort, hielt aber Kontakt mit Schriftstellern und Theaterleuten. 1923 war er Dramaturg an den Münchner Kammerspielen, 1924 ging er nach Berlin, wo er Dramaturg am Deutschen Theater war. 1933 verließ Brecht Deutschland und lebte in Dänemark, Finnland, in den USA. 1948 zog er weiter nach Ost-Berlin. Dort wirkte er als Regisseur am Deutschen Theater und gründete 1949 zusammen mit seiner Frau 105 Helene Weigel das „Berliner Ensemble“. Werke: Dreigroschenroman, Kalendergeschichten, Leben des Galilei, Trommeln in der Nacht, Mutter Courage und ihre Kinder u.a. Textarbeit 1. Exzerpieren Sie die Sätze, die die Hauptgedanken enthalten! 2. Bestimmen Sie die konjunktivischen Formen, und stellen Sie fest, welche Aussagewirkung der Verfasser mit ihnen erreicht! 3. Drücken Sie Ihre Meinung aus! Welchem historischen Ereignis ist diese Geschichte gewidmet? Welchem Zweck sollen die einzelnen Maßnahmen der Haifische dienen? Was beabsichtigt B.Brecht mit dieser Geschichte? 4. Bestimmen Sie die Mittel der Ironie /Paradoxie/ Gegenüberstellung. Sprechen Sie über deren Rolle im Text. Der Mensch soll seine Komplexe nicht ausrotten wollen, sondern sich ins Einvernehmen mit ihnen setzen, sie sind die berechtigten Dirigenten seines Benehmens in der Welt. (Sigmund Freud) 106 Kurt Tucholsky RATSCHLÄGE FÜR EINEN SCHLECHTEN REDNER Text 1 Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Malen vor dem Anfang! Etwa so: „Meine Damen und Herren! Bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz...“ Hier hast du schon so ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht: eine steife Anrede; der Anfang vor dem Anfang; die Ankündigung, daß und was du zu sprechen beabsichtigst, und das Wörtchen kurz. So gewinnst du im Nu die Herzen und die Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern: daß er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt; daß du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer schön umständlich. Sprich nicht frei - das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es: du liest deine Rede ab. Das ist sicher, zuverlässig, auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach jedem viertel Satz mißtrauisch hochblickt, ob auch noch alle da sind. Wenn du gar nicht hören kannst, was man dir so freundlich rät, und du willst durchaus und durchum frei sprechen ... du Laie! Du lächerlicher Cicero! Nimm dir doch ein Beispiel an unsern professionellen Rednern, an den Reichstagsabgeordneten - hast du die schon mal frei sprechen hören? Die schreiben sich sicherlich zu Hause auf, wann sie „Hört! hört!“ rufen ... ja, also wenn du denn frei sprechen mußt: Sprich wie du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst. Sprich mit langen, langen Sätzen – solchen, bei denen du, der du dich zu Hause, wo du ja die Ruhe, derer du so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet, hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die Nebensätze schön ineinandergeschachtelt, so daß der Hörer, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her träumend, sich in einem Kolleg wähnend, in dem er früher so gern geschlummert hat, auf das Ende solcher Periode wartet ... nun, ich habe dir eben ein Beispiel gegeben. So mußt du sprechen. Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist 107 nicht nur deutsch – das tun alle Brillenmenschen. Ich habe einmal in der Sorbonne einen chinesischen Studenten sprechen hören, der sprach glatt und gut französisch, aber er begann zu allgemeiner Freude so: „Lassen sie mich Ihnen in aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meiner chinesischen Heimat seit dem Jahre 2000 vor Christi Geburt ...“ er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute so lachten. So mußt du das auch machen. Du hast ganz recht: man versteht es ja sonst nicht, wer kann denn das alles verstehen, ohne die geschichtlichen Hintergründe ... sehr richtig! Die Leute sind doch nicht in deinen Vortrag gekommen, um lebendiges Leben zu hören, sondern das, was sie auch in den Büchern nachschlagen können ... sehr richtig! Immer gib ihm Historie, immer gib ihm. Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen – das sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale; immer sprich, mein Guter. Gott wird es dir lohnen. Du mußt alles in die Nebensätze legen. Sag nie: „Die Steuern sind zu hoch.“ Das ist zu einfach. Sag: „Ich möchte zu dem, was ich soeben gesagt habe, noch kurz bemerken, daß mir die Steuern bei weitem ...“ So heißt das. Trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor – man sieht das gern. Wenn du einen Witz machst, lach vorher, damit man weiß, wo die Pointe ist. Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog. Weil doch nur einer spricht. Du brauchst auch nach vierzehn Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, daß eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück ist: eine stumme Masse spricht nämlich ununterbrochen mit. Und das mußt du hören. Nein, das brauchst du nicht zu hören. Sprich nur, lies nur, donnere nur, geschichtele nur. Zu dem, was ich soeben über die Technik der Rede gesagt habe, möchte ich kurz bemerken, daß viel Statistik eine Rede immer sehr hebt. Das beruhigt ungemein, und da jeder imstande ist, zehn verschiedene Zahlen mühelos zu behalten, so macht das viel Spaß. Kündige den Schluß deiner Rede langevorher an, damit der Hörer vor Freude nicht einen Schlaganfall bekommen. (Paul Lindau 108 hat einmal einen dieser gefürchteten Hochzeitstoaste so angefangen: „Ich komme zum Schluß.“) Kündige den Schluß an, und dann beginne deine Rede von vorn und rede noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere Male wiederholen. Du mußt dir nicht nur eine Disposition machen, du mußt sie den Leuten auch vortragen – das würzt die Rede. Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es gar nicht erst anzufangen. Wenn einer spricht, müssen die andern zuhören – das ist deine Gelegenheit! Mißbrauche sie. Ratschläge für einen guten Redner Hauptsätze. Hauptsätze. Hauptsätze. Klare Disposition im Kopf – möglichst wenig auf dem Papier. Tatsachen, oder Apell an das Gefühl. Schleuder oder Harfe. Ein Redner sei kein Lexikon. Das haben die Leute zu Hause. Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet; sprich nie länger als vierzig Minuten. Suche keine Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen. Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache – da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad. Merk Otto Brahms Spruch: Wat jestrichen is, kann nicht durchfalln. Erläuterungen zum Text: ausmachen: hier: ergeben, zum Rezultat haben steif: formell, unpersönlich eine Aufgabe aufbekommen (Umgangssprache): eine Aufgabe bekommen (vgl. etwas aufhaben) umständlich: langsam, nicht direkt der Reichstagsabgeordnete: ein Mitglied des deutschen Parlaments (Reichstag) vor dem Zweiten Weltkrieg immer gib ihm (Umgangssprache): (intensive, verstärkte Aufforderung) Kinkerlitzchen (Umgangssprache): unnützes Zeug, Albernheiten geschichtele nur! (Imperativform vom Autor aus dem Nomen Geschichte: Historie gebildet) hier etwa: bring viel Geschichte in deinen Vortrag 109 Textarbeit 1. Fragen zum Text: 1. Sollten diese Ratschläge des Autors befolgt werden? 2. Ist es richtig, den geschichtlichen Hintergrund eines Problems zu erklären? 3. Was halten Sie von den Äußerungen des Autors, eine Rede sei nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück? 4. Welche Fehler muss ein guter Redner nach Ihrer Meinung unbedingt vermeiden? 2. Drücken Sie den Inhalt folgender Sätze mit Worten aus dem Text aus! 1. Der Redner hat schnell die Aufmerksamkeit der Zuhörer gewonnen. 2. Er drückt alle wichtigen Inhalte in Nebensätze aus. 3. Dichterzitate steigern den Wert einer Rede. 3. Was verstehen Sie unter den folgenden Wörtern und Ausdrücken? Erklären Sie anhand der Beispiele: eine steife Anrede, Brillenmensch, Pointe, einen Schlaganfall bekommen, Dispositionen machen. 4. Formen Sie folgende Sätze in Infinitivkonstruktionen um. Das Publikum konnte den Redner nicht verstehen. Der Schuldner konnte das Geld nicht termingerecht zurückzahlen. Leider können wir Ihnen keine verbindliche Auskunft geben. Können Sie vor einem kritischen Publikum eine freie Rede halten? Unser neuer Mitarbeiter muß mit einem Computer umgehen können. 5. Bestimmen Sie Elemente des publizistischen Stils und Mittel der Ironie/Satire. 110 Kurt Tucholsky DIE KUNST, FALSCH ZU REISEN Text 2 Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die – “Alice! Peter! Sonja! Legt mal die Tasche hier in das Gepäcknetz, nein, Da! Gott, ob einem die Kinder wohl mal helfen! Fritz, iß jetzt nicht alle Brötchen auf! Du hast eben gegessen!” in die Welt! Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles: schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge – also: vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. Wenn du reist, nimm um Gottes willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden – sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt – die andern fahren alle umsonst. Bedenke, daß es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht; daß im Nichtraucher-Abteil einer raucht, muß sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt werden – ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und rächende Nemesis in einem. Das verschönt die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig – daran erkennt man den Mann. Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab; das hast du nicht nötig – nur nicht weich werden. Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein... Hast du keinen Titel... Verzeihung... ich meine: Wenn einer keinen Titel hat, dann erfinde er sich einen. Schreib nicht “Kaufmann”, schreib: “Generaldirektor”. Das hebt sehr. Geh sodann unter heftigem Türenschlagen in dein Zimmer, gib um Gottes willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk; reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas entzwei (sag es aber keinem, der Hotelier hat so viele Gläser!), und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt. In der fremden Stadt mußt du zuerst einmal alles genauso haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist – hat die Stadt das nicht, 111 dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts fahren, dasselbe Telefon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben Retiraden (Toiletten). Im übrigen sieh dir nur die Sehenswürdigkeiten an, die im Baedeker (Reiseführer) stehen. Treibe die Deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat – lauf blind an allem andern vorüber, und vor allem: rüste dich richtig aus. Bei Spaziergängen durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut (mit Rasierpinsel), schwere Nagelschuhe (für Museen sehr geeignet), und einen derben Knotenstock. Anseilen nur in Städten von 500 000 Einwohnern aufwärts. Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen; wenn man schon mal in der Fremde ist, muß man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluß die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen: ich hab’s geschafft. Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau, möglichst um hundert Mark zu gering – man kann das immer einsparen. Dadurch nämlich, daß man überall handelt; dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. Fahr lieber doch ein Endchen weiter, als es dein Geldbeutel gestattet, und bring den Rest dadurch ein, daß du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist; daß du zu wenig Trinkgelder gibst; und daß du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiß dabei nie die Hauptregel jeder gesunden Reise: Ärgere dich! Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags. Koch noch einmal allen Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast; vergiß überhaupt nie, daß du einen Beruf hast. Wenn du reisest, so sei das erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun hast: Ansichtskarten zu schreiben. Die Ansichtskarten brauchst du nicht zu bestellen: Der Kellner sieht schon, daß du welche haben willst. Schreib unleserlich – das läßt auf gute Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten: auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Bergesgipfeln und im schwanken Kahn. Brich dabei den Füllbleistift ab und gieß Tinte aus dem Federhalter. Dann schimpfe. 112 Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist: es muß was los sein – und du mußt etwas “vorhaben”. Sonst ist die Reise keine Reise. Jede Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht darin, daß man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält – hast du es nicht innegehalten, gib deiner Frau die Schuld. Verlang überall ländliche Stille; ist sie da, schimpfe, daß nichts los ist. Eine anständige Sommerfrische besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Oceandancing und einer Weinabteilung. Besuche dergleichen – halte dich dabei aber an deine gute, bewährte Tracht: kurze Hose, kleiner Hut (siehe oben). Sieh dich sodann im Raume um und sprich: “Na, elegant ist es hier gerade nicht!” Haben die andern einen Smoking an, so sagst du am besten: “Fatzkerei, auf die Reise einen Smoking mitzunehmen!” – hast du einen an, die andern aber nicht, mach mit deiner Frau Krach. Mach überhaupt mit deiner Frau Krach. Durcheile die fremden Städte und Dörfer – wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert; außerdem ist der Zug, den du noch erreichen mußt, wichtiger als eine stille Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz; dazu reist man nicht. Auf der Reise muß alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast. Schieb dem Kellner die nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht: “Wenn mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen!” Tu immer so, als seist du aufgewachsen bei... Mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, sag alles frei heraus! Immer gib ihm! Sprich laut, damit man dich hört – viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du dich amüsierst, dann lach, aber so laut, daß sich die andern ärgern, die in ihrer Dummheit nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprachen nicht sehr gut, dann schrei: Man versteht dich dann besser. Laß dir nicht imponieren. Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im Vierfarbendruck singt. Die Natur hat das gerne. Handele. Schimpfe. Ärgere dich. Und mach Betrieb. 113 Kurt Tucholsky (Pseud. Kaspar Hauser, Peter Panter u.a.; 1890-1935), politisch-satirischer Schriftsteller und Publizist; stammte aus bürgerlichen Kreisen, studierte Recht; ab 1913 Mitarbeiter an „Schaubühne“; 1915 zum Kriegsdienst einbezogen; 1918/20 Leiter der satirischen Wochenbeilage zum „Berliner Tagesblatt“, dann freischaffender Schriftsteller, Korrespondent, Herausgeber der „Weltbühne“, 1933 aus Deutschland ausgebürgert; verzweifelt durch den deutschen Faschismus setzte seinem Leben ein Ende. Textarbeit 1. Aufgaben zum Wortschatz: Erläutern Sie Vieldeutigkeit und Phraseologie zu weich, blind, sparen, spannen. Führen Sie Komposita mit den Komponenten -reise/Reise- an Erarbeiten Sie ein Schema/eine Tabelle zur Wortfamilie sehen. 2. Kurt Tucholsky nimmt das Verhalten vieler Touristen aufs Korn. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Überschrift? 3. Welche Kunst will dieser Text vermitteln? 4. Tucholsky wird oft als Satiriker bezeichnet. Informieren Sie sich im Lexikon über diesen Begriff. Bestimmen Sie Elemente der Satire bzw. Ironie im Text. 5. Welche direkten Aufforderungen enthält der Text, und welche Aufforderungen sollen eigentlich vermittelt werden? Legen Sie eine Tabelle ein: - die Kunst, falsch zu reisen... - die Kunst, richtig zu reisen... 6. Verfassen Sie eine Anleitung für sinnvolles Reisen. Material dazu haben Sie in der Tabelle. 114 7. Schreiben Sie einen Erlebnisaufsatz gelungene/misslungene Reise. über eine Jedenfalls stünde es besser um die Menschheit, wenn man sich weniger auf Gnade und dergleichen Tugenden und Schwächen verließe, sich desto entscheidender aber auf Gerechtigkeit stützte. (Imanuel Kant) Wir brauchen ... Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in die Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. (Franz Kafka) 115 TEIL II. Texte zum Berichten, Referieren und Interpretieren SPRACHE Von Hermann Hesse Die Sonne spricht zu uns mit Licht, Mit Duft und Farbe spricht die Blume, Mit Wolken, Schnee und Regen spricht Die Luft. Es lebt im Heiligtume Der Welt ein unstillbarer Drang, Der Dinge Stummheit zu durchbrechen, In Wort, Gebärde, Farbe, Klang Des Seins Geheimnis auszusprechen. Hier strömt der Künste lichter Quell, Es ringt nach Wort, nach Offenbarung, Nach Geist die Welt und kündet hell Aus Menschenlippen ewige Erfahrung. Nach Sprache sehnt sich alles Leben, In Wort und Zahl, in Farbe, Linie, Ton Beschwört sich unser dumpfes Streben Und baut des Sinnes immer höhern Thron. In einer Blume Rot und Blau, In eines Dichters Worte wendet Nach innen sich der Schöpfung Bau, Der stets beginnt und niemals endet. Und wo sich Wort und Ton gesellt, Wo Lied erklingt, Kunst sich entfaltet, Wird jedesmal der Sinn der Welt, Des ganzen Daseins neu gestaltet, Und jedes Lied und jedes Buch Und jedes Bild ist ein Enthüllen, Ein neuer, tausendster Versuch, Des Lebens Einheit zu erfüllen. 116 In diese Einheit einzugehn Lockt euch die Dichtung, die Musik, Der Schöpfung Vielfalt zu verstehn Genügt ein einziger Spiegelblick. Was uns Verworrenes begegnet, Wird klar und einfach im Gedicht: Die Blume lacht, die Wolke regnet, Die Welt hat Sinn, das Stumme spricht. (Aus: Hermann Hesse. Ausgewählte Werke in sechs Bänden) Wer redet, was er will, muss hören, was er nicht will. (Sprichwort) Klug reden kann jeder, aber nicht besser machen. (Sprichwort) Reden kommt von Natur, Schweigen vom Verstande. (Sprichwort) Rede wenig mit andern, aber viel mit dir selbst. (Sprichwort) Rede wenig ,rede wahr; zehre wenig, zahle bar. (Sprichwort) 117 Entstehung und Entwicklung des Wortes THEODISCUS/DEUTSCH Von Hugo Moser Text 1 Die Bezeichnung deutsch bietet hinsichtlich ihrer sprachlichen Form wie vor allem ihrer ursprünglichen Bedeutung gewisse Schwierigkeiten. Zunächst tritt sie in der lateinischen Form theodiscus in der Karolingerzeit auf, zuerst 786. Damals betrachtet der romanische Bischof von Ostia und Amiens, daß auf einer angelsächsischen Synode die Beschlüsse einer voraufgehenden Kirchenversammlung tam latine quam theodisce verlesen wurden. 801 wendet sich Karl der Große in einem Kapitular in Italien gegen das Verbrechen unerlaubter Entfernung aus dem Heer, “quod nos teudisca lingua dicimus herisliz (Heeresbruch)”. Bischof Frechulf von Lisieux spricht um 825 im Zusammenhang mit den Goten und Franken von nationes Theotiscae. 840 tritt bei Walahfried Strabo neben Theotiscum sermonem das Wort Theotisci auf, und 842 ist in Nithards Bericht über die doppelsprachigen Straßburger Eide anläßlich der Teilung des Frankenreiches die Rede von Teudisca und Romana lingua. In Ottfrids Evangelienharmonie (um 860) steht in der lateinischen Einleitung theotisce; im deutschen Text liest man frengisk fränkisch, was hier wohl im gleichen, weiteren Sinn gemeint ist. Erst zweihundert Jahre nach dem Auftreten der lateinischen Form, in der ottonischen Zeit, finden sich Belege für die deutsche Form des Wortes. Notker der Deutsche (955-1022) gebraucht das Wort duitisc; in Glossen vor und nach Notker finden sich auch Formen mit anlautendem th und t und innerem d. Dagegen begegnet seit etwa 880, also hundert Jahre nach der ersten Bezeugung von theodiscus, das schon dem klassischen Latein bekannte Wort teutonicus neben Teutoni; es wird bald häufiger als jenes. Schon im 8. Jahrhundert werden auch die Bezeichnungen Germania, Germani, germanicus gebraucht (so von Bonifatius). Der Form nach gehört das Wort deutsch ohne Zweifel zu got. þiuda Volk (þai þiuđo die Heiden), zu frühalthochdeutsch theota, daneben diot Volk (erhalten etwa in Dietrich = Volk + Herrscher). Mit ihm hängen die lateinischen Formen theodiscus, theotiscus, teudiscus zusammen; Weisgerber hat wahrscheinlich gemacht, daß 118 ihnen ein westfränkisches *þeudisk, *þeodisk vorausging, von dem die mittellateinischen Bezeichnungen stammen können. Ihm entsprechen ahd. diutisc, mndl. dietsc, duutsc, afz. tie(d)eis. Das Schwanken der Schreibung zwischen innerem d und t kann landschaftssprachlich sein. Im Anlaut entsprechen sich th und d (ahd. th wird > d); t erklärt sich wohl durch den Einfluß der lateinischen Formen und von teutonicus. Im Mittelhochdeutschen steht diutsch neben tiu(t)sch. Die d-Formen überwiegen im Niederdeutschen, während in Süddeutschland die Schreibung mit t bis in die Goethezeit bevorzugt wurde. In der Klopstockzeit bekam sie noch eine Stütze: damals erfand man ja den germanischen Gott Teut als Stammvater der Deutschen. Das ihnen als Niederdeutschen vertraute, etymologisch richtige anlautende d vertraten Gottsched und Adelung. Überblickt man die Belege, die oben nur in spärlicher Auswahl angeführt werden konnten, so wurde theodiscus “volksmäßig” zunächst von der Sprache, dann erst vom Volk gebraucht. Es wurde benützt im Sinne von vulgaris und bezeichnete (wie Otfrids ingethiuti) anfänglich die Volkssprache gegenüber dem Latein; es bedeutete wohl zuerst germanisch, später dann fränkisch. Dafür spricht neben Äußerungen wie der Frechulfs vor allem die Tatsache, daß theodiscus auch außerhalb des Frankenreichs gebraucht wurde, so etwa in England gleich bei seinem ersten bezeugten Auftreten 786, und daß es nach 800 auch für das Gotische wie um 825 bei Frechulf für die Goten stand. Teutonicus dagegen wird von Anfang an in der Bedeutung deutsch gebraucht, und zwar, wie wir sahen, für die Sprache und, in der Form Teutoni, auch für das Volk. Wir dürfen vielleicht annehmen, daß theodiscus unter dem Einfluß von teutonicus, das damit gleichgesetzt wurde, als die Bezeichnung der nicht romanisierten gegenüber den romanisch sprechenden Franken die eingeschränkte Bedeutung deutsch bekam. Erläuterungen Kapitularien: Verordnungen der karolingischen Könige; Ottonische Zeit: Otto, Fürsten, deutsche Könige und römische Kaiser (912-1218); Notker Labeo: um 950-1022, Mönch in St.Gallen, Übersetzer, verdient um die Deutsche Sprache (Akzentsystem, Rechtschreibung); 119 Bonifatius: Heiliger, angelsächsischer Mönch, um 670-754, bekehrte germanische Stämme zum Christentum, gründete Klöster; Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803), Dichter der Aufklärung; Gottsched, Johannn Christoph (1700-1766), Schriftsteller und Literaturkritiker der Aufklärung. (Aus: Sprache und Literatur, B. 1) DIE DEUTSCHE SPRACHE Text 2 Die deutsche Sprache ist die Muttersprache der deutschen Sprachgemeinschaft. Sie wird von rund 100 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, dem deutschsprachigen Teil der Schweiz sowie von deutschsprachigen Minderheiten in anderen Staaten gesprochen (z.B. in Luxemburg, Dänemark, Polen, Rumänien, Rußland, Kanada u.a.). Die in Grammatik und Schreibung festgelegte neuhochdeutsche Schriftsprache wird als Hochsprache in den Schulen gelehrt und überbrückt so wesentliche Unterschiede der Umgangssprache, der landschaftlichen Ausformungen der Hochsprache und der deutschen Mundarten. Auf jeder Ebene ergänzen Berufssprachen, Fachsprachen und Standessprachen für ihren Bedarf den Wortschatz der Umgangssprache, vielfach durch Fremdwörter; dem Bedürfnis engerer Gruppenbildung entsprechen Sondersprachen. Das von J.und W. Grimm begonnene Deutsche Wörterbuch wurde mit über 100 000 Stichwörtern 1961 abgeschlossen. Deutsch gilt als eine der wortreichsten Sprachen; es kann Ableitungen und Wortzusammensetzungen beliebig neu schaffen. Die Sonderstellung des Deutschen unter den germanischen Sprachen wurde von der Forschung bisher vorwiegend in lautlichformalen Zügen gesehen (Lautverschiebung). Die Betonung der Stammsilbe hebt (im Unterschied zu den romanischen und den meisten slawischen Sprachen) das bedeutungstragende Element ebenso hervor wie der Satzakzent die sinntragenden Redeteile. Charakteristisch für Wortschatz und Wortbildung sind besonders die Zusammensetzungen und die Anschaulichkeit der 120 Benennung. Die Wurzelgleichheit bewahrt die gedankliche Geschlossenheit der deutschen Wortfamilien. Über das durch Lehnübersetzungen bereicherte muttersprachliche Wortgut hinaus wurden auch in die deutsche Sprache immer wieder Fremdwörter und Lehnwörter eingebürgert, seit dem 18. und besonders im 20. Jh. vorwiegend angloamerikanische Fremdwörter und Ausdrucksformen. Kennzeichnend für den Aufbau eines längeren Satzes ist die durch Partizipien begünstigte Klammerkonstruktion. Auch die Endstellung des Verbs im Nebensatz ist eine Besonderheit der deutschen Sprache. Ein stärkerer Wandel in der Gegenwartssprache läßt sich in Wortschatz und Stilistik beobachten. Für die Umgangssprache sind semantische Unschärfe und stereotype Wortwahl typisch, für Wissenschafts- und Verwaltungssprache eine durch Hauptwortstil und Fremdwortgebrauch besonders gesteigerte Abstraktheit der Ausdrucksweise. An der Erweiterung des Wortschatzes haben die Sprachen der Wissenschaft und Technik, des Verkehrswesens, der öffentlichen Kommunikationsmittel, der Wirtschaft, der Werbung und des Sports besonderen Anteil. Seit Jacob Grimm war die Forschung lange Zeit ausschließlich der deutschen Sprachgeschichte in ihrer Verknüpfung mit den anderen indogermanischen Sprachen zugewandt. Das Deutsche wäre so ein Zweig des Westgermanischen (neben dem Altenglischen und dem Friesischen), dieses selbst wäre ein Ast des Germanischen (neben Nord- und Ostgermanisch). Heute steht weniger das Aufspalten als das Zusammenwachsen einer im Gefolge der Völkerwanderung verbliebenen Mannigfaltigkeit im Blickpunkt: Die fränkischen Mundarten entspringen wesentlich anderen germanischen Grundlagen als die bairisch-alemannischen oder die sächsischen Mundarten. So lassen sich auch kaum gemeinsame Merkmale angeben, durch die sich das Deutsche aus dem Westgermanischen herausgelöst hätte, und selbst eine so wesentliche Neuerung wie die hochdeutsche Lautverschiebung, die die deutsche Sprache in Hochund Niederdeutsch gliedert, ist nicht als Vorbedingung, sondern als Ausschnitt der deutschen Sprachgeschichte zu betrachten. Nach dem Abklingen der Völkerwanderung war Oberdeutschland sprachlich aktiv: Die wohl von den Alemannen ausgehende hochdeutsche Lautverschiebung erfaßte das Bairische 121 und Teile des Fränkischen, eine süddeutsche Kirchensprache mit zahlreichen Neubildungen sowie Entlehnungen und Neuprägungen aus den klassischen Sprachen strahlte seit 700 nach Norden aus. Freising lieferte um 765 das älteste schriftliche Denkmal der deutschen Sprache. Die frühesten Glossen finden sich im Maihinger Evangeliar, das in der Abtei Echternach entstanden ist. Überhaupt gingen von der fränkischen Staatsmacht seit dem 8. Jh. von Westen her starke sprachliche Wirkungen aus, die gemäß dem dort entstehenden Gedanken der theodisca lingua (des sprachlichen Überbaues über die fränkischen, sächsischen, bairischen und alemannischen Mundarten) auch Ansätze zu einer Hochsprache enthalten. Das Ende des Frankenreiches, die Normannen- und Ungarnstürme ließen kein dauerhaftes Ergebnis entstehen. Die Folgezeit brachte je nach den Schwerpunkten der Reichsgewalt ein Ausstrahlen des Sächsischen, spärlich des Alemannischen, später (deutlich die Ausbreitung der Diphthongierungen) des BairischÖsterreichischen. Nur die wenigsten sprachlichen Merkmale erreichten das gesamte deutsche Sprachgebiet; das Niederdeutsche trat im Austausch zurück. Auch als im Hochmittelalter die klösterliche Kultur durch eine weltlich-höfische nach romanischem Vorbild abgelöst wurde, ergab die übergreifende Sprache ritterlichhöfischer Dichtung mit zahlreichen Entlehnungen aus romanischen Sprachen keine dauerhafte Gemeinsprache. Erst im späten Mittelalter schuf die deutsche Ostsiedlung neue Bedingungen. Im Zusammenströmen der Siedler wuchsen Ausgleichsmundarten. Im 14.Jh. übernahm Prag die sprachliche Vorrangstellung durch den Hof der Luxemburger. Nach dem Vorbild der Kanzleien im Westen des Reiches setzte sich die deutsche Urkundensprache durch und wurde als höfische Sprache vom böhmischen Adel übernommen. Freizügigkeit der Schreiber schuf die Verbindung zum ThüringischObersächsischen, das nicht nur eine starke innere Entfaltungskraft zeigte, sondern auch mit dem geistigen Einfluß Erfurts und der Reichweite der obersächsischen Kanzlei eine solche Breite gewann, daß die Reformation, besonders in den Schriften Luthers, diese Sprachform selbst nutzen konnte. Auch Renaissance und Humanismus wirkten mit ihrer Wiederbelebung des Lateinischen und Griechischen besonders auf die deutsche Wissenschaftssprache ein. 122 Mystik, Reformation und Pietismus prägten den religiösen und philosophischen Wortschatz aus. Auf den Grundlagen der obersächsischen Kanzleisprache entstand die neuhochdeutsche Schriftsprache. Seit diese Form im deutschen Sprachbereich allgemein aufgenommen wurde (seit etwa 1500 auch im niederdeutschen Raum als Amts- und Schriftsprache), hat die deutsche Sprache in der Folge Wert und Geltung einer Weltsprache erreicht. An der Entwicklung einer deutschen Stilistik und überregionalen Schriftsprache sowie einer Sprachnorm hatten Literaten (z.B. der Aufklärung, der Empfindsamkeit, des Sturm und Drang, der Klassik und Romantik) sowie grammatische und sprachtheoretische Arbeiten und Wörterbücher (J.Chr.Gottsched, J.Grimm) wesentlichen Anteil. Was in dieser Entwicklung an Einzeltatsachen beschlossen ist, wird in der Periodisierung von Althochdeutsch (750-1100), Mittelhochdeutsch (1100-1350), Neuhochdeutsch (seit 1350; von da bis 1500 Frühneuhochdeutsch, im 16.Jh. Abspaltung der niederländischen Sprache) mehr nach Anhaltspunkten des Schrifttums als nach der Entwicklung der Sprache selbst geordnet. (Nach: dtv – Lexikon in 20 Bänden, B. 4) DIE DEUTSCHE SPRACHE Text 3 Um 500 vor unserer Zeitrechnung dringt eine Anzahl von Stämmen in den Raum zwischen Rhein und Elbe ein. Wir nennen diese Stämme zusammenfassend Germanen. Später wurden ihre Siedlungsgebiete nach Westen und Süden erweitert. Um diese Zeit veränderte sich die Sprache der Germanen sehr und unterschied sich stark von der indoeuropäischen Grundsprache. Alle diese Veränderungen führten dazu, daß das Germanische sich von der indoeuropäischen Ursprache trennte und selbständig wurde. Von den Sprachwisssenschaftlern wird sie als Urgermanisch bezeichnet. Man muß allerdings nicht denken, daß Urgermanisch eine einheitliche Sprache war. Es bestand aus mehreren Dialekten (Mundarten), die in verschiedenen Teilen des germanischen 123 Siedlungsgebiets gesprochen wurden und sich voneinander mehr oder weniger unterschieden. Im Laufe der weiteren Entwicklung wurden diese Unterschiede immer größer, und allmählich führte dieser Prozeß zur Herausbildung der einzelnen germanischen Sprachen (in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit). Aus westgermanischen Dialekten entwickelte sich auch die deutsche Sprache. Zu dieser Abtrennung führten vor allem große Veränderungen im Konsonantensystem, die als zweite Lautverschiebung in der Sprachwissenschaft bezeichnet werden. So “verschob” sich das germanische [p] zur Affrikate [pf] – (das englische apple entspricht dem deutschen Apfel), das germanische [t] zu [ts] oder [s] (das englische water entspricht dem deutschen Wasser) usw. Da die zweite Lautverschiebung in süddeutschen Dialekten entstand, also in dem deutschen Hochland, wurde sie die hochdeutsche Lautverschiebung genannt, und die Sprache, die dadurch entstand, als Hochdeutsch im Unterschied zu Niederdeutsch (Dialekte im norddeutschen Tiefland) bezeichnet. Da der hochdeutsche Konsonantismus auch für die deutsche Literatursprache gilt, wird diese als Hochdeutsch bezeichnet. Die weitere Entwicklung der deutschen Sprache gliedert man gewöhnlich in vier Perioden: - die althochdeutsche Periode (8.-11.Jh.), - die mittehlhochdeutsche Periode (11.-14.Jh.), - die frühneuhochdeutsche Periode (14.-Anfang des 17.Jh.), - die neuhochdeutsche Periode (17.Jh. bis zur Gegenwart). Die althochdeutsche Sprache unterscheidet sich sehr stark von dem Deutschen der Gegenwart. Besonders typisch für die althochdeutsche Sprache sind die klangvollen Endungen: Dort, wo jetzt nur ein e steht (Tagen), konnten früher verschiedene Vokale stehen (dagon). Im 11.Jh. beginnt die Abschwächung der Vokale in Endsilben zu unbetontem e (die Reduktion), so daß für die mittelhochdeutsche Sprache reduzierte (abgeschwächte) Endungen sehr typisch sind: Während man im 9.Jh. bringan, bluoma sagte, klang es schon im 12.Jh. bringen, bluome (Blume). Dadurch wurde die Sprache jener Zeit für uns etwas verständlicher, doch konnten wir auch große Unterschiede vom heutigen Deutsch beobachten. 124 In dieser Zeit kämpften die Deutschen für einen einheitlichen Staat, aber noch viele Jahrhunderte blieb Deutschland in viele kleine Staaten zersplittert, was die Bildung der allgemein verständlichen Sprache hinderte. Das deutsche Volk sprach viele Dialekte, die sich so stark voneinander unterschieden, daß ein Deutscher vom Süden seinen Landsmann vom Norden kaum verstehen konnte. Das Volk brauchte ein einheitliches Land und eine einheitliche Sprache. In der Kirche und an den Universitäten herrschte die lateinische Sprache, und das störte auch die Entwicklung der deutschen Nationalsprache. Gegen die Alleinherrschaft der katholischen Kirche und der lateinischen Sprache trat der Professor der Philosophie und Theologie Martin Luther (1483-1546) auf. Sein Auftreten gegen die katholische Kirche entwickelte sich zu einer breiten Volksbewegung, die in die Geschichte als Reformation eingegangen ist. Da Martin Luther auch für die Muttersprache in dem kirchlichen Gebrauch war, übersetzte er im Laufe von einigen Jahren auf der Wartburg die Bibel in die deutsche Sprache. Dabei versuchte er seine Übersetzung allgemein verständlich zu machen, darum gebrauchte er nur solche Wörter, die in allen oder vielen Dialekten vorhanden waren. Luther schuf mit seinem Werk Grundlage für die Herausbildung der deutschen Nationalsprache. (Aus: Deutsch für die Fachrichtung Philologie) HOCHSPRACHE, UMGANGSSPRACHE, DIALEKT Text 4 Diese drei Begriffe suggerieren drei voneinander abgrenzbare hierarchisch angeordnete Sprachformen. Während sich die beiden Pole Hochsprache und Dialekt leicht fassen lassen, ist das bei dem, was man Umgangssprache nennt, nicht der Fall. Welche der vielen Varianten innerhalb des Spektrums von den Sprachteilhabern jeweils ausgewählt wird, hängt von pragmatischen Faktoren ab, z.B. von den Kommunikationspartnern, von der Sprechsituation, vom Thema, von der beabsichtigten Wirkung auf die Ansprechpartner, aber auch von der Tatsache, welche Varianten dem Sprecher überhaupt zur Verfügung stehen. 125 Die Standardsprache ist im Vergleich zu den Umgangssprachen nur wenig regional gegliedert; sie beeinflusst aber in hohem Maße die regionalen Umgangssprachen. Diese selbst weisen größere geographische Unterschiede auf, die größten in der Mitte und im Süden. Im Norden wird unter Umgangssprache eher eine stilistisch niederere, “lässigere”, gleichsam abgesunkene Form der Standardsprache verstanden. In der Mitte und im Süden dagegen jene “Zwischenschicht” mit den vielen Übergangsformen, die heute interpretierbar sind als Tendenz der Sprecher, Formen zu verwenden, die der Einheitssprache näher stehen. Diachron ist diese heutige Zwischenschicht wohl der Vorgänger dieser Einheitssprache bei den Gebildeten, eine regional geprägte Verkehrssprache, die Merkmale meidet, die nur kleinräumig verbreitet sind. Die Dialekte des Nordens sind wegen der nicht durchgeführten 2. Lautverschiebung weiter vom Standard entfernt als die Dialekte der Mitte und des Südens; hinsichtlich der Tatsache, dass die Dialekte jeweils die Sprachform sind, die die stärksten geographischen Unterschiede vorweist, unterscheidet sich Süden und Norden nicht. Die Hochsprache hat die größere kommunikative Reichweite, nicht nur geographisch, sondern auch von der Zahl der Situationen her, in denen sie, ohne dass gesellschaftliche Sanktionen drohen, angewandt werden kann. Im Norden hatte sich das Hochdeutsche als Sprache der Städter schon früh durchgesetzt. Die Schulsprache ist das Hochdeutsche, das von genuinen Plattsprechern als Fremdsprache erlernt wird, der Unterschied zwischen Mundart und Schriftsprache ist zu groß. Das Plattdeutsche ist praktisch nur noch auf das flache Land im Norden des niederdeutschen Raumes beschränkt. Das Platt ist in Situationen mit größerem Öffentlichkeitsgrad praktisch ausgeschaltet, als Alltagssprache der Familie wird es jedoch noch einige Zeit weiterbestehen. In den Städten ist die Sprache der Unterschichten eine Mischung aus Platt und Hochdeutsch. Das Schweizerdeutsche ist keine einheitliche Sprache, sondern setzt sich aus vielen regionalen Untermundarten alemannischer Prägung zusammen. Diese werden in Stadt und Land, hinauf bis in die höchsten sozialen Schichten gesprochen. Zwar pflegen Schule und Wissenschaft die nhd. Hochsprache, doch nach dem Unterricht spricht der Lehrer mit den Schülern, der Professor mit den Studenten 126 in der Mundart. Im Fernsehen und Radio wird mit Ausnahme weniger Sendungen Dialekt gesprochen. Es herrscht praktisch eine mediale Diglossie: Gesprochen wird Schweizerdeutsch, geschrieben wird Hochdeutsch. Die Situation allein, nicht das Thema, bestimmt, ob Dialekt oder Hochdeutsch verwendet wird. Heute ist die Mundart in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens akzeptiert. Die romanischsprachigen Schweizer sind die Leidtragenden dieser Entwicklung, denn sie verstehen eher die Hochsprache als den Dialekt. Die hohe Mobilität unserer heutigen Zeit lässt aber auch in der Schweiz Sprachformen entstehen, die mit den Umgangssprachen Deutschlands die Aufgabe kleinräumig verbreiteter Merkmale gemeinsam haben. Im übrigen hochdeutschen Sprachraum sind Mundart und Hochsprache soziologisch wie sprachlich nicht so weit voneinander entfernt. Die gesprochene Hochsprache ist (besonders in Österreich) sehr viel mehr mundartlich gefärbt, beide Sprechweisen gehen fast gleitend ineinander über. Sehr viel mehr Angehörige der Oberschicht beherrschen die Mundart als z.B. in Norddeutschland. Solange die nhd. Schriftsprache nichts als Schreibsprache war, bestand kein Anlass, Dialekte zu erforschen und aufzuzeichnen.Wenn die Sprachforscher des 16./17. Jh. sich mit der Mundart beschäftigten, dann mit den Problemen, die gesprochene Sprache im Gegensatz zu geschriebener bot. Das Wort Mundart selbst ist 1640 bei Zesen zuerst belegt: die Bildung betont den gesprochenen Aspekt dieser Sprachform und nicht den regionalen, wie es heute der Fall ist. Die künstliche Bildung Mundart ist ein Gelehrtenwort geblieben. Das Wort der Mundartsprecher heißt Dialekt (südd.) oder Platt (md., nordd.). Die ersten Arbeiten, die Mundart in ihrem regionalen Aspekt behandeln, entstehen im 18. Jh. zunächst in Niederdeutschland, wo der Unterschied zwischen Dialekt und Hochsprache besonders groß war und das Nhd. als gesprochene Sprache in der städtischen Bevölkerung schon früh gepflegt wurde, später dann auch im hochdeutschen Bereich. Es sind dies Wörterbücher, die die landschaftlichen Eigenheiten und Besonderheiten aufzeichneten. Beispiele: Richey (Hamburg) 1743, Strothmann (Osnabrück) 1756, Tiling und Dreyer (Bremen und Niedersachsen) 1795 u.a. Die eigentlich wissenschaftliche Beschäftigung mit Mundarten begann im 19. Jh. im Rahmen der Erforschung der Sprachgeschichte und 127 historischen Grammatiken des Deutschen. Man entdeckte die Dialekte als eigenständige Gebilde, im Gegensatz zur Hochsprache, als das Ergebnis einer kontinuierlich organischen Entwicklung. Als Anreger und Forscher stehen hier Jacob Grimm (Deutsche Grammatik, 1819-37), F.J. Stalder (Die Landessprachen in der Schweiz, 1819) an der Spitze. In dieser Zeit wurden auch schon die ersten wissenschaftlichen Wörterbücher begonnen, so Stalders “Schweizerisches Idiotikon” (1806-12) und Schmellers “Bayerisches Wörterbuch” (1827-37). Eine neue Stufe in der wissenschaftlichen Erforschung der Dialekte beginnt zu dem Zeitpunkt, da die Phonetik das Rüstzeug für adäquate Beschreibung der Laute zur Verfügung stellt und Schattierungen eines Lautes noch kennzeichnen kann. Die erste vorbildliche Arbeit in dieser Hinsicht schuf Jost Winteler in der Schweiz (1876). Ihm folgten eine große Anzahl sog. Ortsgrammatiken, die in der Regel die Laute einer Mundart im Vergleich zum Mhd. beschrieben. Bald schon wurde nicht nur Sprache eines Ortes sondern die mehreren mit ihren Unterschieden aufgenommen. Im deutschsprachigen Raum hatte Georg Wenker 1876 im Rheinland die ersten Bogen mit 40 Sätzen in die Dörfer geschickt, damit sie in die dort heimische Mundart übersetzt würden. Nach und nach wurde das ganze deutsche Sprachgebiet auf diese Weise erfasst. Dem “Forschungsinstitut für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas” in Marburg liegen heute 52800 ausgefüllte Fragebogen vor. Aus diesem Material sind bis heute 129 Karten zu 79 Erscheinungen veröffentlicht (von 1926-1956). Eine weitere große Anzahl von Karten liegen nur landschaftlich vor. In der Wortgeographie hat sich das Sprachatlasverfahren bewährt. Ob in einem Dialekt Ziege oder Geiß gesagt wird, kann auch ein Laie beantworten. Der Fragebogen zum Deutschen Wortatlas (DWA) wurde von Walther Mitzka in den Jahren 1939 und 1940 versandt: Er enthielt 200 Einzelwörter; ca. 48000 Antworten liegen in Marburg vor; davon wurden 22 Bände von 1951 bis 1980 veröffentlicht. 1977 wurde von Jürgen Eichhoff ein “Wortatlas der deutschen Umgangssprachen” publiziert, der als drittes großes sprachgeographisches Werk den gesamtdeutschen Sprachraum erfasst. (Nach: dtv – Atlas zur deutschen Sprache) 128 DIE SPRACHEN IN DER SPRACHE Text 5 Gliederung der Sprache Die Sprache lässt sich aus verschiedenen Dimensionen gesehen verschieden gliedern. Leider ist die Terminologie aber noch nicht vereinheitlicht. Für die gleiche Sprachschicht oder den gleichen Bereich werden oft mehrere Bezeichnungen nebeneinander gebraucht, z.B. Hoch-, Normal-, Gemein-, Allgemein-, Gebrauchs-, Standardsprache für die überregionale, nicht gruppengebundene Sprache; und manche Begriffe werden in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet oder undeutlich definiert (bes. Umgangssprache). Vereinfacht lassen sich folgende fünf Dimensionen unterscheiden: Medium, historische, regionale, soziale und stilistische Dimension. Medium Zunächst gibt es den Unterschied zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache. Die letztere ist in verschiedenen Kommunikationsbereichen dokumentiert: in der Verwaltung, der Wissenschaft, der Literatur, der Presse usw., die erstere bisher noch verhältnismäßig wenig. Sie ist die Urform der Sprache, jedoch hat sich die Wissenschaft erst nach Saussure und den amerikanischen Strukturalisten näher mit ihr beschäftigt. Zwischen gesprochener und geschriebener Sprache bestehen vor allem Differenzen in Syntax und Wortwahl. Die gesprochene Sprache weist wiederum regionale und situationsbedingte/soziale Unterschiede auf. Historische Dimension In der Sprachgeschichte wird das Deutsche in verschiedene Perioden eingeteilt, wie Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Deutsch von heute. In jeder Periode gibt es Wörter und Konstruktionen, die besonders zeittypisch sind, und andere, die als veraltet (oder veraltend) gelten. Hier handelt es sich um die geschriebene Sprache verschiedener Zeiten. Regionale Dimension Große geographische Unterschiede, vor allem was Wortschatz und Aussprache betrifft, weisen Mundarten (Dialekte) auf. 129 Nichtregional (oder überregional) ist die Standardsprache (auch Gemeinsprache oder Hochsprache). Zwischen beiden liegen die regional gefärbten Umgangssprachen, die kleinere geographische Variationen aufweisen. Soziale Dimension Früher war der sprachliche Unterschied zwischen den sozialen Schichten stärker ausgeprägt. Heute muss ein Mensch eine größere Anzahl sprachliche Varietäten für verschiedene soziale Situationen beherrschen. Soziale, regionale und auch stilistische Gliederung überschneiden sich hier. Auch die nicht-gruppengebundene (übergruppale) Form der Sprache nennen wir Standardsprache, im Gegensatz zu den verschiedenen Sondersprachen (Fach- und Gruppensprachen). Stilistische Dimension Die terminologische Uneinheitlichkeit ist am größten, wenn es um die stilistische Einteilung der Sprache geht. Was den Überblick kompliziert, ist, dass die verschiedenen Stiltypen einer Sprache teils von der sozialen Situation, teils von dem Thema, dem Medium und der Mitteilungsabsicht abhängen. Folgende Gliederung in vier Stilschichten stammt von Ruth Klappenbach. Daneben rechnet sie mit verschiedenen Stilfärbungen: - gehoben - normalsprachlich - salopp/umgangssprachlich - vulgär. Die regionalen Unterschiede in der Sprache Die Standardsprache (auch Hochsprache oder Gemeinsprache) ist das Resultat einer langen Entwicklung. Ihre grammatischen, stilistischen und orthographischen Normen wurden endgültig erst im 19. Jahrhundert festgelegt. Sie verändern sich jedoch langsam, indem sie sich an den Sprachgebrauch anschließen. Die Standardsprache nähert sich also allmählich der Umgangssprache, und sie ist eher eine geschriebene als eine gesprochene Sprache. Die Mundart ist die älteste Form der Sprache. Aussprache und Wortschatz wechseln stark von Dialekt zu Dialekt, manchmal sogar von Ort zu Ort. Der Dialekt hat deshalb gegenüber der 130 Standardsprache nur eine begrenzte Reichweite. Da die Mundart hauptsächlich gesprochen wird und ihre Orthographie und Grammatik nicht normiert sind, ist sie leichter veränderlich als die geregelte Standardsprache. Die Aussprache enthält viele Assimilationen und Abschwächungen (ostfränk. unner ‘unser’, schwäb. ebbes ‘etwas’). Durch Analogie ist die Flexion weiter vereinfacht worden. Im Ostalemannischen sind z.B. die Pluralendungen im Präsens einheitlich (wir, ihr, sie gebet), und in manchen Dialekten sind der Dativ und der Akkusativ zusammengefallen (“der Akkudativ”). Die Entwicklung vom synthetischen zum analytischen Sprachbau ist also teilweise weiter fortgeschritten als in der Standardsprache. Die Mundarten sind reich an expressiven und anschaulichen Ausdrücken, und der Wortschatz ist teilweise differenzierter als in der Standardsprache. Heute ist die Gesamtzahl der Menschen, die reine Mundart sprechen, stark zurückgegangen, obwohl die meisten Erwachsenen einen Dialekt jedenfalls beherrschen. In manchen Situationen, im Affekt usw. kann die Mundart durchbrechen, auch bei Menschen, die sonst Dialekt nie sprechen. Im südlichen Raum hat die Mundart eine stärkere Stellung als im Norden, und sie hat dort auch die Umgangssprache mehr beeinflusst. Hauptsächlich drei Faktoren haben während der letzten 150 Jahre den Rückgang der Dialekte verursacht: Lange wurden die Mundarten sehr abschätzend bewertet. Die Sprachpfleger stellten sie als Pöbelsprache dar, der Schulunterricht als unkorrekt gegenüber der Hochsprache. Man bemühte sich, nach der Schrift zu sprechen: je höher der soziale Status, umso weniger Dialekt. Die Landflucht und die Binnenwanderung (Ortswechsel) haben zur Nivellierung der Mundarten beigetragen. Etwa 1/5 der Mundartsprecher ist durch die große Umsiedlung 1941-45 ausgefallen. Durch Massenmedien, Fremdenverkehr und Schule kann ein Mundartsprecher heute nicht mehr isoliert in seinem sprachlichen Bereich bleiben. Andererseits erleben wir heute wieder eine gewisse Renaissance der Mundarten. Eine neue Dialektdichtung entsteht: Dramatik ebenso wie Lyrik und Kinderbücher, Schlager und 131 Übersetzungen u.a. Dialektkurse werden gegeben und neue Mundartwörterbücher erscheinen. Die Umgangssprache steht zwischen Mundart und Standardsprache. Entstanden in fnhd. Zeit, hat sie sich in der sozialen Oberschicht der Städte entwickelt, unterschiedlich in den verschiedenen Teilen Deutschlands. Auch die Umgangssprache ist hauptsächlich eine gesprochene Sprache. Sie ist überregional verständlich, weist aber mehr oder weniger starke landschaftliche Züge auf, an denen man die Herkunft des Sprechers erkennt, z.B. an der Intonation einer regionalen Färbung der Aussprache (z.B. von r, st, -ig) dem süddeutschen Gebrauch von sein bei liegen, sitzen, stehen gegenüber nord- und mitteldeutsch haben den wortgeographischen Unterschieden, d.h. in Wörtern und Ausdrücken, die als regionale Varianten der Gemeinsprache nebeneinander gelten: Heidelbeere/Blaubeere, Schlachter/Metzger/Fleischer, einholen/einkaufen. Es sind vor allem Berufsbezeichnungen und Ausdrücke auf den Gebieten Küche und Haushalt, z.B.: Nord – Süd – Unterschiede: Junge Bub Abendbrot Abendessen Apfelsine Orange Klöße Knödel Weißkohl Weißkraut fegen kehren Treppe Stiege Regionale Umgangssprachen sind z.B. Österreichisch, Württembergisch (das sog. Honoratiorenschwäbisch), Obersächsisch, die berlinische, das Kohlenpottdeutsch im Ruhrgebiet und das Missingsch (Umgangssprache zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch). 132 Besonderheiten der deutschen Sprache in Österreich und in der Schweiz Österreichische Besonderheiten: Obers Sahne Sessel Stuhl Trafik Tabakladen Kasten Schrank änner Januar am Markt auf dem Markt usw. Auch die Austriazismen, die Besonderheiten der deutschen Sprache in Österreich, werden durch den Einfluss der Massenmedien und des Fremdenverkehrs allmählich weniger. Schon sagen viele Österreicher für ‘Einkommen’ das Gehalt statt österr. der Gehalt und nennen die Kartoffeln nicht mehr Erdäpfel, die Tomaten nicht Paradeiser und den Rechtsanwalt nicht Advokat. Das österreichische Deutsch hat natürlich viele regionale Varianten mit dem übrigen oberdeutschen Gebiet gemeinsam (vrgl. oben). Andere Ausdrücke sind auf Österreich und Bayern beschränkt, wie Grüß Gott für Guten Tag oder Wörter und Wendungen, die aus der Mundart (bairisch) in die Umgangssprache übernommen worden sind: G(e)selchtes für Geräuchertes, Topfen für Quark. Von der bairisch-österreichischen Mundart beeinflusst ist auch die häufige Verwendung des Diminutivs (erl-, el-): Stamperl ‘kleines Schnapsglas’, Wimmerl ‘Pickel’, Kasperl(e) ‘Kasper’ u.a. Auch zwischen Österreich und der Schweiz gibt es Übereinstimmungen wie verkühlt für erkältet und einige Fremdwörter: Perron ‘Bahnsteig’, Pensionist ‘Rentner’, Magister ‘Apotheker’. Nur auf Österreich begrenzte Besonderheiten sind z.B. Ausdrücke im Bereich der staatlichen Organisation und Verwaltung, der Politik usw.: Proporz, ‚Verteilung der Sitze und Ämter nach dem Stimmenverhältnis bei der Proportionalwahl’ (auch Schweiz) Monocolore, ‘Einparteienregierung’ Erlagschein, ‘Zahlkarte’ (bei der Post) 133 Verlassenschaft, ‘Nachlass’ Präsenzdienst, ‘Militärdienst’ Spital, ‘Krankenhaus’ Eine Erinnerung an die Zeit der Donaumonarchie sind die Lehnwörter aus dem Ungarischen, Slawischen, Rumänischen und Italienischen, vor allem im Bereich der Küche: slaw. - Powidl, ‘Pflaumenmus’ Kolatsche, ‘kleiner Hefekuchen’ rumän. - Palatschinke-n, ‘Eierkuchen’ ital. - Marille, ‘Aprikose’ Biskotte, ‘Biskuit’ Ribisel, ‘Johannisbeere’ In der deutschsprachigen Schweiz fungiert die Mundart, Schwyzerdütsch, als selbstverständliche Umgangssprache aller sozialen Schichten. Das Standarddeutsch ist vorwiegend Schriftsprache und wird nur – aber nicht immer – in den Schulen und Kirchen, im Fernsehen und Rundfunk, vor Gericht und in Vorträgen gesprochen. Der Deutschschweizer ist also zweisprachig (Diglossie). Man erkennt einen Schweizer an seinem musikalischen Akzent, der von den romanischen Nachbarsprachen beeinflusst ist. Auch im Wortschatz ist die romanische Interferenz groß: Velo ‘Fahrrad’, Billet, Konfiserie ‘Konditorei’, Jupe ‘Frauenrock’; und noch öfter als in Österreich wird die Aussprache verdeutscht: Perron, Dessert, Servelat u.a. Die wortgeographischen Besonderheiten der Schweizer Schriftsprache stammen zum großen Teil aus der alemannischen Mundart. Neben den Dialektwörtern fallen auch abweichende Wortbildungen und unterschiedliche Bedeutungen auf. Schweizerhochdeutsche Besonderheiten: träf – treffend urchig – kraftvoll, urwüchtig der Fürsprech – Rechtsanwalt das Großkind – Enkel, -in welsch – französisch, italienisch hausen – sparen usw. 134 In den Namen der deutschen Mundarten leben die alten Stammesbezeichnungen weiter, obwohl die Grenzen sich längst nicht mehr decken. Auch sind die Grenzen zwischen den Mundarten nicht so eindeutig, sondern es gibt Übergangszonen, wie es ja auch Übergangsformen zwischen Dialekt und Umgangssprache gibt. Bei der traditionellen Einteilung der Dialekte stützt man sich vor allem auf lautliche Kriterien (2. Lautverschiebung, Diphthongierung, Monophthongierung usw.), aber auch auf die Wortgeographie. Die 2. Lautverschiebung hat einst das deutsche Sprachgebiet in Niederdeutsch und Hochdeutsch geteilt. Nur im Hochalemannischen ist sie ganz durchgeführt (d.h. auch die Affrikataverschiebung des k). Das Mitteldeutsche hat nur zum Teil die Affrikataverschiebung von p. (Nach: Stedje, A.: Deutsche Sprache gestern und heute) Textarbeit (für mehrere Texte zum Thema Sprache) 1. Bereiten Sie ein Referat/einen Bericht über die deutsche Sprache vor. Bedienen Sie sich der Texte dieses Teiles und der Arbeitshilfen (Teil III). 2. Stellen Sie folgende Recherchen auf: Situation Ihrer Muttersprache und der verbreitesten Fremdsprachen, Tendenzen in der Entwicklung der deutschen Sprache. 3. Berichten Sie darüber im Plenum oder erarbeiten Sie Referate zu Schwerpunkten der Aufgaben 1 und 2. 135 Werner Ross GERMANEN UND ROMANEN Ein Capriccio Über Germanen und Romanen kann man ganze Bibliotheken schreiben. Nimmt man alles zusammen, so haben sie – die Engländer und die Franzosen, die Deutschen mit den Schweizern und Österreichern und Niederländern, die Italiener und Spanier und Portugiesen, die Dänen und Schweden und Norweger und Isländer – die Geschichte Europas mit Schwerterklang und Kanonendonner, aber auch die Kultur Europas mit Ideen und Kunstwerken, mit erstaunlichen Leistungen und rauschendem Ruhm angefüllt. Die Slawen als die dritte große Gruppe sollen nicht vergessen sein. Aber sie sind erst spät hinzugekommen, in voller Größe erst im 19. Jahrhundert. Keine Bibliothek also – was dann, stattdessen? – Ein Capriccio. Das ist italienisch und heißt Laune. Capra ist die Ziege, die läuft bekanntlich selten geradeaus, lieber im Ziegen-Zickzack. Ein Capriccio ist eine Kunstproduktion, die – sei es Zeichnung, Musikstück oder Schreibübung – mehr der Laune, der Willkür, dem Gutdünken folgt als der Logik. Und warum muß man das auf Italienisch sagen? Nun, weil die Italiener jahrhundertelang für Europa die Lehrmeister der schönen Künste waren und den Kunstdingen ihre Namen gaben. Und so kann noch heute eine Primadonna eine Koloraturarie mit Brio singen. Und das deutsche Publikum klatscht auf Deutsch, aber ruft auf Italienisch „bravo!“ – obwohl es bei einer Sängerin richtig „brava“ rufen müßte. Gewiß können wir auch einfach „brav“ rufen; das wäre deutsch, aber es paßt überhaupt nicht auf die Callas, die da singt, sondern nur auf ein Kind, das brav sein Butterbrot oder seinen Brei ißt. Dagegen würden wir auf Französisch sagen, daß der Sopran mit Bravour gesungen hat. Und der Redner spricht mit Verve, der Literat entfaltet Esprit, der Reiter geht das Hindernis mit Elan an. Die Dame braucht ihr Parfüm, und der Herr trägt mit Würde sein Embonpoint. Man kann mit der Mode anfangen, aber man hört so schnell nicht damit auf. Wie ist die Farbe dieses Kleides? Grau? Gelb? Bräunlich? Nein, es ist beige. 136 Es hat in diesem alten Europa so etwas wie nationale Spezialisierung gegeben: Die Italiener waren für die Künste zuständig, die Franzosen für die Damenmode, die Engländer für die Herrenmode. Die Dame trug Crêpe de Chine, der Herr Tweed. Die Deutschen haben die Loden und den Janker, das Dirndl und den Trachtenanzug erfunden, und die Münchner Modemesse ist inzwischen berühmt. Aber die Eleganz, der Chic sind doch eigentlich in Paris, in Florenz und Mailand zu Hause. Und die Franzosen haben die Nouvelle Cuisine aufgebracht, während die Italiener keine neue Küche brauchen, weil ihre alte so gut ist. Die Capriccio-Ziege meckert und sagt, sie möchte einen kleinen Kreuz-und-Quer-Sprung nach Spanien machen. Aber Spanien war für den europäischen Kontinent selten tonangebend, meist war es ein fernes, geheimnisvolles Land. Was man nicht kennt, kommt einem spanisch vor, wie der Stierkampf und die Paella. Doch: Eines haben wir aus Spanien, aus der Zeit, als das spanische Zeremoniell, die strengen spanischen Sitten in Europa vorbildlich waren. Wir sagen nicht „ihr“ wie die Engländer und Franzosen, sondern „Sie“ in der Anrede. Und dieses sonderbare „Sie“ bedeutet „Euer Gnaden“, und das ist die Nachbildung des spanischen „Vuestra Merced“ (heute spanisch „Usted“). Und von spanisch „Mercedes“ – sagt die Ziege und lacht auf ziegenweise – kommt der deutsche Mercedes, aus einem lieblichen Mädchennamen wird ein breitbeiniger Firmen- und ein breiträdriger Autoname. Wie das kommt, erkläre ich das nächste Mal und sage „Auf Wiedersehen“ – wie Sie es wünschen: auf Französisch „adieu“ oder auf Italienisch „ciao“ oder in klassischem Englisch „bye bye“. Werner Ross (geb. 1912), der Münchner Gelehrte; leitete das Goethe-Institut bis in die 70er Jahre. Erst danach begann er richtig mit dem Schreiben. 1980 erschien sein Hauptwerk, die große Nietzsche-Biographie „Der ängstliche Adler“. In den letzten Jahren hat W.Ross vier Bücher veröffentlicht: Über Lou Andreas-Salome, Baudelaire, Venedig und noch einmal über Nietzsche. 137 Textarbeit 1. Stellen Sie eine kleine Sammlung „Die Fremdwörter im Deutschen“ zusammen. 2. Vergleichen Sie das Deutsche mit Ihrer Muttersprache (Welche Wörter kommen ganz ähnlich vor? Für welche Begriffe haben Sie andere, eigene Wörter?) 3. Welche Einflüsse von anderen Sprachen gibt es in Ihrer Sprache? Nennen Sie die Bereiche, in denen internationaler Austausch häufig ist. 4. Äußern Sie Ihre Meinung: Warum nennt der Autor seinen Text ein Capriccio? Es ist nicht genug, einen guten Kopf zu haben; die Hauptsache ist, ihn richtig anzuwenden. Die größten Seelen sind der größten Laster ebenso fähig, wie der größten Tugenden. (Descartes) Eines guten Redners Amt oder Zeichen ist, daß er aufhöre, wenn man ihn am liebsten höret und meinet, es werde erst kommen. (Martin Luther) 138 Die Bundesrepublik und die Deutschen WAS MACHT DIE DEUTSCHEN ZU DEUTSCHEN? Der “Nationalcharakter” – das war vor und nach dem 2. Weltkrieg eines der zentralen wissenschaftlichen Themen: Was macht den Russen zum Russen, den Deutschen zum Deutschen, den Amerikaner zum Amerikaner? Als sich, nach dem Krieg, die Nationen auf eine Ära der friedlichen Zusammenarbeit einrichteten, verschwand auch das Interesse am Nationalcharakter wieder, das Interesse konzentrierte sich jetzt auf Versuche zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern – man ging davon aus, dass die Unterschiede zwischen den Nationen ohnehin verschwänden. Die folgenden Jahrzehnte haben diese Prognose allerdings nicht bestätigt. Vielmehr hat das Nationalgefühl in vielerlei Hinsicht wieder das Interesse an den Besonderheiten der verschiedenen Völker geweckt. Der Grund dafür ist die Erkenntnis, dass sich Menschen verschiedener Völker in der Tat nach den Werten unterscheiden, die einen Teil ihres kulturellen Erbes bilden. Das Urteil über den Nationalcharakter anderer wird dabei immer von der Kultur gefärbt sein, in der der Beobachter aufgewachsen ist. Bestimmte Grundzüge freilich werden stets auffallen: eben die Grundzüge, die alle Deutschen zu Deutschen, alle Amerikaner zu Amerikanern machen. Was sind nun diese kontinuierlichen Eigenarten, die alle Deutschen verbinden? Worin besteht die Besonderheit der deutschen Kultur und ihrer Organisation? Bei der Fahrt durch Deutschland bemerkt man zuallererst die ordentliche und präzise Aufteilung von Raum, Land und Gebäuden: Stadt wie Land sind in ordentliche, geometrische Parzellen aufgeteilt, die von einer Vielzahl von Mauern, Zäunen und Toren bezeichnet werden. Jeder Fleck Boden scheint von einer definitiven Grenze umschlossen, die ihn klar von allen anliegenden Grundstücken scheidet. In den Kleinstädten sind die einzelnen Häuser durch regelrechte Mauern voneinander getrennt, und innerhalb dieser ummauerten Liegenschaften befinden sich wiederum Mauern, die den Vorgarten vom Haus und dieses wieder vom Hof trennen – und das Haus selbst erscheint durch seine Rolläden als Festung. Aber auch 139 innerhalb dieses schon so wohlbefestigten Hauses teilen normalerweise nochmals massive Türen einen Raum vom anderen. Diese Aufteilung des Raums wird von einer ebenso unmissverständlichen Reihe von Regeln und Übereinkünften flankiert, die die Benutzung dieses Raums regeln. Überall scheinen Hinweis- und Verbotsschilder aufgestellt zu sein; eins der ersten Wörter, das jeder Ausländer in Deutschland lernt, ist “verboten”. Appartementhäuser sind mit Verhaltensanweisungen für Bewohner wie Besucher bestückt; Parks und Arbeitsplätze haben ihre Benutzungsordnung. Sogar die Kinderspielplätze, die sowieso schon von Zäunen und Toren markiert sind, haben eine Benutzungsordnung, die genau bestimmt, Kinder welchen Alters auf ihnen spielen dürfen, was sie auf ihnen spielen dürfen, von wann bis wann sie spielen dürfen. Wo man in Deutschland hinkommt, irgendjemand war immer schon da, um ein Schild aufzuhängen. Dieses Grundmuster der Aufstellung und Zuordnung von Land und Raum mit Hilfe besonderer Verordnungen zeigt sich auch im Umgang mit der Zeit. Wie jeder Raum von einem besonderen Regelwerk peinlich genau aufgeteilt und beherrscht wird, so wird auch die Zeit von zahlreichen und unterschiedlichen Zeitplänen strikt eingeteilt. Es gibt genaue Arbeitszeiten, Schulstunden und ganz bestimmte Zeiten, zu denen in den Restaurants ganz bestimmte Gerichte zu haben sind. Es gibt sogar generelle Leitpläne (wie etwa das Ladenschlussgesetz), die wiederum die einzelnen Zeitpläne koordinieren. Die Deutschen halten Essenszeiten fast so exakt ein wie U-Bahn-Fahrpläne. Zeit und Raum sind in Deutschland vom Wert strikter Ordnung durchdrungen. Dieses Ideal zieht sich quer durch die deutschen Wohnungen und Häuser, die Geschäfte, die Regierung, die Freizeit, die Schule. Die Hausfrau will ihr Heim und ihre Kinder in Ordnung halten; der Arbeitsplatz in der Fabrik hat in Ordnung zu sein. Die Klasse des Lehrers, die ganze Lebensführung des Menschen hat in Ordnung zu sein. Das Konzept der Ordnung ist sowohl Teil des stereotypen Bilds, das Ausländer von Deutschland haben, als auch Teil ihres Erstaunens über die Deutschen. Diese Erzwingung der Ordnung von Zeit und Raum ist eine der größten Leistungen der deutschen Gesellschaft. Sie hat die Bundesrepublik zu einer der 140 führenden Industrienationen gemacht, aber gleichzeitig der deutschen Psyche und Persönlichkeit eine ungeheure Starre aufgezwungen. Textarbeit 1. Diskutieren Sie zuerst in Gruppen und dann im Plenum. 1. Die Menschen eines Volkes sind vom Nationalcharakter ihres Volkes geprägt. Stimmen Sie dieser Behauptung zu? 2. Kulturelles Erbe oder soziale Gegenwart – lassen sich beide Bereiche trennen? Wenn ja, welcher Bereich prägt den Menschen stärker? 3. Das Interesse am Nationalcharakter müsste viel stärker sein. Stimmen Sie dieser Forderung zu? 2. Welche inhaltlichen Zusammenhänge bestehen zwischen den Abschnitten? 3. Berichten, Zusammenfassen, Stellungnehmen. (Wählen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus, und bereiten Sie sich in Gruppen vor.) 1. Das “Freigeben” bzw. das “Freiwerden” ist für die ältere bzw. die jüngere Generation (nicht) leicht. – Nehmen Sie Stellung. 2. Junge Menschen brauchen (keine) Vorbilder. – Was meinen Sie? 3. Jedes Land, jede Gesellschaft, jedes System kämpft auf seine Weise mit der Lösung des Problems der Gleichberechtigung von Mann und Frau. – Berichten Sie, wie die Situation der Frau in Ihrer Heimat ist und was zur Lösung des Problems getan wird. 4. Schreiben Sie Ihre Stellungnahme zu den u.g. Aussagen über die Deutschen. Deutsche über die Deutschen Die Deutschen sind im Durchschnitt rechtliche, biedere Menschen, aber von Originalität, Erfindung, Charakter, Einheit und Ausführung eines Kunstwerks haben sie nicht den mindesten Begriff. Das heißt mit einem Worte: Sie haben keinen Geschmack. 141 Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute! Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. Ei, so habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja euch belehren zu lassen und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen! Aber denkt nur nicht immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und Idee wäre. Es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) Die Deutschen mit ihrer “ewigen Ordnung” kann ich nicht als das Ideal der Schöpfung ansehen. Es ist gerade gut genug für den Alltag und die Langeweile. In Liebenswürdigkeit und der ganzen Welt der Formen stehen wir jammervoll zurück. Man kann doch nicht nach Deutschland kommen, bloß um im Lande Luthers oder Goethes oder Friedrichs des Großen oder Bismarcks zu leben. Theodor Fontane (1819–1889) Ein Deutscher ist großer Dinge fähig, aber es ist unwahrscheinlich, daß er sie tut. Friedrich Nietzsche (1844–1900) WER WAR EULENSPIEGEL? Till Eulenspiegel ist eine erfundene Figur Hermann Bote (1467–1520) ist der Verfasser des Eulenspiegelbuches. So wie wir die Figur des Till Eulenspiegel kennen, ist sie von dem Braunschweiger Stadtschreiber Bote erfunden worden. Der aber hat sein Leben lang aus Furcht, seinen Posten zu verlieren, verheimlicht, dass er das Buch geschrieben hat. Erst über 142 400 Jahre später hat man herausgefunden, dass eines der ganz berühmten Bücher der Weltliteratur von diesem Mann stammt. In 96 “Historien” (also einzelnen Geschichten) hat er das Leben Till Eulenspiegels von der Taufe bis zum Tode erzählt, und er nannte das Ganze Ein kurzweiliges Buch von Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig – Wie er sein Leben vollbracht hat. In der Vorrede zu diesen Geschichten schreibt Bote, dass er anderen zuliebe aufgeschrieben habe, “was ein durchtriebener und listiger Bauernsohn getan und getrieben hat in deutschen Landen”. Was war das für eine Figur, dieser Till? Er ist ein Schalk, und dieses Wort bedeutete damals zweierlei: ein boshafter, hinterlistiger Kerl – und ein lustiger, zu Streichen aufgelegter Bursche. Und wirklich, er ist beides! In manchen Geschichten ist er richtig böse und gemein und treibt es mit den Menschen so arg, dass sie allen Grund haben, ihn zu bestrafen. In anderen Geschichten wiederum legt er diejenigen herein, die selber boshaft, dumm und umgerecht sind. Auf jeden Fall gehörte er zu den Ärmsten unter den Menschen. Er hatte keinen Beruf erlernt, war außerdem faul und konnte mit dem wenigen Geld, das er hatte, nicht umgehen. Er gehörte zu den “Fahrensleuten” oder Landstreichern. Er hatte einige “Künste” und Tricks gelernt wie das Seiltanzen – und er war ganz gewiss schlau, so dass es ihm gelang, sich immer wieder durchzuschlagen und weit im Lande herumzukommen. Wo ist Till überall gewesen? Wenn man den Geschichten glauben kann, dann hat er sich in ganz Deutschland und halb Europa herumgetrieben: von Braunschweig nach Frankfurt, von dort nach Polen, dann nach Lüneburg, Marburg und Prag, von dort über Nürnberg bis nach Rom und wieder zurück nach Hildesheim. Sogar in Belgien ist er gewesen. Weite Reisen also – und natürlich fast alles zu Fuß. Sicher ist er auch manchmal geritten und auf einem Pferdefuhrwerk gefahren; auch hat er sich einmal in Hamburg auf ein Schiff begeben. Doch die meisten 143 Strecken reiste er auf Schusters Rappen. Auf der Landkarte kann man einige der vielen Strecken verfolgen. Oft ist er mit anderen fahrenden Gesellen, mit Handwerksburschen und Soldaten gemeinsam gereist, manchmal allein. Und durchgeschlagen hat er sich mit Gelegenheitsarbeiten, Bettelei und, wie wir ja wissen, mit Geld, das er sich durch seine Streiche “verdiente”. Was wollte der Dichter mit seinem Eulenspiegel bewirken? Hermann Bote wollte die Menschen unterhalten und belehren. Er wollte ihnen zeigen: Seht da, so eitel und habgierig, so faul und herrschsüchtig, so dumm und rachsüchtig, so scheinheilig und abergläubisch können die Menschen sein! Und wer die Geschichten las, dem wurde von Eulenspiegel ein Spiegel vorgehalten, in dem man sich selbst wiedererkennen konnte. Und andere konnten darüber lachen; denn Eulenspiegel gelang es immer, seine Gegenspieler hereinzulegen und lächerlich zu machen. Und was waren das alles für Menschen, mit denen Eulenspiegel zusammenkam! Keiner war vor ihm sicher, die Fürsten nicht und nicht die Handwerksmeister, die Gauner und Bettler so wenig wie die Soldaten, und selbst die Priester und Professoren wurden von ihm übertrumpft. Alle prellte er, und fast immer ging er als Sieger hervor. Hat Eulenspiegel wirklich gelebt? Ja, er war nicht nur eine ausgedachte Figur des Dichters Hermann Bote, es gab ihn wirklich. Man weiß allerdings nichts von ihm selbst, sondern nur das, was uns in den Geschichten erzählt wird. Doch es muss damals noch vieles von diesem Burschen mündlich erzählt worden sein, und manches war auch über ihn aufgeschrieben worden. Seinen Namen hat es auch wirklich gegeben. Man rätselt bis heute, was er wohl bedeutet. Die einen sagen, er stamme von “Eule” (= Dummkopf) und “Spiegel” ab, und das heiße dann so viel wie “Spiegel der Dummköpfe”. Die anderen meinen, er komme von “Ulen” (= fegen, lecken) und “den Spiegel” (= Hinterteil, Hintern) her; ihr könnt euch denken, was das dann bedeutete. Die dritten sind davon überzeugt, dass es einfach ein Familienname war, den es 144 damals gab. Eine Frau Ulenspiegel steht tatsächlich mit Namen in den Braunschweiger Urkunden. Wie auch immer – dass Eulenspiegel den Dummköpfen den Spiegel vorgehalten hat, stimmt ja wirklich. Und noch 400 Jahre später lesen wir die Geschichten gern Das Volksbuch von Eulenspiegel hat bis heute in der ganzen Welt Erfolg; es ist in fast alle großen Sprachen übersetzt worden – ein richtiger Bestseller. Obwohl das Buch nicht für Kinder geschrieben worden ist (viele der Geschichten sind selbst für Erwachsene sehr schwer zu verstehen), hat es immer wieder Nacherzählungen einiger der Eulenspiegel-Streiche für Kinder gegeben. Am bekanntesten sind heute wohl die von Erich Kästner. Heute gibt es rund 150 verschiedene Eulenspiegel-Ausgaben. Und immer wieder sind Eulenspiegelgeschichten auch in der Schule behandelt worden, weil eben manche von ihnen sehr witzig und spannend sind. Sie sind weitererzählt und umerzählt worden, und es sind dabei auch ganz neue entstanden. Hermann Bote Die 1. Historie sagt, wie Till Eulenspiegel geboren, dreimal an einem Tage getauft wurde und wer seine Taufpaten waren. Bei dem Wald, Elm genannt, im Dorf Kneitlingen im Sachsenland, wurde Eulenspiegel geboren. Sein Vater hieß Claus Eulenspiegel, seine Mutter Ann Wibcken. Als sie des Kindes genas, schickten sie es in das Dorf Ampleben zur Taufe und ließen es nennen Till Eulenspiegel. Till von Uetzen, der Burgherr von Ampleben, war sein Taufpate. Ampleben ist das Schloß, das die Magdeburger vor etwa 50 Jahren mit Hilfe anderer Städte als ein böses Raubschloß zerstörten. Die Kirche und das Dorf dabei ist nunmehr im Besitze des würdigen Abtes von Sankt Ägidien, Arnolf Pfaffenmeier. Als nun Eulenspiegel getauft war und sie das Kind wieder nach Kneitlingen tragen wollten, da wollte die Taufpatin, die das Kind trug, eilig über einen Steg gehen, der zwischen Kneitlingen und Ampleben über einen Bach führt. Und sie hatten nach der Kindtaufe zu viel Bier getrunken (denn dort herrscht die Gewohnheit, daß man 145 die Kinder nach der Taufe in das Bierhaus trägt, sie vertrinkt und fröhlich ist; das mag dann der Vater des Kindes bezahlen). Also fiel die Patin des Kindes von dem Steg in die Lache und besudelte sich und das Kind so jämmerlich, daß das Kind fast erstickt wäre. Da halfen die anderen Frauen der Badmuhme mit dem Kind wieder heraus, gingen heim in ihr Dorf, wuschen das Kind in einem Kessel und machten es wieder sauber und schön. So wurde Eulenspiegel an einem Tage dreimal getauft; einmal in der Taufe, einmal in der schmutzigen Lache und einmal im Kessel mit warmem Wasser. Erläuterungen zum Text: Sachsenland: Niedersachsen Vertrinken: auf das Wohl des Kindes trinken Badmuhme: Taufpatin Textarbeit 1. Nehmen Sie eine Landkarte und notieren Sie darauf alle Orte, die mit Till Eulenspiegel verbunden sind. 2. Wer war Eulenspiegel? – Schreiben Sie eine Zusammenfassung zu diesen Materialien. 146 Es war einmal… DIE BRÜDER GRIMM Mit diesen Wörtern beginnen viele Märchen. Kinder hören Sie gern, wenn sie noch klein sind, und greifen selbst zum Märchenbuch, wenn sie lesen können. Sie finden ihre Geschichten vom “Rotkäppchen”, “Dornröschen” oder “Schneewittchen” in den “Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. Die beiden deutschen Germanisten Jacob und Wilhelm Grimm hatten sechs Jahre lang Märchen gesammelt, aufgeschrieben und 1812 den ersten Band ihrer Märchensammlung herausgegeben. Im Vorwort schrieben sie: “Wenig Bücher sind mit solcher Lust entstanden.” Wir können heute hinzufügen: Wenig Bücher haben Kindern in aller Welt so viel Freude bereitet, denn inzwischen wurden die Märchenbücher der Brüder Grimm in 140 Sprachen übersetzt. Die Krönung des Lebenswerkes der beiden Germanisten ist jedoch ihre Arbeit an der deutschen Sprache. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, den Wortschatz des Deutschen von Luther bis Goethe zu erschließen. Als Jacob Grimm 1863 vier Jahre nach seinem Bruder starb, waren alle Wörter bis zum Buchstaben F erfasst. Erst hundert Jahre später wurde dieses Werk, das “Deutsche Wörterbuch”, von Wissenschaftlern der Akademien Berlin und Göttingen mit dem Band 32 abgeschlossen. Erläuterungen zum Text: Als Märchen bezeichnet man phantasievolle Erzählungen für Kinder, die früher im Volk mündlich weitergegeben wurden. Zu den Volksmärchen zählen z.B. die orientalischen Märchen „Tausendundeine Nacht”. Kunstmärchen schrieben z.B. Wilhelm Hauff, Eduard von Mörike und Christian Andersen. Die Germanistik ist die Wissenschaft von den germanischen Sprachen, der Kunst und Kultur der Germanen; im engeren Sinn von der deutschen Sprache und Literatur. Der Höhepunkt einer Arbeit oder eines Lebenswerkes wird gern als Krönung bezeichnet. 147 Martin Luther (1483-1546), der deutsche Reformator, hat mit seiner Bibelübersetzung wesentlich zur Schaffung einer deutschen Hochsprache beigetragen. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war als Dichter der deutschen Klassik ein Meister der deutschen Sprache. Textarbeit 1. Geben Sie einige Gedanken wieder, und äußern Sie Ihre Aussagen: - zur Überschrift “Es war einmal…” - zur Rolle des Märchens - zur Märchensammlung der Brüder Grimm - zum Lebenswerk der beiden Germanisten. 2. Wählen Sie ein Märchen von Gebrüdern Grimm, und versuchen Sie es zu interpretieren bzw. zu analysieren. Bedienen Sie sich der Arbeitshilfen (Teil III). 148 Der Vater der deutschen Rechtschreibung KONRAD DUDEN “Deutsche Sprache - schwere Sprache”, meinen nicht nur deutschlernende Ausländer. Sie denken wohl vor allem an die Grammatik und die Orthographie. Kopfzerbrechen bereiten z.B. die Artikel, die Getrenntoder Zusammenschreibung, die Flexionsendungen und was es da noch alles an Schwierigkeiten gibt. Auskunft darüber und über alle anderen Fragen zur deutschen Grammatik und Orthographie gibt der Duden, das Nachschlagewerk für die deutsche Sprache. Es war vor mehr als hundert Jahren, als Konrad Duden, Direktor eines Thüringer Gymnasiums, Ordnung in die deutsche Rechtschreibung bringen wollte. Das war nötig, denn es gab in Deutschland keine einheitlichen Regeln und Gesetze für die Sprache. 1880 hatte er es geschafft. Das Bibliographische Institut Leipzig veröffentlichte das erste Wörterbuch Konrad Dudens mit 27 000 Stichwörtern. Damit war die Grundlage für eine einheitliche deutsche Rechtschreibung geschaffen. Konrad Duden gilt als ihr Vater. Die 20. Auflage mit 110 000 Stichwörtern ist nach der Wiedervereinigung die erste gesamtdeutsche Ausgabe, denn nach der Teilung Deutschlands 1945 gab es in Mannheim und in Leipzig je eine Duden-Redaktion. Der Duden steht heute in nahezu allen Haushalten. Niemand verliert sein Gesicht - ob Professor oder Student, ob Sekretärin, Schüler oder Schriftsteller, - wenn er den Duden zur Hand nimmt. Konrad Duden (1829–1911), Gymnasiallehrer in Soest, Schleiz und Hersfeld, wirkte mit seinem „Vollständigen orthographischen Wörterbuch der deutschen Sprache“ (1880) wegweisend für eine einheitliche deutsche Rechtschreibung. (Aus: dtv-Lexikon in 20 Bänden, B. 4, S. 257) 149 Erläuterungen zum Text: Kopfzerbrechen bereitet uns etwas, das sehr schwierig ist, über das wir angestrengt nachdenken müssen. Das Bibliographische Institut ist ein Verlag, der 1826 in Gotha/Thüringen gegründet, später nach Leipzig verlegt wurde und 1953 auch in Mannheim entstand. Er verlegt Lexika, Wörterbücher und Nachschlagewerke sowie wissenschaftliche Lehrwerke. Sein Gesicht verliert (Redewendung), wer sein Ansehen, seinen Respekt einbüßt. Textarbeit 1. Hier sind einige Sätze, die auf sprachlichen Missverständnissen beruhen. Können Sie erklären, worin das Missverständnis besteht? Schlagen Sie die Wortbedeutungen in einem Duden-Wörterbuch nach. Arzt: “Sie müssen die Medizin aber immer in einem Zug nehmen.” Patient: ”Und wer bezahlt die Fahrkarte?” “Verzeihen Sie, Sie schulden mir 50 Mark.” “Ist schon verziehen.” “Das ist ja ein toller Ring, was hat der gekostet?” “Ein Jahr und sechs Monate.” “Hat dein Hund einen Stammbaum?” “Ja, aber nur einen sehr kleinen.” Richter: “Gegen das Urteil können Sie Einspruch erheben oder darauf verzichten.” Angeklagter: “Dann verzichte ich lieber auf das Urteil, Herr Richter.” 2. „Deutsche Sprache – schwere Sprache“: Nehmen Sie Stellung zu dieser Aussage und schreiben Sie eine kurze Erörterung dazu. 150 “FRIEDENSDOLMETSCH ALLER WELT” (G. J. J. Sauerwein) Von Irena Tumavičiūtė Heute gibt es Sauerwein-Straßen in der Vaterstadt des Dichters Gronau, in Hannover, im litauischen Klaipėda und im norwegischen Dovre. 1990 fand in Gronau das 1. Internationale SauerweinSymposion statt (mit dem damaligen nieder- sächsischen Ministerpräsidenten Dr.Gerhard Schröder als Schirmherrn). 1996 folgte ein weiteres in Gronau und das dritte Symposium 2000 in Dovre. Trotz umfangreicher Publikationen im Anschluss an die Symposien und des Engagements für den Dichter Georg Sauerwein, vor allem durch den langjährigen Vorsitzenden der DeutschLitauischen Gesellschaft (Hannover) Hans Masalskis und durch das Museum in Gronau, ist der Name Georg Sauerwein in keinem deutschen Lexikon zu finden. Als Litauen vor zwölf Jahren von der singenden Revolution erfasst wurde, erklangen auch die Strophen der 1879 von Georg Sauerwein in schönstem Litauisch gedichteten Verse “Als Litauer sind wir geboren”. Seitdem erklingt dieses Lied jeden Abend als Sendeschluss-Melodie im Litauischen Rundfunk und ist sozusagen zur zweiten Nationalhymne geworden. Nur die wenigsten “Sänger” und Hörer wussten damals, dass der Verfasser ein deutscher Publizist, Dichter und ein Sprachgenie, das mehr als 60 Sprachen beherrschte und Gedichte in 30 Sprachen schrieb, war: Dr.Georg Sauerwein. Georg Julius Justus Sauerwein wurde am 15. Januar 1931 in der Familie eines Pastors und Gymnasiallehrers in Hannover geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Universität Göttingen natur- und geisteswissenschaftliche Fächer, mit besonderem Eifer widmete er sich aber den orientalischen Sprachen. 1851 ging er nach England, in der Hoffnung als Sprachkenner eine gute Stellung in Indien zu bekommen. Durch die Bekanntschaft mit Lady Llanover verzichtete er jedoch auf jegliche Karriere und machte sich zum Anwalt der kleineren Sprachen und derjenigen, die sie sprachen. Als Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Göttingen las Sauerwein Bücher lieber anstatt sie zu katalogisieren. 151 Bald nachdem er in England mit der britischen Bibelgesellschaft in Berührung gekommen war und er Probeübersetzungen gemacht hatte, wurden Bibelübersetzungen zu seiner lebenslangen Brotarbeit (er übersetzte bzw. redigierte die Bibel in 21 Sprachen). Seiner Freiheit und Unabhängigkeit zuliebe verzichtet er auf einen längeren Aufenthalt in London und damit auch auf ein gutes Gehalt. Um sein Leben und sein außerordentliches Sprachtalent rankten sich zahlreiche Anekdoten. So wurde gesagt, dass er selbst im Grab noch eine Sprache gelernt habe. Er hat nie geheiratet, hatte keinen festen Wohnsitz, war stets mit einigen Kisten voll Bücher unterwegs. Seine gesamte Freizeit widmete er den Interessen kleinerer Völker – Bulgaren, Armenier, Finnen, um nur einige zu nennen. Besondere Verdienste erwarb er sich aber bei den Sorben in der Lausitz und bei den Litauern im ehemaligen Preußisch-Litauen (Kleinlitauen). Für die Sorben war er Juro Surowin, für die Litauer Jurgis Zauerveinas. Nach 1873, als im Deutschen Reich der Schulunterricht in den Sprachen der Minderheiten verboten war, war die Existenz der Litauer als Nation überhaupt bedroht. In Russisch-Litauen waren bereits seit 1864 litauische Druckerzeugnisse in lateinischer Schrift verboten. Zahlreiche deutsche Autoren sprachen vom baldigen Untergang der litauischen Sprache. Und unter den Litauern selbst fehlte es an Menschen, die es gewagt hätten, sich gegen die Germanisierung offen zu äußern und das nationale Selbstbewußtsein der Litauer zu wecken. Eine Zeitlang war Sauerwein der einzige, der sich mit beeindruckendem poetischem Wort, mit seinen publizistischen Talenten und seinen diplomatischen Fähigkeiten für die Erhaltung der litauischen Sprache einsetzte. Sauerwein versuchte auch als Abgeordneter im Preußischen Landtag bzw. Reichstag für die Litauer aufzutreten. Die Anfeindungen seiner Gegner, die ihn öffentlich sogar des Landesverrates bezichtigten, aber waren zu stark, als dass er hätte gewählt werden können. Zur Rettung der litauischen Sprache verfasste er im Namen der Litauer Petitionen an den König mit bis zu 30.000 Unterschriften. 152 Mit unglaublichem Engagement setzte er sich auch für die sozialen Probleme der Litauer ein. So enthält die Serie seiner litauischen Publikationen aus den Jahren 1884 und 1885 “Über die wahren Aufgaben der deutschen Kultur am Nemunas”, die er vorwiegend aus dem Ausland zusandte, programmatische Forderungen sozialen und kulturellen Charakters an die deutsche Regierung. Dabei handelt es sich um wohlüberlegte Gedanken eines hochgebildeten Publizisten und Politikers, der sich schon seit langem stark für das Überleben und die Erhaltung der Kulturen kleiner Völker engagiert hatte und der von einem “einigen Deutschland” geträumt hatte, “Drin Gedank und lebendiger Glaube / Nimmer erstarre zur Form, / Die die Geister schablonenhaft stempelt”. Als dies nicht passierte, floh er 1899 “wie Lott aus Sodom” für immer aus seiner Heimat. In der litauischen Kulturgeschichte hat sich Sauerwein einen würdigen Platz als größter Vertreter des deutschen Geistes gesichert. Auch in der jüngsten Vergangenheit, als Litauen auf der europäischen Karte nicht mehr existierte, zählte er zu den Geistesgrößen, in deren Schriften und Haltung zahlreiche Litauer ein Vorbild sahen. Sauerwein selbst hat seine Berufung in wunderbare Worte gefasst: “Allen möcht’ ich alles sein Möcht’ der ganzen Menschheit weih’n Friedensdolmetsch aller Welt Die der Haß gefangen hält.” (Aus: Baltische Rundschau, Nr.12; 2000) Textarbeit Schreiben Sie ein Interview mit dem Koordinator einer Veranstaltung (z.B. einer Ausstellung), indem Sie Informationen und Stichworte dieses Textes verwenden. 153 Die Wege der Quadriga DAS BRANDENBURGER TOR Das Brandenburger Tor ist als Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt weltweit bekannt. Es wurde als Berliner Stadttor 1788/91 gebaut. Drei Jahre später erhielt es die Quadriga, eine Plastik aus Metall, die nach den Plänen des Architekten und Baumeisters Schadow in Potsdam gegossen und per Schiff nach Berlin transportiert worden war. Ihre zweite Fahrt machte die Quadriga 1806 unfreiwillig, als sie Napoleon als Kriegsbeute nach Paris bringen ließ. Nach Napoleons Niderlage kehrte Viktoria mit ihrem Siegeswagen nach Berlin zurück und nahm ihren Platz wieder ein. Im Zweiten Weltkrieg wurde von der Quadriga in den Trümmern Berlins nur noch der Kopf eines ihrer Pferde gefunden, das Brandenburger Tor war völlig zerstört. Erst 1958 hatte das wiederaufgebaute Berliner Wahrzeichen seine “Krone” wieder. Die Figuren wurden nach alten Plänen und Fotos neu gestaltet. Drei Jahrzehnte später musste die Quadriga erneut von ihrem Sockel geholt werden. Zum Jahreswechsel 1989/90, als die Deutschen ihre Wiedervereinigung feierten, war sie aus Freude und Übermut so stark beschädigt worden, dass sie völlig restauriert werden musste. Seit der 200-Jahrfeier des Brandenburger Tores 1991 steht Viktoria wieder auf ihrem Wagen mit den vier Pferden und wird hoffentlich ihre Fahrt noch Jahrhunderte friedlich fortsetzen können. Die Quadriga war ein offener, von vier Pferden gezogener Wagen, in dem die römischen Feldherren fuhren. Er diente bei den Griechen und Römern auch als Rennwagen. Zur Berliner Quadriga gehört die römische Siegesgöttin Viktoria. Das Brandenburger Tor ist ein 62 Meter breites und zwanzig Meter hohes Bauwerk. Es wird von der fünf Meter hohen Quadriga gekrönt. In westlicher Richtung führt es zum Reichstagsgebäude und zur Siegessäule, die östliche Richtung weist die Straße Unter den Linden. 154 Der französische Kaiser Napoleon I. hatte auf seinem Feldzug nach Osten auch Berlin besetzt, das er nach seiner Niederlage (Völkerschlacht bei Leipzig, 1813) wieder räumen musste. Das in einem Krieg unrechtmäßig geraubte Gut – meist Kunstwerke und andere Kulturgüter – bezeichnet man als Kriegsbeute. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Deutschland in die BRD und die DDR geteilt und erst am 3.10.1990 wiedervereinigt. Von Übermut spricht man bei zu großer Fröhlichkeit und Ausgelassenheit, die nicht ohne Schaden ausgeht. Deswegen heißt es im Volksmund: Übermut tut selten gut. Textarbeit 1. Geben Sie einige Ereignisse Brandenburger Tores wieder. aus der Geschichte des 2. So wie Berlin haben auch andere Städte ihre Wahrzeichen.Welche Wahrzeichen kennen Sie noch? Führen Sie solche Symbole und Informationen darüber an. 155 Der Weg ins preußische Arkadien Der Boulevard UNTER DEN LINDEN wird 350 Jahre alt Von Andrea Hilgenstock Berlin – 350 Jahre ist es her, da ordnete Kurfürst Friedrich Wilhelm die “Pflanzung der Nuß- und Lindenbeume zu Anrichtung einer Gallerie von der Hundebrücke biß an den Thiergarten” an. Die Straße Unter den Linden war geboren. Was heute an gleicher Stelle an Bäumen zu sehen ist, ist freilich nicht ganz so alt: Nach dem Zweiten Weltkrieg mußte erst wieder aufgeforstert werden. Den Charme von einst kann der Besucher der Staatsbibliothek Unter den Linden jetzt mit der Realität draußen vor der Tür vergleichen. Im wilhelminischen Baukoloß von 1914, der eine der größten Kartenabteilungen Europas beherbergt, fordert die Ausstellung “Vom kurfürstlichen Reitweg zur hauptstädtischen Allee” zum Vergleich auf. Exponate aus den Beständen illustrieren das Gesicht der Lindenallee im Wandel der Zeit. Anhand von Karten, Stadtplänen, Fotos und Dokumenten zeigt eine kleine Schau im Vestibül der Bibliothek vor allem eines: Quadratisch, praktisch, bauklotzig wurde in Berlin schon früher gern geplant. Die erste Ansicht der Linden zeichnete Johann Stridbeck 1691. Auch die bekannte Lindenrolle, die kolorierte Lithographie eines Anonymus von 1850, ist zu studieren. Ebenso eine Glaslaterne aus dem gleichen Jahr – ähnliche stehen noch heute auf dem Prachtboulevard. Unter den Linden: Das war die Einzugsstraße der siegreichen preußischen Heere nach den Kriegen 1815, 1864, 1866 und 1871. Paradestraße der Garden zu allen erdenklichen Fest- und Feiertagen. Promenade für die mehr oder weniger vornehme Welt. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein dienten die Gebäude hier hauptsächlich dem Wohnen, stand das adelige Palais gleich neben dem Haus des Branntweinbrenners. Blücher residierte am Pariser Platz. Auch der Herzog von Cumberland, später König von Hannover, hatte sein Palais Unter den Linden. Die Militärbehörden waren vertreten und die preußische Ministerialbürokratie. Hotels, Banken, Läden, Konditoreien wie das Café Kranzler, Treffpunkt der Gardeleutnants und Dandys, ergänzten das Bild. 156 Vom ehemaligen Schloßbezirk bis zum Brandenburger Tor, wo der historisierende Bau des Hotels Adlon an die Vergangenheit anknüpft, erstreckte sich die Triumphstraße der preußischen Könige. Heute strömen in unmittelbarer Nähe des künftigen Deutschen Bundestages die Touristen. Die Bepflanzung mit Lindenbäumen, die am Pariser Platz endet, nimmt dabei nicht die gesamte Länge der Straße in Anspruch. Sie beginnt gleich hinter dem Reiterdenkmal König Friedrichs II. von Christian Daniel Rauch, das 1851 feierlich enthüllt wurde. Eduard Gaertner hat die Stadt und ihre Prachtstraße minuziös im Bild festgehalten und die bis heute anhaltende Erinnerung an ein preußisches Arkadien geschaffen. Friedrich der Große auf seinem Sockel, vom Verkehr umtost und von Abgasen eingehüllt, läßt inzwischen seinen Blick an gleicher Stelle wieder in die Ferne schweifen. (Nach: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 29.8.1997) Textarbeit Finden Sie ein Bild/Photo mit der heutigen Straße Unter den Linden und beschreiben Sie sie. 157 Der Mythos ist verblasst Die LORELEY soll sich möglichst natürlich präsentieren Von Margit Fehlinger Sie ist grau, faltig und steinalt, doch ihre Anziehungskraft scheint ungebrochen: Die Loreley, ein Schieferfelsen, der bei St.Goarshausen 132 Meter aus dem Rhein ragt, lockt jedes Jahr Hunderttausende von Besuchern aus aller Welt. Aber Mythos und Romantik, die sie suchen, haben sich längst in den Folgen der modernen Zivilisation verflüchtigt. Spätestens seit der Romantik geht ihr Bild um die Welt – mal als “femme fatale”, mal als “Femme fragile”, als hingebungsvolle Liebende oder als dämonische Zauberin. Die Geschichte der Loreley, der Heinrich Heine mit seiner Ballade (“Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin”) zu literarischem Weltruf verhalf und die von Friedrich Silcher vertont zu einem Hit der deutschen Volkslieder avancierte, knüpft an den uralten Mythos der Wasserfrauen an. Und Clemens Brentanos Zauberin Lore Lei mit Wohnsitz in Bacharach, die er in seinem Roman “Godwi oder das steinerne Bild der Mutter” beschreibt, hat viele Schwestern – Medea, Melusine, die Sirenen, Undine und die kleine Meerjungfrau. Alte Sagen ranken sich um den Rheinfelsen, dessen dreifaches Echo die Fantasie der Menschen beflügelte, bis es nach dem Tunnelbau durch den Schieferstein verstummte. Zwerge sollen den hohlen Felsen bewohnt haben, und der Nibelungenschatz wurde hier vermutet. Doch verbürgt ist nur die Gefahr des Rheins, der sich bei der Loreley auf ein Drittel seiner gewohnten Breite verengt und dessen Strudel manches Schifferboot zum Kentern brachte, bis auch hier die moderne Technik Abhilfe schuf: Der Rhein, für die Schifffahrt nicht mehr als eine Wasserstraße, wurde ausgebaggert und vertieft und seine Fahrrinne verbreitert. Dass zuvor so viele Fischerboote am LoreleySchiefer zerschellten, wurde nicht den Tücken des Stroms an dieser Stelle zugeschrieben, sondern jener üppigen Blondine auf dem Felsen, deren Gesang die Sinne der Männer betört hatte. Der Rhein galt jahrhundertelang als Projektionsfläche für ein idyllisierendes Naturverständnis – so lange, bis er schließlich dessen Opfer wurde. Denn der organisierte Massentourismus ließ Zauber und Romantik des einmalig schönen Rheintals zwischen Bingen und Koblenz verblassen. 158 So kitschig wurde zuletzt der Mythos der Loreley verramscht, dass St.Goarshausens Stadtpolitiker Anfang der 80er Jahre die Notbremse zogen. Das Plateau des Loreleyfelsens wurde entrümpelt: Fernröhre, Erzählautomaten, Telefonhäuschen und Kiosk wichen einer behutsamen Renatuierung der Aussichtsterrasse hoch über dem Rhein. Damit folgte die Gemeinde den Wünschen vieler Bürger, die man in einem Wettbewerb um Vorschläge gebeten hatte, wie die Loreley künftig wirkungsvoll zu präsentieren sei. Die Gestaltungsempfehlungen reichten von einer gläsernen Harfe bis zu Goldhaaren am Felsen, doch durchgesetzt hatten sich schließlich jene, die dringend geraten hatten, die Loreley zu lassen wie sie ist. Nur die paar Piktogramme, von der Künstlerin Silvia Beck in den Stein gemeißelt, spielen auf die vielen Legenden an. (Aus: Frankfurter Rundschau, 22.04.2000) Textarbeit Erzählen Sie eine Sage, die mit anderen bekannten Orten deutschsprachiger Länder oder Ihrer Heimat verbunden sind. 159 Das Haremskonfekt Eine Ausstellung zur Geschichte des MARZIPANS in Lübeck Von Franz Lerchenmüller Um keine Irrtümer aufkommen zu lassen: Nein, die Lübecker haben das Marzipan nicht erfunden. Und ein zweites Mal nein: Es entstand auch nicht während einer Belagerung, als in höchster Not auf einem gottvergessenen Speicher ausgerechnet noch ein paar Säcke Mandeln und Zucker entdeckt wurden. Und nein, zum dritten Mal: Der Name stammt nicht von “Marcis Panis” ab, “Marcusbrot”, was eine gradlinige Verbindung zu Venedig und seinem Schutzpatron nahegelegt hatte. Die Wahrheit ist, wie immer, ganz anders. Die richtigen Antworten gibt eine Ausstellung im St.-Annen-Museum in Lübeck. “Erfunden” wurde das Marzipan im Vorderen Orient. Dort wuchsen Mandeln, dort gab es Rosenwasser, dort wurde Zucker aus Indien eingeführt – alles, was es braucht, um Marzipan herzustellen: Ein Drittel hiervon, zwei Drittel davon, geschält, gerieben, gemischt, geröstet, geformt – fertig war das “Haremskonfekt”, wie Thomas Mann es nannte. Und damit versüßten sich naschhafte Kalifen schon vor tausend und mehr Jahren tausendundeine Nacht. Der Name dagegen stammt aus dem Mittelmeerraum. “Matzapanen” hießen die Schachteln, in denen kandierte Früchte und Süßigkeiten aus dem Orient nach Venedig geliefert wurden, den Inhalt nannte man bald “Mazaban”. Die Stadt am Lido war die Drehscheibe für die Schätze des Morgenlands. Venedigs Kaufleute brachten erste Marzipanproben, das Rezept und die notwendigen Rohstoffe ins restliche Europa. Es schmeckte aber auch zu köstlich. Die Gourmets mit den großen Portemonnaies konnten sich das nicht entgehen lassen. Schon bald zierten Marzipanschwäne und –rosen die Hochzeitstafeln der Fürsten. Der allmählich einsetzende Handel mit Amerika machte Zucker billiger. In Frankreich entstand ein neuer Beruf: der Zuckerbäcker. Einige dieser “Canditoren” wanderten nach Deutschland aus, an die Höfe. Kneteten Konfekt. Zogen Zucker. Modellierten Marzipan. Anfang des 19. Jahrhunderts dann die Entdeckung: Auch aus Rüben läßt sich Zucker sieden. Orte mit Hafen und großem 160 Hinterland, Zuckerrübenhinterland, machten Punkte. Städte wie Lübeck am Rande Mecklenburgs etwa. Oder Königsberg an der ostpreußischen Küste. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden erste Marzipanfabriken. Man erdachte neue Pappschachteln zum Transport und bunte Etiketten zur Verkaufsförderung. Nach dem 2.Weltkrieg lagen in Lübeck Teile der Innenstadt in Schutt und Asche. Mit der Währungsreform 1948 aber wurden die Röstkessel wieder angeheizt. Und gingen nicht mehr aus. Heute exportieren Lübecker Firmen in über 40 Länder, da ist kein Tourist, der nicht ein süßes Holstentor nach Hause schleppte. (Nach: Berliner Zeitung, 18.12.1998) Textarbeit 1. Schreiben Sie eine Nachschlagewerk. Erläuterung zu Marzipan für ein 2. Überlegen Sie: Könnten Sie auch etwas aus der Geschichte einer Spezialität, eines Souvenirs etc. berichten? 161 FESTE IN STICHWORTEN Zusammengestellt von Werner Jost Text 1 Geburtstag und Namenstag Das Zählen und Gedenken von Geburtstagen ist keineswegs überall und war auch im deutschsprachigen Raum nicht immer üblich. Relevant war es im westlichen Kulturkreis erstmals im römischen Reich, aus religiösen wie auch politischen Gründen. Die römischen Kaiser machten ihre Geburtstage zu öffentlichen Festen mit Zirkusspielen und Paraden. Mit dem Christentum wurde der Geburtstag zunächst einmal vom Namenstag verdrängt, was mit dem zunehmenden Heiligenkult zu tun hat. In der Mitte des 16. Jahrhunderts bestand die Kirche darauf, dass bei der Taufe ausschließlich die Namen von Heiligen vergeben werden sollten. Die Protestanten fühlten sich an diese Forderung nicht gebunden, so dass der Namenstag eine katholische Institution blieb und sich im Gegenzug der Geburtstag als protestantisches Äquivalent wieder herausbildete. Man musste ihn allerdings kennen, und das war nicht in allen sozialen Schichten der Fall. Allgemeine Bedeutung erlangte der Geburtstag wieder im 19. Jahrhundert mit der beginnenden Demokratisierung, wo das urkundlich nachgewiesene Alter Voraussetzung wurde für das aktive Wahlrecht. Daneben spielten mit einem gleichzeitig wachsenden und staatlich geförderten Nationalismus Gedenktage eine immer größere Rolle, beginnend etwa mit dem 100. Geburtstag Goethes. Ab 1871 wurde auch der Geburtstag des Kaisers in diesem Sinne gefeiert. Heute sind die Geburtstage allgegenwärtig, ob bei Freunden oder am Arbeitsplatz, ob in kleiner improvisierter Runde oder mit großem Aufwand gefeiert wird. Das beginnt schon bei den Kindern, für die jedes Jahr auch einen weiteren entscheidenden Schritt ins Leben bedeutet, vom Kindergartenplatz angefangen über den Schuleintritt, die Kommunion und Konfirmation, den Mopedführerschein, das passive Wahlrecht bis hin zur ersehnten Volljährigkeit. 162 Feiern im Jahresrhythmus Die närrische Zeit Kaum ist mit dem Dreikönigstag am 6. Januar die Weihnachtszeit vorbei, beginnt in vielen Teilen Deutschlands die sog. “Närrische Zeit”. Die Mainzer nennen sie Fastnacht, die Münchener Fasching, im Rheinland sagt man Karneval, und in BadenWürttemberg heißt sie Fasnet. Höhepunkt dieser Zeit sind die “Tollen Tage” (Donnerstag bis Faschingsdienstag) vor Aschermittwoch. Danach beginnt nämlich die Fastenzeit, die bis Ostern dauert. Etwas Besonderes ist die Weiberfastnacht in Köln, Düsseldorf, Mainz, Aachen und Bonn. Hier regieren am Donnerstag vor Karnevaldienstag die Frauen. Mit Scheren bewaffnet jagen sie die Männer, um ihnen die Krawatten anzuschneiden, sozusagen das Symbol für ihre Männlichkeit. Am Rosensonntag finden dann die traditionellen Umzüge statt, und in den Straßen wird bei Musik, Wein und Bier gefeiert. In den Büros wird nicht gearbeitet, die Kinder haben schulfrei. Dass die “Fasnet” ursprünglich ein heidnischer Brauch war und die Vertreibung des Winters und seiner dunklen Geister versinnbildlichte, kann man am Fastnachtdienstag beim Rottweiler Narrensprung in der ehemaligen schwäbischen Reichsstadt Rottweil sehen. Hier tragen die Narren furchterregende, kunstvoll geschnitzte Masken und machen während des Umzugs einen Höllenlärm mit Rasseln, Schellen und sonstigen Instrumenten. Oster-Bräuche Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kirchenjahr, Karfreitag der höchste Feiertag. Und wie bei allen anderen religiösen Festtagen gibt es auch beim österlichen Brauchtum die Vermischung christlicher Rituale mit volkstümlichen Bräuchen aus vorchristlicher Zeit. Allerdings wurden die heidnischen Frühlingsriten nicht restlos in die christlichen Traditionen einbezogen, so dass noch heute vor allem in ländlichen Gegenden fast unverfälschte heidnische neben christlichen Bräuchen gepflegt werden. Am Karsamstag endet die Fastenzeit und die Vorbereitungen für das Fest der Auferstehung werden getroffen. Glaube und 163 Aberglaube liegen auch hier wieder dicht beieinander: Das Osterfeuer ist das wohl verbreiteste Ritual dieses Tages oder vielmehr der Nacht. In süddeutschen Gemeinden setzt man vor der Kirche einen Holzstoß in Flammen und hält die Glut bis zum Beginn der Osterliturgie aufrecht, um daran die geweihte Osterkerze zu entzünden. Eine interessante Variante des Osterfeuers gibt es in Westfalen: den Osterräderlauf. Sechs schwere Holzräder werden mit Stroh gestopft und am Ostersonntag auf den nächsten Berg oder Hügel gerollt. Wenn das Osterfeuer brennt, werden die Osterräder angezündet und den Berg hinabgerollt. Erreicht ein Rad das Tal, werden die Kirchenglocken geläutet. Nach alter Meinung brachte das Feuer den Feldern Fruchtbarkeit. Am Ostermorgen stehen die allseits bekannten Hasen samt den von ihnen gelegten und bemalten Eiern im Mittelpunkt des Osterbrauchtums. Die frühesten Belege über den Osterhasen finden sich bei protestantischen Autoren des 17. Jahrhunderts. Doch wie sie überhaupt dorthin gelangten, darüber sind sich die Gelehrten nicht einig. Die einen vermuten, dass das Tier wegen seiner Fruchtbarkeit zum Eierlieferanten wurde, andere sehen im Hasen ein altes germanisches Symbol für Neubeginn, Frühling, Wiederauferstehung. Und die Eier? In der vorösterlichen 40-tägigen Fastenzeit war nicht nur der Genuss von Fleisch, sondern spätestens seit dem 7./8. Jahrhundert auch das Essen von Eiern ausdrücklich untersagt. Dadurch gab es zur Osterzeit ein Übermaß an Eiern. Aus so praktischen Gründen spielten die Eier dann zum Fest eine besondere Rolle. Ostereier waren es allerdings erst, wenn sie gefärbt und verziert zur Weihe getragen wurden. Diese Sitte ist sowohl in der römischen als auch in der bysantischen Kirche zu finden, reicht also weit zurück in die Zeit vor der Spaltung in die West- und Ostkirche im Jahr 1054. Weniger bekannt, dabei von viel schicksalhafterer Bedeutung, ist das Osterwasserschöpfen, das vor allem im Osten und Norden Deutschlands üblich war. Junge Mädchen schöpften bei Sonnenaufgang schweigend mit einem Krug Wasser aus einem fließenden Gewässer. Wurde das Schweigen gebrochen, verlor das Wasser seine segen- und glückbringende Kraft. Das Osterwasser soll gegen Sommersprossen, Fieber, Hautkrankheiten, Schimmel und Ungeziefer geholfen, zugleich die Schönheit der Mädchen und die 164 Honigproduktion der Bienen gefördert und segensreich für den Gemüsegarten und das Vieh im Stall gewirkt haben. 1. Mai Im “Wonnemonat Mai” wird vor allem der Frühlingsbeginn gefeiert. Die Nacht zum 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Besonders Jugendliche auf dem Lande stellen dazu ihre Umgebung “auf den Kopf”: Sie hängen z.B. Hoftüren aus oder lassen Mülltonnen verschwinden oder umwickeln Autos, Laternen, Bäume mit Toilettenpapier. Seit dem 16. Jahrhundert ist als Fruchtbarkeitssymbol der Maibaum belegt, der an vielen Orten aufgestellt wird. Das ist ein an einem Baum oder an einem geschälten Stamm befestigter Kranz, der mit bunten Bändern geschmückt ist. Weihnachten Im 3. Jahrhundert wurde das Geburtsfest des syrischen Sonnengottes am 25. Dezember gefeiert, während die meisten christlichen Gemeinden das Geburtsfest Christi mit seiner Taufe am 6. Januar feierten. In Ägypten wurde das Weihnachtsfest im Jahr 432, in Palästina erst 634 eingeführt. Dort stand es in Konkurrenz zum Chanukka-Fest, das ebenfalls am 25. Dezember gefeiert wird. Die erste Weihnachtsfeier in Deutschland fand am 25. Dezember 813 statt. Gleichzeitig wurde der Beginn des Kirchenjahres auf diesen Zeitpunkt gelegt. Die deutsche Bezeichnung “Weihnachten” taucht erstmalig in einem Gedicht im 12. Jahrhundert auf: “ze wîhen nahten” – zu den geweihten Nächten. Damit war eine vorchristliche ‘geweihte’ Zeit gemeint, die Opferzeit der germanischen Mittwinternächte. So wurden z.B. im 6. Jahrhundert nördlich des Polarkreises im “Land der Mitternachtsonne” vor Ende der 40-tägigen Polarnacht “Sonnwendfeuer” auf den Bergen entfacht. Der Heilige Nikolaus, Knecht Ruprecht, Krampus In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember kommt der Nikolaus. Der Brauch, dass der Nikolaus in die frisch geputzten Schuhe der Kinder heimlich Süßigkeiten, Nüsse, Mandarinen und kleine 165 Geschenke steckt, besteht schon seit dem 13. Jahrhundert. Er geht zurück auf die Legenden rund um den Bischof Nikolaus von Myra in Lydien (Kleinasien). Er lebte im 4. Jahrhundert und war wegen seiner Barmherzigkeit und Wundertaten berühmt. Um den gabenbringenden Nikolaus herum entwickelten sich eine Fülle landschaftlich unterschiedlicher Bräuche. Die Begleiter des Nikolaus sind maskierte Gestalten, Engel und Heilige, ja Narren und Teufelchen. Der bekannteste der dunklen Nikolausbegleiter in Deutschland ist Knecht Ruprecht. Während der Nikolaus die Kinder gütig ermahnt, immer fleißig, lieb und brav zu sein und sie mit süßen Gaben belohnt, droht sein Begleiter, die unartigen Kinder in den Sack zu stecken oder sie mit Rute zu verhauen. Knecht Ruprecht tritt in einigen Gegenden der Schweiz als “Schmutzli” auf, in Österreich als “Krampus” (griechisch krampos = trocken), eine teufelsähnliche Gestalt, die mit einer Eisenkette rasselt und auf Bocksfüßen daherkommt. Hier ist wohl zu einer Synthese von Teufelsglauben und den “Perchten”, vorchristlichen Winterdämonen, gekommen. In manchen Gegenden der Alpen gibt es ganze Krampusumzüge, bei denen die Figur des Nikolaus weitgehend in den Hintergrund tritt. Das Christkind, der Weihnachtsmann und der Christbaum (Weihnachtsbaum) Nach der Reformation (1517) wurde in den protestantischen Ländern zusammen mit den übrigen Heiligen der Nikolaus abgeschafft, an seiner Stelle sollte das Christkind die Geschenke bringen. Das Christkind wurde jedoch im 19. Jahrhundert in Norddeutschland nach und nach durch den “Weihnachtsmann”, in dem die Figur des Nikolaus und des Knecht Ruprecht in einer liebevoll-autoritären Vaterfigur verschmelzen, verdrängt. In Österreich und in Süddeutschland bringt aber weiterhin das Christkind, begleitet von einer Engelsschar, am 24. Dezember den Weihnachtsbaum und legt die Geschenke darunter. Den Christbaum gibt es im protestantischen Deutschland schon seit vielen hundert Jahren. In den katholischen Wohnzimmern dagegen hielt er als Symbol für das Weihnachtsfest erst im 19. Jahrhundert Einzug. Seine tiefste Wurzel hat der Christbaum in den Maienzweigen der vorchristlichen Zeit, die bei der Wintersonnenwende zur 166 Beschwörung des Sommers und der Fruchtbarkeit ins oder ans Haus geholt wurden. Im ausgehenden Mittelalter wurde der Brauch mit christlicher Symbolik vermischt: In Girlanden aus Efeu und Lorbeer – winterhart wie die Tannen – sah man ein Sinnbild für das Christuskind, das sich wie eine irdische Pflanze ganzjährig entfaltet. (Nach: Fremdsprache Deutsch, Heft 22/2000) FESTE UND BRÄUCHE IN DER SCHWEIZ Text 2 Die meisten Feste sind – wie überall in der Welt – überwiegend jahreszeitlich fixiert oder sie beziehen sich auf kirchliche Feiertage. Ob es sich um Praktiken handelt, die an die Abwehr böser Geister gemahnen, um Aussaat- und Erntebräuche, um die Jahreswende oder ein historisches Ereignis – alle diese Feste sind tief in der ländlichen Bevölkerung verwurzelt und bieten Gelegenheit, den Gemeinschaftssinn zu stärken. Im Winter sind die Feste etwas zahlreicher als im übrigen Jahr – aus gutem Grund: Die Feldarbeit ruht, und man findet mehr Zeit für sich selbst und infolgedessen mehr Zeit, Feste zu feiern. An kirchlichen Feiertagen verbindet sich oft weltliches Brauchtum mit religiösem. So findet in Beromünster der berühmte “Auffahrtsumritt” statt – eine Prozession in Verbindung mit dem alten Flurumritt. Dagegen ist der Eieraufleset in Effingen acht Tage nach Ostern ein Fruchtbarkeitsbrauch mit Wettkämpfen zwischen Frühling und Winter – begleitet von urtümlichen Figuren wie z.B. einem Naturgeist mit einem Kleid aus Schneckenhäuschen. Der Nikolaustag wird um den 6. Dezember mit großem Gepränge in Küssnacht und Arth gefeiert (“Klausjagen”); bei Einbruch der Dämmerung ziehen die “Iffelträger” durch die Orte, mit riesigem, an Bischofsmützen erinnerndem, von innen beleuchtetem Kopfaufsatz. Im Januar sind es am “Silvesterklausen” die “Schönen Kläuse”, die Urnäsch mit ihrem lärmenden Umzug heimsuchen; ihre Maskenaufsätze zeigen Szenen des ländlichen Lebens. Am Donnerstag vor Aschermittwoch lärmen die “Roitschäggättä” (“Rauchgescheckten”) durch die Dörfer des Lötschentals; mit ihren 167 dämonischen Holzmasken, in Ziegen- und Schaffelle gehüllt, sollen sie angeblich die bösen Geister erschrecken. Nicht zuletzt sind es die Fastnachtsbräuche, die in der kalten Jahreshälfte dominieren. Sie sind besonders häufig in den deutschsprachigen Kantonen, wo sie unter den verschiedensten Formen auftreten: in Luzern als “Fritschi-Umzug”, in Herisau als “Gidio Hosenstoß”, in Zug als “Greth-Schell”. Der berühmteste Fastnachtsbrauch findet aber in Basel statt, und zwar von Montag bis Mittwoch nach Aschermittwoch. Während dieser drei Tage ziehen die “Cliquen” (Fastnachtsvereinigungen) kostümiert und maskiert durch die Stadt, begleitet von Trommel- und Pfeifenklang. Der Frühlingsbeginn ist Anlass zu nicht weniger berühmten Festen: Beim “Sechseläuten” in Zürich wird der “Böögg” verbrannt, eine riesige, mit Stroh gefüllte Puppe, die den scheidenden Winter verkörpert; in Graubünden wird am 1. März “Chalanda Marz” begangen, wobei die Schuljugend mit Schellen läutet und mit Peitschen knallt, um den Winter zu vertreiben. Im Greyerzerland und den beiden Appenzell, aber auch sonst im Alpenland begleiten die Sennen in alten Trachten den Alpaufzug der Herde; die Leitkuh an ihrer Spitze ist mit Blumen geschmückt. Im Unterwallis wird die Alpfahrt zum Anlass genommen, um Kuhkämpfe auszutragen. Die Siegerin ist anschließend Führerin der Herde. Volkstänze, Fahnenschwingen, Alphornblasen und Schwingen begleiten diese Festlichkeiten. Der Herbst bringt die beliebten Winzerfeste, die üblicherweise in einem Blumenkorso ihren Höhepunkt finden. Am berühmtesten sind diejenigen von Neuchâtel, Morges und Lugano. Nicht zu vergessen natürlich die Feste, die sich an historische Ereignisse knüpfen – so der Nationalfeiertag am 1. August (Gründung der Eidgenossenschaft). (Nach: Schweizer Brevier) 168 FESTSPIELE IN ÖSTERREICH Text 3 Seit 1950 finden im Mai und Juli alljährlich die Wiener Festwochen statt, die mit ihren Darbietungen aus allen Bereichen der bildenden und darstellenden Kunst einen Höhepunkt des Wiener Kulturlebens bilden. Ein internationales Ballettfestival wird seit 1982 in der Bundeshauptstadt abgehalten. 1920 wurden die Salzburger Festspiele nach einer Idee von Max Reinhardt, Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal gegründet. In das Festspielgeschehen wurden der Domplatz, die Felsenreitschule und ein Teil der ehemaligen Hofstallungen, der als Festspielhaus diente, einbezogen. Nach den großen Erfolgen unter Arturo Toscanini 1934 bis 1937 wurde die Anlage erweitert, die schließlich seit 1960 mit dem Großen Festspielhaus den modernen Erfordernissen Rechnung trägt. Im Mittelpunkt der Festspiele stehen vor allem die Werke Mozarts, aber auch solche von Komponisten der Gegenwart sowie Theateraufführungen und Konzerte. Jeden Sommer finden in Salzburg auch die Internationalen Hochschulwochen, die internationale Sommerakademie für bildende Kunst und seit 1970 das “Fest in Hellbrunn” statt. Seit 1967 werden in Salzburg die von Herbert von Karajan gegründeten Osterfestspiele mit Opern- und Konzertaufführungen und seit 1973 Pfingstkonzerte abgehalten. Herbert von Karajan hat auch bis zu seinem Tod 1989 die Salzburger Festspiele geleitet. Als Festspielintendant folgte ihm Gerard Mortier. In Graz und anderen steirischen Städten wird der “steirische herbst” veranstaltet, Österreichs größtes Avantgardefestival. Jeden Sommer findet die Ars Electronica, das Festival für Technologie und Gesellschaft, in Linz statt. Seit 1985 wird die “Styriarte”, ein Musikfestival mit Nikolaus Harnoncourt, abgehalten. Hochgeschätzt im In- und Ausland sind der “Carinthische Sommer” in Ossiach und Villach, das Internationale Brucknerfest Linz (Oberösterreich), die “Schubertiade” in Feldkirch (Vorarlberg), das Musikfest “Wien modern” und die Haydn-Festspiele in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Das “Donau-Festival” prägt den niederösterreichischen Kultursommer. 169 Operetten-Festspiele finden u. a. in Bad Ischl im oberösterreichischen Salzkammergut, in Baden bei Wien und in Mörbisch am Neusiedler See statt. Darüber hinaus werden zahlreiche größere und kleinere Festspiele in allen Österreichischen Bundesländern abgehalten. (Nach: Österreich. Tatsachen und Zahlen) Textarbeit Referieren Sie über Feste und Bräuche deutschsprachiger Länder anhand dieser Texte. Ergänzen Sie Ihre Berichte/Referate mit Materialien der Nachschlagewerke, Presse etc. Mythen und Sagen aus ÖSTERREICH Die zahlreichen Mythen, Sagen und Märchen, die aus den Alpen kommen und von Generation zu Generation mündlich überliefert sind, entsprechen in der Vielfalt ihrer Themen und Formen den unterschiedlichen alpinen Landschaften. Täler, Flüsse, Seen oder auffallende Orte und Berge haben im Laufe der Jahrhunderte Menschen dazu angeregt, darüber Sagen und Geschichten zu erzählen. Daher erscheint immer wieder die österreichische Landschaft in diesen Überlieferungen und ist damit das Älteste und Ursprünglichste, was uns an Dichtung erhalten ist. Die Wurzeln liegen in weiter Vergangenheit und im Wesen der Bewohner dieses Landes. Die Sagenmotive wiederholen sich zwar in vielen Ländern der Welt, doch sie werden in Österreich in einer eigenständigen Weise variiert, so daß sich das Land, das Volk und auch die Geschichte in ihnen widerspiegeln. (Nach: Dirk Lyon) Der Lindwurm von Klagenfurt Vor langer Zeit war in der Gegend um den Wörthersee ein ungeheuer Sumpf. In den Wäldern ringsum rodeten die Menschen da und dort ein Stückchen und trieben Rinder auf die Weiden. Nun geschah es immer wieder, daß ein Bär ein Rind fortschleppte. Die Hirten gingen dann dem Räuber nach, und manchmal gelang es, ihm die Beute wieder abzujagen. Meist holten die Bären sich Kälber; ausgewachsene Rinder griffen sie selten an. Einmal aber fehlte einem Hirten der größte und wildeste Stier. 170 “Den hat kein Bär geholt”, sagte sich der Hirte. “Aber wer kann es sonst gewesen sein?” Es ließ ihm keine Ruhe. Er übergab die Herde einem anderen Hirten und ging tiefer in die Wälder, fand jedoch weder den Stier noch einen Bären. Auf dem Rückweg aber entdeckte er weiter unten auf der Weide Spuren. Sie führten nicht in den Wald, wo die Bären hausten, sie führten zum Sumpf. Das konnte kein Bär gewesen sein. Ungeheuer große Tatzen hatten die Spur getreten, es sah aus, als wäre eine riesige Eidechse über die Weide gekrochen. Der Hirte folgte der Spur bis an den Rand des Sumpfes. Da hörte er ganz in der Nähe ein dumpfes Brüllen, und aus dem Morast kam ein Lindwurm herausgekrochen. Entsetzt rannte der Hirte davon. Er lief zu den anderen und erzählte von dem Lindwurm. “Wäre ich nicht so gerannt, er hätte mich bestimmt gefressen. Er ist ein schreckliches Untier”, sagte der Hirt, “wenn er Hunger hat, wird er wiederkommen.” Als die Leute dem Herzog von dem Lindwurm berichteten, ließ er nahe am Ufer einen festen Turm erbauen. Er versprach jenem, der das Untier tötete, den Turm und das Land herum zum Lohn. Eine Schar mutiger Hirten band einen Stier mit einer eisernen Kette an den Turm. An der Kette hing ein großer Widerhaken. Bald sahen die Hirten, wie das Ungeheuer aus dem Sumpf hervorkam; die Erde zitterte, Schlamm und Morast spritzten haushoch. Als der Lindwurm sich auf den Stier stürzte und ihn verschlingen wollte, blieb er an dem Widerhaken hängen. Er brüllte entsetzlich, sein schuppenbesetzter Schwanz peitschte die Erde, und seine Krallen gruben sich tief in den Boden. Die Hirten stürzten aus dem Turm und erschlugen das Untier. An der Stelle, wo der Kampf mit dem Lindwurm stattgefunden hatte, entstand ein kleines Dorf. Der Sumpf wurde trockengelegt, und das kleine Dorf wuchs zu einer Stadt. Es ist die Stadt Klagenfurt. Zur Erinnerung führt Klagenfurt heute noch den Lindwurm und den Turm im Wappen, und auf dem Neuen Platz steht als Wahrzeichen der Stadt das Lindwurmdenkmal. (Nach: Käthe Recheis) 171 Frau Hitt In uralten Zeiten lebte auf den Bergen über Innsbruck eine mächtige Riesin, die Frau Hitt. Sie wohnte in einem riesigen Schloß aus weißem Stein. Ringsum breiteten sich Äcker und Wiesen aus, dunkle Wälder und grüne Almen, auf denen die Viehherden der Riesin weideten. Knechte und Mägde arbeiteten auf den Feldern. Die Riesin hatte ein stolzes Herz. Sie verachtete die Bauerin im Tal, über alte Leute sah sie hinweg. Ihren einzigen Sohn verwöhnte sie, wo sie konnte. Eines Tages kam der kleine Riese jammernd heim. Sein Gesicht und sein Haarschopf waren voll Schlamm, die Hände schmutzig, Rock und Hosen schwarz. “Wer hat dir das getan?” schrie die Frau Hitt. “Ein Baum”, schluchzte der kleine Riese. “Ich wollte mir ein Steckenpferd machen und habe eine junge Tanne abgeknickt. Aber der dumme Baum wollte nicht abbrechen. Da bin ich ausgerutscht und in den Tümpel gefallen.” “Armes Kind”, sagte die Frau Hitt. “Weine nicht, ich werde dir gleich ein neues schönes Röcklein geben.” Dann rief sie einen Knecht: “Hol weißes Brot und schneide die Rinde weg. Mit der weichen Schmolle will ich dem kleinen Riesen Gesicht und Hände abwischen”. Der Knecht antwortete: “Frau Hitt, ich bringe Euch Wasser und ein Tuch. Brot ist Gottesgabe. Viele arme Leute wären froh, wenn sie welches hätten.” “Mit meinem Brot mache ich, was ich will!” schrie die Riesin. Sie jagte den Knecht davon und holte selbst einen großen Laib frisches Brot. Sie rindete es ab und wischte mit der Schmolle den kleinen Riesen rein. Am nächsten Morgen ließ Frau Hitt ihr Pferd satteln, denn sie wollte nachsehen, ob die Knechte fleißig arbeiteten. Sie ritt über die Wiesen hinauf, immer höher, bis sie alle ihre Äcker, Weiden und Felder überblicken konnte. Weit unten im Tal sah sie den grünen Inn mit der hölzernen Brücke und die Häuser der Menschen wie winziges Spielzeug. Frau Hitt lachte, als sie die kleinen Häuser sah. 172 Sie lachte, als sie ihre Mägde und Knechte sah, die wie Ameisen auf den Feldern krabbelten. Da klangen Schritte neben ihr, und als sie nach der Seite blickte, stand da eine arme Frau mit einem Kind im Arm. Das Kind schrie. Die Frau fiel vor der Riesin auf die Knie. “Seid barmherzig”, flehte sie. “Wir haben Hunger, gebt uns Brot. Ihr seid doch auch eine Mutter! Ihr könnt euch vorstellen, wie eine Mutter sich quält, wenn ihr Kind nichts zu essen hat!” “Aus dem Weg!” rief die Frau Hitt. “Wie kannst du dich mit mir vergleichen, du Bettelweib! Und den häßlichen Wurm in deinen Armen mit meinem schönen Sohn!” Sie streckte die Hand aus und brach einen Stein aus dem Felsen. “Das hab’ ich für dich!” sagte sie und reichte den Stein der Bettlerin. “Du hast ein Herz aus Stein!” schrie die arme Frau. “So sollst du ganz aus Stein werden!” Kaum hatte sie diese Worte gerufen, da spürte die Frau Hitt, wie ihre Glieder kalt und steif wurden. Sie wollte den Mund öffnen und schreien, aber die Stimme gehorchte ihr nicht mehr. Ihr Leib erstarrte und wurde Fels. Auch ihr Pferd verwandelte sich in grauen Stein. Die Felder und Wiesen verdorrten, und Steine regneten herab, bis alles Grün verschwunden war. Die steinerne Frau Hitt steht heute auf dem Gipfel des Berges. Sie wird so stehen bis zum Jüngsten Tag. (Nach: Käthe Recheis. Kalender-Materialien) Textarbeit Geben Sie den Inhalt dieser österreichischen Sagen wieder, indem Sie die direkte Rede in die indirekte verwandeln und den Konjunktiv gebrauchen. 173 Die Crux helvetica Von Georg Kreis Das Schweizerkreuz, das weiße Kreuz im roten Feld, ist sowohl ein Erkennungs- als auch ein Wiedererkennungszeichen. Form und Farben werden der Schweiz zugeordnet und von ihr in Anspruch genommen. Das ist einfach so. Es ist gesetzlich geregelt und wird auch international anerkannt. Die heutige Form wurde 1889 offiziell festgelegt: ein freischwebendes Kreuz aus vier nicht bis zu den Rändern durchgehenden, leicht verschlankten und um ein Sechstel längeren als breiten Armen. 1890 forderte eine Petition ein Kreuz aus fünf Quadraten, sie fand beim Parlament jedoch kein Gehör. Trotzdem gibt es aber Kreuzvarianten; vor allem in der Werbung und in der Karikatur arbeitet man gerne damit. Die Geschichte des Schweizerkreuzes bietet jedoch mehr als nur eine heraldische Genese. Sie vermittelt Einsichten in zwei Seiten eines Prozesses; den Vorgang des Zusammenschlusses zu einer nationalen Gemeinschaft und die gemeinsame Abgrenzung von einem als Ausland definierten Umfeld. Dieser doppelte Prozess setzte gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein, er verlief aber nicht einfach linear und erhielt nach 1815 eine neue Qualität. Das Zeichen selber allerdings ist älter als der Vorgang, der an ihm und mit ihm gedieh. Schon im 14. Jahrhundert, namentlich in der Schlacht von Laupen (1339), sollen die Berner und die zugezogenen Innerschweizer als praktisches Unterscheidungsmerkmal gekreuzte Leinenstreifen aufgenäht haben, während die gegnerischen Habsburger ein rotes Kreuz getragen haben sollen. Das Zeichen wurde dann im Verlaufe des 15. Jahrhunderts nicht mehr nur auf den Kleidern, sondern auch auf Bannern verwendet. Die gekreuzten Leinenstreifen waren da also nicht – wie später – ein übergeordnetes, sondern eher ein untergeordnetes Zeichen. Spätestens hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Schwyzerkreuz und Schweizerkreuz. Das Schwyzer Standesbanner war ursprünglich ein bildloses rotes Tuch. Später wurde es angereichert durch ein Eckquartier beziehungsweise durch ein Zwickelbild, das mit dem Kruzifix und mit den Marterinstrumenten die Passion Christi veranschaulicht. Nochmals später, im Jahre 1480, 174 erhielten die Schwyzer für diesen Gebrauch die ausdrückliche Zustimmung von Papst Sixtus IV. Auch andere Kantone kannten ähnliche Eckquartiere als zusätzliche Elemente, und Schwyz führte überdies das gemeineidgenössische Erkennungskreuz. Dies festzustellen ist darum wichtig, weil es zeigt, dass das Erkennungskreuz keine stilisierende Ableitung aus dem Marterkreuz ist, sondern durchaus eine eigene Herkunft hat. Das handliche Zeichen wurde aber in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter Bezugnahme auf das Schwyzer Marterkreuz symbolisch aufgeladen und als christliches Heilszeichen gesehen und kultiviert. Marchals (Luzerner Historiker) These von der retroaktiven Umdeutung eines praktischen Zeichens hat ältere Theorien zurückgestellt, die eine Herleitung aus dem Kreuz des St. Mauritius oder St. Ursus oder sogar aus der Reichsfahne vermutet hatten. Wer auch immer recht hat, der Rekurs auf die christliche Symbolik ist in jedem Fall keine schweizerische Exklusivität. Auch andere, vor allem nördlich liegende Länder wie England, Schottland, Norwegen, Schweden, Finnland führten das Kreuz als nationales Symbol. Die Tagsatzung als die alteidgenössische Ständeversammlung schrieb das durchgehende Kreuz 1480 vor. Es diente sozusagen als Emblem der schweizerischen Söldnergruppen in der gemeinsamen Außenvertretung. Und im Schwabenkrieg von 1499, der ansatzweise die Züge eines nationalen Abgrenzungskrieges trug, soll ein gemeineidgenössisches “wyss crütz” als persönliche Markierung vorgeschrieben und auf einem Banner im Einsatz gewesen sein. Das Zeichen verinnerlichte sich allmählich und wurde zur Zierde auf Waffen und weiterer Ausrüstung und ließ sich so nach und nach vom Militärischen ins Zivile übertragen. Die militärischen Aufmärsche und Auszüge erfolgten bis ins 19. Jahrhundert unter den kantonalen Zeichen – das waren heraldische Tiere, Schlüssel und andere Zeichen oder auch bloß zweifarbige, zweiflächige Embleme. Nur für den Kampf heftete man weiße Kreuze an die Ortsfahnen – die so genannte Crux helvetica, die seit dem 16. Jahrhundert ein stehender Begriff war. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das schlanke durchgehende Schweizerkreuz zu einem festen Bestandteil der in den kantonalen Farben geflammten Truppenfahnen. Die 1798 geschaffene 175 Einheitsrepublik der Helvetik hätte aus dieser Kombination die kantonale Farbenskala verbannen und sich ganz auf das Einheitssymbol konzentrieren können. Dieses erschien den republikanischen Erneuerern aber als zu traditionell, sie wollten einen Neuanfang markieren und wählten deshalb in Anlehnung an die französische Mutterrepublik eine moderne Trikolore in den Farben Grün, Rot, Gold. Bis 1848 war die Schweiz ein Bund der Orte beziehungsweise der Kantone und, heraldisch gesehen, eine bunte Vielfalt von Kantonsfahnen. Erst 1814/15 wurde, als gleichwertiges Element, das von den Kantonswappen umgebene Schweizerkreuz zum offiziellen Tagsatzungssiegel. Die Fahnenbäume der Schützenfeste wiesen denselben Dualismus auf. Nach 1848 überwog dann die Nationalsymbolik, aus der Armee verschwanden die kantonalen Farben beinahe vollständig. Im 20. Jahrhundert erhielt die Fahnenwelt eine Ergänzung durch das in der Landesausstellung von 1939 präsentierte Ensemble der dreitausend Gemeindewappen. Den kräftigsten und wichtigsten Beitrag zur Popularisierung des Schweizerkreuzes hatte in der Aufbauphase des nation building die Schweizer Armee geleistet, zunächst mit der 1815 geschaffenen roten Armbinde mit dem weißen Kreuz für die Wehrmänner, die damals immer noch Kantonsuniformen trugen; und dann später mit der Schweizerfahne, die 1841 unter anderem auf Betreiben des späteren Generals Henri Dufour für alle kantonalen Truppen geschaffen wurde. Der Aargau übrigens hatte als erster Kanton bereits 1833 das eidgenössische Banner für seine Bataillone eingeführt. Seither ist das Kreuz, neben der naturalistischen Figur der Landesmutter Helvetia, gewissermaßen das abstrakte Logo der staatlichen und auch der gesellschaftlichen Einheit Schweiz. Nach außen hin findet es eine eher nüchterne Verwendung an Zollämtern und Grenzsteigen, im Krieg erscheint es als großflächige Markierung, die, wie das Rote Kreuz, völkerrechtlichen und humanitären Respekt gebietet. Weiter prangt das Kreuz immer noch auf den Schwanzflossen der Swissair-Maschinen. Im Innern wird es zum Teil ebenfalls nüchtern verwendet, sozusagen als amtliches Gütesiegel. Hauptsächlich als visuelles Zeichen hat es seine Bedeutung, aber auch als verbales, nicht selten 176 verbunden mit einer selbstkritischen Tendenz: “das Kreuz mit uns Schweizern”. Und oft genug erscheint uns das singulär-solitäre weiße Kreuz im roten Feld auch als ins Auge fallender Gegensatz zu den gemeinschaftlichen gelben Sternen Europas. (Nach: NZZ – FOLIO, Oktober 1998) Textarbeit 1. Erarbeiten Sie aus den Materialien des Textes ein Interview. 2. Berichten Sie über die Nationalsymbolik Ihrer Heimat oder anderer Länder. 177 TEZTE ZUR ANALYSE BZW. INTERPRETATION Thomas Bernhard Ludwig Fels Peter Handke Hermann Hesse Franz Hohler Hugo Loetscher Kurt Marti Gerold Späth Robert Walser Mildtätig Umgekehrt Das Haus Eine Zwischenbemerkung über die Angst Sprache (s. Titelblatt zum Teil II) Die drei Beobachter Information Wenn der Liebe Gott Schweizer wäre Meine Angst lässt grüßen Johann Heinrich Allemann King Fabelhaft Lüge auf die Bühne Bedenkliche Geschichte Textarbeit 1. Vergleichen Sie die Verwendung der Wirkungs- und Gestaltungsmittel in zwei/drei Texten (wahlweise). Bedienen Sie sich dabei der nötigen Arbeitshilfen (Teil III). 2. Analysieren Sie sprachliche Besonderheiten (Wortwahl, Tempuswahl, Sprachebene, Lautmalerei, Tropen, Satzbau u.a.) und deren Rolle in den o.g. Texten (wahlweise). 3. Äußern Sie sich zu Problemen bzw. Hauptgedanken der Texte, indem Sie Ihre Stellungnahme zeigen und zugleich die Position des Autors entweder akzeptieren oder bezweifeln (wahlweise). 4. Wählen Sie ein Gedicht aus dem Lehrwerk Literaturkurs Deutsch (Hrsg. U.Häussermann) und versuchen Sie es anhand der Arbeitshinweise (Teil III) zu analysieren.* Für diese Analyse bzw. Interpretation können Sie das Gedicht “Sprache” Hermann Hesse nehmen (s. Titelblatt zum Teil II). * 178 von Thomas Bernhard MILDTÄTIG Eine uns benachbarte alte Dame war in ihrer Mildtätigkeit zu weit gegangen. Sie hatte, wie sie geglaubt hatte, einen armen Türken zu sich genommen, welcher anfänglich auch über die Tatsache, daß er jetzt nicht mehr in einer zum Abreißen bestimmten Bauhütte existieren mußte, sondern jetzt, durch die Mildtätigkeit der alten Dame in ihrem in einem großen Garten gelegenen Stadthaus leben durfte, dankbar gewesen war. Er hatte sich bei der alten Dame als Gärtner nützlich gemacht und war von ihr nach und nach nicht nur neu eingekleidet, sondern tatsächlich verhätschelt worden. Eines Tages war der Türke auf dem Polizeikommissariat erschienen und hatte angegeben, er habe die alte Dame, die ihn aus Mildtätigkeit ins Haus genommen habe, umgebracht. Erwürgt, wie die Gerichtskommission bei einem sofort angesetzten Lokalaugenschein festgestelt hatte. Als der Türke von der Gerichtskommission gefragt worden war, warum er die alte Dame umgebracht und also erwürgt habe, antwortete er, aus Mildtätigkeit. UMGEKEHRT Wenn mir zoologische Gärten auch immer verhaßt gewesen sind und die Leute, die solche zoologischen Gärten aufsuchen, tatsächlich suspekt, ist es mir doch nicht erspart geblieben, einmal nach Schönbrunn hinauszugehn und, auf Wunsch meines Begleiters, eines Theologieprofessors, vor einem Affenkäfig stehenzubleiben, um die Affen zu beobachten, die mein Begleiter mit einem Futter fütterte, das er zu diesem Zwecke eingesteckt gehabt hatte. Der Theologieprofessor, ein früherer Studienkollege, der mich aufgefordert hatte, mit ihm nach Schönbrunn zu gehen, hatte mit der Zeit sein ganzes mitgebrachtes Futter an die Affen verfüttert, als plötzlich die Affen ihrerseits auf dem Boden verstreutes Futter zusammenkratzten und uns durch das Gitter herausreichten. Der Theologieprofessor und ich waren über das plötzliche Verhalten der Affen so erschrocken gewesen, daß wir augenblicklich kehrtmachten und Schönbrunn durch den nächstbesten Ausgang verließen. 179 Thomas Bernhard (1931–1989), österreichischer Schriftsteller, wächst ab 1932 bei den Großeltern mütterlicherseits auf; mit ihnen zieht er mehrmals um; 1943 Tod des Vaters; bis 1947 besucht er in Salzburg ein Internat; Unterricht in Gesang, Geige und Musikästhetik, später Lehre bei einem Lebensmittelhändler; 1949 schwere Lungenkrankheit; ab 1951 Besuch der Hochschule für Musik und Kunst in Wien, später in Salzburg; seit 1957 freier Schriftsteller; mehrere Literaturpreise. – Romane, Erzählungen, Interviews, Dramen: Frost (1963), Der Stimmenimitator (1978), Die Jagdgesellschaft (1974) u.v.a. Ludwig Fels DAS HAUS Links oben haust ein Rentner, der außerdem noch verwitwet ist. In seiner Mansarde träumt er von einer Gartenlaube, besonders am Tag. Er war Arbeiter in einer Chemiefabrik und fürchtet sich vor Krebs am Geschlecht, weil er Zeit gehabt hat, darüber zu lesen. In der Mitte oben lebt ein junges Pärchen in wilder Ehe. Beide jobben tagsüber. Abends holen sie die Mittlere Reife nach. Unzucht kann ihnen niemand nachsagen. Rechts oben wohnt eine Geschiedene. Wenn das Haus Feierabend macht, wird sie in einer Bank als Raumpflegerin beschäftigt. Sie schwärmt von pflegeleichtem Marmor. Den Tresor putzt der Direktor selbst. Links im Zwischenstock sind zwei Schlüsselkinder daheim, ein Junge und ein Mädchen, die dort nach der Schule auf ihre Eltern warten. Auf dem Hof darf nicht gespielt werden. Sie können gar nicht anders, müssen brav und artig sein. Den Haushalt erledigen sie wie eine Fleißaufgabe, aber ihre Eltern sind immer zu müde, um sie zu loben. Nebenan liegt die Wohnung einer Frau, die bei der Liebe schreit. Jedermann hört ihr gern zu. Rechts steht alles leer. Da hat einmal der Vermieter seine Wachstube gehabt, bevor er aufs Land gezogen ist. Höchst selten 180 besucht er sein Stadtquartier, um durch Keller und Speicher zu streifen. Wenn er anwesend ist, dann brüllt er wie ein Feldwebel herum. Wer bei jedem seiner Kommandos salutiert, wenigstens innerlich, das ist der Buchclub-Vertreter von rechts unten, der auf seinen Geschäftsreisen seine Gattin auf Strich und Faden betrügt. Er ist ein mittelalterlicher Knabe. Seine Frau liest für ihn die Bücher, die er vertreibt, damit er bei der Kundschaft weiß, was er überhaupt anbietet. Mitten im Parterre liegt der Hauseingang. Dort treffen sich die Hausbewohner manchmal an den Briefkästen und grüßen sich. Daneben steckt nochmal ein Ehepaar, das sich bis zum Gehtnichtmehrweiter zurückgezogen hat. Sie ist Sekretärin, er ein Bürobote. Gemeinsam pflegen sie moderne Partnerschaftsbeziehungen, haben sich der Toleranz verschworen und hegen vielseitige Interessen. Zu ihrem Bekanntenkreis zählt ein Polizist. Wenn dieser in Uniform bei ihnen erscheint, fühlen sich die beiden sofort sicher und verurteilen die Proletenregierung. Vorm Haus ist nur Platz für die Straße. Ludwig Fels (geb. 1946), schweizerischer Schriftsteller, besuchte die Grund- und Berufsschule und absolvierte eine Malerlehre. 1970 Umzug nach München. Er arbeitete später in verschiedenen Berufen. Seit 1973 freier Schriftsteller.Romane, Erzählungen, Dramen, Hörspiele: Platzangst (1974), Die Sünden der Armut (1975), Mein Land (1978), Lehm (1975), Der Typ (1977), Frau Zarik (1984) u.a. Peter Handke EINE ZWISCHENBEMERKUNG ÜBER DIE ANGST “Du hast immer nur Angst, Angst, Angst”, hat gestern ein Kind zu mir gesagt, und es sagte das ziemlich gelangweilt… Wann habe ich eigentlich keine Angst? Sehr oft, meistens; aber wenn ich dann Angst habe, kommt wieder das Gefühl, daß jetzt ich gemeint bin und daß jetzt das Leben anfängt. Wenn ich keine Angst habe, fühle ich 181 mich entweder stumpfsinnig oder so glücklich, daß ich vor Glück gereizt werde und jeden Buckel in der Umwelt nur als Störung meines Glücks empfinde. Ich habe noch nicht recht gelernt, im Glück vernünftig zu bleiben und aufmerksam für die andern zu sein. Sehr selten gelingt das vernünftige Glück, das von der Umwelt nicht abschließt, sondern für sie öffnet. Das wäre dann die gewünschte Existenz; aber auf dem Weg dahin ziehe ich die augenöffnende Angst meinem blindwütig aggressiven Glück vor, dessen jähe Bösartigkeit ich auch an anderen Glücksfanatikern erschreckt wiederfinde. Angst also wovor? Das ist eine mir unverständliche Frage. Ich habe einfach Angst, wie ich Träume habe, wie ich manchmal Kopfschmerzen habe, wie ich Erinnerungen habe; die äußeren Einzelheiten entzünden die Angst nur. “Panischen Schrecken” nannten die Griechen diese Angst ohne sogenannte Ursache. Ja, wenn ich Angst habe, bricht in mir eine Panik aus, eine stille, heiße, ruhige Panik, fast wie bei dem vor Schrecken angewurzelten Bambi Walt Disney’s, jedenfalls so ähnlich …, und vielleicht auch ähnlich kitschig; und ähnlich auf die Nerven wie das panisch erschreckte Bambi geht mir auch oft meine Angst. Was soll also daran augenöffnend sein? Nicht den Zustand der Angst meine ich, sondern den Zustand danach – wenn die Angst vorbei ist. Da entsteht dann ein Gefühl, das jenem vernünftigen Glück nahekommt: das Gefühl für die Existenz und die Existenzbedingungen der anderen Menschen, ein starkes, mitteilbares, soziales Gefühl. Deswegen kann ich es mir nicht leisten, daß mir meine Angst nur auf die Nerven geht, und deswegen schreibe ich darüber und lebe davon, daß ich darüber schreibe. Und die Todesangst? “Schickt es sich, eine so kurze Sache so lange zu fürchten?” heißt es in den “Essais” von Montaigne. O ja, o ja. Und die Langeweile des Kindes? O, ich könnte über meine Angst so viele komische Einzelheiten erzählen, daß ich schließlich sogar ein Kind damit zum Lachen bringen könnte. 182 Franz Hohler DIE DREI BEOBACHTER Drei Freunde beschlossen einmal, von jetzt an alle etwas zu beobachten. “Ich werde die Hirsche beobachten”, sagte der erste, “wo sie durchgehen, was sie fressen, was sie miteinander tun.” Der zweite sagte: “Ich will die Sterne beobachten. Wie sie sich verschieben, wie sie entstehen und verlöschen, wie sie sich um andere Sterne drehen.” “Und ich”, sagte der dritte, “ich will Häuser beobachten. Wie sie dastehen, wie sie ihre Farbe verändern, wie sie einstürzen.” Da wunderten sich die andern beiden sehr und versuchten, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Häuser, sagten sie, könne man doch nicht beobachten, auch sei ein Hauseinsturz etwas sehr Seltenes, und überhaupt werde es mit dieser Tätigkeit nirgends hinbringen. Der Dritte ließ sich aber nicht davon abhalten, und so trennten sie sich und vereinbarten, daß sie sich nach zwölf Jahren wieder am selben Ort treffen wollten. Als sie sich nach dieser Zeit wieder sahen, konnten die beiden ersten kaum warten, bis sie erzählt hatten, was aus ihnen geworden war, der eine war bereits ein bekannter Hirschforscher und der andere ein aufstrebender Astronome. “Und du?” fragten sie den dritten, der alt aussah, “hast du deine Häuser beobachtet?” “Ja”, sagte der dritte, “ich habe die ganze Zeit nichts anderes getan.” “Und hast du je ein Haus einstürzen gesehen?” fragte der zweite. “Nein”, sagte der dritte, “ich habe nie ein Haus einstürzen gesehen, und ich habe es auch nicht zu etwas gebracht wie ihr. Trotzdem ist es geradezu unheimlich, was ich alles erlebt habe.” INFORMATION “Gibt es die Rede, die Dürrenmatt für Havel hielt, in einem Buch?” fragte ich die junge Buchhändlerin. 183 Sie wußte es nicht, ging zum Computer und tippte “Dürrenmatt” ein und dann “Havel”. Auf dem Bildschirm erschien nach kürzester Zeit der Satz “Suche beendet”, und sonst nichts. “Nein, leider nicht”, sagte die Buchhändlerin. “Sind Sie sicher?” fragte ich, leicht verärgert, denn mir war, als sähe ich vor meinem inneren Auge einen schmalen schwarzen Band. “Die Rede hieß ‘Die Schweiz als Gefängnis’ oder ‘Die Schweiz ein Gefängnis’ “ fügte ich mit dem Nachdruck des Besserwissers hinzu. Die Buchhändlerin tippte nochmals “Dürrenmatt” ein, und dazu “Schweiz”, und als der Computer gleich darauf “Suche beendet” meldete, versuchte sie es mit der Paarung “Dürrenmatt” und “Gefängnis”, und wieder zeigte der Computer an, daß keine solche Kombination auf dem Buchmarkt existiere und daß er seine Suche hiermit definitiv beendet habe. Als ich den Laden resigniert verlassen wollte, legte mir der ältere Buchhändler das gesuchte Buch auf den Tisch. Es war ein schmaler schwarzer Band, enthaltend zwei Reden von Dürrenmatt, eine an Gorbatschow, die andere an Havel, und er hatte im Regal gestanden, bei Dürrenmatts anderen Werken. Aus diesem Ereignis sind verschiedene Schlüsse möglich. Die junge Buchhändlerin wird daraus schließen, daß der Computer besser programmiert werden sollte. Der ältere Buchhändler wird daraus schließen, daß die Anschaffung dieses Computers eine Fehlinvestition war und daß er es schon immer gewußt hat. Und ich, schließe ich auch etwas daraus? Ja. Wenn der Computer sagt “Suche beendet”, dann heißt das, daß die Suche beginnt. Franz Hohler (geb. 1943), schweizerischer Schriftsteller, Sohn eines Lehrer-Ehepaares, studierte fünft Semester Germanistik und Romanistik in Zürich. Seit 1965 lebt er als Kabarettist und freier Schriftsteller. Gastspiele führten ihn durch ganz Europa, Nordafrika, die USA. Mehrere Kunstund Literaturpreise. – Hörspiele, Fernsehfilme, Kinderbücher, Theaterstücke, Interviews. 184 Hugo Loetscher WENN DER LIEBE GOTT SCHWEIZER WÄRE Was wäre passiert, wenn der Liebe Gott Schweizer gewesen wäre? Die Frage ist keineswegs müßig, wie einige meinen könnten, denn es besteht der berechtigte Verdacht, daß manches anders herausgekommen wäre. So vermessen ist die Überlegung nicht. Andere Völker okkupieren den Lieben Gott ebenfalls. Da heißt es zum Beispiel, einer “lebe wie der Herrgott in Frankreich”. Warum soll es dem Lieben Gott ausgerechnet in Frankreich gefallen? Wegen des Essens? Und ist es unbedingt eine Referenz für den Lieben Gott, sich in Paris wohl zu fühlen, über das man einiges munkelt? Weshalb heißt es nicht: Er lebt wie der Herrgott in der Schweiz? Bei uns sind die Verhältnisse viel gesicherter. Wir haben eine weltweit anerkannte Hotelindustrie. Aber anderseits ist natürlich zu bedenken: die, welche sich wohl fühlen, könnten am Ende noch bleiben wollen. Und die Amerikaner sagen zum Beispiel, ihr Land “sei Gottes eigenes Land”. Was für Amerika recht sein mag, ist für uns noch lange nicht billig – bei unseren Bodenpreisen. Haben wir unsere Geschichte nicht damit begonnen, daß wir unseren Boden verteidigen; den lassen wir uns von niemand nehmen, und an Besitzverhältnissen rütteln wir nicht. Die Schönheit dieses Bodens offenbart sich sowieso nur jenem, der Grenzsteine zu setzen weiß und Zäune ziehen kann. Und die Brasilianer behaupten gar, Gott “selber sei Brasilianer”. Aber sie pflegten auch zu sagen: “Wir alle sind Brasilianer”, so daß selbst der Liebe Gott nicht stört. Allerdings dürfte es sich kaum um einen “geborenen Brasilianer” handeln, sondern um einen “naturalisierten”. In der Hinsicht sind wir vorsichtiger. “Alle sind Schweizer”, das ist keine helvetische Einladung. Schweizer, das sind nur wir, eine kleine Zahl, dafür sind wir es um so tüchtiger. Natürlich leuchtet es uns ein, daß alle Schweizer werden möchten, aber da muß man Zurückhaltung üben, nicht nur wegen des Gedränges in einem so kleinen Land. Wenn einer Schweizer werden will, muß er sich das schon was kosten lassen; was es kostet, das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. 185 Nein – soll sich der Herrgott in Frankreich wohl fühlen, in Amerika zu seinem Boden kommen und dem Paß nach AuchBrasilianer sein, für uns stellt sich die Frage anders. Nicht einfach so, wie Carl Spitteler behauptet hat: Hätten wir Schweizer die Alpen selber erschaffen, sie wären nicht so hoch ausgefallen. Einiges spricht tatsächlich dafür, daß der Liebe Gott Schweizer sein könnte – weit weg von allem und nur zuschauen, das ist doch ebenso göttlich wie schweizerisch. Der Gedanke, was passiert wäre, wenn der Liebe Gott Schweizer gewesen wäre, kam auf, nachdem wir am Radio einen Kommentar zum UNO-Beitritt der Schweiz gehört hatten. Interessant waren gar nicht die Argumente dagegen, die kannte man, sondern es redete wieder einmal einer jener Schweizer, die als kleiner Herrgott gegen die Weltgeschichte der andern antreten. Natürlich war eine gewisse Verstimmtheit durchzuhören: Hätte man uns gefragt, wäre alles anders herausgekommen, aber eben, uns fragt man nie. Wenn also mancher Schweizer Talent zum Lieben Gott hat, warum sollte umgekehrt der Liebe Gott nicht auch etwelches Talent zum Schweizer haben? Wobei wir natürlich an den Allmächtigen denken. Nicht an das kleine uneheliche Kind, das im Stall geboren wurde. Wennschon der Liebe Gott, dann der Allmächtige, der im Notfall das Universum hinterlegen kann. Wenn dieser Weltenschöpfer aber Schweizer gewesen wäre, müßte auch die Bibel anders erzählt werden. Nun gibt es Bibeln für Kinder, für Arme, für Neger – warum sollte es da nicht auch eine besondere Bibel für Schweizer geben? Aber da stellen sich schon neue Schwierigkeiten ein. Denn dieser Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Aus Nichts kann nun mal nichts werden. Wir hingegen fangen nicht mit Nichts an, sondern klein. Wir erarbeiten uns, was wir haben, und deswegen wollen wir es auch behalten. Anderseits wäre es uns manchmal schon willkommen, wenn etwas aus dem Nichts entstände. Bei vielen Vermögen, die bei uns deponiert und angelegt werden, ist es uns lieber, wenn sie aus dem Nichts kommen, als daß wir genau wüßten, woher sie stammen. Aber das wichtigste Problem bleibt: der richtige Zeitpunkt, um die Welt zu erschaffen. Für einen Schweizer ist es sehr wichtig zu 186 wissen, wann es endlich soweit ist – wann man zum Beispiel den Frauen das Stimmrecht gibt oder wann es nun einmal soweit ist, der UNO beizutreten – niemand war so schöpferisch im Abwarten wie wir. Und daß die Welt nicht im richtigen Zeitpunkt erschaffen wurde, beweisen Adam und Eva: Kaum waren sie da, mußte man sie vertreiben, kaum hatten sie Kinder, brachte der eine Bub den andern um. Das wäre alles anders rausgekommen, wenn man zugewartet hätte. Deswegen hätte ein Lieber Gott, der Schweizer gewesen wäre, zugewartet; denn alles muß wachsen und reifen. Er hätte um so eher zuwarten können, als für ihn tausend Jahre wie ein Tag sind, auch wenn darob viel Zeit vergangen wäre. Er hätte diese Zeit eines Tages der Uhrenindustrie zur Verfügung stellen können. Wenn der Liebe Gott Schweizer gewesen wäre, würde er heute noch auf den richtigen Moment warten, um die Welt zu erschaffen. Nur eben – wenn dieser Liebe Gott ein Schweizer gewesen wäre und zugewartet hätte, gäbe es nicht nur die Welt nicht, sondern auch die Schweiz nicht. Und das wäre nun wiederum schade. So verdanken wir Schweizer unsere Existenz einem Lieben Gott, der gottlob nicht Schweizer gewesen ist. Insofern ist es richtig, daß wir seiner in der Verfassung gedenken. Aber so weit sind wir am Ende doch nicht vom Lieben Gott entfernt. Denn als Gott die Welt geschaffen hatte, “sah er an alles, was er gemacht hatte, und, sieh da, es war gut”. Der Liebe Gott besitzt doch einen schweizerischen Charakterzug; denn uns geht es ähnlich. Wenn wir etwas machen, schauen wir es an, und siehe da, es ist gut. Hugo Loetscher (geb. 1929), schweizerischer Schriftsteller; Loetscher studierte in Zürich und Paris Politologie, Soziologie, Wirtschaftsgeschichte und Literatur. Er war aktiv in der Schweizer Studentenbewegung. Nach seiner Tätigkeit als Literaturkritiker der “Neuen Zürcher Zeitung” und der “Weltwoche” war er 1958-62 Literaturredakteur der Zeitschrift “du”, später Redakteur der “Weltwoche”. Seither (1969) ist er freier Schriftsteller und Publizist. Längere Reisen durch Europa und Lateinamerika. Loetscher ist ein 187 äußerst vielseitiger Autor: Romane, Erzählungen, Dramen, Essays, Reportagen, Übersetzungen. Kurt Marti MEINE ANGST LÄßT GRÜßEN Meine Angst, wurde mir ausgerichtet, lasse grüßen, sie erfreue sich bester Gesundheit. Ich hatte sie, aber das ist schon fast zwei Wochen her, zwischen Lausanne und Fribourg aus dem Zug geworfen. Warum, fiel mir damals plötzlich ein, sollte man sich einer so lästigen Klette nicht entledigen können? Da außer mir gerade niemand im Abteil war, die gute Gelegenheit mir aufmunternd zunickte, hab ich’s dann also getan. Soviel mir bekannt, ist eine solche Handlung nicht strafbar. Nur vergaß ich natürlich im Überschwang meines Entschlusses, daß Ängste überaus zäh sind. Sie überleben alles, sie überleben auch uns. Meine Angst zum Beispiel ist, bevor sie auf mich kam, die meiner Mutter gewesen. Und meine Mutter hat sie vielleicht schon von einer Tante gekriegt, daß weiß ich schon nicht mehr. Wie immer: Wir Menschen kommen und gehen, doch ungerührt bleiben die Ängste am Leben und wählen sich neue Träger aus. Kein Wunder, daß es einer Angst überhaupt nichts ausmacht, aus dem fahrenden Zug geworfen zu werden. Deshalb ist meine euphorische Handlung ein sinnloser Akt gewesen. Wie zu erwarten war, stellt sich nunmehr heraus, daß die würzige Waldluft des Waadtlandes meine Angst erst recht gekräftigt hat. Schon also läßt sie mich grüßen. Bald wird sie wiederum da sein, ausgeruht und erholt für ihren Erwählten, für mich. Treue, hört man heute oft klagen, sei selten geworden. So kann nur reden, wer für einen Augenblick seine Angst vergessen hat, vielleicht hat vergessen wollen. Aber niemand bleibt uns so unentwegt treu wie die Angst. Kurt Marti (geb. 1921), schweizerischer Schriftsteller; studierte Jura und Theologie in Bern und Basel; 1961-83 Pfarrer in Bern; seither freier Schriftsteller; mehrere Literaturpreise. – Romane, Erzählungen: Dorfgeschichten (1960), Die Riesin (1975), Bürgerliche Geschichten (1981) u.a. 188 Gerold Späth JOHANN HEINRICH ALLEMANN Wenn ich ringsum schaue, sogar unter Kollegen, höre ich meistens nur Gejammer. Ach, dieser grauenhafte Tramp ein Leben lang! Jeden Tag in aller Frühe aufstehen! Den ganzen Tag die gleichen grauen Gesichter! Am Abend halb lahm und halb tot und doch immer nur der gleiche Leerlauf! Ein Leben lang macht man sich kaputt für nichts und wieder nichts letztenends! Sorgen und Krampf und Kummer und man muß noch froh sein, wenn man gesund bleibt dabei! Diesen ewigen Jammerbojen sage ich: Ihr seid hier am falschen Ort. Was habt ihr euch denn gedacht. Ich bin auch Arbeiter, ich verdiene auch zehnmal oder hundertmal weniger als die Bosse, aber ich weiß was ich tue. Ich bin der Mann vom Fach. Ich bin nicht unersetzlich, aber solange ich da bin, ersetzt mich keiner schon gar kein Boß, drum bin ich da. Soll ich mir wünschen, ein Ziegenhirt in der afrikanischen Steppe zu sein? Nehmt eure Probleme in die Hand, Leute, und hört auf zu träumen. Ihr könnt euch wehren, der Neger nicht. Davonlaufen geht nicht und gilt nicht, Leute! Ich bin 62, ich weiß aber, was ich nach der Pensionierung tun werde. Ganz sicher nicht vor Langeweile versauern. Ich bin Werkmeister bei der Ziegler AG. Präzisionsmaschinen. Die Firma ist gut ausgebaut und durchorganisiert, das Klima ist normal, Probleme gibt es in jedem Betrieb. Der oberste Chef hat in seinem Leben mehr Pech gehabt als andere, da hat ihm sein ganzes Geld nichts genützt. Er ist in meinem Alter. Jahrelang Weibergeschichten zuerst, und neuestens pilgert er zu indischen Scharlatanen. Früher war er eine Zeitlang ein verrückter Rösseler, bis der Tierschutz das abgestellt hat. Er ist einer, der ersetzt werden kann, er ist eigentlich schon ersetzt. Er kümmert sich um nichts mehr. Der Betrieb gehört ihm, aber das ist auch alles. Im Betrieb haben andere das Sagen, nicht zuletzt die Werkmeister. Ich lasse mich nicht in die neumodische Miesmacherei hineinschwatzen. Ich habe meinen Posten und meine Arbeit und Verantwortung. Die Misere kommt erst, wenn die Arbeit fehlt, und dann ist es erst recht nicht getan mit Klagen und Stöhnen. Von nichts kommt nichts. 189 KING Ich bin ein Penner. Ich kann nichts dafür. Paß du selber auf. Stadtstreicher. Ein richtiger Stadtberber. Tuareg. Da gibts nix. Man ist vor genau zwölf Jahren daheim abgetanzt. Es machte keinen Spaß mehr. Meine Schnauze war voll gewesen. Natürlich will jeder zurück. Auch wenn ers nicht zugibt will er zurück. Wohnung und automatisch Essen und das Bett und Geld. Aber es ist auch Scheiß. Ich kenne alle guten Pennen. Alle wos automatisch gutes Essen gibt für einen Schein. Ganz anständig. Scheine gibts beim Pfarrer oder aufm Amt. Plus einen Zwickel oder n Fünfermann. Ich saufe nur den schönsten Wein und den besten Südseerum. Die Toten werden immer mehr. Immer mehr Tote flüstern auf die Lebenden ein. Es ist immer schwieriger für uns. Eines Tages werden nur noch die Toten reden. Wir automatisch nur noch Medien wie in den Zauberbuden aufm Rummelplatz. Alles eingeflüstert und einander nicht mehr anhören weil die Ohren bei den Toten sind und zum Schluß wir auch. Nach und nach hört dann das Geflüster auf. Da staunste nicht schlecht. Ich kann auch denken. Ich sage dir dann wird es still sein. Wenns je von den Menschen abhing daß es still ist kann ich dir sagen. Jetzt bin ich besoffen. Ich bin der Mann mit der eisernen Stimme. Mein Name ist King mit K wie Krieg. Das Leben ist furchtbar aber sonst gibt es nix. All men are dying. Ich bin einundfünfzig und seit zwölf Jahren auf Platte. Ich will nicht wissen wer du bist. Gerold Späth (geb. 1939), schweizerischer Schriftsteller; Ausbildung als Exportkaufmann in Zürich, Vevey, London und Fribourg. Seit 1968 freier Schriftsteller. Mehrere schweizerische Literaturpreise. – Hörspiele, Fernsehfilme, Romane, Erzählgeschichten: Unschlecht (1970), Stimmgänge (1972), Balzapf (1977), Barbarswila (1988), Commedia (1989) u.a. 190 Robert Walser FABELHAFT Das Wetter war fabelhaft. Bei dem Wetter mochten Kitsch und Kutsch nicht zu Hause bleiben, und so machten sie sich zum Ausgehen fertig und eilten auf die Straße hinunter. Fabelhaft, dieses Licht in der Straße, murmelte Kutsch, während sie beide rüstig vorwärtsmarschierten, und Kitsch sagte auch: fabelhaft. Bald kam ihnen ein dickes Weib entgegen, dieses Weib wurde von beiden Spaziergängern augenblicklich als fabelhaft empfunden. Sie stiegen in die Elektrische, das sei doch fabelhaft, meinte wieder Kutsch, indem er sich den jugendlichen Bart kratzte, so zu fahren, und Kitsch beeilte sich, seinem Kameraden lebhaft zuzustimmen. Ein Mädchen mit “fabelhaften Augen” saß im Wagen. Plötzlich fing’s an leise zu regnen: fabelhaft! Nach einer Weile stiegen unsere Kitsch und Kutsch aus und traten in einen Kunstsalon. Der Kunsthändler schaute zu seiner Kunsthandlung heraus, das wäre für die beiden um ein Haar fabelhaft gewesen, nämlich so: fabelhaft, wie der Kerl zu seinem Geschäft heraussieht, aber sie vermieden es, diesen Gedanken laut zu äußern, weil sie fühlten, daß man denn doch nicht immer wieder dasselbe sagen darf. Eine halbe Minute später standen sie vor einem Renoir: einfach fabelhaft! fuhr es ihnen zu den Munden heraus. Kutsch fing wieder an, sich mit den Fingern am Bart zu rasieren, aber schon hatte sein Kollege etwas entdeckt, das noch um zehn Fabeln fabelhafter war, als der Renoir, es war dies ein alter Holländer. So etwas, sagten sie, sei mehr wie fabelhaft, und sie hätten beide schreien mögen. Dann gingen sie. Inzwischen war draußen eine feine Kruste Schnee gefallen, das sah fabelhaft aus, der Schnee war ganz schwarz, bläulich schwarz, einfach, na, sie hielten an sich, schließlich möchte man nicht immer dasselbe sagen. Ein Maler begegnete ihnen. Nicht lange dauerte es und so sagte der Maler, er kenne nichts Fabelhafteres als Paris. Kitsch und Kutsch fanden das ekelhaft, zu sagen, Paris sei fabelhaft, sie behandelten rasch den ahnungslosen Maler samt seinem fi-fa-fö-fü fabelhaften Paris mit Verachtung. Sobald sie wieder allein waren, kam’s ihnen schon wieder, aber sie fanden’s am Platz, diesmal war es ein Teich. Sie standen auf einer Brücke, und da unten lag der Teich in seiner ganzen Fabelhaftigkeit. Mit einem Male sprachen sie 191 von Gedichten von Verlaine, Kutsch schlug die Hände zusammen und schrie: fabelhaft. Da lächelte Kitsch. Er hatte es jetzt heraus, er sagte sich: wie gemein, derart fabelhaft bei jeder geringfügigen Gelegenheit. Nach einer Minute stürzte er zu Boden, umgeschlagen vom fabelhaften Aussehen eines blauen Weiberrockes. Das Blau ist enorm, sagte Kitsch, indem er sich mühsam emporrichtete. Er hatte den Fuß verstaucht. Von diesem Moment an sagten sie immer enorm, nicht mehr fabelhaft. LÜGE AUF DIE BÜHNE Wir leben jetzt in einer merkwürdigen Zeit, wiewohl vielleicht alle Zeiten irgend so etwas Zeitlich-Merkwürdiges jeweilen an sich gehabt haben. Item, die unsrige scheint mir sehr, sehr merkwürdig, besonders dann, wenn ich so, wie ich es gerade jetzt tue, meinen Finger an die Nase lege, um darüber nachzudenken, was es eigentlich mit diesem Leben, das wir jetzt mit aller Macht in die Bühne hinaufstopfen, für eine Bewandtnis hat. Wir füttern jetzt die Bühne mit Leben, daß sie wahrhaftig genug zu fressen hat. Der hinterste und verborgenste Dichter präsentiert dem Theater irgendwelches hinterste und verborgenste Stücklein Leben. Wenn das derart schwungvoll weitergeht, wird das Leben bald wie eine schwindsüchtige Kranke platt daliegen, ausgesogen und bis an die Rippen ausgepumpt, während das Theater so fett, behäbig und vollgestopft sein wird, ungefähr wie ein Ingenieur, der mit seinen patentierten Unternehmungen Glück gehabt hat und sich nun alles, was die Welt an Genüssen bietet, gestatten darf. Die Bühne braucht Leben! Ja, aber Herrgottsack, woher all das gute, solide, wahrhaftige Leben nur immer nehmen? Aus dem Leben, nicht wahr? Ja, aber ist denn das Leben gar nur so unerschöpflich? Meiner Ansicht nach ist es nur insofern unerschöpflich, als man es ruhig, flüssig und breit, wie einen wilden, schönen Strom seine natürliche Bahn weiterziehen läßt. Man möchte aber bald des Glaubens werden, wir gebildeten Tröpfe von Menschen seien nur noch Ausbeuter, Ausklopfer des Lebens, nicht die natürlichen Kinder desselben. Gerade, als ob das Leben ein großer, staubichter Teppich wäre, der jetzt in diesem unserm Zeitalter über die Stange gehängt 192 und tüchtig geklopft werden sollte. Sogar die Zahntechniker, nachdem sie die Lulu gesehen haben, fangen jetzt an, die Züge und Muskeln des Lebens zu studieren, als gälte es, eine alte Leiche aufzuschneiden, um die Stücke davon auf die Bühne zu schleudern. Die Sache ist die: je lebhafter und natürlicher es auf dem Theater aussieht, desto ängstlicher, behüteter, geärgerter wird es im täglichen Leben ausschauen. Die Bühne übt, wenn sie Wahrheiten ausklopft, einen verschüchternden Einfluß aus; wenn sie aber, was sie etwa früher noch ein bißchen getan hat, goldene, ideale Lügen in großer, unnatürlich-schöner Form ausspinnt, so wirkt sie aufreizend und ermunternd und fördert wiederum die schönen, krassen Gemeinheiten des Lebens. Man ist dann eben im Theater gewesen und hat sich an einer fremden, edlen, schönen, sanften Welt berauscht. Gebt acht mit euern ungezügelten Naturstücken, daß das Leben nicht eines Tages versickert. Ich bin für ein Lügentheater, Gott helfe mir. BEDENKLICHE GESCHICHTE Im Bereiche der Kunst macht oft das Schlechte und Ungenügende, falls man dazu gelangt, es wiederholt zu genießen, den tiefsten Eindruck, Gemeinheit und Rohheit üben auf ein empfindliches Herz einen außerordentlich starken Einfluß aus, während umgekehrt das Feine und Gute nach und nach zu stören imstande ist. Gerade von der Bühne herab reizen schlechte und ungefüge Kunstleistungen die zuschauende Phantasie in ungefähr eben dem Maß, wie es die ganz hohen und vortrefflichen vermögen. Die mittelmäßige Darbietung aber verschmäht man, man empfindet sie sehr leicht als anmaßend und ungebührlich, und sie erntet weder unsern Dank, noch das gesunde Mißfallen, womit wir die schlechte Vorstellung zu belohnen und zu bekränzen pflegen. Der Kunst gegenüber gibt es nur zwei echte Empfindungen, die Entrüstung oder das Entzücken, den Abscheu oder das Wohlgefallen. Man muß entweder spotten dürfen, oder man soll zittern und lechzen müssen. Die Zuhörerwelt will als solche gern etwas Ganzes, Rundes und Massives sein. Ist es nicht möglich, hingerissen und warm zu sein, so möchten wir die Freiheit genießen, die Nase hochmütig und spöttisch rümpfen 193 zu dürfen, die Achsel zu zucken und in ein kaltes, schneidendes Gelächter ausbrechen zu können. Grausamkeit und Rohheit sind gesund, die Verachtung ist ein Gefühl, das diejenigen, die zu einer andern Stunde zu schwärmen verstehen, zu schätzen wissen. Eine halbe Kunstleistung zu schätzen, ist unmöglich. In der Kunst gibt es keine Achtung, keinen Respekt, die Kunst ist nicht unser lieber guter Freund, der Gold wert ist, weil er ehrlich ist. Wenn Kunst nichts als ehrlich ist, ist sie schlecht. Wenn ein Mensch nichts als ehrlich ist, so hat er die denkbar höchste Stufe erreicht, die die Würde emporklimmen kann. Heutzutage treten sehr viele Menschen in die Reihen der Kunstbeflissenen ein, deshalb, weil sie fühlen, daß sie ein gutes und wohlwollendes Herz haben. Man hält sich für einen Künstler, dadurch, daß man empfindet, daß man kein gemeiner Kerl ist. Als ob nicht gerade die Grundlage zur vortrefflichen Kunstarbeit die genaue Kenntnis des Gemeinen wäre. Alle Irrtümer rächen sich, auch die aus den lieblichsten und reinsten Quellen stammenden, und nirgends treten die ebenso holden wie abscheulichen Irrtümer so klar zutage wie auf der Bühne. Vielleicht hat die Kunst im Laufe der Zeit ein zu hohes und zu solides Ansehen gewonnen, es ist zu gefahrlos geworden, sich mit ihr zu befassen, das mag die Ursache sein, warum jeder dritte oder vierte ‘nette Mensch’ Künstler werden will. Man sollte versuchen, dieses Gebiet zu mißkreditieren, damit sich in Zukunft nur die Lumpen oder die Helden darauf zu tummeln wagen. Robert Walser (1878-1956), schweizerischer Schriftsteller, Walser führte nach kurzer Schulzeit ein unstetes Wanderleben; er erlernte (1892-95) das Bankfach in Biel, in Stuttgart versuchte er vergeblich, Schauspieler zu werden. 1898 erschien seine erste Gedichtsammlung. Von 1905-13 lebte Walser bei seinem Bruder Karl, einem bekannten Maler, Graphiker und Bühnenbildner, in Berlin. Hier entstanden in rascher Folge Romane Geschwister Tauner, Der Gehülfe, Jakob von Gunten und eine weitere Gedichtsammlung. Aus wirtschaftlichen Gründen 1913 Rückkehr in die Schweiz nach Bellelay, dann nach Biel und Bern. Es entstanden weitere Prosawerke. 194 TEIL III. Arbeitshilfen Die deutsche Sprache mit ihren großen Schöpfungen vom Nibelungenlied über Luther und Goethe bis heute, diese reiche, elastische und kraftvolle Sprache mit ihren vielen Spielen, Launen und Unregelmäßigkeiten, mit ihrer hohen Musikalität, ihrer Beseeltheit, ihrem Humor ist der größte Schatz, der treueste Kamerad und Trost meines Lebens gewesen, und wenn Dichtungen und Dichter dieser Sprache gerühmt und gefeiert werden, dann gebührt ihr der Hauptteil daran. Wir Dichter dieser Sprache gehören zwar zu den Arbeitern am Bau und an der Differenzierung der Sprache, aber was auch die größten Dichter ihr geben und hinzufügen können, ist unendlich wenig, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Sprache uns gibt und bedeutet. (Hermann Hesse) Sage mir, mit wem zu sprechen dir genehm, gemütlich ist: Ohne mir den Kopf zu brechen, weiß ich deutlich, wie du bist. (Johann Wolfgang von Goethe) Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. (Johann Wolfgang von Goethe) In der Sprache, die man am schlechtesten spricht, kann man am wenigsten lügen. (Friedrich Hebbel) 195 DIE ERLEBNISERZÄHLUNG (der Aufsatz) Anlässe für das Erzählen: - ein besonderes Ereignis (ungewöhnlich, unterhaltsam); bedeutende Personen; ein Konflikt im Zentrum - Wunsch, etwas persönlich Erlebtes zu erzählen - Wunsch, etwas zu erfahren (Hörer) Aufbau A. Einleitung: wo? wann? wer (Haupt- person)? was (Situation)? B. Hauptteil: ein einmaliges Erlebnis Erzählschritte: Steigerung der Spannung / Höhepunkt / Ausklang (meist mehrere Spannungsbogen); Ereignisse logisch und chronologisch verknüpft, in Episoden unterteilt; Raum festgelegt, begrenzt C. Schluss: Schlussgedanke / Lehre / Folgerung / Erklärung Sprachliche Gestaltung 1. Subjektive Darstellung (die Rolle des Erzählers ist fassbar) Ich – Erzähler direkte Rede (wörtliche Rede) Ausrufe, Fragen eigene Gefühle, Gedanken Sinneswahrnehmungen (Sehen, Hören, Fühlen) 2. Stilmittel: expressive Verben, wirkungsvolle Adjektive, Vergleiche, Tropen 3. Zeitstufe: Präteritum 4. Ausgestaltung des Höhepunktes: Präsens möglich 5. Abwechslungsreiche Wortwahl DIE INHALTSANGABE 1. Titel, Verfasser (mit Lebensdaten); Textsorte; Kurzinhalt (Zusammenfassung); 2. Nur wesentliche Aussagen; Ausgestaltung des inhaltlichen Kerns; W-Fragen beantworten (Personen, Orte, Zeit…); Reihenfolge des Textes berücksichtigen; 3. Absicht des Verfassers, persönliche Stellungnahme; Anmerkungen: keine direkte Rede; keine persönlichen Gefühle; Konjunktiv; Präsens; eigenständige Sprache (in eigenen Worten). 196 DIE CHARAKTERISTIK (die Personenbeschreibung) - Gesamteindruck Äußeres (Figur, Gesicht) Kleidung Biographie / Werdegang soziale Situation / Lebensbedingungen finanzielle Lage Beruf / Berufsausübung / Karriere Vorlieben / Abneigungen Verhaltensweisen charakterliche Eigenschaften Einstellungen (zu Umwelt, einzelnen Personen, bestimmten Problemen usw.) DIE LITERARISCHE CHARAKTERISTIK A. Einleitung z.B.: Bedeutung der Person für das literarische Werk (Hauptfigur, Gegenspieler der Hauptfigur, Nebenfigur u.a.) Bedeutung der Person vor dem historischen Hintergrund Aussehen der Person, soweit es aus dem Text ersichtlich ist B. Hauptteil (leitende / gliedernde Gesichtspunkte können sein): - Licht- und Schattenseiten der Person, - Entwicklung der Person im Verlauf der Handlung, - Verhältnis der Person zu Familie, Beruf, Volk, Gott etc., - die Person im Urteil ihrer Freunde und Feinde, - die Ursachen der Wesenszüge (Erbgut, Erziehung, Umwelt). (Textbelege verwenden!) C. Schlussteil z.B.: Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Gesamturteil Hinweis auf Zeitlosigheit oder Zeitgebundenheit der Person Abgrenzung der Person von anderen Figuren des Werkes (Parallel-, Kontrastfiguren) Vergleich der Person mit einer Figur eines anderen Werkes 197 DER BERICHT A. Einleitung: Ort/Zeit/Beteiligte/Art Sportfest, Diebstahl etc.) des Geschehens (z.B.: B. Hauptteil: - Einzelheiten des Vorfalls - in exakter zeitlicher Reihenfolge - eventuell mit Begründungen - keine Spannungskurve (Genauigkeit) und kein Höhepunkt C. Schluss: Folgen des Vorfalls / Ergebnisse Sprache: sachlich; keine innere Handlung; keine wörtlichen Reden (direkte Rede); Präteritum; knapp, aber genau. Thema Inhalt Aufbau Sprache Absicht Erzählung Erlebnis Handlungen, Gefühle, Gedanken, wörtliche Reden Einleitung (knapp) Hinführung zu Höhepunkt ausführlicher Höhepunkt Schluss (knapp) lebhaft und anschaulich (Vergleiche, Ausrufe u.a.) Unterhaltung des Lesers/Hörers Bericht Unfall, Diebstahl, Sport, etc. Ereignisse, keine Gefühle, keine Gedanken, keine direkte Rede vollständige Beantwortung der W-Fragen (Genauigkeit) /genaue Einhaltung der zeitlichen Reihenfolge Beschränkung auf das Wesentliche klar und sachlich (keine Ausrufe etc.) Information des Lesers/Hörers DAS INTERVIEW Globalziel: informieren/überzeugen Medium: meist mündlich; gelegentlich schriftlich Die Beteiligten sind nicht gleichberechtigt; der Interviewer (Reporter) steuert durch Fragen das Gespräch, die Interviewten genießen 198 allerdings eine gewisse Freiheit, was Umfang und Formulierung der Antworten betrifft. Schriftliche Versionen haben meist eine Überschrift (oft als Schlagzeile formuliert). Häufig findet sich ein Vorspann, in dem die Interviewten vorgestellt werden und das Hauptproblem angesprochen wird. Es fehlen weitere Eröffnungs- und Schlusssignale. Gelegentlich leitet der Interviewer mit einer Anrede des Partners ein. Das Interview besteht im Wesentlichen aus Frage – Antwort – Sequenzen. Gelegentlich formuliert der Interviewer Aussagen provokativen Inhalts, die den Partner zu einer Gegenaussage veranlassen sollen. Im Interview wird dem Befragten Gelegenheit gegeben, eigene Vorstellungen, Begründungen, Pläne darzulegen. DIE ERÖRTERUNG Varianten der Erörterung: 1. Pro-Standpunkt (Annahme) Contra-Standpunkt (Ablehnung) Kompromiss (vermittelnder Standpunkt) 2. These (Argument) – Antithese (Gegenargument) Beispiel (Vergleich) unstreitbares Beleg (Beweis) folgerichtige Begründung (Warum ist dies so?) 3. These – Argument – Beweis (Beispiel etc.) Antithese – Gegenargument – Beweis (Beleg; Beispiel) 199 Ausgangsfrage ↓ Einleitung Hauptteil Zweck: Interesse Zweck: Themafrage wecken erörtern a) Hinführung zum Thema; b) geschichtlicher Bezug, Definition des Thema- begriffs, aktuelles Ereignis, persönliches Erlebnis, Statistik/Daten, Zitat/Sprichwort/Spruch; c) Überleitungssatz (logische Verbindung). a) Auseinanderreihung von Argumenten; b) Gegenüberstellung gegensätzlicher Argumente (Vor- und Nachteile; für und wider); c) Pro- Contra persönliche Stellungnahme / Entscheidung mit Begründung. Schluss Zweck: Abrundung a) persönliche Stellungnahme; b) Ausblick in die Zukunft; c) Zusammenfassung. Argument (Aufbau): Behauptung – These / greift Gliederungspunkt auf / muss beweisbar sein Begründung – Argument / stützt die Behauptung / erklärt, warum Behauptung aufgestellt wird Beispiel – Beleg (Beweis) / veranschaulicht konkreter / entsprechenden Gebieten muss entnommen werden Folgerung – Schluss / bestätigt die Behauptung / fasst eine Argumentation zusammen Überleitung – verbindet Argumentationen / soll Gedanken logisch verbinden SPRACHE IN DER ERÖRTERUNG Bezug auf die Überschrift (schriftliche Erörterung), z.B.: Ich möchte mit einigen Worten und so klar wie möglich darlegen, welcher Sinn ... Beginn des Hauptteils, z.B.: Zuerst ist ... zu nennen / Ein wichtiger Gesichtspunkt / Vorteil ... 200 Überleitung zur Themafrage, z.B.: Deshalb stellt sich die Frage ... / um die Frage nach ... beantworten zu können ... Behauptung Aussagesatz, z.B.: Werbung informiert über ... Fragesatz, z.B.: Informiert Werbung nicht ....? vom Gegenteil ausgehend, z.B.: Gäbe es keine Werbung, so würde über ... Begründung (vieles passt der Behauptung) Beispiel • Behauptung, weil /da/denn ... - Das liegt daran, dass ... - Begründet werden kann das damit, dass ... - Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass ... - Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, sind wir zu der Hypothese genötigt, dass ... - Dennoch wurde der letztere Gedanke ... - Auf diese Frage gibt uns ... klare Antwort. - Wir wissen nicht, ob ... - .. aber wir können uns fragen, ... - (oder was immer es sein mag) (als Parenthese) - Es haben sich also dreierlei Dinge ereignet: ... - Wir lernen / erfahren also aus der Analyse ... - Wir fühlen uns gerechtfertigt ... - Wir haben nun die Überzeugung gewonnen ... - Ehe ich meine Auseinandersetzungen fortführe, will ich auf ... Bezug nehmen. - Die erste kann folgendermaßen formuliert werden... - Wir wollen nun die Vorstellung, ..., nennen und ... - Besonders wichtig aber erscheint ... - An erster Stelle ist zu nennen ... - Als letztes Argument gilt ... - Nicht anders verhält es sich ... - Das ist der ganz entscheidende Punkt. - im Grunde genommen ... - vor allem ... • Bei diesem Experiment, wie es ... ausgeführt hat, ... - Als Beispiel kann ... angeführt werden ... 201 - z.B. ... / ... da wollte ich noch was sagen ... ... beispielsweise ... zum Beispiel ... ... und zwar aus meiner eigenen Erfahrung ... ... das heißt, dass ... das wäre das gleiche Beispiel ... also ich habe festgestellt, dass ... ich meine das eigentlich damit ... Gegeneinwand • Aber wir können darauf erwidern, dass ... (Widerspruch) - ... das Problem umgeht, indem sie daran festhält, dass... - ... nicht als ..., sondern nur als ... - ... nicht bloß ..., sondern ... - ... und trotzdem ... / nicht unbedingt ... - Alle anderen mit dieser Vorstellung assotiierten Ideen ... - Ich finde ... nicht so gut. - Also ich wäre nicht für ... - Ich möchte dem allerdings widersprechen ... - Das kann man nicht so verallgemeinern ... Folgerung • - Daher / Deshalb / Dann / Dieses Beispiel zeigt ... ..., und zwar, ... An diesem Punkte müssen wir darauf gefasst sein, ... Wir wollen nun die Vorstellung, ..., nennen und ... Wir wissen nicht, ob ... Man soll das auch nicht unterschätzen ... Das Wichtige war dabei, dass ... Diese Untersuchung / Analyse etc. ... kann folgendermaßen beschrieben werden: ... ... im übrigen muss gesagt werden ... • Verbindung von Argumentationen: hinzu kommt außerdem darüber hinaus 202 weiterhin ähnliches gilt für ... in besonderem Maße gilt ... das ist das richtige Wort ... das ist ganz klar ... auf jeden Fall so ... trotz all dieser Punkte sollte man nicht übersehen ... ebenfalls / nicht nur Schluss /Abschluss (des Argumentes, der Argumentenkette, der Erörterung) • abschließend ... - nicht zuletzt ... - als letztes Argument gilt ... - dabei muss bedacht werden ... - zudem bleibt zu bedenken ... - vor allem sollte man ... - oftmals/meistens ist es so, dass ... - es herrscht die Meinung vor, dass ... - man geht von der Voraussetzung aus, dass ... - allgemein betrachtet ... - so ungefähr sind jetzt die Meinungen ... DIE SEMINARARBEIT (das Referat) Globalziel: informieren, überzeugen Medium: schriftlich oder mündlich Referate sind immer halböffentlich: sie werden für Expertengremien erstellt bzw. vor Expertengremien gehalten. Das Referat muss sich auf die Zuhörer/Leser und deren Wissensvoraussetzungen einstellen. Referat und Seminararbeit sind wesentliche Bestandteile des wissenschaftlichen Lern- und Einübungsprozesses. Beide Begriffe werden heute meist synonym gebraucht, obwohl sich ‘Referat’ etymologisch auf den mündlichen Bericht bezieht. Der mündliche 203 Vortrag soll vor allem thesenhaft formulieren, bewusst Reaktionen der Hörer provozieren, die Diskussionen in der Gruppe auf Schwerpunkte hin strukturieren. Die schriftliche Arbeit hingegen steht unter dem durchaus anderseitigen Anspruch, methodischen Ansatz, Denkschritte und Arbeitsergebnisse in einer gedanklich ausgewogenen, sprachlich ausgefeilten und ‘fertigen’ Form schriftlich darzulegen. Die Anforderungen an den Umfang von Seminararbeiten sind von Fach zu Fach verschieden. Sie reichen von ca. 8-10 Seiten in Einführungsseminaren über 10-15 Seiten in Proseminaren. Idealtypisches Modell der Seminarbeit ist von Umfang und Aufbau her in der Regel der wissenschaftliche Aufsatz. Gewichtige Inhaltsangaben, Unterteilungen in Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte wirken bei 10-15 Seiten Text recht anspruchsvoll. Hingegen bedeutet das Voranstellen einer anschaulichen Gliederung (‘Disposition’) gerade bei einer Arbeit mit einübendem Charakter eine nützliche Orientierungshilfe. Die seitenmäßige Begrenzung der Seminararbeit erzwingt besondere thematische Disziplinierung. Sekundäre Gedankengänge, Exkurse in Randgebiete sind dabei ebenso problematisch wie das Vorschalten allgemeiner historischer oder methodischer ‘Einführungen’, die oft weniger auf eigene Gedanken und Beobachtungen als auf in jedem Handbuch nachlesbare Gemeinplätze des Faches zurückgreifen. In der Regel wird sich eine Seminararbeit sinnvoll darauf beschränken, in einem überschaubaren, eng abgesteckten Materialbereich anhand einiger repräsentativ ausgewählter und gründlich analysierter Belege eine begrenzte Arbeitshypothese zu erproben. Daraus ergeben sich mehr oder weniger von selbst drei wesentliche Teile der Disposition: - Erläutern von Forschungslage, Arbeitshypothese, Kriterien der Materialauswahl, eigener Begriffsbildung, - Durchführung der Untersuchung und Erprobung der Hypothese, Erhärtung der Ergebnisse an exemplarisch eingearbeiteten Belegen, - Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und ggf. Bestimmung ihres Stellenwertes für die Forschungslage. 204 Das formale Gliederungsschema einer Seminararbeit insgesamt könnte etwa folgendermaßen aussehen, wobei in Klammern einige weitere mögliche Gliederungsteile aufgeführt sind: - Titelblatt - Inhaltsangabe bzw. Gliederungsskizze, ( ‘Disposition’) - Literaturverzeichnis (auch am Ende möglich) - (Abkürzungsverzeichnis) - Einleitungsteil - Durchführungsteil - Zusammenfassung, Schlussteil - (ergänzende Materialien) (Anhang). DAS REFERAT Ein Referat ist eine sachliche Darstellung zu einem klar begrenzten Thema, zu dem der Vortragende den Stoff gesammelt und nach eigenen Gesichtspunkten geordnet hat. Dabei muss er Wissensstand und Interesse seiner Zuhörer berücksichtigen. Referate bedürfen eingehender Vorbereitung und übersichtlicher Gliederung, damit die Zuhörer Sachverhalte verstehen, Zusammenhänge erkennen und Ergebnisse nachvollziehen können. Sie gliedern sich in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Die Einleitung soll den Leser/Zuhörer auf das Thema hinführen. Einleitungsmöglichkeiten: - Zitat oder Anekdote, - aktueller Tatbestand, - persönliches Betroffensein oder Beobachtung zum Sachverhalt, - Einordnen in einen größeren Zusammenhang, - Begriffserklärung, - geschichtliche Einleitung, - Darstellung der Gliederung u.a. Im Hauptteil sollen die Gesichtspunkte des Themas klar und anschaulich dargelegt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Gesichtspunkte sinnvoll zugeordnet und übersichtlich angeordnet werden. 205 Der Schlussteil soll die Darstellung abrunden. Möglichkeiten dafür: - persönliche Meinung zu dem Thema, - Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, - Ausblick in die Zukunft, - Appell an die Leser/Zuhörer u.a. Der Vortrag des Referates sollte durch ein Manuskript vorbereitet sein. Bei der Abfassung muss jedoch stets die Vortragssituation bedacht werden. Der Hörer kann nicht wie der Leser zurückblättern oder komplizierte Satzgefüge wiederholen. Deshalb ist unbedingt zu beachten: - Man spricht anders als man schreibt. Bei einem Vortrag empfiehlt es sich, kurze, klare Sätze zu bilden. - Wiederholungen und Hervorhebungen helfen dem Hörer, den dargestellten Sachverhalt besser zu verstehen. - Gedankensprünge verwirren die Zuhörer ebenso, wie das Abschweifen vom Thema. - Es hilft den Zuhörern, wenn der Redner das Gesagte ab und zu zusammenfasst. - Lange Aufzählungen ermüden die Aufmerksamkeit. - Anschauliche Vergleiche und treffende Beispiele dagegen prägen sich den Zuhörern ein. WENDUNGEN FÜR TEXTZUSAMMENFASSUNGEN Das ist ein Auszug aus ... Der vorliegende Text behandelt .. Das Thema des Textes ist ... Der Text ist ... gewidmet. Es geht um ... (Akk.) Es handelt sich um ... (Akk.) Die Rede ist von ... (Dat.) Der Text bietet eine (...) Darstellung (des Problems) über ... Der Text enthält eine (...) Information über ... Der Text gliedert sich in mehrere Abschnitte. Am Anfang des Textes ... Der einleitende Teil behandelt ... 206 Von besonderem Interesse ist die Aussage ... Der Schwerpunkt des Textes liegt in der Analyse ... Der Autor erklärt / hebt (Akk.) hervor / hebt hervor, dass ... / weist auf (Akk.) hin ... Der Autor äußert seine Meinung über ... (Akk.) Ferner behauptet er, dass ... Er beschränkt sich auf ... (Akk.) Im Gegensatz zu ... (Dat.) Im Vergleich zu ... (Dat.) Im Unterschied zu ... (Dat.) Die Übersicht schließt der Autor mit der Behauptung, dass ... Der abschließende Abschnitt ... Abschließend ... Zum Schluss wird gesagt, dass ... Redemittel a) Zur Kennzeichnung der Leitinformation: In diesem Abschnitt - stellt der Autor fest, dass ... - weist der Autor darauf hin, dass .. - nennt der Autor Gründe für ... / Folgen von ... - spricht der Autor über ... b) Zur Kennzeichnung von Beispielen: Der Autor - nennt / zählt mehrere Beispiele auf: ... - erläutert / veranschaulicht / erklärt dies durch folgende Beispiele: ... c) Zur Kennzeichnung von Vergleich / Unterscheidung / Entgegensetzung: Der Autor - vergleicht x mit y. - stellt einen Vergleich zwischen x und y an. - kommt bei einem Vergleich zwischen x und y zu folgendem Ergebnis: ... - unterscheidet zwischen x und y. - macht auf den Unterschied zwischen x und y aufmerksam. Im Gegensatz zu x ist y ... 207 SCHWERPUNKTE EINER VEREINFACHTEN TEXTANALYSE Aufbau: Die ersten Eindrücke beim Lesen eines Textes (z.B. Vorstellung der Situation, in der die Geschichte spielt, und Aussagen dazu); Wie ist der Text aufgebaut? (Vorhandensein der Einführung / Exposition oder abrupter Anfang; zusammenhängender Handlungsablauf; Erzählsprünge; Höhe- und Wendepunkte); Schluss Inhalt: Sinn des Textes erfassen; das erste Textverständnis formulieren; das Problem benennen; Welchen Sinn (Zusammenhang) haben die Verrichtungen / Handlungen / Worte / Beschreibungen? kurze Inhaltswiedergabe (als Einstieg in die Interpretation) Personen: Welche Personen sind eingeführt? In welcher Weise geschieht das? Was erfährt man von den Personen? Welche Rückschlüsse (logischer Schluss aus einer Überlegung) auf ihre Situation, ihren Charakter, ihre Beziehung zueinander etc. sind möglich? Erzähler: Welche Erzählperspektive bzw. Erzählverhältnis liegt vor? Wie wirkt das auf die Darstellung der erzählten Welt aus? Innensicht oder Außensicht des Erzählers; neutraler/auktorialer oder personaler Erzähler Zeit u. Raum: Welcher Zeitabschnitt wird erzählt, wie viel Erzählzeit wird aufgewendet, wie ist das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit? Kann man ein Fortschreiten der Ereignisse in Zeit und Raum beobachten? 208 Erzählerstandort (von wo aus wird das Geschehen gesehen; worauf richtet sich der Blick besonders; wo werden Einzelheiten wahrgenommen) Darstellungsform: Stilmittel: Wie könnte man die Erzählweise charakterisieren (Bericht, Beschreibung, Kommentar u.a.)? Welche Wirkung haben sie? Welche Rolle spielen die Tropen, sprachliche (Verben des Sagens, Epitheta, Zeitadverbien etc.), syntaktische (Satzbau, Tempora, direkte Rede etc.) und phonostilistische (Lautmalerei, Alliteration) Mittel? andere auffällige Einzelheiten (z.B. Interpunktion, graphische Gestaltung) Intention (Absicht) des Autors / Verfassers Persönliche Stellungnahme Anmerkung: Um einen Text genau analysieren bzw. interpretieren zu können, sollen folgende extralinguistische Aspekte berücksichtigt werden: Epoche, in der der Text entstanden ist; literarische Strömung, zu der er gehört; Genre; Persönlichkeit des Autors, Thematik sowie Problematik seines Schaffens. 209 KATEGORIEN DER ANALYSE EPISCHER TEXTE 1. Autor und Erzähler Autor: historische Person Erzähler: vom Autor erfundener, fiktiver Vermittler Erzählsituation: Es gibt drei typische Erzählsituationen, Perspektiven, aus denen ein Erzähler eine Geschichte vermittelt auktorial (der Erzähler greift kommentierend in die Geschichte ein) personal (der Erzähler wird als Person nicht wahrgenommen) Ich – Erzähler (der Erzähler ist selbst Teil der dargestellten Welt) 2. Inhaltsebene Geschehen Geschichte (sinnhafter Fabel/Plot epischer Text (Ereignisse, nicht Verlaufs(Gerüst der Geschichte, (Erzählung, sinnhaftes zusammenhang) ihr Kern, der zentrale Ausformung der Substrat einer Handlungsstrang) Geschichte durch Geschichte) seinen Erzähler) Figurenkonstellation – Handlung und ihre Phasen/Episoden – Konfliktgestaltung – Thema – Motiv(e) – Atmosphäre und Raum 3. Zeitstruktur lineares, chronologisches Erzählen Erzählen in einem Zeitgefüge: Vorausdeutungen – Rückblenden Erzählzeit (Zeit, in der der Erzähler dem Leser die Geschichte vermittelt) erzählte Zeit (fiktiver Zeitraum, in dem sich die Geschichte abspielt) Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit Zeitraffung – Zeitdeckung – Zeitdehnung 4. Darbietungsformen/sprachlich – stilistische Ebene Erzählrede (Bericht, Beschreibung etc.) szenische Darstellung/Figurenrede/ Bewusstseinsstromtechnik: innerer Monolog – erlebte Rede Semantische Ebene: Schlüsselwörter, Leitbegriffe, Leitmotive und ihre lexikalische, konnotative und kontextuelle Bedeutung – Metaphern - Symbole Syntaktische Ebene: Parataxe – Hypotaxe – Ellipsen – Inversionen Stilistische Ebene: Sprachschicht – archaisierender, ironischer Stil etc. (Nach: Texte, Themen und Strukturen) 210 ARBEITSHINWEISE FÜR DIE ANALYSE VON GEDICHTEN I. Ratschläge für die Aufnahme von Gedichttexten 1. Zweimaliges konzentriertes Lesen des Gedichts, nach Möglichkeit laut oder zumindest mit dem Versuch des inneren Mithörens. 2. Genaues Studium der Fragen oder Arbeitshinweisungen, falls vorhanden. 3. Drittes Lesen mit dem Bleistift zum Zweck des Unterstreichens von auffälligen Besonderheiten. 4. Notieren von spontanen Einfällen zu Inhalt, Thema, Form und Sprache und zu übergeordneten Gesichtspunkten jeweils auf gesonderte Blätter. II. Gesichtspunkte für die Materialsammlung 1. Zum Inhalt Titel: Worauf bezieht er sich? Wie ist er sprachlich gestaltet? Bedarf er einer Klärung? Thema: Welches Motiv, welcher Stoff, welcher Gegenstand, welcher Vorgang, welches Problem wird behandelt? Aussage: Stellt der Dichter ein Erlebnis dar? Gibt er eine Stimmung wieder? Entwickelt er einen Gedankengang? Enthält das Gedicht einen Appell? 2. Zur Form Aufbau: Wie viele Teile weist das Gedicht auf? Wie ist ihr Verhälnis zueinander? Wie wurden sie angeordnet (z.B. Abfolge – Gegensatz – Steigerung)? Strophik: Wie sind die Strophen gestaltet (Kürze – Länge – Anordnung)? Welche Strophenformen liegen vor? Metrum: Welches Versmaß liegt dem Gedicht zugrunde? Wie viele Hebungen sind in einem Vers vorhanden? Um welche Art von Vers handelt es sich? Reim: Welches Reimschema wird verwendet? Wie werden die auftretenden Reimarten bezeichnet? Wie enden die Reime? Rhythmus: Welche Besonderheiten des Sprechtempos, der Betonung und des Satzbaus bestimmen ihn? 211 3. Sprache Lautbestand: Welche Konsonanten und Vokale fallen beim lauten Lesen besonders auf? Wie sind die betonten Reimvokale angeordnet? Wortwahl: Enthält das Gedicht Schlüsselwörter? Wird eine bestimmte Wortart bevorzugt? Stammen die Wörter aus einer oder mehreren Stilebenen? Satzbau: Was lässt sich über die Kürze oder Länge der Sätze feststellen? Überwiegt der parataktische oder der hypotaktische Satzbau? Wie sind die Sätze über die Strophen / Verse verteilt? Bildlichkeit: Wo und wie verwendet der Dichter Vergleiche, Metaphern, Personifikationen, Schiffren? Welche Symbole kommen vor? Sind allegorische Elemente vorhanden? 4. Zusammenfassung Art des Gedichts: Liegt eine besondere Gedichtgattung (Lied) oder Gedichtform (Sonett) vor? Handelt es sich um Erlebnis- oder Gedankenlyrik? Kann man von einem “appellativen Gedicht” sprechen? Werkzusammenhang: In welchem Zusammenhang steht das Gedicht mit einem Werk, mit einer Schaffensperiode oder dem Gesamtwerk des Dichters? Epochenzuordnung: In welche literaturgeschichtliche Epoche ist das Gedicht aufgrund seiner inhaltlichen, formalen und sprachlichen Besonderheiten einzuordnen? III. Möglichkeiten zur Gliederung einer Gedichtanalyse 1. Vorgehen nach den sog. “W-Fragen”: - Was? (Titel, Thema, Zusammenfassung des Inhalts) - Wie? (Besonderheiten von Form und Sprache) - Warum? (Aussage, Absicht des Dichters) Diese Gliederung hat den Vorteil, dass sie leicht überschaubar und handhabbar ist. Ihr Nachteil liegt in der Gefahr, dass eine “Zerlegung” des Textes stattfindet. Wenn dieser Aufbau gewählt wird, ist besonders auf den Zusammenhang zwischen den drei Teilen zu achten. 2. Das sog. “chronologische Vorgehen”: - Untersuchung des Aufbaus oder des Gestaltungsprinzips (Einteilung in Sinnabschnitte oder Bilderfolgen) 212 - Analyse der Einheiten nach inhaltlichen, formalen und sprachlichen Gesichtspunkten (Beschränkung auf wesentliche Besonderheiten, Aufzeigen der gegenseitigen Bezüge) - Deutung des gesamten Gedichts (unter den Gesichtspunkten der Entstehung, der Absicht, der Wirkung) Dieser Aufbau eignet sich vor allem für Interpreten, die wegen mangelnder Kenntnis von Gesichtspunkten außerhalb des Textes auf das werkimmanente Verfahren angewiesen sind. Der ganzheitliche Charakter gerade des Gedichts wird so am ehesten gewahrt. 3. Die “zentralanalytische Methode”: Hierbei wird der Versuch unternommen, Inhalt, Form und Sprache des Gedichts unter einem einheitlichen Aspekt zu analysieren und zu deuten. Als zentrale Gesichtspunkte kommen in Frage werkimmanent - der Titel des Gedichts - das Hauptmotiv - ein Schlüsselwort - ein Zentralsymbol werkintern - die Biographie des Dichters - die Entstehung des Gedichts - die Funktion im Einzel- oder Gesamtwerk - die Einordnung in eine Epoche (literaturgeschichtlich, kunstgeschichtlich, politisch, gesellschaftlich) In allen Fällen erfolgt die Auswahl und Auswertung der Merkmale des Gedichts unter dem zentralen Gesichtspunkt, dem sich alle Einzelheiten unterzuordnen haben. 4. Der Gedichtvergleich: Der Gedichtvergleich kann folgende Aufbauformen aufweisen: - getrennte Analyse der beiden Gedichte; Aufweis der Gemeinsamkeiten und Unterschiede - Vergleich der beiden Gedichte nach dem “Was?”, “Wie?” und “Warum?” - Aufweis der Gemeinsamkeiten, dann der Unterschiede; Klärung der Ursachen der gemachten Beobachtungen. 213 ASPEKTE DER TEXTINTERPRETATION Das lateinische Wort “interpres” bedeutete ursprünglich “Zwischensprecher” (zwischen Personen und Parteien; jetzt: Dolmetscher, Vermittler). Das Interpretieren ist auf Adressaten Leser oder Zuhörer – gerichtet. Der Begriff Interpretation wird in zweierlei Weise gebraucht: Er bezeichnet einmal den Vorgang des Interpretierens und zum andren das fertige, in Form eines Aufsatzes vorgelegte Ergebnis. Das eine ist ein oft langwieriger, immer wieder durch Lektüre und Informationssuche unterbrochener oder auch einmal in die Irre gehender Arbeitsprozess. Das andere ist eine wohlgeordnete, stilistisch gelungene, inhaltlich überzeugende und den Leser/ Hörer beeindruckende Abhandlung/Rede. Es ist üblich, den Gesamtzusammenhang von theoretischen Grundlagen, praktischen Regeln und Arbeitsweisen als Methode der Interpretation zu bezeichnen. Ein einzelner Arbeitsschritt (z.B. Untersuchung des Wortschatzes) ist noch keine Methode, sondern nur eine Technik, deren sich die Interpretationsmethoden bedienen können. Zur Methode gehört ein bestimmter Ausgangspunkt und ein Vorwissen um das Ziel, das man erreichen will. Keiner kann sagen, wie viele solcher Methoden es wohl gibt. Keine der Methoden kann vier Aspekte nicht ausschließen. 1. Autor – “einen Autor durch seinen Text verstehen”: Aus diesem Wunsch entstand zuerst das Bedürfnis nach einer kunstgerechten Interpretation. Um es an Beispielen zu verdeutlichen: Goethes Weltsicht durch seinen “Faust”, Kafkas Nöte und Ängste durch seinen Roman “Der Prozeß” zu verstehen, das sind Ziele methodischer Bemühungen, die von der traditionellen Hermeneutik über das weite Gebiet der Geistesgeschichte bis zur modernen Psychologie reichen. Hermeneutik: 1. wissenschaftliche Auslegung und Erklärung eines Textes oder eines Kunst- oder Musikwerkes; 2. in der Philosophie – metaphysische Methode des Verstehens menschlichen Daseins. 2. Realität – “einen Text von den Fakten her erklären”: Diese Aufgabe der Interpretation konnte erst erhoben werden, als die exakten Naturwissenschaften im 19.Jh. den 214 Geisteswissenschaften den Rang abliefen und diese den verlorenen Boden wieder gutmachen wollten. Z.B.: Welche biographischen, literarischen, gesellschaftlichen, geschichtlichen etc. Bedingungen erklären, dass Lessings “Nathan der Weise” nur so und nicht anders entstehen konnte? (Positivismus in der Textphilologie, Literatursoziologie). 3. Text – “einen Text als autonomes Werk begreifen”: Als Reaktion auf politische und geistesgeschichtliche Irrwege ergab sich für die Literaturwissenschaft (besonders nach dem 2.Weltkrieg) die Forderung, auf das zurückzukommen, was Ausgangspunkt der Interpretation sein sollte: auf den Text (Stilanalyse, Strukturalismus, Werkinterpretation). 4. Leser – “als Leser auf einen Text reagieren”: Eine unablässig sich drehende Interpretationsmühle musste endlich den Leser und seine Verteidiger auf den Plan rufen. Es zeigte sich, dass Leser sehr unterschiedlich reagierten. Es konnte nicht nur an den Lesern, sondern musste auch an der sprachlichen Eigenart der Texte liegen, wenn so viele verschiedene Reaktionen möglich waren. DER ROMAN Merkmale des Romans: - ausführliche Darstellung - Vielfalt von Geschehnissen: mehrere Motive, Einzelheiten, Abschweifungen, Umwege - psychologische und gesellschaftliche Hintergründe - Rolle des Erzählers (ich / er) Romantypen Klassischer Roman: Entwicklungsroman Familienroman Liebesroman historischer Roman 215 Moderner Roman: Abenteuerroman Kriminalroman Heimatroman Science Fiction MERKMALE DES DRAMAS - Ausführung durch Schauspieler im Theater Dialog und Monolog Aufbau: Szenen, Bilder, Akte Handlung: Konflikt – Spannung – Höhepunkt – Verzögerung – Katastrophe / Lösung Handlungsdrama (klassisches Drama) Lesetipp: G.E.Lessing “Nathan der Weise” - ernster Inhalt - erfolgreicher Held - versöhnliches Ende - Zuschauer soll mitfühlen - durchgängige Rollen - meist Einheit von Zeit, Ort, Handlung Tragödie (Trauerspiel) Lesetipp: W.Shakespeare “Romeo und Julia” - Konflikte der Helden mit Schicksal, Mitmenschen und Leidenschaften - tragischer Untergang des/der Helden Erzähldrama (episches Drama) Lesetipp: B.Brecht “Mutter Courage und ihre Kinder” - Verfremdungseffekt: Songs, Kommentare u.a. - lockere Szenenfolge - Zuschauer soll kritisch sein - Gesellschaftskritik - erzählerische Abschnitte Komödie (Lustspiel) Lesetipp: C.Zuckmayer “Der Hauptmann von Köpenick” - scheinbare Konflikte, Verwicklungen, Verwechslungen - heitere Auflösung 216 MÄRCHEN, SAGE, LEGENDE Gemeinsame Merkmale: - Phantasieerzählungen und –gestalten - mündliche Überlieferung - späte schriftliche Aufzeichnung Märchen - Beginn: Es war einmal ...; keine genauen Orts- und Zeitangaben - Phantasiegestalten: Hexe, Fee, Riese, Zwerg, Geister - wunderbare Begebenheiten - Konflikt zwischen Gegensätzen: gut-böse, arm-reich etc. - symbolische Zahlen: drei Wünsche, sieben Zwerge etc. - Schluss: glücklicher Sieg des Guten, Bestrafung des Bösen Sagen und Legenden - Beginn: Angabe von Ort, Zeit und Namen - Gestalten: Helden, Götter, Heilige - wirkliche Begebenheiten, jedoch ausgeschmückt - Kämpfe, Heldentaten, Einsatz für den Glauben - Sieg oder Untergang des Helden oder Heiligen; Lehre für den Menschen NOVELLE UND KURZGESCHICHTE Gemeinsame Merkmale: - Darstellung eines Einzelereignisses - entscheidender Augenblick im Schicksal eines Menschen - Erzählung im weitesten Sinne Novelle - Herkunft: 14.Jh. Italien (Boccaccio “Decamerone” - einzelnes, ungewöhnliches Ereignis - geradliniger Handlungsaufbau mit Höhepunkt, Wendepunkt oder Pointe - eindeutige Charakterschilderung 217 - feste Weltordnung - Einbau eines Symbols Kurzgeschichte - Herkunft: 19.Jh. (amerikanische “short story”) - knappe, spannende Darstellung eines Einzelschicksals - Verkürzung auf das unbedingt Nötige - Höhepunkt oft am Schluss - häufig offener Schluss - Herausforderung des Menschen im Alltag - Probleme des modernen Lebens 218 ERZÄHLUNG, NOVELLE, KURZGESCHICHTE (ein schematischer Vergleich) Erzählung Bedeutende Personen der bürgerlichen Welt; ein Konflikt im Zentrum Novelle Bedeutende Personen der bürgerlichen Welt; unerhörte Begebenheit; ein Konflikt im Zentrum Kurzgeschichte Außenseiter, Ausgestoßene; alltägliche Menschen; Ereignis oft zweitrangig; menschliche Verhältnisse im Zentrum Charaktere plastisch herausgearbeitet plastisch herausgearbeitet grob umrissen; angedeutet; von Leser auszuführen Handlung linear (= stetig, gleichbleibend) Ereignisse logisch und chronologisch verknüpft, in Episoden unterteilt linear; logisch chronologisch Ereignisse aus der Vergangenheit; Erzählzeit und erzählte Zeit übersichtlich auseinander gehalten s. Erzählung spielt in Vergangenheit und Gegenwart zugleich; oft nicht unterschiedbar subjektiv; Kalenderzeit und subjektive Zeit verquickt Tempo und Rhythmus eher gemächlich, diskursiv; lockere, meist mehrere Spannungsbögen schnell; Aufstieg und jäher Abfall; wenn mehrere, dann straffe Spannungsbögen Spannung aus dem Gegenüber und Ineinander verschiedener Wirklichkeiten Raum festgelegt, begrenzt festgelegt, begrenzt zertrümmert; Ineinander von objektivem und imaginärem Raum Perspektive Rolle des Erzählers fassbar Rolle des Erzählers fassbar Figuren und Ereignisse durch die Augen der Hauptpersonen gesehen; Erzähler nicht fassbar Sprache gewählt; literarisch; oft schildernd, erklärend gewählt; literarisch; oft dramatisch Alltagssprache; elliptisch; andeutend Gegenstand Zeit 219 und Fabel kann fehlen; wenn vorhanden, zerfetzt; verschobene, scheinbar alogische Reihung von Erzählskabinen GLOSSAR: Begriffe für die Texterschließung Absicht s. Lehrabsicht äußere Handlung s. Textverständnis, erstes allwissender Erzähler s. Erzähler auktorialer Erzähler s. Erzähler, Erzählverhalten Aussage: ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Inhalt und Gestalt eines Textes. Aussage-Absicht: das, was der Autor mit dem von ihm gestalteten Inhalt seines Textes sagen will. Bei vielen Texten ist es der Beitrag, den der Autor zur Beleuchtung eines menschlichen Problems gibt. Auswahl: Entscheidung des Autors darüber, welche Einzelheiten der erdachten Handlung, zur Beschreibung einer Person oder Situation er zur Sprache bringt oder nicht. Autor: Verfasser eines Textes, z.B. Goethe, Thomas Mann, Heinrich Böll, zwischen sich und den Leser stellt der Autor den Erzähler. Belegen: die Tätigkeit eines Textbetrachters, zur Stützung einer Aussage über den Text Stellen aus dem Text herauszusuchen, an denen das Ausgesagte zu sehen oder aus denen es zu erschließen ist. Beweggrund: Ursache, die eine Person zu einer bestimmten Handlung bringt. Bewertung, literarische Beurteilung: Stellungnahme des Erzählers zum Geschehen und insbesondere zum Verhalten der handelnden Personen. Zu unterscheiden sind ausdrückliche Bewertungen (Erzählerkommentar s. Darbietungsweisen, auktorialer Erzähler, s.Erzählverhalten, Erzähler) und implizite Bewertungen, die sich ergeben aus der Art der Darstellung und der erzählerischen Gestaltung (vgl. Gestaltungsmittel). Bildhaftigkeit vgl. Metapher, Symbol Blickfeld s. Blickrichtung Blickrichtung: Richtung, in die der Erzähler schaut; von ihr hängt die Auswahl ab, ferner, was im Mittelpunkt des Blickfeldes steht und was am Rande (Schwerpunktsetzung); die Blickrichtung steht im Zusammenhang mit dem 220 Erzählerstandort und dem Blickwinkel, ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Blickwinkel: der Winkel, unter dem das erzählte Geschehen gesehen wird; steht in Zusammenhang mit dem Erzählerstandort und der Blickrichtung; wirkt mit ein auf die Auswahl, ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Chiffre: Zunächst dienen Chiffren als Geheimzeichen dazu, Erkenntnis zu verschlüsseln, nicht offen zu legen. Insbesondere moderne Kurzgeschichten bedienen sich der Verrätselung durch Chiffren. Da sie für die Autoren einen Stimmungswert haben, der nicht festgelegt ist, fordern sie dem Leser beim emotionalen Nachvollziehen hohe Konzentration ab. Dies ist auch auf der rationalen Ebene erforderlich, weil die Chiffre ihre Bedeutung aus dem Kontext der Kurzgeschichte empfängt, dessen Sinn sie ihrerseits wesentlich beeinflusst. Darbietungsweisen, erzählerische: Erzählbericht, die erzählerische Darstellung des Geschehens, gerichtet auf den unmittelbaren Geschehensvorgang, die “narratio”. Erzählkommentar: Stellungnahme zum erzählten Geschehen, Zwischenbemerkungen, allgemeine Überlegungen, Ausblicke, insbesondere Vorgriffe, Rückblicke, auch Rückblenden, usw. Beschreibung, Schilderung, direkte Rede, zumeist als Dialog; innerer Monolog. Detailliert darstellen: beim Erzählen die Einzelheiten ausführen, möglicherweise auf besonders anschauliche Art; ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Deuten: die Tätigkeit, einem Text insgesamt eine Aussage zuzuschreiben und diese zu Inhalt und Gestaltungsmitteln in Beziehung zu setzen. Dabei geht es auch darum, den Zusammenhang von Inhalt und Gestaltung und die Textwirkung aufzuweisen. Es geht auch darum, die Bedeutung einzelner Stellen herauszustellen und Zusammenhänge innerhalb eines Textes aufzuweisen: zwischen Handlungsteilen, Verhalten und Beweggründen von Personen; vgl. Textverständnis, begründetes; Verstehensprozess. Einwirken s. Lehrabsicht 221 Erlebte Rede: Sie verwendet die 3.Person des Indikativ Präteritum und liegt zwischen der wörtlichen Rede und dem inneren Monolog (Ich-Form). Der Erzähler schlüpft in eine Person, um ihre Gedanken wiederzugeben. Er bleibt aber als Erzähler noch erkennbar. Ersteindruck, erste Eindrücke s. Textverständnis, erstes Erwartung s. Lesererwartung Erzählbericht s. Darbietungsweisen Erzähler: vom Autor erdachte Gestalt, die von ihrem Standort aus (vgl. Erzählerstandort) auf ihre Weise das Geschehen sieht und erzählt. In vielen Texten tritt der Erzähler nicht hervor, sein Standort muss aus dem Erzählten erschlossen werden (impliziter Erzähler, verborgener Erzähler), er erzählt wie ein unsichtbarer Beobachter. In manchen Texten wendet sich der Erzähler direkt an den Leser (expliziter Erzähler, auktorialer Erzähler, vgl. Erzählverhalten, allwissender Erzähler). Der allwissende Erzähler hat Außen- wie Innenperspektive, kann den Erzählerstandort wechseln ihn auch über das erzählte Geschehen stellen (“olympischer Standort”); er kann als auktorialer Erzähler auftreten, aber auch wie ein unsichtbarer Beobachter erzählen. Im extremen Fall kennt der Erzähler auch die Zukunft und macht über sie Andeutungen. In Rahmenerzählungen tritt der Erzähler in der Rahmenhandlung als Person auf, er erzählt die Binnenhandlung. Erzählerische Darbietungsweisen s. Darbietungsweisen Erzählerische Gestaltungsmittel, erzählerische Mittel s. Gestaltungsmittel Erzählerkommentar s. Darbietungsweisen Erzählerstandort: der Punkt, von dem aus der Erzähler das erzählte Geschehen sieht; der Standort kann dicht vor dem erzählten Geschehen sein, in mittlerer Entfernung oder weit entfernt, der Erzähler kann auch in dem Geschehen oder über dem Geschehen stehen, wenn er darüber steht, kann er allwissend sein; es gibt auch Texte mit wechselndem und solche mit unbestimmtem Erzählerstandort; die Wahl des Standortes steht in Zusammenhang mit dem Erzählverhalten, auch der 222 Erzählform und Erzählperspektive sowie mit Blickwinkel und Blickrichtung; wirkt bestimmend ein auf die Auswahl; die Wahl des Standortes ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Erzählform: Ich-Form: zumeist ist dabei eine der handelnden Personen der Erzähler. Der Erzähler tritt neben anderen Personen selber in Erscheinung und teilt Erlebnisse, Beobachtungen oder Wissen mit, das er von den anderen Figuren des Geschehens erfahren hat. Die Darstellung ist entweder autobiographisch – der Autor ist der Erzähler – oder fiktional – zwischen dem Autor und dem Erzähler wird klar unterschieden. Das Erzählte wirkt gegenüber der neutralen und auktorialen Perspektive zugleich eingeschränkter und subjektiver, weil der Erzähler mit einer Person identisch wird und aus ihrer Sicht berichtet. Anders als bei der auktorialen Form kann der Ich-Erzähler innere Vorgänge anderer Personen nur insoweit mitteilen, als diese äußerlich sichtbar werden. Er/sie-Form: verknüpft mit Erzählperspektive, Erzählerstandort, Erzählverhalten, ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Der Bericht des Erzählers konzentriert sich auf eine Person, aus deren Sicht das Geschehen erzählt wird. Erzählhaltung s. Erzählverhalten Erzählperspektive: Außensicht: der Erzähler gibt nur Boebachtungen wieder, die er als Außenstehender macht. Er kann sich also über die Gedanken und Gefühle der handelnden Figuren täuschen. Die Außensicht findet sich häufig bei neutraler Erzählhaltung; teilweise begegnet sie auch in der Ich-Erzählung, da der Ich-Erzähler innere Vorgänge bei anderen Personen nur wahrnehmen kann, insoweit dies äußerlich sichtbar werden. Innensicht: der Erzähler kann in das Innere der Personen hineinsehen, kennt ihre Gefühle, Gedanken, Vorstellungen; verknüpft mit Erzählform und Erzählerstandort. Diese Erzählperspektive wird bei der auktorialen Erzählhaltung, dem inneren Monolog und der erlebten Rede verwendet. Erzählsprung: Der Erzähler lässt beim Erzählen des Geschehens eine größere Zeitspanne aus, überspringt sie; ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. 223 Erzählung: Wird oft als Oberbegriff für eine kürzere Kunstform verwendet, wie z.B. Sage, Märchen, Legende, Schwank, Anekdote. Die Grenzen zwischen Erzählung und Kurzgeschichte sind fließend. Dennoch lassen sich einige Unterschiede feststellen: Die Erzählung bezieht sich enger auf tatsächliche Erlebnisse und Erfahrungen oder erweckt den Anschein, dies zu tun. Dadurch wird der fiktionale Charakter weniger betont als bei der Kurzgeschichte. Anders als die Kurzgeschichte hat die Erzählung meistens einen linearen Handlungsverlauf mit Anfang und geschlossenem Ende. Die Handlung wirkt weniger hintergründig, die Komposition enthält nicht so viele offenen Stellen, die der Leser selbst füllen muss. Erzählverhalten: auktoriales Erzählverhalten: der Begriff ist von lat. auctor = Urheber, Verfasser abgeleitet. Hier bringt sich der Verfasser als Erzähler selbst ins Spiel, indem er sich kommentierend, reflektierend und beurteilend in das Geschehen einmischt. Er tut dies aus einer allwissenden Position, er überblickt den Handlungsablauf und kann Gedanken und Gefühle der handelnden Personen wiedergeben. Der Erzähler ist ein Mittelsmann zwischen der dichterisch dargestellten Welt und der Wirklichkeit des Autors. Im souveränen Umgang mit der Zeit kann er Vorausdeutungen, Rückblenden und Überlegungen verwenden. Eine Sonderform des auktorialen Erzählverhaltens ist die erlebte Rede; neutrales Erzählverhalten: der Erzähler berichtet wie ein außenstehender Beobachter, berichtet ohne Stellungnahme, auch dann, wenn er Innenvorgänge erzählt (innere Handlung, vgl. Handlungsverlauf); Durch die Er-Erzählung mit häufig verwendeter wörtlicher Rede entsteht der Eindruck objektiver Wiedergabe. Das schließt jedoch nicht aus, dass der Leser den Eindruck haben kann, das Geschehen mitzuerleben; personales Erzählverhalten: der Erzähler tritt hinter die handelnde Person zurück, wählt die Sicht (d.h. Sehweise und Blickfeld) der Personen; verknüpft mit Erzählform, Erzählperspektive, Erzählerstandort sowie Darbietungsweise; ist eine Voraussetzung der erzählerischen Gestaltung. 224 Exposition: einleitender Teil eines Dramas oder eines erzählenden Textes, die Personen werden eingeführt, die Problemlage bzw. der Konflikt dargestellt, der Handlungsverlauf angebahnt. Gestaltungsmittel, erzählerische: Auswahl, Schwerpunktsetzung und Blickwinkel Wahl des Erzählerstandortes, Wahl von Blickwinkel und Blickrichtung, Erzählperspektive, Erzählform, Erzählverhalten; Reihenfolge, Wahl der Darbietungsweise, Darstellungsdichte (detailliert oder summarisch), Grad der Anschaulichkeit und Abstraktheit, Art der Personengestaltung; sprachliche Mittel: Wortwahl (insbesondere: Bevorzugung eines Bedeutungsfeldes, Sprachebene), Tempuswahl, Tempuswechsel, Lautmalerei, Prosareim, Assonanz, Alliteration, Bildhaftigkeit, z.B. Metaphern, Symbole, Stilfiguren der literarischen Rhetorik z.B. Personifikation, Satzbau (Syntax). Handlungsverlauf: die aufeinanderfolgenden Schritte der Handlung: äußere Handlung, die mit den Augen und anderen Sinnen unmittelbar wahrgenommen werden kann; innere Handlung, die Entwicklung der Gefühle und Gedanken, auch der Handlungsvorsätze und Beweggründe in den handelnden Personen. Hinweise im Text s. Textsignale innere Handlung s. Textverständnis, erstes Innerer Monolog: Es handelt es sich um einen Monolog in der IchForm, der von den Tempora her nicht festgelegt ist. Der Erzähler versucht das Bewußtsein einer Person zu verdeutlichen, schlüpft in diese hinein und ist für die Dauer des inneren Monologs nicht präsent. Er erreicht dadurch eine Innensicht. Diese Erzählform findet sich häufig im Kontext der personalen Erzählhaltung, damit der Leser das Erzählte „mit den Augen einer Romanfigur“ sehen kann. Interpretation s. Deutung Interpretationshypothese s. Textverständnis, erstes Konflikt s. Problem Lehrabsicht: ein Autor will mit seinem Text auf das Verhalten der Leser moralisch einwirken. Solche Texte nennt man lehrhafte Texte. Ein typisches Beispiel dafür ist die Textart Fabel. 225 Leseeindruck s. Textverständnis, erstes Lesererfahrung (= Leseerfahrung) s. Textverständnis, erstes Lesererwartung: Erwartungen des Lesers bezüglich des weiteren Handlungsverlaufes und des Verhaltens der Personen; wirkt auf die Textwahrnehmung des Lesers; ist ausgelöst durch den schon gelesenen Teil des Textes, vor allem durch die besonderen Textsignale darin; die Lesererwartung wird durch den Fortgang des Textes entweder bestätigt oder teilweise oder ganz verworfen; vgl. Leserlenkung. Leserlenkung: die Art und Weise, wie der Autor bzw. Erzähler die Wahrnehmung des erzählten Geschehens und der Personen lenkt, z.T. durch die Art der Blickführung, zumeist durch Textsignale, auch durch Weglassen oder Detaillieren, vgl. Gestaltungsmittel; Reihenfolge. Metapher: sprachlicher Ausdruck, mit einer ursprünglichen (“eigentlichen”) und einer übertragenen Bedeutung. Die übertragene Bedeutung hat mit der ursprünglichen ein oder mehrere Merkmale gemeinsam, z.B. “Flussarm”, der “Redestrom”; der Autor bzw. Erzähler meint die übertragene Bedeutung; vgl. Symbol. Motiv: (von lat. movere = in Bewegung bringen) die Motive sind meistens Verhaltensweisen in bedeutenden Situationen, die den Schaffensprozess des Autors auslösen. Solche Situationen können z.B. sein Brutalität oder Ohnmacht des Einzelnen („Die Killer“ von Hemingway), eine unausweichliche Entscheidung („Die Versuchung des Richters“ von Flake), Widerstand gegen die Routine des Alltags („Das Experiment“ von Seuren), das Beharren auf einem Vorurteil („Das Judenauto“ von Fühmann). Es ist nicht leicht, das Motiv vom Thema abzugrenzen. Das Thema stellt in der Regel den äußeren Anlass der Erzählung, den vordergründigen Erzählgegenstand oder Ort und Zeit der Handlung dar, das Motiv hingegen die Absicht des Erzählers, die sich der Leser gedanklich erschließen muss. Person, Personengestaltung: in vielen Texten werden die Personen literarisch charakterisiert durch besonderes Aussehen, Körperhaltung und Bewegung, Redeweise und Verhalten usw.; Person und Figur: Person: ausgeführte, konkret vorstellbare menschliche Gestalt, die zumeist literarisch charakterisiert ist, 226 Figur: die abstrakte Gestalt, deren Eigenschaften, Aussehen, Gewohnheiten und Handlungsweise sich der Leser nicht vorstellen kann, manchmal bloßer Rollenträger; die Art der Personengestaltung ist ein erzählerisches Gestaltungsmittel. Perspektive 1. Erzählperspektive 2. Sicht Pointe: überraschende Wendung des Gedankens oder eines erzählten Geschehens in einem Punkt zusammengedrängt, oftmals Höhepunkt der Darstellung mit unerwartetem Inhalt am Textschluss, auch: überraschende zentrale Aussage eines Textes. Problem: ein Daseinsproblem des menschlichen Lebens, das in einem literarischen Text künstlerisch dargestellt wird; oft besteht das Problem in einem Konflikt, d.h., einem Widerstreit, zwischen zwei Auffassungen, Pflichten, Werteinstellungen, Kräften, auch in einem Streit zwischen zwei Menschen. Rahmenerzählung s. Erzähler Regeldurchbruch: ein Autor verstößt absichtlich gegen Normen sprachlicher Richtigkeit, um besondere Aufmerksamkeit zu bewirken; in vielen Texten möglich, besonders vorkommend als Durchbruch durch die metrische Regelmäßigkeit im Gedicht; in die Nähe des Regeldurchbruchs kommt es, wenn ein Autor bzw. Erzähler mit der Lesererwartung spielt, z.B. eine Person eine Handlung begehen lässt, die zu ihrem sonstigen Verhalten nicht passt, also gegen die Erwartungsregel der Kostanz des Verhaltens verstößt. Sicht: Art und Weise, wie ein Geschehen gesehen wird; Sicht des Erzählers, der einzelnen handelnden Personen, auch des Lesers. Die Änderung der Sicht ist eine der Formen des produktiven Umgangs mit Texten, der “kreativen” oder “aktiven Rezeption”, vgl. Gestaltungsmittel, Blickrichtung, Blickwinkel. Short story: (engl. = kurze Geschichte) eine anglo-amerikanische Kurzform der Epik, die formal nicht streng festgelegt ist. Sie entstand in der ersten Hälfte des 19.Jh. in den USA aus den Bedürfnissen des sich ausbreitenden Zeitungs- und Zeitschriftenwesens. Die Autoren hatten den eiligen Leser des 227 Industriezeitalters vor Augen. Der Umfang der short story wurde von dem Journalisten Fechter auf eine Formel gebracht: „Geschichte – einen Haarschnitt lang“. Folglich musste sich der Autor auf eine entscheidende Situation, ein Ereignis, einen Augenblick konzentrieren und packend schreiben. Dem entsprechend ein geradliniger Handlungsverlauf, oft Beschränkung auf eine Hauptfigur, ein der Realität des Lebens entkommener Inhalt, eine flüssige, auf Effekte abzielende Sprache. Die geschlossene Komposition der Novelle musste aufgegeben, auf eine Entfaltung in Zeit und Raum verzichtet werden. Insbesondere Edgar A.Poe und später O’Henry, London, Hemingway, Steinbeck und Faulkner entwickelten die short story zur Kunstform, bei der die Situation oder das Ereignis „zur Essenz des Lebens“ (Gero von Wilpert) werden mussten. Standort s. Erzählerstandort Stellungnahme, literarische s. Bewertung Symbol: (griech. Verb symballein = zusammenwerfen, vergleichen, schließen, erraten) bildhafter sprachlicher Ausdruck, mit zugleich eigentlicher und übertragener Bedeutung, z.B. “Bär” bedeutet konkret das Tier, das Honig liebt usw. und steht zugleich als Verkörperung für große körperliche Stärke, Gutmütigkeit, Tapsigkeit, entsprechend “Löwe”, vgl. Metapher. Symbolische Bedeutung in Kurzgeschichten können Gegenstände annehmen: z.B. der ausgeschlagene Zahn in „Freund der Regierung“ von Lenz symbolisiert Widerstand gegen ein diktatorisches System. Ferner wirken Orte symbolisch, z.B. eine unfallträchtige Autobahnkreuzung verweist auf die Sensationslust der Menschen des Industriezeitalters in „Bleckboint“ von Max Maetz, der Ort San Salvador erscheint als Symbol für ein exotisches Land der Träume in „San Salvador“ von Peter Bichsel. Auch Menschen können in Kurzgeschichten etwas symbolisieren, z.B. steht Christine in der gleichnamigen Kurzgeschichte von Marie Luise Kaschnitz für Schönheit und Anmut. Textsignal: besondere Stelle im Text mit zeichenhafter Bedeutung, die als auffällige Elemente verschiedenster Art, teils inhaltlicher, teils gestalterischer, die Aufmerksamkeit des 228 Lesers auf sich ziehen; es kann sich beispielsweise um die Redeweise einer Person, um besondere Körperbewegungen, es kann sich um Besonderheiten der Wortwahl, des Satzbaus, auch um eine auffällige Erwähnung von Farben handeln; zu den Signalen gehören auch auffällige Wiederholungen, bzw. Wiederaufnahmen, Parallelen, mehrfaches Auftreten des Gleichen in verschiedenen Stellen, ferner Vorausdeutungen. Textverständnis, begründetes: Ergebnis der Untersuchung eines Textes; ausgehend von Interpretationshypothese werden die Besonderheiten von Inhalt und Gestaltung eines Textes erfasst und dabei das Zusammenpassen von Inhalt und Gestaltung befragt; vgl. Deutung, Verstehensprozess. Textverständnis, erstes: entsteht aus den ersten Eindrücken vom Text als ein vorläufiges Verstehen des Inhalts, insbesondere des Handlungsverlaufs und des Verhaltens der Personen und der Problemlage und der Gestaltung; lässt sich als formulierte Interpretationshypothese aussprechen; vgl. Deutung, Verstehensprozess. Textwahrnehmung s. Lesererwartung, Textverständnis erstes und begründetes Textwirkung 1. Wirkung einzelner Elemente der Gestaltung auf die Textwahrnehmung des Lesers; 2. Wirkung des Gesamttextes, als das Zusammenwirken von Inhalt und Gestalt, als Wirkung des gerade auf die Weise dieses Textes gestalteten Inhalts. Untersuchung s. Textverständnis, erstes und begründetes, Verstehensprozess Verhalten: die Handlungen der Personen in einem literarischen Text; Verhalten wird manchmal gleichbedeutend mit ‘Handlung’, ‘Taten’ gebraucht, manchmal als ‘Inbegriff der Handlungsweise’ verwendet, als die immer gleiche Art zu handeln, die bestimmt ist von den Werteinstellungen der Person; in der zweiten Bedeutung steht der Inhalt des Wortes zwischen “Eigenschaft” und “Taten” und meint den gleichbleibenden gemeinsamen Grund der verschiedenen Handlungen einer Person. Verständnis s. Textverständnis, erstes und begründetes 229 Verstehensprozess: der Weg vom ersten zum begründeten Textverständnis. In der Untersuchung betrachtet der Leser den Text ein zweites Mal. Er sucht gezielt nach Textsignalen, vergegenwärtigt sich die Einzelheiten des Inhalts und nimmt die Besonderheiten der Gestaltung unterscheidend wahr und befragt sie auf ihre Bedeutung hin. Er probiert das Erschauen von Zusammenhängen zwischen Inhalt und Gestaltung. Dabei fragt er sich, ob die erfassten Erscheinungen des Inhalts und der Gestaltung mit seiner Interpretationshypothese in Einklang zu bringen sind. Er bedenkt, ob er diese in Teilen abändern (revidieren) muss oder sie ganz verwerfen muss. Wirkung s. Textwirkung 230 LITERATURVERZEICHNIS Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): Autorenlesungen. Inter Nationes 1992. Beier, Heinz (Hrsg.): Vorkurs Deutsch. Arbeitstechniken – Literaturepochen. Bayerischer Schulbuch – Verlag, Sülzburg im Allgäu 1983. Berger, Norbert: Deutsch unterrichten. Tafelbilder und Arbeitsblätter zum Grammatik-, Sprach- und Aufsatzunterricht. Sekundarstufe/Gymnasium. Verlag Ludwig Auer, Donauwörth 1994. Bichsel, Peter: Stockwerke. Prosa (Hrsg. H.F. Schafroth). Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1974. Biermann, Heinrich u.a. (Hrsg.): Texte, Themen und Unterrichtspraktische Hilfen. Cornelsen Verlag, Berlin 1995. Strukturen. Bischof, Monika u.a. (Hrsg.): Landeskunde und Literaturdidaktik. Fernstudienangebot. Langenscheidt – Goethe Institut, München 1999. Bleier-Staudt, Elke (Hrsg.): Schulbuchverlag, Stuttgart 1994. Unterwegs. Lesebuch. Ernst Klett Böll, Heinrich: Wanderer, kommst du nach Spa ... Erzählungen. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1972. Brauneck, Manfred (Hrsg.): Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1984. Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1972. Dürrenmatt, Friedrich: Der Richter und sein Henker. Rowohlt Verlag, Hamburg 1976. Dtv – Lexikon in 20 Bänden, Band 4. Deutscher Taschenbuch Verlag, München und F.A.Brockhaus GmbH, Mannheim 1992. Emmert, Hans-Dieter/Olschewski, Uli (Konzeption): Österreich. Kalender – Materialien. Goethe Institut, München 1994. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Julius Groos Verlag, Heidelberg 1996. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für Praxis des Deutschunterrichts (Hrsg. Goethe Institut). Heft 22/2000. Verlag Klett Edition Deutsch, München 2000. Fuchs, Herbert (Hrsg.): Klassische und moderne Kurzgeschichten. Varianten – Kreativer Umgang – Interpretationsmethoden. Cornelsen Verlag, Berlin 1992. 231 Fuchs, Herbert (Hrsg.): Klassische und moderne Kurzgeschichten. Varianten – Kreativer Umgang – Interpretationsmethoden. Lehrerheft. Cornelsen Verlag, Berlin 1993. Galaj, Olga u.a. (Hrsg.): Deutsch für die Fachrichtung Philologie. Minsk, 1990. Geißler, Rolf u.a. (Hrsg.): Modelle. Ein literarisches Arbeitsbuch. R. Oldenbourg Verlag, München 1974. Gelfert, Hans-Dieter (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht. Wie interpretiert man eine Novelle und eine Kurzgeschichte? Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1993. Glaser, Hermann u.a. (Hrsg.): Sprache und Literatur, Band 1. C.C. Buchners Verlag, Bamberg 1987. Häussermann, Ulrich u.a. (Hrsg.): Sprachkurs Deutsch 5. Unterrichtswerk für Erwachsene. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/M.,Verlag Sauerländer, Aarau 1985. Häussermann, Ulrich u.a. (Hrsg.): Literaturkurs Deutsch. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt/M., Verlag Sauerländer, Aarau 1987. Hesse, Hermann: Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994. Hohler, Franz: Da, wo ich wohne. Luchterhand Literaturverlag, Hamburg 1993. Jens, Walter (Hrsg.): Kindlers Neues Literatur Lexikon. Kindler Verlag, München 1988. Keller, Gottfried: Kleider machen Leute. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1998. König, Werner: dtv – Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1994. Königsfeld, Lilo u.a. (Hrsg.): Wortwechsel. Deutsch in der Jahrgangsstufe 7. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1993. Krywalski, Diether u.a. (Hrsg.): Kennwort. Ein literaturgeschichtliches Arbeitsbuch. Grundkurs 11. Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1994. Krywalski, Diether u.a. (Hrsg.): Kennwort. Ein literaturgeschichtliches Arbeitsbuch. Grundkurs 12. Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1997. Krywalski, Diether u.a. (Hrsg.): Kennwort. Ein literaturgeschichtliches Arbeitsbuch. Grundkurs 13. Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1996. 232 Lange, Günter (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht. Deutsche Kurzgeschichten. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1993; 1995. Loetscher, Hugo: Der Waschküchenschlüssel oder Was – wenn Gott Schweizer wäre. Diogenes Verlag, Zürich 1988. Mann, Heinrich: Der Untertan. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1994. Mann, Thomas: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Verlag Neues Leben, Berlin 1974. Mann, Thomas: Tonio Kröger. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M. 1995. Mayer, Dieter u.a. (Hrsg.): Verstehen und Gestalten. Arbeitsbuch für Gymnasien. Sprache und Literatur. R. Oldenbourg Verlag, München 1992; 1993. Miebs, Udo/Vehovirta, Leena (Hrsg.): Kontakt Deutsch. Redemittelbuch. Langenscheidt Verlag, München 1997. Nürnberg, H.-W./Sembritzki, H. (Hrsg.): Literatur im Deutschunterricht, Band 1. Kleine literarische Formen. Texte und Interpretationen. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1985. Nürnberg, H.-W./Sembritzki, H. (Hrsg.): Literatur im Deutschunterricht, Band 2. Lyrik – Kurzgeschichten. Texte und Interpretationen. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1984. NZZ – FOLIO. Die Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung. Nr. 10, Oktober 1998. Österreich. Tatsachen und Zahlen. Hrsg. vom Bundespressedienst. Wien 1998. Presse und Sprache. Mit Strategien zum Leseverstehen, Übungen und Vokabular. Jahrgänge 1997 – 2001. Raulfs, Joachim: Deutsche Literaturgeschichte in Beispielen. Merkur Verlag, Rinteln 1972. Richter, Gabriele und Manfred: Interessantes. Kurioses. Wissenswertes. Ein landeskundliches Lese- und Übungsbuch. Verlag für Deutsch, Ismaning 1994. Riesel, Elisa/Schendels, Evgenija: Deutsche Stilistik. Verlag Hochschule, Moskau 1975. 233 Rinsum, Annemarie und Wolfgang: Dichtung und Deutung. Eine Geschichte der deutschen Literatur in Beispielen. Bayerischer Schulbuchverlag, München 1977. Schlingmann, Carsten (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht. Methoden der Interpretation. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1985. Schoebe, Gerhard u.a. (Hrsg.): Verstehen und Gestalten. Sprachbuch für Gymnasien. R.Oldenbourg Verlag, München 1995. Schweizer Brevier. Kümmerly + Frey, Geographischer Verlag, Zollikofen – Bern, 1999. Schischkina, I.P./Smoljan, Prosvescenije 1980. O.A.: Analytisches Lesen. Leningrad, Stalb, Heinrich: Deutsch für Studenten. Text- und Übungsbuch. Neubearbeitung. Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1991. Steinbach, Dietrich (Hrsg.): Kurzprosa der Gegenwart. Bundesrepublik Deutschland. Östereich. Schweiz (mit Materialien, ausgewählt und eingeleitet von Gertrud Schänzlin). Klett Verlag, Stuttgart 1999. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute.Wilhelm Fink Verlag, München 1994. Treffpunkte. Lesebuch. Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1993. Tucholsky, Kurt: Gruß nach vorn. Prosa und Gedichte. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1989. Ulrich, Winfried (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht. Deutsche Kurzgeschichten. Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 1994; 1995. Wagner, Rüdiger (Hrsg.): Roman – Literarisches Leben. Bayerischer Schulbuchverlag, Sülzburg im Allgäu 1979. Walser, Robert: Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Zürich und Frankfurt/M. 1985. Walser, Robert: Bedenkliche Geschichten. Suhrkamp Verlag , Zürich und Frankfurt/M. 1985. Weber, Hans: Vorschläge, Band 1 und 2. Literarische Texte für den Unterricht DaF. Lesehilfen. Inter Nationes 1995. Wunderlich, Dieter u.a. (Hrsg.): Thema: Sprache. Sprach- und Arbeitsbuch für den Deutschunterricht. Cornelsen Verlag, Hirschgraben 1989. 234 LINKS IM INTERNET www.dhm.de/lemo/html/biografien www.digitale-bibliothek.de www.dostoevskij.purespace.de/hesse www.berlinonline.de/wissen/berliner_zeitung/archiv www.bboxbbs.ch/home/gymer/daten/deutsch www.nagel.kimche.ch/autoren/welsh.htm www.frauenstadtarchiv.de/lexikon 235 TEXTE UND ARBEITSHILFEN Tekstai, užduotys, paaiškinimai Mokomoji knyga Sudarė Jadzė Šapalienė Redagavo Jurgita Šapalaitė __________________ SL 843. 2003 08 01. 15 leidyb. apsk. l. Užsakymas 81. Išleido VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, Vilniaus g. 88, LT-5400 Šiauliai. Tel./faks. (8~41) 52 09 80; el. paštas [email protected] Spausdino UAB Šiaulių knygrišykla, Tilžės g. 250, LT-5400 Šiauliai. 236