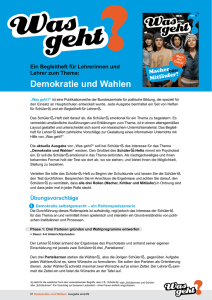Parteien MA3 -14 - Lise-Meitner
Werbung
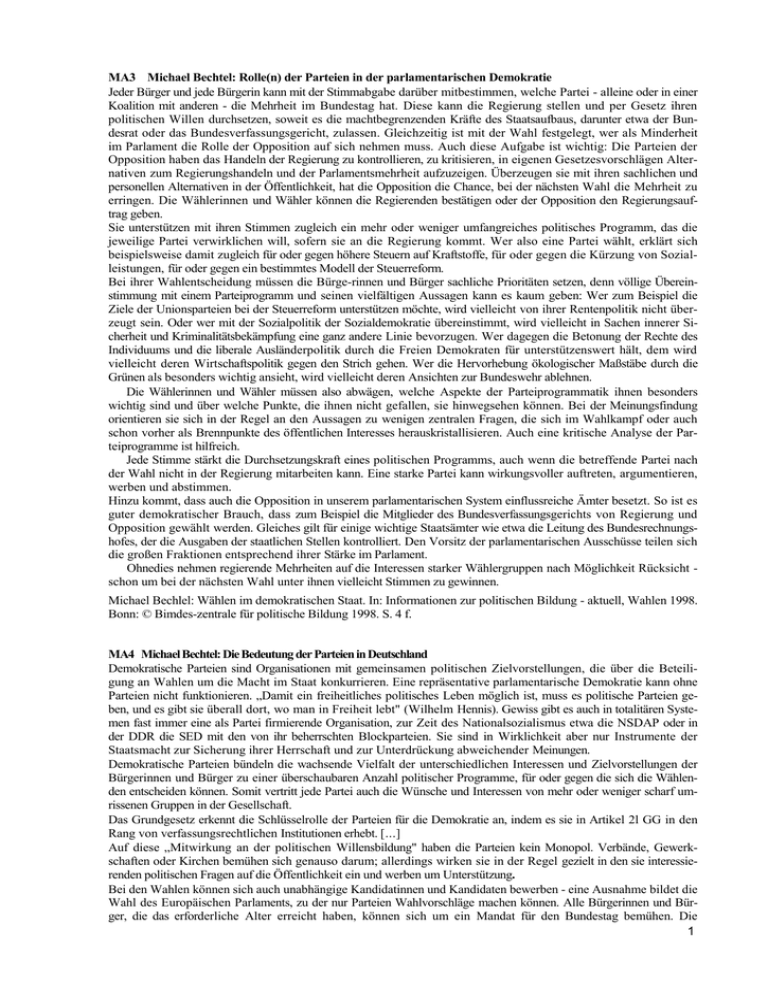
MA3 Michael Bechtel: Rolle(n) der Parteien in der parlamentarischen Demokratie
Jeder Bürger und jede Bürgerin kann mit der Stimmabgabe darüber mitbestimmen, welche Partei - alleine oder in einer
Koalition mit anderen - die Mehrheit im Bundestag hat. Diese kann die Regierung stellen und per Gesetz ihren
politischen Willen durchsetzen, soweit es die machtbegrenzenden Kräfte des Staatsaufbaus, darunter etwa der Bundesrat oder das Bundesverfassungsgericht, zulassen. Gleichzeitig ist mit der Wahl festgelegt, wer als Minderheit
im Parlament die Rolle der Opposition auf sich nehmen muss. Auch diese Aufgabe ist wichtig: Die Parteien der
Opposition haben das Handeln der Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren, in eigenen Gesetzesvorschlägen Alternativen zum Regierungshandeln und der Parlamentsmehrheit aufzuzeigen. Überzeugen sie mit ihren sachlichen und
personellen Alternativen in der Öffentlichkeit, hat die Opposition die Chance, bei der nächsten Wahl die Mehrheit zu
erringen. Die Wählerinnen und Wähler können die Regierenden bestätigen oder der Opposition den Regierungsauftrag geben.
Sie unterstützen mit ihren Stimmen zugleich ein mehr oder weniger umfangreiches politisches Programm, das die
jeweilige Partei verwirklichen will, sofern sie an die Regierung kommt. Wer also eine Partei wählt, erklärt sich
beispielsweise damit zugleich für oder gegen höhere Steuern auf Kraftstoffe, für oder gegen die Kürzung von Sozialleistungen, für oder gegen ein bestimmtes Modell der Steuerreform.
Bei ihrer Wahlentscheidung müssen die Bürge-rinnen und Bürger sachliche Prioritäten setzen, denn völlige Übereinstimmung mit einem Parteiprogramm und seinen vielfältigen Aussagen kann es kaum geben: Wer zum Beispiel die
Ziele der Unionsparteien bei der Steuerreform unterstützen möchte, wird vielleicht von ihrer Rentenpolitik nicht überzeugt sein. Oder wer mit der Sozialpolitik der Sozialdemokratie übereinstimmt, wird vielleicht in Sachen innerer Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung eine ganz andere Linie bevorzugen. Wer dagegen die Betonung der Rechte des
Individuums und die liberale Ausländerpolitik durch die Freien Demokraten für unterstützenswert hält, dem wird
vielleicht deren Wirtschaftspolitik gegen den Strich gehen. Wer die Hervorhebung ökologischer Maßstäbe durch die
Grünen als besonders wichtig ansieht, wird vielleicht deren Ansichten zur Bundeswehr ablehnen.
Die Wählerinnen und Wähler müssen also abwägen, welche Aspekte der Parteiprogrammatik ihnen besonders
wichtig sind und über welche Punkte, die ihnen nicht gefallen, sie hinwegsehen können. Bei der Meinungsfindung
orientieren sie sich in der Regel an den Aussagen zu wenigen zentralen Fragen, die sich im Wahlkampf oder auch
schon vorher als Brennpunkte des öffentlichen Interesses herauskristallisieren. Auch eine kritische Analyse der Parteiprogramme ist hilfreich.
Jede Stimme stärkt die Durchsetzungskraft eines politischen Programms, auch wenn die betreffende Partei nach
der Wahl nicht in der Regierung mitarbeiten kann. Eine starke Partei kann wirkungsvoller auftreten, argumentieren,
werben und abstimmen.
Hinzu kommt, dass auch die Opposition in unserem parlamentarischen System einflussreiche Ämter besetzt. So ist es
guter demokratischer Brauch, dass zum Beispiel die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts von Regierung und
Opposition gewählt werden. Gleiches gilt für einige wichtige Staatsämter wie etwa die Leitung des Bundesrechnungshofes, der die Ausgaben der staatlichen Stellen kontrolliert. Den Vorsitz der parlamentarischen Ausschüsse teilen sich
die großen Fraktionen entsprechend ihrer Stärke im Parlament.
Ohnedies nehmen regierende Mehrheiten auf die Interessen starker Wählergruppen nach Möglichkeit Rücksicht schon um bei der nächsten Wahl unter ihnen vielleicht Stimmen zu gewinnen.
Michael Bechlel: Wählen im demokratischen Staat. In: Informationen zur politischen Bildung - aktuell, Wahlen 1998.
Bonn: © Bimdes-zentrale für politische Bildung 1998. S. 4 f.
MA4 Michael Bechtel: Die Bedeutung der Parteien in Deutschland
Demokratische Parteien sind Organisationen mit gemeinsamen politischen Zielvorstellungen, die über die Beteiligung an Wahlen um die Macht im Staat konkurrieren. Eine repräsentative parlamentarische Demokratie kann ohne
Parteien nicht funktionieren. „Damit ein freiheitliches politisches Leben möglich ist, muss es politische Parteien geben, und es gibt sie überall dort, wo man in Freiheit lebt" (Wilhelm Hennis). Gewiss gibt es auch in totalitären Systemen fast immer eine als Partei firmierende Organisation, zur Zeit des Nationalsozialismus etwa die NSDAP oder in
der DDR die SED mit den von ihr beherrschten Blockparteien. Sie sind in Wirklichkeit aber nur Instrumente der
Staatsmacht zur Sicherung ihrer Herrschaft und zur Unterdrückung abweichender Meinungen.
Demokratische Parteien bündeln die wachsende Vielfalt der unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen der
Bürgerinnen und Bürger zu einer überschaubaren Anzahl politischer Programme, für oder gegen die sich die Wählenden entscheiden können. Somit vertritt jede Partei auch die Wünsche und Interessen von mehr oder weniger scharf umrissenen Gruppen in der Gesellschaft.
Das Grundgesetz erkennt die Schlüsselrolle der Parteien für die Demokratie an, indem es sie in Artikel 2l GG in den
Rang von verfassungsrechtlichen Institutionen erhebt. [...]
Auf diese „Mitwirkung an der politischen Willensbildung" haben die Parteien kein Monopol. Verbände, Gewerkschaften oder Kirchen bemühen sich genauso darum; allerdings wirken sie in der Regel gezielt in den sie interessierenden politischen Fragen auf die Öffentlichkeit ein und werben um Unterstützung.
Bei den Wahlen können sich auch unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten bewerben - eine Ausnahme bildet die
Wahl des Europäischen Parlaments, zu der nur Parteien Wahlvorschläge machen können. Alle Bürgerinnen und Bürger, die das erforderliche Alter erreicht haben, können sich um ein Mandat für den Bundestag bemühen. Die
1
Schwelle dafür ist niedrig: 200 Unterschriften von Wahlberechtigten genügen, um auf dem Stimmzettel zu erscheinen. Die Erfolgsaussichten sind für Einzelkandidaten allerdings sehr gering: In einer von Medien hergestellten und
beherrschten Öffentlichkeit können sich Kandidaten ohne die Unterstützung einer großen Organisation kaum Gehör
verschaffen. Und die Wähler und Wählerinnen geben Einzelkämpfern, die sie nicht kennen und nur schwer einschätzen können, kaum eine Chance.
Die traditionellen Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, den Kampf um die Macht immer unter sich auszutragen - auch wenn sie sich selbst als Rückgrat des demokratischen Staates begreifen und große historische Verdienste vorweisen können.
Die Gründung neuer politischer Gruppen ist frei. Um an der Bundestagswahl teilnehmen zu können, müssen sie vom
Bundeswahlausschuss als Partei anerkannt werden und können dann entsprechende Wahl vorschlage bei den Landeswahlleitungen einreichen. Über ihre Zulassung entscheiden anschließend die Landes Wahlausschüsse. Insgesamt
sind 90 Parteien in die beim Bundeswahlleiter geführte Liste der politischen Parteien aufgenommen.
Die meisten Anläufe zu Parteigründungen bleiben zwar auf längere Sicht erfolglos. Doch zu Beginn der achtziger
Jahre gelang es den GRÜNEN, das über Jahrzehnte scheinbar feste Drei-Parteien-System aufzubrechen. Und die aus
der SED hervorgegangene PDS hat sich in der Bundestagswahl 1994 knapp, aber immerhin behauptet.
Michael Bechtel: Wählen im demokratischen Staat. In: Informationen zur politischen Bildung - aktuell, Wahlen 1998.
Bonn: © Bundeszentrale für politische Bildung 1998, S. 4 f.
MA5 Artikel 21 des Grundgesetzes
(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung
muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie
über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland
zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. (3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
MA6 Parteiengesetz von 1967
§ l Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien
(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes eine
ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.
(2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische
Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund,
Ländern und Gemeinden beteiligen, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss nehmen, die
von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozess der staatlichen Willensbildung einführen und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen.
(3) Die Parteien legen ihre Ziele in politischen Programmen nieder.
§2 Begriff der Partei
(1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder
eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen
Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse,
insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder
einer Partei können nur natürliche Personen sein.
(2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat.
§ 6 Satzung und Programm
(t) Die Partei muss eine schriftliche Satzung und ein schriftliches Programm haben.
Parteiengesetz von 1967
Arbeitsauftrag (Gruppe 1)
Bearbeiten Sie auf der Basis der Jigsaw-Methode die Texte unter folgender Leitfrage: Welche Bedeutung haben die
Parteien in Deutschland? Tauschen Sie Ihre Ergebnisse anschließend in der Unterrichtsrunde mit den Experten der anderen
Gruppen aus.
2
MA7 Kurt Sontheimer: Parteien *~ Licht und Schatten
[...] Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland sehen in ihrer überwiegenden Mehrheit in den politischen Parteien
notwendige, unentbehrliche, wenn auch nicht in jeder Hinsicht gefällige und zufriedenstellende Organisationen der
demokratischen Willensbildung. Sie sind sich bewusst, dass es ohne politische Parteien keine Demokratie geben
kann, und sie haben durch ihr bisheriges Verhalten bei Wahlen klar gezeigt, dass sie demokratiekonforme und
staatstragende Parteien bevorzugen. Dies ist -mit gewissen Abstrichen natürlich - ein im Ganzen positiver Befund,
vor allem im Vergleich zur politischen Kultur des Kaiserreiches und der Weimarer Republik. Die Partei an sich und
das gegebene Parteiensystem werden von einer überwältigenden Mehrheit akzeptiert.
[...] Die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Phänomen des Partei-wesens und dem
bestehenden Parteien System positiv arrangiert. Das ist ein Fortschritt in unserer politischen Kultur, der nicht preisgegeben werden sollte.
[...] Dies bedeutet allerdings nicht, dass unser Parteiensystem den Normen demokratischen und kooperativen
Verhaltens durchgehend entspräche.
Auch wenn man - wie manche Demokratie-Theoretiker - die politische Partizipation nicht für einen durchgehend
anwendbaren Maßstab zur Bestimmung der Qualität demokratischer Prozesse in den Parteien hält, wird man doch
feststellen müssen, dass die deutschen Parteien keine sozialen Gebilde sind, in denen die demokratischen Prozesse
immer vorbildlich ablauten. Weit gefehlt! Einzelne Parteien sind in ihrem Innenleben etwas demokratischer als
andere; manche Parteien haben unangemessenere Vorstellungen von einer demokratischen politischen Kultur als
andere. Die politische Kultur der Parteien selbst ist von unterschiedlicher Qualität. Die Werte und Maßstäbe einer
politischen Kultur sind natürlich nicht starr, aber keine politische Kultur kann ohne solche Werte und Maßstäbe sein.
Die Diskussion über sie ist ein wichtiger Teil unserer politischen Auseinandersetzung in der pluralistischen Gesellschaft. Sie sind nicht beliebig relativierbar.
Kurt Sontheimer: Politische Kultur: Pflege demokratischen Verhaltens. In: Peter Haungs/Eckhard Jesse: Parteien in der Krise? Köln: 1987, S. 24 f.
MAS Eckhard Jesse und Uwe Backes: Innerparteiliche Demokratie
Nach Art. 21,1 GG hat die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen zu entsprechen, die das Parteiengesetz präzisiert. So müssen die Parteien Satzungen und Programme besitzen, sich in Gebietsverbände gliedern (zum
Beispiel Bundespartei, Landes-, Bezirks-, Kreis- und Ortsverband) und regelmäßige Wahlen durchführen.
Mitgliederversammlung und der mindestens alle zwei Jahre zu wählende Vorstand gehören auf allen Organisationsebenen zu den notwendigen Organen der Partei. Die Bestimmung, die Zahl der kraft Amtes in den Vorstand einberufenen
Mitglieder dürfe höchstens ein Fünftel der Gesamtzahl aller Vorstandsmitglieder betragen, hat bei den Parteien nach
1967 zu einer innerparteilichen Demokratisierung geführt. Der Anteil der nicht unmittelbar gewählten Delegierten lag
nämlich höher. Das Parteiengesetz betont die Mitwirkung der Mitglieder an der Willensbildung der Partei, wobei es
auch auf den Schutz der innerparteilichen Minderheiten abhebt. Parteiausschlussverfahren, über die Schiedsgerichte
entscheiden, sind nur rechtswirksam, wenn ein Mitglied „vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze
oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt" (§ 10,4 PartG).
Innerparteiliche Demokratie ist notwendig, um das Gewicht des politisch engagierten Bürgers in einer Partei zu erhöhen. Ein demokratischer Staat kann nicht von Parteien mit undemokratischer Struktur (Beispiel „Führerprinzip"
oder „demokratischer Zentralismus") regiert werden. Ungeachtet aller gesetzlichen Vorkehrungen sind die Einflussmöglichkeiten des einfachen Parteimitgliedes verhältnismäßig beschränkt. Das liegt an der Teilnahmslosigkeit und
Gleichgültigkeit vieler Parteimitglieder („Parteileichen"), an den Versuchen der Parteibürokratie, sich von der „Basis"
abzukapseln, und schließlich an den unverzichtbaren Sachzwängen einer modernen und großen Parteiendemokratie, die
eben auch entschiedene Führung und schnelle Entscheidungen benötigt.
Schon 1911 hat Robert Michels in einem klassischen Werk zur Parteienforschung das eherne Gesetz der „Oligarchie"
(Herrschaft Weniger) nachgewiesen. Michels geht davon aus, dass jede Organisation unvermeidlich eine Führungsschicht
hervorbringt, ohne diese effektiv und dauerhaft zu kontrollieren. Sicherlich, die Notwendigkeit hauptamtlicher Funktionäre, der Informationsvorsprung der Parteispitze und die immer mehr um sich greifende Spezialisierung der Politik
bewirken eine gewisse Verselbstständigung des Parteiapparates. Jedoch darf der innerparteiliche Willensbildungsprozess keineswegs ausschließlich von oben nach unten verlaufen. Ämterhäufungen und {damit verbunden) Machtballung
stellen schwerwiegende Probleme für jede große Partei der Bundesrepublik Deutschland dar. Eine Verbesserung des
innerparteilichen Meinungsaustausches ist zum Abbau verhärteter Parteistruktur genauso vonnöten wie eine stärkere
Mobilisierung der Mitglieder.
Innerparteiliche Demokratie bedeutet schließlich auch, dass die einzelnen parteiinternen Gruppen ihre Kontroversen weitgehend öffentlich kundtun. Vielfach herrscht in den Parteien (und auch bei der Wählerschaft) der Glaube vor, das offene
Austragen von innerparteilichen Konflikten beweise Schwäche, Unglaubwürdigkeit und mangelnde Einmütigkeit einer
Partei. Eine Partei, die Meinungsverschiedenheiten nicht von oben vertuscht, gilt häufig als „zerstritten" und „uneins".
Dies kann im Extremfall tatsächlich so sein, wenn die unterschiedlichen Positionen derart weit auseinander liegen, dass
sich eine Übereinstimmung in Grundpositionen nicht mehr erreichen lässt. Flügelkämpfe dürfen nicht ein Ausmaß
annehmen, dass sie die Energien der Politiker binden und innere Auseinandersetzungen die programmatischen Vorstellungen der Partei überlagern. Vielfach jedoch befruchten innerparteiliche Differenzen die politische Diskussion. Es mag
daher auch ein Zeichen von Stärke und Dynamik sein, wenn eine Partei sie duldet und nicht mit dem beliebten Ruf
nach „Geschlossenheit" abwürgt.
Eckhard Jesse AJwe Backes: Parteiendemokratie. In: Informationen zur politischen Bildung (207). Bonn: © 1985, S. 27
3
MA9 Eckhard Jesse: Volksparteien - Wahlalternativen für den Bürger?
Zu den am leidenschaftlichsten diskutierten Fragen gehört der Problemkreis „Volkspartei". Haben sich die Parteien mit
der Entwicklung zu Volksparteien übertrieben angenähert, und bieten sie dem Bürger noch wirkliche Alternativen? Die
Meinungen gehen hier schroff auseinander:
Kritiker des Typus der Volkspartei (u. a. Johannes Agnoli, Wolf-Dieter Narr) verweisen darauf, dass diese einer Verschleierung der Machtverhältnisse Vorschub leistet: Tatsächlich bestehen die grundlegenden Konflikte einer politischen Ordnung, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln beruht, nach wie vor fort. Die harmonistische Konzeption der Volkspartei ist im Grunde ein Widerspruch in sich, da eine Partei nicht das gesamte Volk repräsentieren
kann. Die Ideologie der „Volkspartei" verzichtet darauf, das reale Klasseninteresse breiter Bevölkerungsteile zu mobilisieren, sondern begnügt sich mit unkritischen Werbefeldzügen und redet einer Personalisierung das Wort. Ein theorieloser Pragmatismus verführt zu Grundsatzlosigkeit und Leerformeln. Wer Volksparteien propagiert, passt sich dem
Status quo an und will die Gesellschaft nicht grundlegend umgestalten.
Befürworter der Volkspartei (z. B. Thomas Eil-wein, Heino Kaack) begrüßen diese als eine notwendige Konsequenz einer
sozial nicht polarisierten Gesellschaft: Das Verhältnis der Parteien in einer Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland darf nicht von Feindschaft geprägt sein. Will eine Partei möglichst viele Wähler ansprechen, muss sie ihre Programmatik so weit fassen, dass sich auch (bisherige) Anhänger anderer Parteien angesprochen fühlen und überzeugen
lassen. Sicherlich ist es problematisch, wenn sich der Parteienwettbewerb bei der Wahl auf ein reines Personalplebiszit
reduziert, jedoch zeigt die Entwicklung seit 1969, dass es durchaus gewichtige programmatische Unterschiede zwischen
den großen Parteien gibt. Wer freilich „glasklare" Alternativen wünscht, übersieht dabei, dass der Wähler derartigen
Konzeptionen eine Absage erteilen würde. Der so massive wie dauernde Misserfolg der Parteien, die sich bewusst nicht
als Volksparteien verstehen, bringt dies klar zum Ausdruck.
Eckehard Jesse: Parteiendemokratie und Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. In: Informationen zur politischen Bildung (171). 1977, S. 26
MA10 Martin und Silvia Greiffenhagen: Parteien in der Kritik
Die wichtigsten Kritikpunkte sind die folgenden:
Die Personalsituation der Parteien sei schlecht: Die modernen Berufspolitiker kämen zu jung in ein Amt, hätten außer Politik nichts gelernt und seien aus diesem Grund zu weit entfernt von der gesellschaftlichen Realität. Selten sei es
politisches Engagement, das sie in die Politik führe, statt dessen persönliches Nutzenkalkül. Die meisten Politiker interessierten sich deshalb weniger für das Gemeinwohl als für ihr eigenes Fortkommen, für Macht und Geld. Sie neigten folglich zur Überanpassung an den Druck Öffentlicher Meinung und gingen im Zweifel den Weg des geringsten Widerstandes.
Die Parteien und ihre Vertreter leisteten nicht genug: Die Schlagworte dieser Kritik heißen „Problemlösungsdefizit"
und „Worte statt Taten". Als Gründe für Handlungsunfähigkeit werden genannt: schlechte Personalrekrutierung, mangelnde Sachkompetenz, fehlende Fortbildungsaktivitäten, mangelnder fachlicher Rat von externen Experten, dazu innerparteiliche oder zwischenparteiliche Zerstrittenheit. Das Einkommen der Politiker (also vor allem die Diäten der
Parlamentarier) werde nicht wirklich verdient: „Es ist weniger die Höhe ihrer Bezüge, als vielmehr das Missverhältnis zu
ihren Leistungen, das auf Kritik stößt." (Hans Herbert von Arnim).
Die Parteien (als Institutionen) beuteten den Staat finanziell aus: das Parteiengesetz sei in Wahrheit ein Parteienfinanzierungsgesetz, das nur dem Zweck der Bereicherung der Parteienkassen diene. Während die 80er-Jahre noch vom
Korruptionsargument geprägt waren, tauchte das Argument der Selbstbedienungsmentalität der Parteien erst in den
90er-Jahren auf. Es ist der schwerwiegendere Vorwurf von beiden, weil in der Folge das gesamte Modell der staatlichen
Finanzierung infrage gestellt wird.
Die Parteien monopolisierten den politischen Prozess: Sie besetzten Verwaltungen, Rundfunkanstalten, die Rechtsprechung, die Wissenschaft und andere Institutionen mit ihren eigenen Leuten, um größeren Einfluss (und bessere
Versorgungschancen) zu bekommen; solche Ämterpatronage nehme immer bedenklichere Ausmaße an.
Innerhalb der Parteien herrsche Demokratiedefizit: Nicht die Parteibasis, noch nicht einmal die aktiveren Gruppen der
Mitgliederschaft, sondern „Klüngelgrüppchen im Hinterzimmer" entschieden über Ziele und Programme der Parteien.
Vor allem die Aufstellung von Kandidaten für wichtige Ämter würde im kleinsten Kreis ausgemacht. [...]
Die Programme der Parteien entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Politik: Sie ließen es an
Trennschärfe fehlen, eine Partei gleiche der anderen wie ein Ei dem anderen, aus diesem Grund gebe es auch keine
wirkliche Kursänderung bei Regierungswechseln. Zukunftsweisende Programmatik fehle fast ganz, und wenn sie
existiere, sei sie zu abstrakt-allgemein und an den konkreten Problemen der Bürger vorbei formuliert. Ein Informationsaustausch mit den Bürgern finde nicht statt, die eigentlichen Probleme der Bevölkerung seien den Parteien
deshalb auch nicht bekannt.
Das Resultat dieser Kritiken: Die Glaubwürdigkeit der Parteien lasse zu wünschen übrig: Hätten sie einmal ein Thema
erkannt, das den Bürgern auf den Nägeln brenne, so versprächen sie viel und hielten wenig. [...]
Martin und Silvia Greiffcnhagen: Ein schwieriges Vaterland. Zur politischen Kultur im vereinigten Deutschland. München: © List 1993, S. 174 f.
Arbeitsauftrag (Gruppe 2)
Bearbeiten Sie auf der Basis der Jigsaw-Methode die Texte unter folgender Leitfrage: Welche Probleme ergeben sich aus
der starken Stellung der Parteien? Tauschen Sie Ihre Ergebnisse anschließend in der Unterrichtsrunde mit den Experten
der anderen Gruppen aus.
4
MA11 Ulrich von Alemann: Abschaffung der Parteien zugunsten direkter Demokratie?
Gibt es Alternativen zum demokratischen Parteienstaat? Existieren Konkurrenten zu den politischen Parteien auf dem
politischen Markt? Welches könnten diese Konkurrenten sein?
- Verbände und Lobbyisten bei Parlamenten und Regierungen, insbesondere auch in der unübersichtlichen internationalen
Politik, ob in EU, UNO oder NAFTA,
- Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen und freie Wählergemeinschaften oder auch NGOs und Quangos,
- die Medien, z. B. auch interaktives Fernsehen als Mittel von Volksentscheid oder
- das Volk pur, d. h. eine generelle Ausweitung von direkter Demokratie durch Volksentscheid nach dem Muster der
Schweiz.
Alle diese Konkurrenten weisen auf reale Tendenzen in den Parteiendemokratien hin. Aber sie sind keine wirkliche Alternative. Die Bedeutung der Verbände und Lobbyisten steigt weiter. Dieses sind zum Teil auch sehr demokratisch motivierte public interest groups, wie z. B. Common Cause in den USA oder Greenpeace und Amnesty International
weltweit. Aber die Bedenken gegenüber dem größeren Einfluss von Verbänden auf die Politik zulasten der Parteien
stimmen doch bedenklich. Denn die Parteien müssen sich demokratischen Wahlen stellen, die Verbände nicht. Dies
gilt auch für Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen und freie Wählergruppen, so idealistisch ihre Motive und so ehrenwert ihre Ziele auch immer sein mögen. Sicherlich haben sie ein weites Betätigungsfeld auf der lokalen Ebene kommunaler Politik. Hier sollten sie mit den Parteien stärker in einen demokratischen Wettstreit treten.
Die Medien werden in Zukunft sicher verstärkt mit den Parteien um Einfluss konkurrieren. Die Macht der Medien wird
weiter zunehmen. Umso wichtiger werden Kontrolle und Transparenz angesichts der Konzentration bei Presse und
Fernsehen weltweit. Insbesondere die Tendenz zu riesigen globalen Medienmischkonzernen, die alle Kommunikationsformen verknüpfen, ist bedenklich. Noch problematischer jedoch als die Konkurrenz von Parteien und Medien, bei
der man immerhin auf eine gegenseitige Kontrolle hoffen kann, wäre eine weitere Durchdringung von Partei- und
Medieninteressen, wie es das Beispiel von Silvio Berlusconi, der als Medienzar zum Regierungschef gewählt wurde,
gezeigt hat. Von Öffentlicher Meinung als vierter Gewalt, die die Kontrolle über die drei anderen ausüben soll, kann dann
sicher nicht mehr die Rede sein.
Viele Kritiker der Parteien, der Verbände und der Medien propagieren eine Verstärkung der direkten Demokratie
durch Volksentscheide, Bürgerbegehren und Referenden. Das Beispiel der Schweiz und der USA, wo diese direktdemokratiscben Elemente zum Alltag gehören, zeigt aber, dass dort gleichzeitig die Parteien schwächer und Verbände
und Aktionsgruppen stärker werden. So notwendig direktdemokratische Elemente zur Ergänzung des repräsentativen
Systems sind, so problematisch sind sie als eine totale Alternative. Denn Referenden sind nicht in der Lage, Kompromisse zu schließen und Prioritätenentscheidungen zu treffen. Am mächtigsten können dadurch wohlorganisierte Einzelinteressen, Veto-Gruppen und konservative Beharrungstendenzen werden.
Im Übrigen hat sich aber in Deutschland gezeigt, dass durch Volksabstimmungen in den Bundesländern die Parteien
nicht etwa überflüssig werden. Nur wenn eine der großen Parteien, meist die Oppositionspartei, ein Bündnis mit großen
Verbänden, z. B. Kirchen oder Gewerkschaften oder Umweltgruppen, eingegangen ist, dann waren Volksbegehren erfolgreich. Auch eine Verstärkung der direkten Demokratie wird demnach die Parteien durchaus nicht arbeitslos machen,
denn sie würden sich sicher ebenfalls dieses Instrumentariums bedienen.
Ulrich von Alemann: Probleme der Demokratie und der demokratischen Legitimation: Gibt es Alternativen zum demokratischen
Parteienstaat? © Ulrich von Alernann, Goethe-Institut Mexiko 1995
MA12 Cornelia Pieper: Mehr Bürgerbeteiligung
Vor 50 Jahren, am 23. Mai 1949, ist das Grundgesetz der Bundesrepublik verabschiedet worden. Die parlamentarische
Demokratie bat sich ohne Zweifel in den letzten 50 Jahren bewährt. Demokratie lebt und wird gestärkt durch die aktive und interessierte Teilhabe ihrer Bürgerinnen und Bürger. Demokratie lebt vom Mitmachen, von Formen direkter Bürgerbeteiligung.
In fast allen Verfassungen der neuen Bundesländer wurden Volksinitiativen und Volksbegehren verankert. Ob die Abschaffung des 13. Schuljahres (35 000 Unterschriften) oder der Erhalt der Kindertagesstätten (250 000 Unterschriften)
in Sachsen-Anhalt, die Bürgerinnen und Bürger haben sich daran beteiligt.
Auch auf Bundesebene würde direkte Bürgerbeteiligung in Einzelfragen das parlamentarisch-repräsentative System
des Grundgesetzes nicht infrage stellen. Hinzu kommt, dass spätestens mit dem Jahrhundertereignis der friedlichen
Revolution in Ostdeutschland und der darauf folgenden Wende die Rolle des Volkes bei der Herstellung demokratischer
Verhältnisse beeindruckend deutlich geworden ist.
Liberale wollen Bürgerbeteiligungen stärken, um mehr Chancen für politische Mitwirkung der Bürger zu erreichen und
mehr Verantwortung für eine aktive Bürgergesellschaft zu erzielen.
Wünschenswert wären solche Volksinitiativen, die die Bürgerinnen und Bürger Einfluss auf wichtige Themen in ihrem Bundesparlament nehmen lassen.
Es ist ein dauerhafter Beitrag, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die Politik zurück zu gewinnen.
5
Cornelia Pieper: Plädoyer für mehr Bürgerbeteiligung. In: Martin K.W. Schwecr (Hg.): Politische Vertrauenskrise in
Deutschland? -Eine Bestandsaufnahme. Münster, New York, München, Berlin: © Waxmann 2000. S. 84
MA 13 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Erweiterung des repräsentativen Systems
Bürgerinnen und Bürger müssen aber auch die Gelegenheit erhalten, an den Prozessen der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung stärker mitzuwirken. Schrittweise sollten daher die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einführung von
Volksinitiativen und Volksreferenden auf Bundesebene geschaffen werden. Selbstverständlich können die Grundund Menschenrechte durch Plebiszite nichtverändert werden, genau so wenig, wie Finanz- und Personalentscheidungen
durch Plebiszite getroffenwerden können. Aber unter engen Voraussetzungen und einem zu bestimmenden Forum könnten weitere Elemente der direkten Demokratie in Ergänzung zur repräsentativen Demokratie das Bewusstsein für dieses
Gesellschaftsmodell, dem besten von allen, stärken helfen.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Ergänzungen des repräsentativen Systems. In: Martin K.W. Schweer (Hg.): Politische Vertrauenskrise in Deutschland? - Eine Bestandsaufnahme. Münster, New York, München, Berlin: © Waxmann
2000, S. 77 f.
MA 14 Rita Süssmuth: Stärkung des Plebiszits
Es wird ja immer wieder über eine Verstärkung plebiszitärer Elemente in unserem parlamentarischen System nachgedacht. In einigen Bereichen kann dieses auch durchaus sinnvoll sein, um Bürger stärker mit politischen Auseinandersetzungen zu verknüpfen. Eine interessante Möglichkeit bietet in diesem Zusammenhang beispielsweise die Einrichtung
von Bürgerfbren auf kommunaler Ebene. Aber die punktuelle, auf das Pro und Contra zugespitzte plebiszitäre Entscheidung kann weder die dauerhafte parlamentarische Organisation noch das Integrationsvermögen der Volksparteien substituieren. Die Leistungen unserer Parteien - innerhalb und außerhalb des Parlamentes - sind nicht ersetzbar. Wir sollten
deshalb ihre Bemühungen stärken und nicht konterkarieren.
Rita Süssmuth: Verstärkung plebiszitärer Elemente. In: Martin K. W. Schweer (Hg.): Politische Vertrauenskrise in
Deutschland? - Eine Bestandsaufnahme. Münster, New York, München, Berlin: © Waxmann 2000, S. 99
Arbeitsauftrag (Gruppe 3)
Bearbeiten Sie auf der Basis der Jigsaw-Methode die Texte unter folgender Leitfrage: Gibt es Alternativen zum Parteienstaat? Tauschen Sie Ihre Ergebnisse anschließend in der Unterrichtsrunde mit den Experten der anderen Gruppen aus.
6