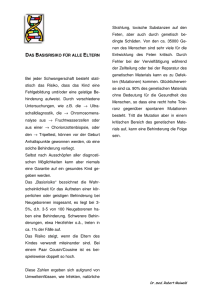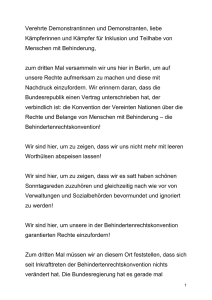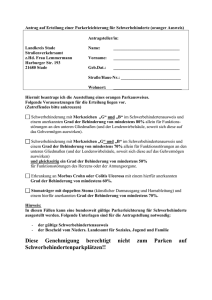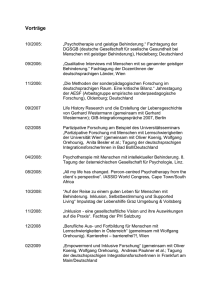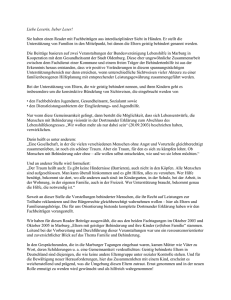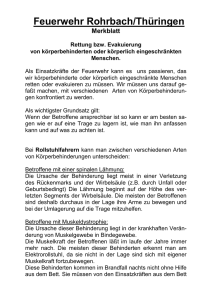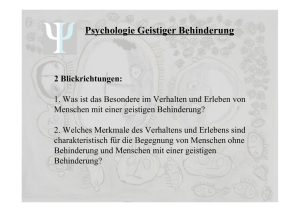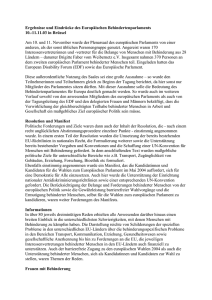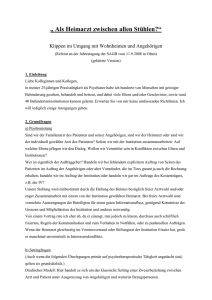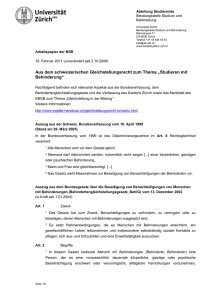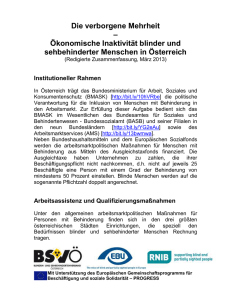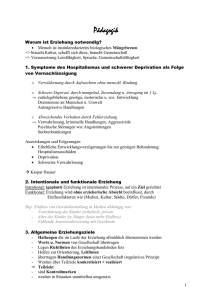Schwerpunkt
Werbung
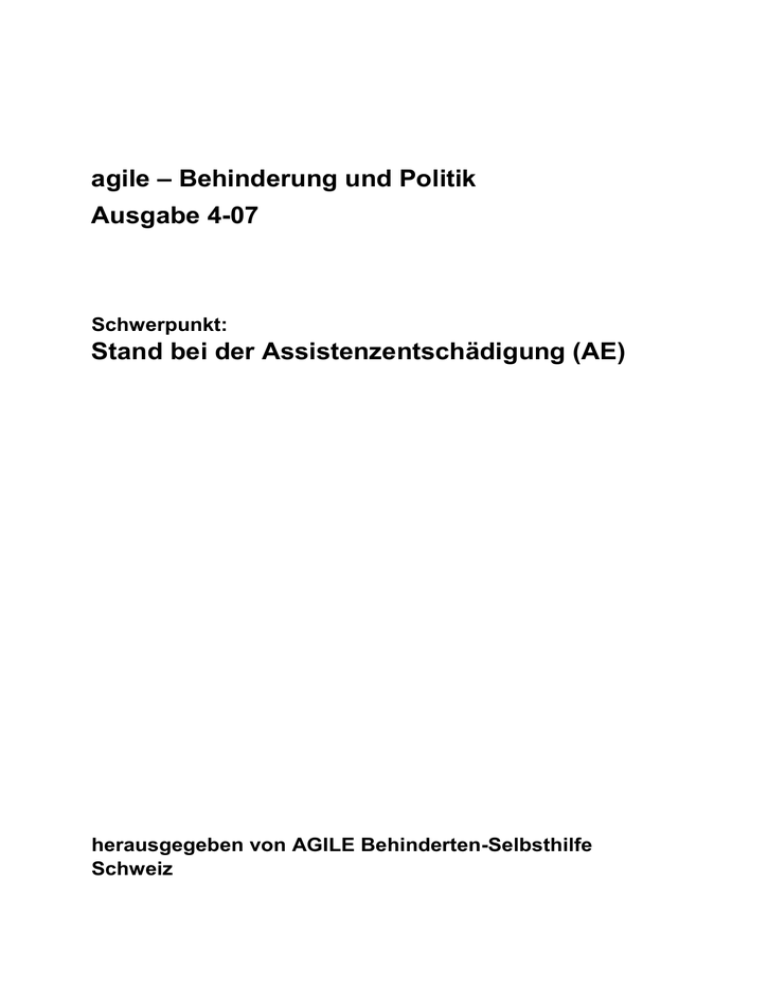
agile – Behinderung und Politik Ausgabe 4-07 Schwerpunkt: Stand bei der Assistenzentschädigung (AE) herausgegeben von AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz Behinderung und Politik 4/07 Inhaltsverzeichnis Editorial Für eine Assistenzentschädigung, die ihren Namen verdient ................................. 3 Schwerpunkt Quo vadis Assistenzentschädigung? ...................................................................... 4 Von Simone Leuenberger Pilotversuch Assistenzbudget: Die Zwischenbilanz ist positiv, aber… .. ................. 5 Von Urs Kaiser Die Erfahrungen am regionalen Stützpunkt ............................................................ 7 Von Alex B. Metger Meine Erfahrungen mit dem Assistenzbudget......................................................... 9 Von Francisco Lopez Sozialpolitik Sozialpolitische Rundschau .................................................................................. 11 Von Ursula Schaffner IV-Zusatzfinanzierung ........................................................................................... 15 Von Ursula Schaffner 5. IV-Revision: Was ändert sich im Bereich der berufliche Wiedereingliederung? 16 Von Eric Haberkorn Pflegefinanzierung: Der Ständerat ist nur teilweise mit dem Nationalrat einig ...... 20 Von Simone Leuenberger Gleichstellung Der Ständerat hat das revidierte Erwachsenenschutzgesetz verabschiedet ......... 21 Verkehr Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr ....................... 22 Bildung Von Catherine Corbaz ....................................................................................... 22 Behindertenszene Beispielhaftes Engagement - für soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung .................................................................................. 23 von Eva Aeschimann Donnerstage können das Leben verändern .......................................................... 26 Von Eva Aeschimann Medien Recht gegen HIV/Aids-Diskriminierung im Arbeitsverhältnis ................................. 28 Für Sie gelesen von Bettina Gruber Impressum .............................................................................................................. 31 2 Behinderung und Politik 4/07 Editorial Für eine Assistenzentschädigung, die ihren Namen verdient Am 31.12.2008, in etwas mehr als einem Jahr also, geht der Pilotversuch Assistenzbudget zu Ende. Die grosse Frage, die sich stellt, lautet: Wie geht es danach weiter mit der Assistenzentschädigung in der Schweiz? Wird der Pilotversuch in ordentliches Recht überführt, d.h. die Assistenzentschädigung gesetzlich verankert und flächendeckend eingeführt? Oder wird's nur eine abgespeckte Variante geben, quasi eine "Assistenzentschädigung light", oder am Ende gar nichts? Wer weiss. Was schon heute sicher ist: Für unser Ziel, eine Assistenzentschädigung, die ihren Namen verdient und Wahlfreiheit für alle Menschen mit Behinderung bringt, werden wir hart kämpfen müssen. Denn schon jetzt zeichnet sich in Verwaltung und Politik Widerstand dagegen ab, mehr Geld in die Hand nehmen zu müssen als ein nettes Trinkgeld. Der – sich anbahnende – Streit, was Assistenz kosten darf und was nicht, dreht sich nicht nur um die zu erwartenden direkten Kosten. Er dreht sich ebenso sehr um die Frage, ob und wie viele Einsparungen sich machen lassen, wenn die behinderten Menschen Wahlfreiheit beim Wohnen haben. Also letztlich darum, was Assistenz unter dem Strich, unter Aufrechnung aller direkten und indirekten Kosten, spart oder kostet. Natürlich sind wirtschaftliche Überlegungen wichtig. Doch geht es beim Thema Assistenz eben nicht primär ums Geld, sondern um mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung, kurz um Menschenwürde und Gleichberechtigung. Das sollten sich insbesondere jene Kreise vor Augen halten, welche in Zusammenhang mit der Invalidenversicherung nicht müde werden, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu fordern. Wer wirklich behinderte Menschen will, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und mitten in der Gesellschaft stehen, kann nicht ernsthaft gegen Wahlfreiheit beim Wohnen sein. Oder würde sich ein hoher Beamter, ein Parlamentsmitglied oder ein Wirtschaftsführer etwa vorschreiben lassen, wo und mit wem er zu leben hat? In Sachen Assistenzentschädigung stehen uns also spannende, vermutlich schicksalhafte Monate bevor. Grund genug für uns, den Schwerpunkt dieser Ausgabe unserer Zeitschrift dem Thema zu widmen. Im Sinne einer Zwischenbilanz werfen wir einerseits einen Blick auf das Pilotprojekt. Anderseits schauen wir voraus auf die politischen Auseinandersetzungen, die uns bevorstehen. Damit unsere Lesenden und alle, denen das Thema Assistenz am Herzen liegt, wissen, welche Stunde geschlagen hat. Dr. Therese Stutz Steiger Präsidentin AGILE 3 Behinderung und Politik 4/07 Schwerpunkt Quo vadis Assistenzentschädigung? Von Simone Leuenberger Seit dem 1. Januar 2006 läuft der Pilotversuch Assistenzbudget. Er ist befristet auf drei Jahre und läuft demnach am 31. Dezember 2008 aus, falls er nicht verlängert wird. Deshalb erheben sich bereits erste Stimmen, die sich über die Zukunft des Modells "Leben mit persönlicher Assistenz" Gedanken machen. Von Zuständigkeiten und Kostenträgern Es ist keine Frage: Das Modell "Leben mit persönlicher Assistenz" funktioniert in der Praxis. Es ermöglicht Menschen, die wegen ihrer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber, eine Assistenzentschädigung kostet Geld. Geld, das im Moment nicht in Hülle und Fülle vorhanden ist. Verschiedene Kostenträger teilen sich im Moment die Kosten für Pflege, Hilfe und Betreuung von Menschen mit einer Behinderung. Die Hilflosenentschädigung kommt von der IV, Spitexleistungen werden teilweise von der Krankenkasse finanziert, ein Heimaufenthalt von der IV und den Ergänzungsleistungen. Vieles muss auch aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Der Wirrwarr im Kostendschungel wird ab 2008 noch grösser, da gemäss Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) die Kantone für die Heimfinanzierung zuständig werden. Die IV "verliert" also das Geld, das sie bisher als Bau- und Betriebsbeiträge an die Heime bezahlt hat und möchte möglichst wenig zusätzliche Finanzen in eine Assistenzentschädigung stecken. Eine gesetzliche Einführung für die ganze Schweiz wäre aus Sicht der IV bzw. des Bundesamts für Sozialversicherungen nur mit einer massiv abgespeckten Variante der Assistenzentschädigung möglich. Keine Sparvariante Das lehnt die Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe DOK ab. Eine Sparvariante oder auch die Finanzierung der Assistenzentschädigung durch die Streichung anderer IV-Leistungen kommt für sie nicht in Frage. Der Pilotversuch soll zuerst abgeschlossen und umfassend ausgewertet werden, bevor weitere politische Schritte beschlossen werden. Der DOK erscheint aber das Modell "Assistenzfonds" prüfenswert, obwohl ihr bewusst ist, dass eine Mitbeteiligung der Krankenversicherung und der Kantone sehr komplexe Fragen aufwirft. Beim Modell "Assistenzfonds" sollten sich auch die Kantone und Krankenkassen an der Finanzierung der Assistenzentschädigung beteiligen. Sie werden ja letztlich bei der Einführung einer Assistenzentschädigung massgeblich finanziell entlastet. FAssiS hat auf ihrer Internetseite www.fassis.net einen Aufruf zur Unterstützung bei der Forderung nach einer gesetzlichen Einführung des Assistenzbudgets lanciert. Mit der Unterschrift kann man den Kampf für eine Assistenzentschädigung ideell unterstützen. Unterstützung braucht es unbedingt. Obwohl die Forderung von Menschen mit einer Behinderung nach einem selbstbestimmten Leben mit Assistenz grundsätzlich kaum 4 Behinderung und Politik 4/07 mehr in Frage gestellt wird, ist die Einführung einer Assistenzentschädigung leider noch lange nicht beschlossene Sache. Pilotversuch Assistenzbudget: Die Zwischenbilanz ist positiv, aber... Von Urs Kaiser, Mitglied der BSV-Begleitgruppe des Pilotversuchs Assistenzbudget Seit dem 1. Januar 2006 läuft im Rahmen der Invalidenversicherung der 3-jährige Pilotversuch Assistenzbudget. Rund 360 Personen mit unterschiedlichen Behinderungen beteiligen sich an diesem Versuch. Sie erhalten anstelle der Hilflosenentschädigung ein individuelles Assistenzbudget und können damit ihre benötigte Assistenz selber organisieren. Eine erste Zwischenbilanz hat nun gezeigt, dass das Modell "Assistenzbudget" die Erwartungen in Bezug auf Autonomiegewinn und Steigerung der Lebensqualität in hohem Mass erfüllt, dass aber eine generelle Einführung des Systems erhebliche Mehrkosten generieren würde. Wahlfreiheit dank Subjektfinanzierung Das Modell "Assistenzbudget" basiert auf der Forderung, dass auch Personen mit einem hohen Bedarf an behinderungsbedingter Assistenz ihre Lebensform frei sollen wählen dürfen. Nach dem heute geltenden System bleibt für viele von ihnen nur der Eintritt in ein Heim. Die Sozialversicherungsleistungen und die Gelder der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen werden in erster Linie an Institutionen ausgerichtet; wer in einer Privatwohnung leben und sich seine Assistenz selber organisieren möchte, ist diesbezüglich benachteiligt. Dies soll mit der Einführung des Assistenzbudgets geändert werden. Wer auf einen Heimeintritt verzichtet und sich die erforderliche Assistenz selber organisieren will, erhält ein persönliches Assistenzbudget zugesprochen, welches in der Höhe durch den individuell anerkannten Assistenzbedarf bestimmt ist. So können die Betroffenen selber bestimmen, welche Hilfe sie wann, von wem und in welcher Qualität in Anspruch nehmen wollen. Die so überlassene Eigenverantwortung führt erfahrungsgemäss zu grösserer Selbständigkeit, einer Ausweitung des Handlungsspielraums, einer verstärkten Integration und Partizipation und somit einer verbesserten Lebensqualität. Nutzen durch Begleitstudie bestätigt Der Pilotversuch, der schwerpunktmässig in den 3 Pilotkantonen Baselstadt, St. Gallen und Wallis durchgeführt wird – es nehmen daneben in begrenzter Zahl auch noch Personen aus andern Kantonen teil –, wird von verschiedenen Forschungsteams wissenschaftlich analysiert und ausgewertet. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat zu diesem Zweck sieben Projektbegleitstudien in Auftrag gegeben. Von drei Studien liegen bereits erste Ergebnisse vor. So hat die Nutzen-Kosten-Analyse klar bestätigt, dass der Nutzen des Assistenzbudgets für die TeilnehmerInnen am Pilotversuch hoch ist. Bei fast 90 Prozent der Teilnehmenden hat sich die Lebensqualität verbessert. Vor allem die Personen mit einer schweren Körperbehinderung profitieren stark. Als wichtigste Verbesserungen wurden eine höhere Selbständigkeit 5 Behinderung und Politik 4/07 und Selbstbestimmung und ein grösserer finanzieller Spielraum genannt. Aber auch die Entlastung der Angehörigen, die Nutzung von Freizeitangeboten, die sozialen Kontakte, die Erwerbstätigkeit und die Freiwilligenarbeit werden durch das Assistenzbudget positiv beeinflusst. Auch wenn in Bezug auf die eingesetzten Instrumente und die Abläufe noch einiges optimiert werden kann, so hat die Evaluation doch gezeigt, dass das erprobte Modell grundsätzlich ein funktionierendes zielführendes System darstellt, welches den Erwartungen und Bedürfnissen der Betroffenen entspricht. Keine Verlängerung vorgesehen Nach einer ersten Würdigung der Evaluationsberichte ist das BSV zum Schluss gelangt, dass sich eine Verlängerung des Pilotversuchs nicht aufdrängt, da damit keine zusätzlichen grundlegend neuen Erkenntnisse gewonnen werden können. Noch unklar ist hingegen die Frage, wie die konkrete Einführung des Assistenzbudgets aussehen wird. Der Pilotversuch hat nicht bloss den erwarteten Nutzen bestätigt, er hat auch gezeigt, dass eine generelle Einführung zu einer erheblichen Mehrbelastung der Invalidenversicherung führen würde. Die Personen, welche aus einem Heim austreten und ihre Assistenz selber organisieren, bringen zwar für die öffentliche Hand finanziell eine gewisse Entlastung. Diese vermag aber die Mehrkosten nicht zu kompensieren, welche auf Seiten der bereits jetzt ausserhalb eines Heims lebenden Personen durch den Systemwechsel entstehen würden. Mehrkosten entstehen bei dieser Personengruppe einerseits dadurch, dass bisher ehrenamtlich erbrachte Assistenzleistungen neu durch das Assistenzbudget abgegolten werden können; andererseits bedingt die Erweiterung des Handlungsspielraums und die verstärkte Integration und Partizipation auch ein Mehr an Assistenz. Die Frage, wie das Modell des künftigen Assistenzbudgets nun konkret ausgestaltet wird, ist somit in erster Linie eine politische Entscheidung und hängt davon ab, wie die Finanzierung geregelt und der Mittelbedarf sicher gestellt werden kann. Ausgehend von den bereits vorliegenden und noch zu erwartenden Ergebnissen müssen konkrete Modelle ausgearbeitet werden, welche den nachgewiesenen Nutzen gewährleisten und gleichzeitig die erforderliche politische Zustimmung finden. Bis zur definitiven Einführung des Assistenzbudgets bleibt also noch einiges zu tun. 6 Behinderung und Politik 4/07 Die Erfahrungen am regionalen Stützpunkt Von Alex B. Metger, Leiter des regionalen Stützpunkts St. Gallen / Deutschschweiz des Pilotprojekts Assistenzbudget Im März 2006 habe ich als regionaler Stützpunktleiter St. Gallen zu arbeiten angefangen. Seit dem 1. August bin ich für die ganze Deutschschweiz zuständig. Ich arbeite zu 25 Prozent. Mein Arbeitsort ist zugleich mein Zuhause. Die Hauptaufgaben sind, neben der Unterstützung und Beratung der (potentiellen) Teilnehmenden und des beratenden Umfeldes, die Vermittlung von Informationen, die Organisation und Durchführung von Workshops, Vorträge halten sowie Medienarbeit. Daneben habe ich regelmässigen Kontakt mit den IV-Stellen und auch den anderen regionalen Stützpunkten. Die tägliche Arbeit Den Hauptteil meiner Arbeit macht ganz klar die Unterstützung und Beratung der Teilnehmenden aus. Die meisten Anfragen werden per Telefon oder E-Mail gemacht. In einem ersten Schritt versuche ich abzuklären, wo meine Unterstützung liegen kann. Ich versuche klarzumachen, dass wir Hilfe zu Selbsthilfe leisten, und nicht, dass ich den Teilnehmenden die ganze Administration vorbereite und allenfalls sogar abnehme. Danach versuche ich, bereits via Telefon oder E-Mail die notwendige Unterstützung zu leisten. Oftmals vereinbare ich aber einen Termin und gehe bei den Teilnehmenden selber vorbei. Diese Form hat sich sehr bewährt, da es Teilnehmende gibt, die behinderungsbedingt Mühe haben, sich am Telefon gut auszudrücken. Mit der privaten Behindertenhilfe habe ich eher wenig zu tun. Solange die Anmeldefrist für die Projektteilnahme noch lief, durfte ich gelegentlich bei Eltern- und Selbsthilfegruppen Vorträge halten. Im letzten Jahr hatten wir, um das Projekt bekannter zu machen, auch viel in die Werbung und Medienarbeit investiert. Das Gespräch mit den neuen Teilnehmern Es ist mir bewusst, dass die Administration für einen Teilnehmer eine grosse Herausforderung sein kann. Mit Beispielen versuche ich, Ihnen das schweizerische Arbeitgebermodell so gut als möglich aufzuzeigen. Von grossem Vorteil ist, wenn der/die TeilnehmerIn einen Computer hat und ihn bedienen kann. In der Zwischenzeit haben wir einige nützliche Excel-Dateien hergestellt, die die Administration stark erleichtern. Bei einem Besuch nehme ich mir genügend Zeit, denn je klarer die Teilnehmenden von Beginn an wissen, wie sie genau vorgehen müssen – von der Anmeldung bei der Ausgleichskasse bis zur monatlichen Rechnungsstellung an die IVStelle –, desto kleiner ist der Aufwand für die Administration. Mit einigen TeilnehmerInnen habe ich regelmässig Kontakt, andere wiederum begleite ich nur zu Beginn, bis die erste Rechnungsstellung an die IV erfolgt ist. Von einer Vielzahl Teilnehmenden höre ich selten bis gar nichts. 7 Behinderung und Politik 4/07 Die Zusammenarbeit mit den IV-Stellen In diesem Fall gut, es gibt keine Probleme. Die IV-Stellen machen periodisch bei den Teilnehmenden eine Rechnungskontrolle. Ab und zu werde ich dann gebeten, mich einmal bei den betreffenden Teilnehmenden zu melden, wenn die Rechnungskontrolle nicht den gewünschten Effekt gebracht hat oder die IV-Stelle merkt, dass die Teilnehmenden mit der Administration überfordert sind. Dies ist in erster Linie bei denjenigen Teilnehmenden der Fall, von denen ich – bis zu diesem Zeitpunkt – noch nie etwas gehört habe. Mein persönliches Fazit Die Stützpunkte sind ein wichtiger Teil in diesem Projekt. An den Reaktionen merke ich, dass die Teilnehmenden nach einem Besuch sehr erleichtert und auch dankbar sind. Ich empfinde diese Arbeit als wertvoll, denn wenn man die Administration gut und rasch erledigen kann, erspart man sich einerseits viel Ärger und hat dann Zeit für anderes. Andererseits ist für mich die Administration nicht einfach ein notwendiges Übel, nein, sie ist notwendig auch zum Schutze der angestellten AssistentInnen, die wiederum Anspruch haben auf eine korrekte Anstellung und regelmässige Entlöhnung. Darauf lege ich grossen Wert bei meiner Arbeit. Schwarzarbeit oder Dumpinglöhne werden von mir und den anderen Stützpunktleitern nicht geduldet. Gut finde ich auch, dass die IV-Stellen periodisch Rechnungskontrollen machen. Diese geben Auskunft darüber, wie das Assistenzgeld verwendet wird. Das empfinde ich in der heutigen Zeit als eine Notwendigkeit. Ein letztes Wort... Den Teilnehmenden gibt dieses Projekt viel Lebensqualität. Diese neu gewonnene Lebensqualität verbunden mit selbstbestimmtem Leben und eigenverantwortlichem Handeln spornen mich an, mich für dieses Projekt weiterhin einzusetzen. Ich hoffe, dass möglichst bald alle Menschen mit einer schweren Behinderung davon profitieren können. 8 Behinderung und Politik 4/07 Meine Erfahrungen mit dem Assistenzbudget Von Francisco Lopez, Teilnehmer am Pilotversuch «Assistenzbudget» Guten Tag. Ich bin 23 Jahre alt und körperlich behindert. Von klein auf bewege ich mich mit dem Rollstuhl. Heute arbeite ich im Bereich Informatik in einer geschützten Werkstätte. Diese befindet sich in der Institution, in der ich bis im Mai 2006 wohnte. Seit Mai 2006 nehme ich am Pilotversuch Assistenzbudget teil. Mit dem Assistenzbudget will die IV die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung fördern. Sie können ihren Wohnort frei bestimmen und selbst diejenigen Personen anstellen, die sie in ihrem Alltag unterstützen sollen. Ich konnte also in eine eigene Wohnung ziehen, im von mir gewählten Dorf. Sie befindet sich im Erdgeschoss und ist für meine spezifischen Bedürfnisse eingerichtet. Dank dem Assistenzbudget konnte ich drei Personen zu meiner Unterstützung anstellen. Sie helfen mir bei meinen alltäglichen Verrichtungen, bei Transporten, bei der Körperpflege, beim Einkaufen, Kochen und allen anderen Dingen, die man jeden Tag erledigt. Zwei weitere Personen besorgen den Haushalt und begleiten mich am Wochenende, und wenn ich aus dem Haus gehe. Dank diesen fünf Personen werden meine Bedürfnisse abgedeckt. Sie helfen mir insgesamt rund vier Stunden täglich während der Woche und sechs Stunden am Wochenende. Dank dem Assistenzbudget kann ich mein Leben wie jeder andere einrichten. Als ich den Wunsch äusserte, am Pilotversuch teilzunehmen, waren die Reaktionen sehr unterschiedlich: Während meine Familie und meine Freunde sehr positiv reagierten, standen die Betreuer im Heim meiner Idee, allein in eine eigene Wohnung zu ziehen, um einiges zurückhaltender gegenüber. Sie versuchten, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Möglicherweise sorgten sie sich um ihre Stelle oder zweifelten an meiner Fähigkeit, allein zu wohnen? Das Assistenzbudget soll aber das System der sozialen Sicherheit ergänzen und keine bestehenden Dienste ersetzen. Im Übrigen hat sich in den eineinhalb Jahren seit Beginn meiner Teilnahme am Projekt gezeigt, dass ich mit den Assistenzleistenden umzugehen und meinen Alltag zu organisieren vermag und die Mitarbeiter des Heims meine Fähigkeiten und meine Persönlichkeit falsch eingeschätzt haben. Ihre Zweifel und Befürchtungen waren umso unverständlicher, als dass ich im Jahr 2005 vorübergehend in einer betreuten Wohnung gelebt hatte und diese Erfahrung sehr positiv gewesen war. Es stellt sich die Frage, weshalb solche Aufenthalte organisiert werden, wenn anschliessend der «Umzug» in eine eigene Wohnung trotz positiver Bilanz nicht gutgeheissen wird. Der Übergang von der Institution in die eigene Wohnung war zugleich einfach und mühsam. Beschwerlich war er wegen der Haltung und manchmal unbegründeten und verletzenden Äusserungen bestimmter Betreuer. Für den Umzug aus dem Heim musste ich meinen Mietvertrag für das Zimmer drei Monate im Voraus kündigen. Während dieser drei Monate hatte ich täglich mit Leuten zu tun, die mein Vorhaben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ablehnten und mich das auch verstehen liessen. Zudem musste meine Mutter eine Art «Disclaimer» unterzeichnen, welche das 9 Behinderung und Politik 4/07 Heim von jeder Verantwortung für den Fall enthob, sollte sich die Erfahrung als negativ herausstellen. Sie können sich selbst vorstellen, wie man sich als Erwachsener fühlt, wenn die eigene Mutter ein solches Dokument unterschreiben muss. Dennoch und auch aus diesen Gründen war der Umzug in meine eigene Wohnung sehr einfach. Dabei wurde ich von der Vereinigung Cap-Contact – der Westschweizer Zweigstelle des Pilotversuchs – sowie von einem Coach unterstützt, der mir bei den Vorkehrungen für die Anstellung meiner Assistenzleistenden half. Sobald meine Teilnahme feststand, gab es eine Vielzahl von Dingen zu organisieren: Ich musste einen Therapeuten, einen neuen Arzt und Assistenzpersonen finden. Für Letztere musste ich Arbeits- und Versicherungsverträge und Einsatzpläne erstellen. Mit anderen Worten hat mich das Assistenzbudget zu einem Arbeitgeber mit neuen Rechten, aber auch zahlreichen Verpflichtungen gemacht. Natürlich erfordert dieser Rollenwechsel vom Betreuten zum Arbeitgeber eine grosse Umstellung und die Bewältigung verschiedener Hindernisse. Das Leben im Heim und das selbstbestimmte Leben unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, insbesondere auch in Bezug auf die Freizeitorganisation und den Kontakt mit anderen Menschen. Heute habe ich das Gefühl, ein Leben nach der Arbeit zu haben, da ich einen Nachhauseweg habe. Ich sehe viele verschiedene Personen, die nicht mit mir in der Werkstätte arbeiten. Ich kann dann duschen, wann ich will, und das essen, worauf ich Lust habe, wie jeder andere. Natürlich bedeutet dies einen grösseren persönlichen Einsatz an Zeit und Energie als in einer Institution. Dies wird jedoch durch die Vorteile in menschlicher und sozialer Hinsicht bei weitem wettgemacht. Das Assistenzbudget berücksichtigt auch den Unterstützungsbedarf für Freizeitaktivitäten. Ich kann also jemanden anstellen, um Freunde einzuladen, was im Heim nicht möglich war. Zuvor standen mir 300 Franken für Freizeitaktivitäten und Kleider zur Verfügung. Ich ging deshalb nur selten aus. Heute habe ich Gäste, wann ich es möchte, und brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich Umstände mache, wie man mir meistens zu verstehen gab. Mit dem Assistenzbudget fühle ich mich freier. Ich lebe wie andere 23-Jährige, ohne ständig überwacht zu werden. Bisher hat mir der Projektversuch nur Vorteile gebracht. Beispielsweise konnte ich dank dem Assistenzbudget jemanden anstellen, der mich im Sommer in die USA begleitete. Ich war damit nicht mehr darauf angewiesen, dass meine Eltern mit mir verreisen. Ich habe mein Ferienziel ausgewählt, die Reise geplant und eine Begleitperson angestellt. Meine Eltern haben alleine Ferien gemacht, da mit dem Assistenzbudget auch die Eltern «entlastet» werden sollen, die oft eine grosse Arbeit leisten. Ich habe mir gewünscht, meine Persönlichkeit frei entfalten zu können. Das Assistenzbudget hat mir die nötigen Mittel dazu gegeben. Ein Hoch dem Assistenzbudget! Übersetzung: S. Alpiger 10 Behinderung und Politik 4/07 Sozialpolitik Sozialpolitische Rundschau Von Ursula Schaffner Die Wahlen ins eidgenössische Parlament waren das politische Hauptthema in der aktuellen Berichtsperiode. Sachthemen wurden in dieser Zeit allenfalls andiskutiert, Entscheide wurden aber kaum getroffen. In der vorliegenden Rundschau stellen wir deshalb vor allem Resultate aus Studien und Statistiken vor. In der Wintersession kann das neue Parlament zeigen, dass es auf den Baustellen IV, AHV und KVG, um nur einige zu nennen, endlich vorwärts und Nägel mit Köpfen machen will. Invalidenversicherung Die IV-Statistik 2006 bietet wieder interessante Lektüre. Ihr ist zu entnehmen, dass ältere Männer zwischen 60 und 64 Jahren das höchste Risiko haben, aus gesundheitlichen Gründen erwerbsunfähig zu werden (21%). Zum Vergleich: In der Altersgruppe der 25 bis 29-jährigen Männer beträgt das gleiche Risiko 3 Prozent. Bei den Frauen ist das Risiko geringer, für die 60 bis 64-Jährigen beträgt es knapp 16 Prozent, bei den 25 bis 29jährigen gut 2 Prozent. Insgesamt gab die IV im letzten Jahr fast 11,5 Mia. Franken aus. Der grösste Teil davon wurde in Form von persönlichen Geldleistungen ausbezahlt, das heisst als Renten (6,4 Mia.), Hilflosenentschädigungen (0,4 Mia.) oder Taggelder (0,4 Mia.). Weitere wichtige Ausgaben entfielen auf Eingliederungsmassnahmen (1,7 Mia.) und Beiträge an Institutionen (rund 1,7 Mia.). Da die IV-Renten nach wie vor nicht existenzsichernd sind, waren 2006 fast ein Drittel der IV-RentnerInnen auf Ergänzungsleistungen angewiesen (Die gesamte IV-Statistik ist unter http://www.bsv.admin.ch zu finden). Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat im September auch die neuesten Zahlen zur Entwicklung der IV-NeurentnerInnen in der ersten Hälfte des laufenden Jahres veröffentlicht. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wurden vier Prozent weniger IV-Neurenten gesprochen. Auch wurden weniger Neurenten gesprochen als Rentenbeziehende aus der IV ausschieden. Dadurch hat die Gesamtzahl der IV-RentnerInnen in der ersten Hälfte 2007 minimal abgenommen. Das BSV spricht deshalb von einer Stabilisierung des Rentenbestandes, betont aber, dass der Reform- und Finanzbedarf in dieser Volksversicherung weiterhin dringend und hoch ist. Allein die Schuldzinsen der IV betrugen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 147 Mio. Franken, das heisst mehr als die Versicherung für Hilfsmittel ausgab, nämlich 117 Mio. Franken. Es ist nun formell beschlossen, dass die 5. IVG-Revision auf den 1. Januar 2008 in Kraft treten wird. In der entsprechenden Medienmitteilung des Bundesrates ist zu lesen, dass er damit eine durchschnittliche jährliche Entlastung der IV von 320 Mio. Franken erwartet. Gerne erinnern wir an dieser Stelle daran, dass erst vor zwei Jahren in der Botschaft zur 5. IVG-Revision von 596 Millionen zu erwartenden Einsparungen zu lesen war (BBl 2005 4631). Hat der Bundesrat also bereits frühzeitig er11 Behinderung und Politik 4/07 kannt und in sein weiteres Programm integriert (Früherfassung und Frühintervention FeFi lassen grüssen), dass die berufliche Integration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht ganz so einfach zu machen ist, wie man es sich wünschte? Wurden deshalb die Erwartungen heruntergeschraubt? Wir erwarten unsererseits, dass die Betroffenen entsprechend realistisch durch die IV-Stellen beraten und begleitet werden. Zur IV-Zusatzfinanzierung verweisen wir auf einen eigenen Artikel in dieser Ausgabe. AHV In agile 3/07 haben wir über das gute Betriebsergebnis der AHV im vergangenen Jahr berichtet. Gestützt darauf und den Umstand, dass die AHV nächstes Jahr ihren sechzigsten Geburtstag feiert, verlangen die Gewerkschaften und die SP für die RentnerInnen ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Der SGB stellt sich im Jubiläumsjahr einen Bonus von sechzig Franken pro Monat und RentnerIn vor, die SP eine dauerhafte Erhöhung der AHV-Renten um fünfzig Franken. Ein solcher "Zustupf" dürfte für manch eine oder einen der rund zwei Millionen BezügerInnen nicht ungelegen kommen. Denn die durchschnittliche Altersrente für Frauen beträgt nämlich lediglich 1911 Franken pro Monat, für Männer 1920 Franken. Ehepaare erhalten in der Regel monatlich durchschnittlich 3183 Franken. Weiterhin im Gespräch ist die Flexibilisierung des Rentenalters – wir haben bereits mehrfach darüber berichtet. Während die Linke einen Rücktritt aus dem Arbeitsleben bei voller Rente mit 62 Jahren verwirklichen möchte, geht der Ständerat in eine andere Richtung. Er beauftragt den Bundesrat zu prüfen, ob Personen, die bis 68 oder 70 gegen Lohn arbeiten und darauf Sozialabgaben bezahlen, eine Art Übergangsrente beziehen könnten. Sozialminister Couchepin ist über den Auftrag wenig erfreut; er hat das gleiche Anliegen bereits selber abklären lassen und befunden, dass es zu teuer kommen würde. Unterdessen dümpelt die 11. AHV-Revision vor sich hin; das Parlament sollte sich daran machen, hier endlich vorwärts zu machen. Berufliche Eingliederung Im Vergleich zum letzten Jahr haben im Sommer 2007 in der Schweiz 2,3 Prozent mehr Personen gearbeitet. Von diesem Wachstum haben alle Regionen und fast alle Branchen profitiert. Dementsprechend ist auch die Zahl der Arbeitslosen im zweiten Quartal dieses Jahres leicht gesunken. Dagegen ist die Zahl der Personen, welche eine Teilzeitbeschäftigung oder ein höheres Arbeitspensum suchen, unverändert hoch geblieben. Es sind immerhin 263'000 Menschen oder 6,2 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung, die gerne mehr arbeiten würden. Die Universität Zürich hat soeben eine Studie veröffentlicht, welche die Chancen von psychisch beeinträchtigten Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt untersucht (http://www.puk-west.unizh.ch/de/aktuell/resultate.pdf ). Demnach haben 42 Prozent der ausschliesslich psychisch kranken Studienteilnehmenden eine Arbeit finden und halten können, wenn sie sich direkt im ersten Arbeitsmarkt um eine Stelle bemühten und von einem Job-Coach begleitet wurden. Zuerst platzieren, dann trainieren, 12 Behinderung und Politik 4/07 scheint wesentlich bessere Chancen zu bieten, als wenn die Betroffenen zuerst an einem geschützten Arbeitsplatz untergebracht werden. Oft kommen sie dann nicht mehr davon weg. Die Erfahrungen der Kontrollgruppe, welche in geschützten Werkstätten untergebracht wurde, haben diese Annahme teilweise bestätigt. Keine einzige Person der Kontrollgruppe fand in der untersuchten Zeitspanne eine Anstellung. BVG Die Geschäfte in der Finanzbranche laufen gut. Der Bundesrat hat deshalb Anfang September beschlossen, den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge zu erhöhen. Und zwar ab 1. Januar 2008 von 2,5 auf 2,75 Prozent. Damit waren die Arbeitgeber einverstanden; die Gewerkschaften ihrerseits hätten gerne eine Erhöhung um 0,5 Prozent gehabt. Wie viel Gewinn dürfen Lebensversicherer auf dem Geschäft mit der dritten Säule einstreichen? Zu dieser Frage nahm Finanzminister Merz in der Herbstsession im Ständerat Stellung. Ausgelöst wurde sie durch eine Untersuchung des Bundesamtes für Privatversicherungen; diese belegt, dass Versicherungsunternehmen in den letzten vier Jahren im Geschäft mit den Pensionskassen eine sogenannte Eigenkapitalrendite von 13 bis 18 Prozent erzielt haben. Wie viel davon an die Versicherten zurückfliessen muss, ist trotz einer bestehenden Verordnung umstritten. Zur Zeit geht es immerhin um 500 bis 700 Millionen Franken, die je nach sozial- oder finanzpolitischer Haltung jährlich anders verteilt werden müssten. BR Merz meinte, die jetzt erzielten Gewinne dienten "zur Glättung der Auszahlungen für ertragsreiche und schlechtere Jahre". Wer sich bei diesem Glättmanöver schliesslich die Finger verbrennen und wer das neue Geschäftsjahr frisch gebügelt und sorgenfaltenfrei antreten kann, ist noch nicht definitiv entschieden. Der Bundesrat hat Ende Juni 2007 vorgeschlagen, dass bis in dreissig Jahren alle öffentlichen Pensionskassen voll ausfinanziert sein müssen, das heisst, dass sie bis dann ihre Ausgaben zu hundert Prozent decken können müssen. In der Vernehmlassung sind die Vorschläge auf breite Ablehnung gestossen. Der Pensionskassenverband etwa findet, das Vorhaben verschlinge zu viele Gelder und könne dennoch nicht alle Probleme lösen, die es zu lösen vorgebe. Viele Gemeinden, aber auch Gewerkschaften, Seniorenverbände und Arbeitgeber kritisieren, die rund 16 Milliarden Franken, die für das Projekt gefunden werden müssten, seien eine zu grosse Last. Bei den Städten ist man unterschiedlicher Meinung, je nachdem, wie weit die eigenen Pensionskassen bereits ausfinanziert sind oder nicht. Zwischen den Kantonen ist ein Röstigraben auszumachen: Die Deutschschweizer Kantone stehen dem bundesrätlichen Vorschlag eher positiv gegenüber, während die französischsprachigen sie ablehnen. Letztere befürchten, entweder grosse Sparpakete schnüren oder aber massive Steuererhöhungen durchführen zu müssen. KVG In den letzten Wochen wurde das Thema "Rationierung von Gesundheitsleistungen" von verschiedener Seite aufgegriffen. Schicksale von alten Menschen wurden bekannt, denen die notwendige Pflege im Spital vorenthalten wurde. Zum Beispiel, dass man einer älteren Frau, die nicht mehr selber essen kann, kurzerhand eine Magensonde verpasste, um so Personal zu sparen. Aus dem gleichen Grund werden 13 Behinderung und Politik 4/07 inkontinenten Patienten Windeln angezogen. Eine Studie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat aufgezeigt, dass die Rationierung von medizinischen Leistungen weiter verbreitet ist, als man bisher angenommen hat. Insbesondere das Pflegepersonal verlangt deshalb nach Leitlinien, die von der Politik zu setzen seien. Anderer Meinung ist der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, der die im Verborgenen stattfindende Beschränkung des Zugangs zu medizinischen Leistungen als nicht vordringlich einstuft. Dennoch zeigt sich bereits heute, dass dort gespart wird, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist: Bei alten, oft alleinstehenden und chronisch oder psychisch kranken Menschen. Das Tabu muss deshalb gebrochen und eine öffentliche Diskussion darüber geführt werden, wie die Qualität der medizinischen Leistungen gesichert werden kann. Da ist auch der Bund gefordert. Viel lassen sich Frau und Herr SchweizerIn ihren Medikamentenkonsum kosten. Rund 800 Franken geben sie pro Person und Jahr im Schnitt aus – beziehungsweise lassen sie sich von den Krankenkassen zum grossen Teil zurückerstatten. Das kostet die Krankenversicherer fast fünf Milliarden Franken pro Jahr. Der Preisüberwacher kritisiert, dass viele Medikamente als kassenpflichtig zugelassen würden, obwohl sie keine therapeutische Mehrwirkung erzielten. Damit werde der Umsatz von teilweise unnötigen Medikamenten angekurbelt. Dagegen sind die Ausgaben in der Schweiz für Gesundheitsprävention gering. Sie machen nur 2,1 Prozent der gesamten Gesundheitskosten von insgesamt 1,13 Milliarden Franken aus. Zum Vergleich: Finnland gibt für Prävention 3,8 Prozent und die Niederlande 5,5 Prozent aus. Das BAG hat nun dem Bundesrat einen Bericht vorgelegt, der die Gesundheitsförderung und Prävention in der Gesellschaft besser verankern will. Solche Investitionen stärken die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und bewahren die Arbeitsfähigkeit, ist das Bundesamt überzeugt. Bis im Herbst 2008 soll ein entsprechender Gesetzesentwurf vorliegen. Erfreulich ist der neueste Bericht des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Demnach geht es der Schweizer Bevölkerung besser als im Jahr 2002. Rund 60 Prozent fühlen sich gelassen und psychisch im Gleichgewicht; vier Jahre zuvor waren es fünf Prozent weniger gewesen. Auch leichtere Beschwerden wie Nervosität oder Schlafstörungen sind zurückgegangen, von 40 auf 30 Prozent. Interessant ist, dass in der beobachteten Zeitperiode mehr Menschen Fachhilfe bei psychischen Problemen in Anspruch genommen haben, und zwar mehr Männer als Frauen. Diese Tatsache widerspricht der landläufigen Meinung, dass sich vor allem Frauen psychologisch oder psychiatrisch behandeln liessen. Vermischtes Steuerfreies Existenzminimum Die nationalrätliche Sozialkommission hält an ihrer Initiative fest, dass das Existenzminimum steuerfrei werden soll. Der Ständerat war auf das Geschäft nicht einmal eingetreten; er fand, es sei Sache der Kantone, ob sie das Existenzminimum besteuern wollen oder nicht. 14 Behinderung und Politik 4/07 Handicap-Forschung an der Uni St. Gallen Dank der grosszügigen Zuwendung eines Unternehmers, der bei einem Unfall schwer verletzt wurde, wird die Uni St. Gallen in den kommenden Jahren einen Lehrstuhl "Handicap-Forschung" aufbauen können. Damit können Lücken geschlossen werden, welche die ökonomische Forschung im Bereich soziale und wirtschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung aufweist. Quellen (berücksichtigt bis 22. Oktober 2007): NZZ, Tagesanzeiger, Der Bund, Le temps, Medienmitteilungen der Bundesämter für Sozialversicherungen und Statistik sowie des Gesundheitsobservatoriums. IV-Zusatzfinanzierung Von Ursula Schaffner In agile 3/07 haben wir über den Stand der Diskussionen in der zuständigen Ständeratskommission (SGK S) in Sachen IV-Zusatzfinanzierung berichtet. Inzwischen hat die Kommission erneut getagt und ist nicht viel weiter gekommen als im August. Damals hatte sie sich dazu bekannt, die Mehrwertsteuer auf sieben Jahre befristet um 0,5 Prozent zu erhöhen. Damit soll das strukturelle Defizit der IV gedeckt, das heisst die Unterfinanzierung der Versicherung behoben werden. Die SGK S will nach Ablauf der magischen sieben Jahre eine neue Beurteilung der finanziellen Lage der IV vornehmen und geht davon aus, dass bis dann die 5. IVG-Revision zu markanten Einsparungen geführt hat und somit der Anteil an der Mehrwertsteuer, der zugunsten der IV erhoben wird, wieder gesenkt werden kann. Eine Erhöhung der Lohnprozente kommt für die ständerätliche Kommission weiterhin nicht in Frage. Eigener IV-Fonds Ebenfalls im August hatte die SGK S nach Anhörung des noch bis Ende Jahr amtierenden Präsidenten des AHV-Fonds bekannt gegeben, dass sie gleichzeitig mit der Mehrwertsteuererhöhung die IV aus dem AHV-Fonds lösen will. Sie skizzierte dabei folgenden Vorschlag: Einerseits soll die heutige Schuld der IV von rund 10 Milliarden Franken beim AHV-Fonds gestrichen werden. Andererseits soll eine einmalige Überweisung von 5 Milliarden Franken vom AHV- an den neuen IV-Fonds vorgenommen werden, sozusagen als Startkapital. Sodann soll der Bund während sieben Jahren einen Sonderbeitrag an den AHV-Fonds leisten als Ausgleich für die Schuldenstreichung. In der nach der Oktobersitzung veröffentlichten Pressemitteilung verweist die SGK vorwiegend auf die Augustsitzung. Neues war also nicht zu hören. Vielmehr wurde einmal mehr beteuert, man wolle eine mehrheitsfähige Lösung finden und erwarte bis zur Sitzung Anfang November noch einige Präzisierungen. Schliesslich sollen auch die Sozialpartner noch angehört werden. 15 Behinderung und Politik 4/07 Welches Weihnachtsgeschenk in der Tüte? Zum x-ten Mal, man kommt mit Zählen kaum mehr mit, haben es somit die BundespolitikerInnen aller Couleur verpasst, in Sachen IV-Zusatzfinanzierung endlich Entscheide zu treffen. Offenbar haben sie Angst davor, Klartext zu reden und den Wählerinnen und Wählern vor der Neubestellung des Parlaments am 21. Oktober 2007 reinen Wein einzuschenken, nämlich dass es zusätzliches Geld für die IV braucht und der Schuldenberg endlich abgebaut werden muss. Er frisst immerhin allein aufgrund der Schuldzinsen jeden Tag ein Loch von rund einer Million Franken in den AHV-Fonds. Diese bittere Pille wird im November nicht süsser sein. Falls die SGK S am 8. und 9. November 2007 aber immer noch auf Verzögerungstaktik und die Vorlage nicht für die Wintersession bereit macht, müssen die Menschen mit Behinderung definitiv andere Töne anschlagen und ihr Weihnachtsgeschenk mit anderen Methoden als Geduld und diplomatischen Briefen einfordern. 5. IV-Revision: Was ändert sich im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung? Von Eric Haberkorn, Leiter des kantonalen Büros von IPT in Freiburg Die berufliche Wiedereingliederung ist einer der Schwerpunkte der 5. IVG-Revision. Sie soll anhand der folgenden Instrumente umgesetzt werden. Frühinterventionsmassnahmen Im Rahmen der Früherfassung sollen arbeitsunfähige versicherte Personen der zuständigen IV-Stelle gemeldet werden können; innerhalb von 30 Tagen entscheidet die Stelle über den Anspruch des Versicherten auf Frühinterventionsmassnahmen. Hat er Anspruch auf solche Massnahmen, wird er aufgefordert, sich bei der IV anzumelden. Die IV-Stelle kann ihn anschliessend zu einem Früherfassungsgespräch einladen. Eine wichtige Neuerung besteht darin, dass nun parallel zur Abklärung des Falls verschiedene Instrumente (die Frühinterventionsmassnahmen) eingesetzt werden können. Bisher war die Abklärung zuerst vorzunehmen. Je nach Ergebnis wurde dem Versicherten Anspruch auf Massnahmen gewährt oder nicht (namentlich Rehabilitationsmassnahmen, da es noch keine Frühinterventionsmassnahmen gab). Da die Erfolgschancen für eine berufliche Wiedereingliederung grösser sind, wenn Massnahmen früh ergriffen werden, handelt es sich hier grundsätzlich um einen klaren Fortschritt. Gemäss dem Entwurf der Verordnung über die Invalidenversicherung dürfen die Kosten für die Massnahmen der Frühintervention 20'000 Franken nicht übersteigen. Im Kommentar wird ein Durchschnittsbetrag von 5000 Franken pro Versicherten angegeben. Im Gesetz ist eine breite Palette von Massnahmen vorgesehen. Darunter befinden sich verschiedene Instrumente, die von den IV-Stellen bereits heute bei der Rehabilitation eingesetzt werden, namentlich im Rahmen der beruflichen Massnahmen: 16 Behinderung und Politik 4/07 Ausbildungskurse, Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Arbeitsplatzanpassung. Neu dabei ist die Möglichkeit, solche Instrumente rasch einzusetzen. Ebenfalls neu sind die Beschäftigungsmassnahmen. Wahrscheinlich werden sich diese nicht stark von den Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung unterscheiden, die heute als aktive Arbeitsmarktmassnahmen im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) angeboten werden. Frühinterventionsmassnahmen und Abklärung können parallel laufen; nach Abschluss dieses Prozesses, der sich in den meisten Fällen über rund 6 Monate erstreckt, wird ein Entscheid über den Anspruch auf Wiedereingliederung getroffen. Zu dieser Wiedereingliederung können Integrationsmassnahmen und berufliche Massnahmen gehören. Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung Diese Massnahmen sind neu. Sie richten sich an versicherte Personen, für welche sich berufliche Massnahmen noch nicht eignen. Die Integrationsmassnahmen bereiten diese Personen auf berufliche Massnahmen vor und dienen dazu, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Voraussetzung ist, dass die versicherte Person eine Präsenzzeit von zwei Stunden täglich während mindestens vier Tagen pro Woche leisten kann. Bei den Integrationsmassnahmen handelt es sich um Massnahmen zur Gewöhnung an den Arbeitsprozess, zum Aufbau der Arbeitsmotivation, zur Stabilisierung der Persönlichkeit sowie zum Einüben sozialer Grundelemente. Im Gesetz erwähnt werden auch Beschäftigungsmassnahmen, die zur Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung einer geeigneten Tagesstruktur dienen sollen, bis berufliche Massnahmen umgesetzt werden oder wieder eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen wird. Ebenfalls genannt werden die Begleitung des Versicherten am Arbeitsplatz und der Wunsch nach Wirtschaftsnähe. Wahrscheinlich werden auch geschützte Werkstätten und die Programme zur vorübergehenden Beschäftigung gemäss AVIG sowie die Arbeitgeber in Anspruch genommen werden. Diese Massnahmen scheinen sich spezifisch an psychisch kranke Personen zu richten. Sie werden längstens für die Dauer von einem Jahr zugesprochen. In Ausnahmefällen kann diese Dauer um ein Jahr verlängert werden. Diese besonderen Massnahmen für psychisch kranke Personen sind positiv zu werten. Es sollte jedoch vermieden werden, dass eine Personengruppe, die bereits unter vielen Vorurteilen leidet, stigmatisiert wird. Zudem zeugt diese Festlegung auf eine Zielgruppe von einer sehr medizinischen Sichtweise von Behinderung. Eine Alternative könnte darin bestehen, dass Integrationsmassnahmen aufgrund der Einschränkungen (Unfähigkeiten) und unabhängig von den Ursachen der Behinderung zur Verfügung gestellt werden. Es wäre schade, wenn eine Integrationsmassnahme, welche einen Eingliederungsprozess erleichtern könnte, nicht zum Einsatz kommen würde, nur weil die Behinderung nicht psychischen Ursprungs ist. 17 Behinderung und Politik 4/07 Massnahmen beruflicher Art Die Arbeitsvermittlung war bereits im Rahmen der 4. IVG-Revision vorgesehen. In der 5. Revision wird ein zusätzliches Instrument hinzugefügt: die Entschädigung für den Arbeitgeber im Falle einer Erhöhung der Beiträge für die obligatorische berufliche Vorsorge (BVG) oder für die Krankentaggeldversicherung (EO). Der Gesetzgeber geht davon aus, dass eine deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt liegende Zahl von Abwesenheiten von der Arbeit zu einer Erhöhung der EO- und BVG-Beiträge des Arbeitgebers führt. Um dies auszugleichen, erhält der Arbeitgeber bei einer länger als 15 Tage dauernden Abwesenheit einer Person (im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt von 8 Tagen) ab dem 16. Abwesenheitstag eine Entschädigung (von 34 bis 48 Franken, je nach Grösse des Unternehmens) für jeden Tag, an dem die Person fehlt. Aufgrund der möglichen Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bestehen bei den Arbeitgebern oft Bedenken, in ihrer Gesundheit beeinträchtigte Personen anzustellen. Mit Hilfe dieses Instruments sollten diese entkräftet werden. Ein weiteres neues Instrument ist für die 5. IV-Revision vorgesehen: der Einarbeitungszuschuss. In der Regel benötigt ein Mitarbeiter an einem neuen Arbeitsplatz eine Anlern- und Einarbeitungszeit. Ist aufgrund der Beeinträchtigung der Gesundheit eine längere Zeit als gewöhnlich erforderlich, kann dem Arbeitgeber eine finanzielle Entschädigung gewährt werden. Dies ist eine Anreizmassnahme für den Arbeitgeber, gesundheitlich eingeschränkte Personen anzustellen. Gleichzeitig kann dadurch das mögliche finanzielle Risiko für den Arbeitgeber während der Anlern- und Einarbeitungszeit verringert werden. Weitere Massnahmen In Artikel 29quater des Entwurfs der IV-Verordnung ist ausdrücklich vorgesehen, dass ein Versicherter, dessen Rente wegen Aufnahme oder Erhöhung einer Erwerbstätigkeit aufgehoben oder reduziert wurde, erneut IV-Leistungen in Anspruch nehmen kann, wenn er innerhalb von fünf Jahren während mindestens 30 Tage in Folge arbeitsunfähig ist. Innerhalb von 30 Tagen hat die IV-Stelle zu entscheiden, ob die Weiterbeschäftigung möglich ist oder nicht; ist diese nicht möglich, hat der Versicherte erneut Anspruch auf die ursprüngliche Rente. Anhand dieser Massnahme soll verhindert werden, dass gesundheitlich eingeschränkte Personen es nicht wagen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, da sie befürchten, bei einem Misserfolg den gesamten schwierigen IV-Prozess von Anfang an wieder durchlaufen zu müssen. Schlussfolgerung Der Schwerpunkt der 5. IV-Revision liegt auf der beruflichen Wiedereingliederung. Dafür sind verschiedene neue Instrumente vorgesehen. Einige dieser Instrumente sollten – bereits im Rahmen der Frühintervention – rasch eingesetzt werden können. Die Absicht des Gesetzgebers ist somit positiv. In Bezug auf die Umsetzung der neuen Bestimmungen bleiben jedoch noch verschiedene wichtige Fragen unbeantwortet. 18 Behinderung und Politik 4/07 Das IV-Gesetz gilt in der gesamten Schweiz. Heute ist seine Anwendung jedoch oft von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Auf politischer Ebene wird das allgemeine Klima immer stärker von der Tendenz beherrscht, die Hürde für den Zugang zu den Leistungen der verschiedenen Versicherungen aus Spargründen zu erhöhen. In der Praxis zeigt sich, dass zuvor durch andere Versicherungen, namentlich die IV, unterstützte Personen in die Sozialhilfe abgleiten. Wie sich die in die 5. IV-Revision gesetzten Hoffnungen konkretisieren, wird weitgehend von der Art der Umsetzung des Gesetzes und den Bedingungen abhängen, zu denen eine Person bestimmte Instrumente in Anspruch nehmen kann! In Artikel 68bis des Gesetzes wird die interinstitutionelle Zusammenarbeit namentlich auf für die Rehabilitation der Versicherten wichtige öffentliche und private Institutionen ausgeweitet. Diese Bestimmung ist begrüssenswert: Vor allem auch in privaten Organisationen ist ein beträchtliches, in jahrelanger Praxis gebildetes Know-how vorhanden, welches zu allgemein anerkannten Eingliederungserfolgen führt. Das Rad neu zu erfinden, würde eine Verschwendung von Ressourcen bedeuten. Auch hier wird sich das Gesetz als das herausstellen, was man daraus machen wird! Seit der 4. IV-Revision hat sich die Haltung der meisten IV-Stellen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den privaten Institutionen kaum verändert, was wir bedauern. Die Entschlossenheit des BSV, welches die 4. und 5. Revision in die Wege leitete, dürfte aber bewirken, dass diese für die Realisierung des Postulats der IV – des Vorrangs der Integration – unerlässliche kulturelle Revolution stattfinden wird! Im Sinn der Subsidiarität und Komplementarität äussern die privaten Institutionen erneut ihren Willen, aktiv zur Umsetzung der neuen Massnahmen beizutragen. Übersetzung: S. Alpiger 19 Behinderung und Politik 4/07 Pflegefinanzierung: Der Ständerat ist nur teilweise mit dem Nationalrat einig Von Simone Leuenberger Ein uraltes Geschäft ist noch immer nicht zu Ende beraten: die Pflegefinanzierung. Nach einigen Zugeständnissen des Ständerates muss nun der Nationalrat über die restlichen Differenzen befinden. 20 Prozent sind genug Die gute Nachricht vorweg: Der Ständerat hat sich bei der Frage des Selbstbehalts doch noch auf die Variante des Nationalrates einigen können. Das heisst, die Beteiligung der Pflegebedürftigen an den Pflegekosten soll 20 Prozent des Höchsttarifs der Krankenversicherungen nicht übersteigen. Damit hat die IG Pflegefinanzierung eines ihrer Hauptanliegen durchsetzen können. Doch Menschen mit einem grossen Bedarf an Pflege werden auch mit dieser Variante stark zur Kasse gebeten. 7'100 Franken pro Jahr müssen sie gemäss der nun beschlossenen Änderung aus der eigenen Tasche bezahlen. Im Gegensatz zur grossen hält die kleine Kammer jedoch an der einseitigen Kostenneutralität der neuen Pflegefinanzierung für die Krankenversicherungen fest, obwohl die geltenden Rahmentarife seit 1997 eingefroren sind. Die Differenz sollen nach dem Willen des Ständerats die Kantone finanzieren. Eine weitere Differenz zwischen den beiden Räten besteht darin, dass der Ständerat die Finanzierung der Akut- und Übergangspflege gleich behandeln will wie die Langzeitpflege. Die Krankenversicherungen sollen demnach nur einen Teil der Kosten der Akut- und Übergangspflege übernehmen. Der Rest soll auf Patienten und Kantone verteilt werden. Diese Regelung wird vor allem von linker Seite heftig kritisiert, weil sie falsche Anreize setze. Für die Patienten ist es dann billiger, länger im Spital zu bleiben, weil dort die ganze Pflege bezahlt wird, zuhause aber nicht. Der Nationalrat wollte, dass die Krankenkassen für eine bestimmte Zeit die vollen Kosten übernehmen. In den anderen strittigen Punkten hat sich der Stände- mehrheitlich dem Nationalrat angepasst: Die Vermögensfreigrenzen für Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, sollen erhöht werden, und HeimbewohnerInnen sollen nicht wegen ihrer Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe angewiesen sein. Keine Pflegeversicherung für Reiche Der Nationalrat hat sich gegen eine Säule 3c ausgesprochen. Damit wollte der Ständerat ein neues, steuerbegünstigtes Vorsorgekonto einführen. Das angesparte Kapital hätte im Alter zur Deckung der Pflegekosten dienen können. Eine Lösung für Reiche sei das, meinte die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Die Pflegefinanzierung betreffe aber alle. Zudem würde eine solche Lösung erhebliche Steuerausfälle nach sich ziehen. Quellen: Tagespresse, Wortprotokolle der Ständeratsdebatte 20 Behinderung und Politik 4/07 Gleichstellung Der Ständerat hat das revidierte Erwachsenenschutzgesetz verabschiedet Egalité Handicap/BA/ Am 27. September hat der Ständerat das neue Erwachsenenschutzrecht verabschiedet und bis auf wenige Ausnahmen den Vorschlag des Bundesrates übernommen. Mit der Revision soll anstelle der bisher geltenden standardisierten vormundschaftlichen Massnahmen ein System treten, das sich stärker an den spezifischen Bedürfnissen der Betroffenen orientiert. Die föderalistische Vielfalt wird durch gesamtschweizerische Standards abgelöst, und die Verfahren sind transparenter und professioneller ausgestaltet. Leider sind die Verbesserungen, welche die Organisationen von und für Menschen mit Behinderung (DOK) am 22. August in einem Schreiben verlangt haben, nicht berücksichtigt worden. Die Vorlage kommt nun in den Nationalrat. Die Organisationen werden ihre Anliegen dort erneut einzubringen versuchen. Die Anträge betreffen die folgenden Defizite: Fehlender Einbezug des gesetzlichen Vertreters bei Behandlungen in der psychiatrischen Klinik; Unverbindlichkeit der Patientenverfügung bei der Erstellung des Behandlungsplans bei einer psychischen Störung; Der Entwurf will im Vergleich zum Vorentwurf den Kantonen die Möglichkeit einräumen, gesetzliche Grundlagen für ambulante Zwangsbehandlungen zu schaffen; Anders als im Vorentwurf sollen die Kantone nicht verpflichtet werden, für die Aus- und Weiterbildung der Beistände und eine genügende Anzahl von Beiständen zu sorgen; Ungleichbehandlung bei medizinischen Massnahmen: Bei der medizinischen Behandlung von urteilsunfähigen Personen unterscheidet der Entwurf zwischen somatischen und psychischen Erkrankungen. Bei körperlichen Krankheiten hat die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei der Wahl der medizinischen Massnahmen grundsätzlich dem Willen der Patientin oder des Patienten zu entsprechen, der in der Patientenverfügung festgehalten ist. Liegt keine Patientenverfügung vor, so sind die in Art. 378 bezeichneten Personen berechtigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten. Für die Behandlung von psychischen Störungen bei urteilsunfähigen Personen gelten grundsätzlich andere Regeln: Bei untergebrachten Personen kann die Chefärztin oder der Chefarzt gemäss Art. 434 unter bestimmten Voraussetzungen eine Behandlung ohne Zustimmung, d.h. eine Zwangsbehandlung, anordnen. 21 Behinderung und Politik 4/07 Verkehr Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr Die Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr (BöV) gibt vierteljährlich ihre Nachrichten heraus. Sie berichtet darin über die neusten Entwicklungen im Bereich behindertengerechter öffentlicher Verkehr. BöV-Nachrichten 4/2007 Bildung Von Catherine Corbaz Kursprogramm 2008 In den letzten Jahren haben Sie das Kursprogramm stets mit dem Erscheinen der Zeitschrift «agile – Behinderung und Politik» im Dezember erhalten. Die gemeinsame Produktion und Herausgabe des Kursprogramms mit Procap ist 2006 zu Ende gegangen. Nun haben wir uns entschieden, dieses Jahr kein separates Kursprogramm zu drucken. Alle Angaben zu den Seminaren von AGILE finden Sie in unserer Zeitschrift, im Newsletter oder auch auf unserer Internet-Seite. Unser nächstes Seminar findet am 23. Januar in Olten statt: „Welche Konsequenzen hat die 5. IVG-Revision für mich als behinderte Person, als Angehörige/r oder als BeraterIn?“ Detailprogramm Im Laufe des Jahres finden zwei weitere Kurse statt. Der eine richtet sich an behinderte Personen, die politisch aktiv werden wollen. „Behindertenpolitik – wo und wie kann ich mich engagieren?“ Das Kursdatum ist der 17. Mai 2008, Kursort ist Zürich. Mehr Informationen dazu erhalten Sie ab Januar 2008. Der dritte geplante Kurs im 2008 befasst sich mit einem Thema aus dem Bereich Gleichstellung. 22 Behinderung und Politik 4/07 Behindertenszene Beispielhaftes Engagement - für soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung von Eva Aeschimann Traditionsgemäss im November trafen sich in Bern die Präsidentinnen und Präsidenten der AGILE-Mitgliedorganisationen zur jährlichen Konferenz. Dieses Jahr stand der Einsatz für soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen im Zentrum. Zum Auftakt der Tagung führte die Präsidentin von AGILE, Therese Stutz Steiger, die gut 50 Teilnehmenden in das Thema ein. Danach präsentierten die Verantwortlichen von fünf unterschiedlichen Projekten ihre Engagements und Projekt-Ziele. Dabei zeigte sich, dass die Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung – als Kernaufgabe der Selbsthilfe – ganz verschiedene Formen annehmen kann. Schulprojekt von Procap „Mal seh’n!“ Informationen zum Thema Behinderung seien für Schulklassen und Lernende wichtig, vor allem jene aus erster Hand - von Menschen mit Behinderung. Dies unterstrichen die Verantwortlichen von Procap in ihrer Start-Präsentation. Leiter Gerhard Protschka und Ursula Eggli, als Moderatorin mit Behinderung, beschrieben ihr Projekt als Einstiegsveranstaltung für Schulen. Ausgangspunkt sind jeweils Anfragen von Schulen zum Thema Behinderung. In der Folge besuchen einer der ungefähr 15 betroffenen Moderatoren und ein Techniker mit dem nötigen Equipment eine Schulklasse. Dieses Gratis-Angebot wird von den Schulen rege benutzt. Bis zu hundert Einsätze jährlich bestreitet das Team „Mal seh’n!“. Neben der persönlichen Begegnung und dem daraus folgenden Austausch mit einem Menschen mit Behinderung wird von ein Kurzfilm gezeigt. Dieser nimmt direkten Bezug auf die Behinderungsform, die die Moderatorin oder der Moderator repräsentiert. Ursula Eggli berichtete von durchwegs positiven Erfahrungen; Kinder würden durch diese Begegnung mit Behinderung aufgeschlossener und verlören ihre Unsicherheit. Neben der erfolgreichen Sensibilisierung von Schülern, verbucht Procap mit diesem Projekt aber auch bezüglich Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung wichtige Punkte. Die ModeratorInnen werden in einer mehrtägigen Weiterbildung gezielt für die Einsätze ausgebildet, ihre Kompetenzen gefördert. Für ihre Engagements werden sie zudem finanziell entschädigt. Auch ohne Werbung ist das Schulprojekt von Procap ausgebucht. Für einen Ausbau des Angebots sucht die Projektleitung weitere Moderatorinnen und Moderatoren. Projekt EFFBIS von VASK Auch die zweite Präsentation, von der Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie-/Psychisch-Kranken VASK, zielt auf Lernende ab. Projektleiterin Trudy Vo23 Behinderung und Politik 4/07 nesch stellte der PräsidentInnen-Konferenz ein eigenes Lehrmittel vor als Informationsquelle über psychische Erkrankungen. Unter dem Titel EFFBIS (Entstigmatisierungs- und Forschungsprojekt zur Früherkennung und Behandlungsverbesserung durch Information an Schulen) schliesst VASK bei den Unterrichtsmaterialien eine Lücke. Das Lehrmittel mit dem Titel „Über die Seele und ihre Leiden“ ist das einzige seiner Art in der Schweiz. Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab Sekundarstufe 2. Es besteht aus einem Lehrbuch für die Lernenden und einem Kommentar für die Unterrichtenden. Ziele des Lehrmittels sind neben der Information unter anderem auch Entstigmatisierung und Früherkennung. Das Lehrbuch stützt sich methodisch auf unterschiedlichste Unterrichtsformen von Tests, über Arbeitsblätter bis zu Comics. Noch gibt es „Über die Seele und ihre Leiden“ erst in deutscher Sprache. Projektleiterin Trudy Vonesch strebt aber möglichst bald die Übersetzung des Lehrbuchs in andere Landessprachen an. Projekt Back to work von AGILE Die Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung stand im Mittelpunkt der Präsentation von AGILE. Unter dem Titel „Back to work“ stellten Projektleiterin Ursula Schaffner und Projektmitarbeiterin Catherine Corbaz eine Informationskampagne für Arbeitgebende in Zusammenarbeit mit kantonalen Handelskammern und IV-Stellen vor. „Back to work“ zielt darauf ab, die verschiedenen Akteure bei der beruflichen Integration an einen Tisch zu bringen. Die beiden AGILE-Mitarbeiterinnen demonstrierten, mit Bauarbeiter-Helm auf dem Kopf, wie wegweisend der Zusammenschluss verschiedener Interessen unter einem Dach sein kann. Das Projekt liefert interessierten Partnern fix-fertige Veranstaltungskonzepte für Info-Anlässe, runde Tische, Medienkontakte, Kontakte zu Menschen mit Behinderungen, Info-Mappen und anderes. „Back to work“ versteht sich in diesem Sinn als Plattform und Einstiegshilfe, um mehr Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt einzugliedern. Mehrere Kantone haben diese Informationskampagne bislang genutzt, so Nidwalden, Solothurn, Freiburg, Neuenburg oder auch die Waadt. In weiteren Kantonen dürften vergleichbare Veranstaltungen realisiert werden, wenn es gelingt, deren IV-Stellen für eine Mitarbeit zu gewinnen. Formazienda FTIA Die Federazione Ticinese Integrazione Andicap FTIA wiederum profilierte sich mit ihrem Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Behinderung im Kanton Tessin. Geschäftsführer Marzio Proietti erläuterte vor der PräsidentInnenKonferenz die Funktionsweise der Formazienda FTIA. Seit zwanzig Jahren bietet diese Einrichtung Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für Menschen mit Körperbehinderung und zum Teil mehrfacher Behinderung. In der Azienda (Betrieb) arbeiten gut zwanzig Personen in einer Art geschützten Werkstatt. Der Bereich Formazione (Bildung) ermöglicht rund 15 Personen eine kaufmännische Ausbildung. Weiter betreibt die Formazienda mit dem Projekt „alla stazione“, im ehemaligen Bahnhof von Giubiasco, eine SBB-Agentur. Fünf Menschen mit Behinderung beraten, verkaufen 24 Behinderung und Politik 4/07 und informieren rund um das SBB-Ticketangebot - dies als Junior Business Team im freien Markt. Die Formazienda FTIA legt bei der Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung unter anderem Wert auf persönliche Entwicklungs- und Ausbildungspläne. Sie hilft auch bei der Stellensuche und offeriert eine individuelle Begleitung. Wichtig ist der Formazienda FTIA, laut Marzio Proietti, insbesondere aber auch die Suche nach neuen, potentiellen Arbeitgebern. Agendaset GmbH Daniel Kaufmann, Geschäftsführer der Firma Agendaset GmbH, präsentierte den Zuhörenden ein Beispiel für eine vollständige berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Die Agendaset GmbH, ein Dienstleistungsunternehmen des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, ist im Telemarketing tätig. Die Agendaset GmbH bietet blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das Unternehmen beschäftigt nach Möglichkeit blinde und sehbehinderte Menschen. Laut Daniel Kaufmann in der Überzeugung, dass Blinde und Sehbehinderte mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Nebst Geruchs- und Tastsinn sei das Gehör, speziell, die Fähigkeit zuhören zu können, bei seinen Mitarbeitern stark entwickelt. Zuhören zu können, sei deshalb auch die Kernkompetenz seiner Unternehmung. Aus der Praxis als Call-Agent berichtete der blinde Martin Käufeler. Er und seine Kolleginnen bearbeiten verschiedene Bereiche des Telemarketings wie beispielsweise Fundraising, Marktforschung und Mitgliedergewinnung. Wichtig ist für Käufeler, dass er mit dieser Anstellung ohne IV-Leistungen bestehen kann. Ein Umstand, der ihm auch für seine weitere Zukunft am Herzen liegt. Die Agendaset GmbH sucht derzeit weitere blinde oder sehbehinderte Mitarbeitende. Denn eine der grossen Herausforderungen des Unternehmens ist die Rekrutierung von Behinderten. Abgesehen von der branchenüblichen, hohen Fluktuation. Schlussrunde – Konsequenzen für die Selbsthilfe? Fünf unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Zielgruppen – alle aber mit der Absicht, die soziale und berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung voranzubringen. In welche Richtung müsste das Engagement der Selbsthilfeorganisationen gehen? Wie müsste AGILE nach Meinung der Tagungsteilnehmer aktiver werden? Diese Frage stellte Therese Stutz Steiger in einer Schlussrunde. Die Rückmeldungen gingen in unterschiedliche Richtungen. Neue Arbeitsmodelle, eigene Firmengründungen – gemeinsam mit Nicht-Behinderten, Normalität ohne Sondereinrichtungen, aber auch Quoten wurden genannt. Insbesondere sei die weitere Sensibilisierung der Gesellschaft wichtig, um die Entwicklung Richtung Integration und Gleichstellung zu beschleunigen. Therese Stutz Steiger schloss die Tagung - dies mit den Worten, dass auch künftig alle Akteure der Behindertenpolitik und insbesondere die Selbsthilfe-Organisationen die Forderungen, Bedürfnisse und Wünsche von Behinderten in der Arbeitswelt anmelden müssen. Und vielleicht auch erzwingen. Dies im Sinne einer besseren Integration aller Menschen mit Behinderung! 25 Behinderung und Politik 4/07 Donnerstage können das Leben verändern Von Eva Aeschimann, neue Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung Der 27. September 2007 war für mich, 39-jährig, ein ausgesprochen guter Tag. An diesem Donnerstag erhielt ich die Zusage, dass ich künftig für AGILE – BehindertenSelbsthilfe Schweiz arbeiten würde. Ein Happy-End einer bald zweijährigen Odyssee. Und damit auch ein persönlicher Neustart. Die Diagnose Ein ausgesprochen schlechter Tag dagegen war für mich der 16. Februar 2006. Auch ein Donnerstag. Damals erhielt ich die Diagnose Brustkrebs. Der Diagnose folgten Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen. Eine harte, fordernde Zeit für mich, meine Partnerin, meine Familie, Freunde und die weitere Umgebung. Wann immer möglich, arbeitete ich während dieser Zeit in meinem Beruf als Redaktorin bei einem Stadtberner Lokalradio. Ende August dieses Jahres entschied ich mich dann, die Seite zu wechseln. Weg vom Tagesjournalismus in Richtung Öffentlichkeitsarbeit. So wurde der letzte August-Tag dieses Jahres für mich zu einem wichtigen, entscheidenden Tag in meinem Leben. Wohin mich das Leben allerdings führen würde, war noch offen. Der Journalismus Schon als Kind, in einem Dorf im Berner Seeland, träumte ich davon, einmal im Radiojournalismus zu arbeiten. In Bern, Basel oder Zürich. Nach der Gymnasialzeit in Biel und der Matura studierte ich an der Universität Bern Germanistik, Volkskunde und Dialektologie sowie Religionswissenschaften. Mit einer guten Allgemeinbildung im Rucksack und dem Lizentiat in der Tasche stieg ich 1996 im Büro Cortesi, in Biel, in den Journalismus ein. Ich lernte von der Pike auf zu schreiben und zu recherchieren. Dies hauptsächlich für die Wochenzeitung "Lysser & Aarbergerwoche", aber auch für die bilingue Wochenzeitung "Biel Bienne". Drei Jahre lang arbeitete ich im Büro Cortesi, dann wechselte ich das Medium und stieg in den Radiojournalismus ein – in den Tagesjournalismus. Der Wochenzeitung "Biel Bienne" bin ich bis heute als Kolumnistin verpflichtet. Gut acht Jahre lang war ich als Redaktorin engagiert – bei Radio 32 in Solothurn, bei Radio EXTRA Bern und dessen Nachfolgesender Capital FM. Fast vier Jahre lang zudem auch als Ressortleiterin Sport. Neue Ziele Meine Brustkrebserkrankung zwang mich in den letzten zwei Jahren, mich intensiv mit mir selbst, meinem Körper, meinen Wünschen und Hoffnungen auseinanderzusetzen. Und entsprechende Konsequenzen zu ziehen, sollte ich diese Erkrankung überleben. Noch während der zahlreichen Therapien wurde mir klar, dass zumindest meine Tage im stressigen und leider oft auch oberflächlichen lokalen Radiojournalismus gezählt sind. Es galt, neue Ziele zu finden und zu setzen. Eines davon war, mich künftig für ein Unternehmen oder eine Organisation mit inhaltlich mehr Tiefgang zu engagieren. Ein weiteres Ziel war, mein berufliches Wissen und meine Erfahrungen für ein sichtbares Gegenüber einzubringen. Das Stelleninserat von AGILE erschien für mich somit im richtigen Moment. Ob es an einem Donnerstag war? 26 Behinderung und Politik 4/07 Die Behinderung Meine Krankheit hat mich mit Grenzen konfrontiert, meinen eigenen und mir auferlegten. Wie nie zuvor habe ich erlebt, was es heisst, auf Hilfe angewiesen zu sein, und um Hilfe fragen zu müssen. Ich habe aber auch den starken Wunsch verspürt, mir, wo möglich, selbst zu helfen und über jede Hilfe zudem selber zu entscheiden. Ohne Haare – als Folge der Chemotherapien – habe ich ausserdem erfahren, was es heisst, angestarrt zu werden. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn einem Krankheit und Einschränkung anzusehen sind – und man auch angesehen wird. Ich habe während meiner Krankheit Leistungen der Invalidenversicherung beansprucht. Damit gelte ich per definitionem als behindert (Kreisschreiben über die Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe, Bundesamt für Sozialversicherung BSV). Die Motivation Meine zwei letzten Lebensjahre, aber auch persönliche Beziehungen zu und Begegnungen mit Menschen mit Behinderung, haben mich in meiner Entscheidung bestärkt, mich nach Möglichkeit bei AGILE zu engagieren. Und damit auch mehr Sinn in mein berufliches Leben zu bringen. Mag dies auch abgedroschen klingen. Kommt dazu, dass ich seit bald neun Monaten in einem neuen Zivilstand lebe. Meine Partnerin und ich haben uns nach über 17 Jahren Lebensgemeinschaft gesetzlich eintragen lassen können. Diesem – für mich immens wichtigen – Schritt ging ein jahrelanger Kampf voraus, ein Kämpfen um die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare und um staatliche Anerkennung unserer Lebensform. Diese Kampfbereitschaft und unzählige Debatten und Auseinandersetzungen – primär mit rechtskonservativen und evangelikalen Zeitgenossen – verbinden mich mit den Menschen mit Behinderung und ihrem Kampf um ein selbstbestimmtes Leben, echte Integration in die Gesellschaft und rechtliche und tatsächliche Gleichstellung mit Nicht-Behinderten. Das Sprachrohr Seit Donnerstag, 1. November 2007, arbeite ich nun offiziell bei AGILE. Täglich lerne ich dazu, werde gefordert und herausgefordert, so wie ich es mir an manchen Donnerstagen zuvor gewünscht habe. Als ein Sprachrohr für die Behinderten-Selbsthilfe bin ich mir auch bewusst, dass ich meine Arbeit nur so weit erfolgreich gestalten kann, wie mich die Basis von AGILE, die Behinderten selbst, unterstützen und beglaubigen. In diesem Sinne freue ich mich auf die Kontakte zu den einzelnen Aktivund Solidarmitgliedern von AGILE und der Basis dieser Organisationen. In den nächsten Monaten ergeben sich bestimmt verschiedene Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie mit mir nicht über politische Themen diskutieren wollen, dann vielleicht über meine privaten Interessen wie Sport, Kriminalliteratur, Lesen allgemein, Hörbücher, Katzen, Schwarztee-Spezialitäten oder biologischen Gartenbau. 27 Behinderung und Politik 4/07 Medien Recht gegen HIV/Aids-Diskriminierung im Arbeitsverhältnis Für Sie gelesen von Bettina Gruber Erinnern auch Sie sich beim Stichwort Aids zuerst an die Fotografien von sterbenden Menschen aus den Achtzigerjahren? Solche Bilder haben viele von uns nachhaltig geprägt. Obwohl seither zwanzig Jahre vergangen sind und effiziente Therapien heute vielen Betroffenen eine bessere Lebensqualität ermöglichen, beeinflussen diese Erinnerungen und damit verbundene Ängste unsere Wahrnehmung. Zum Teil wider besseren Wissens, zum Teil aus Uninformiertheit. Auf diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass HIV-Positive und Aidskranke mit Vorurteilen, Ängsten und Abwehr zu kämpfen haben, welche die Form der Diskriminierung annehmen können. Das vorliegende Buch des AutorInnentrios Pärli/Caplazi/Suter geht solchen Diskriminierungen im Bereich der Arbeit nach. Und es untersucht, mit welchen rechtlichen Dispositionen solcher Diskriminierung begegnet wird oder werden könnte. Nach der (unvermeidlichen) Projekt- und Methodenbeschreibung folgt im zweiten Teil eine Bestandesaufnahme von Diskriminierungssituationen, wie sie von HIV/Aids-Betroffenen in der Schweiz im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit erlebt werden. Dabei orientieren sich die AutorInnen an den verschiedenen Phasen eines Arbeitsverhältnisses (Bewerbung, Vertragsabschluss, während der Anstellung, im Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses und die Zeit danach). Wie Behinderte, so können auch HIV-Betroffene Opfer von Stigmatisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung werden. Es zeigen sich für LeserInnen aus der Behindertenszene Parallelen zu bekannten Problemsituationen. Daneben gibt es aber auch Elemente, die im Bereich HIV eine andere Akzentuierung erfahren. So stellen sich die Fragen um Persönlichkeits- oder Datenschutz in einer anderen Dringlichkeit, als dies für Körper- oder Sinnesbehinderte der Fall ist. Einige diskriminierende Momente seien hier stellvertretend aufgezeigt: Falls sich HIV-Positive bei Bewerbungen als solche zu erkennen geben, ist ihre Chance auf eine Anstellung sehr gering. Beim Vertragsabschluss stellen versicherungstechnische Vorbehalte oder Ausschlüsse bei Krankentaggeld oder beruflicher Vorsorge ein weiteres Feld von Benachteiligung dar. Während der Anstellung können HIV-positive Menschen Mobbing durch Vorgesetzte oder MitarbeiterInnen ausgesetzt sein. Der Arbeitgeber versetzt aufgrund des bekannt gewordenen HIV-Status eine Mitarbeiterin weg vom Kundenkontakt in den Innendienst oder kündigt ihr. Bei den Informationen, die ein künftiger Arbeitgeber bei einem ehemaligen einholt, wird der HIV-Status des Kandidaten bekanntgegeben. Nach dieser Auflistung von diskriminierenden Situationen folgt im dritten Teil die Überprüfung der diesbezüglichen aktuellen Rechtslage in der Schweiz. Hier wird, 28 Behinderung und Politik 4/07 auch wieder entlang der verschiedenen Phasen eines Anstellungsverhältnisses, nach der rechtlichen Situation gefragt, wie sie sich aufgrund von internationalem Recht, Verfassung und Gesetzen, z.B. dem Obligationenrecht oder dem Behindertengleichstellungsgesetz darstellt. Zuerst werden die völkerrechtlichen Abkommen beschrieben, und eine Liste zeigt, welche durch die Schweiz ratifiziert wurden. Danach wird die Rechtslage in der Schweiz beschrieben. Konkret diskutieren die AutorInnen, inwiefern das verfassungsmässige Recht auf Nichtdiskriminierung auch ohne explizite Nennung auf das persönliche Merkmal HIV-positiv anwendbar ist, bzw. ob HIV-Positivität als in den Begriff der Behinderung miteingeschlossen betrachtet werden kann. Im weitern wird ebenfalls deutlich, dass oft prozessuale Hindernisse (z.B. ganze Beweislast beim Kläger/der Klägerin) und ungenügende Sanktionen bei Rechtsverletzung die Durchsetzung des Rechts auf Nichtdiskriminierung erschweren. Der vierte Teil liefert einen ausführlichen Ländervergleich anhand der Beispiele Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Kanada. Nach einer kurzen allgemeinen Einführung ins Rechtssystem des betreffenden Landes werden die dortigen Antidiskriminierungsgesetze und ihre Wirkungsweise anhand der verschiedenen kritischen Situationen erläutert. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der jeweiligen Gesetzgebung geben Experten und Betroffenenorganisationen aus dem betreffenden Land ihre Einschätzung. Zum Schluss der einzelnen Länderberichte folgt eine zusammenfassende Würdigung durch die AutorInnen. (Lesemuffel und Gestresste lesen nur letztere oder ersparen sich diese 170 Seiten und gehen gleich zu Teil fünf). Der letzte Teil beinhaltet eine Synthese und Empfehlungen. In dieser Zusammenschau, die die Besonderheiten der einzelnen Länder nochmals aufnimmt, wird deutlich, dass die Schweizer Gesetzgebung im internationalen Vergleich einige Schwachpunkte aufweist. Beispielsweise optieren die AutorInnen für die Streichung aller Vorbehalte bei kollektiven Krankentaggeldversicherungen, eine Erleichterung der Beweislast bei Klagen (der/die Klagende muss eine Diskriminierung nur glaubhaft machen, der/die Beklagte muss beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt); denkbar wäre auch ein Verbandsklagerecht. Damit es nicht bei der Feststellung des Handlungsbedarfs bleibt, liefern die AutorInnen hier auch den Vorschlag für ein „Gesetz über die Gleichstellung von Arbeitnehmenden mit Behinderung/gesundheitlichen Einschränkungen“ und kommentieren die einzelnen vorgeschlagenen Artikel. Als Alternative dazu, mit Blick auf die Schweizer Realität, werden Anpassungen in bestehenden Gesetzen vorgeschlagen. Und damit es nicht nur bei guten Vorschlägen bleibt, werden die Akteure benannt, die sich für die Realisierung eines verbesserten Schutzes vor Diskriminierung einsetzen sollen. Das Abkürzungsverzeichnis vorne im Buch hilft durch den Buchstabendschungel und ein ausführliches Literaturverzeichnis bildet ein Tummelfeld für alle, die es ganz genau wissen wollen. Soweit der Streifzug durch dieses umfassende Werk von beinahe 400 Seiten. Vieles muss hier notgedrungen unerwähnt bleiben und wird Ihrer eigenen Lektüre überlassen. Nur noch soviel: Aus der Arbeit für die Gleichstellung Behinderter wissen wir, dass Information ein wichtiges Element im Kampf gegen Diskriminierung bildet. Allein das wäre ein Grund, das vorliegende Buch zu lesen. Voraussetzung für die Lektüre ist allerdings ein gewisses Interesse an rechtlichen Fragen. Ebenfalls von Vorteil sind 29 Behinderung und Politik 4/07 Englischkenntnisse, da nicht alle Zitate übersetzt werden. Wer das nötige Durchhaltevermögen mitbringt, wird mit fundiertem Wissen belohnt und sieht das Leben von HIV-positiven Menschen danach garantiert mit anderen Augen. Angaben zum Buch: Kurt Pärli / Alexandra Caplazi / Caroline Suter, Recht gegen HIV/Aids-Diskriminierung im Arbeitsverhältnis. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Situation in Kanada, Grossbritannien, Frankreich Deutschland und der Schweiz, Haupt Verlag, 2007. ISBN 978-3-258-07230-2, Preis: Fr. 54.90 30 Behinderung und Politik 4/07 Impressum agile – Behinderung und Politik (mit regelmässiger Beilage – in elektronischer Form – der "BÖV Nachrichten") Herausgeberin: AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz Effingerstrasse 55, 3008 Bern Tel. 031/390 39 39, Fax 031/390 39 35 Email: [email protected] Redaktion: Eva Aeschimann, Redaktionsverantwortliche deutsche Ausgabe Cyril Mizrahi, Redaktionsverantwortlicher französische Ausgabe Bettina Gruber Haberditz Simone Leuenberger Ursula Schaffner Lektorat: Bettina Gruber Haberditz (deutsche Ausgabe) Claude Bauer, Salima Moyard (französische Ausgabe) Neben der deutschsprachigen besteht auch eine französischsprachige Ausgabe von „agile“. Ihre Inhalte sind weitgehend identisch – Übersetzungen werden als solche gekennzeichnet. Die Übernahme (mit Quellenangabe) von „agile“-Texten ist nicht nur gestattet, sondern erwünscht! Anregungen, Anfragen, Feedback, Bemerkungen usw. bitte an: [email protected] 31