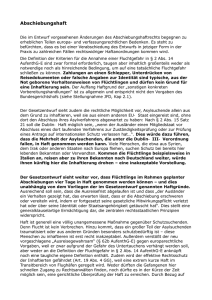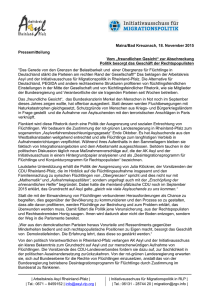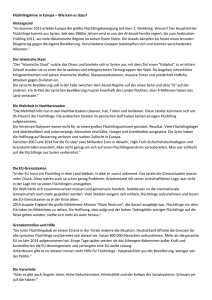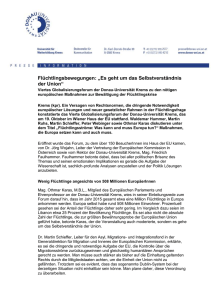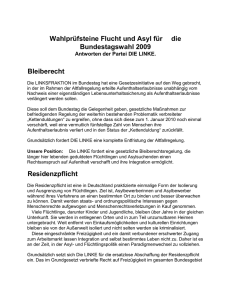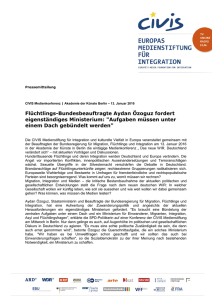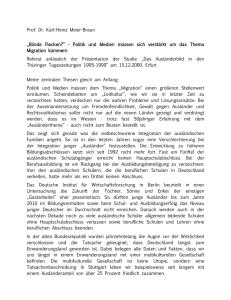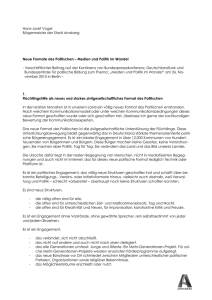PRO_ASYL_ZuwGE_0102 - Infoseite Zuwanderungsgesetz und
Werbung
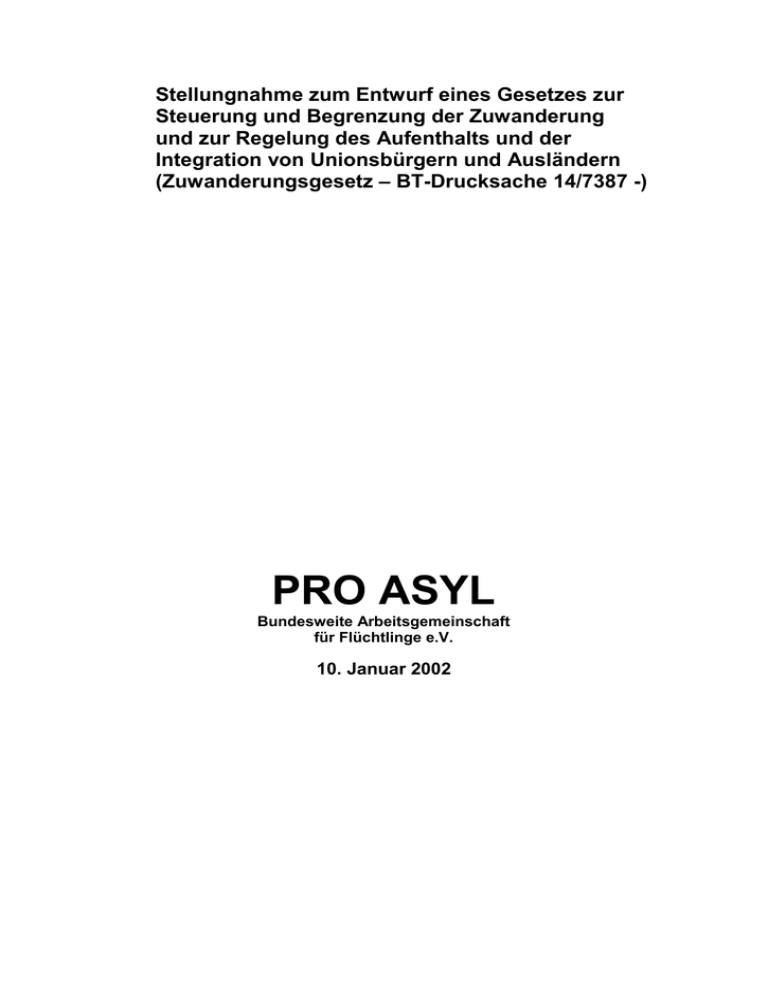
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz – BT-Drucksache 14/7387 -) PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. 10. Januar 2002 2 Inhaltsverzeichnis: Einleitung 3 Kurzbewertung der flüchtlingsspezifischen Elemente des Zuwanderungsgesetzentwurfs vom 6. November 2001 5 Allgemeines zur Konstruktion des Zuwanderungsgesetzes 8 Arbeitsmigration und Arbeitserlaubnis 8 Daueraufenthalt/Möglichkeit der Verfestigung 11 Integrationskurse 12 Statusverbesserungen für bislang Geduldete? Weiterhin ein dorniger Weg 13 Sperrwirkung gegen generelle Gefahren 16 Familiennachzug 17 Nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund 18 Angleichung des Status und Befristung des Aufenthaltstitels für Asylberechtigte und GFK-Flüchtlinge – Probleme mit dem Familienasyl 20 Verschärfung der Ausweisungsbestimmungen 21 Entscheidungsstopp für Asylanträge 22 Weisungsgebundenheit der Entscheider/ Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten 23 Gewillkürte Nachfluchtgründe beim Asylfolgeantrag 23 Verkürzung des Rechtsschutzes wegen Verletzung der Mitwirkungspflichten 24 Erlöschen des Aufenthaltstitels bei Asylantragstellung 24 Passbeschaffung 25 Verbesserung des asylrechtlichen Verwaltungsverfahrens 25 Asylbewerberleistungsgesetz 26 Ausreiseeinrichtungen / Abschiebungshaft 27 Residenzpflicht 28 Flughafenverfahren 28 Kinderrechte 29 Härtefallregelung 29 Illegalisierte 29 Doppelstandard im Datenschutz/Ausländerausweisdokumente 30 Datenfluss bis in die Verfolgerstaaten? Datenübermittlung vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und von den Ausländerbehörden an Verfassungsschutzbehörden 32 Generalverdacht gegen Asylsuchende: Missbrauch ihrer erkennungsdienstlichen Unterlagen 33 3 Missbrauch zweifelhafter Sprachanalysen 33 Änderung des Vereinsgesetzes – zusätzliche Verbotsgründe 34 Fazit 36 4 Einleitung Am 6. November hat der Entwurf der Regierungskoalition für ein Zuwanderungsgesetz das Bundeskabinett passiert. Der Gesetzentwurf betrifft das Schicksal von 7 Millionen Ausländern, nicht eingerechnet hierbei diejenigen, die auf der Basis eines solchen Zuwanderungsgesetzes künftig einwandern oder als Flüchtlinge Schutz suchen werden. Nach wie vor wird von Seiten der Regierungskoalition bei der Beratung des Gesetzes großer Zeitdruck gemacht. Dies obwohl die Absicht der beiden Regierungsparteien, das Thema Zuwanderung aus dem Wahlkampf herauszuhalten, ersichtlich bereits gescheitert ist. Ein sachlicher Grund für die gesetzgeberische Hektik ist weiterhin nicht erkennbar. Das Gesetz soll erst im Jahre 2003 in Kraft treten, seine zuwanderungspolitischen Effekte nach Aussagen des Bundesinnenministers großenteils erst gegen Ende dieses Jahrzehnts wirken. PRO ASYL bleibt deshalb bei seiner grundsätzlichen Kritik: Über das Schicksal so vieler Betroffener, den Schutz bedrohter Menschen und die einwanderungspolitischen Perspektiven der Bundesrepublik darf nicht unter solchem Zeitdruck beschlossen werden. Den Anspruch des Regierungsentwurfes hat Bundesinnenminister Otto Schily am 5. November 2001 nochmals dargestellt: „Mit dem Regierungsentwurf bringen wir ein modernes, flexibles, wirtschaftsfreundliches und sozial ausgewogenes Instrumentarium zur bedarfsgerechten Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung auf den Weg“. Er wiederholte damit fast wortgenau, was er bei der Präsentation des Referentenentwurfs Anfang August 2001 schon behauptet hatte. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom 14. September 2001 zum Referentenentwurf haben die beiden großen Kirchen bereits betont, woran ein Zuwanderungsgesetz über die bloße Behauptung der Modernität und Flexibilität hinaus wirklich zu messen ist: „Vor allem ist wesentlich, dass jegliche Regelung der Zuwanderung – sei es aus ökonomischen Gründen, zum Familiennachzug, zu Ausbildungszwecken oder zum Schutz von Menschen vor ihnen drohenden Menschenrechtsverletzungen – dem Anspruch auf Einhaltung der Menschenwürde sowie dem Gebot der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit entspricht. Zu diesem Zweck muss das Ausländerrecht – jedenfalls teilweise – aus dem Bereich des Polizeirechtes herausgelöst werden. Der Zuzug von Menschen nach Deutschland und der Aufenthalt im Bundesgebiet darf nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr betrachtet werden.“ Diesem Anspruch – Rechtssicherheit und – klarheit zu schaffen – wird der Gesetzentwurf in vielerlei Hinsicht nicht gerecht. Spätestens mit dem zeitgleich mit dem Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes vorgestellten Terrorismusbekämpfungsgesetzes (Anti-Terror-Paket II) wurde deutlich, dass diese Bundesregierung kein wirklich neues Kapitel des deutschen Ausländerrechts aufzuschlagen gedenkt. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz enthält eine Vielzahl äußerst restriktiver Regelungen, die ganz besonders Ausländer treffen. Die entsprechenden Änderungen des Ausländergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes werden Bestandteil des Gesamtpakets Zuwanderungsgesetz. 5 Mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz wird erneut der Weg eingeschlagen, den man verlassen zu wollen vorgab: Die gesetzliche Konstruktion der Ausländer als ordnungsrechtliches Risiko, dem mit einer Vielzahl von Restriktionen entgegengetreten werden soll. Mit Terrorismusbekämpfung hat Vieles in diesem Gesetzentwurf hingegen nichts zu tun. Die Prüfungsmaßstäbe der Verfassung (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit) blieben weitgehend außer Acht. Zum Vorentwurf hatte das Bundesjustizministerium kritisch angemahnt: „Im Hinblick auf den Titel ‚Terrorismusbekämpfungsgesetz‘ scheint es zudem angeraten, den Gesetzentwurf auch tatsächlich auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zu beschränken.“ Dieser Meinung aus dem Bundesjustizministerium trägt das zum 1. Januar 2002 in Kraft getretene Terrorismusbekämpfungsgesetz nicht Rechnung. Die heftige Kritik der Nichtregierungsorganisationen – auch von PRO ASYL – hat lediglich dazu geführt, dass die Regierungskoalition auf einige wenige der drastischsten Verschärfungen verzichtet bzw. einige der umstrittensten Regelungen abgemildert hat. An der Grundproblematik ändert dies nichts. Das geplante Zuwanderungsgesetz muss im Lichte der rechtsstaatlichen Verluste beurteilt werden, die das Terrorismusbekämpfungsgesetz für Ausländerinnen und Ausländer mit sich bringt. Viele gesellschaftliche Gruppen haben von einem neuen Zuwanderungsgesetz den lange überfälligen Paradigmenwechsel erhofft: Die Ablösung des Ausländerrechts als Fremdenabwehrrecht durch weltoffene Zuwanderungsregelungen. Gemessen an diesem Anspruch bleibt auch der Regierungsentwurf des Zuwanderungsgesetzes Stückwerk. Große Teile des bisherigen Ausländerrechts wurden schlicht übernommen und mit neuen Etiketten versehen. Dies gilt auch für seit langem umstrittene Regelungen, wie zum Beispiel diejenigen über die Abschiebungshaft. 6 Kurzbewertung der flüchtlingsspezifischen Elemente des Zuwanderungsgesetzentwurfs vom 6. November 2001 Der überarbeitete Entwurf sieht die Möglichkeit vor, die Opfer nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung als politisch Verfolgte im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anzuerkennen. Damit wird auf die Kritik von PRO ASYL und vielen anderen Menschenrechtsorganisationen an der entsprechenden Schutzlücke reagiert. Es handelt sich – entgegen den Einwendungen der Opposition – um nicht mehr als die völkerrechtskonforme Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention und eine Annäherung an die überwiegende Staatenpraxis in Europa. Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass künftig Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention mit Asylberechtigten nach Artikel 16a GG teilweise gleichgestellt werden. Allerdings wird dies erkauft mit einer für beide Gruppen geltenden Überprüfung des jeweiligen Status nach drei Jahren. Für Asylberechtigte entfällt künftig der Anspruch auf die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Einen Anspruch auf Familienasyl soll es für die Angehörigen von GFK-Flüchtlingen weiterhin nicht geben. Damit wird das Ziel der Angleichung des Rechtsstatus in wesentlicher Hinsicht verfehlt. Zwar sieht der überarbeitete Entwurf die Möglichkeit der Statusverbesserung für bestimmte bislang lediglich geduldete Ausländer vor, aber weiterhin besteht Grund zu der Befürchtung, dass durch eine Vielzahl problematischer Detailregelungen ein Großteil der potentiell Betroffenen von dieser Möglichkeit der Statusverbesserung ausgeschlossen bleiben wird. Als besonderes Hindernis erweist sich, dass der Zugang zu einem humanitären Schutzstatus versperrt ist, wenn die Ausreise der Betroffenen möglich und zumutbar ist. Dies wird oftmals umstritten sein. Den Befürchtungen von PRO ASYL und anderen Nichtregierungsorganisationen, Tausende von Menschen könnten durch den Wegfall der bisherigen Duldung in die Illegalität getrieben werden, trägt der Gesetzentwurf zumindest dadurch Rechnung, dass anstelle der bisherigen Duldung eine „Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung“ eingeführt wird. Deren Rechtsqualität ist jedoch unklar. Die „Bescheinigung“ hat zum Teil die Charakteristika der bisherigen Duldung, zum Teil die einer Grenzübertrittsbescheinigung. Der Überblick über die eher positiven Regelungen des Gesetzentwurfes fällt kurz aus. Es wird deutlich, dass selbst diese Teile erhebliche Mängel und Probleme aufweisen. Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine Vielzahl von Regelungen, die entweder keinen Fortschritt für die Betroffenen darstellen oder gar Verschlechterungen bringen. Der Abschiebungsschutz für diejenigen, denen erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht, bleibt unzureichend. Es wird eine Schutzlücke bestehen bleiben, wenn ein Abschiebungsstopp nicht zustande kommt und dem Einzelnen der Schutz versagt wird unter Hinweis darauf, dass ganze Bevölkerungsgruppen sich in gleicher Lage befinden. 7 Mit Ausnahme der Asylberechtigten und Konventionsflüchtlinge bleibt der Arbeitsmarktzugang für viele andere Personengruppen schwierig. Der Status der Menschen, die lediglich eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung erhalten, liegt auf niedrigstem Niveau. Es ist zu befürchten, dass sie künftig einem unbefristeten Arbeitsverbot unterliegen werden. Der Aufenthaltsbereich vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer soll künftig in jedem Fall beschränkt werden. Der Gesetzentwurf sieht zusätzlich vor, dass die Länder Ausreisepflichtige in neuen Lagern („Ausreiseeinrichtungen“) unterbringen können. Hier wird Druck ausgeübt, um ihre Ausreise zu erzwingen. Die vielfach kritisierte Residenzpflicht für Asylsuchende wird nicht abgeschafft. Stattdessen sieht der Entwurf weitere aufenthaltsbeschränkende Regelungen vor. Die menschenunwürdige Praxis der Abschiebungshaft wird unverändert in das Zuwanderungsgesetz übernommen, ebenso das vielfach kritisierte Flughafenasylverfahren. Auch in Zukunft gibt es keine vernünftige Grundlage für die von Kirchen, Verbänden und Menschenrechtsorganisationen seit langem geforderte Härtefallregelung. Das Kindeswohl wird weiter missachtet, indem die UN-Kinderrechtskonvention durch den Gesetzentwurf nicht umgesetzt wird. Vom BMI angeordnete Entscheidungsstopps des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge sollen künftig über ein halbes Jahr hinaus ohne zeitliche Begrenzung möglich sein. Mit der Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten bleibt auch die Weisungsungebundenheit der Entscheider auf der Strecke. Eine unabhängige Verfahrensberatung, wie von Wohlfahrtsverbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen seit langem als notwendiger Bestandteil eines fairen Asylverfahrens gefordert, sieht auch dieser Gesetzentwurf nicht vor. Das Thema der Menschen in der Illegalität wird weiter verdrängt. Forderungen nach der Sicherung sozialer Mindeststandards auch für diese Personengruppen wird nicht Rechnung getragen. Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz sind weitere problematische Regelungen geschaffen worden, die bereits zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten sind: Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und die Ausländerbehörden unterliegen einer umfassenden Verpflichtung, den Verfassungsschutzbehörden Informationen und Daten von Asylbewerbern zu übermitteln. Zwar wurde der heftigen Kritik an dem geplanten völlig ungehemmten Datenfluss zumindest insofern Rechnung getragen, als das Gesetz nunmehr beinhaltet, dass es ein Übermittlungsverbot an ausländische Stellen gibt, wenn nicht Völkerrecht die Übermittlung solcher Daten gebietet, aber 8 letztlich wird die Umsetzung in der Praxis kaum kontrollierbar sein. Eine Reihe neuer Ausweisungstatbestände wird geschaffen, die äußerst unbestimmt sind. Insbesondere muss befürchtet werden, dass künftig selbst nicht gewalttätige Unterstützer politischer Exilgruppen von Ausweisung bedroht sein werden. Beim Datenschutz gilt weiterhin zweierlei Maß für Ausländer und Deutsche. Eine klare Zweckbindungsregelung für erhobene Daten sieht das Terrorismusbekämpfungsgesetz (im geänderten Pass- und Personalausweisgesetz) für Deutsche vor, das Zuwanderungsgesetz jedoch nicht für Ausländer. Dass das Zuwanderungsgesetz mit dem neuen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine neue Superbehörde – und eine Datensammelstelle in nie da gewesenem Umfang – vorsieht, ist vor diesem Hintergrund besonders problematisch. 9 Allgemeines zur Konstruktion des Zuwanderungsgesetzes Das Zuwanderungsgesetz ist ein sogenanntes Artikelgesetz, das heißt es beinhaltet umfangreiche Änderungen verschiedener bestehender Gesetze. Die größte Veränderung: Das Ausländergesetz wird abgeschafft und künftig ersetzt durch das Aufenthaltsgesetz. Flüchtlingsspezifische Neuregelungen finden sich aber auch insbesondere in den zahlreichen Änderungen des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie weiterer Gesetze. Durch die eng miteinander verzahnten Neuregelungen ergibt sich ein überaus kompliziertes Regelwerk, so dass schon aus diesem Grunde erhöhter Beratungsbedarf im Parlament besteht. Die vom Bundesinnenminister angekündigte Vereinfachung des Ausländerrechts ist in vieler Hinsicht nicht erreicht worden. Im Folgenden werden insbesondere diejenigen Regelungen kommentiert, die Flüchtlinge betreffen. Soweit es zum Verständnis der Neuregelungen nötig ist, wird auch Bezug genommen auf andere Teile des Zuwanderungsgesetzentwurfes. Auch Regelungen, die mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz bereits zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten sind und für das Zuwanderungsgesetz relevant sind, werden dargestellt. Arbeitsmigration und Arbeitserlaubnis Das geplante neue Zuwanderungsgesetz schafft erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Arbeitskräftezuwanderung sowie für die Zuwanderung von Selbständigen und Studierenden. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen sieht der Entwurf keine „Verrechnung“ der Zuwanderung dieser Personengruppen gegen die Aufnahme von Menschen im Rahmen eines menschenrechtlich begründeten Flüchtlingsschutzes vor. Instrument für die künftige Anwerbung und Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem Ausland ist das geplante Aufenthaltsgesetz. Der Entwurf des Aufenthaltsgesetzes markiert zumindest insoweit einen Paradigmenwechsel, als er eine Abkehr von dem im Jahre 1973 erklärten Anwerbestopp darstellt und das Eingeständnis beinhaltet, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, das auf Einwanderung auch ökonomisch angewiesen ist. Die Regelungen zur Arbeitsaufnahme, vormals im Sozialgesetzbuch III enthalten, stehen künftig im neuen Aufenthaltsgesetz, das das bisherige Ausländergesetz ersetzt. Die bisherige begriffliche Unterscheidung zwischen der uneingeschränkten Arbeitsberechtigung und der nachrangigen sog. „Arbeitserlaubnis“ fällt zukünftig weg. Dennoch wird es weiterhin eine Arbeitserlaubnis erster und eine zweiter Klasse geben. Für Arbeitsmigrantinnen und –migranten aus dem Ausland werden verschiedene Zugangsmöglichkeiten eröffnet. § 16 Abs. 4 AufenthGE sieht für Studenten die Möglichkeit vor, nach Abschluss des Studiums eine Arbeit aufzunehmen. § 19 AufenthGE sieht vor, dass hochqualifizierte Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen sofort eine Niederlassungserlaubnis – den unbefristeten Aufenthaltstitel – erhalten. § 20 AufenthGE eröffnet die Möglichkeit einer Zuwanderung im sogenannten Auswahlverfahren. Hierüber soll die Zuwanderung 10 qualifizierter Erwerbspersonen, von denen ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik zu erwarten sind, im Rahmen eines Punktesystems erfolgen können. Erfolgreichen Bewerbern wird die Niederlassungserlaubnis erteilt. § 21 AufenthGE regelt die Zuwanderung Selbständiger. § 18 AufenthGE ermöglicht die Anwerbung sogenannter Engpassarbeitskräfte, wenn hierfür ein „unabweisbarer Bedarf besteht und bevorrechtigte inländische Arbeitnehmer nicht zur Verfügung stehen.“ Hierbei sollen die regionalen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes eine Rolle spielen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in einer Stellungnahme zum Referentenentwurf des Zuwanderungsgesetzes vom 10. September 2001 darauf hingewiesen, dass der Entwurf insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitsmigration und der Integration im Widerspruch zu den Vorschlägen der Zuwanderungskommission und des DGB steht bzw. hinter ihnen zurückbleibt. Vor einer Neuzuwanderung von Arbeitsmigranten sei zunächst ein möglichst weitgehender Zugang zum Arbeitsmarkt für bereits in Deutschland lebende Migranten und die Sicherung ihres Aufenthaltsstatus erforderlich. Einer auf Dauer angelegten quotierten Einwanderung sei der Vorzug vor einer kurzfristigen und befristeten Anwerbung von Arbeitskräften (im Rahmen der Engpassarbeitskräfteregelung) zu geben. Für Migranten, die aus humanitären Gründen Aufnahme finden und bislang nicht über einen Daueraufenthaltsstatus verfügen, fordert der DGB: Bei einer rechtmäßigen Aufenthaltszeit von mehr als einem Jahr ist eine Aufenthaltserlaubnis sowie ein Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. Das soll insbesondere für Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge, bei denen Abschiebehindernisse vorhanden sind, gelten. Gerade für diese Personengruppen ist auch der aktuelle Regierungsentwurf in vieler Hinsicht problematisch. So schließt er die Möglichkeit explizit aus, vom Status eines Asylantragstellers in den Status eines Arbeitnehmers nach Abschnitt 4 AufenthGE (Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit) über zu wechseln (§ 10 Abs. 3 AufenthGE). Das ist nicht sachgerecht, denn die Erfahrung etwa mit Flüchtlingen aus Kosovo und Bosnien-Herzegowina hat gezeigt, dass es Fallkonstellationen gibt, in denen ein solcher Statuswechsel sowohl im Interesse der Betroffenen als auch im Interesse der Arbeitgeber und des Arbeitsmarktes liegt. Selbst wenn man die Auffassung vertreten wollte, mit diesem Ausschluss eines Statuswechsels solle potentiellem Missbrauch entgegengetreten werden, so hätte statt der kategorischen Regelung eine bloße Sollvorschrift genügt. Entgegen den DGB-Forderungen werden auch Viele der bereits lange hier Lebenden weiterhin vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben. Das ist inakzeptabel. Menschen, die sich faktisch über längere Zeit hinweg in Deutschland aufhalten, etwa auf der Basis des § 25 Abs. 3-5 AufenthGE, weil sie letztlich nicht abgeschoben werden können, müssen einen Rechtsanspruch auf Arbeitsmarktzugang haben. Es macht keinen Sinn, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen und damit ausländerrechtlich einen Schritt in Richtung Integration zu ermöglichen, wenn diese mit dem Mittel der Arbeitsmarktpolitik gleichzeitig behindert wird. Der Gesetzentwurf sieht weiterhin eine Vielzahl von Hürden beim Arbeitsmarktzugang vor. Wie hoch sie sein werden und wie viele Betroffene letztendlich von der Aufnahme einer Arbeitstätigkeit abgehalten werden, hängt unter anderem davon ab, wie die Rechtsverordnung gestaltet wird, die § 39 Abs. 1 11 AufenthGE vorsieht. Nach dieser Bestimmung kann ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt, nur mit Zustimmung der Bundesanstalt erteilt werden, soweit durch Rechtsverordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die vorgesehene Rechtsverordnung könnte also auch weniger restriktive Regelungen enthalten, als sie § 39 Abs. 2 AufenthGE bisher vorsieht. Dass über Einzelheiten des Arbeitsmarktzugangs noch spekuliert werden muss, zeigt einen strukturellen Mangel des Gesetzentwurfs, auf den das Bundesjustizministerium bereits anlässlich der Vorlage des Referentenentwurfes hingewiesen hat. Dort wurde moniert, dass die Tatsache, dass dem Verordnungsgeber keine konkreten Vorgaben durch Gesetz auferlegt werden, im Hinblick auf Artikel 80 Abs. 1 Satz 2 GG bedenklich ist. Wesentliche Sachverhalte müssen im Gesetz geregelt werden. § 39 Abs. 2 AufenthGE als bislang einzig überschaubare Grundlage für den Arbeitsmarktzugang jedenfalls enthält eine Reihe von Regelungen, die problematisch bzw. sogar ungünstiger sind als bei der bisherigen Rechtslage: Nur für Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge (§§ 25 Abs. 1 u. 2 AufenthGE) sowie für Angehörige von Deutschen (§ 28 Abs. 5 AufenthGE) und generell für alle Personen mit Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthGE) gibt es eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis. Sie sind damit Deutschen gleichgestellt. Menschen, die über den Familiennachzug nach Deutschland kommen, dürfen unter denselben Voraussetzungen arbeiten wie ihre Angehörigen (§ 29 Abs. 5 AufenthGE). Regelt nicht die ausstehende Rechtsverordnung günstigeres, dann sieht es schlecht aus für diejenigen, die vorübergehenden Schutz genießen (§ 24 AufenthGE), die nach der Europäischen Menschenrechtskonvention und anderen in § 60 AufenthGE genannten Gründen vor Abschiebung geschützt sind (§ 25 Abs. 3 AufenthGE), die eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§ 25 Abs. 4 und 5 AufenthGE) besitzen oder als Familienangehörige von Personen nachziehen, die selbst nur einen nachrangigen Arbeitsmarktzugang haben (§ 29 Abs. 5 AufenthGE): Die individuelle Vorrangprüfung, schon heute vielfach ein – auch von der Arbeitgeberseite abgelehntes – bürokratisches Hemmnis bei der Arbeitssuche, bliebe bestehen. Alternativ – wohl nur in Ausnahmefällen – kommt eine Arbeitserlaubnis für bestimmte Berufsgruppen bzw. Wirtschaftszweige in Betracht. In beiden Fällen allerdings ist eine regionale Arbeitsmarktprüfung vorgesehen (§§ 4, 39 Abs. 2 AufenthGE). Wird § 39 Abs. 2 AufenthGE – ohne günstigere Regelungen in Form einer Rechtsverordnung – Gesetz, so ergibt sich eine Verschärfung für Personen mit Aufenthaltsbefugnis: Diese haben nach jetziger Rechtslage einen Anspruch auf eine Arbeitsberechtigung nach fünfjähriger Beschäftigung bzw. nach sechsjährigem Aufenthalt. Für bestimmte Personengruppen bleibt der Arbeitsmarktzugang weiterhin äußerst schwierig: Dies betrifft beispielsweise Menschen, bei denen auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention Abschiebungshindernisse und eine Aufenthaltserlaubnis zugestanden werden, die aber in Gebieten wohnen, wo aufgrund der regionalen Arbeitsmarktlage schon jetzt praktisch keine nachrangigen Arbeitserlaubnisse erteilt werden (zum Beispiel Ostdeutschland, Berlin). Eine skandalöse Diskriminierung wird auch deutlich, wenn man z.B. an Flüchtlinge denkt, die nach einem langjährigen Aufenthalt als „Altfälle“ ein Bleiberecht erhalten. 12 Sie müssen dafür in der Regel bereits jetzt eine Arbeit nachweisen, um die Chance zu bekommen, ihren Lebensunterhalt auf Dauer selbst sichern zu können. Zukünftig werden sie – obwohl zugestandenermaßen auf unabsehbare Zeit legal in Deutschland – auch weiterhin jahrelang mit dieser zweitklassigen Arbeitserlaubnis leben müssen. Problematisch ist die Situation für diejenigen, denen ohne ein vorangegangenes oder nach einem abgeschlossenen Asylverfahren die Aufenthaltserlaubnis verwehrt bleibt und die damit lediglich über die Bescheinigung gemäß § 60 Abs. 11 AufenthGE verfügen. Nach geltendem Recht ist der Arbeitsmarktzugang auch mit einer Duldung nach der Arbeitsgenehmigungsverordnung möglich, darüber hinaus sogar nach der Versagung einer Aufenthaltsgenehmigung bis zum Eintritt der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht. Diese Regelung ist im Interesse aller Seiten flexibel. Dies spricht gegen eine wesentliche Verschlechterung, die letztendlich die öffentlichen Haushalte belasten würde. Nach der Übergangsregelung des Gesetzentwurfes behalten Personen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes eine Arbeitserlaubnis oder Arbeitsberechtigung erhielten, diese nach Inkrafttreten des Gesetzes (§ 103 AufenthGE). Pech haben freilich die nachkommenden Flüchtlingsgenerationen und diejenigen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens gerade keine Arbeit haben. Problematisch ist dies insbesondere für diejenigen, die heute nach der Härtefallregelung eine Arbeitsberechtigung beanspruchen können, also z.B. Traumatisierte, deren Anträge aber zum maßgeblichen Zeitpunkt noch nicht bearbeitet bzw. entschieden sind. Folglich können sie auch noch keine Arbeit vorweisen. Daueraufenthalt/ Möglichkeit der Verfestigung Positiv ist festzustellen, dass der Gesetzentwurf mit der Niederlassungserlaubnis einen verfestigten Daueraufenthalt vorsieht. Immerhin kursierte bei der Diskussion um die Greencard und andere mögliche Regelungen auch die Idee einer grundsätzlichen Befristung von Aufenthalten. Die Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthGE) ist zeitlich und räumlich unbefristet. Sie darf nicht mit Auflagen versehen werden. Auf dem Weg zum verfestigten Aufenthalt auf der Basis der Niederlassungserlaubnis werden zwischen den einzelnen Zuwanderungsgruppen im Gesetzentwurf jedoch deutliche Unterschiede gemacht: Sog. „Hochqualifizierte“ und Personen, die im Auswahlverfahren aufgenommen werden, sollen eine Niederlassungserlaubnis von Beginn an erhalten. Selbstständige, Familienangehörige von Deutschen, aber auch GFK-Flüchtlinge und Asylberechtigte erhalten eine Niederlassungserlaubnis nach 3 Jahren (die bei Flüchtlingen mit einer Überprüfung der Asylanerkennung einhergeht). Als Voraussetzung für die Erlangung der Niederlassungserlaubnis sieht der Entwurf eine mindestens fünfjährige Aufenthaltszeit mit einer Aufenthaltserlaubnis vor (§ 9 AufenthGE). Die zusätzlichen Hürden für eine Erteilung der Niederlassungserlaubnis sind hoch. Sie entsprechen ungefähr denjenigen, die heute für die Erlangung einer Aufenthaltsberechtigung gelten. U.a. werden 60 13 Monate Rentenversicherungsbeiträge - und damit eine fünfjährige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - vorausgesetzt. Flüchtlinge, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3-5 AufenthGE besitzen, können dagegen erst frühestens nach 7 Jahren unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Nr. 2-9 AufenthGE eine Niederlassungserlaubnis erhalten, wobei die Zeit des Asylverfahrens auf die Frist angerechnet wird. Ein Problem stellt sich bei der Aufenthaltsverfestigung für diejenigen Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge, die lediglich über einen eingeschränkten Arbeitsmarktzugang verfügen. Der heute für viele Geduldete existierende Teufelskreis „ohne Arbeit keine Aufenthaltsgenehmigung – ohne Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeit“ wird, so ist zu befürchten, nun auf formal höherer Aufenthaltsstufe fortgeführt. Ein kleines Trostpflaster gibt es nur in der Übergangsregelung des Gesetzes: Die Migrantinnen und Migranten haben Anspruch auf Vertrauensschutz: Wer bereits hier ist, soll seinen Aufenthalt nach den Bestimmungen des alten Ausländergesetzes verfestigen können. Dabei ist es unerheblich, ob eine Aufenthaltsberechtigung oder eine Aufenthaltsbefugnis vorliegt. Im Bereich der Aufenthaltsverfestigung dürfte es für die bereits hier lebenden Migrantinnen und Migranten also keine Verschlechterungen geben. Integrationskurse Erstmals wird es nunmehr für ArbeitsmigrantInnen, für nachziehende Familienangehörige und für anerkannte Flüchtlinge einen Rechtsanspruch auf Integrations- und Deutschkurse geben – allerdings auch die Pflicht zur Teilnahme. Hierbei gibt es für MigrantInnen, Flüchtlinge und AussiedlerInnen in Zukunft ein einheitliches Integrationsangebot. Bund und Länder teilen die Kosten für die Integrationskurse unter sich auf. Personen mit einem humanitären Schutzstatus haben nach § 44 Abs. 3 AufenthGE nur im Wege einer Kann-Regelung Zugang zu Integrationskursen. Dies ist zwar ein Fortschritt zum ersten Entwurf (dieser wollte den Zugang nur in besonderen Einzelfällen gestatten), fällt aber hinter die Vorschläge der Unabhängigen Zuwanderungskommission deutlich zurück. Der Anspruch auf Integrationsleistungen ist, wie erwähnt, verbunden mit einem Zwang, die Integrationskurse wahrzunehmen: Der Entwurf sieht (bei mangelhafter Teilnahme an Integrationskursen ohne „alternativen Integrationsbeweis“) Sanktionen auch im Bereich des Aufenthaltsrechts vor (§ 8 Abs. 3 und § 45 Abs. 4 AufenthGE). Problematisch erscheint die Tatsache, dass die politische Koordinierung der Integrationspolitik ausgerechnet als Aufgabe des BMI und des nachgeordneten Bundesamts für Migration und Flüchtlinge konzipiert ist (§ 43 Abs. 5 AufenthGE). Die Gefahr liegt in einem ordnungspolitisch verkürzten Integrationsverständnis. Bei den Wohlfahrtsverbänden bestehen zu Recht Befürchtungen, dass diese stärkere „Verstaatlichung“ der Integrationspolitik auch dazu führen könnte, dass die Integrationskurse künftig als Königsweg der Integration gelten werden und andere Angebote der Migrationsberatung und Migrationssozialarbeit zunehmend unter Legitimationsdruck geraten. Da die Finanzierung der Integrationskurse ein wichtiges 14 Thema zwischen Bund und Ländern ist und Finanzierungsanstrengungen von beträchtlicher Größenordnung nötig sind, ist zu erwarten, dass die Integrationskurse als Pflichtangebot finanziert, die sonstige Migrationssozialarbeit als „Luxus“ unter Druck geraten wird. Statusverbesserungen für bislang Geduldete? Weiterhin ein dorniger Weg Mit dem Zuwanderungsgesetz soll die bisherige ausländerrechtliche Duldung abgeschafft werden. Es wäre in der Tat begrüßenswert, wenn die Duldung für die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht abgeschoben werden konnten, endlich durch eine Aufenthaltsgenehmigung ersetzt würde. Viele Geduldete leben in Deutschland schon über Jahre ohne Aussicht auf einen rechtmäßigen Daueraufenthalt. Nunmehr sollen diejenigen, die aus zwingenden humanitären Gründen nicht abgeschoben werden können (z. B. weil ihnen in ihrem Herkunftsland Folter oder Todesstrafe droht) eine Aufenthaltserlaubnis - und damit einen deutlich besseren Rechtsstatus als heute - erhalten. Ausländer, denen rechtliche Abschiebungshindernisse zur Seite stehen, sollen künftig eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können, ohne dass die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen (§§ 25 Abs. 3 und 5 Abs. 3 AufenthGE). Doch die Probleme liegen im Detail. Weiterhin ist zu befürchten, dass nur ein kleiner Teil der bislang Geduldeten von den vorgesehenen Regelungen profitieren wird. Für de-facto-Flüchtlinge mit Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 2-7 AufenthGE wird der Zugang zum humanitären Schutzstatus versperrt, sofern ihre Ausreise „möglich” bzw. „zumutbar” ist (§ 25 Abs. 3 AufenthGE). Nach § 25 Abs. 4 AufenthGE kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn “dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen” dies erfordern. Damit sollen (nach Begründung) z.B. Menschen, die krank sind, kranke Familienangehörige betreuen oder die einen Schulabschluss machen, einen Aufenthaltstitel erhalten. Bislang wurden sie häufig nur geduldet. Solange die Voraussetzungen weiterhin vorliegen, dürfte die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unproblematisch sein. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis, obwohl sie für einen lediglich vorübergehenden Aufenthalt erteilt worden ist, zumindest verlängert werden, wenn das Verlassen des Bundesgebiets eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde (§ 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthGE). Die Hürde der außergewöhnlichen Härte wird in vielen Fällen zu hoch sein. Die Problematik der Regelung liegt darin, dass sie für einen vorübergehenden Aufenthalt konzipiert ist und nicht berücksichtigt, dass auch ein aus einer solchen humanitären Fallkonstellation herrührender längerer Aufenthalt bei Vorliegen eines besonderen Härte zu einem Aufenthalt führen sollte. Für die zahlenmäßig große Gruppe derjenigen mit tatsächlichen Abschiebehindernissen (§ 25 Abs. 5 AufenthGE) kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, sofern die Ausreise “aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich” ist. Endgültigen Aufschluss zu der Frage, wann dies der Fall ist, bringt auch die Gesetzesbegründung nicht. Kein Ausreisehindernis soll jedenfalls vorliegen, „wenn zwar eine Abschiebung nicht möglich ist, (...) eine freiwillige Ausreise jedoch möglich und zumutbar ist.“ Weiter soll die Unmöglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen jedenfalls bei inlandsbezogenen Ausreisehindernissen gegeben sein. Als Fälle der Unmöglichkeit aus tatsächlichen 15 Gründen nennt die Begründung Reiseunfähigkeit, Obdachlosigkeit und unterbrochene Verkehrsverbindungen. Den Nachweis darüber zu erbringen, dass eine Ausreise weder möglich noch zumutbar ist, dürfte für viele Flüchtlinge jedoch nicht möglich sein. Zu häufig unterstellen Ausländerbehörden oder Gerichte, dass zwar eine Abschiebung nicht durchführbar, gleichwohl aber die „freiwillige” Ausreise z.B. über Drittstaaten möglich ist. Zur Zumutbarkeit der Ausreise in einen Drittstaat finden sich Erwägungen des Gesetzgebers in der Begründung zu § 25 Abs. 3 AufenthGE. Die Darlegungslast, in welchen Staat eine Ausreise möglich ist, soll demgemäß bei der Ausländerbehörde liegen, die sich an konkreten Anhaltspunkten zu orientieren hat. Maßgeblich hierfür soll die Beziehung eines Ausreisepflichtigen zum Drittstaat sein. Die Zumutbarkeit der Ausreise wird jedoch von Seiten der Ausländerbehörde regelmäßig vermutet, wenn ihr keine besonderen Hinweise vorliegen. Unzumutbar soll die Ausreise in einen Drittstaat insbesondere dann sein, wenn dem Ausländer dort die Kettenabschiebung in den Verfolgerstaat droht. Die umfangreiche Kasuistik der Gesetzesbegründung zeigt eher die Probleme auf, die künftig der Rechtsprechung überantwortet werden, als dass sie sie gesetzgeberisch schlüssig löst. Flüchtlinge, deren Asylantrag als „offensichtlich unbegründet” nach § 30 Abs. 3 AsylVfG abgelehnt wurde, sollen gar keine Aufenthaltserlaubnis erlangen können (§ 10 Abs. 3 AufenthGE). Damit ist ein großer Teil der heute Geduldeten von vornherein chancenlos. Der Anteil der o.u.-Flüchtlinge an allen abgelehnten Asylbewerbern betrug 37 % (bis Ende November 2001). Man kann davon ausgehen, dass der größte Teil von ihnen nach Abs. 3 (z.B. wegen unsubstantiierten Vortrags o.u. abgelehnt wurde) und nur ein geringer Teil nach Abs. 2 (nur aus wirtschaftlichen Gründen geflohen, oder um einer allgemeinen Notlage oder Krieg zu entgehen). Eine genaue Analyse ist nicht möglich. Bislang ergibt sich aus dem Tenor der Bundesamtsentscheidungen lediglich die Ablehnung als offensichtlich unbegründet, nicht aber der Rechtsgrund. Die Anknüpfung eines humanitären Aufenthaltstitels daran, dass zuvor keine offensichtlich unbegründet-Entscheidung ergangen ist, ist nicht sachgerecht. O.u.Entscheidungen setzen nicht notwendigerweise einen Missbrauchstatbestand voraus, der der gedankliche Hintergrund der geplanten Neuregelung ist. Ein weiteres Beispiel mag zeigen, dass der Ausschluss von der Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, im Falle der Asylablehnung als offensichtlich unbegründet nicht sachgerecht ist: Eine Person hält sich in Deutschland aus einem asylfremden Grund auf und erkrankt. Ein während des Aufenthalts gestellter Asylantrag ist nach geltendem Recht als offensichtlich unbegründet abzulehnen. Falls sich aus der Krankheit selbst ein dauerhaftes Abschiebungshindernis ergibt, weil Behandlungsnotwendigkeiten den weiteren Aufenthalt in Deutschland erfordern, würde trotzdem niemals eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden können. Die inflexible Regelung wird auf diese Weise zu unnötigen Härten führen. Ein erheblicher Teil der bislang Geduldeten wird mit dem neuen Aufenthaltsgesetz unterhalb des Status quo landen. Zwar sieht der Gesetzentwurf nunmehr – im Unterschied zum Vorentwurf – vor, dass jede Person zumindest eine Bescheinigung über die Aussetzung ihrer Abschiebung erhält (§ 60 Abs. 11 Satz 3 AufenthGE). Auch nach dem Wegfall der bisherigen Duldung werden damit in 16 Deutschland keine „Papierlosen“ entstehen. Der Status der Menschen mit dieser Bescheinigung allerdings liegt auf niedrigstem Niveau: Sie unterliegen der Residenzpflicht (§ 61 Abs. 1 AufenthGE). Sie können nach § 61 Abs. 2 AufenthGE gezwungen werden, in sogenannten Ausreiseeinrichtungen zu wohnen, die die Bundesländer errichten können. Bei denjenigen, die angeblich „die Dauer ihres Aufenthalts rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben“, ist die unbefristete Mangelversorgung auf dem Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehen (§ 2 Abs. 1 AsylbLG). Auseinandersetzungen um die Frage, wer die Dauer seines Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst hat, sind absehbar. Sie unterliegen möglicherweise einem totalen Arbeitsverbot (§ 4 Abs. 3 AufenthGE). Für diejenigen, die infolge der geplanten Neuregelungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können, stellt sich die Frage, welche Verbesserungen überhaupt mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis verbunden sind. Klar ist: Es handelt sich um einen erlaubten Aufenthalt. Inhaber der Aufenthaltserlaubnis stehen nicht unter Ausreisedruck und eine Verfestigung ist prinzipiell möglich. Aber: Mit Blick auf die Lebensbedingungen wird die mindere Qualität dieser Aufenthaltserlaubnis deutlich, die sich kaum von der bisherigen Duldung unterscheidet: Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23, 24, 25 AufenthGE erhalten keine Arbeitsberechtigung. Stattdessen gilt: Vorrangprüfung plus regionale Arbeitsmarktprüfung oder Arbeitserlaubnis für einzelne Berufsgruppen / Wirtschaftszweige plus regionale Arbeitsmarktprüfung (§§ 4, 39 Abs. 2 AufenthGE). Weiterhin besteht zumindest die Möglichkeit, den Aufenthalt räumlich zu beschränken (§ 12 Abs. 2 AufenthGE), also z.B. die Wohnsitznahme im Bundesland X vorzuschreiben, aber auch die alltägliche Bewegungsfreiheit auf einen engen Radius einzugrenzen. Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23 und 24 sowie § 25 Abs. 4 und 5 AufenthGE fallen unter das AsylbLG, erhalten also (unter Umständen) lediglich abgesenkte Leistungen, meist in Form entwürdigender Sachleistungen und müssen unter Umständen im Sammellager leben. Das ist eine deutliche Verschärfung. Der Familiennachzug zu Ausländern ist in den Fällen des § 25 Abs. 4 und 5 ausdrücklich ausgeschlossen (§ 29 Abs. 3 AufenthGE). Im Fall der Personengruppe des § 25 Abs. 5 ist dies eine klare Verschlechterung. Kindergeld gibt es nur noch für Asylberechtigte und GFK-Flüchtlinge. Wer die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, 4 und 5 erhalten hat, erhält auch kein Bundeserziehungsgeld. 17 Fazit: Der Übergang von der bisherigen Duldung zu einer künftigen Aufenthaltserlaubnis ist in vielen Fällen schwer oder gar nicht erreichbar. Ein Teil der bislang Geduldeten erhält einen legalen Aufenthaltstitel – allerdings mit teilweise den gleichen sozialen Folgen, die die Duldung hatte. Angekündigt war die Integration all derer, die nicht abgeschoben werden können, in diese Gesellschaft. Der Gesetzentwurf löst dies nicht ein. Sperrwirkung gegen generelle Gefahren Auch der aktuelle Entwurf schreibt die unbefriedigenden Regelungen des bisherigen § 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG in § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthGE fort: Es wird weiterhin eine Schutzlücke geben für Flüchtlinge, die aufgrund allgemeiner Gefahren an Leib und Leben gefährdet sind, aber weder vorübergehenden Schutz (§ 24 AufenthGE) erhalten noch sich auf einen Abschiebungsstopp (§ 60 Abs. 11 AufenthGE) berufen können. Dies betrifft beispielsweise Flüchtlinge aus Bürgerkriegs- und Katastrophengebieten, denen man trotz desolater Verhältnisse im Herkunftsland die Rückkehr zumutet, weil alle Rückkehrer gleichermaßen gefährdet sind. Auch in Zukunft bleibt es dabei: In vielen Fällen wird eine kollektive Schutzregelung nicht zustande kommen und dem Individuum wird der notwendige Schutz versagt mit dem Hinweis, ganze Bevölkerungsgruppen befänden sich in gleicher Lage. § 60 Abs. 11 AufenthGE ermöglicht die Verhängung eines Abschiebestopps für bestimmte Ausländergruppen für maximal sechs Monate. Für einen längeren Zeitraum als sechs Monate gilt § 23 Abs. 1 AufenthGE. Hiernach bedarf eine Verlängerung zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit des Einvernehmens mit dem Bundesinnenminister. Dies schreibt den unwürdigen Zustand der Vergangenheit fort. Das Einvernehmenserfordernis wird von Seiten des BMI und der meisten Bundesländer als Einstimmigkeitszwang interpretiert. Das unwürdige Gezerre um die Verlängerung von Abschiebungsstopps bei Innenministerkonferenzen mit dem in der Regel vorhersehbaren Ergebnis, dass kein Einvernehmen zustande kommt, wird weitergehen. Familiennachzug In Punkto Familiennachzug gibt es, je nach Status der Person, ein abgestuftes Recht – eine Mehrklassengesellschaft, die sich besonders für aus humanitären Gründen geschützte Menschen skandalös ausnimmt. Nur Hochqualifizierte, Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge dürfen ihre minderjährigen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren nachkommen lassen (§ 32 Abs. 1 AufenthGE). Für die anderen Fälle wird die Nachzugsaltersgrenze von 16 auf 14 abgesenkt . Die Regelung ist ein Rückschritt gegenüber dem Status quo, der bislang bei 16 Jahren liegt. Als Ausnahmeregelung gilt: Ab einem Alter von 15 Jahren muss das Kind ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen können, um zu seinen Eltern nachziehen zu dürfen (§ 32 Abs. 2-4 AufenthGE). Für den Nachzug zu GFK-Flüchtlingen und Asylberechtigten gibt es prinzipiell einen Rechtsanspruch. Von den allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung des entsprechenden Aufenthaltstitels (gesicherter Lebensunterhalt, kein 18 Ausweisungsgrund) kann nach § 29 Abs. 2 AufenthGE abgesehen werden. Bei nach § 25 Abs. 3 AufenthGE, also u.a. durch die EMRK, geschützten Personen darf ein Nachzug nur „aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung der Interessen der BRD” erlaubt werden (§ 29 Abs. 3 AufenthGE). Das heißt u.a.: Es können nur Familienangehörige nachziehen, die selbst auch die Voraussetzungen für die Aufnahme aus humanitären oder völkerrechtlichen Gründen erfüllen. Die Gesetzesbegründung ist an dieser Stelle deutlich restriktiv: „Ein genereller Anspruch auf Familiennachzug zu aus humanitären Gründen aufgenommenen Ausländern würde die Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland zur humanitären Aufnahme unvertretbar festlegen und einschränken. Nicht familiäre Bindungen allein, sondern alle Umstände, die eine humanitäre Dringlichkeit begründen, sind für die Entscheidung maßgeblich...“ Nochmals im Klartext: Dass eine hier lebende Person eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen hat und die Familie getrennt ist, genügt nicht als humanitärer Grund. Erforderlich ist ein noch dringenderer humanitärer Grund, der nach der Begründung insbesondere dann vorliegt, wenn die Familieneinheit auf absehbare Zeit nur im Bundesgebiet hergestellt werden kann. Im Prinzip schreibt die Neuregelung die bisher schon unbefriedigende Praxis fort. Die Regelung ist überflüssig: In der Regel wird bei denjenigen Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthGE erhalten haben, feststehen, dass Abschiebungshindernisse in Bezug auf ihren Herkunftsstaat vorliegen und ein sicherer Drittstaat nicht erreichbar ist. Für Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und § 25 Abs. 5 AufenthGE wird ein Familiennachzug in keinem Fall gewährt (§ 29 Abs. 3 AufenthGE). Begründet wird dies mit dem lediglich vorübergehenden Charakter des Aufenthaltes bzw. der bestehenden Ausreisepflicht. Hier orientiert sich der Gesetzentwurf nicht an den praktischen Erfahrungen, dass der ursprünglich vorübergehende Charakter des Aufenthalts einen jahrelangen Aufenthalt eben nicht ausschließt. Der generelle Ausschluss des Familiennachzuges ist inakzeptabel. Wenn sich der Aufenthalt in der Praxis als ein nicht nur lediglich vorübergehender erweist, muss ein Familiennachzug möglich sein. Die Regelung ist möglicherweise verfassungswidrig. Ein Beispiel: Eine Person, die ihre Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des § 25 Abs. 4 oder 5 AufenthGE erhalten hat, wird betreuungsbedürftig. Die einzig geeignete Person, die die Aufgabe übernehmen könnte, ist ein im Ausland lebender Familienangehöriger. Ihm aber dürfte der Nachzug nicht gewährt werden. Die Folge wäre vermutlich, dass eine wesentlich kostenintensivere Betreuungsmöglichkeit zu Lasten des Steuerzahlers gefunden werden müsste. § 29 Abs. 3 AufenthGE ist also – nicht nur zu Lasten der betroffenen Ausländer - zu inflexibel und schafft vermeidbare Härten. Für Personen im sogenannten „vorübergehenden Schutz“ auf der Basis der entsprechenden EU-Richtlinie gelten besondere Voraussetzungen: nachziehende Ehegatten bzw. Kinder erhalten die Aufenthaltserlaubnis, wenn die Familiengemeinschaft durch die Fluchtsituation aufgehoben wurde und Nachziehende entweder aus einem anderen EU-Staat übernommen oder außerhalb 19 der EU leben und dort schutzbedürftig sind. Nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund Die Anerkennung nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung als Asylgrund ist ein wichtiger Fortschritt. Deutschland schließt mit der geplanten Neuregelung zum Niveau vieler anderer Staaten bei der Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention auf. Obwohl der Schutz der Opfer nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung in den letzten Jahren über die Parteigrenzen hinweg als verbesserungsbedürftig angesehen wurde, hielt das Bundesinnenministerium lange Zeit an seiner dogmatischen Interpretation fest, für die Betroffenen gebe es in Deutschland keine Schutzlücke. Vor diesem Hintergrund muss die geplante Neuregelung als ein Erfolg der Arbeit von UNHCR, PRO ASYL und anderen Nichtregierungsorganisationen sowie der vielen Menschen, die sich für die Forderung eingesetzt haben, gesehen werden. Es handelt sich hierbei um einen der wenigen klaren Fortschritte im Vergleich zum geltenden Recht und zum Referentenentwurf. Sollte dieser Fortschritt allerdings im Zuge des weiteren Gesetzgebungsverfahrens erneut zur Disposition gestellt werden, dann bleibt kaum eine flüchtlingsspezifische Regelung des Zuwanderungsgesetzentwurfes, die eine wirkliche Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand darstellt. Künftig sollen Menschen, die von nichtstaatlichen Akteuren verfolgt werden, als Flüchtlinge anerkannt werden können. § 60 Abs. 1 AufenthGE stellt klar, dass das zwingende Abschiebungsverbot in einen Staat, in dem das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist, auch bei nichtstaatlicher Verfolgung vorliegt. Dabei ist zu prüfen, ob der Antragsteller in seinem Herkunftsland Schutz vor drohender Verfolgung erhalten kann, wobei es unerheblich ist, ob die Verfolgung dem Herkunftsstaat zuzurechnen ist. Mit dieser Formulierung bekennt sich der Gesetzentwurf dazu, dass im Zentrum des Flüchtlingsschutzes die Prüfung der Schutzbedürftigkeit und erforderlichenfalls die Schutzgewährung stehen muss, nicht die Prüfung abstrakter Zurechenbarkeitskriterien. Nunmehr können Menschen, die von nichtstaatlichen Akteuren aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt werden, als GFK-Flüchtlinge anerkannt werden. Dies hat – verbunden mit der weitgehenden Angleichung des Status der GFK-Flüchtlinge an den der Asylberechtigten – erhebliche statusrechtliche Folgen. Viele Betroffene, die bislang lediglich auf der Basis kurzfristiger Duldungen in Deutschland gelebt haben, würden durch eine solche Neuregelung einen besseren Schutz und die Möglichkeit zur dauerhaften Verfestigung des Aufenthaltes erhalten. Auch dass §§ 60 Abs. 1 und 25 Abs. 2 AufenthGE geschlechtsspezifische Verfolgung explizit berücksichtigen, indem sie drohende Verfolgung aufgrund des Geschlechtes ausdrücklich erwähnen, stellt einen wichtigen Erfolg der Flüchtlingsbewegung und Menschenrechtsorganisationen dar. Insbesondere verfolgte Frauen können künftig ohne den argumentativen Umweg, als Angehörige einer sozialen Gruppe verfolgt zu sein, das „Kleine Asyl“ erhalten. Der erklärte Wille des Gesetzgebers dürfte auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben. Gegen diesen Fortschritt polemisieren Teile der Opposition, obwohl neben PRO ASYL, den Kirchen, der Süßmuth-Kommission, dem UNHCR zum Beispiel auch der 20 Bundesausschuss der CDU im Juni 2001 auf die Notwendigkeit eines verbesserten Schutzes bei nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung hingewiesen hat. Nunmehr wird offenbar von den Hardlinern aus CDU und CSU von der Folgeseite her argumentiert: Es handele sich um eine Ausweitung des Asylrechts und eine Öffnung mit unabsehbaren Folgen. Dabei wird absichtlich übersehen, dass Viele der potentiell Begünstigten sich bereits in Deutschland aufhalten – nur eben mit dem unzureichenden Status der Duldung. Auch geht es um eine Anpassung der bislang exotischen deutschen Auslegungspraxis der Genfer Flüchtlingskonvention an die überwiegende Staatenpraxis. Angleichung des Status und Befristung des Aufenthaltstitels für Asylberechtigte und GFK-Flüchtlinge – Probleme mit dem Familienasyl Der Status der Konventionsflüchtlinge (Status nach der Genfer Flüchtlingskonvention) wird demjenigen der Asylberechtigten weitgehend angeglichen. Änderungen bringt dies etwa beim Ehegattennachzug und beim Kindernachzug (künftig gesetzlicher Anspruch). Der Status von Asylberechtigten wird allerdings auch nach unten nivelliert, indem ihnen nicht wie bisher eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Sowohl bei Asylberechtigten als auch bei Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist künftig eine obligatorische Überprüfung des Status drei Jahre nach erster Erteilung der Aufenthaltserlaubnis (des befristeten Aufenthaltstitels, den nun auch die Asylberechtigten erhalten) vorgesehen. Gemäß § 26 Abs. 3 AufenthGE ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des AsylVfG mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen. § 73 Abs. 2a regelt, dass die Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme vorliegen, spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung erfolgen muss. Das Ergebnis ist der Ausländerbehörde mitzuteilen. Damit ergibt sich die von PRO ASYL bereits beim Referentenentwurf kritisierte Überprüfungsautomatik. Die Folge ist eine massive Vermehrung der Verfahren. § 73 Abs. 3a AsylVfG ist eine Präzisierung der Widerrufs- und Rücknahmebestimmungen des § 73 AsylVfG. Damit gelten die allgemeinen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf die Anhörungen und die umfassende Aufklärungspflicht. Damit ist die Überprüfung mehr als eine bloß kursorische. Auch die Begründung stellt klar, dass mit der Einführung der obligatorischen Überprüfungspflicht die Vorschriften über den Widerruf und die Rücknahme, die in der Praxis bisher weitgehend leergelaufen seien, an Bedeutung gewinnen werden und der Trend damit in Richtung auf eine Vermehrung der Widerspruchs- bzw. Rücknahmeverfahren geht. Wenn in der Gesetzesbegründung behauptet wird, die Überprüfungen sollten generell anhand der aktuellen Lageberichte des Auswärtigen Amtes erfolgen, ist – zu Lasten der Betroffenen – ohne Belang, denn eine kursorische Überprüfung genügt nicht den gesetzlichen Bestimmungen von § 73 AsylVfG. Fazit: Den betroffenen Ausländern wird nach drei Jahren der Eindruck vermittelt, dass ihr Aufenthalt erneut unsicher ist. Sie sehen sich dann einem neuen förmlichen Verfahren gegenüber, dessen Ziel ihre potentielle Entfernung aus dem Bundesgebiet 21 ist. Ein obligatorisches förmliches Widerrufsverfahren vor der Entscheidung über die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis gemäß § 26 Abs. 3 AufenthGE wäre nicht erforderlich gewesen. Vorschlägen von PRO ASYL und anderen Nichtregierungsorganisationen, entsprechend der Praxis bei der Einbürgerung eine zunächst lediglich interne Anfrage der Ausländerbehörde beim Bundesamt vorzusehen, ob ein Widerrufsverfahren durchgeführt werden soll und andernfalls die Niederlassungserlaubnis zu erteilen, ist der Regierungsentwurf nicht gefolgt. § 34 Abs. 2 AufenthGE schafft ein an den Eintritt der Volljährigkeit anknüpfendes selbstständiges Aufenthaltsrecht für die Kinder von Asylberechtigten und Flüchtlingen. Dies ist positiv. Andererseits sieht der Entwurf entgegen allen Erwartungen keine Erweiterung des Familienasyls auf Konventionsflüchtlinge vor. Damit bleibt es beim Thema Familienasyl beim jetzigen Zustand. Auch künftig ist vom Familienasyl ausgeschlossen, wer den Antrag verspätet stellt. § 14a AsylVfGE schafft die gesetzliche Fiktion der Asylantragstellung durch ein minderjähriges Kind. Mit der Asylantragstellung eines Elternteils gilt ein Asylantrag auch für jedes Kind als gestellt, das ledig ist, das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und sich zu diesem Zeitpunkt im Bundesgebiet aufhält, ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels zu sein. Mit dieser Regelung soll sukzessiven, die Ausreise verzögernden Asylantragstellungen begegnet werden. Gemäß § 30 AsylVfGE ist ein Asylantrag unbeachtlich, wenn er für einen nach diesem Gesetz handlungsunfähigen Ausländer gestellt wird, nachdem zuvor die Asylanträge der Eltern oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils abgelehnt worden sind (§ 30 Abs. 3 Nummer 7 AsylVfGE). Durch die vorgesehenen o.u.-Entscheidungen in diesen Fällen werden sich erhebliche Folgeprobleme ergeben, wenn etwa nur einfach abgelehnten Eltern ein Aufenthaltsrecht eingeräumt werden soll. Für die als offensichtlich unbegründet abgelehnten Kinder wäre dies nach § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthGE nicht möglich. Der Paragraph firmiert unter der Überschrift „Familieneinheit“. Die hier genannte Fallkonstellation führt sie ad absurdum. Unter dem Aspekt der Familieneinheit wäre allenfalls eine Regelung akzeptabel, die zum Ergebnis hat, dass das statusrechtliche Schicksal der Kinder dem der Eltern folgt. Das müsste in der Konsequenz bedeuten, dass auch die Kinder Familienasyl im Sinne von § 60 Abs. 1 AufenthGE erhalten. Verschärfung der Ausweisungsbestimmungen Die Ausweisungsbestimmungen sollen erheblich verschärft werden. Z. T. sind die Regelungen als Teil des Terrorismusbekämpfungsgesetzes bereits zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Zukünftig kann auch ausgewiesen werden (§ 55 AufenthGE), wer falsche Angaben im Visumverfahren gemacht hat oder „trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitgewirkt hat“. (Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz bereits in Kraft.) Eine Ausweisung ist im Regelfall vorgesehen (§ 54 AufenthGE), wenn der/die Betroffene wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 rechtskräftig verurteilt ist. Hierbei handelt es sich um eine Neuregelung mit möglicherweise drastischen 22 Folgen, denn die Höhe der Strafe ist dabei unerheblich. Für die Regelausweisung genügt jede rechtskräftige Verurteilung. Die Regelung betrifft auch keineswegs nur die professionelle „Einschleusung“. Würde die Vorschrift Gesetz, wird etwa ein hier lebender Flüchtling, der sein nachgeflohenes Kind, das an der deutschen Grenze steht, herüberschafft und deswegen verurteilt wird, von der Regelausweisung betroffen sein. sich bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zu Gewaltanwendung aufruft, oder mit Gewaltanwendung droht oder wenn Tatsachen belegen, dass er einer Vereinigung angehört, die den internationalen Terrorismus unterstützt, oder wer eine derartige Vereinigung unterstützt. (Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz bereits in Kraft.) frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten falsche oder unvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht, die der Unterstützung des Terrorismus verdächtig sind. (Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz bereits in Kraft.) Ausweisungsgründe ergeben sich damit auch aus Tatbeständen, die keinerlei Inlandsbezug haben. Auch bleiben die Neuregelungen trotz des nachbessernden Änderungsantrages der Regierungsfraktionen zum Teil unscharf. Es genügt bereits die Unterstützung der verdächtigen Vereinigungen, die als Unterstützerorganisationen des internationalen Terrorismus gelten. Bislang gibt es aber noch keine völkerrechtlich verbindliche Definition des Terrorismus. Zu befürchten ist, dass selbst nichtgewalttätige Unterstützer von politischen Exilgruppen von Ausweisung bedroht sein werden. Als Folge der Expertenanhörung des Bundestagsinnenausschusses und der lauten öffentlichen Kritik haben die Parteien der Regierungskoalition die ursprüngliche Absicht, die sofortige Vollziehbarkeit aller Ist- und Regelausweisungen im Gesetz festzuschreiben, nicht weiter verfolgt. Damit wäre es zu weiteren unnötigen Härten gekommen. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 Verwaltungsgerichtsordnung sieht ohnehin bereits die Möglichkeit vor, im Einzelfall die sofortige Vollziehung einer Ausweisung anzuordnen, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt. Immerhin ist mit der beabsichtigten Abmilderung sichergestellt, dass der Rechtsschutz für diejenigen, denen eine Ist- oder Regelausweisung droht – in vielen Fällen hat die Ausweisungsentscheidung keinen terroristischen Hintergrund – nicht noch weiter ausgehöhlt wird. Entscheidungsstopp für Asylanträge Seit einigen Jahren bittere Erfahrung von Flüchtlingen: Wenn sich die Verhältnisse im Heimatland dramatisch zuspitzen und eine große Wahrscheinlichkeit der Flüchtlingsanerkennung besteht, wird die Entscheidung über Asylanträge ausgesetzt. Sobald abzusehen ist, dass die größte Gefahr vorbei ist, werden die Entscheidungen wieder aufgenommen. So geschah es z.B. bei Kosovo-Flüchtlingen 1999. Zukünftig soll dieser unredliche Umgang mit der Genfer Flüchtlingskonvention gesetzlich verankert werden. Der geplante § 11a AsylVfG (vorübergehende Aussetzung von Entscheidungen) sieht vor, dass der Bundesinnenminister Entscheidungen zu bestimmten Herkunftsländern zunächst bis für die Dauer von sechs Monaten vorübergehend aussetzen kann, wenn die Beurteilung der asyl- und 23 abschiebungsrelevanten Lage besonderer Aufklärung bedarf. Diese Aussetzung kann nach dem Wortlaut unbeschränkt verlängert werden. Das ist unverhältnismäßig. PRO ASYL fordert demgegenüber weiterhin die Beschränkung der Praxis von Entscheidungsstopps auf konkrete Umbruchssituationen. Solche sind ihrem Wesen nach nur vorübergehend. Nach einem halben Jahr kann und muss eine Verfolgungsprognose getroffen werden. Dass man den Betroffenen den ihnen potentiell zustehenden Flüchtlingsstatus vorenthält, ist inakzeptabel. Weisungsgebundenheit der Entscheider/Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten Die Abschaffung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten, der von PRO ASYL seit Jahren als „institutionalisiertes Verfahrenshindernis“ kritisiert wird, wird mit einem erheblichen Nachteil gekoppelt: Zukünftig sollen die Entscheider des Bundesamtes weisungsgebunden sein. Durch diese Neuregelung des § 5 AsylVfG droht das Einzelschicksal des Flüchtlings auf der Strecke zu bleiben. Die individuelle Verfolgungsgefahr ist nichts, was nach Aktenlage - oder gar politischer Interessenlage - beurteilt werden kann. Die Streichung des Amtes des Bundesbeauftragten hätte nicht notwendig die vollständige Abschaffung der Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider bedingt. Jede Entscheidung über ein Einzelschicksal erfordert eine Bewertung, die einen persönlichen Eindruck voraussetzt und nicht delegierbar ist, einen Beurteilungsspielraum beinhaltet. Die daraus resultierenden Entscheidungen werden nicht dadurch richtiger, dass sie von einer übergeordneten Verwaltungseinheit getroffen werden. Deshalb muss hinsichtlich dieser Fragen die Weisungsungebundenheit der Entscheider erhalten bleiben. Weisungen müssen sich daher sinnvollerweise auf solche allgemeiner Art, etwa zur Beurteilung der Situation in bestimmten Herkunftsländern oder zu grundsätzlichen Fragen, beschränken, die das Ergebnis des Asylverfahrens im Einzelfall offen lassen. Gewillkürte Nachfluchtgründe beim Asylfolgeantrag Im Asylfolgeverfahren sollen künftig „in der Regel“ gewillkürte Nachfluchtgründe nicht mehr berücksichtigt werden (§ 28 Abs. 2 AsylVfGE). Der Flüchtling soll also, obwohl er politisch verfolgt wird, auch den Schutz nach der GFK nicht erhalten können. Ihm bleibt allenfalls ein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 3, 5 oder 7 AufenthGE. Dieser generelle Ausschluss des Flüchtlingsstatus nach der GFK bei selbst herbeigeführten Nachfluchtgründen im Asylfolgeverfahren ist mit der GFK nicht vereinbar. Sie differenziert nicht danach, ob die Verfolgung durch eigenes Handeln „provoziert“ ist oder wann sie entstanden ist, sondern fragt nur nach der Schutzbedürftigkeit des Flüchtlings: Wer aus politischen Gründen verfolgt wird, soll geschützt sein. Von diesem völkerrechtlichen Konsens – der als Bestandteil der GFK rechtlich verbindlich ist – versucht sich das Zuwanderungsgesetz zu verabschieden. Die Tatsache, dass Ausnahmen für möglich gehalten werden (weil es sich nur um eine Regel-Bestimmung handelt) und dass die schlimmsten Folgen durch die Gewährung von humanitärem Abschiebungsschutz aufgefangen werden, macht deutlich, dass die Verfasser um die Tragweite der Regelung wissen. 24 Verkürzung des Rechtsschutzes wegen Verletzung der Mitwirkungspflichten In § 20 Abs. 2 und § 23 Abs. 1 AsylVfGE ist vorgesehen, dass ein Verstoß gegen Mitwirkungspflichten weitreichende, auch materielle Wirkungen hat. Wer nach Stellung eines Asylgesuches nicht rechtzeitig den förmlichen Asylantrag stellt oder wer nach bereits erfolgter Aufnahme in der Aufnahmeeinrichtung nicht unverzüglich den förmlichen Asylantrag beim Bundesamt anbringt, wird den Regeln des Asylfolgeverfahrens unterworfen (§ 20 Abs. 2, § 23 Abs. 2 AsylVfGE). Das Ergebnis dieser Bestimmungen ist der Ausschluss auch objektiv vorhandener Vorfluchtgründe. Dies ist verfassungsrechtlich unzulässig und mit der GFK nicht zu vereinbaren. Die Regelung ist auch unbestimmt, weil weder der Begriff „unverzüglich“ hinreichend konkretisiert ist noch klar ist, an welchem Zeitpunkt die Ausschlussregelung fixiert sein soll. Da kein Weg daran vorbeiführt, vorhandene Asylgründe zumindest als Abschiebungshindernisse nach §§ 60 Abs. 3 ff. AufenthGE zu berücksichtigen, bewirkt die neue Vorschrift nicht mehr als eine Herabstufung schutzbedürftiger Menschen. Erlöschen des Aufenthaltstitels bei Asylantragstellung Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Aufenthaltstitel eines Flüchtlings, der gemäß §§ 22, 23 oder 25 Abs. 3 bis 5 AufenthGE einen Asylantrag stellt, erlischt (§ 51 Abs. 1 Nr. 8 AufenthGE). Die Regelung ist nicht sachgerecht und steht zudem im Widerspruch zu § 55 Abs. 2 AsylVfG, der vorsieht, dass nur Aufenthaltstitel unter sechs Monaten erlöschen. Dass die Regelung unangemessen ist, verdeutlicht der Blick auf die Situation afghanischer Flüchtlinge in der jüngsten Vergangenheit. Diese erhielten bisher zumeist lediglich Abschiebungsschutz nach § 53 Abs. 6 AuslG und waren größtenteils im Besitz von Aufenthaltsbefugnissen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und die geänderte Entscheidungspraxis des Bundesamtes eröffneten ihnen von April 2001 zumindest bis zum erneuten Entscheidungsstopp aufgrund der geänderten Lage in Afghanistan die Möglichkeit, durch die Stellung eines Asylfolgeantrages ihren Aufenthaltsstatus zu verbessern, indem sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis nach Asylanerkennung oder den Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erwerben konnten. Die geplante Regelung des § 51 Abs. 1 Nr. 8 AufenthGE würde in diesen Fällen zum Erlöschen der gegenwärtigen Aufenthaltsbefugnis führen und die Betreffenden in den unsicheren Status von Asylantragstellern mit einer Aufenthaltsgestattung zurückwerfen. Die Stellung eines Asyl(folge)antrages ist in solchen Fällen nicht als „missbräuchlich“ anzusehen und darf nicht mit Sanktionen belegt werden. Sie ist die logische Konsequenz einer verfassungswidrigen Entscheidungspraxis. Die hierdurch verursachte Notwendigkeit, einen Asylfolgeantrag zu stellen, ist der staatlichen Seite zuzuschreiben. Dies auch noch mit dem Verlust des bisherigen Aufenthaltstitels zu bestrafen, ist sachwidrig und inakzeptabel. Passbeschaffung § 43b AsylVfG, der die frühzeitige Passbeschaffung in einer Weise regelt, die zu vielen Problemen geführt hat, soll aufgehoben werden. Die Mitwirkungspflichten von Asylsuchenden bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten sollen in Form einer 25 Rechtsverordnung geregelt werden (§ 98 Abs. Nr. 1 AsylVfG). Inhaltliche Vorgaben für eine solche Rechtsverordnung finden sich im Gesetz nicht. Dies dürfte verfassungsrechtlich kaum zulässig sein (Artikel 80 Abs. 1 Satz 2 GG). Es bleibt bei der unpräzisen Regelung, dass der Asylsuchende aufgefordert werden kann, persönlich bei der Auslandsvertretung zum Zweck der Passbeschaffung vorzusprechen (künftig § 70 Abs. 4 AufenthGE). Bezüglich der Passbeschaffung wäre eine Klarstellung im Gesetz notwendig, dass die Aufforderung zur Vorsprache bei der jeweiligen Auslandsvertretung zur Passbeschaffung erst zulässig ist, wenn die begehrte Statusentscheidung unanfechtbar versagt worden ist. Im Falle der Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet kann dies nicht vor Zustellung der gerichtlichen Eilentscheidung zulässig sein. Verbesserung des asylrechtlichen Verwaltungsverfahrens Das asylrechtliche Verwaltungsverfahren hat in den vergangenen Jahren unter den Folgen der Beschleunigungsmaxime gelitten. Die daraus resultierenden Mängel haben zu einer Überlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit geführt, die selbst häufig Defizite des Verwaltungsverfahrens aufarbeiten mussten anstatt sich auf die eigene Kontrolltätigkeit zu beschränken. Dennoch sind Beweiserhebungen und Nachbesserungen im Asylverfahren die extreme Ausnahme. Besonders problematisch ist, dass die persönliche Anhörung von Asylsuchenden unmittelbar nach ihrer Meldung beim Bundesamt ohne ausreichende unabhängige Beratung und Vorbereitung durchgeführt wird. PRO ASYL und andere Nichtregierungsorganisationen haben in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass eine frühzeitige Verfahrensberatung zu den Grundlagen eines fairen Asylverfahrens gehört und deshalb gesetzlich zu verankern ist. Keines der in der Vergangenheit benannten Defizite des asylrechtlichen Verwaltungsverfahrens wird durch den Gesetzentwurf angegangen. An eine Verbesserung der Verfahrensrechte von Asylsuchenden wurde nicht gedacht. Im Gegenteil: Die Vorgaben für die fachliche Kompetenz der Einzelentscheider sollen abgesenkt werden. Diese sollen künftig nicht mehr Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Angestellte sein müssen. Zu fordern ist die gesetzliche Regelung der unabhängigen Verfahrensberatung: Einem Asylsuchenden ist vor der persönlichen Anhörung ausreichend Gelegenheit zu geben, sich über seine Mitwirkungsrechte und –pflichten durch unabhängige und rechtskundige Personen und Organisationen bzw. durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl beraten zu lassen. § 24 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist wie folgt zu fassen: „Das Bundesamt klärt den Sachverhalt auf und erhebt von Amts wegen oder auf Antrag die erforderlichen Beweise“. Es wäre wünschenswert, dass die bereits z.T. eingetretenen Verbesserungen der Bundesamtspraxis hinsichtlich des Umgangs mit traumatisierten Menschen ihren Niederschlag im Asylverfahrensgesetz finden. Vorgeschlagen wird folgende Regelung: „Werden während der persönlichen Anhörung oder im weiteren Verlauf des Asylverfahrens Anzeichen bekannt, die auf eine Traumatisierung oder erhebliche psychische Belastung von Asylsuchenden infolge erlittener Folter oder sexuelle Gewalt hinweisen, so ist das Verfahren auszusetzen und Gelegenheit zu geben, zum 26 Zwecke therapeutischer Behandlung und zu Beweiszwecken fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Den betroffenen Personen muss ein erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden. Asylbewerberleistungsgesetz Der Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bedeutet zum einen, dass Leistungen deutlich unter dem Sozialhilfesatz liegen und zumeist nur in Form von Sachleistungen gewährt werden. Außerdem erhalten die so Versorgten im Regelfall nur eine medizinische Notfallversorgung. Das AsylbLG, erklärtes Instrument der „Abschreckung” von Flüchtlingen, wird nicht etwa abgeschafft, sondern sogar ausgeweitet. Dabei wollte doch die SPD-Bundestagsfraktion der „Diskriminierung entschieden entgegnen” („Eckpunkte-Papier”). Auch die Forderungen des SPDParteitags 1999 (Streichung des § 1a AsylbLG und des Sachleistungsprinzips) und von B90/Die Grünen im März 2001 (Abschaffung des Gesetzes) bleiben ganz und gar unberücksichtigt. PRO ASYL fordert die Abschaffung des Gesetzes seit seinem Inkrafttreten. Die Änderungen im Einzelnen: Flüchtlinge, die nach § 25 Abs. 3 AufenthGE aufgrund von sonstigen rechtlichen Abschiebungshindernissen gem. § 60 Abs. 2-7 AufenthGE eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, sollen zukünftig generell Anspruch auf Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz haben. Die bisherige Praxis ergab ein uneinheitliches Bild: In einigen Bundesländern erhielten diese Flüchtlinge vorrangig Duldungen (und fielen unter AsylbLG), in anderen erhielten sie Aufenthaltsbefugnisse (und damit Leistungen nach BSHG). Die dreijährige massive Absenkung der lebensnotwendigen Versorgung (i.d.R. in Form von Sachleistungen) soll zukünftig auch diejenigen treffen, die aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen ein Aufenthaltsrecht nach § 25 Abs. 4 und 5 AufenthGE erhalten, also z.B. bei Krankheit oder faktischer Unmöglichkeit der Ausreise. Dies trifft alle bisher Aufenthaltsbefugten mit Ausnahme der Konventionsflüchtlinge. Sofern diesen Gruppen bisher eine Aufenthaltsbefugnis zugebilligt wurde, hatten sie auch Anspruch auf Leistungen nach BSHG. Ein Teil dieser Fälle wird bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis bereits drei Jahre lang abgesenkte Leistungen bezogen haben, so dass damit der weitere Bezug von Sozialleistungen nach § 2 AsylbLG „analog BSHG” möglich ist. Dennoch: Der Gesetzesentwurf bezieht erstmalig auch solche Personengruppen mit ein, die unbestrittenermaßen legal über einen längeren Zeitraum in Deutschland leben werden. Die einzige dem AsylbLG unterworfene Gruppe mit einer Aufenthaltsgenehmigung waren bislang die Bürgerkriegsflüchtlinge „für die Dauer des Krieges”. Abgesehen von einer zukünftig denkbaren weiteren Ausweitung der Formen der Sonderbehandlung, wird die Diskriminierung eines Bevölkerungsteils strukturell verfestigt. Die Neufassung des § 2 AsylbLG sieht dagegen eine positive Klarstellung gegenüber geltendem Recht vor: Nach drei Jahren werden die Leistungen analog BSHG umgestellt, wenn die Betroffenen „die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben”. Diejenigen, denen dieser Missbrauch unterstellt wird, dürften bereits unter § 1a (also eine Sonderform der 27 nochmaligen Leistungskürzung) fallen, so dass eine Angleichung an BSHG ohnehin verweigert wird. Für alle, die die „normalen“ Grundleistungen nach §§ 3-7 AsylbLG erhalten, dürfte sich die Angleichung an BSHG also nach drei Jahren zum Automatismus entwickeln – eine leichte Verbesserung. (Artikel 8; §§ 1, 2 AsylbLG). Ausreiseeinrichtungen / Abschiebungshaft Künftig soll bundesweit möglich werden, was einige Bundesländer bereits erproben: Flüchtlinge, denen man z.B. aufgrund fehlender Papiere falsche Angaben zur Identität unterstellt, müssen in Sammellagern leben, in denen eine „intensive soziale Betreuung“ Flüchtlinge zur Ausreise nötigen soll. Dies kann ausdrücklich auch Kinder und Traumatisierte treffen, wie dies aus der Gesetzesbegründung (S.199) hervorgeht. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass viele Flüchtlinge zu Unrecht in Ausreisezentren landen. Psychische Zermürbung ist die Taktik und das Abdrängen der hier Untergebrachten in die Illegalität das kaum verhohlene Ziel der „Ausreisezentren” (§ 61 Abs. 2 AufenthGE). Dass diese Taktik funktioniert, zeigen die Ergebnisse der Modellprojekte in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Nur eine geringe Zahl von Flüchtlingen wurde aus den Ausreisezentren abgeschoben, aber ein sehr großer Teil zog das Leben in der Illegalität dem psychischen Druck der Ausreisezentren vor. Der Staat kann bei Ausreisepflichtigen die ausländerrechtlichen Mittel ausschöpfen, über sozialen Druck ausländerrechtliche Ziele verfolgen darf er nicht. Der Gesetzentwurf sieht keine Maximaldauer der Unterbringung in Ausreiseeinrichtungen vor (während selbst für die Abschiebungshaft eine solche existiert). Damit stellt sich die Schaffung von Ausreiseeinrichtungen de facto als eine Ergänzung und Erweiterung des bisher schon unverhältnismäßigen Abschiebungshaftsystems dar. Dessen Überprüfung hatten die Parteien der Regierungskoalition im Koalitionsvertrag vereinbart. Anstatt, wie dort vorgesehen, zumindest die Dauer der Abschiebungshaft im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu überprüfen, wird mit den Ausreiseeinrichtungen ein Instrumentarium geschaffen, das das Abschiebungshaftsystem erweitert, ohne dessen strukturelle Probleme anzugehen. Der Prüfungsauftrag der Koalitionsvereinbarung bleibt vorsätzlich unerledigt. Stattdessen sollen die bisherigen Bestimmungen über die Abschiebungshaft unverändert ins neue Aufenthaltsgesetz übernommen werden (§ 62 AufenthGE). Residenzpflicht Die vielfach kritisierte, überflüssige Regelung, die die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden auf einen kleinen Radius (i.d.R. Stadt/Landkreis) begrenzt, soll in aller Härte auf diejenigen angewendet werden, die nur noch über eine „Bescheinigung“ (gem. § 60 Abs. 11 AufenthGE) verfügen (§ 61 Abs. 1 AufenthGE). Waren sie bislang geduldet, konnten sie sich – „immerhin“ – innerhalb des Bundeslandes frei bewegen. Schon die bestehende Regelung für Asylsuchende begründete man kaum überzeugend mit dem angeblich schnelleren Asylverfahren. Ebenso wenig kann jetzt das Argument „Terrorismusgefahr” die schikanöse Behandlung aller Menschen, die man nicht abschieben kann, rechtfertigen. Zu 28 fordern ist dagegen, wie dies B90/Die Grünen im März 2001 taten, die Abschaffung der Residenzpflicht. Im Gesetzestext ist lediglich festgeschrieben, dass der Aufenthalt von Ausreisepflichtigen räumlich zu beschränken ist, aber nicht, auf welches Gebiet. Die Gesetzesbegründung macht klar, dass eine Angleichung an die Regelungen, die für Asylbewerber gelten, beabsichtigt ist. Flughafenverfahren Auch beim Flughafenverfahren (§ 18a AsylVfG) gibt es keine Änderung der bisherigen problematischen Praxis. Die politische Diskussion um die Beschränkung der Aufenthaltsdauer von im Flughafenverfahren abgelehnten Asylantragstellern im Transit wird ebenso ignoriert wie die in der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien enthaltene Absichtserklärung, die Zustände, insbesondere die Härten der Situation sogenannter „Langzeitaufenthalter“, im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen. Auch unbegleiteten minderjährigen Kindern bleibt nach dem Gesetzeswortlaut das Verfahren nicht erspart. Das Nichthandeln der Regierungskoalition darf als Absichtserklärung aufgefasst werden: Auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ist eine neue Flüchtlingsunterkunft z.Zt. im Bau. Daneben wird vermutlich später eine Abschiebungshaftanstalt im Transit in Betrieb gehen. 29 Kinderrechte Für minderjährige Flüchtlinge sieht der Gesetzentwurf keinerlei Verbesserungen vor. Es bleibt bei der vielfach kritisierten ausländerrechtlichen Handlungsfähigkeit mit 16 Jahren, bei Drittstaatenregelung, Flughafenverfahren, Abschiebungshaft und Abschiebung auch für Minderjährige. Damit brüskiert die Regierung auch den Bundestag. Bereits zweimal, zuletzt als Reaktion auf eine von PRO ASYL in einem breiten Bündnis mit anderen Nichtregierungsorganisationen und vielen Unterstützern initiierte Petition, hat das Parlament die Regierung aufgefordert, die deutschen Vorbehalte zur UN-Kinderrechtskonvention zurückzunehmen und die Konvention im Ausländer- und Asylrecht voll anzuwenden. Eine der Konsequenzen müsste sein, dass das in § 80 AufenthGE wie bisher festgeschriebene ausländerrechtliche Handlungsfähigkeitsalter geändert wird. Das Votum des Petitionsausschusses des Bundestages vom September 2001 wird im vorliegenden Gesetzentwurf nicht aufgegriffen. Die Bundesregierung, durch den Ausschuss zur Umsetzung der Forderung aufgefordert, bleibt vorsätzlich untätig. Schlimmer noch: Der Gesetzentwurf schafft neue Probleme für Kinderflüchtlinge. So ergeben sich große Probleme für sie aus der Ausschlussklausel des § 10 Abs. 3 AufenthGE, wonach keine Aufenthaltserlaubnis erhält, wer im Asylverfahren als offensichtlich unbegründet gem. § 30 Abs. 3 AsylVfG abgelehnt wird. Da Minderjährige altersgemäß Schwierigkeiten haben, den Anforderungen an die Darstellung der Fluchtgründe bei der Anhörung zu genügen, werden ihre Anträge nicht selten als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Eine solche Ablehnung würde aber endgültig eine Aufenthaltsperspektive zunichte machen. Härtefallregelung Seit Jahren fordern Kirchen, Verbände und Menschenrechtsorganisationen eine Härtefallregelung im Ausländergesetz. In der Koalitionsvereinbarung war eine Prüfung der Frage vereinbart. Die Regierungskoalition hat den selbst erteilten Auftrag nicht erledigt. Dabei hat selbst die CDU-Bundesausschuss eine solche Regelung befürwortet. Das Innenministerium Schleswig-Holstein hat dem BMI im Zuge der Länderabstimmung sogar einen konkreten Vorschlag dafür übermittelt. Im Regierungsentwurf sucht man vergebens danach. Illegalisierte Weder berücksichtigt der aktuelle Aufenthaltsgesetzentwurf die wenigen Anregungen der Unabhängigen Kommission Zuwanderung noch das, was an Verbesserungen vom Rat der Innen- und Justizminister der EU diesbezüglich beschlossen worden ist. Es wird keine „Amnestie“ oder „Schlussstrichregelung“ vergleichbar der in anderen europäischen Staaten geben. Zu fordern ist weiterhin mindestens die Aufhebung der Meldepflicht von Schulen bei Kindern ohne Aufenthaltstitel (Änderung § 87 AufenthGE), eine Ausnahmeregelung im Hinblick auf die humanitäre Flüchtlingshilfe (Änderungsbedarf in § 96 und § 54 Ziff. 2 AufenthGE). 30 Mit Blick auf die neu eingeführte Klausel zur Schaffung von sog. Ausreisezentren ist zu erwarten, dass die Zahl der in Deutschland als „illegal“ lebenden Menschen drastisch steigen wird. Der Anspruch der Regierungskoalition, mit dem Zuwanderungsgesetz eine umfassende Neuregelung der Zuwanderung zu schaffen, hätte es nahe gelegt, im Rahmen einer „Schlussstrichregelung“ eine Legalisierung von hierzulande ohne jeden Status lebenden Menschen vorzusehen. Andere europäische Staaten haben mit umfassenden Neuregelungen des jeweiligen Ausländerrechts solche Legalisierungsaktionen verbunden. Auch mit den Novellierungen des deutschen Ausländerrechts waren mehrmals Altfallregelungen verbunden. Es ist im wohlverstandenen öffentlichen Interesse, möglichst viele Menschen aus der Grauzone der weitgehenden Rechtlosigkeit herauszuholen. Die folgenden Seiten dieser Stellungnahme beziehen sich auf gesetzliche Bestimmungen, die mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz bereits zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten sind und als geltendes Recht in das Zuwanderungsgesetz übernommen werden sollen. Deshalb wird im folgenden auch noch das Ausländergesetz in der geltenden Fassung zitiert. Doppelstandard im Datenschutz/Ausländerausweisdokumente Mit Änderungen des Ausländergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes führt das Terrorismusbekämpfungsgesetz neue Ausweisdokumente für Ausländer ein. Dazu gehören die Aufenthaltsgenehmigung, der Ausweisersatz für Ausländer ohne Passpapiere, die künftige Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung, die Bescheinigung einer Genehmigungsfiktion, die Aufenthaltsgestattungsbescheinigung für Asylsuchende (§§ 5, 39 Abs. 1, 56a, 69 Abs. 2 AuslG, § 63 AsylVfG). Diese neuen Dokumente sollen künftig nach vergleichbaren Gesichtspunkten gestaltet werden. Alle diese Ausweisdokumente sollen zusätzlich identifizierende Merkmale enthalten. Neben einem Foto und der Unterschrift gehören dazu auch weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht sowie eine „Zone für das automatische Lesen“. Während die Einführung von Ausweisdokumenten mit biometrischen Merkmalen bei Deutschen durch Bundesgesetz geregelt werden soll, soll bei Dokumenten, die für Ausländer gelten, eine Rechtsverordnung genügen. Alle Einzelheiten sollen nämlich vom Bundesinnenministerium „nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen durch Rechtsverordnungen“ geregelt werden. Für Deutsche enthält das geänderte Passgesetz bzw. Personalausweisgesetz eine Zweckbindung: „Im Pass enthaltene verschlüsselte Merkmale und Angaben dürfen nur zur Überprüfung der Echtheit des Dokumentes und zur Identitätsprüfung des Passinhabers ausgelesen und verwendet werden. Auf Verlangen hat die Passbehörde dem Passinhaber Auskunft über den Inhalt der verschlüsselten Merkmale und Angaben zu erteilen.“ Ganz anders liest sich dies im Gesetzentwurf des neuen Aufenthaltsgesetzes. Anstelle einer klaren Zweckbindung heißt es in § 78 Abs. 5 AufenthGE: „Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen.“ 31 Der Aufenthaltsgesetzentwurf sieht ebenfalls die Einbringung biometrischer Merkmale in verschlüsselter Form in Ausweisdokumente von Ausländern vor. Ein Auskunftsrecht findet sich nicht. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht, ein aus Artikel 1 und 2 GG abgeleitetes Grundrecht, gilt für Ausländer in weit geringerem Maße als für Deutsche: Sie werden zu Objekten von Datensammelei. Die pauschale Verarbeitungsbefugnis für alle öffentlichen Stellen erlaubt eine Datensammelei auf Vorrat, ohne dass die Zwecke ausreichend klargestellt und beschränkt werden. Sie steht möglicherweise auch im Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot. Für die ungleiche Behandlung von Deutschen und Ausländern ist eine sachliche Rechtfertigung nicht zu erkennen. Zwar soll - so die auf Druck von Bündnis 90/Die Grünen schließlich in das Terrorismusbekämpfungsgesetz aufgenommene Regelung - eine bundesweite Referenzdatei nicht eingerichtet werden, so weit es um die Pass- und Personalausweise Deutscher geht. Für Ausländer gibt es diese Referenzdatei praktisch bereits in Form des Ausländerzentralregisters. Bündnis 90/Die Grünen und die SPD haben den Ausschluss der bundesweiten Referenzdatei als Schritt zur Bewahrung des informationellen Selbstbestimmungsrechtes dargestellt. Für Ausländer gilt dies nicht. In einem „Positionspapier zum Terrorismusbekämpfungsgesetz der Bundesregierung“ vom 7. Dezember 2001 weist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein auf die grundsätzliche verfassungsrechtliche Problematik des Ausländerzentralregisters hin. Bereits bislang „erfolgen nicht verhältnismäßige Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auf unbestimmten rechtlichen Grundlagen. Die sicherheitsbehördliche Nutzung des AZR stellt eine sachlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung gegenüber Deutschen dar. Deswegen im Jahr 1995 eingereichte Verfassungsbeschwerden sind bis heute vom Bundesverfassungsgericht nicht behandelt.“ (Das Positionspapier des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein setzt sich im übrigen ausführlich mit der grundsätzlichen Problematik biometrischer Daten auseinander.) 32 Datenfluss bis in die Verfolgerstaaten? Datenübermittlung vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und von den Ausländerbehörden an Verfassungsschutzbehörden Eine Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1a BVerfSchG) betrifft Flüchtlinge ganz besonders. Künftig sollen das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und die Ausländerbehörden der Länder von sich aus den Verfassungsschutzbehörden „ihnen bekannt gewordene Informationen einschließlich personenbezogener Daten über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, wenn tatsächlich Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist,“ übermitteln. Mit Terrorismusbekämpfung – die Regelung stammt aus dem Terrorismusbekämpfungsgesetz – hat das nur bedingt zu tun. Denn § 3 Abs. 1 Bundesverfassungsschutzgesetz beschränkt sich eben nicht auf die Terrorismusbekämpfung oder den Kampf gegen gewaltbereite Organisationen, die auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, sondern schließt auch bloße extremistische Bestrebungen mit ein. Schon ein legales politisches Engagement von Ausländern kann eine Datenweitergabe legitimieren. PRO ASYL und andere Nichtregierungsorganisationen haben diese brisante Regelung kritisiert. Sie eröffnet die Möglichkeit, dass die sensiblen Inhalte von Asylakten, insbesondere die Begründungen von Asylanträgen, über den Weg der deutschen Inlandsgeheimdienste in die potentiellen Verfolgerstaaten gelangen. Dem hat der Gesetzgeber zumindest insofern Rechnung getragen, als § 18a Abs. 1a BVerfSchG nunmehr um den Satz ergänzt worden ist: „Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen nach § 19 Abs. 3 unterbleibt, es sei denn die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten.“ Die Parteien der Regierungskoalition haben damit auch auf die im Rahmen der Expertenanhörung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages zum Terrorismusbekämpfungsgesetz vorgetragene Kritik reagiert. Was denn nun jeweils völkerrechtlich geboten sei, darüber schweigt sich die kurze Gesetzesbegründung jedoch aus. Es handele sich um eine redaktionelle Neufassung aus Gründen der Klarstellung, darüber hinaus sei dies eine Eingrenzung der Übermittlungsbefugnis auf Fälle, in denen die Übermittlung völkerrechtlich geboten sei. Tautologischer und inhaltsleerer kann man ein Gesetz nicht begründen. Ob die restriktivere Fassung der Übermittlungsregelungen eine praktische Wirkung hat, wird sich zeigen müssen. Deutlich ist jedoch, dass – wie im geheimdienstlichen Bereich ohnehin üblich – der Übermittlungsbefugnis letztlich kaum adäquate und in der Praxis umsetzbare Rechte der Betroffenen gegenüberstehen. Ihre Auskunftsrechte sind äußerst beschränkt, eine Benachrichtigung über die Übermittlung ist nicht vorgesehen. 33 Generalverdacht gegen Asylsuchende: Missbrauch ihrer erkennungsdienstlichen Unterlagen Die von Ausländern und Asylsuchenden erhobenen erkennungsdienstlichen Daten und Unterlagen sollen zehn Jahre lang aufbewahrt werden (§ 78 Abs. 2-4 AuslG, § 16 Abs. 5, 6 AsylVfG). Ihre Nutzung wird durch eine Art Generalklausel geregelt. Erlaubt ist die Nutzung „zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln für Zwecke des Strafverfahrens oder zur Gefahrenabwehr“. Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Daten sollen – ohne daß ein konkreter Verdacht gegen den Betroffenen vorliegt – für jeglichen polizeilichen Daten- und Spurenabgleich benutzt werden können. Im Klartext: Sämtliche im Rahmen von erkennungsdienstlichen Maßnahmen erfassten Ausländer werden wie potentielle Straftäter behandelt. Obwohl das Gesetz heute noch zwischen polizeilichen und ausländerrechtlichen Daten trennt, gibt es eine solche Trennung in der Praxis künftig kaum noch. Missbrauch zweifelhafter Sprachanalysen Erklärtermaßen zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion eines Ausländers wird – die offene – Aufnahme und Auswertung des gesprochenen Wortes zugelassen (§§ 41 Abs. 2 Satz 2, 78 Abs. 3, 4 AuslG, § 16 Abs. 1 Satz 3, Abs. 5,6 AsylVfG). Obwohl über das Anti-Terror-Paket in das Ausländer- und damit künftige Aufenthaltsgesetz sowie das Asylverfahrensgesetz transformiert, ist damit deutlich: Mit der Bekämpfung von Terrorismus oder Straftaten haben die sogenannten Sprachanalysen nichts zu tun. Ihre Bedeutung liegt bei der Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Das Interesse besteht offenbar darin, Ausländer mit unklarer Herkunft einer Herkunftsregion zuzuordnen und damit die Chance zu erhöhen, sie einem bestimmten Herkunftsstaat „anzubieten“ oder abzuschieben. Bezeichnend dafür, welcher Missbrauch mit der Methode betrieben wird, ist auch, dass nach der Erstellung des in vielen Fällen wissenschaftlich zweifelhaften Herkunftsgutachtens über die Zuordnung der Sprache zu einer Region keine umgehende Löschung der Tonaufnahmen vorgesehen ist. Vielmehr sollen sie für zehn Jahre aufbewahrt werden. Sinn macht dies nur, auch wenn die Gesetzesbegründung dies verschweigt, wenn man eine biometrische Sprachzuordnung zum Beispiel von abgehörten Telefonaten plant. Es werden also Daten ohne klare Zweckbindung auf Vorrat gespeichert. Es handelt sich um die Daten Unverdächtiger. Auch hier werden Ausländer und Asylsuchende behandelt wie potentielle Straftäter. 34 Änderung des Vereinsgesetzes – zusätzliche Verbotsgründe In engem Zusammenhang mit der Verschärfung der Ausweisungsbestimmungen stehen geplante Neuregelungen des Vereinsgesetzes. Die Möglichkeiten, Ausländervereine zu verbieten, sollen erweitert werden. Die geplanten Neuregelungen finden sich im Terrorismusbekämpfungsgesetz. Vereine von Migranten werden zukünftig noch stärker vom Verfassungsschutz überwacht, wenn sie sich gegen „den Gedanken der Völkerverständigung“ oder „das friedliche Zusammenleben der Völker richten“. Darüber hinaus sollen sie leichter verboten werden können, z.B. wenn sie Gewaltanwendung befürworten oder androhen, auch wenn sich dies nicht auf Deutschland, sondern auf ihr Herkunftsland bezieht. Was sich nach Terrorismusbekämpfung anhört, ist in der Praxis hochproblematisch: Exilvereinen, die sich politisch gegen Unrechtsregime in ihren Herkunftsstaaten engagieren, droht die Verbotsverfügung. Die generalklauselartigen Formulierungen lösen keine Probleme, sie schaffen neue. Dies zeigen Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit: So hätten nach der Neuregelung afghanische Vereine, die sich in den letzten Jahren für den gewaltsamen Sturz des Talibanregimes in Afghanistan öffentlich eingesetzt haben, verboten werden können. Befreiungsbewegungen, Verhandlungspartner, terroristische Organisationen? Die Frage stellt sich häufig. Die Bewertungen ändern sich oft innerhalb kurzer Zeit. Dies verdeutlicht das Beispiel der kosovarischen UCK. Das Mittel der vereinsrechtlichen Verbotsverfügung ist ein untaugliches Mittel, wo es gilt, sich mit Organisationen, die Gewaltanwendung im Rahmen eines Befreiungskampfes nicht ausschließen, und ihren Methoden auseinander zu setzen. Aus der Perspektive undemokratischer Regime und potentieller Verfolgerstaaten werden Oppositionelle ohnehin oft mit Terroristen gleichgesetzt. Eine solche schlichte Gleichsetzung zwischen Terrorismus und dem Kampf gegen diktatorische Regime, wie sie in den Regelungen in § 3 BVerfSchG und § 14 Abs. 2 VereinsG angelegt sind, darf es nicht geben. Die geplanten Neuregelungen sind ein gutes Beispiel dafür, wie statt konkreter Terrorismusbekämpfung symbolische Sicherheitspolitik mit ungeeigneten Mitteln betrieben wird. So wird in der Begründung des Gesetzentwurfes behauptet, das bisherige Vereinsgesetz biete keine ausreichenden Möglichkeiten, gegen Ausländervereine vorzugehen, die ausländische gewalttätige oder terroristische Organisationen zum Beispiel durch Spenden, durch Rekrutieren oder auf sonstige Weise unterstützen. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 1993 das geltende Recht so ausgelegt, dass die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik bereits dadurch gefährdet werde, dass ein Verein im Bundesgebiet „entweder selbst Terroranschläge organisiert und den Tätern zum Beispiel durch Geldspenden, Gewährung von Unterkunft oder Kurierdienst Hilfe leistet oder wenn er Terroranschläge gegen Einrichtungen oder Organe eines fremden Staates, die von dritter Seite verübt werden, unterstützt.“ Es gibt also keinen Bedarf für die Neuregelung. Den neugefassten Verbotsgründen (§ 14 Abs. 2 Nummer 4 und 5 VereinsGE) liegt ein verschwommener Terrorismusbegriff zugrunde, der geeignet ist, auch bloße Meinungsäußerungen und gewaltlose Betätigungsformen zu kriminalisieren. Insbesondere die Entwurfsbegründung zeigt, welcher Geist hinter den Bestrebungen zur Verschärfung der Vereinsverbote steht. Der Versuch, das friedliche Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen in der Bundesrepublik mit den 35 Mitteln des Vereinsverbots zu flankieren, ist mehr als eine Stilblüte. Das Vereinsverbot soll offenbar nicht mehr länger ultima ratio sein, die extreme Ausnahme von der Vereinigungsfreiheit, wie sie auch Artikel 22 Abs. 2 des Bürgerrechtspaktes und Artikel 11 Abs. 2 EMRK aus Gründen der nationalen Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Verbrechensverhütung vorsehen, sondern Mittel der Wahl, um Druck auf missliebige Vereine auszuüben. Dieser soll zum Beispiel Vereinen gelten, die sich für „theokratische, zum Beispiel islamistische Staatsformen“ in ihrem Herkunftsland einsetzen. Was darunter verstanden wird, wird nicht erläutert. Staatsreligion ist der Islam nach den Verfassungen einer ganzen Reihe von Staaten. Sie sind in ihrer praktischen Ausgestaltung allerdings sehr unterschiedlich. Die Auseinandersetzung mit theokratischen Staatsformen und undemokratischen Praktiken in der Welt kann nicht auf deutschem Boden mit vereinsrechtlichen Kollektivsanktionen und ausweisungsrechtlichem Vorgehen gegen einzelne Ausländer geführt werden. Es bedarf nicht dieser Neuregelung, um etwa den Anhängern der Idee eines Kalifatstaates hierzulande wirksam zu wehren. 36 Fazit Vom großen Projekt Zuwanderungsgesetz ist eine Reformruine geblieben – mit einigen erhabenen Säulen. Die parlamentarische Opposition und der Bundesrat warten mit einer Vielzahl von Änderungsanträgen auf. Deren Zielrichtung: Weitere Verstärkung der restriktiven Elemente. Selbst wenn der Entwurf weitgehend unverändert Gesetz würde – von einer kopernikanischen Wende des deutschen Ausländerrechts könnte nicht die Rede sein. Zu erinnern ist an die Geschichte dieses Gesetzesvorhabens. In der Koalitionsvereinbarung von Bündnis 90/Die Grünen war ein Zuwanderungsgesetz in dieser Legislaturperiode nicht vorgesehen. Ein gesellschaftlicher Konsens schien nicht erreichbar. Bewegung kam in die fast erlahmte gesellschaftliche Zuwanderungsdiskussion, als die deutsche Arbeitgeberschaft einen sektoralen Arbeitskräftemangel im IT-Bereich geltend machte und kurzfristig greifende Regelungen für die Beschäftigung von Fachkräften in diesem Bereich forderte. Dem trug die Regierung mit einer Greencardregelung Rechnung, die letztlich allerdings in sehr begrenztem Maß zur erfolgreichen Anwerbung solcher Fachkräfte führte. Dennoch wurde im Rahmen der Greencarddiskussion immer deutlicher, dass eine Zuwanderung aus vielerlei Gründen im Interesse dieser Gesellschaft liegt. Mit der Einsetzung der Unabhängigen Kommission Zuwanderung unter Vorsitz von Rita Süßmuth wurde der Versuch unternommen, die Diskussion fachlich zu fundieren, Interessenabwägungen vorzunehmen, Konsense auszuloten und entsprechende Politikempfehlungen zu geben. Die Arbeit der Kommission diente jedoch überwiegend als Staffage für die parallel betriebene Vorbereitung eines Zuwanderungsgesetzentwurfes. Die - aus Sicht von PRO ASYL bereits unzureichenden - Vorschläge der Kommission wurden großenteils ignoriert. Seitdem wird im parlamentarischen Verfahren Zeitdruck produziert. In der Folge ist die Suche nach einem zukunftsweisenden gesellschaftlichen Konsens zweitrangig geworden gegenüber der wahltaktisch motivierten parteipolitischen Besetzung des Themas. Was die Einen zur europaweit modellhaften Regelung von Zuwanderung hochstilisieren, kritisieren die Anderen als ein Einfallstor für zusätzliche Einwanderung. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Lehmann hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 19. Dezember 2001 darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf Menschen, die aus humanitären Gründen aufenthaltsberechtigt sind gegenüber denjenigen Ausländern, die zum Zweck der Erwerbstätigkeit nach Deutschland gekommen sind, benachteiligt. Dies betreffe so wichtige Bereiche wie den Familiennachzug, die Erwerbstätigkeit, die Integrationshilfen und die Verfestigung des Aufenthalts. Die Überbetonung des nationalen Wirtschaftsinteresses wird an vielen Stellen der Gesetzesbegründung deutlich. Konsequenterweise enthält das Gesetz deshalb mit der Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte und deren Besserstellung beim Kindernachzug privilegierende Regelungen, die einen Konkurrenzvorteil beim von Wirtschaft und Politik ausgerufenen „Kampf um die besten Köpfe“ verschaffen sollen. In anderer Hinsicht ist das Gesetz entgegen aller Absichtserklärungen wenig innovativ. So erweist sich etwa das als zukunftsweisende Vereinfachung des Ausländerrechts dargestellt Vorhaben, die Zahl der bisherigen Aufenthaltstitel 37 drastisch zu reduzieren, bei näherem Hinschauen als eine Mogelpackung. Eine wirkliche Reduzierung findet nicht statt, da innerhalb der Aufenthaltstitel die jeweiligen Zweckbindungen unterschiedliche Rechtsfolgen haben. Hinter dem Begriff der Aufenthaltserlaubnis etwa verbirgt sich die lediglich terminologische Zusammenfassung der verschiedensten Statusarten. Mit der Bescheinigung nach § 60 Abs. 11 AufenthGE wird eine Schrumpfform der Duldung wiedereingeführt, nachdem die Kritik am Referentenentwurf offenbar zumindest insoweit ernst genommen worden ist, als man die Betroffenen nunmehr nicht der völligen Papierlosigkeit überantworten will. Mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz sind Regelungen eingeführt worden, die den ursprünglichen Intentionen eines Zuwanderungsgesetzes zuwiderlaufen. Was zur Zeit in parlamentarischen Verfahren geschieht, hat Vera Gaserow in der Frankfurter Rundschau vom 13.12.2001 zutreffend beschrieben: „Ein eh schon auf Konsens gebürsteter Entwurf wird noch einmal umfrisiert. Mag Otto Schily bereits in Vorleistung getreten sein. Jetzt wird an Grundpositionen noch einmal kräftig nachgeschliffen – hübsch scheibchenweise. Kindernachzugsalter? Zwei, drei Jahre mehr oder weniger? In der Praxis ein Streit um kleine Personengruppen. Mit Blick auf große Ganze eine Quantité négligeable. Flexible Einwanderung nach regionalen Arbeitsmarktengpässen? Fortschrittliche Idee, aber soll daran der breite Konsens scheitern? Ausweitung der Sozialhilfekürzung für Asylbewerber? Das große Reformvorhaben wird doch nicht an 16,42 Mark für Flüchtlinge hängen! Und letztlich die phonstärkste Forderung der Union – die Begrenzung der Zuwanderung als erklärtes Ziel der Paragraphen. Ein Einwanderungsgesetz zur Verhinderung der Einwanderung? Warum nicht? Man hat schließlich schon manche politische Absurdität zu Paragraphen gemacht. Ohnehin nur kosmetische Gesetzesfloskeln. [...] irgendwann greift die gezielte Zermürbung die Substanz des politischen Materials an. Ein Gesetz zerbröselt, sein Geist löst sich in Beliebigkeit auf, seine Entstehungsabsicht droht, sich ins Gegenteil zu verkehren.[...] Über ein solches Gesetz könnte man die Gespräche getrost abbrechen. An Regeln zur Abschottung mangelt es schon jetzt nicht. Käme es in dem Verhandlungspoker nicht längst darauf an, welche Seite zuerst die Nerven verliert – SPD und Grüne müssten sich in einer stillen Stunde nach dem Sinn ihres Einwanderungsgesetzes fragen. Den Geist der sommerlichen Einwanderungsdebatte trägt es kaum noch. Und spätestens durch ein zweites rot-grünes Gesetz wird er in die Flucht geschlagen. Einen Tag nach dem Zuwanderungsgesetz wird der Bundestag am Freitag Otto Schilys Anti-Terror-Paket verabschieden. Ein Mammutwerk, das auch noch die letzte zaghafte Botschaft des Zuwanderungsgesetzes konterkariert. Seine Entstehung bleibt selbst unter dem Eindruck des 11. September ein denkwürdiges Beispiel für die jähe Verschiebung politischer Koordinaten. Ein halbes Jahr nach dem allseits gefeierten Bericht einer Einwanderungs-Kommission schafft sich die Bundesrepublik damit ein Instrumentarium, das die Einreise und die Ausweisung von Ausländern strenger als je zuvor reglementiert. Die Fremden, um deren Arbeitskraft und jugendliches Alter man gerade noch warb, geraten unter Generalverdacht. Ein anderer Pass rechtfertigt künftig besonders unfreundliche Mittel – feindselige Beobachtung auch von Amts wegen und zweierlei Bürgerrechte. 38 Auch dieses zweite Gesetzesvorhaben der rot-grünen Koalition zeigt Spuren eines Zermürbungsprozesses, dieses Mal provoziert durch künstlichen Zeitdruck und durch die Schwäche einer liberalen Bürgerrechtsbewegung.“ Für Asylsuchende, im Asylverfahren Abgelehnte und viele der bislang Geduldeten wird das geplante Zuwanderungsgesetz erhebliche Verschlechterungen mit sich bringen. Es ist schwierig, aus der Vielzahl der diesbezüglich problematischen Neuregelungen diejenigen hervorzuheben, die sich besonders negativ auf die Situation der hier lebenden Menschen dieser Personengruppen auswirken. Sicher ist, dass der geplante Ausschluss der im Asylverfahren als offensichtlich unbegründet Abgelehnten von der Möglichkeit der Statusverbesserung eine erhebliche Zahl von Menschen treffen wird. Sicher ist, dass mit der Erweiterung des Abschiebungshaftsystems um das Element der Ausreiseeinrichtungen ein bedeutsamer Schritt zur weiteren Entrechtung von Menschen gegangen wird, der – entsprechend der Umsetzung durch die Bundesländer – eine schwer prognostizierbare Zahl von Menschen betreffen kann. Sicher ist, dass die völlige Abschaffung der Weisungsungebundenheit der Einzelentscheider beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge Tür und Tor öffnet für einen verstärkten politischen Durchgriff auf die Asylentscheidungspraxis. Die Fortschreibung einer Abschreckungspolitik gegen Flüchtlinge, wie sie etwa in der Gestaltung einer defizitären Lebenslage durch das Asylbewerberleistungsgesetz zum Ausdruck kommt und durch die Neuregelungen noch erweitert wird, ist ein katastrophales Signal der Ausgrenzung in einem Gesetzentwurf, der sich angeblich der Integration verschrieben hat. Den vielen Mängeln dieses Gesetzentwurfs steht als fast einzig unbezweifelbarer Fortschritt die Anerkennung der nichtstaatlichen und geschlechtsspezifischen Verfolgung als Asylgrund gegenüber. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2001 einer Vielzahl weiterer Verschärfungsvorschläge zugestimmt, die der Bundesregierung zur Prüfung zugeleitet worden sind. Unter anderem setzt sich der Bundesrat für weitere massive Verschärfungen des Asylbewerberleistungsgesetzes ein. Auch in anderer Hinsicht folgt die große Mehrzahl der Vorschläge des Bundesrates dem Muster einer repressiven Ausländerpolitik. Akzeptiert die Bundesregierung auch nur einen Bruchteil der Vorschläge des Bundesrates, so verkehrt sich die ursprüngliche Absicht des Zuwanderungsgesetzes vollends in ihr Gegenteil.