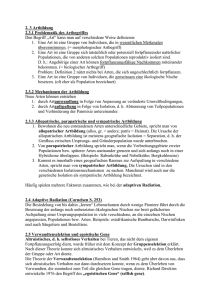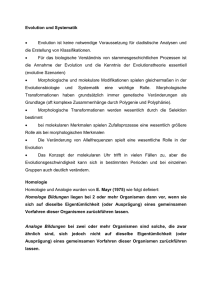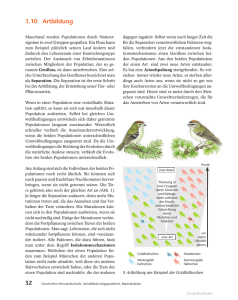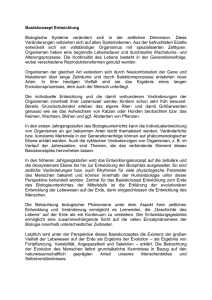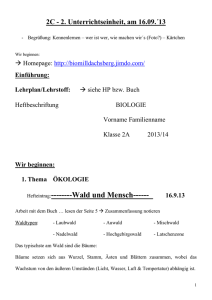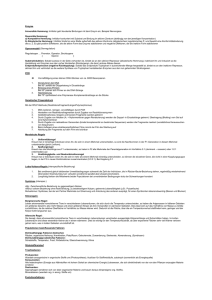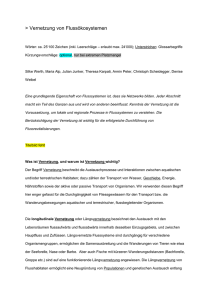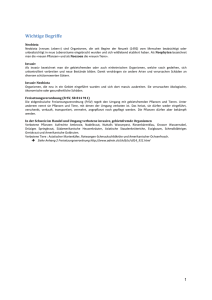Die biologische Art als Genflussgemeinschaft
Werbung
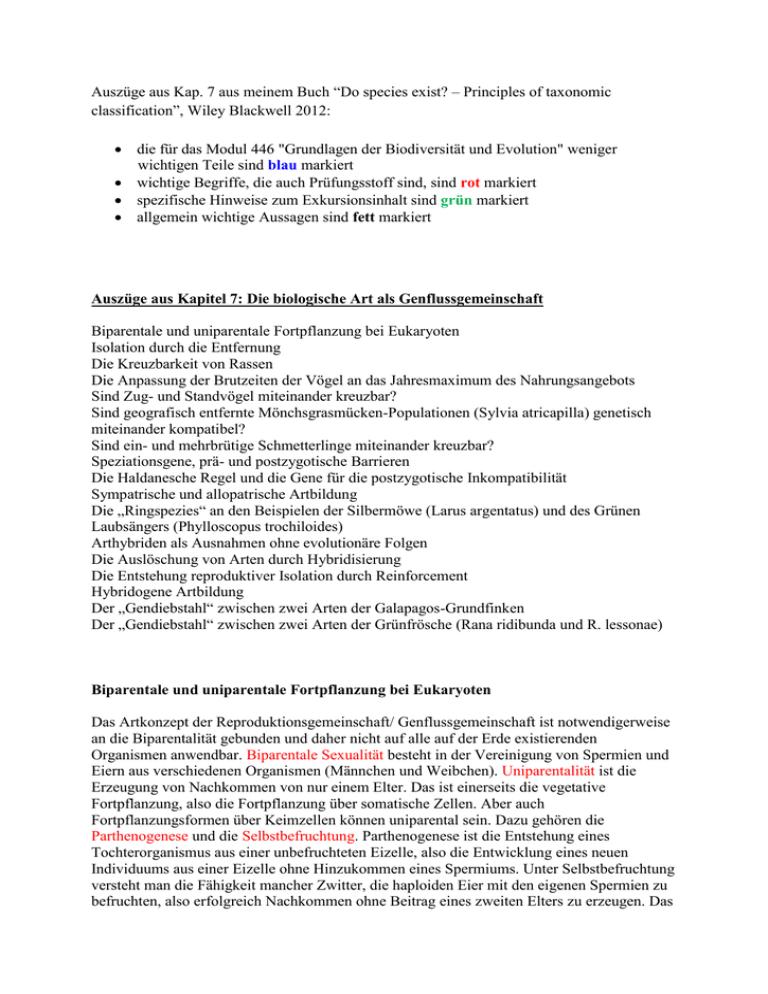
Auszüge aus Kap. 7 aus meinem Buch “Do species exist? – Principles of taxonomic classification”, Wiley Blackwell 2012: die für das Modul 446 "Grundlagen der Biodiversität und Evolution" weniger wichtigen Teile sind blau markiert wichtige Begriffe, die auch Prüfungsstoff sind, sind rot markiert spezifische Hinweise zum Exkursionsinhalt sind grün markiert allgemein wichtige Aussagen sind fett markiert Auszüge aus Kapitel 7: Die biologische Art als Genflussgemeinschaft Biparentale und uniparentale Fortpflanzung bei Eukaryoten Isolation durch die Entfernung Die Kreuzbarkeit von Rassen Die Anpassung der Brutzeiten der Vögel an das Jahresmaximum des Nahrungsangebots Sind Zug- und Standvögel miteinander kreuzbar? Sind geografisch entfernte Mönchsgrasmücken-Populationen (Sylvia atricapilla) genetisch miteinander kompatibel? Sind ein- und mehrbrütige Schmetterlinge miteinander kreuzbar? Speziationsgene, prä- und postzygotische Barrieren Die Haldanesche Regel und die Gene für die postzygotische Inkompatibilität Sympatrische und allopatrische Artbildung Die „Ringspezies“ an den Beispielen der Silbermöwe (Larus argentatus) und des Grünen Laubsängers (Phylloscopus trochiloides) Arthybriden als Ausnahmen ohne evolutionäre Folgen Die Auslöschung von Arten durch Hybridisierung Die Entstehung reproduktiver Isolation durch Reinforcement Hybridogene Artbildung Der „Gendiebstahl“ zwischen zwei Arten der Galapagos-Grundfinken Der „Gendiebstahl“ zwischen zwei Arten der Grünfrösche (Rana ridibunda und R. lessonae) Biparentale und uniparentale Fortpflanzung bei Eukaryoten Das Artkonzept der Reproduktionsgemeinschaft/ Genflussgemeinschaft ist notwendigerweise an die Biparentalität gebunden und daher nicht auf alle auf der Erde existierenden Organismen anwendbar. Biparentale Sexualität besteht in der Vereinigung von Spermien und Eiern aus verschiedenen Organismen (Männchen und Weibchen). Uniparentalität ist die Erzeugung von Nachkommen von nur einem Elter. Das ist einerseits die vegetative Fortpflanzung, also die Fortpflanzung über somatische Zellen. Aber auch Fortpflanzungsformen über Keimzellen können uniparental sein. Dazu gehören die Parthenogenese und die Selbstbefruchtung. Parthenogenese ist die Entstehung eines Tochterorganismus aus einer unbefruchteten Eizelle, also die Entwicklung eines neuen Individuums aus einer Eizelle ohne Hinzukommen eines Spermiums. Unter Selbstbefruchtung versteht man die Fähigkeit mancher Zwitter, die haploiden Eier mit den eigenen Spermien zu befruchten, also erfolgreich Nachkommen ohne Beitrag eines zweiten Elters zu erzeugen. Das ist bei Pflanzen häufig; bei Tieren selten. Ein bekanntes Beispiel für Selbstbefruchtung sind viele Bandwurmarten. Alle Organismen mit uniparentaler Fortpflanzung haben nicht den Zusammenhalt durch Männchen-Weibchen-Interaktion und können daher nicht unter den Begriff der Reproduktionsgemeinschaft fallen. Sie sind daher im Sinne des Artbegriffs der Genflussgemeinschaft artlose Organismen. Im Gegensatz zu den Bakterien lassen sich uniparentale Eukaryoten jedoch nach verschiedenen Kriterien ordnen, weil die verschiedenen Einteilungskriterien, etwa die genetische Distanz bestimmter DNA-Sequenzen oder die Ähnlichkeit bestimmter Merkmals, nicht wie bei Prokaryoten ständig durch lateralen Gentransfer ungeordnet vermischt werden. Daher sorgt die Selektion in bestimmten ökologischen Nischen bei vielen Eukaryoten über gewisse Zeiträume für eine gewisse Einheitlichkeit im Aussehen und in den sonstigen Eigenschaften und erlaubt eine Gruppenbildung. Diese Gruppenbildung reflektiert jedoch keine natürlichen Grenzlinien, sondern ermöglicht lediglich eine Untergliederung in abgegrenzte Einheiten, die durch den Menschen gemacht werden. Uniparentale Fortpflanzung liegt vor bei Pflanzen und Tieren mit Selbstbefruchtung (z.B. Gerste, Bohne, Erbse, Bandwürmer), bei Pflanzen und Tieren mit parthenogenetischer Fortpflanzung (z.B. Rotatorien, Wasserflöhe, Blattläuse, einige Eidechsen) und bei Pflanzen und Tieren mit vegetativer Fortpflanzung, also der Bildung von Tochterorganismen aus somatischen Mutterzellen (z.B. Hydrozoen, Leberegel). Bei Organismen mit uniparentaler Fortpflanzung ist es aus prinzipiellen, leicht verständlichen Gründen nicht möglich, den Artbegriff der Genflussgemeinschaft anzuwenden. Es gibt keine genetische Verbindung zwischen den einmal geborenen Organismen. Und konsequenterweise müsste hier jede Geburt eines Organismus als Speziationsereignis gewertet werden. Diese Konsequenz wäre jedoch eine absurde Begriffsbildung, da es ja das Wesen der Taxonomie ist, mehrere Organismen zu Gruppen zusammenzufassen. Organismen, die seit langen evolutionären Zeiten keine biparentale sexuelle Verbindung mehr zueinander hatten, haben keinen realen zwischenorganismischen Zusammenhalt in der Natur und müssen daher im Sinne der Genflussgemeinschaft als artlose Organismen bezeichnet werden. Es befriedigt den Taxonomen jedoch nicht, dass auf der Welt Organismen existieren, die als artlos bezeichnet werden müssen. Der Taxonom möchte die gesamte Vielfalt des Lebens klassifizieren und nicht nur einen Teil der Organismen. Die Natur ist jedoch nicht dazu geschaffen, vom Menschen klassifiziert zu werden. Die Suche nach realen Spezies, also solchen Einheiten, die in der Natur wirklich existieren, kann sich eher damit begnügen, dass nicht alle Organismen auch solchen Einheiten angehören müssen. Nur das Ordnungsbedürfnis zwingt uns, für alles und jedes einen Platz zu finden. Obwohl die uniparentale Fortpflanzung eine häufige Erscheinung unter den Lebewesen ist, kommt sie bei den meisten Organismen nur zeitweise im Lebenszyklus vor. Dauerhafte Uniparentalität scheint bei Eukaryoten selten zu sein, zumindest bei Tieren (Ghiselin 1997 5325). Dauerhafte Uniparentalität ist schwer nachweisbar, da eine gelegentlich auftretende biparentale Befruchtung nur bemerkt werden kann, wenn die Organismen über Jahre lückenlos unter Beobachtung stehen. Das ist kaum durchführbar. Bei einigen Tiergruppen mit Generationswechsel wechseln sich uniparentale und biparentale Fortpflanzungsphasen periodisch miteinander ab, so bei Hydrozoen und Leberegeln. Oder die beiden Fortpflanzungs- und Vermehrungsformen alternieren mit den ökologischen Bedingungen und richten sich nach den Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnissen der Umwelt, so bei den Rotatorien und Wasserflöhen. In diesen Fällen ist die Anwendung des Artkonzepts der Genflussgemeinschaft nicht in Frage gestellt. Es besteht zweifelsfrei ein kohäsiver Zusammenhalt der Organismen innerhalb der Spezies, auch wenn die Verbindung nur gelegentlich nach mehr oder weniger längeren Pausen in Erscheinung tritt, manchmal nur alle paar Jahre einmal. Die Zahl der eukaryotischen Organismen, die niemals biparentale Sexualität haben, scheint gering zu sein. Es ist sehr schwer, den Lebenszyklus parthenogenetisch lebender Tiere so lange und lückenlos zu verfolgen, dass das Vorkommen von Bisexualität gänzlich ausgeschlossen werden kann. Es ist immer möglich, dass sexuelle Stadien übersehen werden, besonders wenn sie jahrelang nicht auftreten. Selbst bei den diesbezüglich bekannten bdelloiden Rotatorien, die seit Jahrmillionen ohne biparentalen Sex leben sollen (Welch und Meselson 4838), kann das gelegentliche Auftreten miktischer Stadien nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden (Ghiselin 1997 5325). Bei den Vertretern der Rotatorienklasse der Bdelloidea wird die Auffassung vertreten, dass es seit vielen Millionen Jahren keine biparentale Sexualität mehr gegeben hat. Es gibt keine Männchen. Es werden nur Weibchen gefunden, die alle noch erkennbar diploid sind und deren homologe Allele in ungewöhnlich hohem Ausmaß in ihren DNA-Sequenzen voneinander abweichen. Aus dieser starken Heterozygosität wird geschlossen, dass es seit Millionen Jahren keine genetische Rekombination mehr gegeben hat, die dafür hätte sorgen können, dass sich die homologen Allele nicht allzu sehr auseinanderentwickeln. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Status der „Arbeiterinnen“ bei vielen staatenbildenden Hymenopterenarten (Bienen, Wespen, Ameisen). Diese sind steril, haben also keinen kohäsiver Zusammenhalt miteinander. Es ist wenig sinnvoll, aus der Sterilität der Arbeiterinnen der Hymenopteren, die auf jeden Fall Sackgassen des Genflusses sind, ein Artproblem zu machen. Das geht aus folgender Überlegung hervor: Man kann einen Bienenstock als „Superorganismus“ begreifen, bei dem die sich reproduzierende Königin Arbeiterinnen erzeugt, die zum Absterben verurteilt sind, ebenso wie somatische Zellen von der Keimbahn abgespalten werden (Tautz 2008 5850). Somatische Körperzellen haben mit Arbeiter-Bienen gemeinsam, dass es sich um nicht mehr reproduktionsfähige Endlinien der Entwicklung handelt. Alle Körperzellen sterben nach einer gewissen Lebenszeit ab. Sie setzen das Leben nicht mehr fort. Nur die Keimzellen leben weiter. Genauso ist es mit den sterilen Hymenopteren-Arbeiterinnen. Sie sterben, aber die Königinnen werden befruchtet und reproduzieren sich weiter. Es sollte kein so großer Unterschied zwischen einer ontogenetischen Zellgenealogie und einer Organismengenealogie gemacht werden. Es gibt im Tier- und Pflanzenreich viele fließende Übergänge von multizellulären Organismen bis zu Kolonien aus ganzen Organismen, die ähnlich zusammenhängen wie die Zellen in einem Einzelorganismus. Solche „Superorganismen“ sind z.B. die Tierstöcke, die bei vielen Hydrozoen und Korallen gebildet werden. Die nächst-höhere Stufe wäre dann der Insektenstaat. Biparentale Sexualität scheint ein uralter biologischer Prozess zu sein, der schon bei den gemeinsamen Vorfahren aller heute lebenden Eukaryoten entstanden ist und seitdem beibehalten wurde. Der Verlust bisexueller Fähigkeiten in bestimmten stammesgeschichtlichen Linien der Tiere und Pflanzen scheint auf lange evolutionäre Sicht in einer Sackgasse zu enden. Sexualität kann offenbar nicht neu erfunden werden. Es gibt keine Hinweise für die Neuentstehung von Sexualität in solchen Stammeslinien, die die Sexualität einmal verloren haben (Ghiselin 1997 5325). Isolation durch die Entfernung Geografisch weit voneinander entfernte Organismen können noch über Genfluss miteinander verknüpft sein, aber der Genfluss kann sehr schwach geworden sein. Man nennt dieses Phänomen „isolation by distance“, „Isolation durch die Entfernung“. Dieser Begriff muss deutlich vom Begriff der Allopatrie (siehe unten) unterschieden werden. Zwei Populationen werden dann als zueinander allopatrisch bezeichnet, wenn sie durch externe, meistens geografische Barrieren vollständig voneinander getrennt sind, so dass kein Genfluss zwischen ihnen mehr möglich ist. Ist der Genfluss zwischen zwei Populationen dagegen noch nicht vollständig abgebrochen, weil noch Verbindungen da sind, die jedoch zwischen den entfernten Populationen sehr schwach sein können, dann nennt man das „Isolation durch die Entfernung“ (Abb. 10a). Isolation durch die Entfernung ist eine problematische Sache, weil sich die Frage ergibt, ob die Organismen weit entfernter Populationen einer Art überhaupt noch miteinander kreuzbar sind. Es gibt darüber sehr wenige Untersuchungen. Die Merkmalsunterschiede zwischen entfernten Populationen können sehr groß geworden sein. In den vielen Fällen, wo sich dies in Form diagnostisch deutlich unterschiedener Typen zeigt, liegen Rassen vor. Rassen überschneiden sich in klinalen Übergangszonen, in denen sich die Organismen miteinander vermischen. Das legt nahe, dass die Kreuzbarkeit der Organismen auch über die Entfernung noch gegeben ist. Das muss aber nicht so sein. Die Verschiedenheit geografisch entfernter Organismen in vielen Merkmalen, meist in Form genetischer Adaptation an die andersartigen örtlichen Verhältnisse, legt nahe, dass die Kreuzbarkeit der entfernten Populationen trotz stufenweiser klinaler Übergänge entlang einer verbindenden Kette aufeinander folgender Populationen verloren gegangen ist. Es ist aber meist eine offene Frage, ob das stimmt. Ein Beispiel für die abnehmende Kreuzbarkeit der Organismen einer Art mit zunehmender Entfernung wurde schon in den vierziger und frühen fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem britischen Evolutionsforscher und Lepidopterologen E.B. Ford gefunden (Ford 5864, 5863). Ford zeigte am Beispiel des Schmetterlings Coenonympha tullia (Großes Wiesenvögelchen), dass bei zunehmender geografischer Entfernung der Populationen bei Kreuzungen die Anzahl fertiler Nachkommen abnimmt. Diese frühe Erkenntnis hätte eigentlich größeren Einfluss auf das Verständnis des Begriffs der Mayr’schen Reproduktionsgemeinschaft haben müssen, in dem Sinne, dass die Reproduktionsgemeinschaft eben nicht immer eine Gemeinschaft aus Organismen sein muss, die alle miteinander erfolgreich kreuzbar sind. Die Erkenntnisse Fords, wie auch die Befunde von Ehrlich und Raven über den Aktionsradius vieler Tiere und Pflanzen (Ehrlich and Raven 1969 5762), sind aber in der Folgezeit nicht viel beachtet worden. Ein weiteres deutliches Beispiel dafür, dass erfolgreiche Kreuzungen zwischen geografisch entfernten Populationen einer Art nicht mehr möglich sind, liegt in der „Ringspezies“ vor (Abb. 10b) (siehe unten). Hier sind die einzelnen Populationen über einen kontinuierlichen Genfluss über zahlreiche Zwischenpopulationen alle fruchtbar miteinander verbunden. Aber sie sind nicht mehr fruchtbar miteinander kreuzbar, wenn sie sich sekundär wieder aufeinanderstoßen. Ringspezies werden normalerweise als Ausnahmefälle betrachtet, weil es in der Tat selten ist, dass geografisch entfernte Populationen sich so ausbreiten, dass sie an einer Stelle der Erde wieder aufeinandertreffen. Die Ringspezies ist aber nichts weiter als der Spezialfall eines viel allgemeineren Phänomens. Das allgemeine Phänomen ist die Isolation durch die Entfernung (Abb. 10a), wobei hier die Auffassung vertreten wird, dass die entfernten Populationen genetisch oft nicht mehr miteinander kompatibel sind, obwohl die Verbindung über kontinuierlichen Genfluss noch gegeben ist. Entfernte Organismen scheinen oft nicht mehr miteinander kreuzbar zu sein, wenn das Verbreitungsgebiet der Art groß ist. Unter Kreuzbarkeit wird selbstverständlich eine langfristige stabile Kreuzbarkeit über viele Generationen verstanden, wobei die Nachkommen gegenüber den reinrassigen Nachkommen konkurrenzfähig sein müssen. Die Ringspezies ist keine besondere Form der Spezies, schon gar nicht eine „Superspezies“, sondern nichts weiter als die Besonderheit, dass hier die entfernten Populationen in der Natur aufeinandertreffen (Abb. R1b). Ansonsten scheint hier aber nichts anderes vorzuliegen als bei den meisten anderen weit verbreiteten Arten auch. Die Kreuzbarkeit von Rassen Lokale, in ihrer Merkmalsausstattung abweichenden geografische Populationen nennt man Rassen oder (synonym) Unterarten oder Subspezies (siehe Kap. 6). Die Entstehung von Rassen geht auf unterschiedliche Anpassungen an die jeweiligen Bedingungen zurück, die an verschiedenen geografischen Orten herrschen. Rassen entstehen, wenn die homogenisierenden Kräfte des Genflusses geringer geworden sind als die Kraft der Selektion, die zur Anpassung örtliche Gegebenheiten zwingt. Rassen sind demnach immer eine Angelegenheit geografischer Unterschiede. Arten, die nur in einem kleinen geografischen Verbreitungsareal leben, bilden meist keine Rassen aus, offenbar weil der Genfluss alle Angehörigen der Art oft genug erreicht und die ständige Rückkreuzung verhindert, dass Gruppen von Individuen mit beginnender separater Merkmalsausstattung ihre eigenen Entwicklungswege einschlagen. Arten mit ausgedehnter geografischer Verbreitung bilden dagegen fast immer Rassen aus. Aber es gibt Ausnahmen. Unter den Vögeln ist es interessanterweise der Kiebitz (Vanellus vanellus), der trotz seiner Verbreitung von Spanien über die gesamte Paläarktis bis an die ostasiatische Pazifikküste keine Rassen ausbildet (del Hoyo et al. 2007 4139). Bei den meisten Vogelarten sind aber viele Rassen vorhanden (Rensch 1951 5859). Bei den wenig beweglichen, weit verbreiteten Meisen (Paridae) gibt es besonders viele Rassen, bei der Kohlmeise (Parus major) z.B. 34 Subspezies zwischen Westeuropa und Ostasien. Rassen müssen immer diagnostisch unterschiedlich sein; sonst gibt es keine logische Berechtigung für eine Rassenbezeichnung, da der Rassenbegriff ein Begriff ist, der immer rein typologisch vorgenommen wird. Die diagnostischen Unterschiede können gering sein, wie bei einigen Rassen der Meisen. Subspezies können aber auch sehr unterschiedlich aussehen, wie z.B. beim Australischen Flötenvogel (Cracticus tibicen), die an verschiedenen Orten Australiens in mehr als zehn deutlich unterschiedlichen Federkleidern auftritt (Farbbild). Die rein typologische Definition des Rassebegriffs ist auch der Grund dafür, dass der Terminus „Rasse“ gegenüber den synonymen Begriffen „Unterart“ oder „Subspezies“ in diesem Buch bevorzugt wird. Durch die Bezeichnungen „Unterart“ oder „Subspezies“ kommt zu sehr zum Ausdruck, dass es Untergliederungen des Begriffs „Spezies“ sind. Die Spezies als Genflussgemeinschaft aber ist als real existierendes Ding ontologisch etwas ganz anderes als die nach Merkmalsäquivalenz rein typologisch vorgenommene Untergliederung der Spezies in Rassen. Rassen können nicht am selben Ort nebeneinander vorkommen, weil dann die gegenseitige Vermischung die einmal entstandenen Merkmalsunterschiede wieder rückgängig machen würde. Es ist dann die homogenisierende Kraft des Genflusses, die separate Entwicklungen immer wieder rückgängig macht. Und eben diese Kraft lässt mit zunehmender geografischer Entfernung nach und kann dann die Rassenbildung nicht mehr verhindern. Aus diesem Grund müssen Rassen sind also immer geografische Rassen sein (Paulus and Gack 1983 4359). Sollten Rassen trotzdem am gleichen Ort nebeneinander vorkommen, wie das zurzeit bei den Menschenrassen der Fall ist, so ist dies ein Zeichen sekundärer Einwanderung als Folge der Kolonialisierung und der Globalisierung. Viele Angehörige bestimmter Menschenrassen wohnen heute nicht mehr in ihren angestammten Gebieten. Der Zustand sympatrischen Vorkommens unterschiedlicher Rassen ist instabil und daher immer von kurzer Dauer. Es setzt sofort die Vermischung ein, und die Rassen verschwinden. Zurzeit leben blonde und schwarzhaarige Menschen an vielen Stellen der Welt nebeneinander. Sie sind aber in getrennten Regionen entstanden und erst danach wieder zusammengekommen. Sollte das Nebeneinander unterschiedlicher Rassen wegen angeborener Abneigungen oder tradierter Eheverbote fest und langfristig etabliert bleiben und dadurch die Vermischung verhindert werden, so muss man konsequenterweise von verschiedenen Arten sprechen, da der Genfluss zwischen ihnen abgebrochen ist. Die Unterbrechung des Genflusses, die zur Speziation führt, muss nicht unbedingt genetische Ursachen haben. Traditionen und unterschiedliche Erziehungen genügen, um Artschranken aufzubauen. Es gibt kein Argument gegen die Annahme, dass auch bestimmte Traditionen eine langandauernde Unterbrechung des Genflusses verursachen, wie das z.B. als Folge der Gebote bei bestimmten Religionen der Fall ist (Hackstein 1997 3628). Viele Merkmalsunterschiede zwischen den Rassen sind so stark (besonders bei geografisch weit entfernten Rassen), und sie betreffen außerdem auch so viele Merkmale gleichzeitig, dass es schwer verständlich ist anzunehmen, dass weit entfernte Rassen erfolgreich miteinander kreuzbar wären. Experimente dazu sind jedoch schwierig, weil der Erfolg einer solchen Kreuzung unter natürlichen Freilandbedingungen und über sehr viele Generationen hinweg geprüft werden müsste. Die Anpassung der Brutzeiten der Vögel an das Jahresmaximum des Nahrungsangebots Viele Tiere richten ihr jahresrhythmisches Verhalten darauf ein, dass sie ihren Nachwuchs zur Zeit optimalen Futterangebots aufziehen. Viele Vögel können ihre Jungen nur in einem kurzen Zeitraum von wenigen Wochen ernähren, weil in den übrigen Wochen des Jahres nicht genügend Insekten oder andere Beutetiere zur Verfügung stehen. In Europa fangen Eulen, Raben und viele Greifvögel schon unter sehr ungünstigen Außenbedingungen im Winter an zu brüten, um das Futterangebot für ihre Jungen im zeitigen Frühjahr optimal nutzen zu können; denn sie finden ihre Beute leichter, bevor sich die Bäume und Büsche zu belauben beginnen. Die Eleonorenfalken (Falco eleonorae), die auf einigen Mittelmeerinseln brüten, beginnen mit ihrem Brutgeschäft erst im Herbst, weil sie ihre Jungen von Kleinvögeln ernähren. Diese aber leben nicht im Brutgebiet der Falken, sondern erscheinen als europäische und westasiatische Zugvögel erst im später August und September auf den Inseln, wo sie sich während der Mittelmeerüberquerung erschöpft niederlassen und leicht erbeutet werden können. Die auslösenden Signale für die Paarung, die Eiablage und den Brutbeginn können bei diesen Vögeln nicht die Wetterverhältnisse, die Temperatur oder das Nahrungsangebot sein, weil sie die günstigen Bedingungen nicht zu der Zeit brauchen, wenn Balz, Eireifung oder Nestbau erfolgen müssen, sondern um Wochen später, wenn die Jungvögel ernährt werden müssen. Ein Vogel weiß natürlich zum Zeitpunkt des Nestbaues und Brutbeginns nicht, welches Nahrungsangebot ihm zur Verfügung stehen wird, wenn einige Wochen später seine Jungen ernährt werden müssen. Das Nahrungsoptimum kann nicht der Auslöser für bestimmte Verhaltensweisen, etwa den Brutbeginn sein, weil ein optimales Nahrungsangebot keine Bedeutung für den Beginn der Brut hat, sondern erst für die darauffolgende Periode der Jungenaufzucht. Erst das Füttern der Jungen erfordert ein hohes Nahrungsangebot. Woher wissen die Vögel also im Voraus, wann das sein wird? Viele Vögel werden durch die Länge des Tag-Nacht-Rhythmus gesteuert, der für sie der Zeitgeber ist, sich auf die Brut vorzubereiten. Das Balz- und Paarungsverhalten wird hormonal ausgelöst, ebenso die Oogenese, also die Eireifung, der Nestbau und viele weitere Verhaltensweisen. Die hormonale Steuerung jedoch ist genetisch verankert. Das Problem ist nun, dass viele Vogelarten ein weites Verbreitungsgebiet haben. Die Nahrungsoptima aber treten in unterschiedlichen geografischen Breiten und auch in unterschiedlichen vertikalen Höhenlagen in den Gebirgszonen zu recht unterschiedlichen Zeiten auf und sind daher überhaupt nicht mit irgendeiner konstanten Tag-Nacht-Länge korreliert. Die jahreszeitliche Veränderung der Tag-Nacht-Länge ist im Norden eine andere als im Süden. Die niedrigeren Temperaturen des Nordens zwingen die dort lebenden Vögel zu späteren Brutzeiten als im Süden, weil z.B. die Zeit des maximalen Insektenangebots im Norden eine ganz andere ist als im Süden. Die hormonale Auslösung der Eireifung und Eiablage muss bei Vogelpopulationen, die in nördlichen Breiten brüten, durch eine ganz andere Tag-Nacht-Länge gesteuert sein als bei mehr südlich brütenden Vögeln. Solche Differenzen in der hormonalen Steuerung müssen eine genetische Basis haben. Das Gleiche gilt für Vogelarten, deren Populationen sowohl in höheren Gebirgslagen brüten als auch in tieferen Tallagen. Die jahreszeitlich gekoppelte hormonale Steuerung des Nestbaus, der Eireifung und der Eiablage muss bei Gebirgsvogelarten, die in unterschiedlichen Höhenlagen brüten, genetisch unterschiedlich reguliert werden. Bei Blaumeisen (Parus caerulescens) [sehen wir im Bükk] auf der Insel Korsika wurde nachgewiesen, dass die in den sommergrünen Flaumeichenwäldern der höheren Gebirgslagen brütenden Vögel vier Wochen später brüten als ihre Artgenossen, die in den Tieflagen im immergrünen Steineichengürtel brüten (Blondel et al. 1999 4626). Die genetische Grundlage solcher unterschiedlicher lokaler Anpassungen ist mehrfach nachgewiesen worden. Organismen aus Populationen mit unterschiedlicher Aktivitätsphase im Jahr behalten diesen Rhythmus nach Verpflanzung an andere Orte bei (Schwöppe et al. 1998 5858). Sie passen sich nicht an die neuen Umweltbedingungen an. Z.B. wurden Exemplare des flugunfähigen Goldglänzenden Laufkäfers (Carabus auronitens) [sehen wir im Bükk] aus den Wäldern von Münster/ Nordrhein-Westfalen in nur ca. 80 km Entfernung in die Wälder des Sauerlands versetzt. Sie kommen an beiden Orten vor, haben aber jahreszeitlich sehr verschiedene Aktivitätsphasen. Nach der Versetzung behielten sie den Jahresrhythmus ihres Herkunftsgebietes bei, konnten also auf die Dauer nicht überleben. Aus solchen Experimente ergibt sich die dringende Frage, ob die geografisch unterschiedlichen Populationen miteinander erfolgreich kreuzbar sind. Es gibt darüber keine Untersuchungen, weder bei den Blaumeisen noch bei den Laufkäfern. Da die Anpassungen eine genetische Grundlage haben und da es sich um jeweils viele unterschiedliche Merkmale handelt, liegt die Vermutung nahe, dass die Kreuzung zu intermediären Mischtypen führen müsste. Solche Mischtypen dürften gegenüber den ortsansässigen Typen kaum eine Chance haben, dauerhaft zu konkurrieren. Falsche intermediäre Eiablage- und Brutzeiten müssten mit hoher Wahrscheinlichkeit das Resultat sein. Sind Zug- und Standvögel miteinander kreuzbar? Viele Vogelarten bestehen sowohl aus Zugvogelpopulationen als auch aus Standvogelpopulationen (siehe Kap. 6). Das ist sehr oft dann der Fall, wenn die Vögel ein großes Verbreitungsgebiet haben und sowohl im Norden Europas oder Asiens brüten als auch im Süden. Im Süden, z.B. im Mittelmeerraum, steht oft das ganze Jahr über ein ausreichendes Nahrungsangebot zur Verfügung. Daher können die Vögel im Winter im Brutgebiet bleiben und brauchen ihre Reviere nicht aufzugeben. Es sind Standvögel. Populationen derselben Art brüten jedoch auch im Norden. Hier herrscht im Winter Nahrungsknappheit, so dass die Tiere verhungern würden, wenn sie ihre Brutgebiete im Winterhalbjahr nicht verlassen würden. Es sind Zugvögel. Die meisten Zugvogelarten verlassen ihre Brutgebiete jedoch nicht zur Zeit der knapper werdenden Nahrung, sondern schon erheblich früher im Spätsommer. So wird erreicht, dass sie bei hereinbrechendem Winter rechtzeitig in den entfernten Winterquartieren sind. Schon daraus geht hervor, dass das Wegzugverhalten nicht umweltbedingt durch Hunger oder gar Kälte gesteuert sein kann, sondern durch genetische Faktoren, die z.B. auf die Tageslänge reagieren. Es gibt viele Gene, die die für das Zugverhalten notwendigen Eigenschaften steuern. Über diese Gene ist wenig bekannt (Berthold 1992 2589). Die Unterschiede in den Merkmalen zwischen Zug- und Standvögeln sind enorm. In Zugvögeln sind Gene aktiv, die zweimal im Jahr zum richtigen Zeitpunkt das instinktive Zugunruheverhalten steuern. Ein derartiges Verhalten tritt bei den Standvogelpopulationen derselben Vogelart nicht auf. Hinzu kommen die Gene, die die Zugrichtung und Zugweite steuern. Standvögel brauchen solche Genaktivitäten nicht. Zugvögel müssen vor dem Herbstzug gewaltige Fettreserven aufbauen, was wiederum eine komplexe Regulation des Stoffwechsels erfordert, der bei Standvögeln nicht gegeben ist. Auch anatomische Unterschiede sind nachweisbar. So haben Zugvögel andere Flügelproportionen als die nicht-ziehenden Populationen derselben Art (Rensch 1938 5860). Wie ist es vorstellbar, dass Organismen mit derartig unterschiedlichen Allelausstattungen miteinander kreuzbar wären? Da es sich um jeweils viele Merkmale handelt, entsteht die Frage, ob diesen vielen Merkmalen auch ebenso viel Gene zugrunde liegen. Wäre das der Fall, dann ist kaum vorstellbar, dass die residenten Populationen einer Vogelart mit den ziehenden Populationen derselben Art kreuzbar wären, weil die genetischen Inkompatibilitäten zu groß sind. Die vielen Gene, die für Zug- oder Standvogeleigenschaften verantwortlich sind, müssten rekombinieren. Die Allele für Zug- oder Standvogeleigenschaften müssten in den Hybriden genezisch entkoppelt werden, so dass Zugund Standvögel ein und derselben Vogelart nach der Kreuzung ein Gemisch an Merkmalen zeigen müssten. Sie müssten zum einen Teil die Zugvogeleigenschaften besitzen, zum anderen Teil die Standvogeleigenschaften. Experimentelle Kreuzungen haben in der Tat gezeigt, dass die Hybride aus Zug- und Standvögeln teilweise intermediäre Eigenschaften hinsichtlich der verschiedenen Merkmale aufweisen (Pulido et al. 2001 5779). Es ist daher naheliegend, die Annahme zu untersuchen, ob Zug- und Standvögel ein Beispiel für verschiedene Rassen sind, die durch die Distanz isoliert sind. Wie bei anderen Beispielen von „Isolation durch die Distanz“ (siehe oben) wären die genetischen Inkompatibilitäten zu groß, als dass die Hybride einen auf die Dauer konkurrenzfähigen Phänotyp ergeben könnten. Aber es gibt die Zwischenpopulationen in den klinalen Übergangsbereichen; und diese sind ein Problem. Wenn die genetische Ausstattung eines Zugvogels mit der eines Standvogel nicht kompatibel wäre, dann dürfte es auch keine allmählichen Übergänge geben. Diese aber gibt es. Im klinalen Übergangsbereich zwischen Zugvogelpopulationen und Standvogelpopulationen lebt die Population der sogenannten Teilzieher. Darunter versteht man Vogelpopulationen, die sowohl ziehende als auch sedentäre Organismen enthalten. Ein Teil der Vögel verlässt das Brutgebiet im Herbst, ein anderer Teil bleibt im Winter zu Hause. Und dieses Nebeneinander zweier Verhaltensweisen entspringt nicht der freien Entscheidung des jeweiligen Vogels, sondern es wird, zumindest bei den Langstrecken-Zugvögeln, die ohne elterliche Anleitung ziehen, ausschließlich genetisch gesteuert. Es gibt keine intermediären Individuen, die sowohl einige Gene der ziehenden Population als auch einige Gene der sedentären Population enthalten würden. Zug- und Standvögel kreuzen sich in den klinalen Mischpopulationen der Teilzieher offenbar problemlos. Wie kann das populationsgenetisch funktionieren? Einerseits handelt es sich um Organismen mit offenbar wechselseitig genetisch inkompatiblen Erbanlagen. Andererseits bilden die Mischpopulationen aber doch einen lebensfähigen Reproduktionsverband, der eben nicht überwiegend letale Mischlinge erzeugt. Zur Beantwortung dieser Frage fehlen die Kenntnisse über die genetischen Strukturen, die das Zugverhalten steuern. Die Teilzieher-Population bei den „echten“ Zugvögeln, den Langstreckenziehern, stellt offenbar einen stabilen Polymorphismus dar (siehe Kap. 6). Zug- und Standvögel in den geografisch entfernten Brutgebieten wären dann nicht Rassen, sondern es wären Morphen, die allerdings in den verschiedenen geografischen Vorkommengebieten eine ganz unterschiedliche allele Häufigkeitsverteilung aufweisen würden. Diese lokale geografische Adaptation ist dann zwar eine Analogie zur Rassenbildung, das Nebeneinander klarer Morphen bei der Kreuzung unterschiedlicher Typen aber widerspricht dem Rassebegriff. Rassen erzeugen im Falle der Kreuzung intermediäre Typen. Wie kann das Ausbleiben intermediärer Mischtypen bei der Kreuzung von Zug- und Standvögeln genetisch erklärt werden? Eine Denkmöglichkeit wäre es, das Phänomen Zugvogel/ Standvogel so zu erklären wie den Geschlechtsdimorphismus. Zweifellos gibt es bei den höheren Säugetieren hunderte von Merkmalsunterschieden zwischen Männchen und Weibchen, genauso wie es hunderte von Merkmalsunterschieden zwischen Zug- und Standvögeln gibt. Und trotzdem geht der Männchen/ Weibchen-Unterschied bei den höheren Säugetieren wie bei den meisten Tieren auf ein oder wenige Gene zurück, die sehr früh im Embryo eine ganz unterschiedliche Entwicklung einleiten, so dass im Endeffekt hunderte von Merkmalsunterschieden daraus resultieren. Diesen vielen Merkmalsunterschieden stehen selbstverständlich keine Kreuzungsbarrieren entgegen. Männchen und Weibchen sind miteinander kreuzbare Morphen, selbstverständlich keine Rassen. Es wäre ein interessanter Gesichtspunkt, das Phänomen Zugvogel/ Standvogel in analoger Weise zu interpretieren. Sind geografisch entfernte Mönchsgrasmücken-Populationen (Sylvia atricapilla) genetisch miteinander kompatibel? Eines der bestuntersuchten Beispiele für genetische Unterschiede zwischen entfernten Populationen ist die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla). [sehen wir im Bükk] Dieser kleine Singvogel ist von den Kapverdischen und Kanarischen Inseln über Spanien, Mittelund Nordeuropa bis Sibirien verbreitet. Auf den Kapverdischen und Kanarischen Inseln ist er Standvogel, im Mittelmeergebiet Teilzieher und in den übrigen Gebieten Zugvogel (siehe auch Kap. 6). Konsequenzen für die Artabgrenzung ergeben sich vor allem aus den vielen Kreuzungsversuchen von Peter Berthold (Pulido et al. 2001 5779). Westeuropäische Mönchsgrasmücken ziehen im Spätsommer von ihren Brutgebieten nach Südwesten und bleiben dann schon nach wenigen Zugtagen im Winterquartier in Spanien. Die Osteuropäer aber ziehen von ihren Brutgebieten nach Südosten und brauchen mehrere Wochen, um schließlich im Winterquartier in Ostafrika anzukommen. In Zuchtkäfigen durchgeführte Kreuzungsversuche haben nun ergeben, dass beide Merkmale, die Zugrichtung und die Zugdauer, erblich verankert sind und im Hybriden gemischt vererbt werden (Berthold and Querner 1981 2571). Der intermediäre Erbgang ist für den Artstatus unterschiedlicher Mönchsgrasmücken-Populationen ein Problem. Obwohl in der rezenten Literatur diskutiert wird, ob hier die ersten Anzeichen für eine beginnende Artbildung vorliegen (Rolshausen et al. 2010 5868), ergibt sich aus theoretischen Gründen schon seit langem der Verdacht, dass die Mönchsgrasmücken über ihren gesamten geografischen Verbreitungsraum aus mehreren, genetisch nicht miteinander kompatiblen Populationen bestehen könnten, denen der Artstatus zugesprochen werden könnte. Das Problem besteht darin, dass zwischen entfernten Populationen viele Unterschiede bestehen, deren genetische Kompatibilität kaum zu verstehen ist. Andererseits aber gibt es zwischen den Populationen fließende klinale Übergänge, die wiederum die Kompatibilität unter Beweis stellen. Es handelt sich hier um einen ungelösten Widerspruch. Die Problematik sei an folgendem Beispiel erläutert: Die am Bodensee in SW-Deutschland brütenden Mönchsgrasmücken und die am Neusiedler See an der österreichisch-ungarischen Grenz brütenden Mönchsgrasmücken leben nur ca. 600 km voneinander entfernt. Dennoch ziehen beide Populationen im Spätsommer in ganz unterschiedliche Himmelrichtungen. Die südwestdeutschen Mönchsgrasmücken ziehen nach Südwesten und bleiben dann schon nach wenigen Zugtagen im Winterquartier in Spanien. Dann schon lässt ihre Zugunruhe nach. Die südostösterreichischen Mönchsgrasmücken ziehen nach Südosten und brauchen mehrere Wochen, bis sie im Winterquartier in Ostafrika angekommen sind. Erst dann erlischt ihre Zugunruhe. Weder die Zugrichtung noch die Information über die Ankunft im endgültigen Winterquartier werden erlernt (siehe Kap. 6). Es handelt sich stattdessen um genetische Anlagen. Wie ist es möglich, dass solche Verschiedenheiten nach einer Kreuzung im F1-Hybriden zu einer verträglichen Allelkombination führen? Es scheint nicht möglich zu sein. Und dafür sprechen auch die Kreuzungsversuche. Große Zahlen an experimentell durchgeführten Kreuzungen zwischen an osteuropäischen mit westeuropäischen Mönchsgrasmücken haben gezeigt, dass dabei Mischeigenschaften herauskommen (Berthold und Querner 1981 2571). Die Hydride zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Mönchsgrasmücken zeigen teilweise die Zugeigenschaften der Südost-Zieher und teilweise die der Südwest-Zieher. Zwar wurde nicht verfolgt, wie sich solche Hybride in freier Natur verhalten, aber man müsste erwarte, dass solche Hybride ins falsche Winterquartier ziehen würden. Das wiederum würde bedeuten, dass zwischen westeuropäischen und osteuropäischen Mönchsgrasmücken eine klare postzygotische Barriere besteht. Sie dürften eigentlich nicht erfolgreich miteinander kreuzbar sein, weil die Nachkommen einer solchen Kreuzung nicht konkurrenzfähig wären. Dieser Erkenntnis aber widerspricht die Tatsache, dass die westeuropäischen mit den osteuropäischen Mönchsgrasmücken wahrscheinlich lückenlos verbunden sind. Daraus ergibt sich die Frage des Übergangs. Im Übergangsbereich leben Individuen, die durchaus miteinander kreuzbar sind. Es ist nicht leicht erklärbar, wie solche Organismen genetisch gesteuert sind. Es kann nicht sein, dass die Zugrichtung in den Organismen des klinalen Übergangs allmählich von Südwest nach Südost übergeht. Die Situation muss nach dem Entweder-Oder-Prinzip gelöst werden (siehe Kap. 6). Wenn es aber eine solche genetische Entweder-Oder-Lösung gibt, dann müssten auch die Organismen geografisch entfernter Populationen miteinander kreuzbar sein. Dann würde sich die Frage nach dem Artstatus erübrigen. Sind ein- und mehrbrütige Schmetterlinge miteinander kreuzbar? Ein ähnlicher Fall von unterschiedlichen geografischer Populationen, deren Kreuzbarkeit schwer zu begreifen ist, liegt bei ein- und mehrbrütigen Schmetterlingen vor. Aber auch hier sind die Grundlagen unbekannt, ähnlich wie bei den Zug- und Standvögeln. Viele Tagfalter bilden in Europa Populationen aus, die an die geografische Breitenlage angepasst sind. Sie bringen im südlichen Teil Europas jährlich zwei Generationen hervor (zweibrütig = bivoltin) und sind dort deswegen ziemlich häufig. In Nordeuropa haben die Falter derselben Art aber nur eine Generation (einbrütig = univoltin) und sind entsprechend seltener (Rensch 1951 5859). Diese Anpassung an die örtlichen Verhältnisse ist mit einer ganzen Reihe von Merkmalen verbunden, die genetisch verankert sind. Hauhechel-Bläulinge (Polyommatus icarus) [sehen wir im Bükk] in Schweden haben im Süden Populationen mit schnellerer Entwicklungsgeschwindigkeit als im Norden des Landes, weil sie im Süden zwei Generationen bewältigen müssen, während sie im Norden im Frühjahr und Sommer genug Zeit haben, um die Eientwicklung, das Raupen- und Puppenstadium abzuschließen, da sie nur eine Generation hervorbringen müssen. In Versetzungsexperimenten hat sich herausgestellt, dass diese Anpassungen genetischer Natur sind (Nygren et al. 2008 5855). Von Norden nach Süden verfrachtete Bläulinge änderten ihr Verhalten nicht, wenn sie in die andersartigen Umweltbedingungen eingegliedert wurden. Der Tag-Nacht-Rhythmus und die andersartigen Temperaturen im Süden vermochten die nördlichen Populationen nicht zur Zweibrütigkeit zu verleiten. Wie können die beiden Bläulingspopulationen genetisch miteinander kompatibel sein? Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) [sehen wir im Bükk] ist in Nordeuropa einbrütig. Im Laufe des Jahres schlüpft immer nur eine einzige Generation von Faltern (Imagines), deren Nachkommen dann als Puppen überwintern. In Mitteleuropa ist der Schwalbenschwanz meist zweibrütig. Die Imagines der ersten Generation fliegen im Mai, ihre Nachkommen verpuppen sich im Juni, und die Puppen schlüpfen noch im selben Jahr im Juli. Diese Falter sind die zweite Generation. Sie pflanzen sich im Juli fort, und erst die Puppen ihrer Nachkommen überwintern dann. Und noch weiter im Süden Europas fliegt der Schwalbenschwanz dann sogar in drei Generationen. Der Schwalbenschwanz ist nur im Puppenstadium diapausefähig. Das heißt, dass kein anderes Entwicklungsstadium, weder das Ei noch die Raupe noch der fertige Falter überwintern können. Das kann nur die Puppe. Daraus folgt, dass den Unterschieden zwischen Ein-, Zweiund Dreibrütigkeit genetische Unterschied zugrunde liegen müssen. Es kann nicht einfach durch die Temperatur oder andere Außenfaktoren gesteuert werden, ob bei nördlichen Tieren noch eine zweite oder dritte Brut stattfindet. Denn wenn sich die Schwalbenschwanzpuppen der zweibrütigen Population in Mitteleuropa im August in einem warmen Jahr wegen der Witterung „entscheiden“ würden, eine dritte Generation hervorzubringen und nun noch einmal zu schlüpfen anstatt auf den Winter zu warten, so bestünde die Gefahr, dass die Raupen dieser dritten Generation bei einem Kälteeinbruch im September es nicht mehr schaffen würden, erfolgreich bis zur Verpuppung zu kommen. Sie müssten dann als Raupen überwintern. Und das können sie nicht. Sie würden umkommen, und im Extremfall würden in Mitteleuropa sämtliche Schwalbenschwänze aussterben. Würde die Erzeugung einer dritten Brut bei Schwalbenschwänzen in Mitteleuropa eine Verhaltensweise sein, die allein durch die Umweltbedingungen ausgelöst wird, so würde das eine nicht unerhebliche Gefahr in sich bergen. Trotzdem beobachtet man aber in Mitteleuropa in besonders warmen Sommern dreibrütige Schwalbenschwänze. Wie kann dies erklärt werden? Vermutlich handelt es sich um einen genetischen Polymorphismus, der es einigen, aber nicht allen Schwalbenschwänzen erlaubt, ein drittes Mal im Jahr aus der Puppe zu schlüpfen. Da nicht alle Individuen von den Eigenschaften der Dreibrütigkeit betroffen sind, bleibt die Art als Ganzes erhalten. Es könnte sich bei den ein-, zwei- und dreibrütigen Schwalbenschwänzen allerdings auch um Rassenunterschiede handeln. Dann wären die in besonderen Jahren in Mitteleuropa auftretenden dreibrütigen Schwalbenschwänze Zuwanderer aus Südeuropa. Ob es nun Rassen oder Morphen sind; in beiden Fällen entsteht die Frage, ob und wie ein- und mehrbrütige Populationen miteinander erfolgreich und dauerhaft kreuzbar sein können. Speziationsgene, prä- und postzygotische Barrieren Die reproduktive Inkompatibilität ist das Resultat der Unverträglichkeit bestimmter Gene (Wu et al. 1998 4096). Da der weitaus größte Teil aller Gene des Genoms nichts mit der Anpassung an spezifische Habitate und Klimate zu tun hat, ist die reproduktive Unverträglichkeit nicht die selbstverständliche Folge der evolutionären Auseinanderentwicklung, also der räumlichen und zeitlichen Entfernung der Populationen zueinander. Keine biologische Gesetzmäßigkeit zwingt zu der Vorstellung, dass stammesgeschichtlich weit voneinander entfernte Populationen „automatisch“ reproduktiv unverträglich sein müssen. Stattdessen ist die reproduktive Unverträglichkeit das Resultat der Inkompatibilität ganz spezifischer Gene, deren Zusammentreffen zu Einschränkungen der Lebensfähigkeit oder Fruchtbarkeit führt. Die genetische Inkompatibität zwischen zwei Genomen ist nicht zwangsläufig die Folge der Divergenz zwischen zwei Populationen im Allgemeinen. Dafür sprechen auch einige Beispiele der uneingeschränkten Hybridisierung stammesgeschichtlich weit entfernter „Arten“. Es muss nicht immer so sein, dass Populationen, die (meist allopatrisch bedingt) lange Zeit voneinander getrennt waren, nicht mehr genetisch miteinander kompatibel sind, wenn sie sekundär wieder zusammenkommen. Dazu wird unten das Beispiel der Neuwelt- und Altwelt-Ruderente (Oxyura jamaicensis und Oxyura leucocephala) im Detail erläutert. Es wäre zu einfach, die Situation so zu interpretieren, dass sich im Fall der reproduktiven Unverträglichkeit die beiden Populationen halt „weit genug“ gegenseitig auseinander entwickelt hätten, so dass sie genetisch nicht mehr miteinander kompatibel sind. Für die reproduktive Unverträglichkeit sind stattdessen bestimmte Gene verantwortlich. Das sind die „Speziationsgene“. Es sind Gene, deren Mutation bewirkt, dass die davon betroffenen Organismen sich aus dem Verband der Genflussgemeinschaft, der sie angehören, herauslösen und eine eigene Genflussgemeinschaft bilden. Speziationsgene sind Gene, die das Splitting der Spezies verursachen. Es ist eine wichtige Aufgabe der modernen Populationsgenetik und auch der Taxonomie, solche Gene zu finden (Wu et al. 1998 4096). Es gibt prä- und postzygotische Speziationsgene. Präzygotische Speziationsgene sind solche, die für präzygotischen Barrieren verantwortlich sind. Entsprechend sind postzygotische Speziationsgene für postzygotischen Barrieren verantwortlich. Unter einer präzygotischen Barriere versteht man morphologische, physiologische oder Verhaltensmerkmale, die verhindern, dass es zwischen zwei Organismen zur Zygotenbildung kommt. Dazu gehören Gefieder- und Gesangsmerkmale bei Vögeln, die der Partnererkennung dienen und die Paarungsbereitschaft fördern. Dazu gehören aber auch Strukturmerkmale des Kopulationsapparates, z. B. bei vielen Insekten, oder Signallockstoffe, die die erfolgreiche Verschmelzung von Spermien mit Eiern ermöglichen und damit zur Zygotenbildung führen, wie z.B. bei der äußeren Befruchtung. Präzygotische Speziationsgene bewirken assortative Paarung, also die selektive Auswahl des Sexualpartners aus einer bestimmten Population und die gleichzeitig bestehende sexuelle Abneigung gegenüber den Mitgliedern einer anderen Population. Demgegenüber versteht man unter einer postzygotischen Barriere Merkmale, die verhindern, dass der bereits entstandene Nachkomme einer Hybridisierung in seiner Vitalität und/ oder Fertilität mit den reinrassigen Nachkommen der Elternarten effektiv konkurrieren kann. Dazu gehören viele Merkmale, die eine koordinierte Embryonalentwicklung möglich machen, aber auch Verhaltensmerkmale, die z.B. im Arthybriden intermediär ausgeprägt sind. Sie sind weder exakt der einen Elternart noch der anderen Elternart zuzuordnen und verhindern dadurch eine erfolgreiche Paarung. Postzygotische Speziationsgene sind Gene, die sich erst nach der bereits erfolgten Hybridbildung bemerkbar machen. Die Haldanesche Regel und die Gene für die postzygotische Inkompatibilität Schon vor mehr als 80 Jahren entdeckte der britische Genetiker Haldane eine bemerkenswerte Tatsache. Wenn zwei Arten miteinander gekreuzt werden, dann machen sich die postzygotischen Defizite in den Hybriden der F1-Generation viel stärker im heterogametischen Geschlecht bemerkbar als im homogametischen. Das heterogametische Geschlecht ist das Geschlecht, das anstelle von zwei X-Chromosomen die X/Y-Konstellation besitzt, oder die X/0-Konstellation. Deswegen erzeugt das heterogametische Geschlecht durch die meiotischen Reduktionsteilung zwei unterschiedliche Sorten von reifen Keimzellen: zur Hälfte sind es X-Gameten, zur anderen Hälfte sind es Y- oder 0-Gameten. Deswegen spricht man vom heterogametischen Geschlecht. Meistens sind dies die Männchen. In einigen Tiergruppen (die bekanntesten Beispiele sind die Vögel und die Schmetterlinge) sind es aber auch die Weibchen, die das heterogametische Geschlecht ausmachen. In letzterem Fall werden die Geschlechtschromosomen anders benannt: Sie heißen nicht X- und YChromosom, sondern Z- und W-Chromosom. Die Einführung dieser zusätzlichen Termini ist überflüssig und erhöht die Begriffsverwirrung, da die Geschlechtschromosomen genetisch dieselbe Bedeutung haben, ob sie nun im Männchen oder im Weibchen vorkommen. Haldane entdeckte, dass bei Artkreuzungen die X/Y-Söhne eher Störungen aufweisen als die homogametischen X/X-Töchter. Diese Entdeckung ist als „Haldanesche Regel“ in die Biologie eingegangen. Es war dann der amerikanische Genetiker Muller, der die Regel in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgriff und eine plausible einfache Erklärung dafür anbot. Weil der heterogametische Nachkomme von dem einen Elternteil einen vollen Autosomensatz und ein X-Chromosom ererbt, vom anderen Elter aber entweder gar kein Geschlechtschromosom (im Falle des X/0-Typs) oder nur das Y-Chromosom, das wenig Gene enthält (im Falle des X/Y-Typs), käme es zu einem Ungleichgewicht zwischen den autosomalen Genen und den geschlechtschromosomalen Genen. Die Autosomen sind halb und halb von beiden Elternarten, die Geschlechtschromosomen stammen dagegen vollständig oder fast vollständig von nur einer Elternart. Dieses Ungleichgewicht wurde die XAutosomen-Disharmonie des heterogametischen Hybriden genannt und diente ein halbes Jahrhundert lang zur Erklärung der Haldaneschen Regel. Die X-Autosomen-Disharmonie galt als einleuchtende Deutung für die postzygotischen Defizienzen in den Nachkommen von Artkreuzungen. Und wieder einmal zeigte sich in der Geschichte der Biologie etwas, das den Naturwissenschaftler sehr beunruhigen muss: Mullers X-Autosomen-Disharmonie-Hypothese überzeugte allein wegen ihrer Einfachheit und Plausibilität, nicht wegen ihrer experimentellen Stützung. Erst nach Jahrzehnten wurde die generelle Gültigkeit der Haldaneschen Regel durch neue Beobachtungen und Experimente widerlegt. Die Beobachtungen und Experimente geschahen mit simpler Technik. Zunächst wurde festgestellt, dass die ganze Sache weitaus komplexer ist. Erstens wirkt sich die Haldanesche Regel eher auf die Fertilität als auf die Vitalität aus. Der Hybridnachkomme ist viel eher steril als dass seine Lebenskraft geschwächt wäre. Zweitens sind die heterogametischen Söhne (X/Y-Konstitution) deutlich stärker in ihrer Fertilitätsminderung betroffen als die heterogametischen Töchter (Z/W-Konstitution) (Wu et al. 1998 4096). Letzteres dürfte nach dem einfachen Verständnis der Mullerschen Erklärung nicht sein. Aber noch schlagkräftiger wurde die allgemeine Gültigkeit der Haldaneschen Regel durch ein einfaches Experiment an Drosophila widerlegt. Es ist mit einem simplen genetischen Trick gelungen, weibliche F1-Arthybriden herzustellen, die beide X-Chromosomen nur von der einen Elternart erhalten haben. Damit haben diese Töchter das gleiche X-AutosomenUngleichgewicht wie die F1-Söhne. Trotzdem waren die Töchter teilweise durchaus fertil, während ihre Brüder voll steril waren (Wu et al. 1998 4096). Die Gültigkeit der Haldaneschen Regel ist durch diese Beobachtungen und Experimente jedoch nicht vollständig widerlegt. Man muss beachten (und diese Überlegung hätte eigentlich nahe liegen müssen), dass die drei phänotypischen Folgen der postzygotischen Hybridinkompatibilität durch unterschiedliche Gene gesteuert werden. Es sind nicht dieselben Gene, die die Lebenstüchtigkeit (Vitalität), die Funktion der männlichen Geschlechtsorgane und die Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane regulieren. Alle drei Genkomplexe müssen nicht zwangsläufig gleichermaßen vom X-Autosomen-Ungleichgewicht betroffen sein. In der Tat hat sich herausgestellt, dass besonders die Gene, die die männliche Spermatogenese steuern, einer besonders raschen evolutiven Veränderung unterworfen sind. Die Gene für männliche Fertilität sollen einer zehnmal schnelleren Evolutionsgeschwindigkeit unterliegen als die Gene für weibliche Fertilität (Wu et al. 1998 4096). Auch verändern sich die Gene der männlichen Fertilität rascher als die Gene, von denen (bei beiden Geschlechtern) die Vitalität abhängt. Dennoch: Über die Gene, die die postzygotische Unverträglichkeit verursachen und die damit in vielen Fällen erste Ursache der Artbildung sind, wissen die Biologen fast nichts (Orr 2009 5837). Wandeln sich wenige oder viele Gene, wenn sich ein Organismus an eine neue Umwelt anpasst? Lassen sich die betreffenden Gene identifizieren? Beteiligen sich bei Anpassungen an eine neue Umwelt die gleichen Gene, wenn solche Anpassungen in verschiedenen Populationen mehrmals unabhängig voneinander stattfinden? In den vergangenen Jahren sind von Evolutionsgenetikern etwa ein halbes Dutzend Gene bestimmt worden, die bei Hybriden Sterilität oder mangelnde Lebensfähigkeit verursachen. Diese Gene haben meist ganz normale Aufgaben, teils völlig unterschiedlicher Art. Sie sind nicht von vornherein daran zu erkennen, dass sie Einfluss auf die Lebenstüchtigkeit oder die Fruchtbarkeit nehmen. Manche dieser Gene kodieren für Enzyme, andere für Strukturproteine, einige bringen auch Proteine hervor, die sich an die DNA binden und dort Funktionen ausüben. Alle diese Gene zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie sich extrem schnell auseinanderentwickelt haben (Orr 2009 5837). Bei Drosophila wurde ein Gen des Kernporenkomplexes als Ursache für Hybridsterilität identifiziert. Der Kernporenkomplex ist eine Struktur in der Membran des Zellkerns und dient der Kontrolle beim Prozess der Einund Ausschleusung von Makromolekülen. Der Kernporenkomplex setzt sich aus vielen verschiedenen Proteinen zusammen, die mit hoher Geschwindigkeit co-evolvieren. Daher die schnelle Inkompatibilität, wenn sie aus unterschiedlichen Genpools kommen (Tautz 2009 5838). Sympatrische und allopatrische Artbildung Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten, dass sich zwei Organismen nicht miteinander kreuzen können. Entweder sie leben zusammen, aber es besteht eine präzygotische Barriere zwischen ihnen (siehe oben), die eine erfolgreiche Zygotenbildung verhindert. Oder sie leben an getrennten Orten und können sich daher gar nicht begegnen. Die erste Situation nennt man eine sympatrische Verbreitung, die andere eine allopatrische Verbreitung. Die Unterschiede zwischen beiden Formen der Trennung sind enorm. Denn wenn zwei Organismen zusammen leben und sich trotzdem nicht verpaaren, dann müssen sie Eigenschaften besitzen, die diese Verpaarung verhindern. Wenn sich die Organismen dagegen überhaupt nicht begegnen können, dann braucht es auch überhaupt keine präzygotischen Kreuzungsbarrieren zu geben. Die Organismen zweier verschiedener Arten, die in Sympatrie leben, sind durch intrinsische Merkmale ausgezeichnet, die die Zygotenbildung verhindern. Allopatrisch verbreitete Organismen dagegen haben solche Merkmale nicht, weil sie biologisch gar keinen Sinn machen würden. Der wechselseitigen Paarung stehen nur externe Schranken entgegen, und das sind keine Eigenschaften, die die Organismen selbst besitzen. Solche externen Barrieren sind häufig, aber nicht immer, geografischer Natur. Es können Ozeane, Gebirge, Flüsse oder auch nur Autobahnen sein, die das Zusammenkommen der getrennt lebenden Organismen verhindern. Bei einigen Rüsselkäfern und Nematoden kann es aber auch die lebenslange Eingeschlossenheit in einer Wirtspflanze sein, der die Begegnung mit anderen Organismen verhindert (McCoy 2003 5169). Diese Tiere verbringen ihre gesamten Lebenszyklen innerhalb ein und derselben Futterpflanze, ohne diese jemals verlassen zu können. Auch das sind Beispiele für externe Ursachen für die Trennung, die jedoch nichts mit einer geografischen Trennung zu tun haben. Diese Form der Trennung ist auch eine Allopatrie, wenn auch nicht über eine geografische Barriere. In jedem Fall von Allopatrie aber beruht die Nicht-Kreuzung nicht auf den Eigenschaften der Organismen selbst, sondern auf äußeren Barrieren. Die Organismen selbst haben dann also gar keine „Trennungseigenschaften“ in sich. Solche können sich allenfalls zufällig entwickeln. Sympatrische und allopatrische Trennung sind also etwas ganz Unterschiedliches. Entsprechend unterschiedlich sind die Mechanismen der sympatrische Artbildung von denen der allopatrischen Artbildung: (1) sympatrische Artbildung ist die Entstehung zweier neuer Arten unter Konkurrenz und durch die Kontrolle der Selektion am selben Ort, und (2) allopatrische Artbildung ist die Artbildung durch Zufall infolge der genetischen Drift an voneinander isolierten Orten. Zur sympatrischen Artbildung kann es dann kommen, wenn die Geschlechtspartner neue Präferenzen für bestimmte Merkmale entwickeln, an denen sie sich für die Fortpflanzung erkennen und auswählen. Weibchen mit bestimmten, neu aufgetretenen Ansprüchen an die Eigenschaften ihres männlichen Partners und die entsprechenden Männchen, die diesen Ansprüchen entsprechen, können sich als eigene Art abspalten. Das ist sympatrische Artbildung aufgrund sexueller Präferenz. Eine weitere Möglichkeit ist die Absonderung einiger Organismen in eine neue ökologische Nische, die neue Ressourcen eröffnet und damit eine vorteilhafte Anpassung bedeutet, z.B. wenn monophage Käfer auf eine neue Futterpflanze überwechseln. Damit es in diesem Fall zur Artbildung kommt, muss parallel dazu auch die entsprechende selektive Partnerwahl entstehen, damit die Erschließung der neuen ökologischen Nische nicht durch Rückkreuzung mit den Organismen der alten Futterpflanzenpräferenz wieder rückgängig gemacht wird. Wenn also innerhalb einer Art A einige Individuen eine neue Futterpflanze erobern und künftig auf diese neue Pflanze angewiesen sind, dann können sie nur dann zur neuen Art B werden, wenn auch gleichzeitig eine assortative Paarung gewährleistet ist, die dafür sorgt, dass die B-Organismen sich nur noch mit den B-Organismen paaren und nicht mehr mit AOrganismen. Sympatrische Artbildung, also sexuelle Selektion und/ oder adaptive Habitat-Einnischung, ist das exakte Gegenteil des allopatrischen Paradigmas, weil die Selektion die treibende Kraft ist und nicht der Zufall einer allopatrischen Trennung. Die Errichtung von Kreuzungsbarrieren bei sympatrischer Artbildung steht unter hohem Selektionsdruck, um die WiederVermischung der sich trennenden Populationen zu verhindern. Allopatrische Artbildung ist dagegen reiner Zufall. Wenn hier die Populationen verschieden werden, dann hat die Selektion kein „Interesse“ daran, präzygotische Kreuzungsbarrieren zu errichten, weil sich die verschieden gewordenen Populationen ohnedies nicht begegnen. Allopatrische Artbildung braucht daher im Allgemeinen lange Zeit (Orr 2009 5837), während sympatrische Artbildung eine Sache von nur wenigen Generationen sein kann, da sie durch positive Selektion gefördert wird. Falls sich die allopatrisch getrennten Populationen später wieder begegnen sollten, dann können die in Allopatrie zufällig entstandenen Unterschiede ein Hindernis bei der Wiederverpaarung sein. Sie müssen es aber nicht. Wegen der Bedeutung der Rolle, die die Selektion spielt, ist sympatrische Artbildung wahrer Darwinismus (Tautz 2009 5838). Die Selektions-geförderte Anpassung an bestimmte Habitate spielt eine zentrale Rolle. Entscheidend für die sympatrische Artbildung ist die assortative Paarung. Unter assortativer Paarung versteht man eine Partnerwahl, die bestimmte Geschlechtspartner gegenüber anderen bevorzugt. Die Partner müssen in ihren Signalen den gegenseitigen Wunschvorstellungen entsprechen. Das alles führt zurück zu Darwin. Sympatrische Speziation bedeutet, dass die homogenisierende Kraft des Genflusses zwischen den Organismen einer bestehenden Genflussgemeinschaft durch andere Kräfte überwunden wird: durch (1) ökologische Anpassung und durch (2) sexuelle Selektion. (1) Neue Nischen bieten einen Selektionsvorteil für eine neue Gründerpopulation, wenn die alten Habitate vollständig besetzt sind. (2) Wenn eine neue Ressource besiedelt wird, bietet das aber nur dann einen Selektionsvorteil, wenn die Organismen Sexualpartner mit derselben Adaptation finden. Daher muss sich co-evolutiv zur neuen Habitateinnischung auch die assortative Partnerwahl entwickeln. Da die Partnerwahl von spezifischen Signalen abhängt, kann die Eroberung neuer Nahrungsressourcen und die damit kombinierte Absonderung dieser Organismen über neu entwickelte gegenseitige Partnererkennungsmerkmale sofort einen Genpool splitten. Demgegenüber ist die allopatrische Artbildung das Ergebnis einer genetischen Drift. Die Theorie der allopatrischen Speziation beruht auf einem doppelten Zufall. Erstens beruht sie auf der Annahme einer zufälligen Trennung zweier Populationen, die durch extrinsische Kräfte verursacht worden ist, und zweitens auf der Annahme, dass sich im Laufe des allopatrischen Lebens Mutanten zufällig akkumulieren, die zur genetischen Inkompatibilität führen. Keiner dieser beiden Zufälle ist auf einer quantifizierbaren wissenschaftlichen Theorie gegründet. Das allopatrische Paradigma ist keine wissenschaftliche Theorie. Es ist nichts weiter als die In-Worte-Kleidung eines ad-hoc-Konzepts (Tautz 2009 5838). Die Theorie der allopatrischen Speziation hat Folgeerscheinungen, die nicht so ohne weiteres mit dem heutigen Wissen über Artbildung in Übereinstimmung zu bringen sind. Z.B. müssten nach dem allopatrischen Paradigma der Artbildung solche Populationen, die (zufällig) niemals extern getrennt werden, „ewig“ erhalten bleiben und niemals eine Speziation machen, weil es ohne geografische Aufspaltung zu keinem Split kommen kann. (Bei dieser Überlegung werden anagenetische Merkmalsveränderungen selbstverständlich nicht als Speziation gewertet; siehe Kap. 8). Zweitens erklärt die Theorie der allopatrischen Speziation nicht, warum es bei einigen Tiergruppen rasche Artbildung gibt, bei anderen Tiergruppen aber nicht, auch wenn diese prinzipiell die gleiche Chance haben müssten, durch externe Faktoren in isolierte Gruppen zerrissen zu werden. Z.B. haben die Cichliden der afrikanischen Seen in einigen zehn- bis hunderttausend Jahren in jedem See, in dem sie vorkommen, zehn bis mehrere hundert Arten gebildet, die Angehörigen anderer Fischfamilien in denselben Seen aber nicht (Verheyen et al. 2003 5360). Daraus geht klar hervor, dass die Fähigkeit zur Artbildung auch auf genetischen Faktoren beruht, die den jeweiligen Tiergruppen eigen sind. In diesen Fällen beruht Artbildung eben nicht auf der Trennung durch externe Faktoren, sondern auf einer genetischen Potenz, die den verschiedenen Tiergruppen im unterschiedlichen Maße gegeben ist. Auch erklärt das Paradigma der allopatrischen Artbildung nicht, warum die Käfer so artenreich sind, obwohl die meisten Arten flugfähig sind und daher viele externe Barrieren eigentlich überwinden können müssten. Der angeblich so große Artenreichtum der Käfer muss jedoch mit etwas Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Heute werden in der Ordnung der Coleopteren (Käfer) 400 000 Arten unterschieden. Das wäre die artenreichste Ordnung des Tierreichs. Jedoch beruht ein Großteil dieser Artabgrenzungen auf typologischen Merkmalsunterschieden, die oft nur an einer geringen Zahl von gefundenen und untersuchten Organismen ermittelt wurden. Es kann daher oft nicht ausgeschlossen werden, dass die an den wenigen Exemplaren vorgefundenen Merkmalsunterschiede lediglich Unterschiede in der allelen Häufigkeitsverteilung der Merkmale zwischen verschiedenen Populationen sind. Damit könnte es sich bei geografisch entfernten Gruppen in einigen Fällen nicht um unterschiedliche Arten handeln, sondern lediglich um lokale Populationen oder Rassen, wie bei verschiedenen Populationen des Menschen der Fall ist, die sich durch unterschiedliche Häufigkeitsverteilung ihrer Blutgruppen unterscheiden. Oder es könnte sich um Morphen handeln, wie etwa bei den unterschiedlichen Phänotypen der Schmetterlinge Papilio dardanus oder Zygaena ephialtes (siehe Kap. 6). Abgrenzungen im Genfluss sind zwischen den meisten Käferarten nicht untersucht worden. Die „Ringspezies“ an den Beispielen der Silbermöwe (Larus argentatus) des Grünen Laubsängers (Phylloscopus trochiloides) Das Problem mit der eventuellen Nicht-Kreuzbarkeit entfernter MönchsgrasmückenPopulationen (Sylvia atricapilla) ist ein Beispiel für das Phänomen der „Isolation durch die Entfernung“ (siehe oben). Die Vermutung, dass Organismen geografisch entfernter Populationen nicht erfolgreich miteinander kreuzbar sein könnten, findet Unterstützung durch eine bestimmte Erscheinung, die seit langem in der Biologie bekannt ist. Es gibt bei Pflanzen und Tieren viele Beispiele für das Vorliegen von „Ringspezies“. Eine Ringspezies ist eine Gruppe von Populationen, von denen einige miteinander reproduktiv kompatibel sind, andere aber nicht. Das kann folgendermaßen aussehen: Eine Art ist etwa in Europa entstanden, hat sich dann nach Osten über Nordasien ausgebreitet, ist dann über die Behringstrasse nach Nordamerika eingewandert, und trifft schließlich über den Nordatlantik wieder in Europa mit der Ursprungspopulation zusammen. Dann können alle Populationen von Westen nach Osten reproduktiv miteinander verbunden sein, verhalten sich also wie die Angehörigen ein und derselben Art, die aus Nordamerika ostwärts nach Europa eingewanderte Population ist dann aber in Europa mit der ursprünglichen europäischen Population nicht mehr kreuzbar, sondern verhält sich dort wie eine fremde Art. Die Isolation über die Entfernung hat die Populationen immer mehr „entfremdet“, und der Genfluss ist zu schwach geworden, um dies wieder rückgängig zu machen. Schließlich sind die genetisch inkompatibel gewordenen Populationen aber wieder aufeinandergestoßen, und an der Kontaktzone zeigt sich dann, dass die ursprünglich weit entfernten, nun aber wieder miteinander in Kontakt geratenen Populationen in der Tat auch unter den dort gegebenen natürlichen Bedingungen nicht mehr erfolgreich miteinander kreuzbar sind. Am Beispiel einer solchen geografisch ringfömigen Populationskette, die die Polarregion oder andere unbewohnbare Gebiete wie Gebirge oder Wüsten umrundet, wurde der Terminus „Rassenkreis“ eingeführt (Rensch 1947 4823). Dieser Begriff hat sich aber nicht durchgesetzt. Er ist dem Begriff „Ringspezies“ gewichen. Als klassisches Beispiel für eine solche Ringspezies galt lange Zeit die Silbermöwe (Larus argentatus) (Abb. aus Liebers et al. 2004 5345). Folgende Hypothese wurde vertreten: Die Silbermöwe hat sich von Europa über Nordasien und von dort über Nordamerika fortgesetzt ausgebreitet, bis sie schließlich über den Nordatlantik wieder nach Europa eingedrungen ist. Damit galt die Silbermöwe als Paradebeispiel für einen Rassenkreis bzw. eine Ringspezies. Obwohl allgemein anerkannt wurde, dass die Populationen klinal ineinander übergehen, also einen intraspezifischen Zusammenhalt aufweisen und damit als Rassen zu bezeichnen wären, haben die einzelnen Rassen der Silbermöwe zum Teil getrennte Artnamen erhalten. Nach Mayr (1942 3723) ist die Silbermöwe im Aralo-Kaspischen Gebiet entstanden und hat sich von dort über die Mongolei nach Nordostsibirien ausgebreitet. Die dortige Rasse erhielt den eigenständige Artnamen Larus vegae. Von dort setzte sich die Ausbreitung nach Nordamerika fort, wo die Silbermöwe als Larus smithsonianus bezeichnet wurde. In Nordamerika soll sich dann, vermutlich bedingt durch die Eiszeit, die „Rasse“ Larus argentatus abgetrennt haben, die dann nach der Eiszeit nach Europa eingewandert sein soll. Larus argentatus ist dann in Europa im Ostseeraum mit der dort ansässigen Heringsmöwe (Larus fuscus) zusammengestoßen, von der sie als eigene Art präzygotisch abgetrennt ist (siehe unten). Europa galt als der hypothetische Endpunkt des zirkumpolaren Ausbreitungsrings. Von West nach Ost sind die Rassen reproduktiv miteinander kompatibel, während die beiden Endpopulationen des Ausbreitungsringes (Silbermöwe und Heringsmöwe) volle reproduktive Isolation erreicht haben und in Europa wie distinkte Spezies nebeneinander coexistieren. Neuere Untersuchungen haben dieses schöne Modell, das in zahlreiche Lehrbücher eingegangen ist, jedoch nicht bestätigen können (Liebers et al. 2004 5345). Der Vergleich von mitochondrialen DNA-Sequenzen konnte ein Schlüsselelement der Ringspezies-Hypothese nicht stützen, nämlich die zu postulierende nahe verwandtschaftliche Beziehung der nordamerikanischen smithsonianus zur europäischen argentatus. Die für die nearktische smithsonianus charakteristischen mitochondrialen Haplotyp-Sequenzen fanden sich in europäischen argentatus-Möwen nicht wieder, nicht einmal in Island. Es gibt keine Anzeichen für eine evolutionär junge Aufspaltung zwischen smithsonianus und argentatus. Der Silbermöwen-Komplex ist also keine Ringspezies. Stattdessen scheint es sich beim Larus-argentatus-Komplex eher um divergierende Ausbreitungswellen aus zwei getrennten glazialen Rückzugsgebieten zu handeln und nicht um eine ringförmige Ausbreitung. Die mitochondrialen Daten sprechen für eine Ausbreitung einerseits aus einem kontinentaleurasiatischen Rückzugsgebiet und zweitens aus einem nordatlantischen Refugium. Ein gültiges Beispiel für eine Ringspezies ist dagegen der Grüne Laubsänger (Phylloscopus trochiloides). Dieser bildet in Zentralasien einen Rassen-Ring (Irwin et al. 2001 5740). Klimadaten und der Vergleich mitochondrialer Mikrosatellitensequenzen erlauben es zu rekonstruieren, dass die Tiere sich vom Süden des Tibetanischen Hochlands sowohl an der Westseite des Plateaus als auch an der Ostseite um das gesamte Tibetanische Plateau herum ausgebreitet haben. Das Tibetanische Hochland wird heute von mehreren Rassen des Grünen Laubsängers umrundet, die alle miteinander verbunden sind. Die molekularen Daten zeigen, dass zwischen den benachbarten Rassen Genaustausch stattfindet. An der Nordseite des Tibetanischen Plateaus jedoch treffen die Rassen von Westen und Osten aufeinander und sind dort genetisch gegenseitig isoliert. Es findet dort kein Genaustausch mehr statt. Damit bildet der Grüne Laubsänger nachgewiesenermaßen eine echte Ringspezies. Die Ringspezies wird oft als Beginn einer Speziation betrachtet, so als würde eine Art kurz davor stehen, sich in zwei getrennte Arten aufzuspalten. Dieser Schluss ist jedoch nicht zwingend; denn es gibt keine Notwendigkeit anzunehmen, dass die Ringspezies als Art instabil ist und in Bälde völlig in zwei oder mehrere Arten zerfallen würde (Irwin et al. 2001 5740). Kein Naturgesetz zwingt dazu, das Nebeneinander von reproduktiv miteinander kompatiblen und inkompatiblen Populationen innerhalb ein und derselben Spezies als evolutionär kurzlebigen „Übergangsprozess“ zu betrachten. Der Zustand kann durchaus stabil sein. Nur das rein menschliche Bedürfnis, starre Klassengrenzen zu setzen, macht die Ringspezies zum Übergangsphänomen. Arthybriden als Ausnahmen ohne evolutionäre Folgen Hybride zwischen verschiedenen Arten kommen wohl zwischen vielen Arten vor, so lange die Arten stammesgeschichtlich nicht allzu weit voneinander entfernt sind. Es gibt Arthybride und Gattungshybride. Aber Familienhybride sind bei höheren Tieren wohl ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind nicht die Hybride zwischen verschiedenen Arten innerhalb der Familien, z.B. innerhalb der Hunde (Canidae) oder innerhalb der Katzen (Felidae); aber Hybride zwischen Hund und Katze sind wohl ausgeschlossen. Das Vorkommen von Hybriden hat also für die taxonomische Arteinstufung keine Bedeutung. Wer die Auffassung vertritt, wenn Hybride vorkommen, dann seien es noch keine „richtigen“ Arten, der hebt die Kategorie der Art auf die hierarchische Stufe einer Familie. Das gelegentliche Auftreten von Hybriden ist also taxonomisch ziemlich bedeutungslos. Entscheidend ist, wie häufig solche Hybride auftreten. Erst wenn ein nennenswerter Prozentsatz an Arthybridisierungen vorkommt, dann ist dies für die populationsgenetische Struktur und für die taxonomische Einstufung von Bedeutung. Im Extremfall kann dies zur Auslöschung einer Art führen. Der Taxonom hat nicht die Frage zu stellen, ob Hybridisierungen vorkommen und ob die Hybride dann fruchtbar oder steril sind. Vielmehr kommt es darauf an, ob (präzygotisch) assortative Paarung herrscht, d.h. ob und in welchem Maße der Geschlechtspartner der eigenen Art gegenüber dem der fremden Art bevorzugt wird. Weiterhin kommt es darauf an, ob (postzygotisch) die Hybride in ihrer Vitalität und Fertilität gegenüber den reinerbigen Nachkommen benachteiligt sind. Nicht immer ist es so wie beim Schulbeispiel Pferd und Esel, dass die Hybriden fast durchweg steril sind. Hybride zwischen verschiedenen Arten sind den Botanikern aus dem Pflanzenreich seit jeher eine vertraute Erscheinung (Ehrendorfer 1984 4248). Viele Pflanzenarten, besonders Mehrjährige und Hölzer, bilden Arthybride, die auch oft 100% fruchtbar sind. Bei der Gattung Salix (Salweide) wurde künstlich ein Hybrid durch sexuelle Kreuzungen von 13 verschiedenen Arten erzeugt (Gornall 2009 5816). Bei Rosaceen und Poaceen sind auch Gattungshybride durchaus häufig, wobei sich bei Gattungshybriden jedoch die Frage stellt, ob die Verleihung des Gattungsrangs für solche Arten überhaupt gerechtfertigt war. In einer Flora Großbritanniens werden neben 2500 Pflanzenarten 780 Arthybride aufgeführt (Gornall 2009 5816). Die Spitzenstellung unter den Pflanzenhybriden nehmen die Orchideen ein, bei denen zumindest innerhalb der Gattungen nahezu alle Arten miteinander hybridisieren. Die Vaterschaftsanalyse einer gezüchteten Orchideenform entlarvte diese als Produkt aus acht verschiedenen Gattungen. Nur bei der Orchideengattung Ophrys kommt es fast nie zur Bastardierung, weil die Bestäuber dieser Gattung (Dolchwespen, Grabwespen, Vertreter verschiedener Bienenfamilien) streng blütenspezifisch auf jeweils nur eine einzige OphrysArt ansprechen und somit dafür verantwortlich sind, dass die Pollen nicht zwischen unterschiedlichen Arten übertragen werden können (Paulus and Gack 1983 4359). Bei Tieren sind Arthybride seltener als bei Pflanzen, kommen aber durchaus zwischen den meisten verwandten Arten vor. Sie sind häufiger, als man früher angenommen hat. Vor kurzem ist sogar das „Handbook of avian hybrids of the world“ erschienen, das auf 608 Seiten das weltweite Vorkommen von Tausenden von Hybriden bei Vögeln beschreibt (McCarthy 2006 5584). Entgegen der Erwartung sind die Mischlinge in ihrem Aussehen oft nicht intermediär gestaltet. Wegen der Dominanz vieler Gene kann der Phänotyp nur eines Elters im Bastardnachkommen überwiegen, so dass der Hybrid nicht ohne weiteres erkannt wird, weil er nicht beiden, sondern nur einer der beiden Elternarten gleicht, wie das bei Enten oft der Fall ist (Randler 2000 4743; Randler 2000 4502). Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Arthybridisierung besteht auch dann, wenn für die Männchen Sexualnot herrscht. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine Art vor dem Aussterben steht. Die Männchen der eigenen Art werden dann nur noch selten gefunden, während die Männchen der anderen Art zur Genüge vorhanden sind und deswegen „zur Not“ als Sexualpartner von den Weibchen akzeptiert werden. Die Hybridisierung mit der noch häufigen Art ist eine zusätzliche Bedrohung für seltene Arten, die bis zur genetischen Auslöschung der seltenen Art führen kann. Das wurde z.B. bei einer seltenen Seebären-Art auf der Insel Marion im südlichen Indischen Ozean beobachtet (Wirtz 2000 4660). Arthybridisierungen treten auch gegen Ende der Paarungssaison gehäuft auf, wenn die Männchen der eigenen Art fast alle verpaart sind, die der anderen Art aber noch zur Verfügung stehen. Besonders eindrucksvoll sind die vielen Hybridisierungen zwischen fast allen Arten der Anatiden (Enten, Gänse, Schwäne) (Farbbild aus 3852). Die Anatiden sind sozusagen die Orchideen unter den Tieren (Randler 2000 4743). In einer Untersuchung von Scherer und Hilsberg (1982 5822) über die Hybridisierung der Anatiden werden den 149 Arten 418 Hybride gegenübergestellt; 52% davon sind sogar gattungsübergreifend: Stockente (Anas platyrhynchos) mit Nilgans (Alopochen aegyptiacus), Nilgans (Alopochen aegyptiacus) mit Graugans (Anser anser) Graugans (Anser anser) mit Höckerschwan (Cygnus olor) Schwanengans (Anser cygnoides) mit Höckerschwan (Cygnus olor). Beobachtungen sprechen dafür, dass zumindest ein Teil der Hybride fertil ist, so dass sich die aus der Fremdart eingewanderten Gene auch weiter fortpflanzen. Oft ist es jedoch nicht möglich, die Frage zu verfolgen, ob die in der Natur erzeugten Hybride fertil sind. Das liegt daran, dass die Gössel, die einem Gänsepaar folgen, oder die Jungenten, die einer führenden Entenmutter folgen, nicht zwangsläufig von den Eltern abstammen müssen. Bei Anatiden gibt es Nestraub, Fremdgang, Adoptionen und Ähnliches. Die Auslöschung von Arten durch Hybridisierung Die Häufigkeit des Auftretens von Arthybriden darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es biologische Gesetzmäßigkeiten gibt, solche Vorkommnisse zu verhindern. Die Entstehung reproduktiver Isolation ist nach wie vor das zentrale Ziel bei der Evolution der Arten; denn wenn die Organismen einer Art nicht reproduktiv voneinander isoliert sind, dann entstehen Mischformen zwischen den Arten. Das Auftreten von Mischformen birgt die Gefahr in sich, dass eine der Elternarten allmählich ausgelöscht wird (Korol et al. 2000 4637). Das würde die biologische Diversität vermindern; denn damit würden wertvolle Anpassungen an bestimmte Habitatbedingungen verloren gehen. Anpassungen an bestimmte Habitatbedingungen sind aber das entscheidende Kriterium der Artbildung, und genau das ginge durch Bastardierung wieder verloren. Solange die Arten allopatrisch in getrennten Gebieten leben, besteht die Gefahr der Vermischung nicht. Sobald jedoch eine Art in das Vorkommensgebiet der anderen Art eindringt, entsteht diese Gefahr, wenn weder prä- noch postzygotische Barrieren vorhanden sind. Die Vermischung zwischen Arten kann zum Verschwinden einer Art führen, indem die „unterlegene“ Art in der dominierenden Art aufgeht. So hat die in Australien und Neuseeland eingeführte Stockente (Anas platyrhynchos) die dort ursprünglich beheimatete Augenbrauenente (Anas superciliosa) durch Hybridisierung gebietsweise völlig verdrängt (Homma 1998 4136) (Farbbild). Augenbrauenenten kommen nur in Australien, Neuseeland, Neuguinea und auf einigen indonesischen Inseln vor. Das gemeinsame Vorkommen von Stockente und Augenbrauenente hat in Neuseeland dazu geführt, dass heute nur noch 15 bis 20 Prozent der Gesamtpopulation reine Augenbrauenenten sind – im Vergleich zu 95 Prozent im Jahr 1960 (Schäffer 2004 5327). Wenn die Hybridisierung weiter anhält, wird die Augenbrauenente verschwinden. In Südeuropa bedrohen zurzeit die nordamerikanischen Schwarzkopf-Ruderenten (Oxyura jamaicensis) die mediterranen bis kaspischen Weißkopf-Ruderenten (Oxyura leucocephala). Beide Entenarten sehen äußerlich sehr unterschiedlich aus. In den 1940er Jahren hat Sir Peter Scott, der Begründer des Wildfowl and Wetlands Trust, nur sieben Schwarzkopf-Ruderenten (vier Männchen und drei Weibchen) aus Amerika nach England importiert, um die Vögel in seiner Wasservogelsammlung in Slimbridge in Südwest-England zu halten. Von hier aus sind zwischen 1953 und 1973 insgesamt etwa 90 Nachkommen dieser Vögel entflogen und haben begonnen, im Freiland in England zu brüten (Schäffer 2004 5327). Im Jahr 2000 brüteten dann bereits über 5000 Schwarzkopf-Ruderenten in Großbritannien. Heute haben sich die Schwarzkopf-Ruderenten über viele Länder Europas bis nach Spanien ausgebreitet, wo sie sich mit den seltenen, in ihrem Bestand hochgefährdeten einheimischen WeißkopfRuderenten vermischen. Offenbar bestehen keine reproduktiven Barrieren, weder postzogotische noch präzygotische. Da die Weißkopf-Ruderente im gesamten Vorkommensgebiet im letzten halben Jahrhundert stark abgenommen hat, droht diese Hybridisierung die Weißkopf-Ruderente auszulöschen. Dieses Beispiel macht deutlich, dass allopatrisch getrennte Populationen typologisch ein sehr unterschiedliches Aussehen haben können, so dass sie für den Menschen diagnostisch leicht zu unterscheiden sind. Unterschiedliches Aussehen ist jedoch nicht dasselbe wie das Vorhandensein von Artschranken. Die für Artschranken zuständigen Gene sind andere Gene, als die für das phänotypische Aussehen verantwortlichen Gene. Deutlich unterschiedlich aussehende allopatrisch getrennte Populationen können durchaus noch wechselseitig fertil sein, wenn sie zusammenkommen. Die Entstehung reproduktiver Isolation durch Reinforcement Nicht in allen Fällen jedoch besteht bei der Begegnung allopatrisch getrennter Arten die Gefahr des hybridogenen Verschwindens einer Art. Es gibt bei der Begegnung von vorher allopatrisch getrennten Arten zwei Möglichkeiten: Entweder vermischen sich die beiden Arten, was wegen der Dominanz der einen Art fast immer zur Auslöschung der anderen Art führt, oder es gibt Barrieren, die die Vermischung in Grenzen halten oder gänzlich verhindern. Wenn Arten allopatrisch getrennt sind, dann ist oft nicht vorhersehbar, welche der beiden Möglichkeiten eintreten wird, wenn sich die Arten wieder begegnen. Bei der Artbildung entstehen meist zuerst die postzygotischen Unverträglichkeiten. Erst danach entstehen dann die präzygotischen Barrieren. Diese Abfolge ist leicht zu erklären. Wenn bestimmte Allele der Organismen einer Population mit denen der Organismen einer anderen Population in genetische Disharmonie geraten, dann wirkt sich die Hybridisierung nachteilig aus. Kommen zwei solche Population nachträglich zusammen, weil die eine Population in das Verbreitungsareal der anderen eindringt, dann existieren im allgemeinen keine präzygotischen Paarungsbarrieren. Sie hätten vor der Vermischung der Areale ja keinen Sinn gemacht. Die Organismen der beiden Populationen paaren sich also miteinander. Es können dann Nachkommen entstehen, bei denen bestimmte Allele in Disharmonie zueinander stehen. Das könnte ein deutlicher Fitness-Nachteil für die Eltern sein. Das wiederum führt zu einem Selektionsdruck, der dafür sorgt, dass präzygotische Speziationsgene exprimiert werden, die Mischpaarungen verhindern können. Der Druck zur Verhinderung von Mischpaarungen fördert die Entstehung von präzygotischen Barrieren; assortative Paarung ist die Folge. Dieses Phänomen wird „Reinforcement“ genannt. Reinforcement ist der selektionsgeförderte Schutz vor unvorteilhafter Paarung und die Einleitung zur Entstehung präzygotischer Barrieren beim Zusammentreffen von Populationen, die postzygotisch bereits Artschranken aufweisen. Reinforcement dient dazu, bestimmte Genkombinationen vor dem Kollaps durch genetische Rekombination zu schützen (Korol et al. 2000 4637). Selbstverständlich können die Sexualpartner nicht vorher wissen, wie der von ihnen erzeugte Nachwuchs aussehen wird. Aber die Gesetze der Evolution sorgen dafür, dass sich Elterneigenschaften durchsetzen, die die richtige Partnerwahl sicherstellen, weil als Folge davon ein vitalerer und fertilerer Nachwuchs erzeugt wird, der dann auch die präzygotischen Speziationsgene der Eltern erfolgreich weiter vererbt. Wenn also die Nachkommen reinrassiger Paarung Vorteile haben, dann fördert die Selektion auch die Elternmerkmale, die die „richtige“ Partnerwahl sicherstellen. Der dahinter stehende Selektionsdruck sorgt dafür, dass sich solche Merkmale dann meist schnell durchsetzen. Reinforcement wurde an vielen Beispielen nachgewiesen: Als in den 1920er Jahren im südlichen Nordseeraum die Heringsmöwe (Larus fuscus) ins Verbreitungsgebiet der dort ansässigen Silbermöwe (Larus argentatus) eindrang, verpaarten sich beide Arten zunächst relativ oft. Hybride beiderlei Geschlechts sind fertil. Heute, nach nur wenigen Jahrzehnten, vermischen sich beide Arten nur noch sehr selten miteinander (Haffer 1982 4467). Ausgestopfte Hybride finden sich noch in den Museen in Holland und gelten heute als wertvolle Seltenheit. Offensichtlich hatten die Hybride postzygotische Nachteile. Daher ist im Laufe weniger Jahrzehnte seit dem ersten Kontakt eine präzygotische Isolation als Folge natürlicher Selektion gegen Hybride entstanden (oder sie hat sich verstärkt), obwohl – wie in vielen ähnlich gelagerten Fällen – nicht bekannt ist, worin die Nachteile der Hybriden bestehen. Ein zweites Beispiel ist von Drosophila bekannt: Am Mount Carmel in Israel befindet sich eine Schlucht, die pikanterweise „Evolution Canyon'' genannt wird (Korol et al. 2000 4637). Nord- und Südabhang dieses Canyons sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, unterscheiden sich aber mikroklimatisch wegen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit drastisch voneinander. An beiden Canyonhängen haben sich bestimmte Drosophila-melanogaster-Populationen an die stark unterschiedlichen Mikroklimate angepasst, z.B. hinsichtlich der Bodentemperatur, die die Eiablage auslöst. Sofort nach Entstehung dieser Anpassungen wäre die sexuelle Vermischung mit den Populationen des jeweils gegenüberliegenden Berghangs fatal für die Erhaltung des Zusammenhalts der neu entstandenen Merkmale gewesen. Die Kopplung der neuen Allele wäre durch genetische Rekombination zerstört worden. Daher hat ein starker Selektionsdruck für die rasche Entstehung eines assortativen Paarungsverhaltens gesorgt. Es entstand bei der Partnerwahl eine starke Bevorzugung für die Fliegen des jeweils gleichen Berghanges, während die Organismen des gegenüberliegenden Hangs gemieden wurden. Dadurch wurden die neu entstandenen Genpools auseinandergehalten. Dies bedeutet die Neuentstehung zweier Drosophila-Arten unter sympatrischen Bedingungen; denn bei einer Distanz von nur wenigen hundert Metern begegnen sich die Organismen der beiden Berghänge regelmäßig. Die Tiere wurden also nicht durch externe, allopatrische Bedingungen an der gegenseitigen Verpaarung gehindert. Offensichtlich haben (im Gegesatz zu den vorherigen Beispielen) die Hybride zwischen der Schwarzkopf- und der Weißkopf-Ruderente keine verminderte Vitalität und Fertilität gegenüber den reinrassigen Nachkommen beider Elternarten. Hätten sie solche Einschränkungen, so würden die Mischpaarungen zu einem geringeren Erfolg führen als die reinerbigen Paarungen. Es hätte zur Entwicklung von Reinforcement kommen müssen. Zwischen den beiden Extremen, ungehinderte Vermischung am Beispiel der Ruderenten und rasche Entstehung von Barrieren am Beispiel der Nordsee-Möwen, gibt es stabile Zwischenlösungen. Es gibt Arten, die miteinander hybridisieren, wobei sich die Hybridisierung aber in Grenzen hält. Die Arten sind nicht effektiv voneinander abgegrenzt, aber es verschwindet auch nicht eine der beiden Arten. Viele Pflanzen, aber auch manche Tiere, können problemlos miteinander hybridisieren, ohne dadurch ihre Identität zu verlieren. Voraussetzung dafür ist, dass der Prozentsatz der Arthybride auf lange Sicht stabil ist, also mit der Zeit nicht zunimmt. Ist diese Bedingung gegeben, dann stellen Arthybride offensichtlich keine Gefahr für den dauerhaften Fortbestand der Elternarten dar. Gleichbleibende Mengen an Vermischungen scheinen für die Evolution auf lange Sicht tragbar zu sein, ja sie können sich in bestimmten Fällen sogar zum Vorteil der einen Art auswirken (siehe das Beispiel der Darwinfinken weiter unten). Dafür gibt es in Europa ein inzwischen fast klassisch gewordenes Beispiel: die Rabenkrähe (Corvus corone) und die Nebelkrähe (Corvus cornix) [Nebelkrähen sehen wir im Bükk]. Die beiden Arten sind überwiegend allopatrisch verbreitet, die Rabenkrähe in Mittel- und Westeuropa, die Nebelkrähe in Nord- und Osteuropa. Sie bilden zusammenhängende und gegenseitig voneinander abgetrennte Genflussgemeinschaften und müssen daher nach dem Artkonzept der Genflussgemeinschaft als eigene Arten bezeichnet werden. Die Abtrennung ist jedoch nicht vollkommen. In einem schmalen Gürtel von weniger als 50 km Breite (Haas und Brodin 2003 5518), der sich von Nordeuropa über das Elbegebiet und Österreich bis nach Italien zieht, stoßen die Vorkommensgebiete der Raben- und Nebelkrähe aneinander und überlappen sich. Hier kommt es zur Hybridbildung. Es gibt prä- und postzygotische Barrieren zwischen den beiden Arten; diese sind jedoch schwach ausgeprägt. Die Nachwuchsrate der Mischehen ist etwas niedriger ist als bei reinerbigen Paaren, und in geringem Ausmaß wurde assortative Paarung festgestellt (Saino and Villa 1992 4466). Die beiden Arten haben außerdem eine unterschiedliche Habitatwahl, indem die Nebelkrähe eher als die Rabenkrähe Stoppelfelder und Maisschläge bevorzugt (Randler 2008 5796). Das für den Artbegriff Wichtige aber ist, dass sich die Hybridzone in den letzten 80 Jahren, wahrscheinlich jedoch seit viel längerer Zeit, nicht verändert hat (Haas and Brodin 2003 5518). Das Vorliegen von Arthybriden gefährdet also nicht die Distinktheit zweier Vogelarten. Der Genfluss zwischen ihnen löscht weder die eine noch die andere Art aus. Hybridogene Artbildung Das Extrem unter den Beispielen, dass Artschranken in bestimmtem Maße offen sind und dass dies sogar seine evolutionäre Bedeutung hat, ist die hybridogene Artbildung. Darunter versteht man die Entstehung neuer Arten durch Hybridisierung zweier Elternarten. In erster Ansehung erscheint die hybridogene Artbildung als Widerspruch zum Artkonzept der Genflussgemeinschaft, weil nach diesem Konzept die Arten ja gerade reproduktiv voneinander isoliert sein sollen. Und hier hat man nicht nur ein Beispiel für vage Grenzen infolge artüberschreitender Vermischungen, sondern sogar die Entstehung einer neuen Art aufgrund der Durchlässigkeit der Artgrenzen. Hybridogene Artbildung tritt hier als ein positiver, von der Selektion geförderter Prozess zur Entstehung neuer Arten in Erscheinung. Hybridogene Artbildung darf nicht verwechselt werden mit der Verschmelzung zweier ehemals getrennter Arten zu einer neuen gemeinsamen Art. Dieser Prozess führt zu einer Verminderung der Artenzahl, zum Artenschwund. Hybridogene Artbildung dagegen führt nicht zur Verminderung der Artenzahl, sondern zur Neuentstehung einer Art aus zwei getrennten Elternarten, ohne dass diese ihre Existenz beenden. Hybridogene Artbildung ist die Entstehung von drei Arten aus zwei Arten. Dies ist bei Blütenpflanzen ein durchaus häufiger Entstehungsprozess neuer Arten. 2 - 4% aller Blütenpflanzenarten sollen so entstanden sein (Turelli et al. 2001 4871; Schluter 2001 4880). Ausgeweitet auf alle Pflanzen, nicht nur auf Blütenpflanzen, sollen sogar 11% aller Arten hybridogenen Ursprungs sein (Barraclough and Nee 2001 4881). Bei Tieren ist hybridogene Artbildung seltener. Warum ist hybridogene Artbildung bei Pflanzen häufiger als bei Tieren? Woher rührt dieser Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren? Es gibt dafür zwei Ursachen. Erstens gibt es bei Pflanzen viel mehr Beispiele für Selbstbefruchtung als bei Tieren, und zweitens gibt es bei Pflanzen viel mehr Beispiele für Tetraploidien als bei Tieren. Daraus resultiert die relative Häufigkeit der hybridogenen Artbildung bei Pflanzen. Der erste wichtige Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren ist die Fähigkeit der Pflanzen zur Selbstbefruchtung, eine Eigenschaft, die bei Tieren viel seltener auftritt. Arthybride würden nämlich evolutionär ziemlich unbedeutende Einzelerscheinungen bleiben, hätten sie nicht die Fähigkeit, eine individuenstarke neue Population aufzubauen, die im Kampf ums Dasein mit den beiden Elternarten als eigene Art konkurrieren kann. Nur das gibt den Hybriden die Chance, sich als neu entstandene Art durchsetzen und überleben zu können. Normalerweise können Hybride aber keine neue Population aufbauen, weil sie ja bei der Partnersuche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf weitere Hybride treffen, sondern auf die Organismen einer der beiden Elternarten. Paaren sich die Hybride aber wieder mit den Elternarten, so ist dies eine genetische Rückkreuzung. Die Hybridgenome verschmelzen wieder mit den Elterngenomen, und bis auf eine begrenzte Introgression einiger Gene der fremden Art verändert sich nichts in den beiden Elternarten. Sie bleiben erhalten, und eine dritte Art kann nicht entstehen. Viele Pflanzen sind jedoch in der Lage, sich selbst zu bestäuben. Sie benötigen daher keine weiteren Sexualpartner und laufen damit auch nicht Gefahr, sich wieder mit den Organismen der Elternarten zu verpaaren und die ganze Sache rückgängig zu machen. Wegen der Selbstbefruchtung sind sie in der Lage, eine individuenstarke eigene Population aufzubauen, die von den Elternpopulationen vom ersten Augenblick an reproduktiv getrennt ist und wegen ihrer eigenen Vermehrungspotenz mit dieser konkurrieren kann. Damit sind aus zwei Elternarten drei Arten geworden. Selbstverständlich muss beachtet werden, dass eine Gruppe aus sich ausschließlich selbstbefruchtenden Organismen keine Genflussgemeinschaft ist und damit keine Art sein kann. Viele Selbstbefruchter sind jedoch nicht ausschließliche Selbstbefruchter für alle Zeiten. Sie haben durchaus gelegentlichen biparentalen Genaustausch. Bei den Tieren sind nur die Vertreter weniger Taxa zur Selbstbefruchtung fähig, z.B. viele Trematoden (Saugwürmer) und Cestoden (Bandwürmer). Der bekannte Schweinebandwurm Taenia solium ist fast ausschließlich Selbstbefruchter, weil der Mensch als Endwirt in den allermeisten Fällen nur einen einzigen Wurm in sich tragen kann. Die Selbstbefruchtung als Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen ist ein erster wichtiger Grund, warum hybridogene Artbildung bei Pflanzen häufiger vorkommt als bei Tieren. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund. Wenn sich die Angehörigen zweier verschiedener Arten miteinander kreuzen, dann entsteht ein F1-Hybrid, dessen diploides Genom aus den Chromosomensätzen zweier unterschiedlicher Arten besteht. Das kann in der Meiose zu Störungen führen, weil sich manche Chromosomen nicht paaren können, da der für die Chromosomenpaarung verfügbare homologe Chromosomenpartner artverschieden ist und daher keine korrekte Tetradenbildung ermöglicht. Keine korrekte Tetradenbildung aber bedeutet keine korrekte Aufteilung der Genome auf die haploiden Keimzellen. Spermien und Eier des F1-Hybriden enthalten demnach kein vollständiges Erbgut. Das ist einer der Gründe, warum es Reproduktionsbarrieren zwischen unterschiedlichen Arten gibt. Auch ist dies eine der Ursachen dafür, dass sich die Inkompatibilität bei Artkreuzungen öfter und schneller auf die Fertilität auswirkt als auf die Vitalität. Ein Arthybrid ist eher in seiner Fertilität gestört als in seiner Vitalität. Er hat eine höhere Chance, gesund aufzuwachsen und zu leben, als dass er wirklich fruchtbar ist (Wu et al. 1998 4096). Es ist jedoch bemerkenswert, dass dieses Problem, dass die meiotische Tetradenbildung in Arthybriden gestört ist, bei Pflanzen deutlich weniger in Erscheinung tritt als bei Tieren. Das sei im Detail erläutert: Pflanzen können (aus weitgehend unbekannten Gründen) eher im tetraploiden oder sogar polyploiden Zustand leben als die Tiere. Es stellen sich im Leben der Pflanzen viel seltener Vitalitätseinbussen ein, wenn die Pflanze von der Norm abweicht und vier oder noch mehr Chromosomensätze in jeder Zelle hat statt wie üblich zwei Chromosomensätze. Das bezeichnet man als Tetraploidie bzw. Polyploidie. Grobe Schätzungen besagen, dass ein Drittel aller Pflanzenarten polyploiden Ursprungs ist (Schilthuizen 2001 4875). Viele Kulturpflanzen sind zum Beispiel tetraploid. Stammen die zusätzlichen Chromosomensätze von derselben Art, so ist das Autopolyploidie, stammen sie aus unterschiedlichen Arten, so bezeichnet man das als Allopolyploidie. Bei der Kreuzung zweier unterschiedlicher Arten enthält die Zygote des Arthybriden zunächst immer zwei unterschiedliche Genome, die aus den beiden Elternarten stammen, einen Chromosomensatz von der Vaterart und einen anderen Chromosomensatz von der Mutterart. Der Hybrid ist demnach allodiploid. Das kann zu Störungen in der meiotischen Tetradenbildung führen, und so ist es meistens auch der Fall. Pflanzen können sich jedoch davor schützen. Da sie (im Gegensatz zu den meisten Tieren) die Möglichkeit haben, ihren diploiden Chromosomensatz ohne Zellteilung zu verdoppeln und dadurch tetraploid zu werden, können sie die meiotischen Störungen umgehen. Allotetraploide Hybride können ganz normale Tetraden bilden, weil jedes Chromosom einen artgleichen homologen Partner findet (Farbbild). Der einzige Unterschied zur Meiose der reinrassigen Eltern ist, dass die Anzahl der Tetraden sich in allotetraploiden Organismus verdoppelt hat; die Tetraden selbst sind genauso wie bei den reinrassigen diploiden Eltern. Die Keimzellen solcher allotetraploider Hybridorganismen sind nach erfolgreicher Reduktionsteilung nicht haploid, sondern diploid. Würden solche Keimzellen über Rückkreuzung die Keimzellen der Elternarten befruchten, dann entstehen durch die Befruchtung triploide Nachkommen. Diese sind dann Meiose-unfähig, weil es in triploiden Organismen zu keiner passenden Tetradenbildung kommen kann. Folglich sind die Hybridorganismen davor geschützt sich mit ihren Elternarten zurück zu kreuzen und damit die Entstehung einer neuen Art wieder rückgängig zu machen. Sie können sich nur mit ihresgleichen, also wiederum den Arthybriden, erfolgreich paaren. In nur einer Generation entsteht also eine postzygotische Barriere. Diese unterbricht sofort den Genfluss zwischen einer zunächst winzigen Population von tetraploiden Individuen (vielleicht anfangs nur einer einzigen Pflanze) und der sie umgebenden diploiden Ausgangspopulation. In nur einer Generation erzeugt die Genomduplikation Pflanzen, die sich nicht mehr mit ihren Eltern reproduzieren können, sondern nur noch mit sich selbst. Das ist Artbildung in einer Generation, und eben nicht über lange evolutionäre Zeiträume. Die Fähigkeit zur Allotetraploidie ist also der zweite wichtige Grund, warum Pflanzen viel häufiger als Tiere in der Lage sind, hybridogene Arten hervorzubringen. Allopolyploide Hybride sind oft besonders widerstandsfähig, weil sie optimale Eigenschaften ihrer beiden Elternarten in sich vereinigen. Ist der Italiensperling (Passer italiae) eine Hybridart? In Europa leben drei verschiedene Haussperlingsformen, deren Artstatus auch heute noch umstritten ist: der bekannte Haussperling (Passer domesticus), der Weidensperling (Passer hispaniolensis) und der Italiensperling (Passer italiae). Der Haussperling besiedelt ganz Europa außer der Polarregion, aber er fehlt bezeichnenderweise in Italien und auf den benachbarten Inseln. Der Weidensperling brütet in Spanien, auf dem Balkan und auf den meisten Mittelmeerinseln. Der Italiensperling kommt, wie der Name sagt, vor allem in Italien vor, zusammenhängend damit auch auf Sizilien, Korsika und Sardinien, bemerkenswerterweise aber auch auf Kreta. In weiten Teilen Europas kommen die drei Formen jeweils allein vor, aber es gibt auch breite Überlappungsgebiete, so in Nord- und Süditalien, in Spanien, auf dem Balkan und in Nordafrika. In diesen Überlappungsgebieten leben die Arten in einigen Gebieten ohne Vermischung getrennt nebeneinander, in anderen Gebieten kommt es zu Hybridisierungen. In den Hybridisierungsgebieten leben ausgedehnte Populationen intermediärer Organismen. Auf der iberischen Halbinsel, dem Balkan und Teilen Nordafrikas leben Weiden- und Haussperling sympatrisch nebeneinander, ohne dass es zu Hybridisierungen kommt. Sie besiedeln in den Gebieten gemeinsamen Vorkommens getrennte Biotope, indem der Haussperling die angestammten Habitate, Städte und Ortschaften, besetzt hält und der Weidensperling in die ländlichen Lebensräume ausweicht. In Tunesien und Ostalgerien kommt es dagegen zur Hybridisierung beider Arten, wobei dort sehr variable Sperlingspopulationen ausgebildet werden. Der Italiensperling lebt auf der Apenninhalbinsel bis zum südlichen Rand der Alpen. Südlich der Alpen besteht eine ungefähr 35 bis 40 Kilometer breite Übergangszone zwischen den Populationen des Haus- und Italiensperlings, in der es auch häufig zu Hybridisierungen kommt. Im Süden Italiens ist der Italiensperling durch eine breite fließende Übergangszone mit dem Weidensperling verbunden. Die Tiere Korsikas ähneln in ihrem Aussehen denen Norditaliens, während die Sperlinge Sardiniens recht deutliche Übergänge zum Weidensperling zeigen. Damit ist eine schwierig zu interpretierende Situation gegeben. Es war oben das Phänomen der Isolation durch Distanz erläutert worden. Hier handelte es sich um zusammenhängende Populationen, die über größere geografische Entfernungen hinweg ihre reproduktive Kompatibilität vermindert haben. Als Resultat einer zirkulären Ausbreitung stießen die vorher geografisch entfernten Populationen sekundär wieder zusammen. Dieser Spezialfall der Isolation durch Distanz, dass die genetisch inkompatiblen Populationen der Art wieder aufeinanderstoßen, ist die Ringspezies (siehe oben). Aber beim Haus- und Weidensperling liegt weder das Phänomen der Isolation durch Distanz noch das der Ringspezies vor, zumindest nicht mehr in der gegenwärtigen Zeit. Es gibt keine geografische Ausbreitungslinie, entlang der man die kontinuierlich abnehmende genetische Kompatibilität verfolgen könnte, wie bei der Isolation durch die Entfernung oder bei der Ringspezies. Auch gibt es keine getrennten Verbreitungsgebiete der Arten mit abrupter Grenzlinie, wie bei Raben- und Nebelkrähe. Und drittens liegt auch nicht das Phänomen der partiellen genetischen Introgression bei ansonsten eindeutigem Nebeneinander der Arten vor, wie bei Wolf und Kojote. Haus- und Weidensperlinge sind ein Grenzfall. Es gibt einen Genfluss zwischen den Arten, aber er folgt keiner eindeutigen Ausbreitungslinie. Stattdessen ist er bunt gewürfelt an einigen Orten vorhanden, an anderen nicht. Deswegen sind Haus- und Weidensperling nicht eindeutig conspezifisch. Es gibt Mischzonen zwischen Haus- und Weidensperling, aber diese kennzeichnen nicht eindeutig eine Grenze des Zusammenstoßens zweier Arten wie bei Rabenund Nebelkrähe. Stattdessen gibt es die Mischzonen bunt gewürfelt an einigen Orten, an anderen Orten gibt es sie nicht. Und im Unterschied zu Wolf und Kojote gibt es nicht nur gelegentliche genetische Introgression zwischen Haus- und Weidensperling, sondern es existieren ausgeprägte intermediäre Mischpopulationen, die in bestimmten geografischen Bereichen leben. Das wäre ein Argument gegen den Artstatus von Haus- und Weidensperling. Wolf und Kojote sind dagegen „echte“ Arten; denn sie haben keine kontinuierlichen klinalen Übergangsbereiche mit Mischpopulationen (wenn man einmal vom umstrittenen Status des Rotwolfs absieht; siehe oben und Kap. 3). Es besteht aber nicht nur das Problem, ob Haus- und Weidensperling nun Arten oder Rassen sind. Hinzu kommt das Problem, dass der Italiensperling oftmals als Hybridart bezeichnet wird. Er soll hybridogen als dritte Art aus Haus- und Weidensperling entstanden sein. Diese Meinung geht auf Wilhelm Meise zurück, der wegen des intermediären Aussehens des Italiensperlings, der sowohl die Merkmale des Haussperlings als auch die des Weidensperlings trägt, zu dem Schluss gekommen war, der Italiensperling sei eine Hybridspezies (Töpfer 2007 5621). Meises Meinung wirkte so überzeugend, dass sie bis heute von vielen Ornithologen akzeptiert wird. Die Auffassung Meises beeinflusste die Ornithologen in der Folgezeit sehr. Die Entstehung des Italiensperlings wurde sogar als Paradebeispiel der Artentstehung durch stabilisierte Hybridisierung angesehen. Der Italiensperling lehrt uns, wie stark überzeugend vorgetragene Argumentationen Sicht- und Denkweise von Generationen beeinflussen können (siehe auch einige Anmerkungen zu Ernst Mayr in diesem Buch). Eine Hybridart ist aber etwas anderes als eine klinale Übergangspopulation zwischen zwei Arten. Eine Hybridart ist eine hybridogen entstandene neue dritte Art, die aus zwei Elternarten hervorgegangen ist, die langzeitig eindeutig getrennt waren. Um von einer Hybridart zu sprechen, muss die Bedingung erfüllt sein, dass die beiden Elternarten nach Zeiten der Trennung sekundär wieder aufeinandergetroffen sind und dabei durch gegenseitige Hybridisierung eine neue Art gebildet haben. Dieser Artbildungsprozess setzt unbedingt voraus, dass die Hybridart durch bestimmte Eigenschaften eindeutig von den beiden Elternarten abgegrenzt ist, damit sie sich nicht wieder mit ihnen rückwärtig vermischen kann. Die Möglichkeiten für eine Rückkreuzung müssen versperrt sein; sonst kann sich die Hybridart auf die Dauer nicht durchsetzen. Der Italiensperling aber ist sowohl im Norden als auch im Süden Italien durch klinale Übergangspopulationen mit Haus- und Weidensperling verbunden. Das spricht gegen den Status einer Hybridart. Wie der Italiensperling wirklich entstanden ist, ist unbekannt. Es gibt jedoch keine Argumente dafür, dass der Italiensperling sekundär durch das Zusammentreffen des Haussperlings von Norden her und des Weidensperlings von Süden her entstanden ist. Er könnte sich ebenso gut durch lokale Adaptation an örtliche Nischen in Italien von den benachbarten Populationen des Haussperlings im Norden und des Weidensperlings im Süden abgesondert haben (Töpfer 2007 5621). Die Übergänge zum Haus- und Weidensperling sind graduell (klinal). Das entspricht den Mechanismen, wie geografische Rassen entstehen. Der „Gendiebstahl“ zwischen zwei Arten der Galapagos-Grundfinken Es ergibt sich nun folgendes Bild über Art-Hybridisierungen. Art-Hybride sind eine häufige Erscheinung im Tier- und Pflanzenreich. Einerseits handelt es sich um Einzelfälle, denen keine evolutionäre Bedeutung zukommt. Andererseits aber können Art-Hybride zur Auslöschung einer Art führen. Und drittens haben Arthybride auch eine wichtige biologische Bedeutung. Sie können zur Entstehung einer neuen, dritten Art führen, die dann die Eigenschaften beider Elternarten vorteilhaft in sich vereinigt. Das ist vor allem bei Pflanzen oft verwirklicht. Es gibt aber noch eine vierte Bedeutung, die Arthybride für die Evolution haben. Hybridisierung ist keineswegs immer nur eine Fehlleistung der Fortpflanzung zwischen nicht vollständig getrennten Populationen unterschiedlicher Arten. Wie neue Ergebnisse von den Darwinfinken auf Galapagos zeigen, kann die gelegentliche Art-Hybridisierung notwendig für die Bereicherung des Genpools einer Art sein. Auf der Insel Daphne Major leben zwei Darwinfinkenarten nebeneinander: der größere Mittelgrundfink Geospiza fortis mit 200 bis 2000 Individuen und der etwas kleinere Kaktusgrundfink G. scandens mit nur 100 bis 600 Individuen (Grant 2003 5297). Finkenschnäbel sind ganz allgemein ein Beispiel einer besonders sensiblen Kontrolle durch die Selektion (siehe Kap. 6). Schon leichte Differenzen in der Schnabelhöhe von nur Bruchteilen von Millimetern können starke Selektionsvorteile oder Nachteile bieten. Die Finken sind dann nicht mehr in der Lage, die Samen bestimmter Größe oder Härte als Nahrung zu nutzen. Die Schnabelhöhe ist ein genetisch kontrolliertes Merkmal. Auf der Insel Daphne Major verursachen periodische Schwankungen der Meeresströmung eine drei- bis fünfjährige Trockenperiode, die dann wieder von einer ebenso langen Feuchtperiode abgelöst wird. Das hat zur Folge, dass die Vegetation sich rhythmisch ändert. In den Jahren mit feuchter Witterung stehen den Finken kleine, weichere Samen zur Verfügung, in den Trockenperioden überwiegen Pflanzen mit dicken, harten Samen. Dieses Phänomen wird von einem bemerkenswerten Oszillieren der Schnabelgröße beim Mittelgrundfinken Geospiza fortis begleitet. In trockenen Jahren sterben fast alle dünnschnäbligen Finken, weil ihre Nahrungspflanzen mit weichen Samen nicht verfügbar sind. Sie verhungern regelrecht. Nur die starkschnäbligen Individuen überleben, weil sie in der Lage sind, extrem harte Samen zu knacken (Grant und Grant 2002 5226). Die meisten ihrer Nachkommen haben dann größere und breitere Schnäbel, bis nach ein paar Jahren die erneut auftretende feuchte Witterung wieder weichsamige Pflanzen wachsen lässt. Dann haben die wenigen überlebenden dünnschnäbligen Finken sofort einen Selektionsvorteil, produzieren höhere Nachkommenzahlen und beginnen, in der Gesamtpopulation zu dominieren, indem sie die dickschnäbeligen Individuen verdrängen und ersetzen. Es ist dies ein Beispiel für einen allelen Polymorphismus (siehe Kap. 6). Der Genpool der Population des Mittelgrundfinken Geospiza fortis enthält sowohl die Allele für Dickschnäbeligkeit als auch die Allele für Dünnschnäbeligkeit. Aber bei den Grundfinken zeigt sich noch ein ganz anderes bemerkenswertes Phänomen. Wenn eine Population bei einer solchen Klimaänderung durch einen „Flaschenhals" geht, bewährt es sich, dass es trotz der weitgehenden Paarungsbarriere in begrenztem Ausmaß zu Hybridisierungen zwischen dem Mittelgrundfinken Geospiza fortis und dem Kaktusgrundfinken G. scandens kommt. Die Hybriden überleben gut. Und da sie sich kaum miteinander vermischen, sondern überwiegend mit den Elternarten rückkreuzen, verhindern sie effektiv, dass die beiden Arten Geospiza fortis und G. scandens durch Vermischung ineinander aufgehen und zu einer einzigen Art werden. Der Genfluss zwischen den beiden Arten hält sich in Grenzen. Die gelegentlichen zwischenartlichen Hybridisierungen bewirken aber variablere Genpools und schaffen dadurch eine größere genetische Flexibilität. Der zartere Kaktusgrundfink G. scandens „holt“ sich auf diese Weise Allele vom dickschnäbligen Mittelgrundfinken G. fortis und gewinnt dadurch genetisches Material für die Expression eines etwas dickeren Schnabels. Es ist dies eine Form von „Gendiebstahl“ aus einer fremden Tierart, wodurch erreicht wird, dass damit die Fitness der eigenen Art gestärkt wird. Der „Gendiebstahl“ zwischen zwei Arten der Grünfrösche (Rana ridibunda und R. lessonae) Der bekannte Wasserfrosch (Rana esculenta) ist ein Problemfall, der in seinem Artstatus umstritten ist. Der Wasserfrosch ist keine eigene Art, die von den beiden verwandten Arten, dem Seefrosch (R. ridibunda) [sehen wir im Bükk] und dem Kleinen Teichfrosch (R. lessonae), reproduktiv abgegrenzt ist. Er ist diagnostisch vom Seefrosch und vom Kleinen Teichfrosch unterschieden, aber er bildet keine von den beiden anderen Arten abgegrenzte Genflussgemeinschaft. Rana esculenta entsteht durch Hybridisierung zwischen zwei anderen Arten, dem Seefrosch und dem Teichfrosch. Die Kombination der beiden Genome ergibt den Wasserfrosch. Dieser existiert aber nur als F1-Produkt. Und nur das ist der Wasserfrosch. Diese HybridKombination wird nicht weiter vererbt. Sie bleibt nicht für weitere Generationen erhalten, sondern muss immer wieder neu geschaffen werden. Damit ähnelt der Status des Wasserfroschs zunächst den vielen bekannten Fällen von Arthybriden, die als „Unfälle“ entstehen, aber keine evolutionäre Bedeutung haben, weil sie sich nicht weiter untereinander fortpflanzen, sondern nach Ablauf ihres Individuallebens wieder absterben. Der Wasserfrosch aber ist eine Besonderheit. Wasserfrösche pflanzen sich sehr wohl untereinander fort, wie jeder im Gartenteich beobachten kann. Sie sind vital und voll fertil; aber die Nachkommen des Wasserfroschs sind zum Teil wieder reine See- oder Teichfrösche. Die Nachkommen des Wasserfroschs setzen keine eigenständige Wasserfrosch-Linie fort, die dann getrennt neben See- und Teichfrosch existieren würde. Es gibt kein eigenständiges Wasserfrosch-Genom, das getrennt von den Genomen des See- und Teichfrosches existiert und eine separate evolutionäre Linie einschlagen könnte. Der Wasserfrosch ist keine dritte Art neben dem See- und Teichfrosch, die hybridogen entstanden wäre. Stattdessen entsteht der Wasserfrosch immer wieder von neuem. Wie ist das zu erklären? Es beginnt mit einer Hybridisierung zwischen den beiden Arten Seeund Teichfrosch. See- und Teichfrosch sind nicht präzygotisch abgegrenzt; sie paaren sich uneingeschränkt. Aber sie büßen dadurch nicht ihre Identität ein. Der Hybrid, der Wasserfrosch, ist vital und fertil. Die aus der Hybridisierung entstehende Zygote sowie alle Körperzellen des Wasserfroschs sind allodiploid; sie enthalten ein Genom des Seefroschs und ein Genom des Teichfroschs. Aber in der Keimbahn sind die Zellen nur eine gewisse Zeitlang allodiploid. Noch bevor es in den Hoden des Männchens oder den Ovarien des Weibchens zur Meiose kommt, also noch bevor sich die Spermatogonien oder Oogonien herausdifferenzieren, wird eines der beiden Genome vollständig aus den Keimzellen entfernt. Damit enthalten die noch prämeiotischen Keimzellen nur noch eines der beiden Elterngenome, also entweder nur das des Seefroschs oder nur das des Teichfroschs. Mit beiden Genomen sind nur die somatischen Zellen des Wasserfroschs ausgestattet, und diese sterben, wenn der Frosch stirbt. In der Keimbahn kann es in der anschließenden Meiose folglich nicht zur genetischen Rekombination zwischen den Genomen der beiden Elternarten kommen, weil beim Eintritt in die Meiose nur noch eines der beiden Genome vorhanden ist. Wenn der Wasserfrosch dann reife Keimzellen bildet, enthalten diese Spermien oder Eier immer entweder reine Seefroschoder reine Teichfrosch-Genome. Ein paarungsbereiter männlicher Wasserfrosch liefert also entweder Seefrosch- oder Teichfrosch-Spermien, aber keine Wasserfrosch-Spermien, und entsprechend produziert das Wasserfrosch-Weibchen nur Seefrosch- oder Teichfrosch-Eier. Nun kann sich der Wasserfrosch paaren, mit wem er will: entweder mit einem (1) Teich- oder mit einem (2) Seefrosch oder wieder mit einem weiteren (3) Wasserfrosch. Die Nachkommen sind auf jeden Fall entweder (1) Teichfrösche oder (2) Seefrösche oder wieder (3) Hybriden, also Wasserfrösche. Das ist eine merkwürdige Situation. Der Wasserfrosch entsteht zwar immer wieder neu; er ist aber trotzdem keine stabile neue Art wie bei der hybridogenen Artbildung vieler Pflanzen. See- und Teichfrosch behalten auf die Dauer ihre Identität, obwohl sie sich fortgesetzt vermischen (Schröer and Greven 1999 4224). Das liegt daran, dass es in der Meiose des Hybriden, des Wasserfroschs, keine genetische Rekombination zwischen den Genomen gibt. See- und Teichfrosch-Genome bleiben unvermischt erhalten. Wasserfrösche sind gleichsam "reproduktive Parasiten". Für ihren Fortbestand wird bei der Gametogenese der Chromosomensatz von jeweils einer Elternart eliminiert, während das Genom der anderen Elternart unvermischt weitergegeben wird. Der Wasserfrosch existiert nur als Hybrid, und er entsteht durch ständige Rückkreuzung mit der jeweils anwesenden Elternart immer wieder neu. Daher wird der Wasserfrosch auch als "kleptogame Form", als „Kleptospezies“ bezeichnet; denn bei der Befruchtung „stiehlt“ das Ei des Wasserfroschs sozusagen ein Genom aus einer anderen Art, um damit den somatischen Teil seines Körpers aufzubauen. Aber dieses “gestohlene” Genom wird nicht für die meiotische Neukombination für den Nachwuchs genutzt. Wie steht es nun mit dem Artstatus des Seefroschs Rana ridibunda oder des Teichfroschs R. lessonae? Es können keine Rassen sein; denn Rassen kommen nicht dauerhaft syntop im geografisch gleichen Gebiet vor, ohne sich miteinander zu vermischen (siehe oben). Wichtiger aber ist, dass keine Gene über den Wasserfrosch vom ridibunda- zum lessonaeGenpool fließen oder umgekehrt. See- und Teichfrosch bleiben also sauber getrennt. Daher sind der Seefrosch Rana ridibunda und der Teichfrosch R. lessonae aus guten Gründen jeweils eigenständige Arten.