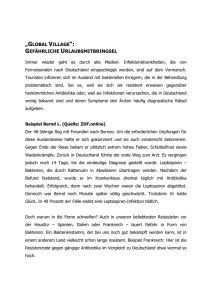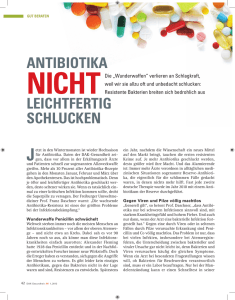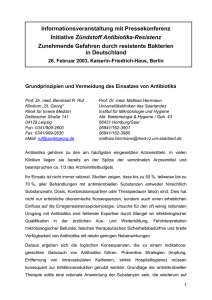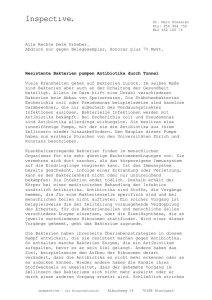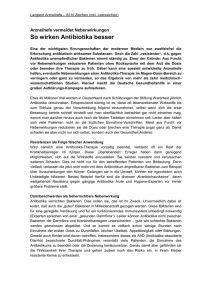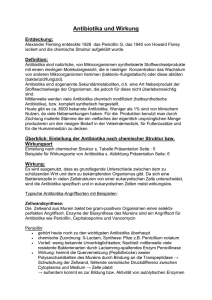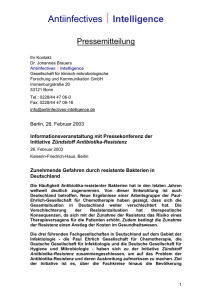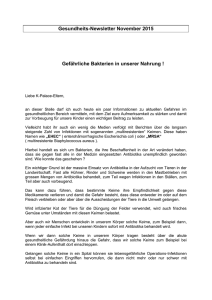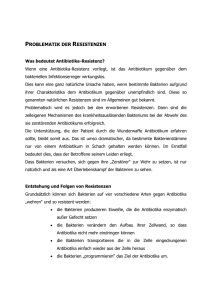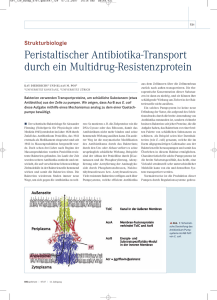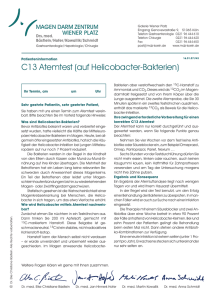Jeffrey A - Ummafrapp
Werbung
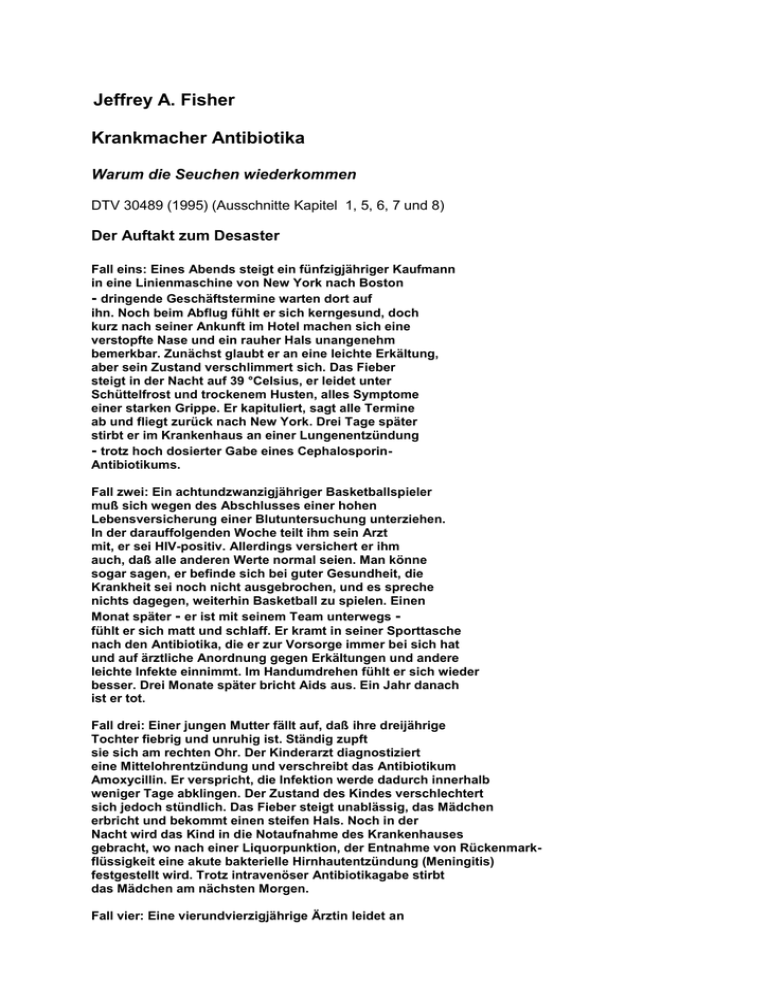
Jeffrey A. Fisher Krankmacher Antibiotika Warum die Seuchen wiederkommen DTV 30489 (1995) (Ausschnitte Kapitel 1, 5, 6, 7 und 8) Der Auftakt zum Desaster Fall eins: Eines Abends steigt ein fünfzigjähriger Kaufmann in eine Linienmaschine von New York nach Boston - dringende Geschäftstermine warten dort auf ihn. Noch beim Abflug fühlt er sich kerngesund, doch kurz nach seiner Ankunft im Hotel machen sich eine verstopfte Nase und ein rauher Hals unangenehm bemerkbar. Zunächst glaubt er an eine leichte Erkältung, aber sein Zustand verschlimmert sich. Das Fieber steigt in der Nacht auf 39 °Celsius, er leidet unter Schüttelfrost und trockenem Husten, alles Symptome einer starken Grippe. Er kapituliert, sagt alle Termine ab und fliegt zurück nach New York. Drei Tage später stirbt er im Krankenhaus an einer Lungenentzündung - trotz hoch dosierter Gabe eines CephalosporinAntibiotikums. Fall zwei: Ein achtundzwanzigjähriger Basketballspieler muß sich wegen des Abschlusses einer hohen Lebensversicherung einer Blutuntersuchung unterziehen. In der darauffolgenden Woche teilt ihm sein Arzt mit, er sei HIV-positiv. Allerdings versichert er ihm auch, daß alle anderen Werte normal seien. Man könne sogar sagen, er befinde sich bei guter Gesundheit, die Krankheit sei noch nicht ausgebrochen, und es spreche nichts dagegen, weiterhin Basketball zu spielen. Einen Monat später - er ist mit seinem Team unterwegs fühlt er sich matt und schlaff. Er kramt in seiner Sporttasche nach den Antibiotika, die er zur Vorsorge immer bei sich hat und auf ärztliche Anordnung gegen Erkältungen und andere leichte Infekte einnimmt. Im Handumdrehen fühlt er sich wieder besser. Drei Monate später bricht Aids aus. Ein Jahr danach ist er tot. Fall drei: Einer jungen Mutter fällt auf, daß ihre dreijährige Tochter fiebrig und unruhig ist. Ständig zupft sie sich am rechten Ohr. Der Kinderarzt diagnostiziert eine Mittelohrentzündung und verschreibt das Antibiotikum Amoxycillin. Er verspricht, die Infektion werde dadurch innerhalb weniger Tage abklingen. Der Zustand des Kindes verschlechtert sich jedoch stündlich. Das Fieber steigt unablässig, das Mädchen erbricht und bekommt einen steifen Hals. Noch in der Nacht wird das Kind in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo nach einer Liquorpunktion, der Entnahme von Rückenmarkflüssigkeit eine akute bakterielle Hirnhautentzündung (Meningitis) festgestellt wird. Trotz intravenöser Antibiotikagabe stirbt das Mädchen am nächsten Morgen. Fall vier: Eine vierundvierzigjährige Ärztin leidet an immer wiederkehrenden Blaseninfekten, sie verspürt ein Brennen beim Wasserlassen stellt zudem Blut im Urin fest, hat hohes Fieber und stechende Schmerzen in der rechten Körperhälfte. Ihre zutreffende Selbstdiagnose lautet: Nierenbeckenentzündung. Sie ruft ihren Freund an, einen Nierenspezialisten, der ihr bestätigt, was sie schon befürchtet hatte: Zur intravenösen Verabreichung von Antibiotika muß sie in eine Klinik - sie hat Angst. Warum sollten sich Ärzte, für die der Anblick, die Geräusche und der Geruch eines Krankenhauses zum täglichen Leben gehören, davor fürchten, selbst als Patienten eingeliefert zu werden? Die Antwort ist einfach: Sie sind sich weit mehr als sonst irgendjemand der Gefahren bewußt, die in den Hospitälern lauern. Nur zu gut wissen sie, daß in diesen strahlenden High-Tech-Tempeln, in denen täglich medizinische Wunder vollbracht werden, die Geister vergangener Zeiten umgehen. Wir wähnten sie schon längst vergessen. Doch die Ärzte wissen, daß der typische Krankenhauspatient der neunziger Jahre zwar mit organischen Erkrankungen wie Krebs, Herzleiden, Schlaganfall oder Begleiterscheinungen des Diabetes eingeliefert wird und auf Hilfe hofft. Sie sind sich aber auch dessen bewußt, daß den Patienten anderes Unheil droht, daß wir uns - eigentlich unvorstellbar - klinisch längst wieder auf dem Stand der dreißiger Jahre befinden. Die Ärzte ahnen angesichts der bestehenden Gefahr, daß das Personal in den Krankenhäusern kaum behandelbaren Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung (Pneumonie), Tuberkulose, Meningitis, Typhus und Ruhr (Dysenterie) machtlos gegenübersteht. Blicken wir sechzig Jahre zurück: Damals stellten nicht die organischen Erkrankungen, sondern die Infektionskrankheiten die Hauptursache für Schmerz und Tod dar. Wir hatten ihnen nur wenig entgegenzusetzen. Das war vor der Entdeckung antibiotischer Medikamente. Heute stehen dem Arzt unzählige verschiedene Antibiotika zur Auswahl: In den Vereinigten Staaten befanden sich 1992 weit über vierhundert antibakterielle Mittel auf dem Markt." " In Deutschland werden 1995 in der Roten Liste einhundertfünfundfünfzig antibakteriell wirksame Substanzen( Antibiotika, Chemotherapeutika, Antimykotika, Virustatika, ohne Desinfektionsmittel) aufgeführt. Da jedoch viele dieser Substanzen nicht mehr patentgeschützt sind und von den Generikaherstellern unter verschiedenen Namen gleichzeitig angeboten werden, kann zur Anzahl der Handelspräparate keine Angabe gemacht werden, die nicht schon einen Monat später überholt wäre. Trotz dieses beeindruckenden Rüstzeugs sterben in den Hospitälern Tag für Tag Patienten an unheilbaren Infektionen, ob in New York, London, Paris, Tokio oder Barcelona. Der erschreckende Fall von Jim Henson, dem Erfinder der Muppets, der vor einigen Jahren in einem New Yorker Krankenhaus plötzlich an schwerster Lungenentzündung starb, war nicht anormal, sondern ein alltäglicher Vorbote der Katastrophe. Wir haben die Gefahren der Infektionskrankheiten nicht überwunden, wir sind ihnen - mehr denn je und vor allem .n den USA - offensichtlich hilflos ausgeliefert. Denn den heute in unseren Krankenhäusern vermehrt auftretenden Infektionen können die meisten Antibiotika nichts mehr anhaben. Bislang vertrauten wir der Wirkung der Antibiotika blind. Doch nun stehen die Ärzte dem Geschehen neuerlich machtlos gegenüber. Wie in den Zeiten vor der Entwicklung der Antibiotika können sie nur zusehen, die Angehörigen trösten und auf ein Wunder hoffen. Der Fall liegt heute jedoch ein wenig anders: Vor der Entwicklung der Antibiotika boten sich noch keine therapeutischen Möglichkeiten an, heute, so glauben viele Fachleute, haben wir diese nahezu ausgeschöpft. Nicht nur in den Kliniken lauert die Gefahr. Bakterien, die neuen Epidemien antibiotikaresistenter Lungenentzündung, Meningitis und eine Unzahl anderer Infektionen auslösen können, sind durch zufälligen Kontakt, beispielsweise im Einkaufszentrum oder im Kino, übertragbar. Die Todesfälle durch verschiedene infektiöse Erkrankungen häufen sich überall auf der Welt in alarmierender Weise. Alles Anzeichen einer drohenden Katastrophe, die innerhalb der kommenden zehn Jahre - vielleicht sogar früher - Millionen von Menschen treffen wird. Wir stehen am Rande des Abgrunds. Wenn wir jetzt nichts dagegen unternehmen, werden wir eine verheerendere Epidemie von Infektionskrankheiten erleben als je zuvor. Den Auslöser dieser Krise bilden paradoxerweise die Antibiotika selbst. Tatsächlich wurde der Gedanke, daß die Behandlung infektiöser Erkrankungen ein zweischneidiges Schwert sein kann, schon vor fast hundert Jahren geäußert. Der deutsche Nobelpreisträger für Medizin Dr. Paul Ehrlich, Vater der Immunologie und der spezifischen Therapie von Infektionskrankheiten, bemerkte, daß Syphiliserreger gegen das von ihm entwickelte Arsenderivat eine Resistenz entwickeln konnten. Salvarsan, so der Name dieses Mittels, war zwar kein Antibiotikum, auch wußte Ehrlich nicht genau, wie sich diese Resistenz herausbildete, doch die biomechanischen Vorgänge ähnelten den später bei Antibiotika nachgewiesenen Prozessen. Deutsche und englische Wissenschaftler entdeckten schon im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert Schimmelpilze mit antibakteriellen Eigenschaften. Der Beginn des modernen Zeitalters der Antibiotika wird aber nur mit einem Namen in Verbindung gebracht: 1928 entdeckte Sir Alexander Fleming durch einen glücklichen Zufall die antibakteriellen Eigenschaften des Brotschimmelextrakts Penicillin. Aber als Bakteriologe zog Fleming die therapeutische Bedeutung seiner Erkenntnisse nicht in Betracht. Es vergingen nahezu fünfzehn Jahre, ehe Howard Florey und Ernst B. Chain, zwei Wissenschaftler aus Oxford, die Wirkung des Penicillins für den Menschen erprobten und nachweisen konnten. Nur wenige Jahre später folgte die Massenproduktion des Medikaments. Zusammen mit den Entdeckungen der Sulfonamide durch den deutschen Mediziner und Bakteriologen Gerhard Domagk in den dreißiger Jahren, von Streptomycin durch den Mikrobiologen Selman Waksman an der Rutgers-Universität von New Jersey und den Cephalosporinen durch Giuseppe Brotzu Mitte der vierziger Jahre, leitete dies die Ära der Antibiotika ein und revolutionierte so die medizinische Praxis. Es war eine aufregende Zeit für Ärzte. Endlich hatten sie eine Waffe in der Hand, mit der sie - ähnlich wie der heilige Georg den Drachen - Bakterien zur Strecke bringen konnten. Jene Geißel der Menschheit, die im Laufe der Jahrhunderte mehrmals fast ganze Völker ausgelöscht hatte. Die neuen Mittel, die »Wunderwaffen“, die Ehrlich gesucht, doch nie gefunden hatte, wurden gegen beinahe alles verordnet und fast immer mit Erfolg. Die Überlebensrate bei der bis dahin so gefürchteten Lungenentzündung, die der weltberühmte Mediziner Sir William Osler 1901 als »Kapitän des Todes« bezeichnet hatte, stieg sprunghaft an: von weniger als zwanzig Prozent im Jahre 1937 auf fünfundachtzig Prozent im Jahre 1964. Walsh McDermott beschrieb dies 1982 in einem Artikel der medizinischen Fachzeitschrift Johns Hopkins Medical Journal: Die Einführung der Antibiotika in die medizinische Praxis» läutete den Beginn einer neuen Ära ein, in der buchstäblich Millionen von Menschen dem Tod geweihte oder zu Invalidität. verurteilte Kinder, Erwachsene und Ältere - verschont wurden. „Der Hausarzt wurde zum Helden“. Die Entdeckung der Antibiotika gilt auch heute noch als eine der bedeutendsten medizinischen Errungenschaften des zwanzigsten Jahrhunderts, und es werden auf diesem Gebiet immer noch neue wirksame Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Erst 1992 wies man beispielsweise nach, daß einige Arten von Magengeschwüren, die man jahrzehntelang für eine Folge übermäßiger Magensäureproduktion hielt, statt dessen von einem weitverbreiteten Bakterium, dem Heliobacter, hervorgerufen und mit Antibiotika geheilt werden können. In den dreißiger und vierziger Jahren wurden zwar noch andere erstaunliche medizinische Fortschritte erzielt, aber gerade die antibakterielle Therapie stellte ein wirklich schweres Geschütz dar, mit dem einige Infektionen verhindert, andere geheilt und die Übertragung und Ausbreitung von Krankheiten eingedämmt werden konnten. Es ist also völlig verständlich, daß niemand erste Anzeichen der Gefahr beachten wollte, als bereits vereinzelt darauf hingewiesen wurde. In einer Abhandlung in der Fachzeitschrift The British Journal o[ Experimental Pathology aus dem Jahre 1929 führte Fleming aus, daß Penicillin im Labor zwar außergewöhnlich wirksam das Wachstum von Staphylokokken hemmt, bei anderen Bakterienformen, den sogenannten Kolibakterien (heute als Escherichia coli oder kurz E.coli bezeichnet) allerdings keinerlei Wirkung zeigt. Elf Jahre später isolierten Ernst B. Chain und dessen Kollege Edward P. Abraham ein Enzym aus Kolibakterien, das Penicillin zerstören konnte, und lieferten so den biochemischen Beweis für Flemings Beobachtung. Aufgrund dieser Laborbefunde wurden schon einmal leise Warnungen ausgesprochen. 1942, noch vor der kommerziellen Vermarktung von Penicillin, machte Fleming den medizinischen Berufsstand darauf aufmerksam, daß Staphylokokken ebensolche Widerstandsfähigkeit gegen Penicillin entwickeln konnten, wie er sie bei Kolibakterien beobachtet hatte. Zwei Jahre später, kurz nach der Einführung von Penicillin auf dem US-amerikanischen Markt, verdammte Florey öffentlich den Mißbrauch des Medikaments. Ein Mißbrauch, der in Großbritannien bereits absurde Formen angenommen hatte: Penicillin wurde wie Bonbons verteilt, das Angebot konnte mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Florey stellte fest, daß bei einer Penicillinbehandlung die Anzahl der resistenten E.coli und anderer Bakterien, deren krankheitserregendes Potential unbekannt war, sogar anstieg. Am beunruhigendsten war, daß Florey Fälle vorweisen konnte, bei denen die Wirksamkeit dieses neu eingeführten Wundermittels sogar schon abnahm. Er führte klinische Beispiele an, bei denen zur Eindämmung der Infektion das Achtfache der normalen Anfangsdosis benötigt wurde. Aber die Warnungen Floreys, Flemings und anderer Wissenschaftler mit klarem Kopf verhallten in der Euphorie des Augenblicks ungehört. Niemand wollte schlechte Neuigkeiten hören. Medizinische Kassandrarufe hatten keinen Platz im Zeitalter der Wundermittel. Es dauerte jedoch nicht lange, bis diese Kassandrarufe Wirklichkeit wurden. Erste Berichte über den Ausbruch von Infektionen, die aufgrund antibiotikaresistenter Bakterien nur schwer: oder gar nicht zu behandeln waren, erschienen schon in den vierziger Jahren in medizinischen Fachzeitschriften. Die Antibiotikaresistenz steht also nicht erst seit kurzem auf der Tagesordnung der Mediziner. Sie hat sich in mehr als fünfzig Jahren direkt vor unserer Nase weiterentwickelt, und wir haben praktisch nichts gegen diesen kontinuierlich fortschreitenden Prozeß unternommen. Zwar diskutieren Mikrobiologen und Infektiologen seit Jahrzehnten dieses Problem, jedoch nur auf medizinischen Tagungen oder in rein wissenschaftlichen Abhandlungen - und damit hinter verschlossene Türen. Nur für kurze Zeit drang die Diskussion nach außerhalb des akademischen Elfenbeinturms: Im Dezember 1984 leitete der heutige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Al Gore, gegen Ende seiner Amtszeit als Mitglied des Repräsentantenhauses eine zweitägige Anhörung vor dem Kongreß. Zahlreiche Experten brachten aufschlußreiche und verblüffende Aussagen zu Gehör. Aussagen, die die mannigfachen Ursachen und äußerst greifbaren und unerfreulichen Folgen der Antibiotikaresistenz unterstrichen. Unternommen wurde jedoch nichts. Man muß sich sogar die Frage stellen, wie viele Mediziner überhaupt von dieser Anhörung erfuhren und wie viele später von den Ergebnissen wußten? Es mutet dann auch etwas seltsam an, daß das Thema heimlich, still und leise ad acta gelegt wurde. Vielleicht lag es nur daran, daß Gore in den Senat, damit in andere Aufgabenbereiche wechselte und niemand die Sache weiterführte. Vielleicht gibt es aber auch andere Gründe? Der Stab des Vizepräsidenten war mir gegenüber bei der Beschaffung von Informationen und Material zu den Anhörungen von 1984 äußerst hilfsbereit, aber der Frage, warum das Thema nicht weiterverfolgt wurde, wich jeder geschickt aus. Das Problem der Antibiotikaresistenz scheint die wenigsten praktischen Ärzte zu kümmern - oder es scheint ihnen nicht bewußt zu sein. Ich erinnere mich noch an die Mikrobiologievorlesungen während meines Medizinstudiums. Zum ersten Mal hörte ich dort, daß Bakterien unempfindlich gegen Antibiotika werden können. Doch dies wurde dort nur am Rande bemerkt, in einem beiläufig hingeworfenen Nebensatz. Niemand rührte das Thema je wieder an, nicht während meines pädiatrischen Praktikums, als ich täglich Antibiotika einsetzte, und auch nicht später, in meiner Zeit als praktizierender Pathologe, als ich ein mikrobiologisches Labor leitete und den Vorsitz der Ausschüsse zur Infektionsbekämpfung in mehreren Gemeindekrankenhäusern innehatte. Ich nahm an Nationalen Fachtagungen in den USA teil, um meinen Pflichten besser nachkommen zu können, doch die Überwachung der Antibiotikaresistenz und deren Einschränkung kamen nicht ein einziges Mal zur Sprache. Die meisten jungen Mediziner - ich schließe mich dabei selbst ein - legten das Thema geistig zu den Akten, zusammen mit den biochemischen Zwischenprodukten des zellulären Glukosestoffwechsels und den komplizierten Lebenszyklen unbekannter tropischer Parasiten, mit denen wir in der Praxis doch nie konfrontiert werden würden - so zumindest dachten wir. so blind wir waren, wird durch die folgende, keineswegs vollständige Chronologie deutlich. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs traten bei den amerikanischen Streitkräften mehrere ernst zu nehmende Pneumonie-Epidemien auf, ausgelöst durch Betahämolysierende Streptokokken. Diese Mikroorganismen waren völlig unempfindlich gegen das Sulfonamid Sulfadiazin, das einzig erhältliche antibakterielle Mittel, von dessen universeller Wirksamkeit gegen Streptokokken man bis dahin überzeugt war. Bemerkenswerterweise war nur kurz zuvor Sulfadiazin im Rahmen prophylaktischer Maßnahmen bei den Truppen eingesetzt worden. Man wollte solchen Epidemien gerade vorbeugen. Mitte der vierziger Jahre traf Flemings Vorhersage ein, als die ersten Spielarten penicillinresistenter Staphylokokken beschrieben wurden. Heute sind weltweit mehr als fünfundneunzig Prozent aller Staphylokokken gegen Penicillin resistent. 1955 erkrankte eine Japanerin nach einer Hongkongreise an einem hartnäckigen Fall von Bakterienruhr. Der betreffende Krankheitserreger wurde isoliert und als ein typischer Erreger der Bakterienruhr namens Shigella identifiziert. Aber es handelte sich keinesfalls um ein gewöhnliches Shigellabakterium. Die isolierten Shigellen reagierten unempfindlich auf vier verschiedene Arten von Antibiotika: Sulfonamide, Streptomycin, Chloramphenicol und Tetracycline. Obwohl dieses Geschehen damals nur von einigen scharfsinnigen japanischen Wissenschaftlern erkannt wurde, bedeutete es eine Warnung vor den Gefahren der folgenden Jahrzehnte. Erstmals zeigte sich ein Erreger mehrfachresistent gegenüber verschiedenen Antibiotika. In den darauffolgenden Jahren häuften sich in Japan Fälle mit mehrfachresistenten Shigellen, und es kam zu einer Reihe von schwer eindämmbaren Ruhrepidemien. 1963 tauchten erste Berichte über einige tetracyclinresistente Abarten von Pneumokokken auf, den damals häufigsten Erregern der Lungenentzündung, die zu falschen Diagnosen und in der Folge zu mehreren Todesfällen führten. Kurz darauf trat in New York und in einigen englischen Städten nahezu gleichzeitig eine Pneumokokkenart auf, die auf die Antibiotika Erythromycin und Lincomycin unempfindlich reagierte. 1967 vermeldete man erstmals in Australien das Auftreten penicillinresistenter Pneumokokken. Vier Jahre später erschien eine kurze Nachricht im New England Journal of Medicine, daß die Empfindlichkeit auf Penicillin in Neuguinea bei Trägern des Keims und bei Patienten mit von ihm verursachter Lungenentzündung abgenommen habe. Da Penicillin in einer Gegend Neuguineas vorbeugend gegen Lungenentzündung verabreicht worden war, zeigte man sich besorgt. Man vermutete, daß dies für die stark verringerte Empfindlichkeit der isolierten Pneumokokken verantwortlich sei. Im Iran entstand innerhalb von nur zehn Jahren eine seuchenverursachende Salmonellenart: 1963 reagierten fast alle Vertreter dieser Bakterienart noch sensitiv auf Antibiotika. 1973 zeigten nahezu hundert Prozent eine Resistenz. Fast alle Erreger des Trippers (Gonorrhoe), die Neisseria gonorrhoeae, reagierten auf Penicillin empfindlich, bis 1975 auf den Philippinen einige Fälle mit resistenten Gonorrhoe-Erregern beobachtet wurden. Heute reagieren mehr als neunzig Prozent aller Gonokokken auf den Philippinen und in Thailand sowie fast die Hälfte in Indien, Afrika, Japan, Westeuropa und den USA unempfindlich auf Penicillin. Die Resistenz von Haemophilus influenzae, dem häufigsten Erreger schwerer Ohrenentzündungen (Otitis) und Meningitis bei Kindern unter fünf Jahren, gegen das. Antibiotikum Ampicillin zeigte sich erstmals 1974. Damals wurde die Resistenz in den USA nur bei etwa vier Prozent der Blut- und Liquortests nachgewiesen. 1982 war diese Zahl auf achtundvierzig Prozent angestiegen. 1977 wurden in einem Hospital in Durban, Südafrika, drei Meningitisfälle und zwei Fälle von Blutvergiftung (Sepsis) durch Pneumokokken hervorgerufen, die sowohl gegen Penicillin als auch Chloramphenicol resistent waren. Alle drei Meningitispatienten starben. 1978 wurde dieselbe Pneumokokkenart bei Patienten in Johannesburg festgestellt die Erreger hatten zwischenzeitlich noch Widerstandskraft gegen Erythromycin, Tetracycline und Cephalosporine entwickelt und vierzehn Menschen starben. Kurz darauf tauchte dieselbe resistente Bakterienart in Colorado und Minnesota auf. Und – diese Krankheitserreger aus Südafrika zeigten sogar noch stärkere Resistenz gegen Penicillin als ihre früheren Verwandten aus Australien und Neuguinea. Obendrein handelte es sich dabei um den ersten Fall von mehrfachresistenten Pneumokokken. »Nach und nach erleben wir eine Erosion des stärksten Bollwerks gegen schwere bakterielle Infekte im modernen Zeitalter der Antibiotika«, schrieb 1978 Dr. Maxwell Finland von der »Harvard Medical School« in einem begleitenden Leitartikel zu seinem Bericht im New Englandjournal o[ Medicine. Finnland, eine weltweit anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten, war der Ansicht, daß wir unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuern, wenn nicht bestimmte Maßnahmen getroffen werden. Zwei Jahre später äußerte Dr. Lewis Thomas Bedenken, ein bekannter Arzt und Philosoph. Er schrieb: »Ich bin besorgt über die weitere Zukunft der Antibiotika, wenn wir nicht dem entsetzlichen Problem der Antibiotikaresistenz unserer häufigsten Krankheitserreger durch weitere Forschungen begegnen.« Die Warnungen dieser beiden weitblickenden Männer wurden größtenteils ignoriert, wie zuvor schon die Einwände von Fleming und Florey. 1989 ergab eine in mehreren griechischen Krankenhäusern durchgeführte Studie eine äußerst hohe Häufigkeit antibiotikaresistenter Bakterien, in einigen Fällen bis zu hundert Prozent, je nach Bakterienart und Antibiotikum. In Finnland stieg zwischen 1988 und 1990 der Prozentsatz der isolierten Streptokokken mit Resistenz gegen Erythromycin sprunghaft von vier auf über vierundzwanzig Prozent an. Dies sind nur einige Beispiele aus Hunderten von in den letzten fünfzig Jahren bekanntgewordenen Fällen bakterieller Antibiotikaresistenz. Die meisten führten zu Behandlungsfehlern, viele verliefen deshalb tödlich. Einzeln betrachtet, scheinbar ohne jeden Zusammenhang, geben diese Ereignisse keinen Anlaß zu größerer Beunruhigung. Sieht man jedoch gen au er hin, wird ein besorgnisErregender Zusammenhang deutlich. Diese Ereignisse sind das Ergebnis eines heimtückischen Prozesses, einer Bakterienseuche, entstanden aus einer ununterbrochenen, weltumspannenden Kette von Ereignissen, die bis in die Gegenwart reicht. Sir Mac Farlane-Burnet, der australische Immunologe und Nobelpreisträger, dessen Forschungen wegbereitend für Organtransplantationen waren, schrieb noch 1962, daß das ausgehende zwanzigste Jahrhundert die eigentliche Ausschaltung von Infektionskrankheiten als wesentlichen Faktor des sozialen Lebens« erleben wird. Über Infektionskrankheiten zu schreiben, sei »fast so, wie über einen Teil der Geschichte zu schreiben«. Diese Ansicht wurde sieben Jahre später vom US-amerikanischen Gesundheitsminister William Stewart bekräftigt, als dieser 1969 vor dem Kongreß äußerte, es sei an der Zeit, »das Kapitel der infektiösen Krankheiten zu beschließen«. Praktisch zur selben Zeit wurden diese Worte durch die Szenarien in den pharmazeutischen Labors aller Welt widerlegt. Die Krise, die bereits 1969 ihren Anfang nahm, wird in den letzten Jahren dieses Jahrtausends ihren schrecklichen Höhepunkt erreichen. Doch selbst jetzt ist der Öffentlichkeit diese Gefahr nicht bewußt, trotz eindringlicher Appelle einiger anerkannter Forscher. »Die pharmazeutische Industrie in den Vereinigten Staaten, in Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland war in den letzten dreißig Jahren in der Entwicklung neuer Antibiotika so erfolgreich, daß Gesellschaft und Wissenschaft das Problem der potentiellen Bakterienresistenz selbstgefällig beiseite schieben «, meint Dr. Harold Neu, Facharzt für Infektionskrankheiten und Antibiotika an der medizinischen Fakultät der ColumbiaUniversität. Und gerade diese Selbstgefälligkeit hat uns seiner Meinung nach an den Rand der Katastrophe geführt. Neu steht mit seiner Ansicht nicht allein. Dr. Richard Krause, leitender wissenschaftlicher Berater der amerikanischen Gesundheitsinstitute (» National Institutes of Health«) und ehemaliger Direktor des amerikanischen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (»National Institute of Allergy and Infectuous Diseases«), warnte, die sich häufenden Fälle therapieresistenter Lungenentzündung, Ruhr, Malaria, Streptokokkeninfekte und anderer Krankheiten ließen einzig und allein folgenden erschreckenden Schluß zu: »Wir erleben eine Epidemie resistenter Mikroben.« Am pessimistischsten beurteilt die Lage Dr. Michael Cohen, Facharzt für Infektionskrankheiten und Epidemiologie am Zentrum für Krankheitsbekämpfung und -vorbeugung in Atlanta (»Center for Disease Control and Prevention«). Er prägte einen erschreckenden Begriff, der vielleicht bald unseren Alltag beschreiben wird: »Wenn wir die Wirksamkeit der verfügbaren antibakteriellen Mittel nicht erhalten können und die Übertragung arzneiresistenter Mikroorganismen nicht eindämmen, nähern wir uns rasant dem >post-antibakteriellen Zeitalter<, in dem unheilbare Infektionen wieder an der Tagesordnung sein werden.« Wie haben wir uns in eine so mißliche Lage manövriert? Diese Frage ist äußerst vielschichtig und nur schwer zu beantworten. Die Ursachen muß man auf jeden Fall bei den wissenschaftlichen Grundlagen suchen, oder besser gesagt, bei deren Mißachtung. Um das Problem in seiner Komplexität zu begreifen und dessen mögliche Lösung zu erkennen, werden wir daher im restlichen Teil dieses Kapitels auf diese Grundlagen eingehen müssen - auf die antibiotische Wirkungsweise und die Mechanismen der Resistenzentwicklung bei Bakterien. Alle Antibiotika treten entweder mit der Struktur oder mit dem Stoffwechsel der Bakterienzelle in Wechselwirkung und treffen sie so in ihrer Lebens- und Vermehrungsfähigkeit. Grundvoraussetzung der therapeutischen Brauchbarkeit eines Antibiotikums ist, daß die physiologischen Abläufe des Mikroorganismus, in die es eingreift, sich so weit wie möglich von unseren eigenen Lebensvorgängen unterscheiden. Ein ähnliches Problem stellt sich in der Krebsforschung bei dem Versuch, unbedenkliche, aber wirkungsvolle Chemotherapien zu entwickeln, die lediglich Tumorzellen angreifen, gesundes Gewebe jedoch unversehrt lassen. Bisher war die Aufgabe für die Onkologie (Tumormedizin) schwieriger als für die Antibiotikaforschung. Es stehen nicht nur weitaus weniger Antikrebsmittel zur Auswahl, es ist auch komplizierter, grundlegende Unterschiede zwischen normalen Körperzellen und Krebszellen festzustellen als zwischen menschlichen Zellen und Bakterien. Daher mußte man bei der Chemotherapie von Krebserkrankungen toxische Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Im Kampf gegen Mikroorganismen hingegen war man in der Lage, aus einer reichen Auswahl antibakterieller Stoffe zu schöpfen und daher selektiver vorzugehen. Aus Tausenden von bislang bekannten antimikrobiellen Mitteln, ob natürlichen Ursprungs oder synthetisch im Labor hergestellt, konnte man einige hundert der wirkungsvollsten Antibiotika mit den geringsten Begleiterscheinungen aussuchen. Zwar können manche dieser Medikamente immer noch ernste Nebenwirkungen hervorrufen, im großen und ganzen zählen sie aber, was diesen Punkt betrifft, in der Regel zu den unbedenklichen Arzneimitteln. Wie wir noch sehen werden, war dies sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Klinisch einsetzbare Antibiotika lassen sich nach der Art, wie sie in den Stoffwechsel der Bakterien eingreifen, klassifizieren. Eine große Gruppe verhindert die zur Zellteilung erforderliche Verdopplung der Bakteriengene und die Bildung der lebensnotwendigen Zellproteine. Das zur Tuberkulosetherapie verwendete Rifampicin hemmt ein bestimmtes Enzym, das für die Verdopplung der Bakterien-DNA, des Trägers der Erbsubstanz, verantwortlich ist. Eine neue Antibiotikaklasse, zu der auch Ciprofloxacin (Handeisname Ciprobay) zählt, wirkt ganz ähnlich an dem Enzym DNA-Gyrase. Zwar besitzen unsere eigenen " Zellen auch ein derartiges Enzym, doch es unterscheidet sich so grundlegend, daß eine Verwechslung mit dem Bakterienenzym ausgeschlossen werden kann. Eine andere Antibiotikagruppe, deren bekannteste Beispiele Streptomycin, Kanamycin, Gentamicin und Tobramycin sind, greifen ebenfalls auf genetischer Ebene ein, jedoch auf eine andere Art. Sie stören den Proteinaufbau der Bakterien in den Eiweißfabriken der Zelle, den Ribosomen. Tetracycline, Chloramphenicol, Erythromycin und einige ihrer später entwickelten Verwandten gehören zwar ihrer chemischen Struktur nach einer unterschiedlichen Klasse an, stören aber ebenfalls die Proteinsynthese. Leider können die meisten dieser die Eiweißbildung hemmenden Antibiotika nicht hundertprozentig zwischen bakteriellen und menschlichen Zellen unterscheiden so. daß bei dieser Gruppe die meisten toxischen Nebenwirkungen auftreten. So wird Streptomycin heute kaum noch verordnet, da es in einigen Fällen bleibende Hörschäden verursachte. Chloramphenicol wird weltweit zwar noch immer gegen Typhus eingesetzt, in den USA aber kaum noch verwendet, da es relativ häufig zu Knochenmarksdepression führen und so die Bildung von Blutzellen beeinträchtigen kann. Erythromycin schließlich verursacht Magenverstimmung, keine ernsthafte, aber doch eine lästige Nebenwirkung, die zudem die Aufnahme des Medikaments beeinträchtigt. Neben den eben erwähnten Antibiotika, die die Genfunktionen oder die genetisch gesteuerte Proteinsynthese behindern, gibt es noch antibakterielle Mittel, die die Bakterienenzyme angreifen. Die bekanntesten darunter sind die Sulfonamide, synthetisch hergestellte chemische Verbindungen, die erstmals in den dreißiger Jahren zum Einsatz kamen. Sulfonamide wirken, indem sie spezifisch die Bildung der essentiellen Folsä~e in Bakterienzellen hemmen, die menschlichen Zellen jedoch nicht beeinträchtigen. Die wohl am besten erforschte Antibiotikagruppe wirkt durch Zerstörung der Zellwandstruktur. Dazu zählen Penicillin und Cephalosporine. Da menschliche Zellen keine Zellwände besitzen, sind diese Antibiotika völlig unbedenklich – abgesehen von selten auftretenden Allergien gegen diese Mittel. Penicillin hemmt die Enzyme, ohne die das Bakterium keine Querverbindungen zwischen den Proteinen der Zellwand aufbauen kann. Ohne diese Querverbindungen werden die Bakterien instabil und lösen sich auf. Penicillin wirkt zwar nicht auf alte Bakterien, deren Zellwände sich bereits gebildet haben, es greift aber auf andere Weise ein: Erst die Bakterienvermehrung ist die Ursache der meisten schweren Infektionen und ihr kann mit Penicillin entgegengewirkt werden. Seit dem ersten erfolgreichen Einsatz von Penicillin im März 1941, der schon historisch zu nennen ist, wurde eine breite Palette von Penicillinen und penicillinverwandten Verbindungen eingeführt. Hauptanreiz für die Entwicklung solcher Derivate und Verbesserungen war die klinische Beobachtung zu Beginn der fünfziger Jahre, daß Staphylokokken schwerste und oft tödliche Fälle von Lungenentzündung hervorriefen. Gegen jene war Penicillin anfänglich äußerst wirksam. Doch sie entwickelten rasch Widerstand gegen das Medikament. Ganz so, wie Fleming vorhergesagt hatte, bildeten Staphylokokken jenes Enzym, das Abraham und Chain 1940 in anderen Bakterien identifiziert hatten. Man entdeckte, daß dieses Enzym einen bestimmten Abschnitt des Penicillinmoleküls, den sogenannten Betalactam-Ring lahmlegt. Anfang der sechziger Jahre wurden neue Penicilline sowie die verwandten Cephalosporine entwickelt. Diese Verbindungen~ stabilisierten den Beta-lactam-Ring des Antibiotikums, schützten ihn vor bakteriellen Angriffen und verhinderten somit die Resistenzbildung. Man nahm an, daß mit der Einführung dieser neuen Penicilline das kurze Kapitel der bakteriellen Antibiotikaresistenz Abgeschlossen sei. Die Vorstellung, daß Staphylokokken durch einen seltsamen biochemischen Zufall Resistenzgegen Penicillin entwickelt hatten und dieses Problem durch Stabilisierung des BetalactamRings ein für allemal gelöst schien, war beruhigend. Praktisch die gesamte pharmazeutische Industrie beglückwünschtes sich zu ihrem Erfindungsreichtum. Wieder einmal hatte die Wissenschaft über die Mikroorganismen triumphiert und diesmal vermeintlich für immer. Doch der Sieg erwies sich als trügerisch, da äußerst kurzlebig. Die Fähigkeit der Staphylokokken, dem Penicillin enzymatisch die Wirkung zu nehmen, war kein vereinzeltes Phänomen, sondern vielmehr das erste Beispiel einer weitverbreiteten und beunruhigenden Entwicklung. Unsere Auseinandersetzung mit resistenten Bakterien sollte noch nicht zu Ende sein. Im Gegenteil, dies war erst der Anfang. Voller Nervosität wurden Wissenschaftler zur Entwicklung weiterer Antibiotika zurück in die Labors geschickt, um den ständig neu auftretenden Fällen von Antibiotikaresistenz etwas entgegenzusetzen. Seither sind sie mit dieser Sisyphusarbeit beschäftigt. Bakterien fanden nicht nur eine Möglichkeit, Widerstand gegen Cephalosporine und die neuen Penicilline zu entwickeln, sondern allmählich auch gegen praktisch alle anderen Antibiotika, ob alt oder neu. In den letzten dreißig Jahren lieferten wir uns ein Wettrennen mit einem scheinbar völlig unterlegenen Gegner: einzelligen Organismen, die entwicklungsgeschichtlich kaum gegensätzlicher sein können. Aber in dieser Gegenüberstellung erwiesen sich unsere spezialisierten Organe und unser komplizierter genetischer Code deutlich als Nachteil. Ebenso wie sich kleine Wirtschaftsunternehmen oftmals neuen Produktentwicklungen leichter anpassen können als die Verwaltungsapparate großer Konzerne, sind auch Bakterien weitaus wendiger als unser komplexes System. Bakterien brauchen kein Gehirn und keine Leber. Sie benötigen lediglich die biochemischen Voraussetzungen zum Widerstand gegen Antibiotika: optimale Genmaschinen - und wie drückte es Dr. David Perlman, ein anerkannter Mikrobiologe der Universität von Wisconsin, so treffend aus: »Mikroorganismen können alles. Mikroorganismen sind schlauer als Chemiker.« In unserer menschlichen Selbstüberschätzung haben wir übersehen, daß wir den Bakterien nie mehr als einen Schritt voraus waren, und wir laufen jetzt auch noch Gefahr, diesen hauchdünnen Vorsprung zu verlieren. Eigentlich hätten wir uns nicht überraschen lassen dürfen. Bakterien hatten unendlich viel Zeit, ihre molekulare Struktur anzupassen, so daß sie wesentlich besser für den Kampf gegen Antibiotika gerüstet sind als wir für deren Entwicklung und Herstellung. Antibiotika werden erst seit sechzig Jahren klinisch eingesetzt, Bakterien dagegen existieren seit fast vier Milliarden Jahren. Und sie hielten keinen Dornröschenschlaf, sie haben sich vermehrt und angepaßt und sie haben das, genetisch gesehen, stets mit atemberaubender Geschwindigkeit getan. Bei Menschen zählt man etwa- alle zwanzig Jahre eine neue Generation, Bakterien jedoch bringen alle zwanzig Minuten eine neue Nachkommenschaft hervor. Fünfhunderttausendmal so schnell wie wir. Evolutionär gesehen, ist ein Bakterium aus der Zeit vor Einführung der Antibiotika mit einem heute isolierten Erreger so verwandt wie der Dryopidlecus, unser vor dreißig Millionen Jahren lebender Vorfahr, den Menschen von heute. In all der Zeit des Versuchs und Irrtums haben die Bakterien drei biochemische Verteidigungsstrategien gegen die Antibiotika entwickelt - diese sind ebenso elegant wie simpel. Welche Möglichkeit davon zum Einsatz kommt, hängt von der Art des Bakteriums und des Antibiotikums ab. Oft wirken gleichzeitig mehrere Abwehrmechanismen auf ein Antibiotikum. 1. Inaktivierung Die Inaktivierung ist die verbreitetste Resistenzmethode gegen Penicillin, Ampicillin, Amoxycillin und die meisten Cephalosporine. Wenn Sie in den letzten fünf Jahren an einem Infekt litten, insbesondere der Harn- oder Atemwege, wurde Ihnen wahrscheinlich ein Cephalosporin-Präparat verschrieben. Diese Antibiotika greifen das zellwandstabilisierende Enzym an, ohne das der Erreger nicht lebensfähig ist. Um diesem Angriff auszuweichen, lernen Bakterien, ein anderes Enzym namens Betalactamase zu bilden, dessen einzige Funktion in der Ausschaltung des Antibiotikums besteht. Die Biochemiker gingen mit einer neuentwickelten Substanzklasse, den Betalactamasehemmern, zum Gegenangriff über. Diese Stoffe, das Sulbactam (Combactamin Unacid), Tazobactam (in Tazobac) und die Clavulansäure (in Augmentan) werden mit Penicillinen und Cephalosporinen kombiniert und schützen die Antibiotika vor den bakteriellen Enzymen, die sie sonst inaktivieren würden. Aber niemand glaubt, daß wir diesen Vorsprung halten können. Es wird wohl nicht lange dauern, bis eine neue Bakteriengeneration mit einem weiteren Enzym entsteht, das die Betalactamasehemmer außer Gefecht gesetzt.Noch ein Beispiel: Streptomycin wird, wie die meistenjüngeren Mycine, zum Beispiel Tobramycin, Gentamicin und Kanamycin, ebenfalls durch bakterielle Enzyme inaktiviert. 2. Strukturänderung Anstatt ein Enzym zu bilden, das den Angreifer ausschaltet, lassen Bakterien in manchen Fällen das Antibiotikum unverändert und nehmen stattdessen meist durch Mutation, selbst eine andere Struktur an. Die Erreger verändern ihren Aufbau so, daß sich Antibiotika nicht mehr an sie binden können. Die Bakterien »verstecken« sich praktisch vor ihren Angreifern, eine weitere Methode, die Wirksamkeit von Penicillinen und Cephalosporinen auszuschalten. 3. Umwege im Stollwechselsystem Neben der Ausschaltung von Antibiotika oder dem eben beschriebenen Versteckspiel umgehen manche Bakterien einfach die Antibiotikawirkung. Beispielsweise blockieren Sulfonamide ein zur Herstellung von Folsäure benötigtes Enzym. Resistenten Erregern gelang es jedoch, ein völlig neues Enzym für die Folsäureproduktion zu bilden und so die Wirkung der Antibiotika zu unterlaufen.* Mit Ausnahme weniger Fälle, bei denen die Ursachen der Resistenzentwicklung noch nicht genau ermittelt werden konnten, beruhten fast alle klinischen Fälle von Antibiotikaresistenz, die seit Einführung des Penicillins weltweit von Japan bis Griechenland von Finnland bIs Amerika, m den letzten fünfzig Jahren auftraten, auf einem oder mehreren der oben erwähnten drei Anpassungsprinzipien. Dies ist ein außerordentliches Beispiel für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eines Organismus, doch noch erstaunlicher ist die Weitergabe dieser Resistenzmöglichkeiten an andere Bakterien: Erreger einer Spezies können ihre biochemischen Errungenschaften auf Vertreter einer anderen Spezies übertragen. Die bakteriellen Schutzmechanismen gegen Antibiotika werden genetisch codiert und gesteuert. Struktur und Sitz der bakteriellen Gene sind denen des Menschen erstaunlich ähnlich. Wie auch bei uns bestehen sie aus einem DNA-Doppelstrang und sind meist in Chromosomen angeordnet. Natürlich besitzen Bakterien nur einen kleinen Bruchteil unserer Genanzahl, aber ihre Gene bestimmen dennoch all ihre Eigenschafteen, einschließlich der Antibiotikaresistenz. Bakteriengene sind gelegentlich Veränderungen oder Mutationen unterworfen - eine weitere Parallele zu den Genen des Menschen. Eine Mutation, die dem Bakterium bessere Überlebenschancen sichert, bleibt erhalten und wird von Generation zu Generation weitervererbt. Doch Bakterien können nicht nur mutieren, sie haben zudem ein weiteres genetisches Verfahren der Resistenzbildung entwickelt, das die Möglichkeiten menschlicher Zellen sogar übersteigt. Diese Methode ist die Hauptursache für die weite Verbreitung der Antibiotikaresistenz, die uns an den Rand der Katastrophe gebracht hat. Denn mit ihrer Hilfe lassen sich einmal erworbene Resistenzeigenschaften rasch auch auf andere Bakterienstämme übertragen. Zwar ist der Großteil des Bakterienerbguts auf Chromosomen angeordnet, einige Gene finden sich aber außerhalb des Bakterienchromosoms auf ringförmigen DNA-Einheiten, den sogenannten Plasmiden. Die meisten Resistenzgene sitzen nun auf diesen Plasmiden. Ein Bakterium kann mehrere Plasmide besitzen; enthalten diese Resistenzgene, werden sie R-Plasmide oder R-Faktoren genannt. Plasmide können unabhängig vom Bakterium existieren; sie stellen insofern einen eigenen Organismus innerhalb des Mikroorganismus dar und besitzen ein Eigenleben. Sie können sich unabhängig vom Erreger, der sie beherbergt, teilen und - was noch wesentlicher ist - sie sind leicht auf andere Bakterien übertragbar. Eine Transfermöglichkeit ist der Austausch von Plasmiden im direkten Kontakt zweier Bakterien- ein Parasexueller Vorgang, der auch Konjugation genannt wird. Nur spezialisierte Plasmide können durch Konjugation ausgetauscht werden. Befinden sich die Resistenzgene bereits auf spezialisierten Plasmiden, können sie folglich ohne weiteres übertragen werden. Ist dies nicht der Fall, wenden Bakterien ein anderes, einzigartiges, molekulares Hilfsmittel an. Wie ein genetischer Floh setzen sich winzige Materie-Einheiten, die Transposone, an den R-Faktoren fest und »hüpfen« mit ihnen von einem nicht übertragbaren Plasmid zu einem übertragbaren. Dieser zusätzliche Schritt ermöglicht praktisch den Austausch aller R-Faktoren durch Konjugation, so daß Resistenzgene äußerst effektiv weitergegeben werden können. Einige Erreger sind allerdings nicht zur Konjugation fähig. Ersatzweise kommen ihnen bestimmte Viren, die Bakteriophagen, zu Hilfe. Diese klinken sich in die R-Faktoren ein, teilen sich dann und wechseln von einem Wirtsbakterium zum anderen. Somit übertragen sie die Resistenzgene. Bei den meisten Erregern sitzen die Resistenzgene auf Plasmiden und nicht. auf Chromosomen, was die Chancen der Bakterien zu unseren Ungunsten erhöht. Das Phänomen der Antibiotikaresistenz entwickelte sich von einer klinischen Rarität aus den Anfangstagen der Antibiotikatherapie zur Alltagswirklichkeit von heute, mit all ihren schrecklichen Auswirkungen. Die Resistenzeigenschaften werden nicht nur vertikal von Mutter- auf Tochterzellen übertragen, wie das der Fall ist, wenn Resistenzgene auf Chromosomen sitzen. R-Faktoren können von einem Bakterium auch auf alle anderen Bakterien übertragen werden, mit denen sie in Kontakt kommen. Da jeder der fast sechs Milliarden Menschen mehr Bakterien als Körperzellen besitzt und Bakterien vor keinen Grenzen haltmachen fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie Bakterien ständig mit neuen Empfängern ihres genetischen Materials zusammentreffen. So ist es möglich, daß eine neue Antibiotikaresistenz an einem Ort und kurz darauf, ja beinahe zur gleichen Zeit, auch am anderen Ende der Welt beobachtet wird. Plasmide und ihre leichte Übertragbarkeit sind noch für ein weiteres, parallel auftretendes Problem verantwortlich, welches Experten für die Herausforderung unserer Zeit halten: die Mehrfachresistenz. Betrachten wir einige der bereits erwähnten Fallbeispiele Etwas eingehender Am bemerkenswertesten ist wohl der nun schon vierzig Jahre zurückliegende Fall der Japanerin mit Bakterienruhr, hervorgerufen durch eine vierfach antibiotikaresistente Shigellenart. Diesem Phänomen folgten mehrere Epidemien. Als sich Herausstellte daß andere aus dem Darm isolierte Bakterien infizierter Patienten, wie das normalerweise harmlose E.coli, auf dieselben vier Medikamente unempfindlich reagierten, folgerte Tomoichiro Akiba von der Universität Tokio, daß die Resistenzend urch Konjugation zwischen Shigellen und E.coli im Verdauungstrakt der Patienten übertragen worden waren. Der Befund mehrfach resistenter Plasmide bei normalerweise Unschädlichen Darmbakterien konnte nur bedeuten, daß die Plasmide »Huckepack« mit Leichtigkeit überallhin gelangen konnten. Vor ein paar Jahren führten Dr.. Stuart Levy und seine Kollegen von der Tufts-Universität eine Studie durch und fanden dabei heraus, daß fast zwei Drittel der von den Einwohnern Bostons willkürlich genommenen Stuhlproben Bakterien mit mindestens einer Antibiotikaresistenz enthielten. Dies ist heute kein ungewöhnliches Ergebnis mehr. Bakterielle Antibiotikaresistenz ist unvermeidbar. Dies ist eine zwingende molekulare Folgeerscheinung des Antibiotika-Einsatzes, es wird aber auch niemand zum völligen Verzicht auf diese Medikamente raten. Wir haben es allerdings versäumt, Vor- und Nachteile im Gleichgewicht zu halten und einen Mittelweg zu finden, bei dem der Nutzen des sinnvollen Antibiotikaeinsatzes die Gefahren ihres Missbrauchs überwiegt. Zur Zeit liegt aber das Übergewicht eindeutig bei den Gefahren. Ärzten fehlte bislang der nötige Überblick über die physiologischen und biochemischen Bakterieneigenschaften sowie deren Auswirkungen. Doch dies ist nur ein Teil des Dilemmas. Das eigentliche Problem liegt in der Wissenschaft und ihrer Nähe zum Pharmamarkt begründet. * Ein vierter Mechanismus der Antibiotikaresistenz wurde erst 1993 beschrieben und ist im amerikanischen Original daher noch nicht berücksichtigt. Der gramnegative Keim Pseudomona aequinosa ist in der Lage, Antibiotika durch aktiven, energiefordernden" Ausstoß (Efflux) wieder aus der Zelle zu entfernen. Dieser Mechanismus ist in seiner Bedeutung für den Infizierten deshalb so gefährlich, weil er weitgehend unspezifisch ist, das heißt strukturell völlig unterschiedliche Antibiotika betrifft. Pseudomonas ist in der Lage, Tetracycline, Chloramphenicol und Fluorchinolone ebenso nach außen zu pumpen wie Penicilline und Cephalosporine. Aufgrund dieser" multidrug-resistance« gehört Pseudomonas zu den gefürchteten Problemkeimen bei Patienten mit cystischer Fibrose oder Zytostatikabehandlung und auf Intensivstationen. Nachtrag zur Aids-Hypothese In einem weiteren Gespräch mit Root-Bernstein erfuhr ich, daß ein noch direkterer, nicht minder interessanter Zusammenhang zwischen Antibiotika und Aids besteht, der keinen Widerspruch zu Montagniers Ausführungen darstellt, sondern sie vielmehr ergänzt. Dr. Luc Montagniers Forschungen deuten auf eine Beschleunigende Wirkung der Antibiotika bei der Entwicklung von Aids hin. Dr. Robert Root-Bernstein behauptet, der Einsatz antibiotischer Medikamente könne einen unmittelbaren Einfluß haben. Der Unterschied dieser beiden Standpunkte liegt in der Gewichtung. Die Art jedoch, in der sich beide Anschauungen überschneiden, stützt die Behauptung, es bestehe ein Zusammenhang zwischen Antibiotika und Aids. Montagnier, der Entdecker des HIV, hat seine Ansicht nicht geändert, die Anwesenheit des Virus sei eine notwendige Voraussetzung für Aids. Im Juli 1992, auf der achten Internationalen Aids-Konferenz in Amsterdam, verdeutlichte er seinen Standpunkt: "Ich denke, wir sollten den Co-Faktoren das gleiche Gewicht beimessen wie HIV. « Er glaubt nicht länger an HIV als alleinige Aids-Ursache, doch hält er die Anwesenheit des Virus mit Einschränkungen nach wie vor für eine notwendige Bedingung. Root-Bernstein hingegen entschied sich völlig gegen die herkömmliche Ansicht über HIV und Aids. Er gehört einer in San Franciscon gebildeten Gruppe namens »Rethinking Aids« an. Diese Gruppe setzt sich aus anerkannten Wissenschaftlern zusammen, die sich unter der Leitung von Dr. Charles Thomas um eine Neubewertung der gängigen H ypothese von HIV als Aids-Verursacher bemühen. Sie entwickeln eine Gegenhypothese, in der HIV unter Umständen keine Rolle mehr spielt. Root-Bernstein hält HIV lediglich noch für einen immunschwächenden Co-Faktor unter vielen. Zu Beginn unseres zweiten Treffens erklärte er mir, warum er den Co-Faktoren so große Bedeutung im Zusammenhang mit Aids beimißt. Ursprünglich gelangte er wie Montagnier und Duesberg zu dieser Ansicht, weil er erkannte, daß ein einziger Virus mit Affinität zu T-Lymphozyten unmöglich alle unterschiedlichen Komponenten des Immunsystems - T-Zellen, natürliche Killerzellen, B-Lymphozyten und Makrophagen - gleichzeitig betreffen kann. Dies ist bei Aids-Patienten aber in der Regel der Fall. Deshalb und wegen der steigenden Zahl von HIV-negativen Aids-Fällen, wuchs bei Root-Bernstein der Verdacht, etwas anderes als HIV müsse beteiligt sein. Die jüngsten epidemiologischen Daten geben ihm recht. Studien an homosexuellen Männern und Fixern zeigen, daß die durchschnittliche Inkubationszeit zehn Jahre beträgt. Wäre Aids ausschließlich durch HIV gesteuert, müßte die Krankheit 1993 bei etwa der Hälfte aller HIV-Infizierten des Jahres 1983 zum Ausbruch gekommen sein. Für die infizierten Bluter, eine klar abgrenzbare und daher leicht zu erfassende Gruppe, trifft dies freilich nicht zu. In den USA infizierten sich zwischen 1981 und 1984 fünfzehntausend Bluter mit HIV. Somit wäre zu erwarten, daß heute etwa die Hälfte von ihnen an Aids erkrankt ist. Bisher wurden jedoch nur eintausendfünfhundert Aids-Fälle bei Blutern registriert, dies entspricht nur zehn Prozent der Infektionen.), Wenn es einen Beweis dafür gibt, daß HIV nicht allein für die Entwicklung von Aids verantwortlich ist, dann diesen«, meint Root-Bernstein. Was spielt sonst noch eine Rolle? Root-Bernstein: "Bevor wir HIV als alleinigen Verursacher der Immunschwäche annehmen können, müssen wir sicher sein, daß die Daten nicht auch anders gedeutet werden können. « Mit anderen Worten: Es muß festgestellt werden, daß dIe HIV-Theorie eine notwendige und hinreichende Erklärung für Aids liefert und dies auf keine andere Theorie zutrifft. In diesem Zusammenhang muß man eine Frage stellen: Wurden bei Aids-Patienten außer HIV noch andere immunschwächende Faktoren nachgewiesen? Die Antwort lautet, so Root-Bernstein, eindeutig ja. Bei allen Aids-Patienten sind vor, gemeinsam mit, nach und manchmal auch ohne HIV-Infektion mehrere Ursachen für die verminderte Immunstärke zu beobachten. «Bei den immunschwächenden Faktoren lassen sich sieben Grundtypen unterscheiden chronische und wiederkehrende Infektionskrankheiten, hervorgerufen durch immunschwächende Organismen (wie Mykoplasmen), stimulierende Suchtdrogen, Anästhetika (Schmerzmittel), Sperma, Blut (durch intravenösen Drogenmißbrauch oder Transfusionen), Unterernährung und Antibiotika. Zwar kommen nur bei wenigen Aids-Patienten alle Faktoren zusammen, Root-Bernsteins Forschungen ergaben jedoch, daß bei allen Patienten mindestens einer und mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere dieser Faktoren zutreffen. Insbesondere die Immunschwächung durch Antibiotikamißbrauch wurde als Aids-Risikofaktor übersehen, meint Root-Bernstein. Die traurige Ironie dabei ist, daß Antibiotika, im Gegensatz zu allen anderen Co-Faktoren, als krankheitsvorbeugend gelten. Allem Anschein nach ist gerade das Gegenteil der Fall. Antibiotikamißbrauch ist besonders bei den beiden größten Aids-Risikogruppen, homosexuellen Männern und Fixern, sehr verbreitet. Homosexuelle waren sich ihrer erhöhten Krankheitsanfälligkeit bewußt, lange bevor das Aids-Problem entstand. Viele von ihnen nahmen in den siebziger Jahren freiwillig an Experimenten teil, bei denen Hepatitis-Impfstoffe getestet wurden. Viele wurden zu Dauerkonsumenten antibiotischer Medikamente, entweder zur Vorbeuge oder zur Behandlung wiederkehrender Geschlechtskrankheiten und anderer Beschwerden. Meist wurden Antibiotika eigenmächtig eingenommen und durch geschickte Überredungsmanöver von arglosen Ärzten oder Apothekern beschafft. 1987 veröffentlichte das Southern Medical Journal eine statistische Untersuchung über den Antibiotikakonsum bei homosexuellen Männern. Dr. Linda Pifer und ihre Mitarbeiter von der medizinischen Fakultät der Universität von Tennessee führten unter den regelmäßigen Besuchern von Schwulenbars in Memphis eine umfangreiche Studie durch. Sie stellten fest, daß vierzig Prozent der Männer sich regelmäßig selbst mit verschreibungspflichtigen Antibiotika behandelten. Dazu kam der Mißbrauch von Drogen, unter anderem von Nitriten. Viele Fixer wissen um das erhöhte Infektionsrisiko, dem sie sich aussetzen, und treffen daher Vorbeugemaßnahmen zu ihrem vermeintlichen Schutz. In einem Leserbrief an das Journal o[ the American Medical Association berichteten die Internisten Dr. Scott R. und Dr. Sydria K. Schaffer von ihrer dreimonatigen Tätigkeit in den Notaufnahmen der Universitätskliniken der Temple- und der Hahnemann-Universität. Sechzig Prozent der Drogenabhängigen, die sie dort behandelten, nahmen regelmäßig Antibiotika ein. Sie hofften, damit einer eitrigen Entzündung des Unterhautgewebes, Venenentzündungen (Phlebitis) und der Bildung von Abszessen vorzubeugen. Diese Infekte treten bei Fixem häufig auf. Die Einnahme von Antibiotika wurde von den Befragten anfangs verschwiegen, wohl deshalb, damit sie nicht preisgeben mußten, auf welchem Weg sie sich diese Medikamente beschafft hatten. Nahezu jeder Fixer gab schließlich zu, daß sein Drogendealer auch mit Antibiotika handelte. Illegaler Drogen- und Antibiotikamißbrauch sind mittlerweile untrennbar miteinander verbunden. Über Monate oder sogar Jahre hinweg wird tagtäglich beides gleichzeitig konsumiert. » Ironischerweise machen sich die Menschen durch den Schutz vor alltäglichen Erregern anfällig für exotischere und tödliche Infekte«, so Root-Bernstein. Viele dieser Infekte, wie zum Beispiel die PneumocystisLungenentzündung zählen zu den fast dreißig Krankheitserscheinungen, die bei Aids beobachtet werden. Drogenkranken zufolge, die Antibiotikamißbrauch zugaben, ist das am häufigsten erhältliche antibiotische Präparat das Cephalosporin Cefalexin. Dies ist ein Breitspektrumantibiotikum, das nicht nur die Resistenzbildung fördert, sondern außerdem starke immunschwächende Eigenschaften aufweist. Daraus ergibt sich nicht nur ein theoretisches Risiko: Diese Wirkung wurde in klinischen Untersuchungen nachgewiesen. Dr. P. H. Chandrasekar und seine Kollegen von der medizinischen Fakultät der » Warne State University« in Detroit äußerten 1990, Antibiotikamißbrauch zähle, neben anhaltendem intravenösem Drogenmißbrauch, häufig wechselnden Geschlechtspartnern und Unterernährung zu den Hauptfaktoren, die mit der Entwicklung von Aids in engen Zusammenhang gebracht werden müssen - in vielen Fällen völlig unabhängig von einer HIV-Infektion. Die immunsuppressiven, das heißt immunschwächenden Eigenschaften von Antibiotika sind seit geraumer Zeit bekannt. Bereits in den fünfziger Jahren, noch zu Beginn der Antibiotika-Ära, erschienen etliche Berichte, denen zufolge die Behandlung mit Penicillinen häufig zu begleitenden Infektionen mit Pilzen, vor allem Hefen wie dem Soorpilz Candida albicans führte. Dabei spielt die Zerstörung der natürlichen Feinde der Hefepilze, apathogener Bakterien im Körper, eine Rolle. Außerdem beeinträchtigen Antibiotika das Immunsystem, dessen Aufgabe es ist, einem übermäßigen\ Wachstum dieser allgegenwärtigen Organismen Entgegenzuwirken Das Spektrum der Hefepilzerkrankungen reicht vom lästigen, aber relativ harmlosen Befall der Vagina bis hin zu tödlichen Infektionen mit Candida-Sepsis, die immer häufiger bei Krebs und Aids-Patienten zu verzeichnen sind. Diese Beeinträchtigung des körpereigenen Abwehrsystems ergibt sich aus einer Reihe unterschiedlicher biochemischer Mechanismen und je nach Art der eingenommenen Mittel. Das Antibiotikum Chloramphenicol wird als immunsuppressiv bezeichnet, da es erwiesenermaßen verschiedene Funktionen des Immunsystems stört. Bei Männern, die durch Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) immunisiert worden waren und vor der Auffrischungsimpfung zehn bis vierzehn Tage lang mit Chloramphenicol behandelt wurden, fiel die normalerweise sehr heftige Antikörper-Reaktion nach der Auffrischung nur schwach aus. Im Tierversuch ist es sogar gelungen, die Abstoßung von Hauttransplantaten nicht verwandter Tiere durch vorherige Behandlung des Empfängertiers mit Chloramphenicol hinauszuzögern. Dies war allerdings keine begrüßenswerte Entdeckung in Hinblick auf die Behandlungsmöglichkeiten in der Humanmedizin, sondern vielmehr ein deutlicher Beweis für die weitreichende Beeinträchtigung des Immunsystems durch dieses Antibiotikum. Nach allgemeiner Expertenansicht ist diese starke Immunsuppression auf die schwerwiegende Hemmung der Proteinsynthese zurückzuführen: Die Bildung jener Proteine wird gestört, die für die verschiedenen Funktionen des Immunsystems wichtig sind. Hätte lediglich Chloramphenicol diese Auswirkung, wäre die Gefahr, an Aids zu erkranken, für Homosexuelle, Fixer und andere Risikogruppen geringer. Chloramphenicol bildet jedoch nur den Prototyp einer breiten Palette von Antibiotika, die ebenfalls die Proteinsynthese stören und somit die Immunabwehr in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigen. Die biochemischen Abläufe sind je nach Medikament leicht unterschiedlich, wirken sich letztlich jedoch stets ähnlich aus. Aus dieser Antibiotikagruppe ist vor allem das Tetracyclin hervorzuheben, jenes Mittel, das Dr. Luc Montagnier auf seiner Suche nach weiteren Aids-Faktoren für die Resistenz der Mykoplasmen verantwortlich machte. Tetracyclin wird von Homosexuellen zur Krankheitsprophylaxe bevorzugt eingenommen. Andere Antibiotika, die den Folsäurestoffwechsel stören, können das Immunsystem ebenfalls schädigen. Zu dieser Gruppe zählen die Sulfonamide sowie Trimethoprim und Pyrimethamin. Die Hemmung der Folsäuresynthese ist in gewisser Weise von Vorteil, da Bakterien dieses Vitamin zu ihrer Vermehrung benötigen. Wird das Medikament jedoch über einen längeren Zeitraum oder hoch dosiert eingenommen, geht die Wirkung über die Hemmung der Mikroben hinaus und beeinträchtigt die Immunabwehr. Viele der neueren Antibiotika, wie zum Beispiel die jüngst entwickelten Cephalosporine, Amikacin und Piperacillin - die jeder der in Philadelphia befragten Fixer einnahm- , werden als Immunmodulatoren eingestuft, da sie nur ganz bestimmte Funktionen des Immunsystems betreffen. Dadurch wirken sie vermutlich weniger verheerend. In Bezug auf Aids trifft dies allerdings nicht zu. Eine Komponente des Immunsystems, auf die sie sich auswirken, sind die bei Aids besonders betroffenen T -Zellen. Es hat sich gezeigt, daß diese Antibiotikagruppe Essentielle Mineralien und Spurenelemente, besonders Zink, aber auch Kalzium und Selen, binden oder sie auf andere Weise dem Körper entziehen. T-Zellen benötigen einen oder mehrere dieser Stoffe zur Teilung und Klonierung. Sind diese wichtigen Funktionen für die Immunreaktion gegen einen fremden Mikroorganismus gestört, wird der Körper rasch anfällig für die Aids-typischen, opportunistischen Infektionen. 1992 Entdeckten Wissenschaftler der medizinischen Fakultät der Vanderbilt-Universität, daß jene T-Zellen-Subpopulationen Zink am nötigsten zum Wachstum brauchen, die den CD4-Rezeptor tragen, der im Zusammenhang mit Aids bereits zu einem gängigen Begriff geworden ist. Laut Definition ist der Ausbruch von Aids ohne eine Reduzierung der CD4-T-Zellen unter einem Wert von dreihundert nicht möglich. Selbst ohne die Einnahme von Antibiotika haben homosexuelle Männer und Drogenkranke im Vergleich zu lesbischen Frauen und Heterosexuellen ungewöhnlich niedrige Zink- und Selenspiegel im Blut. Der Grund dafür wurde bisher noch nicht eindeutig ermittelt. Einige Wissenschaftler meinen jedoch, es handele sich dabei entweder um eine Folge von Mangelernährung, um eine Häufung von Infektionen oder eine Verquickung von beidem. Jene geringen Werte wurden bereits bei Personen ohne erkennbare Krankheitssymptome festgestellt. Durch die Einnahme von Antibiotika werden zusätzlich zu den bereits bestehenden Mängeln dem Immunsystem Spurenelemente entzogen, so daß es schließlich seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Auch Antibiotika, die speziell gegen parasitäre Infektionen eingesetzt werden, haben eine Reihe von Immunschwächenden Nebenwirkungen, daher könnten vor allem Afrikaner von diesen Medikamenten betroffen sein, denn sie sind sowohl für Malaria und Schistosomiasis, eine durch Würmer hervorgerufene Krankheit, als auch für Aids anfällig. Chloroquin (Resochin), das am häufigsten zur Behandlung von und Vorbeugung gegen Malaria verwendete Antibiotikum, wurde eingehend auf seine immunsuppressiven Eigenschaften untersucht. In Labortests war die Vermehrung von T-Zellen sowie ihre Fähigkeit, fremde Organismen zu vernichten, nach der Behandlung mit Chloroquin von hundert auf fünfundzwanzig Prozent reduziert. Dieses Mittel ist ein so effektives Immunsuppressivum, daß es sogar zur Behandlung schwerer rheumatoider Arthritis eingesetzt wird. Diese Erkrankung, die durch Überaktivität des Immunsystems hervorgerufen wird, ist in vielerlei Hinsicht geradezu das Gegenteil von Aids. Nach Root-Bernsteins Ansicht wurden bisher keine hinreichenden klinischen Studien über die immunschwächende Wirkung parasitentötender Antibiotika durchgeführt. Er habe allerdings den Eindruck gewonnen, daß diese Antibiotika für die hohe Aids-Rate in Afrika mitverantwortlich seien. Auch homosexuelle Männer verwenden sehr häufig Antiparasitika. Zwischen zwanzig und fünfzig Prozent der Homosexuelleni n den amerikanischen Großstädten leiden wiederholt an einer Reihe gleichzeitig auftretender parasitärer Darminfektionen. Aus diesem Grund wenden sie regelmäßig Antiparasitika an Auch vorbeugend in Selbstmedikation oder nach ärztlicher Anordnung. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie Antibiotika Aids begünstigen können, sowohl über das Immunsystem als auch durch andere Mechanismen. Das antimykotische Medikament Ketoconazol, das häufig bei homosexuellen Aids-Risikopatienten zur Behandlung von Infektionen verordnet wird, hemmt die Produktion des Hormons Cortisol in der Nebennierenrinde. Die Folgen sind Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Störung der Kalium- und Natriumspiegel sowie niedriger Blutdruck. Cortisolmangel ist äußerst gefährlich für alle, die großem Streß ausgesetzt sind, insbesondere vor chirurgischen Eingriffen. Rifampicin beschleunigt den Abbau von Cortisol. Das Antibiotikum Trimethoprim/Sulfamethoxazol, das vielfach von Homosexuellen und Drogenkranken eingenommen wird, wurde mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse in Zusammenhang gebracht. Diese Erkrankung wird bei der Hälfte aller Autopsien von homosexuellen Männern festgestellt. Das Medikament stört auch den Folsäurestoffwechsel. Nitrite sind keine Antibiotika, sie können aber zusammen mit diesen verheerende Schäden anrichten. Inhalate wie Amylnitrit und Butylnitrit gehören schon zum Alltag homosexueller Männer. Dieselbe Studie, die Antibiotikamißbrauch bei Homosexuellen in Memphis feststellte, ergab auch, daß achtzig Prozent der untersuchten Männer zumindest gelegentlich Nitrite verwendeten, dreißig Prozent davon öfter als einmal wöchentlich. In Metropolen wie Washington, San Francisco, Los Angeles und New York geben etwa fünfundneunzig Prozent der Homosexuellen die Anwendung von Nitriten zu, viele von ihnen nehmen sie sogar regelmäßig. Dieser Mißbrauch beruht auf der erweiternden Wirkung hinsichtlich der glatten Eingeweidemuskeln, was den Analverkehr erleichtert und aufgrund der erweiterten Blutgefäße im Gehirn offenbar auch das sexuelle Lustempfinden steigert. Nitrite wirken immunschwächend, und noch am Anfang der Aids-Krise erwog die CDC - bevor der HIV-Virus entdeckt wurde - ernsthaft die Möglichkeit, daß Nitritmißbrauch die Aids-Ursache sein könnte. Besonders beängstigend sind die Auswirkungen, wenn Antibiotika und Nitrite gemeinsam zum Einsatz kommen, und die gleichzeitige Einnahme ist sehr wahrscheinlich, da der Mißbrauch beider Medikamente gerade in bestimmten Gruppen sehr verbreitet ist. In Labortests und Tierversuchen zeigte sich, daß Nitrite die meisten Antibiotika in Karzinogene, krebs erregende Stoffe, verwandeln können. Zwar ist es noch nicht erwiesen, man nimmt jedoch an, dass dieselbe chemische Reaktion auch bei Homosexuellen abläuft. Sollte diese Vermutung zutreffen, wäre dies eine Erklärung für die große Häufigkeit von KaposiSarkom und malignem Lymphom, dem Lymphknotenkrebs, die bei dieser Risikogruppe fast durchwegs zu beobachten sind. Welche Schlüsse können wir nun aus all diesen Daten ziehen? Ganz gleich, was wir bisher geglaubt haben, wir müssen die Rolle des HIV für die Entwicklung von Aids neu bewerten. Da wir uns so sehr daran gewöhnt haben, HIV als »das Aids-Virus« zu bezeichnen, oder sogar die HIV-Infektion mit der Erkrankung Aids gleichsetzten, wird das Umdenken schwerfallen. Aber es ist höchste Zeit, unser Interesse den Co-Faktoren zuzuwenden, insbesondere den Antibiotika. Zu umfangreich sind die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur immunschwächenden Wirkung von Antibiotika, als daß wir sie ignorieren könnten. Dieses Wissen muß allen gefährdeten Personen vermittelt werden. Gefährliche Importe aus der Dritten Welt Als Marshall McLuhan die Welt als »global village«, als ein großes Dorf bezeichnete, beschrieb er das Ergebnis der elektronischen Revolution. Dieser Begriff kann jetzt auch in Bezug auf die Antibiotikaresistenz verwendet werden. Das »global village« wurde nämlich zum Reagenzglas für die Züchtung einer Vielzahl antibiotikaresistenter Bakterienstämme. Die Vereinigten Staaten und die übrige industrialisierte Welt haben im Umgang mit diesem Problem versagt. Doch selbst mit einem wohldurchdachten und perfekt umgesetzten Plan wären wir noch in Schwierigkeiten. Die Anzahl resistenter Erreger, die sich in den entwickelten Ländern bilden, ist ein Rinnsal verglichen mit dem reißenden Strom, der in der Dritten Welt entfesselt wurde. Die sich daraus ergebenden Folgen sind nicht nur hypothetische Gedankengebäude, über die sich die Wissenschaftler in der medizinischen Fachliteratur Auslassen sollten. Es handelt sich vielmehr um ein ernstes Problem, das uns ebenso direkt betreffen kann, wie jede andere Krise im Ausland, die wir vor dem Fernseher oder in den Zeitungen mitverfolgen. Allerdings macht dieses Dilemma weder vor geographischen noch vor politischen Grenzen halt. Ebenso wie tödliche Bakterien in unseren Krankenhäusern zunehmen und sich von dort ausgehend in der Bevölkerung verbreiten, bereichern auch die durch Selektion gestärkten resistenten Mikroorganismen aus Nigeria, Chile oder Thailand das beständig anwachsende globale Reservoir resistenter Krankheitserreger. Und diese können sich schließlich über die ganze Welt verbreiten. Schutzlos werden wir dann jenen Bakterien ausgeliefert sein, die zu einem ebenso gewöhnlichen und zugleich gefährlichen Import aus den Entwicklungsländern geworden sind, wie Kokain und Heroin, deren Einfuhr wir ja auch nicht verhindern können. Durch die Zunahme der Fernreisen ist die Verbindung zur Antibiotikaresistenz in der Dritten Welt hergestellt. Bakterien, die sich dort bilden, hängen sich Einfach an Reisende oder Exportartikel an und lassen sich wie Anhalter über Ozeane und Kontinente hinweg mitnehmen. Die Dritte Welt bildet aus vielen Gründen eine ideale Brutstätte für resistente Bakterien. Einige sind kultureller, andere wirtschaftlicher Natur. Aber letztlich lassen sich zwei Hauptfaktoren feststellen: ungeeignete Antibiotikawahl und falsche Dosierung. Dies stellt auch in den Industrieländern das Kernproblem dar, in den Entwicklungsländern aber hat es wahrlich bizarre Formen angenommen. Dr. Sjaak van der Geest, ein medizinischer Anthropologe aus Holland, beschreibt ein Erlebnis, das er am Hauptbahnhof von Kumasi in Ghana hatte. Kurz nach seiner Ankunft wurde er auf einen Jungen aufmerksam, der Kapseln aus einer Plastiktüte verhökerte. Dr. van der Geest fragte, wofür diese Kapseln gut seien. »Gegen Hämorrhoiden«, antwortete der Junge mit Fachmännischem Selbstbewußtsein. Auf dem Bahnhof verfolgte van der Geest einige Zeit den regen Handel mit dem Medikament. Später beobachtete er, wie der Junge dieselben Kapseln als Mittel gegen Impotenz verkaufte. Seine Neugier wuchs, van der Geest kaufte dieses Wunderheilmittel schließlich selbst. Wieder daheim in Holland, ließ er das Medikament analysieren: Es handelte sich um zweihundertfünfzig Milligramm eines Antibiotikums namens Penbritin.':. Dieses Mittel wirkt zwar gegen bakterielle Infektionen, zur Behandlung von Hämorrhoiden, Impotenz und all der anderen Beschwerden, gegen die es der geschäftstüchtige Junge anbot, ist es aber denkbar ungeeignet. Auf den Marktplätzen in Nairobi und den meisten anderen Städten Afrikas wird eine stattliche Anzahl unterschiedlicher Antibiotikakapseln auf riesigen Tabletts angeboten- zusammen mit einer ebenso bunten Auswahl an Bonbons und Süßigkeiten. Tagtäglich kann man lange Schlangen von Menschen beobachten, die anstehen um eine einzige Kapsel Chloramphenicol, Tetracyclin oder Penicillin zu erstehen. Sie behandeln damit Kopf- oder Bauchschmerzen oder versprechen sich davon einen Rundumschutz gegen Geschlechtskrankheiten. Die Einnahme einer Kapsel würde keinen großen Schaden anrichten, doch für Hunderttausendein der Dritten Welt ist es ganz normal, regelmäßig Antibiotika bei Straßenhändlern zu kaufen. Dies sind ideale Bedingungen für eine gefährliche Entwicklung. Bei jeder dieser unkontrollierten AntibiotikaEinnahmen findet die Selektion resistenter Krankheitserreger- falls vorhanden- oder apathogener Bakterienstämme, die immer im Körper existieren, statt. Daher ist zum Beispiel die Ampicillinresistenz in der indischen Stadt Vellore wesentlich verbreiteter als etwa in Edinburgh. Aus diesem Grund waren E.coliBakterien, die aus Stuhlproben in einer Kinderkrankenstation in Kenia isoliert wurden, gegen Streptomycin, Tetracyclin und Ampicillin resistent, und deshalb sind in Bangladesch über achtzig Prozent der Shigella gegen Ampicillin und Trimethoprim, also die Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von Ruhr, widerstandsfähig. In einer anderen Studie wurden die Darmbakterien vollkommen gesunder Kinder und Kleinkinder aus Boston, Caracas, Venezuela und Quin Pu in China verglichen. Dabei wurde speziell untersucht, wie resistent die Darmbakterien von Kindern waren, die noch nie Antibiotika eingenommen hatten. Daß es an all diesen Orten schwierig war, überhaupt Kinder im Alter unter fünf Jahren zu finden, die noch nie antibiotisch behandelt worden waren, ist bereits ein weiteres Anzeichen für die unmäßige Anwendung dieser Medikamente weltweit. Die E.coli-Bakterien der Bostoner Kinder waren wenig resistent gegen die acht Getesteten Antibiotika, die bei Kindern aus China und Venezuela isolierten E.coli dagegen zeigten starke Resistenz. Eine weitere Studie stellte fest, daß Gonokokken, die Erreger der Gonorrhoe, in Ländern, in denen keine Rezeptpflicht für Antibiotika besteht, zu fünfundsiebzig Prozent resistenter sind als anderswo, in Ländern mit strengen Arzneimittelverordnungen dagegen nur zu zwanzig Prozent. Eine Untersuchung der Universität von Texas demonstrierte nicht nur, daß antibiotikaresistente Bakterien in der Dritten Welt sehr viel verbreiteter sind, sondern auch, wie leicht diese Erreger in industrialisierte Länder eingeschleppt werden können. Bei US-Amerikanern, die in Mexiko studiert hatten, fanden sich nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten in ihren Darmbakterien Resistenzplasmide gegen Trimethoprim. Gegen dieses Antibiotikum waren sie vor ihrem Mexikoaufenthalt noch nicht resistent gewesen, zumal die Resistenz gegen Trimethoprim bis vor kurzem in den Vereinigten Staaten äußerst selten war. Diese Art der gefährlichen subtherapeutischen oder untherapeutischen Dosierung ist ein Problem, das nicht nur von den Straßenverkäufern der Dritten Welt ausgeht. In Entwicklungsländern ist es gang und gäbe, im Krankheitsfall einen Heiler aufzusuchen, wie zum Beispiel den Medizinmann eines Stammes in Afrika oder einen »Spritzendoktor« in Südostasien, besonders in Laos. Diese Heiler verwenden traditionell Kräuter oder andere in der westlichen Welt unübliche Heilmittel, doch diese werden immer unbeliebter. Der Glaube, westliche Medikamente besäßen magische Heilkräfte sowie vorbeugende Wirkung, macht sich seit geraumer Zeit in den Entwicklungsländern breit. Aus diesem Grund übernehmen viele traditionelle Heiler westliches Marketing und geben nun ihren Patienten, was sie verlangen. Sie beziehen westliche Medikamente, vor allem Antibiotika, in ihre Behandlungsmethoden ein. Auch wenn sie sicherlich in besserer Absicht als die Straßenverkäufer handeln, sind die Folgen doch meist dieselben wie bei jenen. Die Heiler sind für den richtigen Umgang mit diesen Pharmazeutika kaum oder überhaupt nicht ausgebildet, und sie verordnen Antibiotika fast immer in therapeutisch sinnlosen Dosen oder gegen Erkrankungen, die gar keine antibakterielle Behandlung erfordern. Selbst in Ländern, die eine gewisse Kontrolle über die Abgabe von Medikamenten ausüben und in denen man daher einen fachgerechteren Umgang mit diesen Medikamenten erwarten könnte, ist die Lage kaum besser. Hauptsächlich aufgrund des in Entwicklungsländern herrschenden Ärztemangels, hat der Gesetzgeber dort Apotheker mit der Rezeptierung und Abgabe von Medikamenten, einschließlich der Antibiotika, betraut. Während in den Industriestaaten statistisch gesehene ein Arzt auf fünfhundertzwanzig Einwohner kommt, ist das Verhältnis in den meisten Entwicklungsländern etwa 1: 2700, in einigen Fällen sogar nur 1: 17000. Und die meisten Apotheker dort gehen ebenso leichtfertig mit gefährlichen Arzneimitteln um wie die Straßenverkäufer. Ich erinnerem ich in diesem Zusammenhang an ein persönliches Erlebnis. Während meines Urlaubs in Rio de Janeiro 1983 litt ich an Halsschmerzen und erhöhter Temperatur. Ich vermutete keinen Streptokokkeninfekt, lediglich eine leichte virale Erkältung. Da ich - im Gegensatz zu den Ansichten vieler KollegenFestgestellt hatte, dass erhöhte Vitamin-C-Zufuhr und Zinkpastillen fast immer meine Symptome linderten, ging ich in die große Apotheke, die meinem Hotel gegenüberlag. Glücklicherweise verstand der Apotheker etwas Englisch. Nachdem ich ihm erklärt hatte, was ich wollte, händigte er mir gleich das Vitamin C aus. Da er keine Zinkpastillen hatte, bot er mir einen in seinen Augen wesentlich besseren Ersatz dafür an: Ampicillin, in der praktischen Packung mit fünf Kapseln. Mir wurde schnell klar, daß er Ampicillin oder auch andere Antibiotika gegen alle möglichen Beschwerden zu verkaufen pflegte. Soweit ich weiß, wird dies immer noch so gehandhabt. Dr. Diana Melrose aus Oxfam in Großbritannien, die sich mit dem Problem des Medikamentenmißbrauchs in Entwicklungsländern eingehend beschäftigt hat, berichtet von einem ähnlichen Erlebnis im Nordjemen, wo ein angeblich ausgebildeter Apotheker ihr kurzerhand ein Antibiotikum namens »Rivomycin Strepto« gegen ihre Diarrhoe empfahl, und zwar für eine äußerst kurz bemessene Einnahmedauer. Vor einigen Jahren führte in Thailand Visanu Thamlikitkul von der Abteilung für Infektionskrankheiten am »Siriraj Hospital« in Bangkok eine Studie über die Abgabe pharmazeutischer Produkte in der Dritten Welt durch. Die Untersuchung war ausschlaggebend für den Versuch, die Apotheken behördlich zu kontrollieren ... dies jedoch blieb ohne Erfolg. Die Apotheken, besser Drogerien, in Thailand werden in zwei Klassen unterteilt. In Läden der ersten Klasse, von denen es in Bangkok etwa 1800 gibt, muß ständig ein amtlich zugelassener Apotheker Dienst tun. Dieser allein ist gesetzlich berechtigt, antibakterielle Medikamente ohne ärztliche Verschreibung abzugeben. Vierzig Medizinstudenten im achten Semester spielten für diese Studie Patienten, die in die Drogerien erster Klasse ausschwärmen und den dort beschäftigten Apothekern unterschiedliche Beschwerden schildern sollten, die sie an sich selbst oder ihren Kindern feststellten: zum Beispiel Ausfluß aus dem Penis, eine Wunde bei einem Vierjährigen, wäßriger Durchfall bei einem sechs Monate alten Baby, Fieber und Halsschmerzen bei Kindern und Erwachsenen sowie Schnupfen und Husten bei einem zwei Monate alten Säugling. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die Studenten hätten sich ebenso gut an Straßenhändler wenden können. Nur vier der Apotheker weigerten sich, Medikamente für den zwei Monate alten Säugling zu verkaufen, und nur einer für das Baby von sechs Monaten. In allen anderen Fällen wurden bereitwillig Antibiotika abgegeben. Sowohl die Art der Antibiotika als auch die Dosierungsanweisungen variierten beträchtlich, ohne erkennbaren Sinn und Zweck. Und was die Sache noch verschlimmerte: In keinem der Fälle wurde eine ausreichende therapeutische Dosis verordnet. Die Abgabemengen reichten von einer einzelnen Dosis bis hin zu Mehrfachgaben, die für weniger als vier Tage reichten, durchschnittlich für nur zwei Tage. Wären die Mittel gegen tatsächlich bestehende Beschwerden verordnet worden, hätte es sich um therapeutisch zu geringe Dosierungen gehandelt und somit zur Selektion resistenter Bakterienstämme geführt. Neben ber mangelnden Kenntnis, wie und wogegen Antibiotika überhaupt wirken, ist in der Dritten Welt die Armut ein weiterer Grund für den Mißbrauch. Viele Menschen können es sich einfach nicht leisten, Antibiotika über einen längeren Zeitraum einzunehmen. In der Dominikanischen Republik und anderen Ländern kostet die Tagesdosis eines Medikaments oft einen ganzen Tageslohn eines Arbeiters. Eine zehntägige Medikation würde bedeuten, daß die Familie für längere Zeit nichts zu essen hätte. Damit ist die Entscheidung klar. Die Apotheken in den Entwicklungsländern stimmen die Packungsgrößen zweifellos auf diese wirtschaftlichen Verhältnisse ab. Bieten sie Antibiotika nur in Zehn-Tage-Packungen an, verkaufen sie keine. Aus Sicht des Geschäftsinhabers ist es natürlich besser, wenn wenigstens ein paar Kapseln über den Ladentisch gehen als gar keine. Die Armut wirft natürlich auch noch andere Probleme auf. Kommt es in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan zu Resistenzbildung gegen ein Medikament wie Penicillin oder Tetracyclin, sind bald neuere Mittel erhältlich, die möglicherweise aus dem einfachen rund besser wirken, weil sie noch nicht so lange auf dem Markt sind und weil sich daher noch keine so große Widerstandsfähigkeit gegen sie aufgebaut hat. Aber diese neueren Mittel sind auch teurer. Die meisten Entwicklungsländer können es sich nicht leisten, sie zu importieren. Daraus ergibt sich ein Teufelskreis: Durch mangelnde Kontrolle und früheren Mißbrauch sind die in Entwicklungsländern vorherrschenden Krankheitserreger weitgehend resistent gegen die verfügbaren Antibiotika. Dennoch werden sie weiterhin eingesetzt. Folglich setzt sich die Resistenz immer mehr durch, wird auf immer mehr Plasmide übertragen und findet schließlich ihren Weg in die Industrieländer. Die Ärzte der Dritten Welt könnten versuchen eine andere Lösung anzustreben, zum Beispiel indem sie ihre Regierungen dazu drängen, strengere Kontrollen zu veranlassen oder zumindest eine begrenzte Menge neuerer Antibiotika zu erwerben. Aber ganze Horden von Pharmavertretern, von denen die Ärzte ihre Medikamenteninformationen beziehen, arbeiten ständig hiergegen. Selbst Ärzten in den Industrienationen fällt es schwer, über die jüngsten Entwicklungen der Pharmazie auf dem laufenden zu bleiben, auch sie verlassen sich weitgehend auf die Vertreter der Pharmafirmen. In den USA bestehen für die Arzneimittelindustrie strenge Vorschriften, bei deren Überschreitung schwere Strafen drohen. Aber in der Dritten Welt gibt es keine Organisation, die mit der amerikanischen Gesundheitsbehörde »Food and Drug Administration «, kurz FDA, die auch für die Zulassung von Medikamenten zuständig ist, vergleichbar wäre. Die Pharmaunternehmen können praktisch über ihr Produkt verbreiten, was sie wollen. Und sie tun dies auch. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren allerdings Wesentlich gebessert. Unter dem Druck der Forschungsergebnisse von Dr. Phillip R. Lee und Dr. Milton Silverman von der Universität von Kalifornien in San Francisco, die bereits in den siebziger Jahren viele Unzulässige Vermarktungspraktiken der Pharmaindustrie aufdeckten, veröffentlichte der Internationale Verband der pharmazeutischen Industrie (»International Federation of Pharmaceutical Manufacturers ~ Associations«, IFPMA) 1981 einen Kodex mit Wettbewerbsregeln für die pharmazeutische Industrie (Code for Pharmaceutical Marketing Practices) Mitgliedsunternehmen sind dazu aufgerufen, all ihre '" Geschäfte in »völliger Offenheit« zu führen und ihre ~~ Behauptungen auf wissenschaftlich belegbare Fakten ':" zu beschränken. Wie Dr. Lee Ende der achtziger Jahre in einer. Nachfolgestudie feststellte, hielten sich die meisten der großen internationalen Konzerne auch an diese Vorschriften. Ergänzend zum IFPMA-Kodex kamen gesetzliche Regelungen und die Informationsarbeit verschiedener Verbraucherschutzgruppen hinzu, wie z.B. „Health Action Interntional“ kurz HAI, eine Organisation mit Büros in Südamerika, Asien und Amsterdam, die Internationale Verbraucherschutzorganisation „Interntional Organisation of Consumer Unions (IOCU) mit Sitz in London, die sich seit Januar 1995 »Consumers International« nennt, sowie die englische Organisation »Social Audit« und die jüngst gegründete» Medical Lobby for Appropriate Marketing“ Dieser Organisation ist es zu verdanken, dass einige wirkungslose oder potentiell schädliche Medikamente vom Markt geworden wurden, insbesondere gefährliche und sinnlose Arzneimittelkombination, wie sie in der Dritten Welt häufig angeboten werden. Auch einige irreführende Werbebehauptungen wurden abgeändert. Leider ist das Resultat immer noch nicht völlig befriedigend. Es bestehen Diskrepanzen, da viele der kleineren Pharmaunternehmen mit Sitz in Entwicklungsländern ihre unlauteren Wettbewerbsmethoden beibehalten, so daß Antibiotika immer noch gegen die falschen Krankheitserscheinungen eingesetzt werden. Hier ist kein Ende abzusehen. Wieviel Schaden wird nun durch diesen beklagenswerten Antibiotikamißbrauch in der Dritten Welt tatsächlich angerichtet? Man weiß um das Problem schon seit 1969, als eine dramatische Ruhrpandemie in Guatemala ausbrach und sich in sechs mittelamerikanische Länder und nach Südmexiko ausbreitete, bis sie schließlich im darauffolgenden Jahr abebbte. Eine halbe Million Menschen war von dieser gewaltigen Epidemie betroff~ n, Tausende starben daran. Ausgelöst wurde die verheerende Seuche von einem Erregerstamm mit einem R-Plasmid, das für die Resistenz gegen Sulfonamide, Streptomycin, Tetracyclin und Chloramphenicol sorgte. Dann, 1972, brach in Mexiko-Stadt eine Typhusepidemie aus, mehr als 10000 Menschen erkrankten. Später, in den siebziger und achtziger Jahren brachen weltweit in Entwicklungsländern ähnliche Infektionskrankheiten mit mehrfacher Antibiotikaresistenz aus, von Mexiko bis Bangladesch, Indien, Burma, Sri Lanka und Zaire. Ebenfalls in den siebziger Jahren wütete in Afrika eine verheerende Cholerapandemie, ausgelöst durch das sogenannte EI-Tor-Bakterium. Heute sind in großen Teilen Afrikas mehr als fünfzig Prozent derartiger Bakterien resistent gegen Tetracyclin, und trotz dieser weitverbreiteten Resistenz wird Tetracyclin in geradezu erstaunlichem Ausmaß weiter verabreicht. Es hat sich nichts geändert, seit Dr. Stuart Levy von der Tufts-Universität, ein weltweit anerkannter Experte auf dem Gebiet des Antibiotikamißbrauchs, 1981 bei seinem Besuch in einem Labor in Jakarta, Indonesien, folgendes erlebte: 100000 indonesische Muslime wollten sich mit einer Pilgerfahrt nach Mekka einen Lebenswunsch erfüllen. Das indonesische Ministerium für Religion war allerdings besorgt über die Verbreitung von Krankheiten auf einer so langen Reise, mit so vielen, dicht zusammengedrängten Menschen. Vor allem die Verbreitung von Cholera war zu befürchten. Als Vorsichtsmaßnahme wurden von sämtlichen in den Flugzeugen und Zügen gereichten Mahlzeiten Bakterienkulturen angelegt und alle 100000 Pilger wurden vorbeugend mit Tetracyclin behandelt. Diese prophylaktische Anwendung war nicht nur unangebracht, das Probllem wurde durch die Antibiotikagaben noch verschärft, da die Bakterien bereits gegen Tetracyclin resistent waren. Doch der Regierung stand nur dieses Medikament zur Verfügung, und man wußte nicht, wie man der drohenden Gefahr sonst begegnen sollte. Nicht lange, nachdem die Epidemien in der Dritten Welt ihren Höhepunkt erreicht hatten, fand man heraus, dass Resistenzgene übertragbar sind. In vielen Fällen steckten sich ausländische Reisende in diesen Ländern mit denselben mehrfachresistenten Infektionserregern an oder wurden auf andere Weise zu Trägern der Antibiotikaresistenzplasmide und brachten diese mit nach Hause. Dieses Phänomen der Übertragung von Antibiotikaresistenz gab es auch schon unter weniger katastrophalen Umständen, häufig sogar völlig unbemerkt, es bereitet uns aber heute immense Schwierigkeiten. Bevor die amerikanischen Streitkräfte nach Vietnam gingen, reagierten die Gonorrhoebakterien der westlichen Welt einheitlich empfindlich auf Penicillin. Als dann aber Amerikaner die Bordelle in Saigon besuchten, zogen sie sich einen ungewöhnlichen GonorrhoeErreger zu, der fast völlig resistent war. Den Prostituierten dieser Bordelle war seit geraumer Zeit regelmäßig Penicillin verabreicht worden, um sie vor dieser Geschlechtskrankheit zu schützen. Diese wohl gutgemeinte, aber letztlich schlechte Maßnahme bewirkte gerade das Gegenteil. Denn so fand schließlich die Selektion der seltenen penicillinresistenten Gonokokken statt, die auf die amerikanischen Soldaten übertragen wurden und die mit ihnen in die Vereinigten Staaten gelangten. Heute findet man kaum noch penicillinsensitive Gonokokken in Amerika oder Europa. In der heutigen Zeit, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs müssen wir mit antibiotikaresistenten Bakterienstämmen Beispielsweise aus Ungarn, wo mehr als fünfzig Prozent der Erreger der Lungenentzündung bereits penicillinresistent sind, und anderen Ländern rechnen, in die nun viele Touristen aus westlichen Ländern reisen. Das alles muß nicht sein. Eine Untersuchung über den Einsatz von Antibiotika in medizinischen Grundversorgungseinrichtungen in Harare, Simbabwe, machte deutlich, daß es durchaus möglich ist, das medizinische Hilfspersonal im fachgerechten Umgang mit Antibiotika zu schulen. Die Versorgung in diesen Kliniken war ebenso gut wie sie in den meisten amerikanischen Krankenhäusern ist. Und kürzlich meldeten sich sowohl in Nigeria als auch Costa Rica Wissenschaftler zu Wort, die die Verantwortlichen der Gesundheitspolitik dazu bewegen wollen, auf den gefährlichen Einsatz alter Antibiotika zu verzichten. Statt dessen soll für einen gezielten Einsatz wirksamerer Mittel gesorgt werden. Wird mit diesen neueren Medikamenten allerdings nicht vernünftig umgegangen wiederholt sich derselbe Kreislauf. Größere Tiere, höhere Resistenz Vor einigen Jahren nahm ich an einem Wissenschaftlerkongreß der Universität von Kalifornien in Berkeley teil. Das gesellschaftliche Rahmenprogramm sah für den Samstagabend einen Ball auf einem gecharterten Schiff vor. An diesem Abend wurden meine Frau und ich Dr. Thomas Jukes vorgestellt. Jukes, emeritierter Biologieprofessor an der Universität in Berkeley und mittlerweile Mitte achtzig, hatte als Ernährungswissenschaftler Berühmtheit erlangt. Er hatte in den vierziger und fünfziger Jahren grundlegende Forschungsarbeit über das Vitamin B12 geleistet. Aber ich sollte noch etwas anderes über Dr. Thomas Jukes erfahren. Ich stand dem Mann gegenüber, dessen Arbeit vielleicht mehr als die irgend eines anderen zum verbreiteten Einsatz antibiotischer Mittel in den USA beigetragen hatte. 1948 suchte Jukes, damals noch ein junger Forscher in den Laboratorien des amerikanischen Pharmaherstellers Lederle, zusammen mit seinem Kollegen Robert Stokstad nach Methoden zur Wachstumssteigerung bei Küken. Die Forscher waren vor allem an der Gewinnung von Vitamin B12 als Zusatz zum Geflügelfutter interessiert, das hauptsächlich aus Sojabohnenmehl hergestellt wurde und daher kein Vitamin B12 enthielt. Dieses Vitamin wird nicht von Pflanzen produziert. Eine Reihe glücklicher Zufälle ließ sie nicht nur finden, was sie gesucht hatten, sondern noch weit mehr. Nur ein Jahr zuvor hatte ein anderer Wissenschaftler der Lederle-Laboratorien, Benjamin Duggar, aus Bodenbakterien das erste Tetracyclinantibiotikum isoliert: Chlortetracyclin, auch als Aureomycin bezeichnet. Diese Entdeckung wurde als bedeutender Durchbruch gefeiert, und die Produktion von Chlortetracyclin aus Tonnen von Bodenbakterien lief in großem Maßstab an. Nach der Gewinnung des Antibiotikums blieb in den Behältern ein Bakterienrückstand, für den bei Lederle zunächst niemand Verwendung hatte. Daher beanspruchten ihn Jukes und Stokstad, in dem Wissen, daß Bakterien Vitamin B12 produzieren können. Wie für sie gemacht, bot sich ihnen eine billige und leicht erhältliche Quelle dieses Vitamins. Als Jukes und Stokstad diese Masse dem Futter junger Küken beimengten, übertraf deren Wachstum alle Erwartungen. Nach nur fünfundzwanzig Tagen waren die mit der Bakterienmasse gefütterten Küken dreimal so groß wie andere Küken, deren Futter reines Vitamin B12 zugesetzt worden war. Die Wissenschaftler trauten ihren Augen kaum. Solch rasches Wachstum war beispiellos, es mußte außer an der Vitaminwirkung noch an etwas anderem liegen. Um sicherzugehen, daß es sich bei ihrer Entdeckung um keinen Einzelfall handelte, führten Jukes und Stokstad jenes Experiment wieder und wieder durch und variierten dabei die Versuchsbedingungen in jeder erdenklichen Weise. »Nur wenige Experimente wurden so oft wiederholt wie dieses«, erzählte mir Jukes. Jedesmal bewirkte der Bakterienrückstand beachtliche Wachstumserfolge, obgleich sie nicht ganz so dramatisch ausfielen wie im ursprünglichen Versuch. Rundum begeistert von ihrer Entdeckung, bezeichneten sie diesen bisher noch unbekannten Stoff als neuen ernährungstechnischen Wachstumsfaktor. Dieser Wachstumsfaktor bestand aus Spuren des Antibiotikums Chlortetracyclin, die nach der Extraktion in den Fermentationsbehältern zurückblieben. Später wurde entdeckt, daß Tetracyclin nicht nur bei Küken eine enorme Wachstumsförderung bewirkte, sondern auch bei Rindern und Schweinen. Als Jukes 1950 auf dem jährlichen Treffen der »American Chemical Society« von seinen Erkenntnissen berichtete, wurden diese von der Presse lauthals verkündet. Der Daily Telegraph brachte die Schlagzeile »Arzneimittel beschleunigt Wachstum bei Tieren um fünfzig Prozent« und berichtete weiter, »die American Chemical Society meldete in Philadelphia, daß Auromycin, bisher bekannt für seine antibakteriellen Eigenschaften, einer der bedeutendsten wachstumsfördernden Stoffe sei, die je entdeckt wurden.« Innerhalb kürzester Zeit wurde diese Entdeckung zum größten Geschenk für die Vieh- und Geflügelzucht und machte aus dieser in den frühen fünfziger Jahren noch kleinen Branche die Multi-MilliardenDollar- Industrie von heute. Da Jukes herausfand, daß schon winzige Mengen Tetracyclin, etwa 5 ppm (parts per million, entspricht fünf Milligramm pro Kilogramm), das Wachstum ebenso wirksam anregten wie höhere Dosierungen, waren die zusätzlichen Kosten für Bauern und Viehzüchter minimal. Da die zuständige Aufsichtsbehörde Antibiotikazusätze in Tierfutter als Nahrungsergänzung einstufte, und nicht als therapeutische Gabe, konnten die Antibiotika rezeptfrei verkauft werden. Antibiotikazusätze in Tierfutter stießen auf so einhellige Zustimmung, daß man den Bauern gar keine Entscheidungsmöglichkeit mehr ließ. Häufig wurden die Medikamente bereits während der Futterherstellung beigemischt, zusammen mit Vitaminen und Mineralstoffen. Als Jukes den wachstumsbeschleunigenden Erfolg mit einem anderen verfügbaren Antibiotikum, Penicillin, zu wiederholen versuchte, gelang ihm das. Auch bei anderen antibakteriellen Mitteln ließ sich danach ein wachstumsfördernder Effekt nachweisen- jedoch werden Tetracycline und Penicillin in der Viehzucht am häufigsten eingesetzt. Und nun zum Haken an der Geschichte. Antibiotika werden nun schon seit vierzig Jahren zur Wachstumsbeschleunigung verwendet, und wir wissen immer noch nicht, welche Wirkungsmechanismen Dabei ablaufen. Jukes erzählte mir, seiner Ansicht nach hätten alle sogenannten normalen Jungtiere leichte bakterielle Infekte. Diese könnten das Wachstum hemmen. Die Bakterien könnten mit dem Wirtstier direkt um das begrenzte Nährstoffangebot konkurrieren, oder aber mit den nicht krankmachenden Bakterien des Verdauungstrakts, die für die Versorgung mit manchen Nährstoffen, wie zum Beispiel Vitamin B12, zuständig sind. In beiden Fällen werde durch Antibiotikagaben eine größere Nährstoffmenge für das Tier und dessen Wachstum gesichert. Zwar haben andere Forscher Antibiotika einen verborgenen, bisher unentdeckten Nährwert beigemessen, aber Jukes widerspricht dieser Meinung. Unter völlig sterilen Laborbedingungen, in keimfreier Umgebung aufgezogene Versuchstiere erlangen durch Antibiotikagaben keinen Vorteil, sie wachsen dadurch nicht schneller. Dies legt den Verdacht nahe, daß die Wachstumsförderung auf die antibakterielle Wirkung der Antibiotika zurückzuführen ist. Tiere scheiden Antibiotika völlig unverändert wieder aus. Hätten die Mittel irgendeinen Nährwert, sollte man logischerweise annehmen, daß sie beim Stoffwechsel in irgendeiner Weise verändert werden. Warum sind in all der Zeit jene mysteriösen Bakterien, die für die Erkrankungen der Jungtiere verantwortlich sein sollen, nicht identifiziert worden? Jukes meint dazu, daß sich im Verdauungssystem warmblütiger Wirbeltiere etwa einundzwanzig Billionen Bakterien befinden, wovon viele Arten bisher noch nicht isoliert sind. Die Einführung der Antibiotika brachte zunächst eine ganze Reihe von Vorteilen. Auch heute sind die hygienischen Bedingungen auf den Bauernhöfen und in den Zuchtbetrieben nicht ideal, doch vor vierzig Jahren war es darum wesentlich schlimmer bestellt. Vor der Verwendung von Antibiotika waren die Ställe zur Aufzucht der Jungtiere oft ein Hort von Parasiten, die Erkrankungen hervorriefen. Ferkel gingen an blutiger Diarrhoe ein, Tausende Küken erstickten an Atemwegserkrankungen, und neugeborene Kälber verendeten an einer Art Ruhr. Diese Probleme konnten durch Antibiotika behoben werden. Aber fraglos wurde der Einsatz von Antibiotika aufgrund ihrer wachstumsfördernden Wirkung zur Regel. In den Vereinigten Staaten werden jährlich etwa Sechs Milliarden Tiere für den menschlichen Verzehr gezüchtet, hauptsächlich Rinder, Schweine und Geflügel, dreißigmal so viel wie das Land Einwohner zählt, von der Zahl her sogar mehr als die gesamte Weltbevölkerung. Die meisten dieser Tiere erhalten täglich mit ihrem Futter Antibiotika, von ihrer Entwöhnung bis zur Schlachtung Das ergibt einen jährlichen Antibiotikaverbrauch von knapp zehn Millionen Kilogramm, doppelt so viel wie der Verbrauch in der Humanmedizin. Doch diese Art des Antibiotika-Einsatzes wäre beinahe auch auf den Menschen angewandt worden. Die Erfolge in der Viehzucht waren so enorm, dass Jukes und andere Wissenschaftler sich mit dem Thema der routinemäßigen Verabreichung antibiotischer Medikamente an Kinder beschäftigten. Sie befürworteten die Idee, in der Annahme, daß alle Kleinkinder an ähnlichen Infekten litten wie Kälber. Selbst heute noch hält Jukes die routinemäßige Gabe von Antibiotika an Kinder für eine gute Idee. Er meint, wenn ein wirtschaftliches Interesse daran bestünde, Kinder ebenso schnell heranwachsen zu lassen wie Tiere, würde diese Methode zweifellos Anwendung finden. Es ist nicht verwunderlich, daß diese Art des AntibiotikaEinsatzes ein gewaltiges Problem heraufbeschwor. Was für die Fleisch- und Geflügelindustrie ein Segen war, erwies sich weltweit als Unheil für die Gesundheit. Die Verabreichung subtherapeutischer Antibiotikadosen an Tiere kann genauso wie beim Menschen zur Selektion resistenter Bakterienstämme führen - und die zur Wachstumsförderung eingesetzten geringen Antibiotikamengen sind subtherapeutisch, obwohl sie über längere Zeiträume gegeben werden. Das Problem wird durch die fortgesetzte Gabe dieser Dosen sogar noch erschwert. Sollte ein Mikrobiologe im Laborversuch die Selektion möglichst vieler resistenter Bakterien erreichen wollen, könnte er kein besseres Verfahren erfinden als diese tagtäglich in der Viehzucht praktizierte Methode. Die Anwesenheit dieser durch jene unverantwortlichen Praktiken gezüchteten resistenten Bakterien bleiben nun nicht auf die Tiere begrenzt, in deren Körpern sie sich entwickelten. Es gibt keine Kuhbakterien« oder »Schweine-« oder »Hühnerbakterien«. Im mikrobiologischen Sinn gehören wir Menschen zusammen mit dem übrigen Tierreich zu einem einzigen riesigen Ökosystem. Die gleichen resistenten Bakterien, die im Verdauungstrakt einer Kuh oder eines Schweines wachsen, können und werden schließlich in unsere Körper gelangen. 1965 traten in England gehäuft Lebensmittelvergiftungen und Diarrhoe auf, hervorgerufen durch Salmonellen. Solche Salmonelleninfektionen nehmen normalerweise einen vergleichsweise leichten Verlauf, in schwereren Fällen, die eine antibiotische Behandlung erfordern, spricht der Patient im allgemeinen schnell auf die Therapie an. Diesmal allerdings waren viele der Erreger gegen mehrere Antibiotika resistent, so daß die Infektion in sechs Fällen sogar tödlich verlief. Gleichzeitig mit dieser Epidemie trat eine Welle von Salmonellenvergiftungen bei Kälbern auf. Untersuchungen ergaben, daß fast fünfundzwanzig Prozent der bei Menschen identifizierten Salmonellenstämme das gleiche Resistenzmuster aufwiesen wie die Salmonellen der Kälber. Aufgrund dieser Seuchen wurde eine Gruppe von Mikrobiologen und Ärzten, das sogenannte SwannKomitee, mit intensiven Nachforschungen betraut. 1969 veröffentlichte das Swann-Komitee einen Bericht, in dem gefolgert wurde, daß langfristige subtherapeutische Antibiotikagaben an Tiere eine starke Selektion resistenter Bakterien in der Darmflora herbeiführen und diese Bakterien eine potentielle Gefährdung für den Menschen darstellen. Das Komitee empfahl das Verbot der routinemäßigen Anwendung solcher Antibiotika bei der Viehzucht, die häufig in der Humanmedizin eingesetzt werden. Außerdem wurde geraten, Antibiotika als Futterzusatz nur auf Rezept eines Veterinärmediziners zuzulassen. Die Empfehlungen wurden 1970 angenommen. Seitdem sind in Großbritannien im Tierfutter nur solche Antibiotikazusätze Gesetzlich zugelassen, die von einem Tierarzt verordnet wurden und nicht bei der Behandlung von Menschen angewandt werden. Diese Regelung wurde Schon bald von einigen anderen europäischen L ändern übernommen, zum Beispiel von Holland, ganz Skandinavien und Deutschland, Kanada schloß sich ebenfalls an. Bald nachdem das Verbot in jenen Ländern in Kraft getreten war, wurden vielfach auch in den USA gesetzliche Maßnahmen gefordert. Im April 1977 trug das FDA den Vorschlag vor, auf den Zusatz von Penicillin und Tetracyclinen im Tierfutter zu verzichten und nur noch nach tierärztlicher Verordnung »für die kürzeste zur Erzielung der beabsichtigten Wirkung nötige Dauer« zuzulassen. Die theoretische Möglichkeit, daß resistente Pathogene aus dem antibiotisch erzeugten Selektionsdruck hervorgehen, ist zu einer echten Bedrohung geworden«, so das FDA. »Wesentlich ist dabei, dass bekanntermaßen Übertragungswege bestehen, was die Gefahr des Antibiotika-Einsatzes bei Tieren noch erhöht.« Der amerikanische Kongreß hat dieses Antibiotikaverbot jedoch nie verabschiedet. Ob die Viehzüchterlobby hinter den Kulissen ihren Einfluß geltend machte oder nicht, der Kongreß verlangte jedenfalls mehr Beweise für einen Zusammenhang zwischen antibiotikaresistenten Krankheitserregern beim Menschen und der Verwendung von Penicillin und Tetracyclinen als Mittel zur Wachstumsförderung bei Tieren. Schon vor 1977, ja sogar bevor in Großbritannien 1970 jenes Gesetz in Kraft trat, war die Wissenschaft über die Frage, welche Maßnahmen zu treffen seien, in zwei Lager gespalten. Und obwohl viele der von der FDA 1977 geforderten Nachweise bereits erbracht worden waren, bestand und besteht noch heute Uneinigkeit. Es überrascht nicht, daß Jukes immer noch zu den eisernen Befürwortern des Antibiotikazusatzes zum Tierfutter zählt. Er faßte für mich die Argumente einiger Einflussreicher Wissenschaftler zusammen, die seinen Standpunkt teilen. Seiner Meinung nach wird die positive Auswirkung auf das Wachstum nun schon seit dreißig Jahren, zum Beispiel an der »Washington State University«, der »American Cyanamid Corporation« (Lederle) und der Universität von Wisconsin, beobachtet. Der Effekt bestehe trotz der Resistenzbildung weiter. Er ist der Ansicht, es gebe selbst heute keinerlei Anzeichen für einen Anstieg der Erkrankungshäufigkeit bei den Tieren, der auf resistente Stämme zurückgeführt werden könne. Einmal abgesehen von den unterschiedlichen Auswirkungen auf Tiere, ist bei diesem Thema der springende Punkt die Auswirkung auf die menschliche Gesundheit. Unddaran scheiden sich die Geister erst recht. Jbkes ist gemeinsam mit einigen anderen Wissenschaftlern der Ansicht, es gebe keine überzeugenden Beweise für einen Zusammenhang zwischen antibiotikaresistenten Krankheitserregern beim Menschen und der Verwendung von Penicillin und Tetracyclinen zur Wachstumsförderung bei Tieren. Genau darin liegt die Schwierigkeit. Wir sind hier mit einem Problem konfrontiert, für das sich vielleicht nie endgültige Beweise finden lassen werden. Zur Behandlung von Mensch und Tier werden die gleichen Antibiotika eingesetzt, so daß sich schwer herausfinden läßt, welche Verwendung zu welcher Resistenzbildung führt. Dr. Calvin Kunin, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität von Ohio, meint, daß die übermäßige Antibiotikamedikation in der Humanmedizin Probleme aufwirft, nicht aber die subtherapeutische Dosierung im Tierfutter. Er weist darauf hin, daß die Resistenzbildung Gegen die neuesten Antibiotika, zum Beispiel die Cephalosporine der dritten Generation oder Chinolone, auf unsachgemäße humanmedizinische Einsätze zurückzuführen sei und mit Tieren nichts zu tun habe. Was immer man für richtig halten mag, fest steht, daß es für dieses Problem keine Patentlösung gibt. Im Dezember 1984 leitete der damalige Kongreßabgeordnete Al Gore die Anhörung eines Unterausschusses über Antibiotikaresistenz. Der gesamte erste Tag wurde der Anwendung von Antibiotika in der Tierzucht gewidmet. Einer der Sachverständigen, Dr . Leon Sabath Professor der Medizin und Infektiologie an der Universität von Minnesota, verwies darauf, daß Antibiotika auf vier unterschiedliche Arten zum Einsatz kommen, die alle zur Selektion und Vermehrung resistenter Bakterienstämme beitragen: subtherapeutische Mengen zur Wachstumsförderung in der Viehzucht, therapeutische Dosierung zur Behandlung von Krankheiten in der Tiermedizin, zur Krankheitsvorbeugung und zur Behandlung in der Humanmedizin. Nur in einem dieser Anwendungsbereiche Beschränkungen zu veranlassen, würde seiner Meinung nach zu keiner Lösung führen. Selbst bei völligem Verzicht auf Antibiotikazusätze im Tierfutter hätten wir doch immer noch mit der unsachgerechten veterinärmedizinischen Anwendung zu kämpfen. Tierärzte hätten das Recht, nach eigenem Ermessen weiterhin Antibiotika zu verschreiben. Weiterhin unterstrich Sabath: Seit 1970 in Großbritannien das Verbot subtherapeutischer Antibiotikagaben in der Viehzucht in Kraft getreten sei, habe sich weder die Antibiotikaresistenz noch der Antibiotikaverbrauch verringert. Allgemein wird die Ursache darin gesehen, daß die Bauern nicht bereit sind, längere Wachstumsperioden und damit höhere Futterkosten in Kauf zu nehmen. Sie bitten daher einfach den Tierarzt jeweils um ein Rezept, offensichtlich mit Erfolg. Sabath meinte, da das gesetzliche Verbot subtherapeutischer Antibiotikagaben in Großbritannien erwiesenermaßen keinen Einfluß auf den Gesamtverbrauch hatte, wäre es sinnlos, ähnliche Gesetzliche Regelungen in den USA zu erwägen. Bakterielle Resistenzgene können auf verschiedene Weise vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Der direkteste Weg ist der Verzehr von rohem oder nicht ganz durchgebratenem Fleisch. Doch es bestehen auch indirekte Übertragungsmöglichkeiten. Dr. Stuart Levy von der Tufts-Universität, einer der Bedeutendsten Forscher auf dem Gebiet des Antibiotikamißbrauchs, schätzt, daß eine Kuh im Vergleich zum Menschen täglich das Hundertfache an Exkrementen produziert. Dabei werden resistente Bakterien, die sich im Verdauungstrakt des Tiers gebildet haben, ausgeschieden, die meisten davon sind für sich überlebensfähig. Größtenteils werden diese Exkremente als Dünger auf Äcker ausgebracht, entweder direkt oder in aufbereiteter Form. In beiden Fällen gelangen die resistenten Bakterien in den Boden und werden von Pflanzen während des Wachstums aufgenommen. In den letzten Jahren verstärkte sich die Besorgnis über Pestizidrückstände in landwirtschaftlichen Produkten, aber diese Giftstoffe lassen sich wenigstens durch geeignete Behandlung in der Küche entfernen. Resistente Bakterien kann man allerdings nicht vollständig abwaschen, im Gegenteil, beim Waschen gelangen die Mikroorganismen noch tiefer in bestehende kleine Risse. Das bedeutet, dass Vegetarier, auch wenn sie sich nur von biologisch angebauten Erzeugnissen ernähren, ebenso Antibiotikaresistenzgenen ausgesetzt sind. Selbst wenn die tierischen Exkremente nicht zur Düngung verwendet werden, können resistente Bakterien noch auf andere Weise verbreitet werden, vor allem durch Vögel, Insekten - Fliegen sind besonders geeignet für die Übertragung von Bakterien über weite Entfernungen ~ und andere Tiere, über die die resistenten Mikroorganismen schließlich zum Menschen gelangen. In der Landwirtschaft beschäftigte Personen können besonders leicht mit den Antibiotikaresistenzgenen von Tieren in Kontakt kommen. Ganz gleich, wie vorsichtig man auch sein mag, Bakterien sind allgegenwärtig. Sie können geschluckt oder über die Atemwege oder die Haut aufgenommen werden. Vor über fünfzehn Jahren untersuchte Dr. Stuart Levys Forschungsgruppe an der medizinischen Fakultät der Tufts-Universität, was geschieht, wenn subtherapeutische Dosen von Tetracyclin - die gleichen Mengen wie sie normalerweise zur Wachstumsförderung verwendet werden - in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt. werden. Sie verteilten dreihundert neu geschlüpfte Küken auf sechs verschiedene Käfige. Vier Käfige wurden in einem Stall aufgestellt, zwei im Freien.. Bei der Hälfte der Küken wurde dem Futter Tetracyclin zugesetzt, bei der anderen Hälfte nicht. Während der nächsten neun Monate untersuchten die Forscher die Exkremente aller Hühner, sowie aller Landarbeiter und von deren Familien. Sie entdeckten, daß innerhalb von knapp zwei Tagen nach Beginn der Fütterung die Mehrzahl der E.coli-Bakterien der mit Tetracyclin behandelten Küken antibiotikaresistent waren. In den folgenden drei Monaten entwickelten die Bakterien auch Resistenz gegen Ampicillin und Streptomycin sowie gegen Sulfonamide, obwohl weder den Küken noch sonst jemanden auf dem Bauernhof diese Antibiotika verabreicht worden waren. Ebenso beunruhigend war, daß sich nach etwa sechs Monaten das gleiche Resistenzmuster auch bei den Landarbeitern und deren Familien zeigte, wobei sich zunächst Widerstandsfähigkeit gegen Tetracyclin bildete und danach auch gegen die anderen genannten Medikamente. Keine dieser Personen nahm irgendwelche Antibiotika ein, und auch die Versuchshühner wurden nicht verzehrt. Kunin von der »Ohio-StateUniversity« tat die Befürchtung, der Zusatz eines Antibiotikums zum Tierfutter könne zu mehrfacher Antibiotikaresistenz führen, die wiederum auf den Menschen übertragbar sei, als rein theoretisch ab. Levys Studie macht jedoch deutlich, daß es sich hier um weit mehr als nur eine Hypothese handelt. Und dies ist nicht die einzige Untersuchung, die uns diese gefährlichen Zusammenhänge vor Augen führt. In den späten achtziger Jahren wurden in Schweinezuchtbetrieben der damaligen DDR Studien durchgeführt. Das Resultat zeigte, daß die Übertragung von Mehrfachresistenzgenen sogar noch weiter ging. Sechs Monate, nachdem das Antibiotikum Streptothricin zur Wachstumsförderung dem Schweinefutter beigemengt worden war, stellte man ein Resistenzgen in den Darmbakterien der Tiere fest. Zwei Jahre später wurde das gleiche Resistenzgen nicht nur aus den Stuhlproben vieler Landarbeiter isoliert, sondern auch aus Proben von Personen, die gar nicht auf diesem Hof, sondern nur in der Umgebung wohnten. Zwar führen diese von Tieren stammenden antibiotikaresistenten Bakterien nicht notwendigerweise zu Erkrankungen, im Krankheitsfall wird allerdings die Behandlung aufgrund der mehrfachen Antibiotikaresistenz äußerst erschwert und manchmal sogar unmöglich. Keines der wissenschaftlichen Gremien in den USA hat einen Gesetzesvorschlag für ein Verbot von Antibiotikazusätzen in Tierfutter eingebracht, der Trend geht jedoch in diese Richtung. In den letzten Jahren unternahm beispielsweise der amerikanische Verband der Rinderzüchter einen beispiellosen Schritt, indem er seinen Mitgliedern empfahl, auf den routinemäßigen Einsatz herkömmlicher Antibiotika zur Wachstumsförderung zu verzichten, statt dessen dem britischen Beispiel zu folgen und nur mehr solche Antibiotika zu verwenden, die nicht in der Humanmedizin zur Anwendung kommen. Offensichtlich beherzigen viele Viehzüchter diesen Rat und verwenden seither das Mittel Monensin. Auch andere Chemikalien zur Wachstumsförderung werden nun auf den Markt gebracht. Die Geflügelindustrie schlägt möglicherweise auch diesen alternativen Weg ein, aber in der Schweinezucht werden immer noch Tetracycline und Penicillin verwendet. Vor allem Organisationen wie das »National Resources Defense Council« und der »Food Animal Concerns Trust« (FACT) machen diese Gefahren einer breiten Öffentlichkeit bewußt, so daß nun die Verbraucher eine Viehzucht ohne Antibiotika fordern. Der Druck, der über die Nachfrage ausgeübt wird, ist am deutlichsten spürbar. Folglich richten sich die Anbieter zunehmend danach. FACT brachte die sogenannten »nest eggs« auf den Markt, Eier aus Landwirtschaftsbetrieben in New Jersey und Illinois, von Hühnern in Bodenhaltung. Diese Hühner erhalten keine Antibiotikazusätze und können frei umherlaufen und scharren, im Gegensatz zu der herkömmlichen dichtgedrängten Käfighaltung. Die Eier von diesen freilaufenden Hühnern werden immer häufiger auch in Supermärkten und gehobenen Restaurants angeboten. Was als Randbewegung einiger Gesundheitsapostel begann, findet nun wissenschaftliche Unterstützung; Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, wird sich ein bedeutender Wandel in diesem Bereich der Antibiotikaverwendung vollziehen. Dies wäre ein gewaltiger Schritt zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit. Doch während sich im Bereich der Viehzucht einige Lösungen anbieten, müssen wir uns auf anderen Gebieten neuen Herausforderungen stellen. Zum Beispiel beim Ackerbau. Antibiotika gelangen nicht nur durch die Düngung in unser Obst und Gemüse, in einigen Fällen werden die Pflanzen direkt mit diesen Mitteln behandelt. Diese Methode ist vor allem auf Obstplantagen weit verbreitet. Ebenso wie der Mensch sind auch Pflanzen anfällig für eine Reihe bakterieller Infektionen. Viele Anbauer setzen zur Verhütung solcher Krankheiten zu einem besonders kritischen Zeitpunkt im Wachstumszyklus der Pflanze Antibiotika ein. Manchmal werden Antibiotika direkt in den Stamm injiziert, häufiger allerdings werden sie versprüht, entweder mit riesigen Sprühanlagen oder Flugzeugen. Bei diesem Verfahren werden die Antibiotika zwar besser von den Pflanzen aufgenommen, sie werden auf diese Weise aber auch auf benachbarte Pflanzen verbreitet. Dadurch wird eine starke Resistenz gebildet, die wiederum auf den Menschen übertragbar ist. Zwar rufen Bakterien, die Pflanzen befallen, selten Erkrankungen beim Menschen hervor, doch die Resistenzgene finden ihren Weg in den menschlichen Verdauungstrakt und können dann an andere Pathogene Bakterien weitergegeben werden. Auch in der Fischindustrie kommen immer mehr Antibiotika zum Einsatz. Mit wachsendem Gesundheitsbewußtsein ist die Nachfrage nach Fisch gestiegen, so daß überall in den Vereinigten Staaten neue Fischzuchtbetriebe eröffnet werden. Sie züchten Seewolf, Forelle oder Lachs und übernehmen Methoden, die in Japan oder Skandinavien, wo die Mehrheit der konsumierten Fische gezüchtet und nicht gefangen wird, schon seit Jahren praktiziert werden. In fast allen Ländern werden dem Fischfutter Antibiotika zugesetzt. Es gibt kaum Anzeichen dafür, daß damit auch bei Fischen eine Wachstumsförderung erzielt wird, doch viele Fischarten sind anfällig für bakterielle Erkrankungen, so daß häufig Antibiotika verwendet werden. Laut Gesetz muß in den USA die Medikation mehrere Wochen vor dem Verkauf der Fische abgesetzt werden. Dadurch wird sichergestellt, daß sich keine Antibiotikarückstände im Fisch befinden - die Fische werden in regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nach solchen Rückständen untersucht- , doch diese Maßnahme schützt nicht vor antibiotikaresistenten Bakterien, nach denen bei den Kontrollen nicht gesucht wird. Außerdem werden auch unseren Haustieren wahllos Antibiotika verabreicht, entweder durch den Tierarzt oder manchmal auch durch die Besitzer selbst. In nahezu jeder amerikanischen Zoohandlung werden rezeptfreie Antibiotika angeboten. Diese sind hauptsächlich für Aquarienfische bestimmt, doch häufig werden die Medikamente auch Hunden und Katzen gegeben und manchmal sogar von den Tierhaltern selbst eingenommen. Dies ist keine Bagatelle. Allein in den Vereinigten Staaten werden einhundertfünfzig Millionen Hunde und Katzen gehalten, sowie zahllose Fische und Vögel. Deren wahllose Behandlung mit Antibiotika aber kann zu einer bedeutenden Zunahme der resistenten Bakterien beitragen: Daher ist es unerläßlich, das Problem des Antibiotikamißbrauchs in all diesen Berreichen ebenso ernsthaft anzugehen, wie dies in der Viehzucht geschehen ist. * Penbritin ist ein Ampicillin, in Deutschland unter anderem als Binotal im Handel. Die Dosierung von zweihundertfünfzig Milligrammi ist für Erwachsene therapeutisch gesehen zu gering, zumal Ampicillin nur zu etwa fünfzig Prozent aus dem Darm resorbiert wird. Dadurch steht nur die halbe Dosis für die Wirkung zur Verfügung, der Rest verursacht im Darm durch Schädigung der natürlichen Darmflora Nebenwirkungen und trägt zur Bildung von Resistenzen bei. In Deutschland wird dem Ampicillin meist Amoxicillin vorgezogen, das bei gleichem Wirkungsspektrum eine weitaus bessere Verfügbarkeit für den Körper hat und zu etwa neunzig Prozent resorbiert wird. Das Schlimmste verhindern Aufgrund der drohenden Gefahren muß der unangemessenen Antibiotika-Anwendung Einhalt geboten werden. Dazu benötigen wir ein Programm. Wie ein solches Programm aussehen kann, können Sie auf den nächsten Seiten in Thesen lesen. Das Gute daran ist: Wir alle können uns an diesem Programm beteiligen, indem wir selbst tätig werden oder manchmal auch nur unbequem nachfragen und fordern. Schließlich können wir vor diesem Problem nicht länger die Augen verschließen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Medizinstudenten und junge Assistenzärzte müssen Angemessen über Antibiotika instruiert werden. Dr. Donald Kollisch ist ein praktischer Arzt, der schon auf beiden Seiten gestanden hat: als praktizierender Arzt in seiner Privatpraxis und nun als Dozent des Ausbildungsprogramms für praktische Ärzte der Universität von North Carolina. Bei einem Interview für dieses Buch gab er an, daß es erschreckend sei, w ie wenig die Teilnehmer seiner Kurse, seine Kollegen, Studenten und Assistenzärzte über die klinische Anwendung von Antibiotika wissen. »Es ist. an der Zeit, die Studierenden im Fach Mikrobiologie nicht länger listenweise Keime auswendig lernen zu lassen, sondern stattdessen den klinischen Aspekt stärker in den Unterricht zu integrieren. Nur so können wir sie auf den Umgang mit Patienten vorbereiten.« Kollisch schlägt vor, die ersten beiden Jahre des Medizinstudiums, die vorklinische Ausbildung, in der die Studenten die meiste Zeit in Vorlesungssälen und Labors zubringen, praxisorientierter zu gestalten. Ist das Thema der Vorlesung zum Beispiel die Struktur und Physiologie von Streptococcus pneumoniae, sollte ein Patient mit einer durch diese Bakterien hervorgerufenen Lungenentzündung von den Studenten Untersucht werden. Vor Ort sollte besprochen werden, welches Antibiotikum aus welchem Grund zur Anwendung kommen solle. Dabei muß eindringlich vor unsachgemäßem Antibiotika-Einsatz und der Resistenbildung gewarnt werden. Nur dann wird diese praxisorientierte Methode auch ihren Sinn erfüllen. Wenn dieser Plan auch auf die Ausbildung der Assistenzärzte ausgeweitet wird, gelingt es uns vielleicht, Ärzte heranzubilden, die besser mit dem Resistenzproblem umgehen werden«, meint Kollisch. Die ärztliche Approbation sollte nur nach regelmäßig durchgeführten Auffrischungsexamina), an denen die Antibiotikakenntnisse überprüft werden, verlängert werden. Das wachsende Angebot medizinischer Fortbildungsprogramme ist bereits ein Anfang. Doch das ist bei weitem nicht ausreichend. Zunächst sollte für jeden Arzt, der mit Antibiotika umzugehen hat (von dieser Regelung könnten zum Beispiel Psychiater, Radiologen und Physiotherapeuten, Fachärzte der physikalischen Medizin und der Rehabilitationsmedizin ausgenommen werden), die Teilnahme an jährlichen Fortbildungskursen über Antibiotika und Infektionskrankheiten zur Pflicht erhoben werden. Wobei das Hauptaugenmerk auf die Vermeidung neuer Resistenzbildung bei Bakterien gelegt werden sollte. Zweitens sollte alle paar Jahre dieses Wissen in einem Examen geprüft werden, nicht nur damit sich der Arzt mit seinem Fachverband gut stellt, sondern damit er eine Verlängerung der ärztlichen Zulassung erhält. Diese Prüfungen könnten und sollten auch andere Medizinische Wissensgebiete abdecken, doch Antibiotika sind eben ein wesentlicher Bestandteil der Medikation in allen Fachbereichen. In dieser Hinsicht gibt es schon Positives zu vermelden. Der amerikanische Fachverband für praktische Medizin »American Board of Family Practice« hat bereits mit der Einführung solcher Examen für seine Mitglieder begonnen, und beim amerikanischen Fachverband für innere Medizin sind sie bereits im Gespräch. Wir stehen nun vor der Aufgabe, diese Praxis auch auf Chirurgen, Gynäkologen und Kinderärzte auszuweiten und sicherzustellen, daß der später zu prüfende Lehrstoff auch die richtigen Informationen über Antibiotika enthält, und diese Examina als Bedingung an die Verlängerung der Approbation geknüpft werden. Den Krankenhausapothekern sollte ein Vetorecht Gegen ärztliche Rezeptierungen eingeräumt werden. Da so viele der antibiotikaresistenten Bakterien in Krankenhäusern gezüchtet werden, muß sich ein Großteil unserer Anstrengungen auf diesen Bereich konzentrieren. Dem exzessiven Antibiotikaeinsatz in Krankenhäusern muß Einhalt geboten werden. Einige kleinere Maßnahmen in dieser Richtung sind bereits getroffen worden. Dr. Calvin Kunin, Leiter der infektiologischen Abteilung an der »Ohio State Uniersity« und Verantwortlicher für die Einführung des Überprüfungsprogramms der Antibiotikaverschreibung in den meisten amerikanischen Krankenhäusern, sowie Dr. Harry Gallies, Infektiologe an der »Duke University Medical School«, verweisen beide auf eine deutlich feststellbare Verhaltensänderung der Ärzte bei der prophylaktischen Antibiotikagabe in der Chirurgie. Die kurze Behandlungsdauer setzt sich allmählich durch. Da etwa die Hälfte der im Krankenhaus verabreichten Antibiotika zur Prophylaxe eingesetzt wird, muß weiterhin mit Nachdruck für die Reduzierung dieser prophylaktischen Anwendung vor dem chirurgischen Eingriff gekämpft werden. Die Einhaltung dieser Empfehlung sowie die Verbesserungen der Antibiotikabehandlung in anderen Krankenhausabteilungen läßt sich sicherstellen, indem den Ärzten Beschränkungen bei der Wahl der Antibiotika auferlegt werden. Dabei ist dem Krankenhausapotheker eher als dem Arzt eine vernünftige Entscheidung über den Einsatz von Antibiotika zuzutrauen. Der Leiter der Klinikapotheke hat eine einflußreiche Stellung in der Arzneimittelkommission eines größeren amerikanischen Krankenhauses. Er entscheidet über die geeignete Antibiotikamedikation bei unterschiedlichen Krankheitsbildern. Der leitende Apotheker trifft seine Entscheidungen nicht allein, sondern im allgemeinen zusammen mit lnfektiologen, Hygienefachkräften und der Klinikverwaltung, doch die Verantwortung, die ärztlichen Verschreibungenz u beurteilen und sich gegebenenfalls dagegen zu entscheiden, liegt bei ihm. Die Unvoreingenommenheit der Ausschussmitglieder wird durch den Kostendruck auf das Gesundheitswesen zusätzlich gewährleistet: Die Kosten der Gesundheitsversorgung sollen möglichst gering gehalten werden, so daß größerer Wert auf den Einsatz preisgünstiger Antibiotika gelegt wird. Außerdem soll stärker darauf geachtet werden, daß eine antibiotische Behandlung nur in wirklich notwendigen Fällen eingeleitet wird und nicht länger als erforderlich andauert. Auch so kann die Bildung neuer resistenter Bakterienstämme eingedämmt w erden. In einigen Krankenhäusern wurden solche Vorgehensmaßnahmen er probt. Dr. Stephen Barrier ist Leiter der Klinikapotheke am » UCLA Medical Center« und Vorsitzender der dortigen Arzneimittelkommission. Er konnte mir von positiven Erfahrungen berichten. Wiederholte Prüfungen hätten eine übermäßige Antibiotika-Anwendung nachgewiesen, so daß der Verabreichung einiger der neueren und teureren Antibiotika - unter anderem Ciprofloxacin, Imipenem und dem Kombinationspräparat Ampicillin/Sulbactam Beschränkungen auferlegt wurden. An dieser Klinik muß bei jeder Rezeptierung eines dieser Medikamente, eine »Pflichtberatung« durch die pharmazeutische Abteilung des Hauses erfolgen. Dann erst wird entschieden, ob die Anordnung gerechtfertigt ist oder nicht. Hält der Krankenhausapotheker eine bestimmte Antibiotikatherapie für nicht angebracht, ist er ermächtigt, das Rezept des Arztes abzulehnen und um Verschreibung eines anderen antibiotischen Präparats zu bitten: Barrieres Ausführungen zufolge sträubten sich die Arzte zunächst, sahen sie doch ihre Autorität in Frage gestellt, doch allmählich bemerkten sie, daß ihre Verschreibungen ja durchgingen, sobald sie gelernt hatten, die Medikamente nur bei der jeweiligen Indikation anzuordnen. Doch Barrier und andere Ausschussmitglieder stellten ebenso fest, daß die Kontrollen nicht gelockert werden dürfen. Ähnliche Erfahrungen machte Dr. Cheryl Himmelberg vom Klinikum der Universität von North Carolina: Während der Testphase des Pflichtberatungsprogramms seien der Antibiotikamißbrauch und die bakterielle Resistenz zurückgegangen. Doch die anschließende Aufhebung der Beschränkungen hatte sintflutartige Auswirkungen: Die Zahl der Rezepte der vormals mit Auflagen versehenen Antibiotika erhöhte sich um hundertachtundfünfzig Prozent. Computerprogramme zur ärztlichen Fortbildung müssen zum Einsatz kommen. Dr. Jerry Avorn, Professor der Sozialmedizin und Gesundheitspolitik an der »Harvard Medical School«, leistete Pionierarbeit bei der Verbesserung der ärztlichen Verschreibungspraktiken. Und er ist zwar nicht generell gegen das Vetorecht des Klinikapothekers eingestellt, meint aber, Ärzte würden auch auf einen weniger autoritären Ansatz reagieren. Er appelliert eher an den Lerneifer der Mediziner. :" Die Situation der Krankenhauspharmazie in Deutschland unterscheidet sich grundlegend von der in den USA. Während in den USA selbst kleine Krankenhäuser über eine eigene Apotheke mit teilweise imponierender Personalstärke verfügen, werden in Deutschland die meisten Kliniken mit unter vierhundert Betten von öffentlichen Apotheken versorgt. Auch in größeren Häusern sind den Apothekern hierzulande in ihrem Handeln durch die sehr knappe Ausstattung mit qualifiziertem Personal enge Grenzen gesetzt. Die Teilnahme des Apothekers an der klinischen Visite, in den USA eine Selbstverständlichkeit wird in Deutschland erst zögernd eingeführt, und auch dies meist nur in Universitätskliniken und anderen großen Häusern der Maximalversorgung. Allerdings ist auch in Deutschland der Krankenhausapotheker ein wichtiger Faktor in der Verbrauchssteuerung auf dem Arzneimittelsektor. Die meisten Kliniken haben eine Arzneimittelliste. Nicht in dieser Liste enthaltene Arzneimittel- zum Beispiel teure Antibiotika – müssen über eine Sonderanforderung bestellt werden, die immer einem Apotheker vorgelegt wird. So kann im Einzelfall eine gezielte Beratung ermöglicht werden, ohne daß, wie in den USA üblich, die ständige Anwesenheit des Apothekers auf. der Station notwendig ist. Da sich die Beratung jedoch auf den Einzelfall beschränkt, stellt dieses System sicher nur die zweitbeste Lösung dar. Und in größeren Kliniken mit Arzneimittelkommissionen könnten beide Methoden gleichzeitig erprobt werden. Ein Vorschlag Avorns ist die Absprache der Ärzte mit einem Infektiologen statt mit dem Apotheker. Diese Beratung sollte ebenfalls zur Pflicht werden, allerdings ohne ein damit verbundenes Einspruchsrecht gegen das Rezept. Anstelle der Beschränkungen für die Medikation eines bestimmten Antibiotikums würde der Facharzt für Infektionskrankheiten seinen Kollegen darüber aufklären, warum das Präparat X in Hinsicht aftf die Resistenzbildung eine bessere Wahl wäre als das Medikament Y. Avorn ist zuversichtlich, daß die meisten Ärzte unter solchen Umständen die richtige Entscheidung treffen werden und keine Restriktionen erforderlich sind. Diese Methode wurde bisher jedoch nur in begrenztem Umfang erprobt, und ein so wenig autoritärer Ansatz muß sicherlich längere Zeit getestet werden. Auch bei diesem Ansatz sollte die Möglichkeit des Einspruchs gegen eine Verschreibung zumindest als Notmaßnahme bestehen. Avorn entwickelte außerdem noch einen neuartigen Lehransatz, gestützt auf dasselbe Prinzip, daß Ärzte die geeignete Wahl treffen, wenn sie zur richtigen Zeit mit den korrekten Informationen versorgt werden. Zu diesem Zweck erdachte er spezielle Rezeptformulare für Antibiotika, die gleichzeitig die Funktion eines »Lernprogramms« erfüllen. Um dieser Methode zum Erfolg zu verhelfen, muß die Klinikleitung dafür Sorge tragen, daß alle Antibiotikarezeptierungen auf speziellen Formularen erfolgen. Diese Formblätter, für jedes Antibiotikum ein anderes, enthalten wichtige Informationen und anschauliche Hinweise für die richtige Anwendung des jeweiligen Medikaments. Und zwar nicht nur, welche Infektionen damit therapiert werden sollen, sondern auch die empfohlene Dosierung und Dauer der Anwendung. Avorn hat diese Formulare bereits 1988 entwickelt, und im kleinen Maßstab erprobt, wobei sie sich recht positiv auf die Rezeptierungspraktiken der Ärzte auswirkten. Teilweise gingen die Verordnungen gerade bei den teuersten und meist auch neuesten Antibiotika, bei denen es ja besonders auf den Erhalt ihrer Wirksamkeit ankommt, drastisch um über siebzig Prozent zurück. Avorn arbeitet bereits an der Entwicklung eines entsprechenden Computerprogramms, da gegen Ende der neunziger Jahre die meisten Antibiotikarezepte ohnehin per Computer ausgestellt werden dürften: »Damit eröffnen sich noch weitere Lernmöglichkeiten für das ärztliche Krankenhauspersonal «, meint Avorn. Bei der von ihm entwickelten Software können Veränderungen der jeweiligen Sensitivitätsmuster eingegeben und bei der Bestellung eines Antibiotikums wieder abgerufen werden. Außerdem wird es sich um ein interaktives Computerprogramm handeln. So bietet der Computer immer dann individuelle Lernprogramme an, wenn vom Arzt das Rezept eines Medikaments in den Computer Eingegeben wird - also genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Arzt für diese Art der Information am aufgeschlossensten ist, denn er kann diese Information ja zur Beratung nutzen. Zudem läßt sich ein Computerprogramm leicht verbreiten. Von den über achttausend Krankenhäusern der Vereinigten Staaten sind mehr als die Hälfte Gemeindehospitäler mit weniger als hundert Betten. Kaum eines dieser Krankenhäuser verfügt über das Personal für eine gut und kompetent besetzte Arzneimittelkommission. Aber alle benutzen Computer. Die Einführung einer Software wäre vergleichbar mit einer persönlichen Expertenberatung bei jeder einzelnen Antibiotikaverschreibung. Es muß ein Gegengewicht zu den Werbefeldzügen der pharmazeutischen Industrie geschaffen werden. Auch gegen unangemessene Antibiotikaverschreibungen der niedergelassenen Ärzte muß etwas unter-. nommen werden; größtenteils ergibt sich dieses Problem daraus, daß sich die Ärzte zu sehr auf die Aussagen der Pharmavertreter verlassen. Avorn hat auch hierfür einen Lösungsansatz erdacht: »Laßt die Vertreter ruhig kommen und ihr Bestes versuchen, gleichzeitig müssen wir aber mit geeigneten Mechanismen gegensteuern«. Hauptsächlich scheint es für die Einsetzung dieser Mechanismen finanzielle Anreize zu geben, doch bei richtiger Anwendung bringen sie ebenso Vorteile im Kampf gegen die Antibiotikaresistenz. Viele der großen und einflußreichen US- Konzerne bieten ihren Angestellten ein betriebseigenes Gesundheitsversorgungssystem an und haben in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Antibiotikarezepte häufig nur unnötige Ausgaben verursachen. Um diesem Problem zu begegnen, stellen einige dieser Unternehmen nun Pharmazeuten ein, deren einzige Aufgabe darin besteht, Ärzte aufzusuchen und der Beeinflussung seitens der Arzneimittelhersteller entgegenzuwirken. Diese Methode wurde als Gegeninformationsarbeit bezeichnet. Avorn bevorzugt den Begriff "akademische Informationsarbeit«.Auch in den Arztpraxen soll es zum Einsatz von Computerprogrammen zur Unterstützung einer vernünftigen Antibiotikamedikation kommen. Zur Verstärkung der akademischen Informationsarbeit sollte auch bei niedergelassenen Ärzten ein Instrument herangezogen werden, das bereits für den Einsatz im Krankenhaus empfohlen wurde: ein Computerprogramm, das dem Arzt die nötigen Begleitinformationen liefert, wann er ein Antibiotikum verschreiben soll. Im Gegensatz zu den Kliniken sollte die Einführung solcher Programme für Arztpraxen allerdings nicht zur Vorschrift werden. Der Wunsch nach qualifizierter Information und der Druck regelmäßiger Überprüfungen der Antibiotikaverschreibungen durch staatliche oder örtliche medizinische Behörden würde einen Anreiz zur Verwendung solcher Software bieten. Ein Computerprogramm dieser Art ist in den USA bereits auf dem Markt, es heißt Antibiotica PC: lnfectious Disease Analytical Software und wird von einem kleinen Unternehmen namens »MacroMed« in Whittier vertrieben. * Eine ähnliche Strategie wurde in Deutschland von einigen Krankenkassen verfolgt. Dabei ließ man praktischen Ärzten, die mit ihren Verordnungen über dem Durchschnitt lagen, eine Zwangsberatung durch von der Kasse angestellte Apotheker angedeihen. Sogenannte Verhaltensrezepte sollen ausgestellt werden. Einigen Umfragen zufolge kennen die meisten Leute immer noch nicht den Unterschied zwischen Virus und Bakterieninfektionen und wissen nicht, daß Antibiotika nur gegen letztere wirken. Aufgrund dieser Wissenslücke bestehen viele Patienten auf einem Antibiotikarezept gegen eine Erkältung oder andere virale Infekte. Da die Ausstellung eines Rezepts in vielen Augen heutzutage zu einem wesentlichen Bestandteil des Arztbesuchs geworden ist, ist der Arzt oft auch in Fällen, die keine antibiotische Behandlung erfordern, gezwungen, die Verschreibung nicht rundweg abzulehnen. Avorn hat auch hierzu eine Idee, die dem Ausstellen eines Rezepts eine positive Seite abgewinnt. Sein Vorschlag ist, dem Patienten eine Verschreibung zu überreichen, die wie ein herkömmliches Rezept aussieht, aber nicht für ein Antibiotikum gedacht ist, sondern als »Verhaltensrezept« bezeichnet werden kann. Auf ihm wird erklärt, worin sich virale von bakteriellen Infekten unterscheiden, warum Antibiotika keine Viren abtöten, und was der Patient statt dessen gegen seine Erkrankung unternehmen kann. »Ein Rezept ist ein sehr wirksames soziologisches Werkzeug«, meint Avorn, »und diese Verhaltensrezepte verleihen dem Verzicht auf Medikamente die gleiche Schlagkraft wie deren Anwendung.« * Nach unseren Recherchen ist eine deutschsprachige Version eines solchen Computerprogramms nicht erhältlich. Solche Verhaltensrezepte sind auch auf andere Weise nützlich. Da viele Patienten eine indizierte Antibiotikatherapie vorzeitig abbrechen und damit die Entwicklung resistenter Bakterien fördern, könnte der Arzt zusammen mit dem Antibiotikarezept auch ein Verhaltensrezept asusstellen, auf dem erklärt wird, wie wichtig es ist, vor allem im Hinblick auf die Resistenzbildung, die gesamte Dosis des Medikaments einzunehmen. Der Aufbau eines weltweiten Netzwerks zur Überwachung fer bakteriellen Antibiotikaresistenz muß unterstützt werden. Vizepräsident und Vorstandsmitglied der APUA, der »Alliance for Prudent Use of Antibiotics« (Vereinigung für eine angemessene Antibiotikatherapie), ist Dr. Thomas O'Brien, der medizinische Leiter des mikrobiologischen Labors in Brigham und der Frauenklinik in Boston sowie außerordentlicher Professor der Medizin an der »Harvard Medical School«. O'Brien ist der Überzeugung, daß ein Schlüsselelement zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz ihre rechtzeitige Entdeckung ist, aufgrund deren die geeigneten Kontrollmaßnahmen eingeleitet werden können. Zum Beispiel können Bakterien in Malaysia Resistenzen bilden, die dann auf schnellstem Wege nach Minneapolis oder an irgendeinen anderen Ort der Welt gelangen. Wenn wir von einer neuerlichen Resistenzbildung wüßten, hätten wir im Umgang mit diesem Problem eine wesentlich bessere Ausgangsposition. »Ebenso wie die Bakterien ein globales Netzwerk zur Verbreitung der Antibiotikaresistenz bilden, müssen auch wir unser eigenes Netzwerk zur Resistenzbekämpfung aufbauen«, meint O'Brien. Zu diesem Zweck entwickelte er gemeinsam mit seinem Kollegen D r. John Stelling eine erstklassige Software, die sich die Tatsache zunutze macht, daß fast in jedem Krankenhaus der Welt, sogar in den Entwicklungsländern, tagtäglich routinemäßig Antibiotikasensitivitätstests durchgeführt werden. Als einzig nötiger weiterer Schritt müßten die Untersuchungsresultate in O'Briens Computerprogramm namens WHONET eingespeist werden- die Weltgesundheitsorganisation, WHO, hatte die Entwicklungskosten getragen. Vom Zentralcomputer in Boston aus ließe sich dann täglich weite Entwicklung der Resistenzmuster verfolgen. Die Weltgesundheitsorganisation in Genf benötigt allerdings erhebliche finanzielle Mittel, um WHONET in allen Krankenhäusern der Welt zu installieren - bislang sind nur siebzig Krankenhäuser an dem Pilotversuch beteiligt. Antibiotika müssen als wachstumsfördernde Mittel in der Viehzucht verboten werden. Bei diesem Thema scheiden sich die Geister der Verbraucherorganisationen und der Regierungsbehörden. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, daß sich die Dinge endlich in die richtige Richtung entwickeln und der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht ausgeschlossen oder zumindest drastisch reduziert wird. Doch dieses Ziel muß weiterhin mit Nachdruck verfolgt werden, und zwar von mehreren Seiten. Nur der Druck des Verbrauchers, auf solche Lebensmittel zu verzichten, kann zu einer Verhaltensänderung der Lebensmittelproduzenten führen. Die diagnostischen Verfahren in Praxen und Krankenhäusern Müssen verbessert werden. Einer der Hauptgründe für den vielfachen Einsatz von Breitbandantibiotika ist Unkenntnis: Welche Bakterien haben die Infektion ausgelöst? Handelt es sich überhaupt um einen bakteriellen Infekt? Damit die Ärzte zur Wahl der geeigneten Schmalspektrumantibiotika geführt werden können, muß zunächst eine rasche und genaue Bestimmung der Mikroorganismen ermöglicht werden. In dieser Hinsicht sind in den mikrobiologischen Labors der Krankenhäuser in den letzten Jahren Wesentliche Verbesserungen erreicht worden. Die meisten Idetifizierungen und Sensibilitätstests werden mit vollautomatischen Geräten durchgeführt. Doch es sind noch weitere Verbesserungen möglich. Ärzte können zum Beispiel einige der Bestimmungen selbst durchführen. Mittlerweile ist eine erschwingliche Testausrüstung für die Praxis erhältlich, mit der die Bestimmung von Streptokokken aus einem Halsabstrich oder aus einer Urinprobe in weniger als vierundzwanzig Stunden möglich ist. In diesen Fällen muß der Arzt nicht mehr nur versuchen, den Erreger der Infektion zu erahnen. Jene Testsets sind zwar bereits von großem Wert, stellen aber nur eine Zwischenstufe bis zur Entwicklung anderer Schnelldiagnosetechniken dar. Zum Beispiel wird das DNA-Sondenverfahren immer preisgünstiger und findet in den USA immer breitere Anwendung, so daß es nicht nur in den großen Universitätskliniken, sondern bald auch in kleineren Gemeindekrankenhäusern zum Einsatz kommen kann - und letztlich auch bei den niedergelassenen Ärzten. Läßt sich der Krankheitserreger innerhalb weniger Stunden ermitteln, kann der BreitspektrumantibiotikaEinsatz drastisch reduziert werden. Die entwickelten Impfstoffe müssen besser genutzt werden. Je besser wir mit unseren körpereigenen Anlagen und Fähigkeiten Fremdkeime bekämpfen können, um so weniger Antibiotika werden benötigt. In dieser Hinsicht sind vor allem Impfstoffe von größter Bedeutung, besonders fü r ältere Personen und Kinder, zwei Bevölkerungsgruppen, die ein weniger starkes Immunsystem besitzen und die daher besonders anfällig für Infektionen sind. Dies gift: vor allem für die durch Pneumokokken verursachte Lungenentzündung, eine nach wie vor häufige Todesursache bei älteren Menschen. Wie Dr. David Fedson von der Universität von Virginia berichtet, werden in den USA jährlich bis zu 120000 Patienten im Alter von über fünfundsechzig Jahren wegen einer solchen Erkrankung stationär behandelt und mit Antibiotika voll gepumpt. Dennoch verläuft die Krankheit bei 40000 von ihnen tödlich. Das müßte nicht sein. Seit über zehn Jahren gibt es Einen unbedenklichen und wirksamen Impfstoff gegen Diese Art der Lungenentzündung, doch er wird kaum verwendet. In den achtziger Jahren setzte der damalige oberste Gesundheitsbeamte der Vereinigten Staaten, C. Everett Koop, das Ziel, sechzig Prozent der älteren Bevölkerung gegen Pneumokokken und Grippe zu impfen. Nach der letzten Erhebung der jährlichen Immunisationsrate durch die CDC im Jahr 1985, erhielten jedoch nur zehn bis fünfzehn Prozent der älteren und anderer hoch gefährdeter Personen eine Pneumokokkenschutzimpfung. Laut Fedson ist es unwahrscheinlich, daß sich diese Rate in den darauffolgenden Jahren auf mehr als zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent erhöht hat. Die Forschung nach neuen Impfstoffen und anderen immunstärkenden Substanzen muß unterstützt werden. Wenn Bakterien in unseren Körper eindringen, sondern sie bestimmte Proteine ab, die sogenannten Adhäsine. Impfstoffe, die die Produktion von Antikörpern gegen diese Adhäsine anregen, können wirkungsvoll die Immunisierung gegen eine große Anzahl verschiedener Stämme einer Bakterienart herbeiführen. Ein kleiner biotechnischer Betrieb namens MicroCab behauptet, Zellrezeptoren und die entsprechenden Adhäsine von über sechzig Mikroorganismen identifiziert zu haben, und arbeitet nun an der Entwicklung von Impfstoffen gegen verschiedene Bakterientypen - Haemophilus influenzae, Streptococcus pneuinoniae, Helicobacter pylori (Mitverursacher von Magengeschwüren und Chlamydien. Neben immunologischen Verfahren zur Stärkung der Immunabwehr gegen bestimmte Bakterien besteht außerdem die Möglichkeit, das Immunsystem ganz allgemein zu unterstützen und somit die Widerstandskraft gegen viele bakterielle Infektionen zu erhöhen. Die unspezifische Stärkung des Immunsystems ist keine neue Idee. Schon seit Anfang dieses Jahrhunderts wurde in vielen Studien nachgewiesen, daß die unspezifische Widerstandsfähigkeit gegen Infekte durch die Verabreichung abgetöteter Mikroorganismen erhöht werden kann. Später fand man heraus, daß dies durch eine Induktion der Bildung verschiedener immunstimulierender Proteine, der sogenannten Zytokine, durch Zellen unseres Immunsystems geschieht. Zu den Zytokinen zählen die Interferone, Interleukine, und der Tumor-Nekrose-Faktor. Diese Zytokine wiederum steigern die Fähigkeit der weißen Blutkörperchen, fremde Eindringlinge zu fassen und zu zerstören. Eine breite Palette ernster bakterieller Infekte, hervorgerufen durch Pneumokokken, Staphylokokken, Klebsielien und Pseudomonaden sprachen auf die Behandlung mit Zytokinen als Iinmunmodulatoren an. Diese Methode wird bisher allerdings erst im Labor erprobt. Zwar steckt in den Zytokinen ein enormes Potential, doch bisher weisen sie noch zu starke Nebenwirkungen auf. Neue Medikamente zur Infektionsbekämpfung und Lösung des Resistenzproblems müssen entwickelt werden. . Zuerst die gute Nachricht: In den späten achtziger Jahren fragte sich Dr. Michael Zasloff, Professor für Pädiatrie und Leiter der mikrobiologischen Abteilung der Universität von Pennsylvania, warum sich der Afrikanische Krallenfrosch so selten im verschmutzten Wasser der Vorratstanks infizierte. Nach einigen Forschungsreihen fand er die Antwort: In der Haut des Frosches entdeckte er eine Reihe von proteinartigen Verbindungen, die Bakterien, Protozoen und Pilze abtöteten, er nannte diese Substanzen Magainine. Nur wenige Jahre später, 1989 hörte Zasloff in einem Vortrag, wie trächtige Riffhaie ihre Eileiter zur Entfernung fetaler Stoffwechselprodukte mit Meerwasser durchspülten. Und wiederum fragte er sich, wie die Föten von dem unreinen Wasser geschützt werden. Schließlich isolierte er zusammen mit seiner Assistentin Karen Moore eine Substanz aus verschiedenen Gewebeproben von Haien, die eine große Anzahl verschiedener Mikroorganismen abtötet, eine Steroidverbindung, der er die Bezeichnung Squalamin gab. Er hält die antibakterielle Wirkung dieses Stoffs für vergleichbar mit der von Ampicillin. Zasloffs Einfallsreichtum ist nur ein Beispiel für die Möglichkeiten zur Entwicklung antimikrobieller Mittel, deren Wirkmechanismen sich von denen herkömmlicher Antibiotika unterscheiden. Zasloffs Forschungsarbeit mit Magainin führte bereits zur Gründung einer Arzneimittelfirma: die »Magainin Pharmaceutical« - deren zweiter Verwaltungschef Zasloff selbst ist. Das Unternehmen entwickelte die Substanz MSI-78 und stellte 1993 bei der FDA den Antrag auf Zulassung dieses Mittels für die lokale Behandlung tropischer bakterieller Infektionen der Haut. Zur Zeit arbeitet man an der Entwicklung einer systemisch anwendbaren antibakteriellen Substanz aus Squalamin. Ein weiterer Ansatz ist die Suche nach Techniken zur Ausschaltung der Resistenzplasmide in den Bakterienzellen - beispielsweise durch die Einschleusung eines R-Faktor-Analogons, das in der Lage ist, die Expression von Resistenzgenen gegen eines oder mehrere Antibiotika zu blockieren. Sprich, die Resistenzgene bleiben zwar in der Bakterienzelle, diese wird aber durch einen Eingriff in die Genexpression daran gehindert, nach den auf dem Plasmid gespeicherten Erbinformationen Betalactamasen oder andere für Resistenzen verantwortliche Proteine zu synthetisieren. Außerdem müssen die molekularen Grundlagen der Resistenzmechanismen gegen Antibiotika weiter erforscht werden. Der Durchbruch, der 1992 dem Londoner »Hammersmith Hospital« mit dem Erkennen der genauen Vorgänge bei der Resistenzbildung von Tb-Bakterien gegen Isoniazid gelang, deutet darauf hin, daß auf diesem Wege noch weitere wichtige Ergebnisse erzielt werden können. Am spannendsten sind die Fortschritte auf dem Gebiet der sogenannten rationalen oder strukturorientierten Arzneimittelentwicklung. Alle infektiösen Stoffe, Bakterien, Viren und Pilze besitzen ihre eigenen lebenswichtigen Enzyme und DNA. Dies ist ein möglicher Ansatzpunkt für die Bekämpfung dieser Organismen. In den vergangenen fünfzehn Jahren wurden die Möglichkeiten zur Produktion und Reinigung dieser Proteine und Nukleinsäuren enorm verbessert, sodaß die Wissenschaft heute in der Lage ist, daraus Verfahren zur Entdeckung und Entwicklung verschiedener Hemmstoffe abzuleiten. Nach Ansicht Dr. Irwin Kuntz', eines Dozenten für pharmazeutische Chemie an der' Universität von Kalifornien in San Francisco, sind auch die Methoden zur Strukturanalyse Verbessert worden, besonders was die Kristallographie und die Kernspinresonanzspektroskopie angeht, so dass nun auch ein bessere Verständnis für den dreidimensionalen Aufbau der zu hemmenden bakteriellen Stoffe ermöglicht wurde. Die so gewonnenen Daten werden dann in der computergestützten Entwicklung von Medikamenten genutzt. Dabei können die Wissenschaftler die exakte Molekularstruktur der benötigten Substanz auf dem Bildschirm nachbilden. Die erste und wohl auch vielversprechendste Gelegenheit zur Anwendung dieser Technik der strukturorientierten Arzneimittelentwicklung könnte sich aus einer 1993 an der» Harvard Medical. School« gemachten Entdeckung ergeben, die die Wissenschaftler In Aufregung versetzte. Es war bereits seit einiger Zeit bekannt, daß es nicht möglich ist, vom Verhalten der Bakterien »in vitro« auf ihr Verhalten »in vivo« zu schließen: Allzuoft hatte sich schon gezeigt, daß ein Mikroorganismus, der in Laborversuchen harmlos erschien, bei Tier oder Mensch verheerende Krankheiten hervorrufen konnte. Man vermutete, daß solche Organismen sogenannte Virulenzgene besitzen, die irgendwo versteckt oder inaktiv bleiben, bis die Bakterien in einen Wirtsorganismus gelangen, woraufhin die Virulenzgene aktiviert werden und so den Mikroorganismus in einen Krankheitserreger verwandeln, der sich im Gewebe ausbreitet. Dr. lohn Mekalanos und seinen Kollegen gelang es, mit Hilfe der DNA-Rekombinationsmethode das Geheimnis dieser Bakterien zu entschlüsseln und die Virulenzgene zu entdecken. Dabei wurde die bakterielle DNA in einzelne kleine Abschnitte zerlegt und in bestimmtenS equenzenn eu kombiniert. Ursprünglich wurde diese Methode bei einem Stamm von Typhusbakterie~ angewandt, die nur Mäuse befallen, doch Mekalanos ist zuversichtlich, daß dieselbe Technik auch auf fast alle den Menschen betreffende Bakterien angewandt werden kann. Das erste Resultat dieser Forschung könnte ein strukturorientiert entwickeltes Medikament zur Blockierung der Virulenzgene sein. Dieser Ansatz ist so weit von allen herkömmlichen entfernt, daß es wirklich nicht korrekt wäre, diese neuen Arzneimittel noch zu den Antibiotika zu zählen; d ie Wissenschaft wird eine neue Bezeichnung erdenken müssen - vielleicht Antivirulentia? Da Virulenzgene, wie alle anderen Gene auch, die Bildung von Proteinen steuern, die wiederum deren Instruktionen ausführen, wäre es theoretisch möglich, neue Impfstoffe zu entwickeln, die die Funktion der Virulenzproteine blockieren. Ein weiteres nützliches Ergebnis dieser Entdeckung ist laut Dr. Staffan Normark von der Universität von Washington in St. Louis, einem Experten für molekulare Grundlagen bakterieller Erkrankungen, die Möglichkeit, die Wirkung der Virulenz gene bei verschiedenen Mäusegattungen zu beobachten. Die Befunde könnten für die Humanmedizin interessant sein, da damit vielleicht eine Antwort auf die bisher ungeklärte Frage gefunden wird, warum einige Mikroorganis-en bei manchen Menschen Krankheiten auslösen, bei anderen dagegen nicht. Dies lediglich mit der unterschiedlichen Stärke des Immunsystems zu erklären, wäre zu simpel. Eine tiefere Einsicht, wie unser Immunsystem mit den Virulenzgenen zusammenwirkt, könnte eine Antwort liefern, die möglicherweise weitere neue Wege zur Bekämpfung bakterieller Infekte ohne Antibiotika aufzeigt. Nun zu den schlechten Nachrichten: Diese Forschungen erfahren nicht annähernd genug Unterstützung, um solche Ideen zur Entwicklung von Medikamenten umsetzen zu können. Die Beiträge der erwähnten biotechnologischen Firmen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen die pharmazeutische Industrie zu einem großangelegten Einsatz bewegen. Momentan konzentrieren sich die meisten Arzneimittelhersteller auf andere gewinnversprechende Tätigkeitsfelder statt auf antibakterielle Substanzen. 1992 schätzte eine Arbeitsgruppe der »National Institutes of Health« (NIH), der Nationalen Gesundheitsbehörden, daß neunzig Prozent der US- Unternehmen in der Pharmaindustrie antimikrobielle Forschungen entweder reduziert oder sogar völlig von ihrem Forschungsplan gestrichen haben. Der Grund dafür sei, daß der Antibiotikamarkt als gesättigt gelte. Sicherlich ist der Markt voll mit unnötigen antibiotischen Präparaten, die gegenüber den schon früher vorhandenen keine Vorteile bieten. Nun jedoch eröffnen sich völlig neue, ja fantastische Möglichkeiten, deren Entwicklung unbedingt gefördert werden muß, auch wenn die Forschungs- und Entwicklungskosten dabei sehr hoch sein werden. An dieser Stelle müssen die Regierungen einspringen. Ein Beispiel für sinnvolle Hilfe sind kooperative Forschungs- und Entwicklungsverträge, wobei die Arzneimittelhersteller mit Regierungsbehörden wie den NIH zusammenarbeiten sollen. Für einen Großteil der Grundlagenforschung wären dann die Nationalen Gesundheitsbehörden verantwortlich. Der private Sektor würde eine neue Entwicklung zur Marktreife bringen: eine den jeweiligen Möglichkeiten entsprechend ideale Aufgabenverteilung. Als zusätzliche Anreize könnten die Pharmaproduzenten zur Bildung von Konsortien angeregt, zusätzliche Steuervergünstigungen.. Angeboten sowie der Patentschutz verlängert werden. Diesen Forderungen müssen wir uns stellen. Überall auf der Welt entwickelt sich die bakterielle Resistenz gegen Antibiotika täglich weiter fort, und die Anzahl der Patienten mit unkontrollierbaren Infektionen steigt. Dieser Prozeß hängt mit den molekularen Gegebenheiten der Bakterien zusammen und läßt sich daher nie völlig aufhalten. Doch wenn wir sofort damit beginnen, für einen vernünftigen Umgang mit Antibiotika zu sorgen, können wir diesen Prozeß zumindest verlangsamen. Bemühen wir uns darum, gewinnen wir damit Zeit für die intensive Entwicklung und Einführung alternativer Methoden der Bakterienbekämpfung. Tun wir das nicht, werden wir die schrecklichen Konsequenzen tragen müssen. * Das Prinzip der gesonderten Formulare im Krankenhaus ist . nur auf die in den USA übliche individuelle Verschreibung der Medikation anwendbar, bei der für jeden Patienten einzeln ein Rezept erstellt wird, das von dem Apotheker, der für die jeweilige Station zuständig ist, patientenbezogen beliefert wird. In Deutschland beliefert eine Krankenhausapothekke eine Patienten, sondern Stationen, die über eigene umfangreiche Ärzneimittelvorräte verfügen. Aus diesen Vorräten wird vom Pflegepersonal die Medikation für den einzelnen Patienten zusammengestellt. Die Verordnung des Arztes .liegt dabei nicht als Rezept vor, sondern lediglich als Eintrag in die Krankenakte. Computerprogramme zur Unterstützung der Arzneimittelverordnung stecken in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Bisher sind selbst in großen, modernen Krankenhäusern nur wenige Stationen mit PCs ausgerüstet.