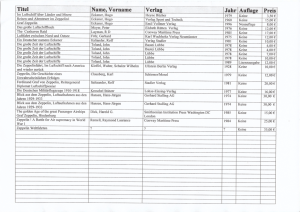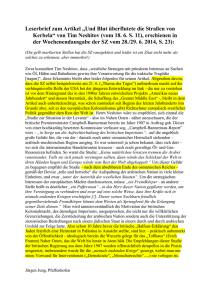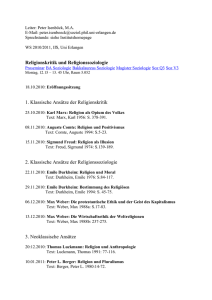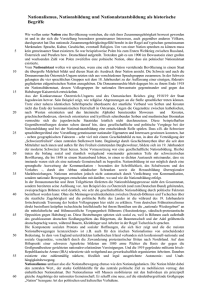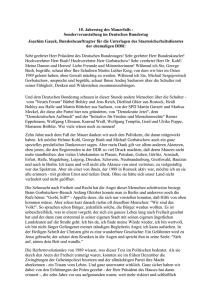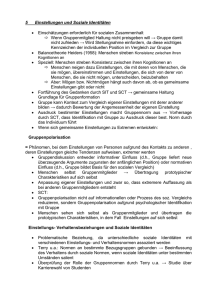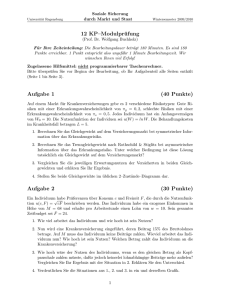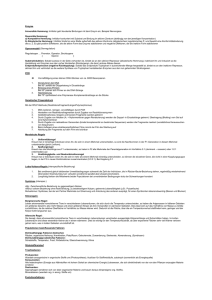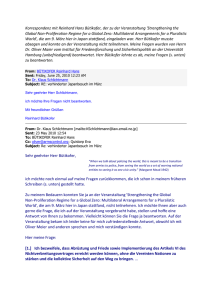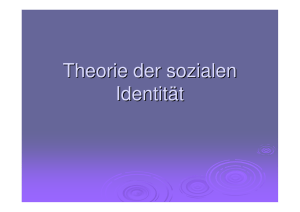Kollektive Identität
Werbung

Dr. habil. Wolfgang Luutz Teilprojekt A6 "Kollektive Identität" Karriereende eines folgenreichen Konzepts?1 Die wohl wirkungsmächtigste, allerdings nicht unumstrittene Auffassung zur Frage „Karrieresprung oder Karriereende“ des Konzepts „kollektive Identität“ hat im deutschsprachigen Raum Jürgen Habermas formuliert. Er schreibt: “Wir können die Identität unseres Ich immer weniger an den konkreten Rollen festmachen, die wir als Angehörige einer Familie, einer Region oder Nation erwerben. Das, was uns inmitten komplexer und wechselnder Rollenerwartungen erlaubt, wir selber zu sein und zu bleiben, ist die abstrakte Fähigkeit zu einem ganz und gar individuellen Lebensentwurf". Die Rationalisierung der Lebenswelt in der Moderne, so Habermas´ Begründung, führe zu einer Dauerrevision verflüssigter Traditionen. Es bleibe nur noch die Möglichkeit der riskanten Selbststeuerung durch eine hochabstrakte Ich-Identität. (Habermas 1989, S.1197 f.) Steuern wir also auf das Ende der Karriere eines umstrittenen Konzepts, des Konzepts kollektiver Identifizierung zu? Nicht nur der aufkommende Neonationalismus, von den einen mit mühsam verborgener Abneigung mißtrauisch beäugt (Beck 1993, Jeismann/Ritter 1993), von den anderen unter dem Stichwort "Wiederkehr der Nation" als endlich vollzogene Rückkehr zur Normalität verhalten begrüßt (Bubner 1993, Henrich 1993), sprechen dagegen. Auch das „Erwachen“ der Regionen, die Revitalisierung regionalen Bewußtseins inmitten einer unbestritten globalisierten Gesellschaft sollte uns, insofern wir darin mehr als das späte Aufflammen atavistischer Neigungen entdecken, zum Nachdenken veranlassen. Selbst wenn also die Diagnose eines Bedeutungsverlustes nationaler Identitäten stichhaltig sein sollte, muß daraus m.E. nicht folgen, daß jegliche Formen kollektiver Identifizierung zu einem Ende gekommen sind. Überhaupt sollten wir uns bemühen, die normative Frage, ob eine bestimmte Form kollektiver Identität „sein soll“, zunächst zugunsten der deskriptiven Frage, wie solche Prozesse zu beschreiben und zu erklären sind, zurückzustellen. Mit den folgenden begriffsanalytischen und theoretisch-konzeptionellen Überlegungen beabsichtige ich sowohl die Vorbehalte gegen das Konzept der "kollektiven Identität" in der zeitgenössischen Sozialwissenschaft (und Philosophie) zu erklären als auch Wege für einen sinnvollen Umgang mit diesem umstrittenen Begriff aufzeigen. Angestrebt wird damit ein Beitrag zur Begründung eines neuartigen Konzepts regionenbezogener Identifikationsprozesse 2. Ich beginne mit einer begriffsgeschichtlichen Analyse zum Begriff des Kollektivbewußtsein bei E. Durkheim, stelle in Anschluß daran Überlegungen an, woraus die Vorbehalte gegen den Begriff „kollektive Identität“ in den modernen Sozialwissenschaften resultieren, setze fort mit einer Untersuchung zu verschiedenen möglichen Wegen der Annäherung an das Phänomen „kollektiver Identität“ und schließe mit Darstellungen zum Begriff der regionalen Identität. 1. „Kollektive Identität“ - Überblick über unterschiedliche Verwendungsweisen Ein Grund für Vorbehalte gegen das Begriffskonzept „kollektive Identität“ könnte darin bestehen, daß eine ursprünglich für die Beschreibung individueller Handlungssubjekte reservierte Kategorie, nämlich Identität, auf soziale Phänomene übertragen wird. Man mag 1 Der Untertitel enthält eine Anspielung auf das Standardwerk zeitgenössischer Nationalismusforschung, B. Andersons Buch „Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts“, Frankfurt/M. 1983 2 Siehe Sonderforschungsbereich „Regionenbezogene Identifikationsprozesse. Das Beispiel Sachsen (Sprecher: H.-W. Wollersheim), Leipzig 1998 2 sich mit dem Hinweis zufrieden geben, daß solche Übertragungen in den Sozialwissenschaften und in der Philosophie vielfach vorgenommen werden, etwa wenn wir von gesellschaftlichen Zielstellungen, vom Allgemeinwohl, von kollektiven Denkformen/ Mentalitäten, vom gesellschaftlichen Bewußtsein, von sozialen Werten/Selbstbildern etc. reden. Erst recht scheinen Umgangssprache und politische Sprache ohne die Verwendung solcher Kollektiva nicht auszukommen. Unbefangen werden Parteien zu Siegern von Wahlen erklärt, melden Regionen ihre Ansprüche an, wird (die Niederlage einer Fußballmannschaft beklagend) vom verletzten Stolz der Nation gesprochen, ja manchmal wird sogar die Menschheit als denkendes und fühlendes Handlungssubjekt vorgeführt. Aber der Verweis auf Üblichkeiten der Alltagssprache entbindet uns nicht von einer Analyse und kritischen Reflexion. Wer spürt nicht ein gewisses Unbehagen, wenn er, im Fluß der Rede einmal unterbrochen, seinen Gebrauch obiger Termini erläutern soll. Wissen wir doch, daß nur Individuen denken, fühlen, werten, sich identifizieren können. Mit dem Wort „Kollektives“ scheint es sich ebenso zu verhalten wie von Hayek das für das Wort „Soziales“ nachweist. Immer dann, wenn es sich an andere Begriffe wie Gerechtigkeit, Identität, Bewußtsein etc. heftet, führt das zu ihrer Aushöhlung und Entleerung. Von Hayek spricht in diesem Zusammenhang sehr bildhaft von einem Wieselwort (von Hayek 1979, S. 16 ). Ein weiterer Grund für die Vorbehalte scheint in der Vagheit und Diffusität des zugrundeliegenden Begriffs „Identität“ zu liegen. Dieses Schicksal teilt der Begriff Identität allerdings mit vielen anderen Grundbegriffen der Sozialwissenschaften wie Handeln, Sinn, Interessen, Gemeinschaft, Gesellschaft etc. Also, was meinen wir eigentlich, wenn wir von "kollektiver Identität" reden? Wie läßt sich unser Unbehagen beim Gebrauch dieses Terminus erklären? Gibt es sinnvolle Verwendungsweisen, die man von problematischen oder gar sinnlosen abgrenzen könnte? Ich will mich der Antwort auf einem scheinbaren Umweg, durch einen Exkurs in die Geschichte der Sozialwissenschaften nähern. Ich werde mich zunächst mit der Karriere des von E. Durkheim eingeführten Begriffs des „Kollektivbewußtseins“ beschäftigen, weil mir scheint, daß sich aus der Auseinandersetzung um diesen Begriff viel für unsere Fragestellung lernen läßt. Durkheim verwendet diesen vor allem in seinem religionssoziologischen Hauptwerk „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ (vgl. Durkheim 1994) eingeführten Begriff in mehreren Bedeutungen.3 Zum einen geht es ihm, wenn er von Kollektivbewußtsein spricht, um eine bestimmte Qualität individueller Handlungsorientierungen. Kollektivbewußtsein meint hier vor allem die Ausrichtung individueller Orientierungen auf un- bzw. überpersönliche Ziele. Dabei versteht er unter „unpersönlichen Zielen“ Handlungsorientierungen, die auf die Erhaltung und Entwicklung der Gruppe als Ganzes, und nicht lediglich auf die Sicherung der individuellen Reproduktion, gerichtet sind. Erst diese Qualität der individuellen Ziele macht aus seiner Sicht eine Handlung zu einer moralischen Handlung (Durkheim 1984a).4 Häufig verwendet Durkheim aber „Kollektivbewußtsein" auch gleichbedeutend mit „kollektive Mentalitäten“. Gemeint sind damit bei Durkheim relativ stabile psychische Strukturen und Verhaltensdispositionen von Individuen, in denen sich a) historisch-soziale Existenzbedingungen niederschlagen und die b) spezifisch für die Mitglieder bestimmter Gruppen sind. Das Besondere dieser Strukturen besteht in ihrem „überindividuellen“, an das 3 Genauer handelt es sich um Bedeutungsvariationen, die nicht streng typologisch abgrenzbar sind, sondern sich als Aspekte eines Gesamtkonzeptes erweisen. 4 Diesen Begriff des Kollektivbewußtseins hebt er übrigens von einem anderen (zum Beispiel im Utilitarismus gebräuchlichen) Verständnis unpersönlicher Ziele ab, das lediglich auf die allen Individuen gemeinsamen Ziele abstellt. Wenn alle dasselbe wollen (z.B. essen), wendet Durkheim gegen diese Auffassung ein, so macht das diese Handlung noch nicht zu einer moralischen. Deshalb steht er der naheliegenden Bestimmung des Begriffs Kollektivbewußtsein im Sinne der bloßen Summe oder des Durchschnitts individueller Intentionen insgesamt ablehnend gegenüber. 3 Gruppenleben gebundenen Charakter. Das heißt, obwohl sie nur im Verhalten von Individuen präsent sind, sterben sie dennoch nicht mit dem Tod bestimmter Individuen oder Generationen ab, sondern erhalten sich generationenübergreifend oder verstärken sich gar in der Generationenfolge. Ein wiederum anderes Verständnis liegt zugrunde, wenn er Kollektivbewußtsein im Sinne des sozialen Selbstbewußtseins der Gruppenmitglieder faßt. Durkheim geht dabei von einem dualen Wesen des Menschen aus, bestimmt dieses aber (anders als Kant) als Scheidung zwischen einem individuellen und einem sozialen Wesen des Menschen. Für ihn ist klar, daß die Menschen ihr Selbst nur in Auseinandersetzung mit einem Wir entwickeln können. Beide Pole hält er dennoch nicht für gleichwertig. Das „eigentlich Menschliche“ entfaltet sich erst im Bezug der Individuen auf die Gruppe, die Sozialität. Das Beste im Menschen, so postuliert er, ist sozialer Natur. Zuweilen kommt aber, wenn Durkheim von kollektivem Selbstbewußtsein redet, auch eine distanzierte Verwendung ins Spiel. Das geschieht immer dann, wenn er die (ideologischen) Selbstbilder der Gruppe, die Selbststilisierungen der Gruppe durch privilegierte Vertreter (Ideologen) kritisch in den Blick nimmt. Durkheim warnt die Soziologen davor, bei der Untersuchung solcher sozialer Oberflächenerscheinungen stehen zu bleiben. Ideologische Selbstbilder stehen mit Herrschaftsinteressen in Verbindung. Sie enthalten daher immer ein Moment der Verzerrung, das der Entlarvung durch den wissenschaftlichen Beobachter bedarf (Durkheim 1994). Ferner benutzt Durkheim den Begriff des Kollektivbewußtseins immer dann, wenn er auf die Art und das Niveau des Zusammenhalts in der Gruppe abstellt. Er unterscheidet nach Arten der sozialen Integriertheit verschiedene Qualitäten des Kollektivbewußtseins (Durkheim 1992). Im Unterschied zu primitiven Gesellschaften, die auf mechanischer Solidarität beruhen, konstatiert Durkheim für moderne Gesellschaften eine Dominanz der „organischen“, sich auf Arbeitsteilung gründenden Solidarität. Dennoch ist für Durkheim ausgemacht, daß arbeitsteilige, marktwirtschaftlich organisierte Verhältnisse den notwendigen sozialen Zusammenhalt allein nicht gewährleisten. Soziale Anomien in modernen Gesellschaften führt er auf den Verlust verbindlicher sozialer Normen, auf ein Erschlaffen der moralische Kraft des Kollektivbewußtseins zurück. Schließlich spricht Durkheim von Kollektivbewußtsein immer dann - hier kämen wir zu einer Kernschicht seines Begriffskonzepts - wenn er die besondere Qualität sozialer Bewußtseinsphänomene gegenüber individuellen psychischen Erscheinungen hervorheben will. Das Kollektivbewußtsein existiert zwar, so betont er, nicht getrennt vom individuellen Bewußtsein. Es ist jedoch Produkt der Wechselwirkung zwischen Individuen, der Assoziation individueller Psychen und gewinnt als solche eine neue Qualität. Denn das Ganze, so argumentiert er, ist mehr als die Summe seiner Teile. Durch die Wechselwirkung komme es zu einer Kräftepotenzierung, damit entstünden psychische Gebilde ganz neuer Qualität. Die Sprache, die wissenschaftlichen Kategorien, große moralische Ideen hätten ihre Quelle nicht im isolierten Individuum, sondern in der Gesellschaft. Durch Bindung an eine Gesellschaft würden die Individuen zu Ideen und Anstrengungen (z.B. Großmut, Aufopferung) motiviert, die sie für sich genommen niemals entwickelt hätten. Kollektivbewußtsein ist daher für ihn wesentlich moralischer Natur. Als moralisches Regulativ verpflichte und begrenze es die Individuen; zugleich erhöhe es sie aber auch, motiviere es sie zu besonderen Anstrengungen und Leistungen. Diese verpflichtende Kraft hat das Kollektivbewußtsein nach Auffassung Durkheims aber nur, weil es als eine über den Individuen stehende objektive Macht wahrgenommen wird, ja weil es sich häufig als äußerer Zwang gegenüber den Individuen geltend macht. Die Verwandlung in eine objektive Macht lasse sich als Prozeß der Verdinglichung und Vernatürlichung des Kollektivbewußtseins beschreiben. Erst durch die Bindung des Bewußtseins an Symbole und Rituale, durch seine Haftung an Dinge werde Bewußtsein aufbewahrt, erhalte es seine Stabilität und Dauer, die es für die Handlungsaktivierung und -mobilisierung benötige. Die Verdinglichung und damit 4 verbundene Substantialisierung sozialer Zusammenhänge wird also bei Durkheim als funktional für die Realisierung der verhaltensorientierenden Funktion des Kollektivbewußtseins angesehen und nicht wie bei Marx ideologiekritisch in den Blick genommen. Soweit dieser Exkurs. Ich versuche nun, ausgehend von der Analyse des Durkheimsches Konzepts des Kollektivbewußtseins, eine Übertragung auf unser Problemfeld vorzunehmen. Es ließe sich vermuten, daß in Hinblick auf den Begriff „kollektive Identität“ ähnlich vielfältige Verwendungsweisen im Spiel sind. Wenn von kollektiver Identität die Rede ist, könnte es gehen - um die Ausrichtung individueller Handlungen an sozialen Zielen (Bedeutung 1) - um kollektive Mentalitäten, also um in einer Gruppe dominierende Überzeugungen, psychische Dispositionen und Verhaltensstrukturen (Bedeutung 2) - um das soziale Selbstbewußtsein von Individuen, wobei dieses „Wir-Bewußtsein“ durch (ideologische) Selbstbeschreibungen und Zukunftsprojektionen einer Elite, die in strategischer Absicht handelt, beeinflußt sein kann (Bedeutung 3) - um die Integriertheit und Stabilität der Gruppe, die Sicherung eines Mindestmaßes an Einheitlichkeit des Handelns und Handlungskoordinierung (Bedeutung 4) - um die soziale Handlungsaktivierung bzw. Handlungsmobilisierung von Individuen durch Berufung auf die existentiellen Erfordernisse („höherwertiger“) kollektiver Einheiten, wobei die exklusiven Ansprüche der kollektiven Einheit in der Regel durch Verdinglichung bzw. Vernatürlichung des Sozialen abgestützt werden (Bedeutung 5) Was aber ist gegen ein solches Konzept kollektiver Identität/kollektiven Bewußtseins, außer dem Hinweis, daß es unterschiedliche Bedeutungsvariationen unter einem Dach zusammenführt, einzuwenden? Bekanntlich war die Durkheimsche Auffassung des Kollektivbewußtseins ja schon zu seinen Lebzeiten starker Kritik ausgesetzt (Durkheim 1984b). Worin besteht aus der Sicht der Gegner das Problematische dieses Begriffskonzepts? Welche Argumente werden gegen seinen Gebrauch geltend gemacht und auf welche philosophischen „Basisüberzeugungen“ wird dabei zurückgegriffen? 2. „Kollektive Identität“ - Ansätze der Dekonstruktion Um die hier vertretene These vorwegzunehmen: Die Vorbehalte gegen das Konzept kollektiver Identifizierung lassen sich vor allem auf die Dominanz der universalistischen Theorietradition in den modernen Sozialwissenschaften und ein damit verbundenes einseitiges Gesellschaftsverständnis zurückführen. Insofern ist das charakteristische Herangehen an das soziale Phänomen kollektiver Identität ein analytisch-dekonstruktives. Ich werde mich bei der Analyse solcher dekonstruktiver Ansätze zunächst auf die moderne Nationalismusliteratur konzentrieren. Gerade die umfangreiche Nationalismusforschung enthält ein reiches Arsenal kritischer Einwände zu Formen kollektiver Identifizierung. Im Verhältnis dazu steckt die Untersuchung anderer moderner Formen der Herstellung von Gemeinschaftlichkeit, beispielsweise die Untersuchung des „region-making“, noch in den Kinderschuhen. Ich habe versucht, die vielfältigen Einwände gegen das Begriffskonzept "kollektive („nationale“) Identität" etwas zu bündeln, ohne damit den Anspruch auf vollständige Darstellung zu erheben. 9 Gruppen von Gegenargumenten lassen sich abheben: 1. Grundlegend für die Auseinandersetzung mit dem Konzept „nationaler Identität“ ist der Vorwurf der Substantialisierung und Hypostasierung sozialer Realitäten (Berger/Luckmann 1996): Mit diesem Vorwurf der Substantialisierung des Bewußtseins muß sich bereits Durkheim auseinandersetzen (Durkheim 1984b, S. 88). Der Begriff der kollektiven Identität 5 lege die Auffassung nahe, daß Gesellschaft als besondere Wesenheit, als spezifische Ganzheit, getrennt von deren eigentlichen Trägern, den Individuen, aufgefaßt werde. Dem wird die durch Weber in den modernen sozialwissenschaftlichen Diskurs eingeführte Überzeugung des methodologischen Individualismus gegenübergestellt, daß man die Gesellschaft nur ausgehend vom sinnhaften Handeln der Individuen beschreiben bzw. erklären könne. Den Hintergrund bildet eine bestimmte Ontologie, nämlich die Auffassung, daß die Individuen bzw. deren Handlungen die Letztelemente und wesentlichen Substanzen der Gesellschaft darstellen. Verbunden ist damit die Ablehnung der holistischen Vorstellung von einer besonderen „überindividuellen“ Existenz des Gesellschaftssystems. 2. Der Hinweis auf den - vielen Konzepten kollektiver Identität zugrundeliegenden ontologischen Holismus ist in der Regel gekoppelt mit dem Vorwurf des (normativen) Kollektivismus. Das heißt; die Orientierung an kollektiven Identitäten würde dazu führen, daß das Individuum der Gruppe untergeordnet werde. Ausgegangen werde von einer problematischen Wertentscheidung. Die Gesellschaft wird nicht nur als etwas qualitativ Anderes angesehen, sondern als im Verhältnis zum Individuum höherstehend betrachtet. Sie ist nicht lediglich als Mittel gut (soweit würde ein individualistischer Ansatz mitgehen), sondern hat einen eigenen Wert. Dahinter, so der weitergehende Vorwurf, verberge sich die Ignoranz gegenüber der individualistischen Tradition in der modernen westlichen Kultur, die in der Idee der Menschenrechte und Grundfreiheiten ihren Ausdruck gefunden hat. In der Konsequenz führe dieses Begriffskonzept zu Beschränkung oder gar zur Mißachtung individueller Freiheiten im Interessen des „Wohls aller“. 3. Vorbehalte gegen den Begriffskonzept "kollektive Identität" resultieren auch daraus, daß durch die Annahme einer besonderen, von der Tätigkeit der Individuen getrennten Substanz die Gesellschaft enthistorisiert und vernatürlicht werde (Henrich 1993, S. 87). Der Gesellschaft werde eine überzeitliche Existenz zugesprochen, die ihrerseits in „der Natur“ (Gemeinsamkeiten der Abstammung, des Bluts, des Lebensraums, der psychischen und physischen Ausstattung der Menschen, der natürlichen Sprache etc.) ihren Grund habe. Diese Gefahr sei schon mit Verwendung des Begriff Identität selbst verbunden. Er lege nämlich die Auffassung nahe, daß man etwas Festes, Gleichbleibendes im Wandel der Ereignisse annehmen könne, daß es eine stabile Substanz des Individuums, ein „Natur“ des Menschen jenseits der sozialen Geschehnisse und der sich wandelnden historischen Erscheinungen gebe. Durch die problematische Übertragung des Identitätsbegriff auf soziale Einheiten werde dieser Eindruck eher noch verstärkt. 4. Ein weiterer Einwand läuft darauf hinaus, daß das Konzept kollektiver Identität die Vielfalt individueller Lebensentwürfe in der Moderne auslösche. Auch dieser Einwand knüpft an Überlegungen zu prinzipiellen Schranken des Begriffs Identität an: Der Begriff Identität impliziere Homogenität. Die Annahme einer Identität bedeute, daß man nach einem in sich homogenen, mit sich selbst identischen Ich suche (Niethammer 1999). Die Identität des Individuums in der Moderne sei jedoch bestenfalls als ein Flickenteppich (Keupp 1990), als Identitätsbalance unterschiedlicher Rollen (Henrich 1993, S. 48 ff.) beschreibbar. Jegliche Annahmen über eine Identität würden die Vielheit, Verschiedenheit, die Pluralität und den Wandel individueller Rollen ausschließen und ein festes, homogenes Selbst unterstellen. Das wäre erst recht gefährlich, wenn man diesen Begriff auf kollektive Entitäten übertrage. Das Konzept kollektiver Identität unterschätze die Komplexität sozialer Beziehungen, die Pluralität der Lebensstile und Wertorientierungen in modernen Gesellschaften. Damit werde die Vielheit und Einmaligkeit der Individuen in modernen Gesellschaften, die Ihr Selbst zunehmend nicht durch Bezug auf überkommene Rollen bestimmen, sondern sich selbst erfinden (Beck 1993), ideologisch negiert. 5. Ein wichtiger Einwand bezieht sich auf die Annahme, daß bei jeglichen kollektiven Identitätskonstruktionen dichotomische Denkschemata Verwendung finden (Anderson 1984). Insbesondere das Freund-Feind-Schema wird als konstitutiv für die Bildung kollektiver 6 Identitäten angesehen. Den Ausgangspunkt bildet die Behauptung, daß Identitätsbildung immer ein Anderes, eine Negativfolie brauche, daß sich das Ich(Wir) nur in Abhebung von einem Sie definieren könne. Das gelte erst recht für den Konstruktionsprozeß kollektiver Identitäten. Hierbei schließt man insbesondere an Simmels Überlegungen zur Negativität kollektiver Verhaltensweisen an. Großgruppen, so Simmel, würden auf Grund ihrer Diffusität kaum über gemeinsame positive Wertüberzeugungen integrierbar sein. Es bleibe also nur die Möglichkeit einer negativen Integration durch Abhebung von einem (feindlichen) Außen (Simmel 1992, S. 533 ff.). Carl Schmitt (1987) hat diese Überlegungen weiter zugespitzt, wenn er das Freund-Feind-Schema zu dem Konstruktionsprinzip politischer Gemeinschaften verklärt. In der bis heute anhaltenden Auseinandersetzung um diese Positionen wird relativ übereinstimmend auf die verheerenden Auswirkungen solcher Freund-Feind-Konstruktionen verwiesen. (z.B. Schmid 1993, S. 115) Zwar bewirke das Freund-Feind-Schema eine starke Binnenintegration, dies werde aber mit negativen Folgen in Form nationalistisch, religiös oder rassistisch motivierter Kriege zwischen verfeindeten Gruppen sowie der gewaltsamen Unterdrückung „abweichender“ Gruppen (z.B. ethnischer Minderheiten) erkauft. Dieses Konstruktionsprinzip kollektiver Identitäten führe zwangsläufig zur Überschätzung des Eigenen und zur Abwertung des Fremden, es sei eine Hauptursache ethnischer Konflikte in Vergangenheit und Gegenwart. Diese Auseinandersetzung wird durch den ideologiekritischen Hinweis ergänzt, daß das FreundFeind-Schema ein Mechanismus sei, der von privilegierten Schichten mit der strategischen Absicht eingesetzt werde, eigene Machtinteressen gegenüber sozialen Unterschichten durchzusetzen. Das führe zur Auslöschung der Interessendifferenzen im Innern der zu konstruierenden Einheit. Derart zusammengeschweißte Gemeinschaften seien bestenfalls als illusorische Gemeinschaften zu bezeichnen (Marx/Engels 1993). 6. Einwände werden auch ausgehend von der Unterscheidung vormoderne - moderne Formen der Sozialintegration erhoben. Das Konzept "kollektiver Identität" bedeute einen Rückgriff auf vormoderne Konzepte der Vergemeinschaftlichung. Bindungen in der Moderne seien jedoch viel eher selbstgewählt statt überkommen, sie seien flüchtig, instabil, themenbezogen (Hitzler 1998, S. 81 ff.) Insofern sei ein solches Konzept eher rückwärtsgewandt, versuche es, vormoderne Traditionen wiederzubeleben. Ähnlich argumentiert Habermas: Der Hauptfehler des alten Konzepts "kollektiver Identität" bestehe darin, daß Gesellschaft auf Gemeinschaft, Systemintegration auf Sozialintegration reduziert werde (Habermas 1988b, S. 173 ff.). Ein solches Konzept habe seine empirische Entsprechung noch am ehesten in traditionalen, archaischen Gesellschaften. Hingegen seien moderne Gesellschaften nur noch ausgehend von einem zweistufigen Gesellschaftsmodell, der Unterscheidung von Lebenswelt (Sozialintegration) und System (Steuerungsmedien Macht und Geld) begreifbar. Konzepte, die einseitig auf kollektive Identität setzen, würden hingegen dazu führen, daß die Eigenlogik der systemischen Steuerungen untergraben und die Kraft normativer Bindungen überdehnt werde. Das einzige, was emanzipatorischen Bewegungen in modernen Gesellschaften noch möglich wäre, sei die Übergriffe des Systems auf die Lebenswelt abzuwehren. Noch weiter geht Luhmann, wenn er das Parsons´sche Konzept der normativen Grundlagen der Gesellschaften vollständig zugunsten eines nichtnormativen Konzepts autopoietischer Reproduktion des Sozialsystems aufgibt (Luhmann 1988). 7. Andere Einwände sind mit Befürchtungen verbunden, daß Konzepte kollektiver Identität die universalistische Tradition in der modernen westlichen Demokratie gefährden (Henrich 1993, S. 87). In klassischer Weise hat solche Befürchtungen Rousseau ausgesprochen, wenn er fordert, daß auf die Formulierung des Gesellschaftsvertrags nicht die spezifischen Interessen besonderer Gruppen Einfluß haben dürfen (Rousseau 1978). Mit dem Begriff "kollektive Identität" sei eine Schwerpunktverlagerung hin zu partikularen Normen, Werten und Lebensstilen verbunden, dies stehe der universalistischen Orientierung innerhalb der modernen Staats- und Rechtsentwicklung entgegen. Zwar seien die Gewährung vom 7 Grundfreiheiten an ein politisches Gemeinwesen gebunden. Die Identität des politischen Gemeinwesens, so behauptet Habermas, hänge aber primär von den in der politischen Kultur verankerten Rechtsprinzipien und nicht von einer besonderen ethnisch-kulturellen Lebensform ab (Habermas 1997, S. 658f.). Hingegen führe die Bevorzugung des Konzepts kollektiver Identitäten dazu, daß man sich auf partikulare Solidaritäten, auf gruppenspezifische Konzepte des Guten festlege. Damit seien gegenmoderne Tendenzen des Partikularismus und Neo-Nationalismus verbunden (Beck 1993). 8. Zudem wird kritisch angemerkt, daß das Konzept kollektiver (nationaler) Identität sozial und politisch höchst ambivalent sei, es mit den verschiedensten politischen Zielstellungen aufgefüllt werden könne, angefangen von emanzipatorischen Gehalten über dynastische und imperialistische Ansätze bis hin zu offen rassistischen bzw. faschistischen Politikkonzepten (Anderson 1983). So sei „Identität“ in den 70er Jahren in Deutschland zum Kernbegriff des neuen Rechtsradikalismus geworden (Niethammer 1999). Andere Autoren betonen, daß die verschiedenen Formen nationaler Identifikation in besonderem Maße für die Rhetorik und Überredungskünste von Ideologen anfällig seien (Henrich 1993, S. 81) 9. Nicht zuletzt wird auf den dünnen, schlüpfrigen Boden anthropologischer Annahmen verwiesen, der solchen Konzepten kollektiver Identität zugrunde liege (Thomä 1995, S. 350). Mehr oder weniger alle Konzepte kollektiver Identität würden mit anthropologischen Letztbegründungen arbeiten. Um diese Behauptung zu illustrieren, sei mir ein kurzer Exkurs zu Wolfgang Schäubles vielbeachtetem, inzwischen in zweiter Auflage erschienenem Buch „Und der Zukunft zugewandt“ (1998) gestattet. Schäuble versucht seine zentrale These, daß es notwendig sei, die nationale Identität der Deutschen wiederzubeleben, zwar auch politiktheoretisch zu untersetzen, er begründet sie aber vor allem mit anthropologischen Annahmen. Die anthropologische Dimension seiner Argumentation wird besonders in seiner Behauptung deutlich, daß trotz aller gedanklichen Fortschritte die Grundbedingungen menschlicher Existenz unverrückbar bleiben würden. Der Mensch, so Schäuble, werde weder besser noch schlechter. Politik habe sich darauf einzustellen. (Schäuble 1998, S. 250) Was gehört nach Schäuble zu diesen unverrückbaren Tatbeständen menschlicher Existenz? In erster Linie gehöre dazu, daß der Mensch von Natur aus auf Gemeinschaft, auf staatliche Gemeinschaft hin angelegt sei (ebenda, S. 112). Mehr noch: Es gäbe ein im Menschen angelegtes Bedürfnis nach nationaler Bindung (ebenda, S. 200). Warum hält Schäuble gerade die Nation, die ja eine historisch sehr spezifische Form von Gemeinschaftlichkeit darstellt, für die menschliche Existenz für unverzichtbar? Schäuble behauptet mit Dahrendorf, gegen eine mißverständliche Interpretation der These vom Verfassungspatriotismus gerichtet, daß soziale Institutionen kalte Projekte darstellen, die die notwendige Identifizierung mit einer Gesellschaft allein nicht gewährleisten könnten. Nur die Nation schaffe die emotionalen Bindungen, die entscheidend für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft seien (ebenda, S. 46 f.). Die Menschen würden nicht von Brot und Begriffen allein leben, sie müßten etwas Positives lieben; die Gemeinschaft müsse nicht nur durch den Verstand, sondern auch im Herzen der Bürger gestiftet werden. Diese Kraft besitze allein die Nation (ebenda, S. 219 f.). Zugrunde liegt ein bestimmtes Menschenbild. Der Mensch wird als Kosten-Nutzen-Maximierer aufgefaßt, der einen Hang zur Minimierung von Aufwand, Kosten und zur Abschiebung von Lasten auf andere aufweist. In seinem natürlichem Egoismus bedürfe der Mensch, um gemeinschaftsfähig zu werden, der Begrenzung durch gemeinsame Wertvorstellungen. Die Nation aber sei genau die Form menschlicher Gemeinschaft, die einerseits auf gemeinsamen Wertüberzeugungen beruhe bzw. diese trage, die aber andererseits auch selbst diese auf die Gemeinschaft bezogenen Werte hervorbringe (ebenda, S. 46, 55). Daß der Mensch mit dieser Orientierung auf die Gemeinschaft nicht überfordert werde, hänge mit einer anderen Seite menschlicher Tiefenstrukturen zusammen. Es gebe nämlich ein zur anthropologischen Grundausstattung 8 zählendes Selbstverantwortungspotential des Menschen und ein daraus erwachsendes konstantes Potential an solidarischem Verhalten in jeder Gesellschaft, das durch die Nation als Schutz- und Schicksalsgemeinschaft lediglich abgerufen werde (ebenda, S. 78). Welche Funktion besitzt - aus dieser Perspektive betrachtet - die Identifizierung mit einer Nation? Für Schäuble gehören menschliche Hoffnungen und damit verbundene Zukunftswünsche zur Grundbedingung menschlicher Existenz. Die Hoffnung habe eine transzendente Dimension, dieses Bedürfnis wäre traditionell durch Religionen befriedigt worden. Unter Bedingungen der abnehmenden Bindungskraft von Religionen müsse Gemeinschaft an derer Stelle treten. Die Hoffnung und Zukunftsfähigkeit, so Schäubles These, speise sich unter heutigen Bedingungen wesentlich aus dem Eingebundensein in eine Gemeinschaft (Familie, Verein, Nation). Alle Gemeinschaften geben dem individuellen Dasein Sinn, Hoffnung, Orientierung (ebenda, S. 50 f.). Wesentlich für Schäubles Begründungsansatz ist schließlich, daß er Tendenzen in allen Kulturen ausmacht, das Vertraute, Bekannte positiv zu diskriminieren bzw. sich von einem Fremden zu unterscheiden. Diese kulturindifferenten Erscheinungen dürfe man nicht einfach moralisierend verdammen, vielmehr müsse man sie in einer realistischen Politik berücksichtigen. Man dürfe die Bürger hinsichtlich der Menschheitsideale nicht überfordern. Wir sind - so Schäuble - niemals nur Weltbürger, sondern immer auch Vertreter besonderer Lebenslagen, Interessen und Wertmaßstäbe. Insofern sei eine besondere kollektive Identität für die Orientierung des Einzelnen wie für den Erhalt freiheitlicher Gesellschaften unverzichtbar (ebenda, S. 174 f.). Soweit Schäubles Gedankengänge: Es bedarf wohl keiner ausführlichen Kommentierung, um auf Schwächen dieser Argumentation aufmerksam zu werden. Von Gegnern solcher anthropologischen „Fundierungen“ wird meines Erachtens zu Recht immer wieder darauf verwiesen, daß diese Berufung auf das menschliche Wesen eine Strategie der Letztbegründung sei, die Grenzen des Fragens und Sagens setze und damit zur Immunisierung dieser Konzepte gegen Kritik führe. Nachdem ich wesentliche Gegenargumente gegen das Konzept „kollektiver Identität“ referiert habe, möchte ich mich nun der Frage zuwenden, worauf diese Vorbehalte zurückzuführen sind. Meines Erachtens geht es nämlich nur vordergründig um einen Streit innerhalb der Sozialwissenschaften. Vielmehr werden philosophische „Grundüberzeugungen“ berührt. Nebenbei bemerkt: Vielleicht ließe sich die Diskussion etwas versachlichen, wenn man sich stärker auf solche philosophischen Fundamente besinnen würde. Ich sehe eine Verbindung mit vier zum Teil sehr alten philosophischen Streitfragen, welche den Boden(satz) der aktuellen sozialwissenschaftlichen Diskussion um den Stellenwert und die Berechtigung „kollektiver Identitäten“ bilden: Einmal wird die (erkenntnistheoretisch-ontologische) Frage nach der Natur des Allgemeinen berührt5: Die Frage lautet: Existiert das Allgemeine (hier kollektive Identitäten) objektiv real, getrennt von den einzelnen Dingen und vor dem Einzelnen oder ist das Allgemeine lediglich der gemeinsame Durchschnitt einzelner Dinge, ja existieren gar nur die einzelnen Dinge, während jede Klassenbildung lediglich als das Konstrukt, als Erfindung individueller Akteure erscheint. Ersterer Standpunkt hätte zur Folge, daß Aussagen über Ganzheiten ein höherer Wahrheitswert zukommt, letzterer Standpunkt würde bedeuten, daß wahrheitsfähig nur Aussagen über einzelne Sachverhalte sind, während jede Aussage über Ganzheiten in den Bereich der verzerrten ideologischen Reflexion fiele (der Streit zwischen Platonismus und Nominalismus). Daran schließt sich die (sozial-ontologische) Frage an, auf welche Strukturen bzw. Letztelemente das gesellschaftliche Sein zurückgeführt werden kann, wie die 5 Siehe besonders die Einwände 1 und 3. 9 gesellschaftliche Wirklichkeit im Unterschied zur Welt natürlicher Tatsachen existiert (Searle 1997). Bilden die letzten Bausteine der Gesellschaft die (personalen) Individuen bzw. deren Vorstellungen oder Tätigkeiten? Oder kommen Handlungen erst innerhalb eines Systems von sozialen Bedingungen und Verhältnissen zustande, das insofern als eine höhere Realität gegenüber dem Handeln von Individuen anzusehen wäre. (Handlungstheorie versus Struktur-, System- bzw. Figurationstheorie) Das leitet zu einer dritten (methodologischen) Frage über, wie gesellschaftliche Phänomene angemessen zu beschreiben bzw. zu erklären sind. Muß man bei der Analyse sozialer Zusammenhänge vom sinnhaften, intentionalen Handeln der Individuen ausgehen oder sind die Handlungen und deren Motivationen aus den gesellschaftlichen Bedingungen/Verhältnissen/Sinnsystemen abzuleiten. Ist Gesellschaft durch Reduktion auf das interessegeleitete und motivierte Handeln einzelner Menschen zu erfassen oder kann Soziales nur aus Sozialem selbst erklärt werden (der Streit zwischen methodologischen Atomismus und Holismus). Darauf aufbauend läßt sich eine vierte (Wert-)Frage formulieren, die Frage, „was wichtiger ist, die Erhaltung der Gesellschaft oder die Entfaltung des Individuums“ (Simmel, 1992, S. 40) 6. Ist das Individuum und dessen Entfaltung der einzige Zweck der Gesellschaft? Ist die Gesellschaft daher nur als Mittel gut, stellt sie gar nur ein notwendiges Übel dar, das selbst der Begrenzung bedarf? Oder hat die Gesellschaft nicht nur einen Instrumentcharakter, sondern einen Zweck in sich selbst? Hat sie vielleicht sogar über diese zugestandene Funktionalität für menschliche Bedürfnisbefriedigungen hinaus einen höheren Wert als das Individuum? (der Streit zwischen Individualismus und Kollektivismus) Die Antworten auf diese philosophischen Streitfragen sind jedoch im Diskurs der Moderne kaum strittig, genauer, die Fragen sind auf Grund der Dominanz der universalistischen Idee individueller Menschenrechte im zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen bzw. sozialphilosophischen Diskurs eigentümlich vorentschieden.7 So hätte man gegen das Konzept kollektiver Identität aus erkenntnistheoretisch-ontologischer Perspektive einzuwenden, daß hier dem Allgemeinen eine besondere Existenz mit besonderem Wahrheitswert zugesprochen wird. Aus sozialontologischer Sicht wäre die damit verbundene Substantialisierung der Gesellschaft zu beklagen. Aus methodologischer Perspektive käme der "verkehrte Erklärungshorizont" dieses Ansatzes ins Spiel, der von den sozialen Strukturen ausgeht statt die sinnhaften Handlungen in den Blick zu nehmen. Aus normativer Perspektive schließlich stünde der Werthorizont, der hinter dem Konzept kollektiver Identität steht, die Auffassung der Gesellschaft als einer im Verhältnis zum Individuum höherwertigen Realität, vor Gericht. Sollte man die Frage nach dem "Karriere-Ende eines folgenreichen Konzepts" daher getrost zum Abheften ins Museum für sozialwissenschafliche Altertumskunde (Luhmann) schicken, wo schon so viele alte Fragen ruhen? Entgegen dieser naheliegenden Schlußfolgerung plädiere ich dafür, die Frage weiterhin offenzuhalten. Zur Begründung will ich, bevor ich auf verschiedene theoretische Annäherungen an das Problem eingehe, zunächst wissenssoziologisch argumentieren und fragen, welche Lagen und Interessen es denn sind, die zur distanzierten Betrachtung kollektiver Identitäten führen. Überraschenderweise ist gerade in dieser Hinsicht ist ein beachtliches Maß an „Unmittelbarkeit“ zu verzeichnen. Noch deutlicher: Gerade die reflexivste aller Wissenschaften, die Philosophie, ist häufig nicht in der Lage (oder nicht willens?), ihren 6 Siehe besonders Einwand 2. An dieser Einschätzung hat die eher abwehrende Diskussion zum amerikanischen Kommunitarismus im deutschsprachigen Raum nichts wesentliches ändern können, man schaue sich nur einmal R. Forsts modifiziertes universalistisches Rechts- und Moralkonzept an (vgl. Forst 1996). 7 10 eigenen Standort im sozialen Feld zu benennen. Auf den Punkt gebracht, lautet die Frage: Ist die Vorstellung einer entgrenzten, nur über allgemeine Bürgerrechte verbundenen Welt nicht selbst Ausdruck einer besonderen Lage? Vielleicht könnte man diese Lage, eine Überlegung von Mannheim aufgreifend, mit dem Begriff „freischwebende Intelligenz“ umschreiben (Mannheim 1985). Dabei wäre aber gegenüber Mannheim darauf zu bestehen, daß das Einnehmen einer abgehobenen oder Zwischen-Position nicht bedeutet, daß man ohne Position ist. Im Gegenteil; man urteilt dann ausgehend von einer sehr spezifischen Lage. Es ist dies die Lage der sich an vielen (Berufungs- und Konferenz-) Orten Zu-Hause-Fühlenden, die Lage derjenigen, die mehrsprachig mit ähnlich Positionierten in aller Welt kommunizieren. Zugleich handelt es sich aber um eine eigentümlich geschützte Position, eine Lage, die die Möglichkeit bietet, sich an versteckte Orte der Ruhe und Besinnung zurückzuziehen, wo man die „Welt“ hinter sich zurücklassen kann. Ungewollt hat U. Beck diese Spannung benannt, wenn er sich im Vorwort zu seinem Buch „Die Erfindung des Politischen“ für die Möglichkeit bedankt, an anregenden oder ruhigen Orten (Wissenschaftskolleg zu Berlin sowie Starnberger See) frei von profanen Sorgen und weltlichen Störungen über die Konturen der rettungslos globalisierten Welt nachdenken zu können (Beck 1993, S. 9ff.). Warum aber sollte gerade diese Lage repräsentativ für alle übrigen sozialen Positionen sein? Insofern bietet es sich an, nach dem blinden Fleck dieser Sichtweise, nach demjenigen, was aus diesem Blickwinkel heraus verborgen bleiben muß, zu fragen. Dieser „andere“ Blick scheint allein deshalb geboten, weil man einer davoneilenden Wirklichkeit neuer Nationalismen und Partikularitäten in der Philosophie (die allerdings nach Hegel sowieso immer zu spät kommt) irgendwann doch nacheilen muß. 3. Verschiedene theoretische Annäherungen an das Phänomen kollektiver Identität Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin, verschiedene Wege zur Beschreibung und Erklärung des Phänomens kollektiver Identität in ihren Möglichkeiten und Grenzen zu erörtern. Ich werde eine sprachhygienische, eine mentalitätsgeschichtliche (strukturalistisch bzw. ideengeschichtlich-hermeneutisch inspirierte), eine dekonstruktive (ideologiekritische), eine rekonstruktive (konstruktivistische), eine normative (rechts- bzw. politikphilosophische) und eine historisch-typologisierende Richtung unterscheiden, wobei ich nicht ausschließe, daß sich diese Wege manchmal kreuzen oder gar ineinander übergehen. Eine naheliegenden Lösungsversuch will ich zunächst diskutieren: Ich nenne diesen Ansatz die sprachhygienische Lösung. Sie läuft darauf hinaus, den diskreditierten und mißverständlichen Begriff kollektiver Identität durch den weniger mißdeutbaren Begriff der raumbezogenen Identifikation zu ersetzen.8 Der Vorteil dieser Begriffsstrategie bestünde darin, daß man der Gefahr der Substantialisierung und Vernatürlichung von sozialen bzw. Gruppenphänomenen entgeht, also dem Anschein besser entgegentreten kann, daß von sozialen Zusammenhängen losgelöst vom sinnhaften Handeln der Individuen die Rede ist. Bei dieser Sprachregelung bleibt das Subjekt, das solche Identifikationsprozesse vornimmt, nämlich das Individuum, klar erkennbar. Zugleich wird auf den Prozeßcharakter dieser Identifikation, die nie zu einem Ende kommt, immer offen für Neudefinitionen oder Uminterpretationen bleibt, abgestellt und die Vielheit möglicher Identifikationen ins Auge gefaßt. Schließlich wird auch mit der Möglichkeit der Differenz zwischen Identifikation/Bewußtsein und Handeln gerechnet. Die Frage lautet nun aber: Haben wir uns mit dieser Festsetzung über den Sprachgebrauch 8 Vgl. die entsprechenden Bemerkungen im Vorspann zum Sonderforschungsbereich Regionenbezogene Identifikationsprozesse. Das Beispiel Sachsen (1998) 11 lediglich von sprachlichen Mißverständnissen freigemacht, oder haben wir damit bereits eine theoretische Vorentscheidung getroffen, die das Sichtfeld unzulässig einschränkt? Um deutlicher zu werden: Läßt sich ein Prozeß als solcher, getrennt von den sozialen Wirkungen und Bedingungen analysieren? Zählt zu Resultaten des Prozesses nur die Ausprägung psychischer Dispositionen oder kommt es im Gefolge der Identifizierung nicht auch zu bestimmten sozialen „Entäußerungen“ bzw. „Objektivationen“? Der Begriff der kollektiven (regionenbezogenen) Identifikation lenkt m.E. die Aufmerksamkeit (zu) stark auf die (psychischen) Vorgänge im Individuen. Die sozialwissenschaftlich interessanten Fragestellungen beginnen aus meiner Sicht aber erst jenseits der Untersuchung dieser intraindividuellen Vorgänge und Dispositionen. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wäre beispielsweise zu fragen, wie diese Vorgänge motiviert sind, welche sozialen Identifikationsanreize Verwendung finden, welche historisch-kulturell variierenden Identifikationsmuster in den Prozeß der Identifikation eingehen, welche sozialen Eliten diese Identifikationsangebote mit welchen Zielen produzieren, welcher soziale Gewinn sich für die Individuen aus dieser Identifikation erwarten läßt und welche soziale Folgen solche Prozesse der Identifikation hinsichtlich der Stabilität/Integriertheit von sozialen Einheiten haben. Meine These lautet daher: Wenn es um die Beschreibung von Motiven, Anreizen, Bedingungen und Resultaten von Identifikationsprozessen geht, kommen wir ohne einen Begriff kollektiver Identität oder entsprechende Ersatzbegriffe nicht aus. Das wird bereits deutlich, wenn wir darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, sich zu identifizieren. Hier sind nämlich mehrere sinnvolle Fortsetzungen der Rede möglich: Einmal kann ich mich selbst als jemand identifizieren oder werde als jemand identifiziert. Sich zum Beispiel als Sachse identifizieren (Selbstzuschreibung) oder als Sachse identifiziert werden (Fremdzuschreibung) setzt immer bereits eine Vorstellung vom typischen Sachsen voraus, Vorstellungen, die nie allein vom sich identifizierenden Individuum produziert worden sind. So einmalig und individuell varierend diese Vorstellungen auch sein mögen, es gehen kulturelle Stereotype und kollektiv geteilte Vorurteile ein. Zu fragen wäre daher: Welche mentalen Strukturen werden üblicherweise als typisch sächsisch angesehen? Wie sind diese Vorstellungen geschichtlich entstanden bzw. wie wurden diese Vorstellungen geschichtlich variiert? Wer ist ihr „Erfinder“, welche Bedingungen und Institutionen haben zu ihrer Verbreitung beigetragen? Zum zweiten kann ich mich mit jemandem (entweder gefaßt als konkreter anderer Mensch oder aufgefaßt als mehr oder weniger anonyme Gruppe) und mit etwas (mit bestimmten „Objekten“ wie Räumen, Gütern, Kulturen, Sprachen, Symbolen etc. ) identifizieren. Identifiziere ich mich mit einer Gruppe, ist eine kollektive Einheit immer schon unterstellt. Die vorgestellte Gruppe wird dann zu einem Teil meiner eigenen Identität, wenn ich ihre Existenz als für mich wertvoll erachte. Dabei ist die Identifizierung mit der Gruppe die Brücke auch zur Verbindung mit dem konkreten anderen Menschen. In Vermittlung über die Gruppenexistenz werde ich als Gleicher anerkannt und erkenne den anderen als mir gleich an. Das Ergebnis ist eine bestimmte Integriertheit der Gruppe selbst, wobei diese Binnenintegration häufig durch Abgrenzung von einer Fremdgruppe verstärkt wird. Auch wenn ich mich mit bestimmten Gegenständen oder Räumen identifiziere, identifiziere ich mich nicht primär mit der natürlichen Beschaffenheit des Objekts, sondern mit den ihm anhaftenden kollektiv produzierten Bedeutungen. So wird der Raum Sachsen, mit dem ich mich als Sachse identifiziere, vor allem in seiner kulturell-sozialen Überformung und symbolischen Aufladung Identifikationsobjekt. Es ist der Raum der von mir „angeeigneten“ (erzählten oder erlebten) Geschichte, der Raum der (vertrauten) Symbole, der Raum der (gelebten) Lebensformen und Traditionen. Wieder kommen wir zu dem Ergebnis: Die Konzentration auf die Untersuchung der Prozesse der Identifikation befreit nicht von der Frage nach der Existenz kollektiver (hier regionaler) Identitäten. Wenn man fragt, als was und womit sich der andere identifiziert, sind Formen 12 kollektiver Identität bereits immer schon unterstellt. Sich identifizieren setzt nämlich etwas relativ Beständiges im Fluß der Ereignisse voraus. Zugleich ist kollektive Identität aber auch ein Ergebnis von Identifikationsprozessen. Gerade wenn man nach den Resultaten bzw. Erträgen solcher Identifizierungen fragt, kommt man ohne den Begriff der kollektiven Identität nicht aus. Ein mögliche Ertrag wäre die soziale Mobilisierung der Adressaten, eine andere (beabsichtigte oder unbeabsichtigte) Wirkung könnte jedoch in einer gewissen Vereinheitlichung der Lebensstile und in der Stabilisierung des sozialen Zusammenhalts in der Gruppe (in diesem Sinne in der Erzeugung einer „kollektiven Identität“) selbst bestehen. Also: Solche Sprachregelungen können forschungsstrategisch sinnvoll sein, um Mißverständnisse auszuschließen und falschen Beschuldigungen zu entgehen. Sie erlauben es bestimmte Forschungsakzente neu zu setzen, befreien uns aber nicht von der Frage selbst und der Suche nach Lösungsansätzen. Wie könnte man sich aber sinnvoll dem Problem „kollektiver Identität“ nähern, ohne solchen vorab beklagten Substantialisierungen sozialer Realitäten aufzusitzen. Rational weiterführen ließe sich die Diskussion zum Problem kollektiver Intentität m.E. zunächst ausgehend von einer mentalitätsgeschichtlichen (strukturalistischen bzw. ideengeschichtlich-hermeneutischen Perspektive. Auf die Notwendigkeit von mentalitätsgeschichtlichen Untersuchungen wird u.a. von Lepenies (1992, S. 12 ff.) und Henrich (1993) aufmerksam gemacht. Allerdings ist der Begriff der sozialen Mentalitäten in seiner Leistungsfähigkeit stark umstritten. Für die strukturalistisch inspirierte Mentalitätsforschung hat Durkheim, wir erwähnten es bereits, mit seinen Untersuchungen zum Kollektivbewußtsein wesentliches beigetragen. Innerhalb dieser Perspektive wäre der Begriff der kollektiven Identität in den Begriff (überlieferter) gruppenspezifischer psychischer Dispositionen zu transformieren. In der modernen Kulturphilosophie wurde dieser Ansatz vor allem von P. Bourdieu in seinem Habitusansatz aufgegriffen. Wenn Bourdieu von Habitus spricht, sind damit nicht natürliche Phänomene, sondern sozial determinierte psychische „Strukturen“ (Dispositionen) gemeint. Diese Dispositionen entfalten ihre verhaltensdeterminierende Funktion nicht jenseits der menschlichen Vorstellungen. Vielmehr besitzen solche Gemeinsamkeiten psychischen Erlebens für ihn zu wesentlichen Teilen selbst einen konstruktiven Charakter, an dem Interpretationen Anteil haben. Soziale Verhaltenserwartungen haben für Bourdieu also keine Existenz jenseits der Aneignung und Interpretation durch Individuen. Es handelt sich um Zuschreibungen, die aber für die soziale Position (Identität) nicht äußerlich bleiben. Indem wir uns zu solchen mentalen „Strukturen“ ins Verhältnis setzen, wir uns mit ihnen identifizieren oder sie ablehnen, positionieren wir uns im sozialen Raum. Dabei ist für Bourdieu aber klar, daß die Definitionsmacht hinsichtlich solcher Zuschreibungen nicht gleichmäßig verteilt ist. Für ihn stellt daher der Kampf um die Zuschreibungen, die symbolischen Formen und Benennungen selbst ein wesentliches soziales Kampffeld dar. Einen anderen Weg als Bourdieu wählt D. Henrich. Er geht der Frage, durch welche geistigen Strukturen die „deutsche Identität“ gekennzeichnet sei, ausgehend von einer hermeneutisch-geistesgeschichtlichen Perspektive nach. Henrich unterscheidet hierbei zunächst zwischen einer Binnen- und einer Außenperspektive auf Identität. Besonders sichtbar werden solche Mentalitäten aus seiner Sicht aus der Außenperspektive. Zwar könnten sich bei solchen Fremdzuschreibungen leicht Banalitäten und mit ihnen verbundene Klischees (über das „typisch Deutsche“, „Französische“ etc.) einstellen. Doch hätten Völker und Kulturen wirklich Eigenschaften, die über lange Zeit in allem Wechsel charakteristisch für sie blieben (Henrich 1993, S. 22). Diese Außenperspektive greife nun auf Umwegen auch in die Binnenwahrnehmung ein. Aus der Binnenperspektive der sich identifizierenden Individuen lassen sich drei Verwendungsweisen von Identität abheben: einmal persönliche Identität, worunter er die aus 13 Erinnerung gespeiste Erfahrung der Kontinuität eines Lebens versteht, zum zweiten die soziale Identität, die er als die durch soziale Rollen und Normen determinierte Position des Individuums interpretiert, schließlich die personale Identität, von der er in Abhebung von den beiden ersten Bedeutungen immer dann spricht, wenn er den Abbau der Außenbestimmung im Handeln im Auge hat (ebenda, S.28 ff.). Für Henrich ist dabei aber klar: Es geht, wenn er von sozialer Identität redet, nicht um die Unterordnung oder gar Aufgabe persönlicher Identität, sondern um die Frage, wie sich die persönliche (Ich-)Identität in Wechselwirkung mit einer sozialen (Wir-)Identität herausbildet. Den Begriff der personalen Identität führt er vor allem deshalb ein, um die Möglichkeiten der Selbstbestimmung individueller Handlungssubjekte im Rahmen von zunächst vorgegebenen biographischen und sozialen Kontexten deutlich zu machen. Henrich untersucht nun, inwieweit diese zunächst auf das Individuum bezogenen Identitätsbegriffe auf Kollektiva wie die „Nation“ anwendbar sind. Er hält eine solche Übertragung mit Abstrichen für möglich. Auf die Nation angewandt, meint der Begriff der persönlichen Identität eine Konstruktion kollektiver Identitäten, wo die entsprechenden Selbstbilder durch kollektive Erinnerungen gespeist werden. Zwar sieht auch Henrich die Gefahr des Mißbrauchs solcher Identitätskonstrukte. Dennoch wendet er gegen Habermas´ These des Verfassungspatriotismus ein, daß die Identität eines republikanischen Staates nur zum Teil von Prozessen innerhalb seiner Institutionen herzuleiten sei. Es bedürfe deren Verwurzelung in den subjektiven Einstellungen der Teilnehmer. Daher müsse dem prozeduralen Ansatz der Rationalität (Freiheitsprinzip) eine ganz andere Stütze zur Seite gestellt werden. Die Lösung liegt für Henrich in einem weiteren Identitätssinn, von ihm Identitätsbalance genannt. Es ist die Identität, die sich herausbildet, wenn Individuen unter Wahrung der persönlichen und personalen Identität in gänzlich neue Lebensverhältnisse hineingerissen werden. In diese Identitätsbalance würden Selbstbeschreibungen eingehen, die die Individuen großräumig verorten. Gerade bei der Umorientierung der Identiätsbalance können Gehalte kollektiver Erinnerung eine Ressource für Kontinuität und Orientierung sein. Solche Gehalte sind in der Binnenwahrnehmung der Individuen mit dem verbunden, was für die Individuen die Kultur, das Volk, die Nation ausmacht. (Ebenda, S. 48 ff.) Eine andere Annäherung an das Phänomen der kollektiven Identität, eine Annäherung, die im Unterschied zu vorab dargestellten mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen eher eine kritische Brechung beinhaltet, scheint ausgehend von einer dekonstruktiven ( ideologiekritischen) Perspektive möglich. Mit diesem Ansatz wollen wir uns jetzt etwas näher beschäftigen. Ausgehend von der These, daß es sich bei kollektiven Identitäten um (illusorische) Formen von Gemeinschaftlichkeit handelt, werden die Ideologeme, die der „Herstellung“ kollektiver Identitäten zugrundeliegen, also die Leitbilder, die binärer Tiefenstrukturen sowie diskursiven Verfahren untersucht. Das Ziel besteht in einer kritischen Analyse des Prozesses des Gemeinschaft-Machens. Diese ideologiekritische Perspektive, insbesondere bei der Analyse des Nationenbildungsprozesses vielfach erprobt (siehe Berding 1994, 1996 u.a.), könnte man auf die Untersuchung des Konstruktionsprozesses anderer kollektiver Identitäten, beispielsweise der Region, ausdehnen, um durch vergleichende Untersuchungen allgemeine Annahmen über die Herausbildung bzw. Stabilisierung kollektiver Identitäten zu gewinnen. Als Kandidaten für solche allgemeinen Mechanismen der Konstruktion sozialer Einheiten kämen etwa in Betracht9: 9 Die folgende Liste ist sicher nicht vollständig. Zudem enthält sie, so wird der kritische Betrachter einwenden, Elemente höchst unterschiedlicher Qualität, die kaum auf gleicher Ebene analysiert werden können. So müßte man beispielsweise zwischen Leitbildern bzw. Leitideen, die dem Konstruktionsprozeß kollektiver Einheiten zugrunde liegen einerseits und den jeweiligen Verbreitungsmedien andererseits unterscheiden. Die Liste ist daher lediglich als Aufzählung wesentlicher in der Nationalismusliteratur genannter Mechanismen zu verstehen, ohne daß hier eine systematischen Untergliederung vorgeschlagen würde. 14 die Traditionskonstruktion, die kollektive Erinnerung an eine gereinigte, heroisierte Geschichte die Verwendung mythischer Elemente, insbesondere von Gründungs- und Abstammungsmythen der Einbau der Grenzziehung zwischen Eigenem und Fremden, häufig aufgeladen im Sinne des Freund-Feind-Schemas die Psychologisierung sozialer Realitäten (kollektives Gedächtnis, Seele des Volkes, Stolz und Würde der Nation etc.) gemeinsame, auf die Zukunft bezogene Zielstellungen und Leitmodelle, in denen sich das Versprechen einer besseren Zukunft niederschlägt der Messianismus; der Glaube, das auserwählte, privilegierte Volk zu sein die Existenz entsprechender Verbreitungsmedien wie Sprache, Schrift, Buchdruck, Printmedien oder elektronischer Medien die Vernatürlichung und Verdinglichung des Soziales, dessen Bindung an räumliche, sprachliche, blutsverwandtschaftliche und andere ethnische Merkmale die Veralltäglichungen der Leitbilder in Form von Ritualen, Symbolen, Denkmälern, Museen etc. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Was hier jedoch vor allem interessiert, sind die Grenzen dieser Vorgehensweise. Das vordergründig neutrale sozialwissenschaftliche Interesse an Rekonstruktion – so meine These – ist innerhalb der ideologiekritischen Perspektive der aufklärerischen Absicht der Dekonstruktion des falschen Bewußtseins und der Entlarvung zugrunde liegender Interessen untergeordnet. Das letzte Ziel besteht in der Enttarnung derjenigen Subjekte bzw. Ideologen, die diese Mechanismen in strategischer Absicht verwenden, um damit bestimmte Machtinteressen durchzusetzen. Demgegenüber bleiben Fragen, welche Bedürfnisse die Adressaten veranlassen, sich auf solche angebotenen Identifikationen einzulassen und inwieweit sie selbst Anteil an der Konstruktion kollektiver Identitäten haben, weitgehend ausgeblendet. Ein solcher Ansatz gilt daher heute vielen Sozialwissenschaftlern als veraltet. Schon das Wort Ideologiekritik, das man in früheren Jahren noch als Markenzeichen verwenden konnte, ruft heute bei manchen distanzierte bis polemische Stellungnahmen hervor. Dennoch, diese Einsicht sollte unbefangeneren Beobachtern möglich sein, hat die ideologiekritische Perspektive zu wichtigen Einsichten in die Mechanismen des Gemeinschaft-Machens geführt. Eine zeitgemäße Transformation scheint der ideologiekritische Ansatz innerhalb moderner rekonstruktiver (konstruktivistischer) Ansätze gefunden zu haben. Die Stärken und Schwächen einer solchen Annäherung an das Konzept kollektiver Identität seien im folgenden erörtert. Innerhalb dieser Ansätze werden soziale Einheiten als Konstrukte, als Erfindungen, basierend auf dem „Wissen von Jedermann“ (Berger/Luckmann 1996) untersucht. Die dadurch hergestellten Gemeinschaften werden als imaginierte Gemeinschaften (Anderson 1983) aufgefaßt. Anders gesagt: Das alte ideologiekritische Bemühen um die Dekonstruktion des falschen bzw. illusorischen Bewußtseins wandelt sich zur Frage, welche Vorstellungen, Überzeugungen und Werturteile von bestimmten Individuen geteilt werden und wie diese Vorstellungen soziale Realitäten konstituieren. Die Vorzüge solcher Ansätze liegen auf der Hand: Da sie bewußt von individualistischen Prämissen ausgehen (Berger/Luckmann 1996) scheinen sie gegen den Einwand, man betreibe eine Substantialisierung sozialer Realitäten, immun. Da sie das Alltagsbewußtsein bzw. die Vorstellung von Jedermann in den Mittelpunkt rücken, setzen sie sich nicht dem Einwand aus, den Konstruktionsprozeß zu stark auf die strategischen bzw. legitimatorischen Diskurse von Eliten zuzuschneiden. Da sie das vordergründige Interesse an Entlarvung und schonungsloser Kritik zugunsten sachbezogener Analyse aufgeben, entgehen sie dem Ideologieverdacht, leisten dabei aber zugleich 15 beachtliches bei der Rekonstruktion kollektiver Vorstellungen. Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge gegenüber einem eng aufgefaßten ideologiekritischen Ansatz bleibt dieser Ansatz jedoch Mißverständnissen und Zweifeln ausgesetzt, die zu einer genaueren Fassung bzw. Modifikation des Ansatzes Anlaß geben sollten. Die erste naheliegende Frage, bezogen auf das Konzept der Nation als Erfindung bzw. Konstrukt, von weniger wohlmeinenden Kritikern immer wieder gestellt, lautet, wer eigentlich der Erfinder ist. Zwar beansprucht dieser Ansatz für sich, die kritische Absicht der Entlarvung von Sonderinteressen zugunsten der Perspektive des neutralen Beobachters aufgegeben zu haben. Explizit oder implizit liegt aber auch in diesem Fall eine Subjektsprache zugrunde, schließlich setzt eine Erfindung einen Erfinder voraus. Eine Subjektsprache impliziert jedoch, daß bestimmte Individuen, mit bestimmten Zielen und Absichten ausgestattet, bestimmte Wirkungen erreichen wollen. Ist kollektive Identität aber als eine solche intendierte Folge individueller Handlungsakte anzusehen? Das wäre sicher nur zum Teil zu akzeptieren. Man muß wohl kaum daran erinnern, daß sich manche Wirkungen spontan, als nichtintendierte Folge von kollektiv vernetzten Handlungen ergeben. Zum Beispiel waren die Intentionen derjenigen, die im Oktober 1989 in Leipzig mit der Losung „wir sind das Volk“ auf die Straße gingen, zunächst noch weit entfernt von dem Ziel, eine neue staatliche bzw. nationale Einheit zu erstreiten. Wie aber können solche Phänomene in einem konstruktivistischen Ansatz berücksichtigt werden? Möglicherweise kann der Einwand entkräftet werden, wenn man zwischen verschiedenen Bewußtseinszuständen bzw. –niveaus unterscheidet, etwa zwischen a) Intentionen der Akteure, b) damit korrespondierenden Selbstbildern, c) zugrundeliegendem Wissen sowie (partiell unbewußten) psychischen Dispositionen, d) den Vergegenständlichungen dieser intentionalen Akte in (allerdings: interpretationsoffenen, historisch sich wandelnden) Sinnordnungen und Symbolsystemen. Im übrigen – so ein zweiter Einwand - kommt die subjekttheoretische Lesart der Nation/Region als Erfindung ungewollt dem eingangs zurückgewiesenen ideologiekritischen Ansatz wieder recht nahe. In dieses Verständnis ist nämlich eine implizite Dichotomie eingebaut. Den „Erfindern“ bzw. „Konstrukteuren“ stehen üblicherweise die vielen „Anwender“, „Nutznießer“ bzw. „Adressaten“ der vorgedachten Modelle und Leitbilder gegenüber. Auch wenn Berger/Luckmann sich in ihrem Ansatz ausdrücklich gegen solch eine Interpretation im Sinne eines zu einfachen Angebot-Nachfrage-Modells zur Wehr setzen, die verwendete Subjekt-Sprache hat ihre eigene Logik und leitet das Verstehen unabhängig von den verkündeten Intentionen der Autoren. Diese Schwächen, so meine These, der ich hier nicht weiter nachgehen kann, sind nur durch Einbau des Diskursmodells in das konstruktivistische Paradigma überwindbar. Zumindest mißverständlich ist der konstruktivistische Ansatz der Nation (Klasse, Region ) als vorgestellter Gemeinschaft drittens auch insofern, als er nahelegt, daß soziale Einheiten ihre Wirklichkeit nur in der Vorstellung hätten. In Abwehr solcher Fehldeutungen wird in konstruktivistische Ansätzen üblicherweise auf die Notwendigkeit von Verbreitungsmedien aufmerksam gemacht (vgl. Luhmann 1988, Anderson 1983). Aus meiner Sicht wäre darüber hinaus aber zumindest auf Sprache(n) und kulturelle Traditionen zu verweisen, in denen kollektiv verbreitete psychische Dispositionen vergegenständlicht sind. Zwar wird auch bei Anderson (1983) die Herausbildung einer einheitliche Schrift-Sprache zu den Bedingungen nationaler Identitätsbildung gezählt. Er untersucht die Sprache aber nur als Medium, nicht Element des Konstruktionsprozesses. Die Art der Sprache ist aus seiner Sicht für den Charakter des jeweiligen Identitätskonstrukts irrelevant. Noch deutlicher gesagt: Welche Sprache der jeweiligen Identitätskonstruktion zugrunde liegt, wird als zufällig betrachtet, allein daß eine einheitliche Schrift-Sprache als Verkehrsmittel benutzt wird, ist aus dieser Sicht notwendig. Hier liegt noch eine alte (bewußtseinsphilosophische) Auffassung der 16 Sprache als eines Transportmittels, mit dem sprachunabhängige Vorstellungen ausgedrückt werden, zugrunde. Damit ist eine systematische Unterschätzung der Sprache als Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaft verbunden. Der Gedanke der sprachlichen Konstitution sozialer Einheiten, wie er innerhalb der neueren Sprachphilosophie etwa von Wittgenstein, Foucault und Searle entwickelt wurde, setzt hier aus meiner Sicht gänzlich neue Akzente. Nicht nur, das jetzt die diskursiven Praktiken, und nicht die isolierten Bewußtseinsphänomene (Ideen, Vorstellungen) in den Mittelpunkt der Untersuchungen rücken. Es wird auch ein einseitiges Sprachverständnis überwunden. Mittels Sprache, davon müßte m.E. ein modifizierter konstruktivistischer Ansatz ausgehen, werden nicht nur gemeinsame Vorstellungen verbreitet, in ihr sind auch für bestimmte Gemeinschaft charakteristische Bedeutungen, kulturelle Praktiken und Lebensformen vergegenständlicht. Insofern Sprachen bzw. Sprachvariationen diese „kollektiven Identitäten“ in geronnener Form enthalten, können sie selbst zu wichtigen Quellen und Ressourcen der Identifikation werden. Neben Sprachen, so ein vierter Einwand, wären aber noch andere Objektivationen zu untersuchen, in denen nationale (u.a.) Identitäten Wirklichkeit werden. Das Bild von der kollektiven Identität als Konstrukt aufgreifend, könnte man sagen: Das Konstrukt ist zwar Vorlage, Urbild, Schema des Baus, aber es ist noch nicht das Gebäude selbst! Zur Ausführung der Konstruktion bedarf es immer auch eines entsprechenden Materials. Gedanken müssen sich an Dinge heften, um Beständigkeit und Reproduzierbarkeit zu erhalten. Handlungs- und Umgangsformen müssen sich zu Ritualen und Institutionen verfestigen, den Charakter des Fraglosen gewinnen, um die Individuen von Verhaltensunsicherheit zu entlasten (Gehlen 1956). Ich stehe daher Versuchen, neue Modelle kollektiver Identität zu konstruieren, die gänzlich ohne solche Vernatürlichungen und Verdinglichungen auskommen, skeptisch gegenüber. Die Skepsis resultiert nicht einmal so sehr daraus, daß innerhalb solcher Vorschläge der zugrunde gelegte normative Rahmen – die Vorstellung „unbegrenzter Durchsichtigkeit sozialer Zusammenhänge“ – in der Regel nicht offen gelegt wird. Sie leitet sich vielmehr vor allem aus begrifflichen Überlegungen zum Charakter der Identifikation ab. Sich identifizieren, hatten wir gesagt, heißt immer, sich als jemand und mit etwas zu identifizieren. Das setzt sowohl beim Ich als auch beim Gegenüber (bzw. der Sache) eine gewisses Maß an Beständigkeit voraus. Nur die typologische Betrachtung des anderen, die einschließt, daß ich ihn nicht in seiner Unwiederholbarkeit, sondern wie durch einen Schleier, irgendwie verallgemeinert wahrnehme, ermöglicht soziale Wechselwirkung (Simmel 1992). Beständigkeit und Wiederholbarkeit, so meine These, erhält eine kollektiv geteilte Verhaltensdisposition, mit der ich mich identifizieren will, nun aber vor allem dadurch , daß sie sich an äußerlich wahrnehmbare Dinge heftet. Erst durch diese Verdinglichung und Symbolisierung wird das individuelle (oder kollektive) Selbst für mich (uns) wie für andere sichtbar repräsentiert und damit anschlußfähig. Gerade in dieser Hinsicht dominiert jedoch nach wie vor eine ideologiekritische Einstellung, in der die Verdinglichung sozialer Phänomene als Ausdruck eines falschen Bewußtseins bekämpft wird. Das läßt sich gut anhand des Ansatzes von Berger und Luckmann beobachten. Sie weisen zwar einerseits jegliche ideologiekritischen Absichten strikt von sich weisen, nehmen aber andererseits solche Verdinglichungen, verstanden als Verselbständigungen sozialer Beziehungen gegenüber dem Handeln der Individuen, immer wieder sehr kritisch in den Blick (Berger/Luckmann 1996, S. 84 ff.). Positivere Vermerke und Hinweise findet man da schon eher in der „älteren“ konstruktivistischen Auffassung. Für Durkheim sind kollektiv geteilte Überzeugungen und Normen zwar konstitutiv für die soziale Einheit - das weist diesen Ansatz als einen konstruktivistischen aus. Zugleich betont er aber, daß Symbolisierungen und Verdinglichungen zu den notwendigen Existenzbedingungen kollektiver Bewußtseinsphänomene gehören. Besonders in seinen religionssoziologischen Arbeiten geht Durkheim der Frage nach, wie diese kollektiven Ideen 17 dadurch, daß sie sich an natürliche Objekte heften, Stabilität und Reproduzierbarkeit gewinnen (Durkheim 1994). In der modernen konstruktivistisch ausgerichteten Sozialphilosophie wurde diese Gedanke meines Wissens ansatzweise nur von Searle aufgegriffen, der immer wieder betont, daß soziale Tatsachen als Bewußtseinstatsachen auf „natürlichen Tatsachen“ aufruhen (Searle 1997). Der sozialkonstruktivistische Ansatz der Nation als Erfindung – damit wäre ich bei einem fünften Einwand - sieht sich aber noch einem weiteren Mißverständnis ausgesetzt: Wenn wir umgangssprachlich von Erfindung sprechen, kommt häufig eine negative Bedeutung ins Spiel. Wir meinen dann, daß es sich um bloße Wunschbilder ohne realen Gehalt (um „bloße Erfindungen“) handelt. Wird hingegen in konstruktivistische Ansätzen von Nation als Erfindung geredet, ist nicht gemeint, daß es sich um Vorstellungen ohne Wirklichkeit handelt. Ganz im Gegenteil: Individuelle Vorstellungen, so Berger und Luckmann, objektivieren sich in Handlungsdispositionen und Institutionen, sie konstituieren soziale Wirklichkeiten. Dabei besteht die spezifische soziale Wirkung solcher Kollektivvorstellungen, das wird schon bei Durkheim nachgewiesen, darin, daß sie die Individuen sozial mobilisieren, sie zur Loyalität gegenüber den Mitgliedern der Gruppe verpflichten, ja, mehr noch, daß sie die Individuen motivieren, zugunsten bestimmter Gruppenziele „Opfer zu bringen“. Insofern sind die vorgestellten Gemeinschaften immer auch wirkliche (wirksame) Solidargemeinschaften (Henrich 1993). Offen ist jedoch die Frage, wie diese Gruppenloyalitäten zu bewerten sind, insbesondere wie partikulare Solidaritäten und allgemeine Bürgerpflichten gegeneinander abzuwägen sind. Gerade in dieser Frage, so mein Vorwurf, bietet der konstruktivistische Ansatz keine befriedigende Antwort. Vielmehr verbleibt er selbst in einer unentschiedenen Position. Man kann partikularen Solidaritäten und auf die Erhaltung der Gruppe gerichtete Verpflichtungen ausgehend von dem Naturrechtskonzept universeller Menschenrechte oder bestimmten Modernisierungskonzepten sehr skeptisch gegenüberstehen (Beck 1993, Habermas 1989), setzt sich dann aber früher oder später selbst dem Ideologieverdacht aus. Oder man kann die Solidaritäten in Rahmen der Gruppe und gegenüber der Gruppe zur Originalform bzw. einzig möglichen Form moralischer Verpflichtung machen (Rorty 1992, Etzioni 1995) und sieht sich dann zwangsläufig mit dem Vorwurf der Geringschätzung universeller Menschenrechte und der Hypostasierung von Gruppenidentitäten konfrontiert. Meines Erachtens laufen beide Positionen auf ein gleichermaßen einseitiges Konzept des Menschseins und ein komplementär-einseitiges Konzept des In-Gesellschaft-Seins des Menschen hinaus. Antworten, die aus diesem Entweder-Oder herausführen, wären nur im Feld einer nicht lediglich phänomenologisch bzw. analytisch verfahrenden Gesellschaftstheorie möglich. Das überschreitet jedoch die konstruktivistische Perspektive, die vorgibt, sich im Unterschied zur alten Ideologiekritik wertender Stellungnahmen und entsprechender normativer Setzungen zu enthalten (vgl. Berger/Luckmann 1996, Searle 1997). Ich komme damit zur Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen einer vierten Annäherung an das Phänomen kollektiver Identität, von mir als normative (rechts- bzw. politikphilosophische) Perspektive bezeichnet. Exemplarisch soll hier lediglich auf R. Bubners rechtsphilosophisches Konzept des Nationalstaates als eines partikularen Allgemeinen eingegangen werden: Bubner hält die Gegenüberstellung einer universalistischen und einer kommunitaristischen Theorietradition schlichtweg für verfehlt. Der Nationalstaat sei nicht in Abgrenzung vom demokratischen und Rechtsgedanken zu bestimmen. Vielmehr, so die provokante Gegenthese Bubners, stellt er die primäre Verwirklichung der modernen Rechtsidee dar. Er knüpft dabei an Hegels Idee des Volksgeistes an. Das real wirksame Recht sei nach Hegel ohne den historischen Kontext nicht zu verwirklichen. Die universelle Rechtsidee bedürfe der lebensweltlichen Unterfütterung, der Verwurzelung in den konkreten Kontexten eigentümlicher Lebensformen. Demgegenüber hänge ein von den empirischen Bedingungen 18 gereinigtes Sollen (die Forderung nach Achtung der Freiheitsrechte als solche) in der Luft, da sie keine Wirklichkeit in der realen politischen Ordnung habe (Bubner 1993, S. 26 ff.). Ähnlich wird von anderen Autoren argumentiert. Abstrakt gedachte universalistische Institutionen befriedigen bestimmte emotionale Bedürfnisse der Menschen nicht, sie seien keine Heimstätten für die Gefühle der Menschen“ (Fessen 1995, S. 879). Einem solchen blutleeren, substanzlosen Universalismus fehle, da er die vielfältigen lebenweltlichen Vermittlungen ausspare, das emotionale Hinterland. Gefährlich wäre eine kollektive Identifizierung nur dann, wenn die Gemeinschaft allein durch eine integrierende Ideologie zusammengehalten werde und sie mit einem bestimmten Exklusivitätsanspruch auftrete. (Bialas 1995, S. 372) Diese rechts- und politikphilosophischen Versuche einer Rehabilitierung des Konzepts nationaler Identität setzen sich jedoch dem Einwand aus, ungenügend zwischen verschiedenen Typen kollektiver Identität zu unterscheiden. Ein letzte Gruppe von Annäherungen an das Phänomen kollektiver Identität würde ich deshalb unter die Überschrift „historisch-typologisierendes“ Vorgehen stellen. Zunächst: Was ist der Problemhintergrund solcher Versuche? Wir hatten festgestellt, daß die Vorbehalte gegen das Konzept kollektiver Identitität vor allem auf die Beobachtung zurückzuführen sind, daß dem Konstruktionsprozeß kollektiver Einheiten dichotomische Denkschemata zugrunde liegen. Das Freund-Feind-Schema, so die Behauptung, sei für den Prozeß der Herausbildung kollektiver Identitäten konstitutiv. Man kann in Abwehr solcher vorschnellen Verallgemeinerungen nun die Frage stellen, ob die Orientierung an einer Negativfolie zwangläufig zum Kern der Identitätsbildung gehört oder ob andere Arten der Konstruktion kollektiver Identitäten möglich sind. Damit ist in der Nationalismusliteratur zumeist der Versuch verbunden, verschiedene Typen bzw. Modelle der Bildung kollektiver Identität zu unterscheiden. So schlägt etwa E. Nolte vor, zwischen einem aggressiven und einem defensiven Nationalismus zu unterscheiden (Nolte 1993, S. 90f. ). Dieser Versuch, einen „guten“ von einem „schlechten“ Nationalismus abzuheben, hat eine lange Tradition: Bereits Durkheim unterscheidet ein Modell des Nationalstaates im Sinne der Selbstüberschätzung und Aggressivität nach außen von einem anderen Modell, in dem die nationale Idee an humanistischen Werten orientiert ist und der Nationalstolz mehr nach innen als nach außen gerichtet ist (Durkheim 1984a, S. 126 f.). Wir wissen heute allerdings mehr über die Fragilität und mögliche Umkehrbarkeit dieses von ihm bevorzugten Modells.10 In der aktuellen Literatur wird diese Unterscheidung in verschiedener Hinsicht weitergeführt und begründet: So wird unterschieden: a) zwischen der Volksnation, die auf Gemeinsamkeiten der Abstammung und Kultur beruht – hierfür stehe modellhaft Deutschland - und der Staatsbürgernation, für die die Idee der Menschenrechte und der freien Wahl der Nation konstituierend sei - hierfür sei die französische Nation beispielgebend (Henrich 1993, S. 95ff.) 11, b) zwischen modernen westlichen Nationen, die primär durch Pluralität, Konsumdenken und ideologische Zurückhaltung gekennzeichnet sind und Formen des (östlichen) Nationalismus als leidenschaftlicher Identifizierung mit einer großen, anonymen Gemeinschaft gleicher Kultur (Gellner 1993, S. 30 ff.), c) zwischen einem Nationalstaat, aufgefaßt als multiethnischem Staat (beispielhaft dafür sei die USA), und ethnisch homogenen Staaten, die eher für die Entwicklung in Europa charakteristisch seien (Fuller 1993, S. 45 ff.), 10 Durkheim hat sein Modell des defensiven Nationalismus, wo der Stolz mehr nach innen gerichtet ist, bezeichnenderweise am Vorabend des ersten Weltkrieges entwickelt! 11 Henrich wendet sich aber zugleich sehr deutlich gegen die Verabsolutierung dieser Unterscheidung. Alle realen Nationsbildungen seien Mischformen aus beiden Typen. 19 d) zwischen einem groben Nationalismus, der im Namen der Nation untilgbare Verbrechen begangen hat und einem nichtgroben Nationalismus; letzterer sei im Unterschied zu ersterem definiert durch Rechte, die allen Bürgern gemeinsam zukommen, ungeachtet sprachlicher, religiöser u.a. kultureller Eigenarten (Dahrendorf 1993, S. 101 ff.), e) zwischen einer offenen, rechtsstaatlich verfaßten Nation und der Nation im Sinne einer geschlossenen Gemeinschaft, die auf eine „gereinigte“ Gesellschaft hinausläuft, letztere Denkungsart würde Haß und Intoleranz gegen andere hervorbringen (Michnik 1993, S. 62 ff.), f) zwischen einer Nation im Sinne einer integralen Gemeinschaft, die die Tradition beschwöre und auf transzendente Autoritäten setze und einer Gemeinschaft, die durch Glaube an die Vernunft und die Ablehnung von Traditionen gekennzeichnet sei (Berlin 1993. S. 146 ff.). Die wohl gebräuchlichste Unterscheidung verschiedener Typen der Nation stammt von M. R. Lepsius. Er schlägt vor, zwischen Volksnation, Kulturnation, Klassennation und Staatsbürgernation zu unterscheiden. Der letztere Typ der Nation, in dem die Verbindung zwischen den Staatsbürgern nicht primär durch die Abgrenzung von einem feindlichen Außen, sondern durch die Anerkennung gleicher universeller Rechte zustande kommt, ist für ihn der implizite Maßstab der Typenbildung. Er hebt diesen (im Kern normativen) Begriff der Staatsbürgernation ab vom Begriff der Staatsnation im Sinne bloßer staatlicher Verfaßtheit der nationalen Gebilde (Lepsius 1993, S. 193 ff.). Dennoch sind solche Typenbildungen, was ihre empirischen Relevanz betrifft, nicht unumstritten. Wir stoßen hier wiederum auf das Problem, daß deskriptiv-empirische und normative Fragen (ob die behauptete Erscheinung sein soll) zu schnell vermengt werden. Aber nicht nur die empirische Triftigkeit solcher idealtypischen Konstruktionen läßt sich anzweifeln. Noch prinzipieller wendet Jeismann gegen solche typologischen Versuche ein, daß damit der Blick auf die prinzipielle Gleichartigkeit der verschiedenen Nationalismen verstellt werde (Jeismann 1993, S. 9ff.) Mehr oder weniger alle Modelle der Nation würden mit einem offenen oder versteckten Messianismus arbeiten. Modelle des auserwählten Volkes aber hätten die Selbstüberhebung und damit die Dichotomie von Eigenem und Fremden immer bereits zur Grundlage. Eine andere Schwerpunktsetzung innerhalb der Zuwendung zur Problematik kollektiver Identitäten nimmt deshalb Thomä vor. Er schlägt vor, an die Stelle der Ambitition auf „nationale Identität“ den Respekt vor Identitäten treten zu lassen, wie sie sich in Lebensformen unterhalb dieser Ebene konkretisieren (Thomä 1995, S. 351). Thomä untersetzt diesen Vorschlag vor allem durch Überlegungen zu Konturen eines Multikulturalismus, der die kulturelle Verschiedenheit zwischen Ost- und Westdeutschen ernst nimmt und produktiv macht. Es wären aus meiner Sicht aber auch andere Ausbuchstabierungen des Ansatzes, beispielsweise in Hinsicht auf die stärkere Beachtung regionaler Identitäten denkbar. Ein ähnliches Anliegen, die Vielheit kollektiver Identifizierungen in den Blick zu bekommen, vertritt V. Havel. Er plädiert, ausgehend von der Kategorie der „Lebenswelt“ dafür, das „Zu-Hause-Sein“ als System konzentrischer Kreise, die sich um das Individuum legen, zu fassen. Dazu rechnet er sowohl die Gemeinde, die Stadt, die Familie, das berufliche Milieu, den Betrieb, als auch die Sprache, die man spreche, das Land, indem man lebe. Selbstverständlich sei die nationale Zugehörigkeit ein Teil dieses Zuhauses. Dazu gehöre unter heutigen Bedingungen jedoch gleichermaßen Europa, ja die ganze Welt. Keine dieser Schichten dürfe den anderen ihr Recht bestreiten, alle Schichten sind nicht wegzudenkende Bestandteile unserer Selbstidentifikation (Havel 1993, S. 129 ff.). Allerdings verzichtet Havel nicht auf die hierarchische Anordnung dieser Identitätsschichten. Für ihn stellt die Bürgergesellschaft, die auf Universalität der Menschenrechte basiert, den Kern moderner, zeitgemäßer Identität dar. 20 Auch Henrich argumentiert in diese Richtung. Bezogen auf Europa sei eine Identitätsbalance vorstellbar, in der regionale und nationale Identitäten mit einer eigenen europäischen Identität zusammengeführt werden. Er favorisiert im Unterschied zu Thomä und Havel jedoch nach wie vor die nationale Perspektive (Henrich 1993, S. 59 ff.). Eine andere Typenbildung, die nicht mit dem umstrittenen Begriff der nationalen Identität arbeitet und sich daher obigen Vorwürfen nicht auszusetzen scheint, stammt von Clifford Geertz. Er schlägt vor, zwischen „angestammten Loyalitäten“ (primordial loyalities) und „bestehenden Einheiten“ (gemeint sind vor allem nationalstaatlich verfaßte politische Einheiten) zu unterscheiden. Letztere Einheiten, in denen die Fundamente der Selbstheit sich im Wechselspiel mit den Maschinerien der Macht entfalten, würden auf einer effizienten Ideologie allgemeiner Identität mit ihrem Kern, einer „eklektischen, synthetisierenden Meistererzählung“ basieren. Mit dem Begriff der angestammten Loyalitäten sind demgegenüber partikulare Bindungen gemeint, die nicht vom Beobachter konstruiert werden, sondern aus dem Gefühl der Gegebenheiten der sozialen Existenz auf Seiten der Teilnehmer herrühren. Es handle sich um Grundgegebenheiten von Herkommen, Rede, Brauch, Glaube, Seßhaftigkeit, physischer Erscheinung und Geschichte. Diese angestammten Bindungen erscheinen aus der Sicht der Teilnehmer als vorhanden und unverrückbar. Den Vorteil dieser Konzeption partikularer primordialer Bindungen im Verhältnis zum Diskurs über „Nation“ sieht Geertz vor allem darin, daß er die Zerlegung bzw. Unterscheidung der Faktoren ermögliche, die der Bindung zugrunde liegen. So könne Sprache einigen und die Religion trennen, es könne aber auch Religion einen und Kultur trennen etc. Außerdem bestehe ein Vorzug des Konzepts darin, daß es den Historiker vor den verbreiteten Reduktionsbewegungen beim Diskurs um Identität schütze.(Geertz 1994, S. 392 ff.) Resümieren wir: Ungeachtet unterschiedlicher Akzentsetzungen scheint unter den Befürwortern eines modifizierten Konzepts kollektiver Identität Übereinstimmung darüber zu bestehen, daß die Diskussion zur gemeinschaftlichen Identität nicht allein auf die nationale Identität zugeschnitten sein darf. Vielmehr sollte, statt Identität als ein monolithisches Gebilde aufzufassen und die Diskussion einseitig auf gute oder schlechte Nationalismen zu fokussieren, über kollektive Identitäten im Plural nachgedacht werden. Welcher Stellenwert regionalen Identitäten in diesem Konzept multipler Identitäten aus philosophischer Sicht beigemessen wird, möchte ich abschließend darstellen. 4.„Regionale Identität“ Forschungsprogramms im philosophischen Diskurs: Konturen eines Bezieht man sich in einem Text, der sich an ein philosophisch gebildetes Publikum wendet, anders als kritisch auf das Problem regionaler Identitäten, muß man mit Vorbehalten rechnen. So wendet etwa R. Dahrendorf gegen die regionalistische Vision von P. Glotz, daß wir „kulturell herunter zu den Stämmen und ökonomisch hinauf zu größeren supranationalen Einheiten müßten“, ein, daß Bürgerrechte gerade auf der politischen Überwindung der Partikularitäten durch größere nationalstaatliche Gebilde beruhen. Ein adäquater Ersatz für den Nationalstaat sei gegenwärtig nicht in Sicht (Dahrendorf 1993, S. 106). Auch Henrich grenzt sich deutlich von Vorstellungen ab, die von der Besinnung auf regionale Identitäten einen Abbau der gegenwärtigen Identitätsdefizite erwarten. Als (politische) Handlungssubjekte und Quellen kultureller Kreativität kämen nicht vorrangig die Stämme, lokalen Stile und Traditionen, sondern nur die Nationen in Betracht. Die Nation bleibe der primäre Träger der Kultur. Die Lösung für die Identitätsprobleme der Deutschen sieht er deshalb auch nicht in der Abschaffung der Nation, sondern in einer multiplen 21 Identität. Der Weg zu einem einheitlichen Europa, so Henrichs Schlußfolgerungen, muß für alle absehbare Zeit über die europäischen Nationen erschlossen werden.(Henrich 1993, S. 59ff.) Wer den Regionalismus gegen die Kulturen zur Geltung bringe, favorisiere in der Konsequenz nur kleinere Wirtschaftsräume in der Konkurrenz um den Erfolg auf dem europäischen Markt. Sehr deutlich spricht er von Fehlentwicklungen im Rahmen eines Europa-Verschnitts, der neben der großen Mobilität in der Welt der Warenproduzenten nur eine sterile Folklore der Regionen zulasse. So würde Europa auf eine Situation zusteuern, die mit der Spätphase des ausgehenden römischen Welt vergleichbar sei (Henrich 1993, S. 65). Gerade diese Hierarchisierung kollektiver Identitifizierungen, in der die nationale Identität an der Spitze steht, ist jedoch höchst umstritten. Zu fragen ist nicht nur, ob unter heutigen Bedingungen die Nation überhaupt noch als entscheidender Kulturträger aufzutreten vermag. Zu fragen ist vor allem, ob sich nicht längst auf regionaler Ebene neue Formen der politischer Partizipation und entsprechende Institutionalisierungen herausgebildet haben. Um einen polemischen Begriff von Henrich aufzugreifen: Während inzwischen überall in der Politik, aber auch in den Sozialwissenschaften „die Advokaten des neuen Regionalismus“ am Werke sind (auch nur die wichtigsten Standpunkte zur referieren, übersteigt die Möglichkeiten dieses Aufsatzes bei weitem), hält sich die Philosophie, von einigen noch zu nennenden Ausnahmen abgesehen, eigentümlich zurück. Sich auf die Region als Forschungsgegenstand einzulassen, würde nämlich etwas voraussetzen, wozu man bis heute in der modernen Sozial- und politischen Philosophie überwiegend nicht bereit ist, nämlich die dominierende Perspektive des Nationalstaates bzw. der universellen Weltbürgergesellschaft zumindest zu relativieren. Könnte aber diese Distanz nicht auch etwas mit dem Gegenstand zu tun haben, der philosophisch wenig ergiebig ist? Dieser vorschnellen Schlußfolgerung möchte ich jedenfalls für den Bereich der praktischen Philosophie - widersprechen. Also: Inwieweit kann die regionale Identität zum legitimen Forschungsfeld der praktischen Philosophie werden? Für die Sozialphilosophie käme die Region als Thema insofern in Betracht, als es ihr um die Frage der sozialen Bindungskräfte geht, sie die Bedingungen und konstitutiven Regeln kollektiven Handelns untersucht. Wie Simmel es formuliert, lautet eine zentrale sozialphilosophische Frage: Wie entstehen soziale Einheiten aus Elementen, die selbst unwiederholbare Einheiten mit einem eigenen Zentrum sind (Simmel 1992, S. 41 ff.). Region käme hier also weniger als natürliche Bedingung des Handelns als vielmehr als besondere soziale Einheit , als spezifische Form der Sozialintegration in den Blick. In einem aktuellen Text kommt Jeismann, ausgehend von einer kritischen Sichtung der Ergebnisse der Nationalismus-Forschung, zu ähnlichen Folgerungen: Es gehe heute, so Jeismann, um eine zeitgemäße Theorie der Identifikation als Theorie der sozialen Integration (Jeismann 1993, S. 25 f.). An dieser transdisziplinären Aufgabe der Untersuchung spezifisch moderner Formen der Sozialintegration sollte auch die Philosophie mitwirken. Zuvörderst könnte das geschehen, indem sie ihre Kompetenz in Fragen der Begriffsanalyse einbringt. Ich beginne daher mit einigen Überlegungen zur Unterscheidung von „regionaler“ und „nationaler Identität“. Zur Unterscheidung „regionale Identität“ – „nationale Identität“ Wenn wir von Region reden, ist immer ein bestimmter Raumbezug menschlicher Existenz gemeint. Welche Räume aber lassen sich als Region bezeichnen? Nimmt man die angesprochene Raumdimension näher ins Visier, scheinen die Grenzen des Begriff der Region eher zu verschwimmen statt feste Konturen anzunehmen. Das kann damit zusammenhängen, daß es sich um einen relationalen Begriff handelt. Etwas Region nennen, so meine These, heißt im Unterschied zu Benennungen als „Nation“ immer, dieses Etwas zu 22 einem übergreifenden Raum in Beziehung zu setzen. Die „Region“ hat in der Vorstellung niemals eine selbständige Existenz; Region „ist“ etwas als Teil von etwas. Daher schwankt der Begriffsumfang von „Region“ stark in Abhängigkeit von seinem Bezugspunkt. Je nach Gegenüber können Kontinente (in Relation zu „Welt“), Bundes-Länder (in Relation zu „Bundesrepublik“) oder auch wesentlich kleinere Einheiten als Regionen bezeichnet werden. Sicher scheint andererseits, daß der Begriff der Region, wenn er als sozialwissenschaftlicher Begriff eingeführt wird, nicht auf beliebig kleinräumige „natürliche“ Einheiten angewandt werden sollte. Von solchen Verwendungen wie „Regionen des menschlichen Gehirns“ etc. sehen wir daher ab. Auch sollten wir zwischen dem Lokalen und dem Regionalen unterscheiden. Obwohl der Begriff der Region wie der Begriff des Lokalen auf den erfahrenen Lebensraum von Individuen bezogen ist, unterscheidet er sich von letzterem doch dadurch, daß er in der Regel auf einen Raumbezug abstellt, der nicht durch die Gleichzeitigkeit des Erlebens der Bewohner und die Möglichkeit direkter persönlicher Kommunikation gekennzeichnet ist, sondern vielfältige, im wesentlichen anonyme Formen der sozialen Wechselwirkung beinhaltet. Charakteristisch für heutige Verwendungen von Region im sozialwissenschaftlichen Diskurs scheint vor allem zu sein, daß damit soziale Bindungen benannt werden, die quer zur nationalstaatlichen Organisation sozialen Lebens liegen: Egal, ob es um intranationale Gliederungen (z.B. Sachsen, Niederlausitz) oder supranationale Einheiten (z.B. sächsischböhmische Grenzregion) geht, immer ist die klassische Organisationsform von Politik, Recht, Wirtschaft und Kultur, der Nationalstaat, in seiner Funktionalität in Frage gestellt. Eine mögliche abstrakte Negativbestimmung der Region wäre folglich: Sie ist nicht (mehr) bzw. noch nicht Nationalstaat. Für diejenigen, die mit solche abstrakten begrifflichen Ausgangsbestimmungen nicht zufrieden sind, schließe ich eine These über den historischen „Standort“ des modernen Phänomens Region an: Das Besinnen auf regionale Identität erfolgt angesichts erfahrener Unzulänglichkeiten bisheriger nationalstaatlicher Organisation des sozialen Lebens vor dem Hintergrund europaweiter bzw. globaler Vernetzungen und Beziehungen. Die sich an solche begrifflichen Vorüberlegungen anschließende Frage lautet nun, aus welcher Forschungsperspektive regionale Identität angemessen beschrieben werden kann. Hier sind in Abhängigkeit von der Fragestellung mit Sicherheit mehrere Annäherungen möglich. Auch „objektive“ Untersuchungen zu dem, was die Region (z.B. „Sachsen“) „als solche“ ist, durch welche natürlichen, ökonomischen und politisch-administrativen Besonderheiten sie im Vergleich mit anderen Regionen gekennzeichnet ist, schließe ich nicht gänzlich aus. Die Frage, die mich interessiert, lautet jedoch eher, in Form welcher Selbstbilder und Leitvorstellungen die Region Sachsen „gedacht“ wird, wie der vorgestellte Raum eine kulturell-symbolische Identität gewinnt. Mit einem Satz, es geht darum, wie die Region „gemacht“ wird. Für die Bearbeitung solcher Fragen bietet sich die im Abschnitt 3 dargestellte konstruktivistische Perspektive, die sich vor allem bei der Untersuchung nationaler Identitäten bewährt hat, an. Dabei gilt es aber Schwächen des konstruktivistischen Ansatzes im Auge zu behalten. Mit der konstruktivistischen These, daß es sich „imaginierte Gemeinschaften“ handelt, ist nämlich noch wenig über die Spezifik des Nation- oder RegionMachens gesagt. Nach Henrich trifft es auf viele soziale Gruppenbildungen zu, daß sie ein Moment des Konstruktiven haben, an dem menschliche Vorstellungen mitwirken. Henrich nennt solche Gruppen verallgemeinernd ethnische Gruppen. (Henrich 1993, S. 88) Die nächste Frage müßte daher lauten: Wie ist der konstruktivistische Ansatz zuzuschneiden, wenn er auf die Frage des Regionen-Machens angewandt wird? Inwieweit sind Ergebnisse der Nationalismus-Forschung auf die Untersuchung dieses Prozesses übertragbar? Zunächst will ich eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten hervorheben: In beiden Fällen geht es um Formen kollektiver Identifizierung, für die der Raumbezug konstitutiv bzw. mitkonstitutiv ist. Dabei wird der Raum nicht als natürlicher Raum, sondern 23 in seiner kulturell-symbolischen Überformung identitätsstiftend wirksam. Es handelt sich um Raumkonstrukte, um Räume als Sinnordnungen. Für beide Konstruktionsprozesse ist weiterhin charakteristisch, daß die vorgestellten Gemeinschaften durch den Schein von Natürlichkeit und überhistorischer Dauer stabilisiert werden. Schon ein erster Blick auf die beiden Diskurse, in denen relativ übereinstimmend von Vaterland (Abstammung), Heimat (Boden), Volk (Blut), Kultur und (natürlicher) Sprache die Rede ist, macht das deutlich. Durch diese Verdinglichungen bzw. Vernatürlichungen erhalten die mit dem Motiv Region/Nation versehenen Handlungsanforderungen ein Moment des unausweichlich Gegebenen und mir notwendig Auferlegten. Als spezifischen Solidarverbänden (Henrich), als Formen sozialer Bindung (Durkheim) ist beiden Integrationsformen gemeinsam, daß sie die Individuen auf gemeinsame Ziele einschwören ihre Mitglieder zur Solidarität gegenüber den „Mitmenschen“ (gemeint sind jene Menschen, die man in der Regel nicht persönlich kennt, die aber dennoch in einem spezifischen Sinne als Gleiche angesehen werden) verpflichten, darüber hinaus zur Loyalität gegenüber der Gruppe auffordern, ja häufig von den Individuen im Namen der sozialen Einheit bestimmte Opfer abverlangen (neutraler formuliert, die Individuen sozial bzw. politisch mobilisieren)12, bis zu einem gewissen Grade zur Vereinheitlichung der Lebensstile der Gruppenmitglieder beitragen. Nicht zuletzt auf Grund dieser Funktionalität sind regionenbezogene Identifikationsprozesse ähnlich wie Formen nationaler Identifikation anfällig für die Rhetorik und Überredungskünste von Ideologen (Henrich 1993). Insofern bietet es sich an, den erprobten konstruktivistischen Ansatz unter Einbeziehung ideologiekritischer Werkzeuge als Instrumentarium für die Untersuchung des RegionenMachens zu nutzen. Dabei müßten die strategischen und reflexiven Diskurse der Eliten einen Schwerpunkt der Untersuchung bilden13. Forschungsfragen, die in exemplarischen und vergleichenden Untersuchungen zu bearbeiten sind, wären: a) Welche Selbstbilder und Leitmodelle der Region werden entwickelt, welche „Regiovisionen“ tauchen auf? Dabei fassen wir diese Selbstbilder als Angebote zur Identitätsfindung, als Muster der Identifikation auf, mit Hilfe derer die „politische Klasse“ dem Raum eine symbolische Identität geben will. b) Inwieweit liegen dem Regionenkonstrukt messianistische Vorstellungen, Vorstellungen einer besonderen Aufgabe der Region zugrunde? Kommen Formen regionaler Identifikation ohne die Idee des „auserwählten Volkes“ aus? c) Zu welchem Anderen setzt man sich in Beziehung bzw. von welchem Außen grenzt man sich ab, welche Muster der Grenzziehung werden verwendet (Untersuchung der InnenAußen-Differenz)? Zu vermuten ist, daß als Außen neben dem Nationalstaat oder der konkurrierenden Region mehr und mehr Europa auftritt. d) Welche mythischen Elemente, insbesondere welche Gründungsund Abstammungsmythen (Berding 1995) werden verwendet, mittels welcher geschichtlich verwurzelter Metaerzählungen soll diese regionale Einheit unterbaut werden? e) Wie werden die Selbstbilder durch Berufung auf konstruierte Traditionen stabilisiert? An welches historische Erbe wird angeknüpft, welches wird verworfen, von welchen Ereignissen 12 Wer meint, solche Forderungen seien antiquiert, sollte sich jüngste Reden des Vertreters der „Bürgergesellschaft“ USA Bill Clinton anschauen, wo er unbefangen davon spricht, sich nach seinen Affären wieder „dem Dienst an der Nation widmen zu wollen“ (zitiert nach: Freisprüche. Clinton bleibt im Amt, LVZ vom 13./14. Februar 1999, S.1) 13 Einen anderer Forschungsschwerpunkt müßten Analysen der alltäglichen, sich im wesentlichen spontan herausbildenden Denkformen bilden, die sich als komplementär oder widerständig im Verhältnis zu diesen Elitendiskursen erweisen. 24 wird die Geschichte „gereinigt“? Welche historischen Brüche werden aufgemacht, welche geschichtlichen Kontinuitäten hergestellt? f) Mittels welcher diskursiver Strategien werden die Differenzen innerhalb des Eigenen (der regionalen Einheit) ausgelöscht? Welche mythischen Aktanden werden zur Stabilisierung des Selbst eingeführt, welche Letztbegründungsstrategien, die der Immunisierung des eigenen Standpunktes gegen Kritik dienen, finden Anwendung? Wir vermuten, daß diese Diskurse durch eine ausgeprägte Wir-Symbolik, insbesondere die häufige Verwendung des inklusiven Wir gekennzeichnet sind. g) Durch welche „Veralltäglichungen“ werden diese Prozesse stabilisiert, welche „Verdinglichungen“ in Form von Symbolen, Denkmälern, Festen, Preisen etc. lassen sich nachweisen? Erste Untersuchungsergebnisse zu diesen Fragen liegen, bezogen auf den Konstruktionsprozeß sächsischer Identität, inzwischen vor (vgl. Luutz 1996, S. 35 ff.) Bei diesen Untersuchungen hat sich jedoch auch gezeigt, daß einer schematischen Anwendung der Ergebnisse der Nationalismusforschung auf die Untersuchung des Prozesses des Regionenmachens Grenzen gesetzt sind. Ein konstruktivistischer Ansatz, der auf die Untersuchung von Regionen zugeschnitten ist, muß diese Differenzen beachten. Welche Unterschiede lassen sich nachweisen? Unterschiede ergeben sich einmal in Hinblick auf den Stellenwert des Raumbezugs innerhalb der Identifikationsprozesse. Wie Lepsius hervorhebt, kann die „Substanz“ nationaler Identitäten sehr unterschiedlich sein. Die konstruierten Gemeinsamkeiten können blutsverwandtschaftlicher, territorial-räumlicher, klassen- bzw. schichtmäßiger, religiöser, sprachlicher, kultureller oder bürgerrechtlicher Art sein. Konstrukte nationaler Identität bedienen sich niemals nur räumlicher Bindungen, sie scheinen komplexer gebaut zu sein als Konstrukte der Region. Während der Begriff Nation immer auch ökonomische, politische sowie kulturelle Gemeinsamkeiten umfaßt (nur daß in manchen theoretischen Modellbildung davon abgesehen wird), stellt der Begriff der Region primär auf einen bestimmten RaumBezug menschlicher Existenz ab. Formell könnte man also Formen raumbezogener Identifikation abheben von anderen Formen sozialer Identifikation, in denen der Raumbezug zurücktritt oder gänzlich (wie im Falle der Identifikation als Mitglied einer Berufsgruppe oder Schicht) irrelevant wird. So sinnvoll solche Unterscheidungen auch sein mögen: Ich warne jedoch vor ihrer Verabsolutierung.14 Nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist nämlich auch die Gegenthese, daß jegliche Formen kollektiver Identifizierung mit einem verdeckten oder offenen Raum-Bezug arbeiten. Sich identifizieren heißt nämlich immer auch sich zu positionieren, ein Eigenes (Innen, Selbst) von einem Anderen (Außen, Fremden) abzugrenzen. Die Festigung dieser Innen-Außen-Differenz verlangt aber nach einer Verörtlichung bzw. Verräumlichung des Selbst bzw. des Anderen. Das Andere wird als anders vor allem dann erfahren, wenn es als sichtbar verschieden von mir, an einem anderen Ort befindlich vorgestellt wird. So sprechen wir beispielsweise nicht nur von Sprachgruppen, Kulturgemeinschaften oder Wirtschaftseinheiten, sondern ebenso selbstverständlich von Sprach-, Kultur- oder Wirtschaftsräumen. Dem Begriff der sozialen Schicht liegen sogar explizite räumliche Vorstellungen einer Aufschichtung zugrunde. Selbst eine ethnisch inhomogene „offene Nation“, eine Bürgergesellschaft, die allein an der „Idee des Verfassungspatriotismus“ (Habermas) orientiert ist, kommt, so Lepsius, nicht umhin, den Raum abzugrenzen, innerhalb dessen die durch staatliche Sanktionsmittel gesicherten Bürgerrechte gelten (Lepsius 1993). Wenn also innerhalb mehr oder weniger aller Formen kollektiver Identifikation mit dem Raumbezug gearbeitet wird, so gilt doch; der Raumbezug ist für Formen regionenbezogener Identifikation zentral, die Identifikation erfolgt hier in der 14 In solchen Standpunkten scheint mir ein genereller Mangel vieler moderner sozialwissenschaftlicher Theoriebildungen zum Ausdruck zu kommen, die Unterschätzung des räumlichen Moments der sozialer Einheitsbildung. 25 Regel im Unterschied zur Nation primär über (kulturell aufgeladene) Räume und erst sekundär über andere ethnische Merkmale wie Sprache und Kultur. Unterschiede zwischen regionaler und nationaler Identifikation gibt es aber nicht nur in Bezug auf den Stellenwert des Raumbezugs, sondern auch hinsichtlich der Art des Raumbezugs. Zu einfach macht man es sich nämlich m.E., wenn man Unterschiede allein daran festmacht, daß regionale Räume in der Regel kleiner als nationale Räume seien. Zwar lassen sich viele Regionenkonstrukte als intranationale Raumordnungen beschreiben, es ist aber nicht zu übersehen, daß andere Regionen als supranationale („grenzüberschreitende“) Regionen konstruiert werden. Die These lautet vielmehr, daß die durch Regionen vorgenommene Raumgliederung nicht voll paßfähig mit der in Nationalstaaten ist, daß sie sich quer zu nationalstaatlichen Raumordnungen legt. Regionen stellen nicht einfach soziale Untergliederung unterhalb der Ebene des Nationalstaates dar, die sich in eine vorhandene hierarchische Ordnung sozialer Einheiten (Familie, Stadt, Land, Nationalstaat) unproblematisch eingliedern ließen. Vielmehr handelt es sich um Versuche, ehemals nationalstaatliche Aufgaben und Funktionen neu zu organisieren! Die Besinnung auf die Region geht häufig mit einem Bedeutungsverlust des Nationalen einher. Neue regionale Identitäten entstehen zwar zumeist im Schoße des Nationalstaates, sie sprengen aber dessen Grenzen. Solche Regionalisierungstendenzen sind daher eher ein Ausdruck dafür, daß alte nationalstaatliche Identitäten an Kraft verlieren, sie zum Teil - wie beispielsweise bestimmte wohlfahrtsstaatliche Funktionen heute - dysfunktional werden. Hier sind die Befunde und die entsprechenden Bewertungen allerdings nicht eindeutig. Zuweilen, das soll nicht außer acht gelassen werden, münden diese regionalen Bewegung selbst wieder in Bestrebungen zur Neugründung von Nationalstaaten. Dabei ist ein dominierender Kontext gegenwärtiger Regionalisierungsprozesse – auch das unterscheidet diese Vorgänge wesentlich von den europäischen Nationenbildungsprozessen des 18.-20 Jh., der Prozeß der europäischen Vereinigung vor dem Hintergrund globaler Kommunikationsbeziehungen und weltweiter ökonomischer Vernetzungen. Zum Außen der Region gehört deshalb nicht nur die (um Ressourcen konkurrierende) Nachbarregion bzw. der („eigene“) Nationalstaat. In der Regel ist der direkte Bezug auf Europa oder Welt für das Selbstverständnis der Region konstitutiv. Das geht mit einer schrittweisen Verlagerung nationalstaatlicher Souveränitätsrechte (Zoll- und Währungshoheit, Festlegung einheitlicher technischer und Umweltstandards, wirtschaftliche Strukturpolitik, Außen- und Sicherheitspolitik) an die europäische Zentrale einher. Aus der These, daß für die Selbstidentifikation als Region der Bezug auf ein übergreifendes Ganzes (Nation, Europa etc.) konstitutiv ist, ließe sich folgern, daß es grundlegende Unterschiede in der Auffüllung der Innen-Außen-Differenz zwischen Region und Nation gibt. Zugespitzt lautet die Frage, ob das „Regionen-Machen“ heute nicht durch so scharfe Grenzziehungen im Sinne des Ausschlusses des feindlichen Anderen, wie das für die Phase der europäischen Nationsbildung im 19./20 Jh. nachgewiesen wurde, charakterisiert ist. Eine eher skeptische Position in dieser Frage wird von Henrich formuliert, der – wir erwähnten es bereits - angesichts der beobachtbaren Revitalisierung der Regionen in Europa die Befürchtung äußert, daß es zu einem Wiederaufleben alter Partikularitäten komme könne, womit ein neuerlicher Zerfallsprozeß Europas eingeleitet werde. Aus meiner Sicht sollten solche vorschnellen Urteile vermieden werden. Gegenteilige Vermutungen gehen davon aus, daß die Grenzziehungen im Rahmen regionaler Identifikationen flexibler, beweglicher, instabiler, kurz „postmodern“ (Hitzler 1998) werden. Das wird zwar kaum zur Aufhebung aller räumlichen Grenzziehungen führen. Aber die Grenzziehung von Innen und Außen muß nicht notwendig im Sinne des Freund-Feind-Schemas aufgeladen sein. Es sind andere Typen der Grenzziehung möglich, die nicht mit so scharfen Ausgrenzungen bzw. Stigmatisierungen des Anderen arbeiten. Die negative Aufladung des Anderen kann zurücktreten, die Schwerpunkte können sich von der negativen auf die positive Identifikation verschieben. 26 Identifizierung bedeutet zwar immer Besonderung, aber nicht notwendig Absonderung. Wie ich in entsprechenden Untersuchungen nachweisen konnte, existieren verschiedene Formen regionaler Identifikation, in denen das Andere statt als Konkurrenz eher als Ergänzung des Eigenen angesehen wird. Bezogen auf den „Sachsen-Diskurs“ kommen etwa zur Anwendung: -die Grenzziehung Wir-Sie im Sinne des Bildes vom (hilfreichen) Nachbarn -die Auffüllung der Innen-Außen-Differenz im Sinne der Differenz von Zentrum und Peripherie -die Grenzziehung im Sinne der Unterscheidung von Teil und Ganzem, Besonderem und Allgemeinem (Luutz 1996). Ob die Konstruktion der Region im Unterschied zum Konstruktionsprozeß der Nation jedoch gänzlich ohne die „Logik des Entweder-Oder“ (Beck 1993) und damit ohne das FreundFeind-Schema auszukommen vermag, will ich an dieser Stelle offen lassen. Es scheinen, insoweit sich für den „Sachsen-Diskurs“ messianistische Züge nachweisen lassen, berechtigte Zweifel angebracht. Unterschiede werden auch sichtbar, wenn man die für den Konstruktionsprozeß verwendeten dominierenden Medien vergleicht. Wie Anderson feststellt, ist für viele Modelle der Nationsbildung die Herausbildung einer gemeinsamen Schriftsprache wesentlich. Folglich werden als dominante Medien der Nationenbildung vor allem der Buchdruck bzw. später die Tageszeitung, also Printmedien betrachtet. Heutige Prozesse des Regionenmachens greifen hingegen, so läßt sich vermuten, stärker auf (elektronische) Medien zurück, die mit dem gesprochenen Wort arbeiten. Diese neuartige Mediatisierung hat Konsequenzen für den Identifikationsprozeß selbst. Damit, so meine These, gewinnen nämlich regional verbreitete, hauptsächlich im mündlichen Sprachgebrauch verwendete Sprachvariationen für die Selbstund Fremdidentifikation als Bewohner einer Region eine ausschlaggebende Rolle. Untersuchungen zur Renaissance der Dialekte scheinen diese These zu belegen (vgl. LVZ vom 14./15. 2. 1998). Schließlich sollte bei einem Vergleich der Formen nationaler und regionaler Identifikation auch nicht übersehen werden - hier gehe ich auf Einwände Henrichs zu Grenzen der Regionalisierung ein - daß mit Formen nationaler Identifikation evt. Leistungen verbunden sind, die nicht ohne Verluste durch regionale Einheiten ersetzt werden können. Eine ganze Reihe von für den Konstruktionsprozeß der Nation wesentlichen Elementen scheint nicht bruchlos auf die regionale Ebene übertragbar zu sein. Beck erwähnt, allerdings in kritischer Absicht, die nationale Wehrpflicht, die traditionell stark auf die Ausbildung nationaler Solidaritäten ausgerichtet sei (Beck 1993). Eine Regionalisierung der Wehrpflicht scheint schwer vorstellbar, es sei denn, man will einen neuen Nationalstaat etablieren. Die Region besitzt also nicht die für die Nation typische „Wehrhaftigkeit“. Mit der Armee fehlt der Region jedoch auch ein Machtmittel, mit der sie ihre ökonomischen und anderen Interessen nach außen gegenüber einem konkurrierenden Nachbarn umsetzen kann. Das allein schon begrenzt die Ausbildung dichotomischer Freund-Feind-Bilder. Ähnlich verhält es sich mit dem Rechtssystem. Beim modernen Rechtssystem, darauf macht Bubner aufmerksam, handelt es sich zum größten Teil um nationales Recht. Bürgerrechte sind gegenwärtig nur im Rahmen des Nationalstaates garantierbar. Der Hinweis auf die rechtlichen Aktivitäten der Bundesländer entkräftet diese These nicht, denn bekanntlich ist das Länderrecht in der Bundesrepublik dem Bundesrecht untergeordnet und auf bestimmte nachgeordnete Bereich beschränkt. Ein drittes Element der Bildung nationaler Einheiten, das nur bedingt auf Regionen übertragbar ist, ist das nationale Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem. Hier könnte man einwenden, daß zu den Errungenschaften der Bundesrepublik die Kulturhoheit der Länder gehöre. Solange Schul- und Hochschulabschlüsse aber noch allgemein anerkannt sind, solange es „nationale“ Medien gibt, die sich nicht vorrangig auf ein regionales Publikum konzentrieren und solange noch eine einheitliche Schriftsprache verwendet wird, 27 scheint dieses durch den Nationalstaat zu gewährleistende Minimum an kultureller Einheit noch nicht gefährdet. Dennoch hat die Kulturhoheit der Länder schon zu einem beachtlichen Maß der Differenzierung der Regionen geführt. Daß damit auch die Gefahr des Provinzionalismus verbunden sein kann (ich denke hier etwa an die Alleingänge einzelner Bundesländer bezüglich der Rechtschreibreform), daß die Gefahr real ist, daß sich Kultur in bloße Folklore verwandelt, ist nicht zu übersehen. In dieser Hinsicht könnte Henrich recht bekommen. Auch die Zoll- und Währungsunion und damit die Konstituierung eines inneren Marktes, klassische Funktionen des Nationalstaates (Funktionen, die allerdings heute weitgehend auf die europäische Zentrale übergegangen sind), werden üblicherweise nicht auf die Region rückübertragbar sein. Hingegen werden andere wirtschaftsfördernde Funktionen des Nationalstaates mehr und mehr von Regionen wahrgenommen. Regionen versuchen sich heute durch aktive Steuer- und Subventionspolitik verstärkt als Wirtschaftsstandorte, als attraktive Orte für die Produktion überregional agierender Wirtschaftssubjekte anzubieten, d.h. sie versuchen gerade in Hinblick auf diese klassischen Funktionen der Wirtschaftsförderung und der Arbeitsmarktpolitik den Nationalstaat zu ersetzen. Damit treten Regionen selbst als Konkurrenten im Kampf um die knappen Kapitalressourcen und innovativen Techniken in Erscheinung. Halten wir fest: Beide Formen kollektiver Identifikation sind, obwohl historisch miteinander verflochten, sowohl was ihre sozialhistorischen Hintergründe, ihre konstitutiven Merkmale als auch ihre sozialen Funktionen betrifft, deutlich zu unterscheiden. Sie sind auch nicht bruchlos ineinander übersetzbar. Damit bleibt umstritten, wie beide Integrationsformen in modernen Gesellschaften im Verhältnis zueinander und im Verhältnis zu universellen Prinzipien und Beziehungen zu wichten sind. Das verweist auf die Notwendigkeit einer umfassenden Gesellschaftstheorie, einer Theorie der Formen der sozialen Integration in der Moderne. Eine solche Theorie ist aus konstruktivistischer Perspektive, die ja durch bewußten Verzicht auf die normative Perspektive gekennzeichnet ist, allein nicht zu leisten. Ohne eine gesellschaftstheoretische bzw. modernisierungstheoretische Einbettung und ohne eine korrespondierende Theorie der sozialen Integration, die den „historischen Standort“ dieser spezifischen Gruppenphänomene klärt, fehlt der konstruktivistischen Beschreibung des Region-Machens das Fundament. Welche Stellungnahmen und Erklärungen zum historischen Standort der Region liegen aus der Sicht der praktischer Philosophie dazu bisher vor? Stellungnahmen aus sozialphilosophischer Sicht Aus sozialphilosophischer Sicht dominieren eher kritische Stellungnahmen. Eine solche kritische Position erwächst einmal aus der in der Sozialphilosophie üblichen Unterscheidung zwischen vormodernen (traditionalen) und modernen (bzw. postmodernen) Formen sozialer Bindung. Ausgehend von solchen Unterscheidungen steht man der Wiederbelebung regionaler Identitäten eher skeptisch gegenüber (siehe Hitzler 1998, Beck 1993). So wird in Becks Theorie reflexiver Modernisierung, die von einer Enttraditionalisierung und Individualisierung der Lebensformen ausgeht, der Neonationalismus (wie wohl auch der neue Regionalismus) lediglich unter dem Stichwort „Gegenmoderne“ eingeordnet. D.h., solche Tendenzen zur Abgrenzung, die der Tendenz der Entgrenzung im Zeitalter der Globalisierung gegenüberstehn, werden lediglich als eine mögliche Reaktion auf Tendenzen der Selbstaufhebung der Moderne, als Herstellung neuer Fraglosigkeit gedeutet. Diese neuen Beschwörungen des „Wir-Gefühls“ seien als Reaktionen auf erfolgreiche Individualisierungen, und zwar als Reaktionen auf die erlebte Unlebbarkeit der Individualisierung, die anomische Züge annehme, zu interpretieren. Trotz vorgeblich analytisch-deskriptiven Perspektive steht Beck solchen Gegentendenzen der Verräumlichung 28 der sozialen und individuellen Existenz sehr skeptisch gegenüber. Allerdings betont er immer wieder, daß es sich auch bei diesen gegenmodernen Bewegungen um Erscheinungen der Moderne und nicht um die Rückkehr zu vormodernen Zuständen handelt. Allein deren konstruierter Charakter weise sie als Bestandteil der Moderne aus.(Beck 1993) Ähnlich negative Befunde ergeben sich, wendet man sich der sozialphilosophisch ambitionierten Systemtheorie Luhmanns zu. Zwar wird Luhmanns differenztheoretischer Ansatz, insbesondere seine sinnstiftende Differenz von Innen und Außen manchmal zur Begründung der Notwendigkeit räumlicher Grenzziehungen herangezogen. Wie Luhmann aber immer wieder hervorgehoben hat, versteht er seine Theorie sozialer Systeme primär als eine Theorie der Weltgesellschaft (Luhmann 1988). Für ihn ist Kommunikation die basale Operation, die das Sozialsystem konstituiert. Daher komme als Einheit der Gesellschaft im Zeitalter der Massenkommunikation nur die Weltgesellschaft, und nicht die Region oder Nation, in Betracht. Auch wenn wir seine Überlegungen zur Grenzziehung einbeziehen, sind kaum begründete Bezüge herstellbar. Das soziale System konstituiert sich zwar aus seiner Sicht durch spezifische Grenzziehungen (Inklusion-Exklusion). Aber das Dazugehören bzw. Nichtdazugehören ist nicht primär räumlich zu verstehen (und im übrigen gar nicht auf personale Individuen, sondern spezifische Kommunikationen bezogen). Vielmehr geht es Luhmann um die systeminternen sozialen Ein- und Ausschließungen von Kommunikationen/Handlungen, wobei die jeweiligen systemimmanenten Codes den Maßstab der Exklusion/Inklusion bilden (Luhmann 1994). Angeschlossen wird mitunter auch an Luhmanns Auffassung zur notwendigen Komplexitätsreduktion als Existenzbedingung des Sozialsystems. Sich auf Luhmann berufend, werden regionale bzw. nationale Identität mitunter als unerläßliche Reduktion von Komplexität angesichts überkomplexer, für das Individuum undurchschaubarer sozialer Verhältnisse gedeutet. Allerdings läßt sich der Luhmannsche Komplexitätsbegriff, der sich sehr allgemein auf die Differenz System-Umwelt bezieht, aus meiner Sicht nur begrenzt auf diese spezifischen räumlichen Dimensionen beziehen. Während Luhmanns Theorie der sozialer Systeme also nur sehr bedingt für das Begreifen des Problems „regionaler Identitäten“ fruchtbar gemacht werden kann, trifft das auf medientheoretische Ansätze, die in Anschluß an Luhmann mit dem Globalisierungstheorem arbeiten, nicht im selben Maße zu. Region kommt in Globalisierungsansätzen angesichts der weltweiten Vernetzung der Handlungen allerdings weniger als Ort der Produktion, sondern vielmehr als Ort der Aneignung und Rezeption von kulturellen Produkten global agierenden Wirtschaftssubjekte in den Blick (Thomson 1997, S. 881 ff.). Zwar sei heute die Produktion kultureller Massenprodukte auf einen Weltmarkt zugeschnitten. Dennoch, so wird gegen eine kulturimperialistische Interpretation massenkultureller Phänomene eingewandt, seien bei der Aneignung und Nutzung von global verbreiteten Nachrichten, Medienprodukten, Konsumgütern und Leistungen lokale und regionale Bedingungen des Orts/der Zeit wirksam, die dazu führen, daß derartige Produkte sehr unterschiedlich genutzt und verschieden verstanden werden. Wie läßt sich regionale Identität in der konkurrierenden Sozialphilosophie J. Habermas´ verorten? Innerhalb seines zweistufigen Gesellschaftsmodells, in dessen Mittelpunkt die Unterscheidung von Lebenswelt und System steht (Habermas 1988a,b), findet Region zunächst im Lebensweltkonzept Platz. Regionalität wäre hier als Teil der überkommenen kulturellen Selbstverständlichkeiten und sozialen Bindungen, die Kommunikation erst ermöglichen, deutbar. Folglich ließe sich regionale Identität als eine Form sozialer Integration, genauer als Ausdruck einer historisch gewachsenen, partikularen Solidarität bestimmen. Aber auch Habermas verfolgt, ähnlich wie Beck, implizit kritische Absichten. Wie er in seiner Theorie der Rationalisierung der Lebenswelt, die er in Anschluß an Webers These der Entzauberung der Welt entwickelt, darstellt, kommt es in der Moderne zu einer sukzessiven diskursiven Verflüssigung lebensweltlicher Hintergrundüberzeugungen, zu einer 29 Dauerrevision der Traditionen. Damit aber sei die Identität der Person nicht länger an vorgefundene feste Rollen (Nation, Region) festzumachen. Es bleibe nur die Möglichkeit der Selbststeuerung einer hochabstrakten, instabilen Ich-Identität. Bezogen auf die Ebene der Sozialintegration führe das zu einer Überprüfung historisch-kontingenter, partikularer Normen und Solidaritäten im Lichte allgemeiner Prinzipien. Die Revitalisierung der regionalen Solidaritäten käme in diesem Denkweise einer Rückkehr zu vormodernen Mustern der Integration gleich. Habermas hält sich jedoch eine Hintertür offen. Eine Möglichkeit der Wiederaufnahme des Themas „regionale Identifizierung“ bietet ihm seine Theorie der Sozialpathologien der Moderne, der die Lebenswelt-System-Dichotomie zugrunde liegt. Habermas konstatiert nämlich in der Moderne eine Tendenz zur Mediatisierung und Kolonialisierung der Lebenswelt. Das bedeutet: die Systemimperative (Macht und Geld) werden übermächtig, sie schlagen destruktiv auf die kommunikativ strukturierte Lebenswelt durch und ersetzen den Mechanismus der Verständigung auch dort, wo er für die Reproduktion der Lebenwelt unverzichtbar ist. Habermas diagnostiziert eine Überlastung der kommunikativen Infrastruktur in der Moderne, ein Leiden an einer kulturell verarmten, einseitig rationalen Alltagspraxis. Folglich entstehen aus seiner Sicht neue Konfliktlinien genau an der Nahtstelle von Lebenswelt und System, in den Bereichen der kulturellen Reproduktion, der sozialen Integration und der Sozialisation. Hier nun haben regionale Bewegungen ihren Platz. Es sind aus seiner Sicht eher Widerstands- als Emanzipationsbewegungen. Im Unterschied zur alten Politik, die um die Fragen der Sicherheit und Verteilung kreise, gehe es in dieser neuen Politik eher um das Problem der Selbstverwirklichung und Partizipation (also um den Ausgleich von Identitätsverlusten und sozialer Bindungslosigkeit). Damit sei eine Aufwertung des Partikularen, historisch Gewachsenen, der Wunsch nach überschaubaren sozialen Räumen und entspezialisierten Tätigkeiten verbunden. Kurz: Diese Bewegungen lassen sich als Widerstand gegen Tendenzen der Kolonialisierung der Lebenswelt begreifen. Das Ziel bestehe in der Eindämmung formal organisierter zugunsten kommunikativ strukturierter Lebensbereiche. Es solle damit die Revitalisierung von Kommunikationsmöglichkeiten gefördert werden (Habermas 1988b, S. 449 ff.). „Regionale Identität“ aus kulturphilosophischer Perspektive Einer der wenigen Vertreter der zeitgenössischen Philosophie, der sich explizit und dabei nicht vordergründig ablehnend dem modernen Phänomen des Regionalismus zuwendet, ist Hermann Lübbe. Mit seinem kulturphilosophischen Ansatz will ich mich daher etwas intensiver auseinander setzen. Lübbe geht zunächst typologisch vor. Er unterscheidet insgesamt 6 verschiedene Typen von europäischen Regionalismen, angefangen von politischen Bewegungen, in denen ethnische Minderheiten ihre Volksgruppenrechte festigen wollen über separatistische Bewegungen zur Lostrennung von einem Nationalverband bis hin zu grenzüberschreitenden Regionen (Lübbe 1989, S. 30ff.) Von Vertretern der neutral beobachtenden Sozialwissenschaften unterscheidet sich Lübbes Ansatz jedoch insofern, als er versucht, diese Prozesse der Revitalisierung regionaler Bewegungen und Identitäten auf der Grundlage bestimmter modernisierungs- und zivilisationstheoretischer Annahmen zu rechtfertigen bzw. zu erklären. Lübbe wendet sich gegen eine in der Philosophie der Gegenwart dominierende abfällignegative Behandlung des Regionalismus. Charakteristisch für solche Herangehensweisen sei, daß regionale Bewegungen als antimoderne Erscheinung bzw. als Konservierung vormoderner Lebensformen betrachtet würden. Der Regionalismus, so Lübbe, sei mehr als die nostalgische Beschwörung alter, längst überlebter Identitäten, er sei in seiner politischen Form auch nicht mit kulturellem Provinzionalismus gleichzusetzen. Lübbe verkennt zwar nicht die Gefahren, die mit einer Besinnung auf regionale Identität verbunden sind (vgl. etwa Lübbe 1985, S. 21 f., Lübbe 1989, S. 39 f.). Dennoch handelt es sich bei der Revitalisierung 30 regionaler Identitäten aus seiner Sicht um ein spezifisch modernes Phänomen, das aus der Entwicklung moderner Gesellschaften zu erklären sei. Lübbe geht dabei von einer Diagnose der Trends moderner zivilisatorischer Evolution aus, auf die hier ausführlich nicht eingegangen werden kann (siehe zusammenfassend Lübbe 1997, S. 3 ff.). Seine Hauptthese lautet: Die Gegenwartszivilisation ist durch eine beispielhafte Dynamik gekennzeichnet, zugleich hat der dynamische Zivilisationsprozeß globale Dimensionen angenommen. Ein hauptsächlicher Faktor dieses Beschleunigungsprozesses ist die Zunahme des (wissenschaftlichen) Wissens, das in Technologien umgewandelt, unsere realen Lagen dynamisch ändert (Lübbe 1989, S. 133). Entscheidend für Lübbes Vorgehen ist nun, daß er diese Trends der industriegesellschaftlichen Moderne nicht einseitig kulturkritisch in den Blick nimmt oder fortschrittspessimistisch relativiert sehen will. Für Lübbe gibt es kein Zurück zu einfachen Gesellschaften; weder ist Fortschrittsverzicht für ihn ein gangbarer Weg noch vertraut er auf neue Utopien, die eine Beseitigung aller Unzulänglichkeit der bisherigen Evolution in naher oder ferner Zukunft versprechen. Seine These lautet vielmehr, daß wir uns in den Grenzen des Fortschritts einrichten müssen. Dieses „Einrichten“ setzt aber die Herausbildung von „Entschädigungen“ voraus. Lübbe konstatiert ausgehend von der (aus der Wirtschaftswissenschaft bekannten) These eines sinkenden Grenznutzens ein wachsendes Ausmaß an „negativen Folgekosten“ des zivilisatorischen Fortschritts, das durch entsprechende kulturelle bzw. politische Prozesse aufgefangen werden müsse (Lübbe 1989, S. 104). Diese These vom abnehmenden Grenznutzen des Fortschritts bildet auch den Horizont für seine Erklärung des gegenwärtig zu beobachtenden Phänomens des Regionalismus. Lübbe arbeitet dabei mit drei miteinander verzahnten Hypothesen: a) Kompensationshypothese Zentral für den Erklärungsansatz von Lübbe ist der Begriff der Kompensation. Mit der zunehmenden Dynamik des zivilisatorischen Modernisierungsprozesses schrumpft die Gegenwart, von ihm als Zeitraum bestimmt, für den wir mit relativ konstanten Lebensbedingungen rechnen können (Lübbe 1997, S. 33). Damit ist aber zugleich ein Schwund an Vertrautheit verbunden. Wird die Lebensumwelt zu stark geändert, wird sie zu einer fremden. Das führt dazu, daß die Traditionen mehr und mehr entwertet werden. Dieser Schwund an Vertrautheit müsse aufgefangen werden. Traditionen seien unersetzlich. Als geronnene Erfahrung sichern sie kulturelle Lebensformen gewohnheitsmäßig. Ohne eine Entlastung durch kulturelle Selbstverständlichkeiten seien jedoch weder Individuen noch Institutionen handlungsfähig. Das Problem moderner Gesellschaften sei also nicht die Starrheit und Übermächtigkeit der Tradition, sondern umgekehrt ihr Schwinden. In einer dynamischen Zivilisation werde Tradition zu einem sehr knappen Gut (Lübbe 1989, S. 58 ff.). Folglich sei mit der Dynamik der modernen Zivilisation die Nötigung zur Entwicklung von Kompensationen verbunden. Modernisierungserfahrungen und Fortschrittswille treiben als Ausgleich das historische Bewußtsein hervor. Über Leistungen des historischen Bewußtseins halten wir unsere eigene Vergangenheit als Vergangenheit zuschreibungsfähig. Die Leistungen des historischen Bewußtseins seien für die moderne Identitätsbildung unverzichtbar. Sie ermöglichten eine Antwort auf die Frage, wer wir sind. Eine Form der Kompensation neben der Musealierung von Relikten sei der Regionalismus. Unter Regionalismus versteht Lübbe eine Form des politischen Historismus. Es handle sich um den politischen Anspruch auf Bewahrung von Herkunftsbedingungen einer Region bzw. Kultur gegenüber der destabilisierenden dynamischen Zivilisation. (Lübbe 1985, S. 12 ff.) Regionalismus lebe aus der Notwendigkeit der Kompensation von Gefahren des kulturellen Identitätsverlustes. Nicht um Flucht in die Vergangenheit gehe es, sondern um Bemühungen der Erhaltung der Herkunftsidentität in der Absicht der Stabilisierung unserer Zukunftsfähigkeit. Lübbe wörtlich: „Es sind Bewegungen der Vergegenwärtigung und Verlebendigung regionaler Herkunftsprägungen in der Absicht der Kompensation eines durch 31 die zivilisatorische Wandlungsdynamik bedingten kulturellen Vertrautheitsschwundes.“ (Lübbe 1989, S. 38.). b) Komplementaritätshypothese Als globaler Prozeß, der kaum einen Landstrich und eine Menschengruppe auslasse (Lübbe spricht in diesem Zusammenhang vom Trend zur Entwicklung geschlossener Netzwerke) ist die zivilisatorische Evolution durch eine Tendenz zur Homogenisierung der Lebensformen gekennzeichnet. Exemplarisch stehe für diese Einebnung kultureller Differenzierungen im Konsumbereich Coca Cola, im Bereich der Verkehrssprachen die Durchsetzung des Englischen oder im massenkulturellen Bereich die weltweite Vermarktung von Produkten der Unterhaltungsindustrie. Es bilden sich herkunftskulturindifferente Internationalismen heraus (Lübbe 1997, S. 7 ff.) Komplementär zur Tendenz der Homogenisierung entwickle sich aber das Bedürfnis nach kultureller Besonderung. Je mehr sich die Lebenszusammenhänge vereinheitlichen, desto größer sei das kompensatorische Interesse, aussagbar zu halten, was uns voneinander unterscheidet. Die Fast-Food-Industrie und das Regionalkochbuch, die Ausbreitung des Englischen und die Wiederbelebung regionaler Dialekte stünden zueinander in einem Komplementärverhältnis (Lübbe 1985, S. 19 ff.). Anders formuliert wachse das Interesse an der Erhaltung der besonderen Herkunftskultur komplementär mit der Menge dessen, was uns in modernen Gesellschaften gemeinsam sei. Vereinheitlichung und Differenzierung der Lebenswelten bedingen sich wechselseitig (Lübbe 1989, S. 34 f.). c) These der Verlagerung der Souveränitätsrechte Die vor allem in früheren Schriften entwickelte kulturphilosophische Mikrosicht der Sicherung von Identität in einer dynamischen Welt, die deutlich auf bestimmten anthropologischen Fundamenten aufruht, wird in späteren Schriften relativiert und ergänzt durch eine Makrosicht der gesellschaftlichen Selbststeuerung bzw. -organisation. Nun betrachtet Lübbe die Erklärung regionaler Identitäten im Sinne einer Kompensation für negative Folgeschäden als falsch bzw. zumindest als einseitig. Regionale Bewegungen werden jetzt eher politiktheoretisch und nicht kulturphilosophisch begründet. Im Mittelpunkt dieses partiellen Neuansatzes steht der Begriff der Komplexität. Mit der zivilisatorischen Komplexität nehmen – so Lübbe - die Chancen zentraler Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen ab. Allein schon informationell seien zentralistische Organisationen überlastet. Daher werde unter heutigen Bedingungen der klassische Zentralstaat als historisch überlebte, nicht zukunftsfähige Organisation erkennbar. Der Zentralstaat war die Organisationsform für primär agrarisch geprägte Gesellschaften, währenddessen lasse sich die moderne Industriegesellschaft auf Grund expandierender Abhängigkeiten und prinzipiell offener Zukunft nicht mehr zentral organisieren. In zivilisatorisch verdichteten Netzen erhöhe sich daher der Zwang zur Selbstorganisation durch kleinere Kommunitäten. Es vollziehe sich ein Prozeß der Verlagerung der Souveränitätsrechte weg vom Nationalstaat, ohne daß es zu einer generellen „Überwindung“ nationaler Identitäten komme. Einerseits habe er faktisch schon eine Reihe von Souveränitätsrechten an die europäische Zentrale abgegeben. Andererseits müßten viele Entscheidungen in die betroffenen Regionen verlagert werden. Der Beteiligungswille der Bürger bringe sich vor allem vor Ort zur Geltung. Insofern seien politische Institutionen mit kontinentaler Zugehörigkeit zu ergänzen durch regionales Engagement bzw. föderale Bewegungen. Europäisierung und Regionalisierung betrachtet er daher unter politischen Gesichtspunkten als komplementäre Entwicklungen. Dabei ist für ihn die Schweiz mit ihrem ausgeprägten Föderalismus ohne herausgehobenes Zentrum das Modell Europas (Lübbe 1997, S. 18 f, S. 102 ff.) Lübbes Ansatz verdient eine ausführlichere Kritik. Welche Schwächen weist dieser Ansatz aus meiner Sicht auf? Insgesamt dominiert in Lübbes Erklärungsansatz der Begriff der Kompensation, auch wenn dieser Ansatz in späteren politiktheoretischen Überlegungen relativiert wird. Der Grundgedanke ist: Kulturelle Prozesse der Besonderung werden sekundär nötig als Ausgleich 32 der Folgelasten primärer Fortschrittlichkeit. Der Erfolg unseres Handelns ist durch unerwünschte Nebenfolgen belastet, von denen wir uns durch bestimmte Kompensationen entlasten (Lübbe 1989, S. 79). Der Kompensationsansatz erweist sich aus meiner Sicht in verschiedener Hinsicht als zu eng. Zum einen ist regionale Identität nicht allein als kultureller Ausgleich für Defizite der Modernisierung, als Reaktion auf negative Folgen zu deuten. Vielmehr ist sie selbst ein Vehikel dieses Prozesses, vollzieht sich ökonomische Modernisierung heute zumindest teilweise im Gewand der Regionalisierung. Zum anderen gilt es, die Prozesse des Regionen-Machens zu untersuchen, Prozesse, in denen Regionen auf der Grundlage bestimmter ökonomischer und politischer Interessen in strategischer Absicht hergestellt werden. Da Lübbe das Phänomen des Regionalismus sehr stark an historisch gewachsene Herkunftsprägungen bindet, muß ihm diese Untersuchungsrichtung, die zudem mit ideologiekritischen Instrumentarien arbeitet, suspekt bleiben. Weiterhin gilt: Der Kompensationsansatz wie auch die Komplementaritätsthese beruhen auf bestimmten anthropologischen Voraussetzungen. Zugrunde liegt die Annahme bestimmter menschlicher „Urbedürfnisse“ nach Vertrautheit und Wiedererkennung, die auf Grund bestimmter mit Modernisierungsprozessen verbundener Schädigungen kompensatorisch befriedigt werden müssen. Das Individuum weise - schon allein bedingt durch seine begrenzte Lebenszeit - eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität auf. Um dennoch Orientierungssicherheit zu gewinnen und sein „Ich“ in dieser dynamisch sich entwickelnden Welt zu bewahren, ist es auf die Schaffung von Zonen der Vertrautheit und Stabilität angewiesen. Diese anthropologischen Annahmen sind aber, so plausibel sie auch klingen mögen, wie alle anthropologischen Argumentationen dem Einwand ausgesetzt, daß es sich um nicht weiter ableitbare Letztbegründungen handelt. Aber es geht mir nicht allein um die Grenzen eines Erklärungsansatzes, der auf bestimmten anthropologischen Fundamenten aufruht. Selbst wenn wir von solchen tiefsitzenden menschlichen Bedürfnisstrukturen ausgehen könnten, bleibt ein anderes Begründungsdefizit zu konstatieren: Was Lübbe nahelegt, was sich aber keinesfalls von selbst versteht, ist, daß sich diese Urbedürfnisse nach Besonderung und Verhaltenssicherheit vor allem in Form des Regionalismus äußern. Warum sind gerade Regionen Träger von Herkunftskulturen, warum nicht größere nationale Verbände oder kleinere lokal bzw. familiar organisierte Entitäten? Was also fraglich und damit begründungsbedürftig ist, ist die unterstellte Verbindung von Herkunftskultur und Region. Kritische Anmerkungen sind daher vor allem zu Lübbes Begriff der Herkunftswelten bzw. Herkunftskulturen angebracht. Seine These lautet, daß Identitätsbildung an partikulare, besondere Herkunftswelten gebunden ist. Die Identifizierung mit einer Herkunftswelt erlaube die Frage zu beantworten, woher ich komme und wer ich bin. Dieser Begriff wird von Lübbe als mehr oder weniger evident vorausgesetzt, ist jedoch aus meiner Sicht in verschiedener Hinsicht problematisch. Zentral für seine genauere inhaltliche Fassung scheinen die Begriffe Familie, Kultur und Identität sein. Lübbe wendet sich allerdings gegen eine naturalistische bzw. nativistische Interpretation . Es gehe nicht oder nicht in erster Linie um eine Gemeinsamkeit des Blutes. Das „Blut“ der Herkunftswelt ist die gemeinsame, wesentlich in familiären Kontexten erworbene Kultur einschließlich der Sprache. Dennoch läuft die Rede von kulturellen Herkunftswelten, die die schwindende Vertrautheit in der modenen Welt kompensieren sollen, auf die Auszeichnung von etwas Beständigem, dem Modernisierungsprozeß Vorausliegendem bzw. sich als ihm zumindest als widerständig Erweisendem hinaus. Hier setzt meine Kritik an: a) Inwieweit sind diese „natürlichen“ Herkunftswelten ideologisch stabilisiert, massenmedial erzeugt, durch Eliten gesteuert? Noch zugespitzter formuliert, könnte man fragen, ob die gemeinsame Herkunftskultur, die, wie Lübbe hervorhebt, als Geschichte erzählt wird, nicht selbst ein Mythos ist. Lübbe selbst regt solche Gedanken an, wenn er im Zusammenhang mit der Musealisierung als Trend in modernen Zivilisationen nach Strategien der Auswahl von Bewahrenswertem fragt oder wenn er Regionen erwähnt, die „künstlich“ entstanden 33 sind. Er bewertet solche Prozesse aber eher als Ausnahme. Weder ist seine Absicht die generelle ideologiekritische Destruktion solcher Modelle noch führen ihn diese Randbemerkungen zu einer konstruktivistischen Brechung seiner Auffassung von „Herkunftskultur“. b) Nach Lübbe erlaubt die Besinnung auf die Herkunftswelt dem Individuum, sein besonderes Ich angesichts homogenisierender Tendenzen der modernen Zivilisation zu behaupten. Zu fragen ist jedoch, ob durch die Erhaltung von Relikten der Vergangenheit die besondere Identität dauerhaft zu sichern ist. Lübbe selbst verwendet mitunter das aus der Gebäudesanierung vertraute Bild der „Entkernung“. Lübbe interpretiert diesen für moderne Gesellschaften charakteristischen Umgang mit der Vergangenheit jedoch überwiegend positiv; nur wenn die alte Hülle mit neuer Funktionalität aufgefüllt werde, sichere das die Zukunftsfähigkeit. Verkommt aber hier die besondere Herkunftskultur nicht zur bloße Folklore, zum auswechselbaren Kleid einer weltweiten Massenkultur, ist die Besonderheit nicht lediglich eine Besonderheit des Scheins, die es nur äußerlich erlaubt, das besondere Ich in Abhebung von einer homogenisierenden Welt zu erhalten? c) Lübbe verlangt, daß man die Herkunftskultur nicht vordergründig räumlich verstehen darf. Identität, so seine These, sei durch die Zeit ungleich stärker geprägt als durch den Raum (Lübbe 1989, S. 44). Die auf den ersten Blick wenig verständliche Setzung wird plausibel, wenn man an die Folgen räumlich verstandener kultureller Selbstbehauptungsprozesse denkt. In einer mobilen, durch vielfältige Wanderungsbewegungen gekennzeichnete Welt sind nämlich herkunftshomogene Räume kaum noch vorhanden. Ein Verständnis der Herkunftskultur im Sinne von räumlich eingegrenzten sozialen Einheiten hätte die Vertreibung der Vertreter der fremden Kultur vom „eigenen Ort“ zur Folge. In diesem Zusammenhang wendet sich Lübbe gegen die Zielbestimmung des Regionalismus im Sinne der Schaffung kulturell homogener Räume. Hier bleibt zunächst zu konstatieren, daß Lübbe in seine funktionale Beschreibung des Regionalismus ein systemfremdes normatives Moment einbaut (der Regionalismus müsse sich hüten, den Raumbezug zu bornieren). Außerdem: So real die negativen Folgen einer ethnisch verstandenen Regionalität sind und so ehrenwert daher entsprechende normative Setzungen sein mögen; es fällt schwer, eine Herkunftskultur ohne Herkunftsort zu begreifen. Lübbes Argument, daß sich spezifische Kulturen auch an „fremden Orten“ zu reproduzieren vermögen (wie er das für die jüdische Kultur oder die polnische Identität in den USA nachzuweisen versucht), ist nicht stichhaltig, denn hier haben sich die Kulturen vor allem durch verörtlichende Abgrenzung nach außen (Ghettoisierung, Versammlung an einem heiligen Ort - der Synagoge bzw. Kirche, Versammlung an einem profanen Ort - dem heimischen Herd) erhalten. Gerade das „Judentum“ ist ja durch das Streben nach Rückgewinnung des heiligen Ursprungsorts gekennzeichnet, ein Streben, das zwangsläufig in der Gründung des Staates Israel mündete. Um übrigen vermag auch Lübbe die obige These in seiner Beschreibung der Herkunftswelten nicht immer konsequent durchzuhalten. Mitunter verwendet er selbst räumliche Bestimmungen (vgl. z.B. Lübbe 1997, S. 46). Räumliche Verortung und kulturelle Selbstbestimmung hängen enger zusammen als Lübbe es bereit ist zuzugestehen. d) Die Auffassung der Existenz besonderer kultureller Herkunftswelten unterhalb der Ebene des Nationalstaates sieht sich nicht nur mit dem durchaus umstrittenen Einwand konfrontiert, daß der primäre Träger der Kultur bis in die Gegenwart doch der Nationalstaat sei (Henrich 1993), sondern muß umgekehrt auch mit der Frage rechnen, warum die kulturelle Besonderung denn mit den heute bekannten Regionen zum Abschluß kommen sollte. Erfahrungsgemäß ist eine Minderheit, die ihr Recht auf kulturelle Selbstbestimmung erfolgreich eingeklagt hat, auf darunterliegender Ebene selbst schnell Ansprüchen von Minderheiten bzw. lokalen Interessengruppen ausgesetzt. Es gibt in diesem Prozeß der Besinnung auf Besonderung keine absolute Grenze, es sei denn die 34 Grenzen werden politisch gezogen. Wird die spiralförmige Bewegung der Besonderung in Gang gesetzt, bleibt begründungsbedürftig, warum sie an einem bestimmten Punkt zum Stillstand kommen soll. e) Nicht ganz einsichtig ist schließlich die generelle Behauptung, daß der Regionalismus nichts mit Provinzionalismus zu habe. Unklar ist insbesondere, woraus Lübbe seine Überzeugung speist, daß der europäische Regionalismus der Gegenwart sich nicht gegen das richte, was alle Menschen vereint (die Idee allgemeiner Menschenrechte), sondern es lediglich um das allgemeine Recht auf Anderssein gehe (Lübbe 1989, S. 34 f.). So sehr das zu wünschen wäre: Geschichtlich hat sich immer wieder gezeigt, wie im Namen der Bewahrung kultureller Identität die Rechte anderer Gruppen mißachtet wurden. Zumindest müßten mögliche Konfliktfelder benannt werden und Wege institutioneller Regelung aufgezeigt werden, wenn solche generellen Behauptungen aufgestellt werden. Ein weiterer Kritikpunkt: Lübbes Ansatz liegt ein bestimmter, um das Konzept „kultureller Herkunftswelten“ zentrierter Begriff der Identität zugrunde. Lübbe grenzt sein Identitätskonzept besonders von emanzipatorischen Konzepten, die wie Marx lediglich das universell-Menschheitliche betonen, ab (Lübbe 1983, S. 101). Identität sei stets das Resultat einer besonderen Herkunftsgeschichte. Als Übereinstimmung mit uns selbst sei Identität vom Ausmaß mitbestimmt, in dem wir uns zu der jeweils eigenen Vergangenheit zustimmend zu verhalten vermögen (Lübbe 1989, S. 135). Die Antwort auf die Frage, wer wir sind, hat stets die Form einer erzählten Geschichte. Das gelte sowohl autobiographisch für das Individuen als auch für Institutionen, ja ganze Nationen (Lübbe 1985, S. 17). Als Resultat unserer Herkunftsgeschiche sei Identität nicht zu finden in den Letztgegebenheiten von Landschaft, Stamm, Volkscharakter etc. Dennoch sei Identität keine Fiktion, die durch bloße Propaganda zu erzeugen und durch das historische Bewußtsein zu entlarven sei. Ohne solche Zugehörigkeiten seien weder Individuen noch Gruppen oder Institutionen lebensfähig (Lübbe 1989, S. 38). An diesem kulturellen, auf die Konservierung besonderer kultureller Traditionen gerichteten Identitätskonzept ist besonders kritikwürdig, daß hier Identität lediglich „rückwärts“, in Richtung auf die Konservierung kultureller Herkunftsbestände und nicht „vorwärts“, in Richtung auf die Erreichung gemeinsamer Ziele bestimmt wird. Zwar ist die Besinnung auf die kulturelle Herkunftswelt, in der ich meine Identität finde, für Lübbe kein nostalgischer Prozeß der Rückbesinnung, sondern funktional auf die Bewältigung der dynamische Gegenwart und die Herstellung von Zukunftsfähigkeit ausgerichtet. Aber für die Struktur der Identifizierung selbst wird diese Ausrichtung auf die Zukunft als irrelevant angesehen. Warum übersieht Lübbe diese für die Bildung kollektiver Identitäten konstitutive Zukunftsperspektive? Das hängt vor allem mit Lübbes negativer Einstellung zur Geschichtsphilosophie und parallel dazu mit seiner Polemik gegen die Berechtigung von Utopien in der Politik zusammen. Entsprechend seinem Modell der Modernisierung steht nicht der Fortschritt in seinen Zielen in Frage. Die Ziele Wohlstand, Sicherheit und Frieden seien weiterhin konsensfähig. Gegenwärtige Krisenprozesse seien keine Zielkrisen, sondern lediglich Steuerungskrisen. Insofern wird angesichts wachsender Dynamik unserer Gegenwartszivilisation auch keine neue Geschichtsphilosophie, keine Reideologisierung des öffentlichen Lebens gebraucht. Es gehe lediglich eine „behutsamere Fortbewegung auf der Grundlage der maximalen Konservierung von zukunftsträchtigen Herkunftsbeständen“. Dieser verengte Blickwinkel muß zwangsläufig zur Unterschätzung der auf die Zukunft bezogenen Dimension von Identität führen. Demgegenüber wird in vielen anderen Identitätskonzepten darauf hingewiesen, daß die Frage danach, wer wir sind bzw. woher wir kommen, sich nur vermittelt über die Frage, wer wir sein wollen, beantworten läßt. Kollektive Identität, das ist nicht nur die gemeinsame Herkunftswelt, sondern vor allem ein mitreißenden Zukunftsprogramm. Mehr noch: Erst ausgehend von diesem gemeinsamen Projekt wird die gemeinsame Vergangenheit „erfunden“ . Nichts hat, so Ortega Y Gasset, für die Menschen 35 Sinn außer in Bezug auf ihre Ziele (in: Jeismann/Ritter 1993, S. 277 ff.). Ein Forschungsprogramm, das sich der Untersuchung des Konstruktionsprozesses regionaler Identitäten zuwendet, muß daher neben der Traditionskonstruktion immer auch die Leitbilder und Zukunftsprojektionen ins Auge fassen. Zum Ort „regionaler Identität“ in der politischen Philosophie Wie läßt sich regionale Identität im Rahmen der politischen Philosophie verorten? Politische Philosophie, soweit sie universalistisch allein an der Naturrechtsidee universeller individueller Menschenrechte und nicht kommunitaristisch an besonderen ethnisch fundierten Gemeinschaften ausgerichtet ist, wird der Region eher distanziert gegenüberstehen. Von dieser Idee ausgehend wäre der Regionalismus als ein Wiederaufleben alter partikularer Bindungen, verbunden mit der Gefahr des Neuaufbrechens bewaffneter Konflikte, zu verurteilen. Politische Subjekte, die sich lediglich auf die Wahrnehmung der Interessen bestimmter Regionen und Landsmannschaften konzentrieren, würde man ausgehend von einseitig verstandenen universalistischen Prämissen eher ablehnend gegenüberstehen. Der sozial-historische Raum kommt in der politischen Philosophie erst dann verstärkt in den Blick, wenn man das Problem des Kontextes und der Motivation für politisches Handeln ernster nimmt (Thomä 1995, S. 349 ff.). Allerdings ist Ausmaß und Notwendigkeit dieser lebensweltlichen „Unterfütterung“ der Idee universeller Rechte zwischen Universalisten und Kontextualisten höchst umstritten. Wenn eine solche lebensweltliche Verwurzelung der Menschenrechte betont wird, dann zumeist auf Basis des nationalstaatlichen Paradigmas (Henrich 1993, Bubner 1993, Rorty 1992). Neue politikwissenschaftliche Überlegungen in Richtung eines „regionalen Staates“ brechen jedoch mit diesem überkommenen (national)staatlichen Paradigma von Politik. Den Hintergrund bilden häufig Forderungen nach höherer Effektivität staatlicher Leistungen bzw. nach Beschränkung wohlfahrtsstaatlicher Funktionen. Auch werden neue Anforderungen an die Politik zur Förderung von Wirtschaftsstandorten geltend gemacht, die über bisherige regionale staatliche Strukturpolitik zur Angleichung der Lebensverhältnisse im nationalen Maßstab weit hinausgehen (Biedenkopf 1994). Hier handelt es sich um Politikmuster, in denen politische Eliten „ihre“ Regionen als die besten Standorte für Investitionen überregional agierender Wirtschaftssubjekte im Kampf mit konkurrierenden Regionen präsentieren. Die Region wird auch wiederentdeckt im Rahmen neoliberaler Konzepte eines „begrenzten Staates“ (Murray 1996), in denen ausgehend von den Zwillingsbegriffen Freiheit individuelle Verantwortung die Rolle freiwilliger Assoziationen, insbesondere nachbarschaftlicher bzw. kleinräumigerer Solidaritäten betont wird. Ebenso tragen neuere demokratietheoretische Überlegungen vor dem Hintergrund der zum Teil als Demokratieabbau empfundenen europäischen Zentralisierungsprozesses zur Neuthematisierung der Region bei (Brunkhorst 1997, S. 895 ff.). Im Mittelpunkt steht dabei der Gedanke der Subsidiarität, d.h. die Vorstellung, die staatlichen Entscheidungsprozesse auf die niedrigstmöglichen Ebene zu verlagern. Das ist der Ansatzpunkt für Forderungen nach Umverteilung politischer Kompetenzen weg vom Nationalstaat hin zu den Ländern, Regionen und Kommunen. Auch bei Beck (1993) finden wir ähnliche Überlegungen: Ausgehend von der These, daß sich die alten nationalstaatlichen Institutionen (beruhend auf dem LinksRechts-Schema und dem Primat der Sicherheitsinteressen) mehr und mehr verbraucht haben, analysiert er unter dem Stichwort „Subpolitik“ bzw. „Erfindung des Politischen“ neue Politikmuster. Diese - unter anderem in Form regionaler Bewegungen auftretend - würden dazu führen, daß die Individuen in die Politik zurückkehren. Resümee Wagen wir trotz „neuer Unübersichtlichkeit“ ein kurzes Resümee: 36 Der Sonderforschungsbereich hat sich entschlossen, regionenbezogene Identifikationsprozesse vorzugsweise in einer konstruktivistischen Perspektive zu untersuchen. Wir sollten an dieser Entscheidung festhalten, den konstruktivistischen Ansatz aber selbst als unabgeschlossenes Projekt, also als Forschungsaufgabe verstehen. Offen ist aus meiner Sicht u.a. die Frage, ob es sinnvolle Verwendungsweisen des Begriffs kollektiver Identität gibt, die wir unseren Untersuchungen zugrunde legen können. Meine These in diesem Zusammenhang lautete, daß die forschungsstrategisch richtige Entscheidung, regionenbezogene Identifikationsprozesse zu untersuchen, uns nicht vom Begriff der „kollektiven Identität“ befreit. Zudem sollte die Anwendung der konstruktivistischen Perspektive von einem Bewußtsein über deren „blinden Flecke“ begleitet sein. Eine Grenze bisheriger konstruktivistischer Ansätze sehe ich darin, daß sie vor allem für die Untersuchung von Formen nationaler Identifikation entwickelt wurden. Die These der Nation als einer imaginierten Gemeinschaft ist zwar auf die Region (und andere soziale Einheiten) übertragbar, sie lenkt den Blick aber noch nicht auf die Untersuchung der Spezifik des Region-Machens. Strittig ist aber darüber hinaus, wie beide modernen Formen der sozialen Bindung zueinander ins Verhältnis zu setzen und zu wichten sind. Das überschreitet die analytisch-phänomenologische Perspektive des konstruktivistischen Ansatzes. Antworten führen in das Feld der normativen Gesellschaftstheorie, traditionell ein Feld philosophischer Reflexion. Das Herangehen an das soziale Phänomen „regionale Identität“ innerhalb von Sozialphilosophie und politischer Philosophie ist jedoch bisher noch ein überwiegend kritisches bzw. dekonstruktives. Das hängt mit der Dominanz eines einseitig verstandenen universalistischen Prinzips in der Sozialphilosophie oder mit der in der modernen Staats- und Rechtsphilosophie favorisierten nationalstaatlichen Perspektive zusammen. Wenn Region anders als dekonstruktiv in den Blick genommen wird, dann unter dem anthropologischen Aspekt der Kompensation für negative Folgen des Modernisierungsprozesses oder unter dem damit verbunden Blickwinkel eines Widerstandspotentials gegen systemische Übergriffe. Die Schwächen solcher Ansätze liegen auf der Hand. Weder kommt in den Blick, wie Regionen heute in strategischer Absicht durch politische Eliten hergestellt werden, um damit bestimmte wirtschaftliche und politische Interessen durchzusetzen. Noch wird ausgehend von solchen Stichworten wie „Gegenmoderne“ und „Protestbewegung“ regionale Identität anders denn als rückwärtsgewandte Reaktion auf Tendenzen der Globalisierung begriffen. Der Sonderforschungsbereich sollte sich das ehrgeizige Ziel setzen, etwas zum Abbaus dieser gesellschaftstheoretischen Leerstellen beizutragen. Entsprechende Bemühungen müßten aus meiner Sicht in der Entwicklung einer Theorie der Formen der Sozialintegration in der Moderne münden. Innerhalb dieser Theorie wäre dem Begreifen der Formen regionaler Identifikation anders als bisher üblich ein wesentlichen Platz einzuräumen. Literaturverzeichnis Anderson, B. (1983), Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Berlin Beck, U. (1993), Die Erfindung des Politischen, Frankfurt/M. Berding, H. (Hg.) (1994), Nationales Bewußtsein und kollektive Identität, Frankfurt/M. Berding, H. (Hg.) (1996), Mythos und Nation, Frankfurt/M. 37 Berger, P. L./ Luckmann, Th. (1996), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M. Berlin, I. (1993), Der gekrümmte Zweig, in: Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Bialas, W. (1995) Gemeinschaft und Gesellschaft, in: DZfPh Heft 2/1995, S. 365 ff., Berlin Biedenkopf, K. (1994), Einheit und Erneuerung. Deutschland nach dem Umbruch in Europa, Stuttgart Bourdieu, P. (1974), Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt/M. Bourdieu, P. (1985), Sozialer Raum und „Klassen“, Frankfurt/M. Bourdieu, P. (1987), Die feinen Unterschiede, Frankfurt/M. Brunkhorst, H. (1997), Die Weltgesellschaft und die Krise der Demokratie, in: DZfPh Heft 6/1997, S. 895 ff. Bubner, R. (1993), Zwischenrufe. Aus den bewegten Jahren, Frankfurt/M. Dahrendorf, R. (1993), Die Sache mit der Nation, in: Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Durkheim, E. (1984a), Erziehung, Moral und Gesellschaft, Frankfurt/M. Durkheim, E. (1984b), Die Regeln der soziologischen Methode, Frankfurt/M. Durkheim, E. (1992), Über soziale Arbeitsteilung, Frankfurt/M. Durkheim, E. (1994), Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt/M. Etzioni, A. (1995), Die Entdeckung des Gemeinwesens, Stuttgart Fessen, B. (1995), Mißlungene Verständigung. Wortmeldungen von Philosophen zum neuen Deutschland, in: DZfPh Heft 5/1995, S. 861 ff. Forst, R. (1995), Kontexte der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. Foucault, M. (1984), Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M. Fuller, G. E. (1993), Das Auseinanderbrechen der Nationen und die Bedrohung der amerikanischen, in: Jeismann, M./Ritter, , H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Gehlen, A. (1956), Urmensch und Spätkultur, Bonn Gellner, E. (1993), Aus den Ruinen des großen Wettstreits, in: Jeismann, M./Ritter, H. (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig 38 Habermas, J. (1989), Produktivkraft Kommunikation. Fragen von Hans-Peter Krüger. In: Sinn und Form, Heft 6/1989, Berlin Habermas, J. (1988a), Theorie kommunikativen Handelns, Bd. 1, Franfurt/M. Habermas, J. (1988b), Theorie kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt/M. Habermas, J. (1997), Faktizität und Geltung, Frankfurt/M. Havel, V. (1993), „Zuhausesein“, in: Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen alten Nationalismus, Leipzig von Hayek, Fr. A. (1979), Wissenschaft und Sozialismus, Tübingen Henrich, D. (1993), Nach dem Ende der Teilung. Über Identitäten und Intellektualität in Deutschland, Frankfurt/M. Hitzler, R. (1998), Posttraditionale Vergemeinschaftung. Über neue Formen der Sozialbindung, in: Initial Heft 9/1998, S. 81 ff., Berlin Horch, da kommt eine Sachse (1998), in: Leipziger Volkszeitung vom 14./15. 2. 1998, Leipzig Jäger, M./Jäger, S. (Hg.)(1996), Baustellen. Beiträge zur Diskursgeschichte deutscher Gegenwart, Duisburg Jeismann, M., (1993), Alter und neuer Nationalismus, in: Jeismann, M. /Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Keupp, H. (1990), Identitäten im Umbruch. Das Subjekt in der Postmoderne, in: Initial Heft 7/1990 Lepenies, W. (1992), Folgen einer unerhörten Begebenheit, Berlin Lepsius, M. (1993), Nation und Nationalismus in Deutschland, in: Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Lübbe, H. (1983), Zeitverhältnisse. Zur Kulturphilosophie des Fortschritts, Graz/Wien/Köln Lübbe, H. (1985), Die Gegenwart der Vergangenheit. Kulturelle und politische Funktionen des historischen Bewußtseins. Oldenburg Lübbe, H. (1989), Die Aufdringlichkeit der Geschichte. Herausforderungen der Moderne vom Historismus bis zum Nationalsozialismus. Graz/Wien/Köln 1989 Lübbe, H. (1997), Modernisierung und Folgekosten. Trends kultureller und politischer Evolution, Berlin/Heidelberg/New York 39 Luhmann, N. (1988), Soziale Systeme, Frankfurt/M. Luhmann, N. (1994), Inklusion und Exklusion, in: Berding, H. (Hg.), Nationales Bewußtsein und kollektive Identität, Frankfurt/M, S. 15 ff. Luutz, W. (1996), Regionalismus als Nationalismusersatz? Zur Konstruktion regionaler Identität im politischen Diskurs am Beispiel „Sachsens“, in: Jäger, M,/Jäger, S. (1996), Baustellen. Beiträge zur Diskursgeschichte deutscher Gegenwart, Duisburg. Mannheim, K. (1985): Ideologie und Utopie. Frankfurt/M. Marx, K. /Engels, F. (1973), Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. 3., Berlin Michnik, A. (1993), Im Schatten des Sokrates, in: Jeismann, M./Ritter, H. (Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Murray, Ch. (1996), What It Means to Be a Libertarian, New York Niethammer, L. (1999), „Historisches Gedächtnis“ und „Identität“, in: „Mitteldeutschland“: Begriff-Konstrukt-Historische Realität. Tagung am 26. und 27. Februar 1999 in Leipzig (zitiert nach Mitschrift des Vortragstextes – Veröffentlichung ist beabsichtigt) Nolte, E. (1993), Die unvollständige Revolution, in: Jeismann, M. / Ritter, H.(Hg.) (1993), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig Rorty, J. (1992), Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt/M. Rousseau, J.-J. (1978), Der Gesellschaftsvertrag, Leipzig Schäuble, W. (1994), Und der Zukunft zugewandt, Berlin Schmid, W. (1993), Was geht uns Deutschland an? Frankfurt/M. Schmitt, C. (1987), Der Begriff des Politischen, Berlin Searle, J. R. (1997), Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit, Reinbeck bei Hamburg Simmel, G. (1992), Soziologie, Frankfurt/M. Sonderforschungsbereich Regionenbezogene Identifikationsprozesse. Das Beispiel Sachsens (Projektantrag) (1998), Leipzig Thomä, D. (1995), Multikulturalismus, Demokratie, Nation, in: DZfPh Heft 2/1995, S. 349 ff., Berlin Thomson, J. B. (1997), Die Globalisierung der Kommunikation, in: DZFPh Heft 6/1997, S. 881 ff., Berlin