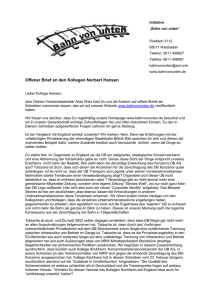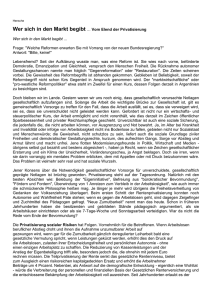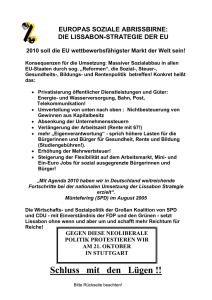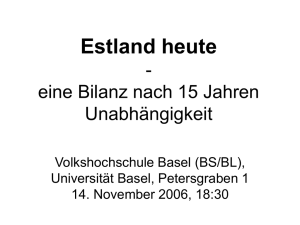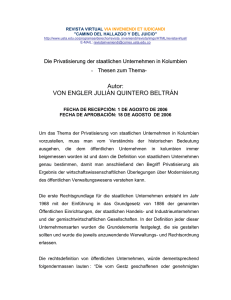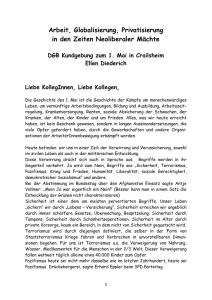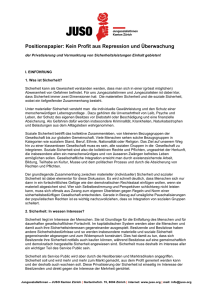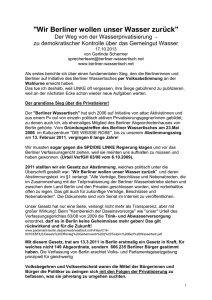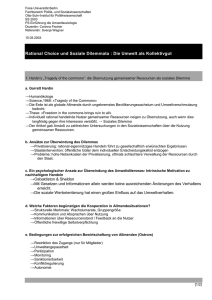Politik der Staatszerstörung
Werbung

"Politik der Staatszerstörung" INTERVIEW HANNES KOCH taz: In Ihrer Studie "Grenzen der Privatisierung" versuchen Sie den großen Wurf. Sie stellen die Politik der Privatisierung staatlicher Wasserwerke, Schulen, Sozialversicherungen und Unternehmen grundsätzlich in Frage - und damit auch die neoliberale Globalisierung. Kann es eine gute Privatisierung geben? Ernst Ulrich von Weizsäcker: In den ehemals kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas gibt es viele gute Beispiele. Für die Menschen dort ist die Privatisierung manchmal wie ein Ausbruch aus einem Gefängnis gewesen. Ein gutes Beispiel ist das Leasing der Wasserversorgung von Rostock durch das deutsch-französische Privatunternehmen Thyssen/Ondeo. Dort sind die Preise für die Kunden ziemlich gestiegen. Aber sie bewegen sich im erträglichen Bereich. Die Preiserhöhung ermöglicht die Finanzierung der Investitionen, ohne sie hätte die Firma die maroden Leitungen nicht sanieren können. Wenn Privatkapital in öffentliche Infrastruktur investiert wird und dabei eine faire Verzinsung herauskommt, finde ich das in Ordnung. Aber diese Sorte von Privatisierung ist eine für reiche Länder, wo es echte Armut eigentlich nicht gibt. In der Dritten Welt ist die Privatisierung häufig damit verbunden, dass arme Leute sich Wasser oder Bildung dann nicht mehr leisten können. Der afrikanische Staat Sambia hat ab 1992 sein größtes Staatsunternehmen verkauft, einen Bergbaukonzern. Die neuen Eigentümer, zwei US-Firmen, stießen alles ab, was der Staatskonzern bis dahin finanziert hatte: Schulen, Energieversorgung, Krankenhäuser. Weil auch die Zahl der Arbeitsplätze drastisch abnahm, setze ein Exodus der Bevölkerung aus den betroffenen Gegenden ein. Ein krasses Beispiel oder die Regel? In Sambia ist das sehr schlecht gelaufen. Die Mehrzahl der sechzig Beispiele in unserem Buch beschreiben negative Auswirkungen. Kennen Sie überhaupt positive Fälle aus Entwicklungs- oder Schwellenländern? In Mexiko war das Telekommunikationssystem Ende der Achtzigerjahre schlecht, ineffizient und teuer. Es wurde privatisiert. Und es wurde modern, preisgünstig und schnell. Die Regierung von Uruguay dagegen hat die Telekommunikation selbst modernisiert und hat nun das vielleicht leistungsstärkste Netz ganz Südamerikas - in Form eines Staatsunternehmens. Am anderen Ufer des Rio de la Plata, in Argentinien, ist die Privatisierung währenddessen weitgehend gescheitert. Was müsste passieren, um Privatisierungsprojekte sozialverträglich zu machen? Man muss das Dogma der Privatisierung vor allem in der Entwicklungspolitik untergraben. Die Lösung aller Probleme in der Zurückdrängung des Staates zu sehen, ist pure Ideologie. Unser Bericht schildert, dass manche Staaten die einfachsten Formen der Grundversorgung ihrer Bevölkerung nicht mehr hinbekommen. Sie haben ihre Einwohner abgeschrieben. Danach kommen dann die Apologeten des Marktes und beschreien das Versagen des Staates, das ihre Politik teilweise selbst herbeigeführt hat. Wir haben es mit einer Delegitimierung des Staates zu tun. Diese Politik der Staatszerstörung ist ungerecht und muss politisch entlarvt und bekämpft werden. Wollen Sie Macht für den Staat zurückerobern? Allerdings. Jeder fordert doch heute good governance - gutes Regieren. Vor allem angesichts der rund dreißig Länder der Erde, in denen sich die lebensnotwendigen staatlichen Funktionen weitgehend aufgelöst haben. Das sind die so genannten failed states - ein enormer zivilisatorischer Rückschritt. Was sollten Regierungen konkret beachten, wenn sie ihren Besitz verkaufen? Die jeweilige Staat oder ersatzweise auch Geberländer müssen in Verträgen mit den privaten Käufern strikte Rahmenbedingungen formulieren: Welche Qualität soll beispielsweise das Trinkwasser haben, werden die Wohnquartiere der Armen an das Leitungsnetz angeschlossen? Außerdem müssen die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sozialverträglichen Preisen gewährleistet werden. In Entwicklungsländern ist genau das häufig das Problem. Man muss immer damit rechnen, dass die privaten Käufer die festgelegten Standards nicht einhalten. Was dann? Dann muss der Staat das Recht haben, Strafen zu verhängen und die Konzession zurückzunehmen. Das Interesse der Aktionäre der Privatfirma darf nicht verabsolutiert werden. taz Nr. 7291 vom 23.2.2004, Seite 5, 149 Zeilen (Interview), HANNES KOCH Beispiel 1: Wasser für Manila Die Wasserversorgung der philippinischen Hauptstadt Manila galt lange als Paradebeispiel für eine funktionierende Privatisierung. Der Weizsäcker-Report revidiert diese Einschätzung. Einer der beiden privaten Mitbetreiber des Wassernetzes hat den Vertrag mit der Regierung gekündigt und fordert Entschädigungen. Offenbar hielten die allgemein als richtungsweisend betrachteten Rahmenbedingungen des Vertrags - Begrenzung des Preisanstiegs, Ausdehnung des Netzes in die Slums - der Realität nicht stand. Obwohl die tatsächlichen Preise für die Verbraucher seit 1997 auf das Dreifache stiegen, reichte das nicht aus, um den Finanzbedarf der privaten Anteilseigner um Suez/Ondeo zu stillen. Jetzt ist der Streit bei Gericht anhängig. KOCH taz Nr. 7291 vom 23.2.2004, Seite 5, 25 Zeilen (TAZ-Bericht), KOCH Beispiel 2: Strom für Südafrika Eskom, der noch staatliche Stromversorger Südafrikas, schließt nach Angaben der Regierung jeden Monat knapp 30.000 Haushalte zusätzlich an das Stromnetz an. Seit 1994 sind angeblich rund vier Millionen Anschlüsse hinzugekommen. Die Weizsäcker-Studie beruft sich nun auf ein alternatives Forschungsinstitut, das diesen Zahlen andere entgegenhält. Im Zuge der Vorbereitung auf die bevorstehende Privatisierung habe Eskom ein rigides Kontrollprogramm aufgelegt, um ihre Tarife durchzusetzen. Eine Folge davon: Dreimal so viele Anschlüsse wie neu verlegt werden, würden monatlich abgeschaltet, weil die Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen könnten. Insgesamt sinke der Stromverbrauch in Südafrika ebenfalls ein Indiz für die schlechter werdende Versorgung. KOCH taz Nr. 7291 vom 23.2.2004, Seite 5, 27 Zeilen (TAZ-Bericht), KOCH Beispiel 3: Universitäten für Tansania Seit Beginn der 90er-Jahre betreibt die tansanische Regierung die Privatisierung der Hochschulausbildung. Im Jahr 2000 standen 3.069 Plätze an den staatlichen Universitäten zur Verfügung, 3.145 an privaten Instituten und Colleges. Letztere erheben zumeist Studiengebühren. Stipendien für ärmere Studenten gibt es kaum. Einen "einkommensabhängigen Prozess der Selektion in Schul- und Universitätsausbildung" analysiert deshalb der Weizsäcker-Report. Damit habe die Privatisierung der Unis zur "sozialen Ungleichheit" beigetragen. Der Prozess der Privatisierung erschien der Regierung freilich als einziger Weg, um die Zahl der Studienplätze überhaupt zu erhöhen. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in den 90er-Jahren fehlte das Geld, um die staatlichen Universitäten mit ausreichenden Investitionen auszubauen. KOCH taz Nr. 7291 vom 23.2.2004, Seite 5, 29 Zeilen (TAZ-Bericht), KOCH