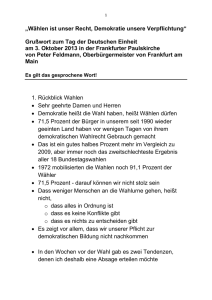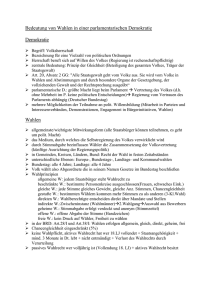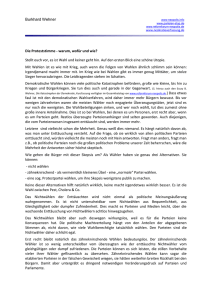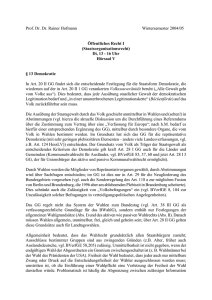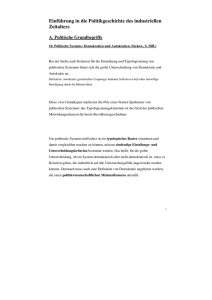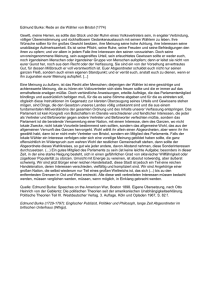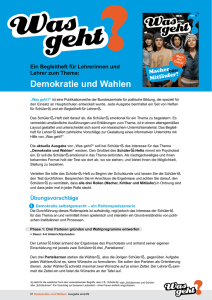Materialien Demokrati und Wahlen Grafstat - Lise
Werbung

M 02.03 Die Bedeutung von Wahlen Eine optimistische Perspektive Die Grundfunktion der Wahl in der Demokratie ist darin zu sehen, dass sie das Medium ist, durch welches die Selbstregierung des Volkes verwirklicht wird. Die Wähler bestimmen Männer und Frauen ihres Vertrauens, die für sie die Staatsgewalt handhaben, die in ihrem Namen und Auftrag 'regieren'. Die Wahl ist der 'Grundvorgang des Verfassungslebens, auf dem alles andere aufbaut': sie verleiht dem Parlament die erforderliche Legitimität, durch sie wird die Volksvertretung und jeder einzelne Abgeordnete ermächtigt, für die Gemeinschaft zu handeln (...). Regelmäßige Wahlen bilden daher ein Kernstück jeder demokratischen Verfassungsordnung. Ohne sie ist eine demokratische Herrschaftsausübung, ist Demokratie ausgeschlossen. (aus: A. Jüttner: Wahlen und Wahlrechtsprobleme. Geschichte und Staat, Bd. 137, München/Wien 1970, S. 8 f.) Eine kritische Perspektive Die Verselbständigung der politischen Institutionen (vor allem der Parteien und des Parlaments) von ihren nominellen Trägern, dem Wahlvolk, verkehrt den Sinn und die Bedeutung von Wahlen: aus einer Demonstration des politischen Willens der Staatsbürger und der Bestimmung ihrer Interessenvertretung wurden sie weitgehend zu Manipulationsveranstaltungen von Parteien, die mit den Methoden des wirtschaftlichen Marktes um die Zustimmung der Wähler konkurrieren und ihre Waren mit Reklametricks und Werbemethoden dem Verbraucher anbieten. (...) Die ideologische [Verklärung] des Wahlaktes verdeckt seine sinkende praktische Bedeutung, seine Wandlung von einem Akt politischer Mitbestimmung in eine formale Veranstaltung und seine reale Machtlosigkeit trotz des Scheins der Macht. Politische Theorie, die mit dem zynischen Argument auftritt, auch bei politischer Apathie der Wähler funktionierten doch die politischen Institutionen, dient (...) der Verschleierung eines Systems, in dem Demokratie zur ideologischen Fassade geworden ist, hinter der sich der Herrschafts- und Machtvollzug der 'power-elite' von Kontrolle und Einfluss durch das Wahlvolk weitgehend unberührt abspielt. (aus: U. Schmiederer: Wählerverhalten, in: W. Abendroth / K. Lenk (Hrsg.): Einführung in die politische Wissenschaft, Bern/München 1968, S. 352.) Eine realistische Perspektive Für eine realistische Einschätzung der Vorzüge und Nachteile unserer parlamentarischen Demokratie sind einige Grundeinsichten nötig. So ist die Vorstellung vom 'Volk' oder von der 'Gesellschaft' als Subjekt einer einheitlichen Vernunft und eines einheitlichen Willens eine gefährliche Chimäre, die uns Rousseau aufgebunden hat. 'Das Volk' oder 'die Gesellschaft' ist - zumindest in normalen Zeiten - keineswegs ein konkordanter Verein, sondern eine Pluralität von Interessengruppen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, unterschiedlichen Lösungskonzepten. (...) Auch in einer Basis-Demokratie hat nicht jedes Mitglied der Gesellschaft dieselben Interessen und denselben politischen Einfluss. In basisdemokratisch verfassten kleinen Gemeinwesen kommt es normalerweise zur Ausbildung von informellen Herrschaftsstrukturen, insbesondere zur unkontrollierten Machtausübung von Meinungsführern, die über besondere manipulative Fähigkeiten verfügen, niemandem verantwortlich sind und nicht abgewählt werden können. (...) Eine direktdemokratische Entscheidung aller politischen Probleme ist in einer Großgesellschaft ohnehin praktisch unmöglich. Demokratie in einer Großgesellschaft kann im wesentlichen nur über die Wahl von Repräsentanten mit zeitlich begrenztem freien Mandat realisiert werden. (...) Eine repr äsentative BürgerDemokratie ist in erster Linie ein System zur Vermeidung oder Begrenzung des Unheils, das durch unabsetzbare politische Führer angerichtet werden kann. Wen wir wählen, wissen wir zwar im voraus nie so genau. Die Möglichkeit der Abwahl von Politikern ist jedoch ein unschätzbarer Vorteil unseres politischen Systems, auch wenn dabei die Geduld mancher Bürger gelegentlich strapaziert werden mag. (aus: L. Czayka: Die ungeliebte Demokratie, in: Der Spiegel 29/1992, S. 42 f.) M 02.04 Volkssouveränität: direkte Demokratie oder Repräsentativsystem Fragt man nach den einzelnen Elementen, aus denen ein demokratisches Gemeinwesen aufgebaut ist, dann stößt man auf den Satz, dass Demokratie Herrschaft des Volkes sei. (...) Dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, bedeutet freilich nicht, dass das Volk auch selbst regiert und bei allen Einzelheiten der politischen Entscheidungen mitwirkt, selbst wenn das in der formalen Konsequenz des demokratischen Gedankens läge. Nur auf diese Weise ließe sich ja verwirklichen, dass der Bürger allein seinen eigenen Gesetzen und Befehlen gehorchen müsste und insofern wirklich frei bliebe. Aber diese Identität der Regierenden und Regierten hat es im strengen Sinne des Wortes nie wirklich gegeben, obwohl die historischen Frühformen der Demokratie im antiken Griechenland an Modellen einer "direkten Demokratie" orientiert waren und noch Rousseau nur diese als Demokratie gelten lassen wollte. Doch die direkte Demokratie war nur unter zwei Voraussetzungen denkbar. Einmal musste es sich um einen sozial homogenen, kleinen, überschaubaren Staat, in der Regel einen Stadtstaat, handeln, so dass alle Bürger an einem Ort sich versammeln und miteinander diskutieren und Beschlüsse fassen konnten. Dies Erfordernis veranlasste Aristoteles dazu, als ideale Größe eines Staates denjenigen Bereich festzulegen, den die Stimme eines Ausrufers gerade noch durchdringen könnte. Daneben aber galt als Voraussetzung der direkten Demokratie eine enge Begrenzung und klare Übersichtlichkeit der Staatsaufgaben. Der einzelne Bürger kann ja nur über Fragen mitentscheiden, die er wirklich zu beurteilen und in ihren Konsequenzen zu erkennen vermag. Das mochte im Rahmen einer Stadt oder eines Schweizer Landkantons, wo fast jeder jeden kennt, in den vorindustriellen Zeiten mehr oder weniger unabhängiger Kleinstaaten noch angehen. Im modernen Großflächenstaat aber sind solche Voraussetzungen nicht mehr gegeben. (...) Wenn so aus äußeren und inneren Gründen die Regierung des Volkes durch das Volk in unserer Zeit eine Unmöglichkeit ist, dann bleibt als Konkretisierung der Volkssouveränität vor allem die Wahl von Vertretungskörperschaften oder Repräsentanten, die dann die Regierung nach dem Willen des Volkes und mit seiner Zustimmung verantwortlich führen. Die Entscheidung der detaillierten Sachfragen wird gewählten Vertretern überlassen; der Wähler hat nur zwischen den ihm von den Parteien präsentierten Kandidaten zu entscheiden und diejenigen auszuwählen, von denen er in der Regel aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit glaubt, dass sie die Politik im Sinne seiner Überzeugung und Interessen führen werden. Wer freilich durch den Akt der Wahl dem Willen des Volkes Geltung verschaffen und so die Wahl zum entscheidenden Instrument einer Konkretisierung der Volkssouveränität machen will, muss gewisse unabdingbare Forderungen stellen. (aus: W. Besson/G. Jasper: Das Leitbild der modernen Demokratie. Bauelemente einer freiheitlichen Staatsordnung. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 300, überarb. und aktual. Neuausgabe, Bonn 1990, S. 23ff.) M 02.05 Voraussetzungen und Funktionen der Wahl Voraussetzungen der Wahl Jede Wahlentscheidung setzt eine Auswahl voraus. Nach allgemeinem Sprachgebrauch heißt wählen, zwischen mehreren tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten sachlicher oder personeller Art zu entscheiden. Es müssen verschiedene miteinander konkurrierende Personen, Personengruppen (Parteien) und Sachprogramme vorhanden sein, zwischen denen der Wähler eine Auswahl treffen kann. Ist eine Konkurrenzsituation nicht gegeben, liegt kein Wahlakt, sondern allenfalls eine Akklamation im Sinne einer totalen Zustimmung vor. Die der Wahl innewohnende Konkurrenz setzt freilich gleiche Chancen aller um die Gunst des Wählers wetteifernden Personen und Gruppen voraus. Das heißt, jede Person, jede Partei und jedes Sachprogramm müssen im Grundsatz in der Lage sein, sich in der Konkurrenz mit- und gegeneinander durchzusetzen. Wo das nicht möglich ist, kann man von Wahlen nicht sprechen. Versteht man unter Wahl eine Auswahl unter mehreren Möglichkeiten, so gehört dazu auch die Wahlfreiheit des Wählers. Er muss sich frei, d.h. eigenverantwortlich und ohne Druck oder Zwang entscheiden können. Um die gewählten Repräsentanten an den Willen ihrer Wähler zu binden, ist zudem unverzichtbar, dass sie sich in periodischen Abständen erneut zur Wahl stellen müssen, so dass die Wähler die Möglichkeit behalten, ihre einmal getroffene Entscheidung zu überprüfen, zu erneuern oder zurückzunehmen. Nur dadurch können die Gewählten genötigt werden, die Überzeugungen und Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler zu respektieren. Funktionen der Wahl in einem repräsentativen Regierungssystem Die Wahl gibt den Bürgern die Möglichkeit zur Teilnahme an der politischen Willensbildung. Unter den verschiedenen Mitwirkungsformen des Bürgers in der Demokratie sind die Wahlen die allgemeinste und die wichtigste: die allgemeinste, weil alle Staatsbürger daran teilhaben können, und die wichtigste, weil es in den Wahlen um politische Macht geht. Durch ihre Stimmabgabe beeinflussen die Wähler die Zusammensetzung der Volksvertretung und damit (indirekt) die Auswahl des politischen "Führungspersonals" und die programmatische Ausrichtung der künftigen Regierungspolitik. Durch die Wahlentscheidung soll eine klare Mehrheit im Parlament geschaffen werden, aus der eine handlungsfähige Regierung hervorgeht. Die gewählte Mehrheit ist berechtigt (legitimiert) und beauftragt (autorisiert), für eine begrenzte Zeit die Regierung zu führen, für die Gesamtheit der Staatsbürger verbindliche Entscheidungen zu treffen und Macht auszuüben. Wahlergebnisse sind Handlungsauftrag und Machtzuweisung auf Zeit. Während die gewählte Mehrheit zur befristeten Machtausübung befugt ist, übernimmt die Minderheit die wichtige Rolle der Opposition. Wahlen sollen nicht nur für eine handlungsfähige Regierung, sondern ebenso für eine starke Opposition sorgen. Deren Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren, indem sie die Mehrheitspartei(en) ständig zwingt, ihr politisches Handeln vor der Öffentlichkeit zu erläutern und zu begründen. Die regierende Mehrheit kann sich der Pflicht, Rechenschaft abzugeben, nicht entziehen, wenn sie das Vertrauen und die Zustimmung ihrer Wählerinnen und Wähler nicht verlieren will. Ist es in der Zeit zwischen den Wahlen in erster Linie Aufgabe der Oppositionspartei(en) und der öffentlichen Meinung, die Regierung zu kontrollieren und darüber zu wachen, dass die durch Wahlentscheidung übertragene Macht nicht missbraucht wird, so erhält das Volk in der Wahl unmittelbar eine Möglichkeit der Machtkontrolle. Die Wähler können ihre einmal getroffene Wahlentscheidung bestätigen, wenn sie mit der Regierung und der von ihr vertretenen Politik einverstanden sind, oder sie können ihre Entscheidung korrigieren und damit die Machtzuweisung und den Handlungsauftrag an die Parteien ändern, wenn das nicht der Fall ist. Periodische Wahlen sollen die Chance des Machtwechsels offenhalten und dafür sorgen, dass die Regierung den Wählern verantwortlich bleibt. (Vgl. W. Gensior / V. Krieg: Kleine Wahlrechts-Fibel. Wahlrecht und Wahlverfahren in der Bundesrepublik Deutschland und im Lande Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., Leverkusen-Opladen 1984, S. 16 ff., und W. Besson / G. Jasper: Das Leitbild der modernen Demokratie. Bauelemente einer freiheitlichen Staatsordnung. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung Bd. 300, überarb. und aktual. Neuausg., Bonn 1990, S. 25.; D. Nohlen: Artikel "Wahlen/ Wahlfunktionen" in: U. Andersen/ W. Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1997, S. 597 ff.) M 02.08 Die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt." (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) a) Allgemeines Wahlrecht. Diese Rechtsnorm fordert, dass grundsätzlich alle Staatsbürger, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Sprache, Einkommen oder Besitz, Beruf, Stand oder Klasse, Bildung, Konfession oder politischer Überzeugung Stimmrecht besitzen und wählbar sind. Gegen diesen Grundsatz verstößt nicht, dass einige unerläßliche Voraussetzungen gefordert werden wie ein bestimmtes Alter, Staatsbürgerschaft, Wohnsitznahme, Besitz der geistigen Kräfte und der bürgerlichen Ehrenrechte und volle rechtliche Handlungsfähigkeit. (...) b) Gleiches Wahlrecht. Dieser Grundsatz erfordert, dass das Stimmgewicht der Wahlberechtigten gleich ist und nicht nach Besitz, Einkommen, Steuerleistung, Bildung, Religion, Rasse, Geschlecht oder politischer Überzeugung differenziert werden darf. Postuliert wird die Zählwertgleichheit der Stimmen. Mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar sind alle Klassen-/Kurien- und Pluralwahlrechte: (1) Beim Klassen- oder Kurienwahlrecht wird die Wählerschaft in zahlenmäßig stark voneinander abweichende Gruppen unterteilt, die eine fixierte Zahl von Abgeordneten wählen. (2) Beim Pluralwahlrecht wird die Anzahl der den Wahlberechtigten zur Verfügung stehenden Stimmen durch Zusatzstimmen für bestimmte Personengruppen (Grundeigentümer, Familienväter etc.) differenziert. Der Gleichheitsgrundsatz ist auch für die technische Gestaltung von Wahlen relevant, vor allem im Bereich der Wahlkreiseinteilung. Soll die Zählwertgleichheit der Stimmen garantiert bleiben, muss bei der Wahlkreiseinteilung für ein etwa gleiches Verhältnis von Bevölkerung (oder Wahlberechtigten) zur Zahl der zu wählenden Abgeordneten Sorge getragen werden (...). (aus: D. Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, Opladen 1990, S. 31 f.) c) Unmittelbar ist die Wahl, wenn die Wähler die Abgeordneten selbst bestimmen, also keine Mittler in Gestalt von Wahlmännern (...) bzw. Vertretern für ihre Entscheidung benötigen. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit besagt danach, dass jede Zwischenschaltung eines fremden Willens zwischen Stimmabgabe der Wähler und Bestimmung der Gewählten bei oder nach der Wahl ausgeschlossen ist. Der Wähler muss das letzte und entscheidende Wort haben. Die unmittelbare Wahl steht im Gegensatz zu den weitgehend historischen Erscheinungen der Wahl von sog. Wahlmännergremien, die die geeigneten Kandidaten sollten besser herausfinden können. Die heute noch überkommenen mittelbaren Wahlen in einigen Ländern sind weitgehend nur noch formal mittelbar, weil der Wähler praktisch eine gezielte Stimme abgeben kann (...). Die Listenwahl, auch die Wahl nach starren Listen, liegt im Rahmen der unmittelbaren Wahl, solange die Listen aus vorab, vor der Wahl, unabänderlich festgelegten Bewerbern bestehen. d) Geheim ist die Wahl, wenn der Wähler seine Stimme so abgeben kann, (...) dass andere keine Kenntnis von seiner Wahlentscheidung erhalten, also nicht erkennbar ist, wie er wählen will, wählt oder gewählt hat. [Zu diesem Zweck werden Einrichtungen geschaffen wie Wahlkabine, amtliche Wahlzettel, Umschlag, versiegelte Wahlurne.] Der Grundsatz der geheimen Wahl dient damit der Sicherung der freien Wahl und steht, historisch betrachtet, gegen jede offene Stimmabgabe wie Wahl durch Zuruf oder Handzeichen, zu Protokoll oder durch Abgabe unterzeichneter Stimmzettel. Der Grundsatz schützt vor allem die Stimmabgabe selbst und ist insoweit auch der Disposition des Wählers entzogen, der nicht nur geheim wählen darf, sondern zur Sicherung der freien Wahl - auch geheim wählen muss. (...) e) Frei ist die Wahl, wenn der Wahlberechtigte bei der Wahl seinen wirklichen Willen unverfälscht zum Ausdruck bringen kann. Dieser Grundsatz besagt damit im besonderen, dass der Wähler sein Wahlrecht ohne Zwang oder sonstige unzulässige Beeinflussung von außen ausüben kann, und zwar gleichgültig, ob diese von amtlicher oder privater Seite ausgehen. Praktische Voraussetzung und historisch-tradiertes Postulat der freien Wahl sind deren Geheimheit. Die Grundsätze der freien und geheimen Wahl sind nach heutigem Verständnis derart unauflöslich zugeordnet, dass sich die meisten Verfassungen auf die besondere Garantie der geheimen Wahl beschränken. (aus: W. Gensior/ V. Krieg: Kleine Wahlrechts-Fibel. Wahlrecht und Wahlverfahren in der Bundesrepublik Deutschland und im Lande Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., Leverkusen-Opladen 1984, S. 21 ff.) M 02.10 Wahlrechtsgrundsätze in der Entwicklung Bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1848 wurde in Deutschland erstmals ein - nach damaligen Maßstäben - annähernd allgemeines Wahlrecht praktiziert. Die Wahl blieb "freilich begrenzt auf die volljährigen selbständigen männlichen Staatsangehörigen. (...) In der Regel behandelten die Landeswahlgesetze [der deutschen Einzelstaaten] jemand als unselbständig, der Armenunterstützung bekam, keinen eigenen Hausstand unterhielt und der zu Kost und Lohn in einem abhängigen Dienstverhältnis stand, also den großen Teil der 'handarbeitenden Klassen'. Wurden diese Bestimmungen streng gehandhabt wie in Sachsen, Hannover und Baden, blieben auch das ländliche Gesinde sowie die im Hause des Meisters wohnenden Handwerksgehilfen ausgeschlossen, insgesamt bis zu 25 % der volljährigen Männer." (aus: W. Siemann, Die deutsche Revolution von 1848/49, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1985, S. 84f.) Bis 1918 war es für die herrschende Staatslehre in Deutschland eine ausgemachte Sache, dass Frauen keine politischen Rechte haben könnten. So erklärte beispielsweise der preußische Historiker und Staatsrechtler Heinrich von Treitschke (1834-1896): "Man erkennt, dass unsere germanischen Vorfahren von gesundem Sinne gewesen sind, wenn sie die Weiber von der Regierung ausgeschlossen haben. ... Obrigkeit ist männlich; das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht. Von allen menschlichen Begabungen liegt keine dem Weibe so fern wie der Rechtssinn. Fast alle Frauen lernen, was Recht ist, erst durch ihre Männer." (Zit. nach B. Schenkluhn, Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1987, S. 24.) Als im Berliner "Verein zur Vertretung der Arbeiterinneninteressen" 1895 die Forderung nach dem Frauenstimmrecht erhoben wurde, erschien in der Zeitschrift "Nation" eine Erwiderung, in der es hieß: "Lassen Sie (...) die Frau in ihrer eigensten Berufssphäre, da, wo der Reichtum des warmen Gemüts zur Geltung kommt, während sich der kalte Verstand des Mannes draußen abmüht; sei es im Parlament, sei es außerhalb desselben". (ebd.) - Frauen durften in Deutschland erstmals an den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung 1919 teilnehmen. In Frankreich wurde das Frauenwahlrecht erst mit der Verfassung von 1946, in der Schweiz auf Bundesebene erst 1971 eingeführt. In den Vereinigten Staaten von Amerika garantiert eine Verfassungsbestimmung von 1870 (Zusatzartikel 15) allen Bürgern, ungeachtet der Rasse oder Hautfarbe, das Wahlrecht. In einigen Bundesstaaten war es allerdings noch lange Zeit üblich, von schwarzen Wählern eine "Intelligenzprüfung" zu verlangen, wodurch die Wahlbeteiligung der schwarzen Bevölkerung gesenkt wurde. Diese Praxis wurde durch das Wahlrechtsgesetz von 1965 verboten. (Vgl. J. Raschke, Wie wählen wir morgen?, 4. erg. Aufl., Berlin 1969, S. 7.) In Preußen wurde durch Verordnung vom 30. Mai 1849 für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus das Dreiklassenwahlrecht eingeführt, das bis 1918 gültig blieb: Jeder Wahlkreis umfasste mehrere "Urwahlbezirke". In jedem Urwahlbezirk wurde das gesamte Steueraufkommen durch drei geteilt. Die Wahlberechtigten wurden in drei Abteilungen/Klassen aufgeteilt, die jeweils ein Drittel der gesamten Steuersumme entrichteten, zahlenmäßig aber völlig ungleich besetzt waren. In der ersten Abteilung befanden sich die wenigen Höchstbesteuerten (1913: 4,4 % der Wahlberechtigten), in der zweiten Klassen waren wenige Bürger mit höherem Steueraufkommen (15,8 %) zusammengefasst, in der dritten Klasse die Masse der übrigen Wähler (79,8 %), auch diejenigen, die keine Steuern zahlten. Jede Abteilung wählte die gleiche Zahl von Wahlmännern. Die Stimmabgabe war offen. Die Wahlmänner traten auf Wahlkreisebene zusammen, um den Abgeordneten zu wählen. Sie waren dabei an Weisungen der Urwähler nicht gebunden. (Vgl. J. Raschke, Wie wählen wir morgen?, 4. erg. Aufl., Berlin 1969, S. 8 f. und Th. Bartholomé/ L. Letsche, Wie gerecht sind Wahlverfahren? Tübingen 1990, S. 31 ff.) Ein Beispiel für "Wahlkreisgeometrie" liefert das Deutsche Reich bis 1918: Die Wahlkreiseinteilung erfolgte auf der Grundlage einer Volkszählung von 1864. Auf je 100.000 Einwohner sollte ein Abgeordneter kommen, jedem Land stand mindestens ein Abgeordneter zu. Trotz starker Bevölkerungszunahme in den Städten und Industriebezirken wurde die Wahlkreiseinteilung nicht geändert. 1912 kam z.B. in Schaumburg-Lippe ein Abgeordneter auf 10 709 Wähler, im Wahlkreis Berlin-Nord-Nordwest aber auf 219 782 Wähler. (aus: J. Raschke: Wie wählen wir morgen? 4. erg. Aufl., Berlin 1969, S. 9.) Aus Ostpreußen wird folgende Anekdote berichtet: Vor der Wahl versammelte der Gutsherr das Gesinde des Wahlkreises um sich. "Und dass mir keine rote (d.h. SPD-)Stimme dabei ist! Ist bei der Auszählung keine rote Stimme dabei, dann gibt´s Freibier für alle!" Der Gutsherr konnte sich bei offener Abstimmung am Wahltage davon überzeugen, dass niemand SPD gewählt hatte. Da er nicht gewillt war, Freibier auszuschenken, gab er schließlich selbst die "rote Stimme" ab ...(aus: Informationen zu politischen Bildung 135: Bundestagswahl 1969, Bonn 1969, S. 7.) In Südafrika galt bis April 1994 gemäß der Verfassung von 1984 ein Dreiklassenwahlrecht, das getrennte Wahlen der Weißen, Mischlinge und Inder für die drei ebenfalls nach Rassen getrennten Kammern des Palaments vorsah: Die Weißen wählten das House of Assembly (178 Mitglieder), die Mischlinge das House of Representatives (85 Mitglieder) und die Inder das House of Delegates (45 Mitglieder). Mit der neuen Verfassung wurde das allgemeine Wahlrecht in Südafrika eingeführt. Die schwarze Bevölkerungsmehrheit war im südafrikanischen Parlament nicht vertreten. M 02.11 USA: Gleiches Wahlrecht für alle? Unstimmigkeiten in Florida bei der US-Präsidentschaftswahl 2000 George W. Bush mag keine Handauszählungen von Wählervoten, zumindest nicht in Florida. Der Grund liegt auf der Hand: die Gefahr, in diesem Bundestaat seinen ausgesprochen knappen Vorsprung von 537 (bei insgesamt 6 Millionen abgegebenen) Stimmen auf AI Göre durch recount der ca. 43 000 undervotes zu verlieren. Bei den undervotes waren die Zählmaschinen oder die Wahlauszähler außerstande festzustellen, wem die Stimme gelten sollte. "Unterzählt" wurde vor allem in jenen Wahlbezirken, in denen das "Lochkartensystem" zum Einsatz kam. Dort mussten die Wählerinnen und Wähler Geräte benutzen, die Löcher in die Stimmzetteln stanzen. Zählmaschinen übernahmen die Auswertung der Stimmzettel. Dieses System ist fehleranfällig die Maschinen zählen nicht alle Stimmzettel, vor allem dann nicht, wenn die beim Stanzen entstehenden Schnipsel nicht ganz herausgefallen sind. Selbst Texas beschloss kürzlich ein - von Gouverneur George W. Bush unterzeichnetes - Gesetz, das bei knappen Wahlresultaten Nachzahlungen von Hand vorsieht. Der Mensch ist in diesem Fall der Maschine überlegen. Nach Angaben des "Miami Herald" (2. Dezember 2000) sind in Florida in den 24 Counties, in denen das Lochkartensystem zur Anwendung kam, 3,9 % der Stimmen nicht gezählt worden, in den anderen 43 Kreisen mit "optisch lesbaren" Stimmzetteln hingegen nur 1,4 %. Und wie es der Zufall will: Lochkarten wurden überproportional in den mehrheitlich demokratisch ausgerichteten Counties verwendet, zum Beispiel in Miami-Dade, wo 9 000 Stimmen aus der Zählung herausfielen. In der angelaufenen Nachzählung hatte Gore vor dem höchstrichterlichen Stopp beträchtlich aufgeholt; Bushs Vorsprung betrug nur noch 154 Stimmen. Kein Ausnahmefall Gar nicht in Betracht gezogen wurden die berüchtigten "Schmetterlingsstimmzettel" in Palm Beach, die knapp 20 000 Wähler doppelt gestanzt oder vermutlich irrtümlicherweise statt für Gore zugunsten des erzkonservativen Pat Buchanan gelocht hatten. Auf richterliche Anweisung gab es auch kein Nachspiel bei "Unregelmäßigkeiten" in Seminole und Martin County. Dort hatten republikanische Funktionäre fehlerhafte oder unvollständige Briefwahlanträge von republikanischen Wählern korrigiert oder ergänzt. Vertretern der Demokratischen Partei blieb der Zugang zu entsprechenden Anträgen ihrer Wähler verwehrt. Bush dürfte so hunderte Stimmen dazubekommen haben. Bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen werden etwa 2 % der Stimmen aus verschiedenen Gründen nicht gezählt. Sie sind fehlerhaft, missverständlich oder die Zählmaschinen haben sie ausgesondert. Bei etwa 30 % der Stimmen kommen nach Angaben des Committee for the Study of the American Electorate Stanzmaschinen zum Einsatz. Florida war also kein Ausnahmefall. Doch was dort passiert (oder unterbleibt), entscheidet darüber, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. aus: Konrad Ege: Gleiches Wahlrecht für alle? Unstimmigkeiten in Florida bei der USPräsidentschaftswahl 2000, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 1/2001, S. 35. M 02.15 Wahlrecht schon mit 16 Jahren? Pro: Margit Gerste Seit 1970 dürfen auch 18-jährige wählen. Würde heute noch jemand diese sozialliberale Reform für unsinnig oder gar für gefährlich halten? Bestimmt nicht. Und doch werden in der heutigen Diskussion um eine erneute Reform des Wahlrechts alle Argumente von damals wieder hervorgekramt. Es heißt: 16- bis 17-jährige seien politisch unreif, noch nicht fähig, ein vernünftiges Urteil zu fällen in einer Welt, die immer komplizierter werde; sie könnten Parteien nicht unterscheiden, sie seien wirtschaftlich unselbständig, trügen noch keinerlei Verantwortung; sie neigten womöglich extremen Parteien zu. Ein besonders beliebtes Gegenargument war damals und ist heute: Wer wählen will, der muss auch volljährig sein und den muss auch, wenn er straffällig wird, die volle Härte des Gesetzes treffen können. Dieses Junktim hat das Parlament schon 1970 verneint. Es hat erst fünf Jahre später das Alter für die zivilrechtliche Mündigkeit herabgesetzt, von 21 auf 18 Jahre. Das Recht für Jugendliche bis 18 Jahre können Richter auch auf Heranwachsende bis 21 anwenden. Und überhaupt: Werden Erwachsene, werden "reife" Menschen für ihre Stimme etwa haftbar gemacht? Zum Glück nicht. Für das Wahlalter, also die gleichwertige Integration in die Demokratie und ihre Entscheidungsprozesse, ist vor allem eine politische Frage ausschlaggebend: Haben Jugendliche, also auch 16- und 17-jährige, bestimmte existentielle Interessen, von denen sie zu Recht behaupten, dass Erwachsene sie nur unzulänglich oder gar nicht vertreten? Das kann man wohl sagen! Von den Jungen selber werden immer wieder drei Politikbereiche genannt, die ihr Leben, ihre Zukunft in ganz besonderem Maße bestimmen: Umwelt, Bildung und die zunehmende Überalterung der Gesellschaft, in der sie sich immer stärker in eine Minderheitenposition gedrängt sehen. (...) Dass 16- und 17-jährige Jungwähler nicht zu fragwürdigen Eskapaden neigen, haben sie bei der Kommunalwahl in Niedersachsen bewiesen. Demokratie als Herrschaft des Volkes muss den Ausschluss aus dem Wahlgeschehen sorgfältigst begründen. Das war und ist in ihrer Geschichte nicht die Regel; statt dessen: Vorurteile, Diskriminierung und das Konservieren von Privilegien. (...) Die Wahlrechtsreform von 1970 entsprach nicht nur der Programmatik Willy Brandts - "mehr Demokratie wagen"-; sie sollte die revoltierende Jugend integrieren. Später trat sie dann den "Marsch durch die Institutionen" an. Heute gibt es das umgekehrte Problem, und es ist nicht weniger dramatisch. Es interessiert sich doch niemand für uns, klagen Jugendliche und: Brauchen die uns überhaupt? Resignation und Entfremdung machen sich breit. Der Streit um das Wahlalter wäre nicht so wichtig, wenn es nur um die Entdeckung ginge: Jugendliche werden heute zwei Jahre früher erwachsen. Politisch brisant wird er, weil die Kluft zwischen allen Parteien und Jugendlichen mehr oder weniger riesig geworden ist. Wer aber die partizipatorische Demokratie wirklich am Leben erhalten und die Parteienwelt bewahren will, der muss Konsequenzen daraus ziehen, dass junge Leute ihr immer fremder werden. Eine gründliche Korrektur muss her, das Wahlalter 16 wäre ein Angebot und nur der Beginn. Contra: Hans Schueler Wo immer der Gesetzgeber Rechte, Pflichten oder Verantwortlichkeiten eines Menschen von dessen Lebensalter abhängig macht, unternimmt er einen Akt der Willkür. Das ist im Grunde unvermeidlich, weil das Gesetz Biographien dem Zwang formaler Gleichheit unterwerfen muss. (...) Willkürliche Altersbegrenzungen oder Jugendermächtigungen sind nicht zu umgehen; sie sollen nur eine gewisse Rationalität des Ermessens der damit betrauten Politiker und Parlamente für sich haben. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn der Gesetzgeber halbe Kinder wählen lässt, müssen nicht sie, sondern er gute Gründe dafür geltend machen. Bei der jetzt erneut in die Diskussion geratenen Herabsetzung der Wahlaltersgrenze und sei es zunächst nur für Kommunalwahlen - mangelt es daran aber ganz und gar. (...) Horst Eylmann, Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag, hat in anderem Zusammenhang ganz allgemein auf die "Tendenz zur Bagatellisierung des Wahlakts" hingewiesen. Sie ist unverkennbar. Wenn Kinder wählen dürfen, weil sich die Alten davon einen Stimmgewinn erhoffen, kann es auch erlaubt sein, dass Väter und/oder Mütter so viele Kreuze auf ihrem Stimmzettel machen, wie die Kopfzahl ihres Nachwuchses zulässt. Wahlrechtsreformer verlangen das inzwischen ebenso wie ein Kinderwahlrecht auf den richtigen Spielplatz. Aber weshalb soll man sich noch darüber aufregen, dass ein Jungspund das Wahlrecht bekommt, obwohl er aus Altersgründen noch nicht strafmündig ist? (aus: Die Zeit 45/1996)