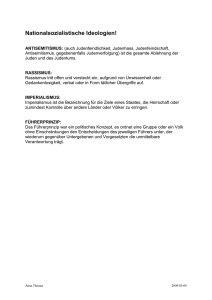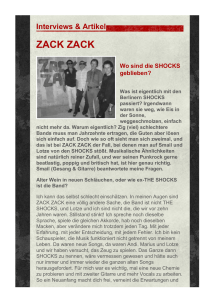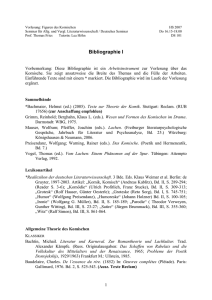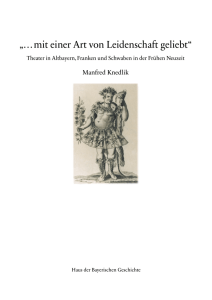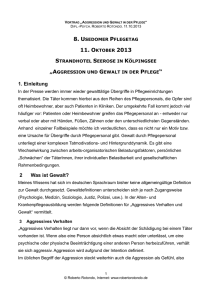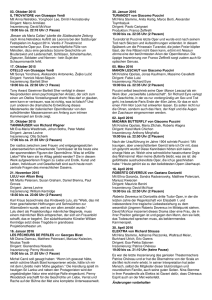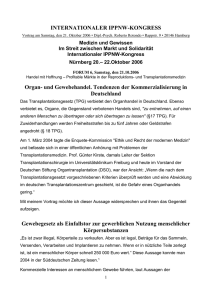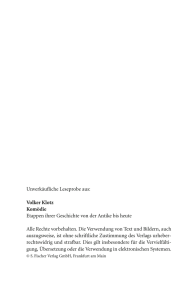Der weltfremde Kobold
Werbung
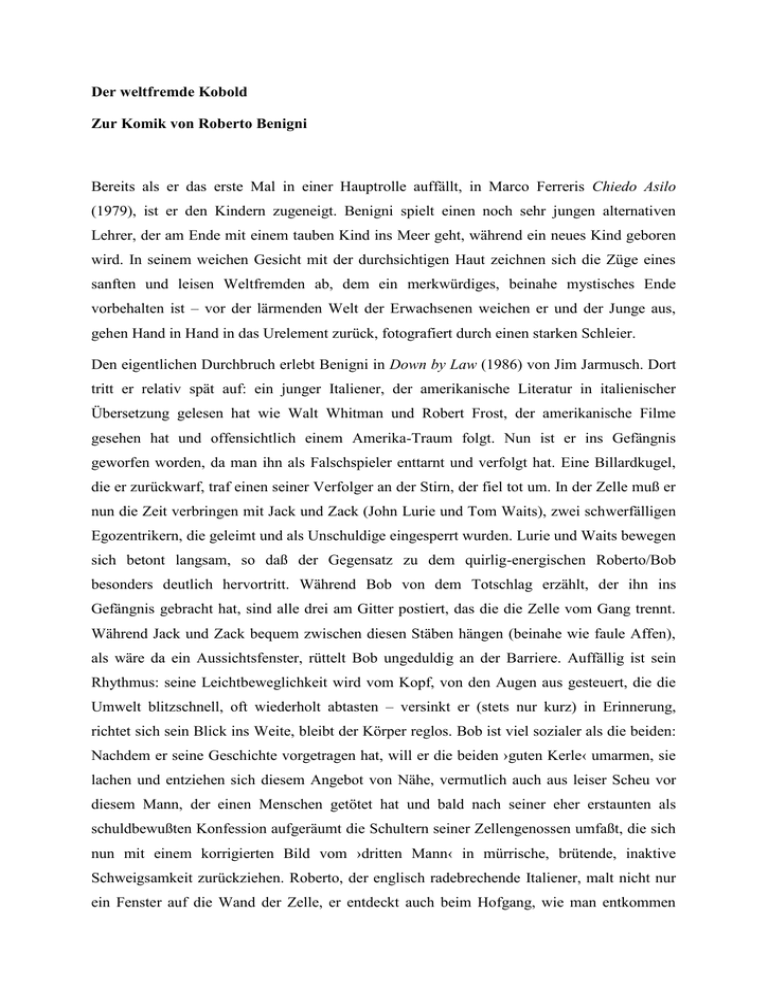
Der weltfremde Kobold Zur Komik von Roberto Benigni Bereits als er das erste Mal in einer Hauptrolle auffällt, in Marco Ferreris Chiedo Asilo (1979), ist er den Kindern zugeneigt. Benigni spielt einen noch sehr jungen alternativen Lehrer, der am Ende mit einem tauben Kind ins Meer geht, während ein neues Kind geboren wird. In seinem weichen Gesicht mit der durchsichtigen Haut zeichnen sich die Züge eines sanften und leisen Weltfremden ab, dem ein merkwürdiges, beinahe mystisches Ende vorbehalten ist – vor der lärmenden Welt der Erwachsenen weichen er und der Junge aus, gehen Hand in Hand in das Urelement zurück, fotografiert durch einen starken Schleier. Den eigentlichen Durchbruch erlebt Benigni in Down by Law (1986) von Jim Jarmusch. Dort tritt er relativ spät auf: ein junger Italiener, der amerikanische Literatur in italienischer Übersetzung gelesen hat wie Walt Whitman und Robert Frost, der amerikanische Filme gesehen hat und offensichtlich einem Amerika-Traum folgt. Nun ist er ins Gefängnis geworfen worden, da man ihn als Falschspieler enttarnt und verfolgt hat. Eine Billardkugel, die er zurückwarf, traf einen seiner Verfolger an der Stirn, der fiel tot um. In der Zelle muß er nun die Zeit verbringen mit Jack und Zack (John Lurie und Tom Waits), zwei schwerfälligen Egozentrikern, die geleimt und als Unschuldige eingesperrt wurden. Lurie und Waits bewegen sich betont langsam, so daß der Gegensatz zu dem quirlig-energischen Roberto/Bob besonders deutlich hervortritt. Während Bob von dem Totschlag erzählt, der ihn ins Gefängnis gebracht hat, sind alle drei am Gitter postiert, das die die Zelle vom Gang trennt. Während Jack und Zack bequem zwischen diesen Stäben hängen (beinahe wie faule Affen), als wäre da ein Aussichtsfenster, rüttelt Bob ungeduldig an der Barriere. Auffällig ist sein Rhythmus: seine Leichtbeweglichkeit wird vom Kopf, von den Augen aus gesteuert, die die Umwelt blitzschnell, oft wiederholt abtasten – versinkt er (stets nur kurz) in Erinnerung, richtet sich sein Blick ins Weite, bleibt der Körper reglos. Bob ist viel sozialer als die beiden: Nachdem er seine Geschichte vorgetragen hat, will er die beiden ›guten Kerle‹ umarmen, sie lachen und entziehen sich diesem Angebot von Nähe, vermutlich auch aus leiser Scheu vor diesem Mann, der einen Menschen getötet hat und bald nach seiner eher erstaunten als schuldbewußten Konfession aufgeräumt die Schultern seiner Zellengenossen umfaßt, die sich nun mit einem korrigierten Bild vom ›dritten Mann‹ in mürrische, brütende, inaktive Schweigsamkeit zurückziehen. Roberto, der englisch radebrechende Italiener, malt nicht nur ein Fenster auf die Wand der Zelle, er entdeckt auch beim Hofgang, wie man entkommen könnte – und so geschieht’s. Auf der Flucht wird er beinahe zweimal allein gelassen von seinen amerikanischen Gesellen. Immerhin: er, der nicht schwimmen kann und in den Sümpfen von Louisiana deshalb auf Hilfe und auf Boote angewiesen ist, ihm gelingt es, einen Hasen zu fangen und zu braten – währenddessen erzählt er von seiner Mutter, die Hasen freundlich liebkost, bevor sie sie brutal ins Genick schlägt. Daran schließt sich eine murmelnde Reflexion Bobs über seine merkwürdige Mutter und seine Familie an (wobei übrigens Benigni die realen Namen seiner Familie und seiner Schwestern nennt). Als die drei auf einer einsamen Landstraße an ein Haus kommen, geht Roberto ohne zu zögern hinein und bleibt vorerst verschwunden – die beiden anderen folgen furchtsam und vorsichtig und entdecken ein Idyll. In dem Haus wohnt eine junge Italienerin (Nicoletta Braschi, die Lebensgefährtin und Ehefrau von Roberto Benigni, die in all seinen Filme mitspielt). Zwischen der Italienerin und Roberto entwickelt sich schnell und kurzerhand eine Liebesgeschichte, Roberto bleibt als Beschützer in der einsamen Wirtschaft zurück, während die beiden anderen den Weg ins Freie suchen, jeder für sich. Benigni gelang in Jarmuschs Film das Kunststück, einen äußerst einprägsamen komischen Charakter zu entwerfen, der ihn nicht nur als Komödienspieler, der das richtige Timing hat und das entsprechende Temperament, sondern auch als leibhaftigen Komödianten, als ›funny bone‹ auszeichnet. Schon die Haare, die in der Mitte emporstehen wie bei Wilhelm Buschs Max und sich zur Seite wegsträuben, links und rechts, lassen ihn wie einen Irrwisch erscheinen. Hinzu kommt kontrollierte Beweglichkeit des mageren Körpers, vor allem des Kopfes mit den eingefallenen Wangen, der sich blitzschnell hin- und herwendet und die Situation erkundet – das wichtigste ist allerdings die an Begeisterung reichende gesellige Fröhlichkeit, die dem Umstand gilt, daß er nicht allein auf der Welt ist: Das trompetenartig hinausgestoßene »Jack, Zack, my friends«, mit dem er gleichsam die beiden muffelnden Sonderlinge in einen partnerschaftlichen Verband eingemeindet, der ›Menschheit‹ zurückgewinnt, haftet auch deshalb in Erinnerung, weil die elementare Stimme der franziskanisch-asketischen Erscheinung widerspricht. Auch die konzentrierte erotische Zugewandtheit, die er seiner Partnerin beim langen gemeinsamen Tanz entgegenbringt, zeugt von einem immer wieder überschäumenden, anscheinend unzerstörbaren ›élan vital‹ einer Figur, die Gesellschaft braucht. Dabei, das wird im Gefängnis wie auf der Flucht erkennbar, raubt ihm dieser Lebensmut nicht die Sensibilität – er zeigt leichtes Nachbeben, als er von seinem Totschlag berichtet - , sondern er erlaubt ihm zusätzlich eine Art weltüberlegenes Spiel in Notsituationen: So hat Bob Zeit, auf der oberen Pritsche sitzend und mit den Beinen baumelnd, Zack interessiert nach seiner Meinung zu Walt Whitman und später in einer 2 ähnlichen Situation nach Robert Frost zu fragen, wobei er bei dem eher zarten und hinter der verhärteten Außenschicht durchaus empfindlichen Zack (der ein DJ sein soll) damit rechnen kann, daß der sowohl Walt Whitman und Robert Frost kennt - aber nicht auf die Idee käme, mitten in der beklemmenden Lage, in der alle drei sind, über Dichtung zu reden. Nach dem Erfolg von Down by Law spielt Benigni vornehmlich in italienischen Produktionen. Dabei wird seine Komik drastischer, sein Bewegungsrepertoire exzentrischer, ohne daß sich das Liebenswürdige, immer wieder Schamhafte seiner Charaktere ganz verlieren würde. In Il piccolo diavolo (Ein himmlischer Teufel, 1988) führt er bereits selbst Regie und spielt an der Seite von Walter Matthau, der einen Priester darstellt, einen Teufel, der der Hölle entkommen und zurück auf die Erde geraten ist. Er kehrt in diese Welt zurück, indem er in eine rundliche ältere Dame namens Giuditta schlüpft, also übernimmt er deren Namen, sobald er von diesem Körper befreit wird. Der Teufel Benignis ist vor allem durch das beinahe fassungslose Staunen ausgezeichnet, das ihn bei der Begegnung mit irdischen Verhältnissen immer wieder überfällt: Musik übt einen unwiderstehlichen Zauber auf ihn aus, er hört sie früher als der schon leicht gealterte Pater Maurice an seiner Seite, dem Phänomen der Liebe steht er arglos verblüfft gegenüber – als er zum ersten Mal die attraktive Nina sieht, eine Teufelin, die ihn heimholen will (Nicoletta Braschi), verharrt er in blöder Starre, selbst das hingerissene Grinsen in seinem Gesicht bleibt fixiert, während er unbewegt zuschaut, wie die Frau, die ihn entzückt, einen schweren Koffer über Bahnsteig und Gleise schleppt. Er kennt nicht die Zeremonien des Miteinanders von Frauen und Männern, erscheint deshalb als Tölpel, indes als faszinierter Tölpel. Als eines der wichtigsten Mittel, schon in Down by Law fiel dies auf, stabilisiert sich nun die Stimme Benignis: Er artikuliert kräftig und laut, seinem impulsiven und sanguinischen Temperament entsprechend, das heißt aber, es fehlen die leisen Abschattierungen der vorsichtigen oder behutsamen Artikulation – gerade dieses Heraustrompeten, ebenso unbedacht wie unbedenklich, läßt ihn die Riten der situationsangepaßten Konversation ständig ignorieren. Wenn dann noch von heiklen Themen wie Sex gesprochen wird, deren ›Delikatesse‹ er als Naiver gar nicht versteht, und er über alle Ziererei und die verbogene Metaphorik der prüden Anspielung mit der Stentor-Stimme des arglosen Toren hinauskräht, demontiert er die moralische Phrasealogie und zugleich betulichidealisierende Art, sie zu artikulieren. Also ist der komische Höhepunkt ein Essen, bei dem würdige, ältere und jüngere Geistliche mit einem ergrauten und feinsinnigen Ehepaar zusammensitzen. Mißverständnisse über körperliche Liebe und die Bemerkung Giudittas/Benignis, daß er in den Leib einer zufällig gegenwärtigen Frau hineingeschossen sei, um auf dieser Welt anzukommen, stürzen die Anwesenden in schockiert-pikierte 3 Sprachlosigkeit und den Freund, den Giuditta auf Erden gefunden hat, Pater Maurice/Matthau in tiefe Verzweiflung, die ihn immer weiter trinken läßt, so daß er am Ende des Gastmahls fast erheitert-betrunken auf den monströsen Störenfried reagiert. Federico Fellini holt Benigni für seinen letzten Film, den er gedreht hat: La voce della luna (Die Stimme des Mondes, 1989). Benigni figuriert hier als romantischer mondsüchtiger Wanderer, bleich geschminkt, traurig weltfremd: ein zarter Narr, der wenig versteht und durch die künstliche Welt der Fabel hindurchirrt. Diese Sentimentalisierung der Figur knüpft an Ferreris Chiedo Asilo an, überspringt die antithetische Entwicklung ins Drastische, die Benigni vorher und danach wieder in seinen Filmen anstrebt. In der römischen Episode von Jim Jarmuschs Night on Earth (1991) darf er als römischer Taxichauffeur wieder ›diabolisch‹ agieren. Während einer nächtlichen Autofahrt erzählt Benigni von seinen erotischen Erlebnissen, mit Schafen und Menschen, während er in abenteuerlicher Fahrt durch die leere Stadt saust. Die lustvolle Erinnerung steigert sich so sehr, daß Benigni am Schluß wirklich beide Hände braucht, um den ins Gedächtnis eingebrannten üppigen weiblichen Formen seiner Liebschaft auch gestisch Umriß zu verleihen, während er in mimetischer Vergegenwärtigung auf seinem Sitz aufgeregt hin und her rückt: Komik der schamlosen Nachahmung, des geradezu archaischen Verstoßes gegen das Diktat der Sublimierung, das in der Zivilisation und erst recht in der kirchlichen Gemeinde gilt. Denn sein Fahrgast ist ein katholischer Würdenträger, ein Bischof, der diese Form der Ohrenbeichte, vor allem die Intensität der wollüstigen Reminiszenzen, gar nicht gut verträgt. Ein tödlicher Herzanfall ereilt ihn – fast ein schauriger Witz. Der Taxifahrer arrangiert die Leiche auf einer Bank: Verlegenheitslösung eines Komödianten der noch nicht länger beim Tod verweilen will. Auf zwei weitere Filme, die Benigni in den neunziger Jahren auch als Regisseur verantwortet, gehe ich nur zögernd ein. In Johnny Stecchino (1991) agiert er in einer Doppelrolle, einmal als schwarzbehüteter Mafioso, der seine zwangsneurotische Prägung nicht verbergen kann: Er haßt die Küsse seiner Geliebten, putzt sich ständig ab, ein Narziß mit Furcht vor ›Schmutz‹, ausgerechnet in diesem Metier. Zum anderen spielt er einen harmlosen Schulbusfahrer für geistig Behinderte, den Doppelgänger des Mafioso, der - wie einst in Chiedo Asilo – sich mit den Schwächsten in dieser Gesellschaft anfreundet. Ironisch ist der Transfer der Erfahrungen, die der Schulbusfahrer, von der Frau des Mafioso entdeckt, auf die neue Klientel im kriminellen Milieu überträgt: So übt er mit den Behinderten ein Tierstimmenkonzert ein und wiederholt dasselbe später mit den Gangstern. Immerhin erweist er sich – und das unterscheidet ihn von seinem finsteren alter ego - als Verteidiger der Wehrlosen, übrigens auch der Frauen. Leider verliert der Film seine Kraft durch einfältige Scherze (der brave Held 4 klaut Bananen und glaubt deshalb in Palermo verfolgt zu werden) und durch die Verschiebung des Gangstermilieus ins Lächerliche und Karikaturistische. Deutlichere Realitätskoordinaten sind dem folgenden Film Il Mostro (1994) eingezogen. Benigni tritt wieder einmal als argloser Einzeller auf, der Ärger mit seinem Hausverwalter hat und durch Gelegenheitsarbeiten ein wenig Geld verdient. Dank seines sonderbaren und sozial wenig kontrollierten Verhaltens kommt er ins Visier der Polizei, die ihn als lang gesuchten Sexual- und Serienmörder zu identifizieren glaubt. In der Tat hält die versteckte Kamera der Behörde Momente fest, die ihn als Ungeheuer entlarven sollen – diese Passagen sind typische Beispiele dafür, wie sehr der Augenschein trügen kann. In einem Café beispielsweise stößt Benigni aus Versehen mit einem anderen Mann zusammen, dessen herabfallende Zigarettenkippe hinter Benignis Hosenbund verschwindet. Auf der Straße bleibt Benigni verzückt stehen, wieder einmal, weil er einer üppigen jungen Frau dabei zusieht, wie sie ausgestreute Lebensmittel in ihre Tasche zurückstopft und dabei ihr Hinterteil in der Luft umherkreisen läßt. Plötzlich merkt er, daß die brennende Zigarette höchst unangenehme Wirkung tut, alle folgenden Handlungen sind aufs Äußerste zweideutig. Er klopft auf seine Hose und würgt an seinem Hosenlatz, gießt Mineralwasser hinein und zeigt Anzeichen spürbarer Erleichterung – aus polizeilicher Perspektive muß dies als schamlose Vorführung der Körperreaktionen eines ungehemmten Triebtäters erscheinen. Eine Polizistin wird auf ihn angesetzt, die ihn verführen soll (Nicoletta Braschi) und das gesamte Repertoire lasziver Posen durchprobiert – ohne Erfolg, denn der schamhafte und arglose Held ist eher verstört von diesem Verhalten ›culo a face‹ und versucht, sich abzulenken. Bevor sich am Ende der Irrtum auflöst, Weiblein und Männlein friedlich zueinander finden, und auf karikaturistische Weise in Hockstellung auf der einsamen Straße in den Sonnenuntergang davonhumpeln wie einst Chaplin und Goddard am Ende von Modern Times, schon durch dieses ›freakhafte‹ Verhalten das auf den aufrechten Gang verzichtet, als Außenseiter stigmatisiert, erlebt die Figur Benignis noch die Verfolgung durch einen lynchbereites Publikum, das ihn fälschlicherweise für das Monster hält. Dies scheint der wesentliche Punkt an dem Film Il Mostro zu sein, der längeres Nachdenken verdient: Die manchmal einfältige Komik absonderlicher, sogar exzentrischer Lebensführung und scheinbar obszönen Verhaltens, selbst auf der Straße, vor den Augen der Öffentlichkeit, kann umkippen in das Bedrohliche einer Jagd auf Nicht-Angepaßte, der Kobold kann zum Sündenbock werden, zum Opfer der mörderischen Meute von Normalmenschen. Virtuoser als bisher exekutiert Benigni in diesem Film seine Körperwendigkeit: Mit einem blitzschnellen Sprung tauscht er ein Stück Gebäck in eine Kaffeetasse, die von einem Kellner rasch vorbeigetragen wird; scheinbar tollpatschig 5 reißt er im Fallen der vor ihm gehenden Polizistin das Höschen unter dem Minikleid hinunter bis auf die Knöchel - ein zweifellos ebenso derber Einfall wie die in der Hose quergestellte Taschenlampe, Bubenstücke, Pennäler-Clownerie, aber perfekt ausgeführt. Benigni knüpft damit an die präzise Artistik der großen Slapstick-Komödianten an, ohne sie ständig zu demonstrieren – die blitzschnelle Aktion bleibt für ihn ein beiläufiger ›lazzo‹, Nebenwerk des gelernten Komödianten. La vita è bella (1997) offenbart den reifsten Ausdruck von Benignis komischer Kunst: Wieder erleben wir den hingerissen Liebenden, der scheinbar wie ein tumber Tor zweimal auf die junge Frau fällt, die er zu begehren beginnt. Wieder erleben wir den unbotmäßigen Kobold, aber in einer eigentümlichen Wendung: Aus dem kleinen, mehr oder weniger den Teufel spielenden Sonderling ist eine furchtlose, unbestechliche, sogar verwegene Retterfigur geworden, der sich im faschistischen Italien selbst als verfolgter Jude nicht einschüchtern läßt. Wie nie zuvor strahlt diese Figur Benignis Lebenslust, Laune und Überlebenswillen aus – wobei die Metapher ›ausstrahlen‹ hier mit Überlegung gewählt worden ist. Daß sich Benignis feiner Physiognomie schon Altersspuren eingezeichnet haben, ist kaum zu bemerken, weil dieses Gesicht ständig lacht: aus dem Mund dringt laut, ungeniert, furchtlos eine vehemente Suada. Er starrt nicht mehr die Geliebte an, sondern begrüßt sie mit einem hinreißenden Enthusiasmus. Die rückhaltlose Bewunderung, der Glanz der Liebeserklärung in der Artikulation der einfachen Formel ›Buon giorno, principessa‹ wird niemand vergessen, der den Film gesehen hat. Man könnte von einer gewappneten Naivität sprechen, die sich hier kundtut, einer Fröhlichkeit, die sich durch Weltkenntnis nicht verbittern läßt. Als Benigni, im zweiten Teil des Films zum Vater geworden, seinem Sohn Giosuè das Wahnsystem des rassistischen Faschismus, das im Zweiten Weltkrieg auch Italien ereilt, erklären muß, ist nicht nur dieversatile Intelligenz zu bewundern, mit der er ständig QuasiErklärungen für das Ausgesperrtsein der Juden und später im KZ für den Terror findet, sondern auch die Promptheit, mit der ihm die Worte zur Rede zusammenschießen, nicht zuletzt die Zugeneigtheit, die ihn nie vergessen läßt, daß er einem vierjährigen Knaben die verrückte Welt zur vernünftigen Spielanlage zurechtrücken muß. Nie zuvor hat Tempo die Inszenierung und die Spielweise des Protagonisten so sehr bestimmt wie in La vita é bella: das Tempo der Rede, das Tempo der äußeren Bewegung. Benigni springt, läuft, hüpft, saust mit dem Fahrrad die engen Gassen von Arezzo hinab. Er ist fast hemmungslos in seinen Einfällen, die in großer Geschwindigkeit aufeinanderfolgen – ein Teil eher den banaleren Kabinettstückchen der Komikerpraxis zugehörig: Eier, die auf dem Kopf 6 des ›pompous ass‹, des Gegenspielers zerplatzen. Andere Pointen werden in doppelsinnige Szenen eingefügt, z.B. der Raub der Braut aus dem Verlobungsfest, als gehöre dies zum Ritual - mit Hilfe eines grün angemalten Pferdes, auf das Faschisten unsinnigerweise ›cavallo ebreo‹, hebräisches Pferd, geschrieben haben. Hier tritt Benigni auf wie ein Robin Hood, ein Ivanhoe, halb verklärt lächelnd, halb ironischer Spaßmacher in der Gestalt eines unerschrockenen ›Märchenprinzen‹, der längst kein Luftikus mehr ist. Benignis Übermittlung der barbarischen Lagerregeln, die er angeblich übersetzt, doch für den Sohn ins ›Humane umfunktioniert‹ (um einen Ausdruck Thomas Manns zu verwenden), haben den Charakter einer genialen Improvisation, die das gewalttätige Zerbrechen menschlicher Würde, die Unterwerfung des Individuums unter eine kalte und lebensverachtende Maschinerie, schier unverständlich für den wahren Menschen, auf fromme Weise in die Bedingungen und Vorschriften eines Kinderspiels ›umlügt‹. Ich finde es bewundernswürdig, daß sich Benigni in dieser Dolmetscherrolle nicht versteift, was ihn sonst auf die Dauer zu einem grotesken ›Verdrängungskünstler‹, wenngleich aus den besten Absichten, verwandeln würde, zu einer deformierten Narrenfigur – er gewinnt stattdessen zwei neue Dimensionen: (a) Er wird traurig, am allertraurigsten in der Szene mit dem deutschen Arzt, der den Namen des kämpferischen Aufklärers Lessing zu Unrecht trägt und in der Uniform selbst zum pathologischen Subjekt mutiert, der sich nicht mehr um den Schutz des Lebens kümmert, sondern nur um das Lösen kurioser Rätsel (Horst Buchholz ist eindrucksvoll als ›wahnsinniger‹ Arzt). Auch Benigni kann es die Sprache verschlagen, als er bei einem Spaziergang, das schlafende Kind im Arm, zuerst von den Wonnen der Alltäglichkeit träumend erzählt und plötzlich vor einem Hügel aus Schädeln und Knochen steht, Metapher des unfaßlichen Todes-Grauens. (b) Er zeigt sich rührend besorgt um seine Familie, wenngleich unbesorgt um die Folgen seines Tuns, als er in der Offizierskantine neben dem alten Grammophon eine Platte mit der Barcarole aus Jacques Offenbachs »Hoffmans Erzählungen« entdeckt (es ist zu vermuten, daß in keiner deutschen Offizierskantine des Dritten Reichs Musik dieses jüdischen Komponisten zu finden war), sie auflegt, den Klangtrichter zum offenen Fenster dreht und so eine musikalische Botschaft an seine geliebte Principessa richtet, quer über die dunklen Höfe und die kalten Schlafsäle dieser Zwangsanstalt. (c) Benigni ist am Ende auch energisch und zielbewußt - wieder aus Sorge und Fürsorge. Wenn er sich diesmal wie eine Frau verkleidet, dann nicht um mit Charlies Tante in Konkurrenz zu treten, sondern um unauffällig zu den Frauen zu stoßen und seine Geliebte zu suchen, alle zu warnen vor dem Abtransport. Das letzte Bild, das wir von ihm im Sinn 7 behalten, wird durch den Schlitz des kleinen Kastens fotografiert, in dem sich der kleine Giosuè versteckt hält, mit den Augen des Sohns also – der dort aushält, bis am nächsten Tag die amerikanischen Panzer um die Ecke biegen, die Befreier da sind. Weil Guido weiß, daß ihn sein Sohn sieht, will er ihm Mut machen: Mit weit ausgreifenden Arm und Beinbewegungen marschiert er ab, ein heiterer Hampalmann, der lacht wie ein Bajazzo, dem doch eher nach Weinen zumute ist, noch das Kopftuch umgebunden, das ihn als Frau erscheinen lassen sollte - so geht er zur Exekution, die für uns unsichtbar hinter einer Mauer vollzogen wird. Er ist im Schlußbild also nicht dabei, wenn das Kind die Mutter wiederfindet und jubelt, daß sie gesiegt hätten, wie der Papa das . vorausgesagt habe - Giosuè meint das Pseudospiel, das ihm suggeriert worden ist. Wir Zuschauer wissen, daß es noch ein Sieg anderer Art ist, sicherlich genauso groß, wie er für den Vierjährigen erscheinen mag. Sorge und Fürsorge, ich habe diese Begriffe in den letzten Sätzen öfter verwendet, komplettieren Benignis komische Ausdrucksnuancen um Spielarten des Tragischen. Vielleicht gehört diese Vervollständigung des spielerischen Reservoirs zur Figur des Komödianten per se – wieviele ›Hanswurste‹ haben in späteren Stadien ihrer Laufbahn in Theater- und Filmgeschichte abgrundtief verstörte Melancholiker gespielt (z.B. Michel Serrault)! Bei Benigni mag man diese Ausweitung des Rollenprofils in La vita é bella nicht unbedingt als neuerworbenes Repertoire bezeichnen, ist doch ein rührendes Moment, eine feine Sensibilität schon früh der Hauptfigur in Chiedo Asilo zu eigen. Fast will mir erscheinen, als sei das Lustspielhafte in einigen Produktionen der achtziger und neunziger Jahre nur Abweichung von der ursprünglich bereits vorhandenen Kombination aus Lustigkeit und Zartsinn, als habe das Koboldhafte nur vorübergehend das Sentimentalische (ich verwende den Begriff nicht in negativer Absicht). Gerade die Brücke zwischen Empfindsamkeit und Komik im Spiel Benignis macht das Unverwechselbare und Besondere seines filmischen Kunstcharakters aus. Ein letztes Beispiel für diese heikle, anderswo seltene und bei Benigni in La vita è bella oft zauberhaft funktionierende Chemie der unterschiedlichen Elemente möchte ich erwähnen. Guidos Freund erzählt ihm von Schopenhauer und der Kraft des Willens (die spezifische Auslegung im Film hat natürlich wenig mit Schopenhauers eigenen Ansichten zu tun). Worum geht es? Wenn man nur mit Handbewegungen etwas magisch beschwört, kann man auch ohne direkten Kontakt seinen Willen auf entfernte Personen ausüben. Als Guido, im Parterre sitzend – es wird »Hoffmanns Erzählungen« gespielt – , seine Principessa in einer Loge erspäht, bemüht er sich mit beschwörenden ›Fingerübungen‹, ihren Blick auf sich zu lenken. Bevor ihm dies am Ende auch gelingt, hat er indes die Aufmerksamkeit seiner 8 erfreuten Nachbarin gefunden. Der Effekt ist eingetreten, nur unbeabsichtigt doppelt: Die unbekannte Schöne und die bekannte Schöne wenden sich dem sehnsüchtig lockenden Mann freudig zu. Der Kobold ist zum Verführer geworden, mehr noch: zum magischen Verzauberer, der Weltfremde zum Weltkundigen, der diese mißratene Welt abwehrt und durch eine vorgeschobene private Harmoniesphäre den Blicken entzieht. Man kann weitere Schlußfolgerungen ziehen und in dieser strikten Bejahung des Familienglücks, verbunden mit der ebenso affektiven Verleugnung einer mehr oder weniger schlecht organisierten Außenwelt eine spezifisch italienische Reaktionsweise wiedererkennen. Auch in dem Umstand, daß das Vorspielen ungebrochenen Humors für die Augen der Kinder zur Pflicht (der Begriff ist schon zu preußisch), zum Auftrag eines sich sorgenden Komödianten gehört! Schließlich scheint mir ein unverkennbar italienisches Moment in der Komplexität des Komödianten Benigni zu liegen, daß er in fast allen Lebenslagen, wo nicht bestürzende Trauer am Platz ist, das frohgemut Provozierende eines lauten Dagegenredens, der sinnlichen Lust am Dasein nicht verliert - als Prophet unversiegbarer Lebensfreude. Henri Bergsons These, daß das Lachen anästhesiere, unempfindlich mache für den wahren Schrecken, gilt nicht für Benigni in La vita è bella. Das Lachen, das diese Figur begleitet, kann sich auf unnachahmliche Weise mit Einfühlung und ›Verständnisinnigkeit‹ vereinigen. Man muß weit zurück in der Filmgeschichte suchen, um dergleichen aufzufinden – bis zu Charlie Chaplins The Kid (1921) Thomas Koebner 9