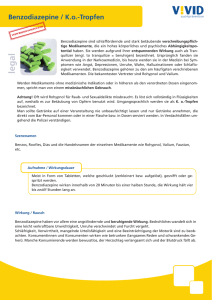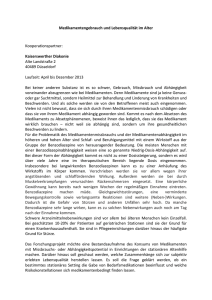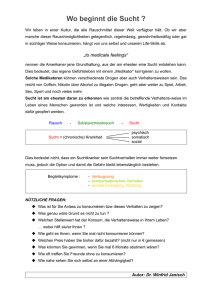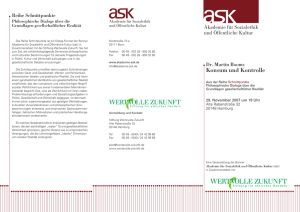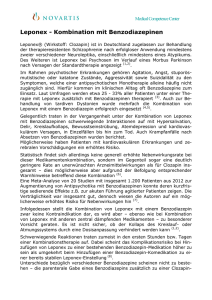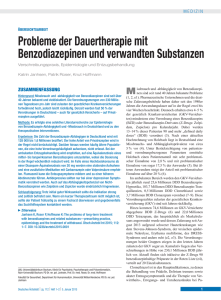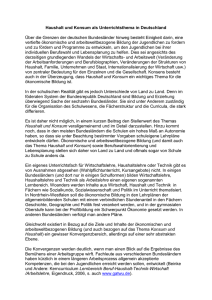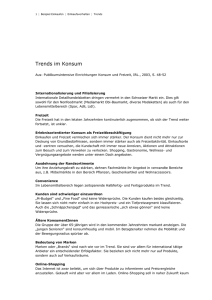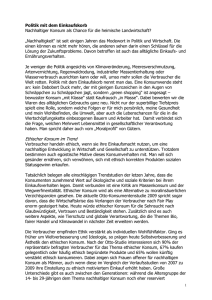Original Downloaden
Werbung

Blaue Lippen – blaue Venen Eine Studie zum Benzodiazepinkonsum bei den KlientInnen der akzeptierenden, niederschwelligen Drogenarbeit Englischer Titel: Blue Lips – Blue Veins. A Survey About the Benzodiazepin Use of Clients in the Low-threshold Drug Work Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts in Social Sciences der Fachhochschule Campus Wien Masterstudiengang Klinische Soziale Arbeit Vorgelegt von: Fabian Grümayer BA Personenkennzeichen: 1010534017 Erstbegutachter/in: FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Raab-Steiner Abgabetermin: 25.10.2012 Kurzfassung Deutsch Titel: Blaue Lippen – blaue Venen. Untertitel: Eine Studie zum Benzodiazepinkonsum bei den KlientInnen der akzeptierenden, niederschwelligen Drogenarbeit. Hintergrund: KlientInnen der akzeptierenden, niederschwelligen Drogenarbeit in Wien haben vielfältige Konsummuster von Benzodiazepinen. Der Titel „Blaue Lippen – blaue Venen“ soll auf zwei der in dieser Arbeit behandelten Konsumformen hinweisen: blaue Lippen entstehen durch das Lutschen oder im Mund behalten der Tablette und blaue Venen stehen sinnbildlich für den intravenösen Konsum von Benzodiazepinen. Einige dieser Applikationsarten stellen ein hohes Risiko für die Gesundheit dar, abhängig unter anderem von der gewählten Konsumform, Dosierung und von der Einnahme weiterer Substanzen wie Alkohol und Opiaten. Ziele: In dieser Arbeit sollen die Konsummuster von Benzodiazepinen von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit dargestellt werden. Dabei werden im speziellen die gesundheitsgefährdenden Konsummuster betrachtet und versucht deren Verbreitung zu bestimmen. Außerdem sollen die momentanen Ursachen des Konsums ermittelt werden. Soweit als möglich und sinnvoll sollen Zusammenhänge zu soziodemographischen Daten hergestellt werden. Methoden: Für diese Forschungsarbeit wurde eine quantitative Methodik gewählt. Hypothesen sind aufgrund von Literaturrecherche erstellt worden. Die Datenerhebung hat mittels standardisiertem Fragebogen stattgefunden. Mit einem Umfang der Stichprobe von n=100 ist die Erhebung beendet worden. Die statistische Analyse ist mit SPSS 19 durchgeführt worden. Resultate: Es konnte gezeigt werden, dass risikoarme Konsummuster überwiegen. Nicht außer Acht zu lassen sind ein gewisser Anteil an KlientInnen, die risikoreichen Konsummustern zugeneigt sind: intravenöser Konsum wird immer wieder angewendet und Benzodiazepinen weit überdosiert und mit Alkohol und Opiaten kombiniert. Es werden überwiegend schnell anflutende Benzodiazepine wie Flunitrazepam konsumiert, gefolgt von Oxazepam. Bei dem Medikament Somnubene® hat die Analyse der Daten eine häufige Verwendung von Dosen über der medizinisch definierten Grenzmenge, bei unregelmäßig konsumierenden Personen ergeben. Neben der Sicherheit beim Konsum sind es die beruhigenden, angstlösenden und entspannenden Effekte, die als Grund für den Benzodiazepinkonsum die meiste Zustimmung von den KlientInnen bekommen 2 haben. Auch die berauschende Wirkung wird als momentane Ursache des Benzodiazepinkonsums bestätigt. Konsequenzen für die Praxis: KonsumentInnen von Benzodiazepinen müssen auf das erhöhte Risiko für ihre Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Zwar konsumieren die meisten Personen gesundheitsschonend, es können aber bestimmte riskante Konsummuster identifiziert werden. Das ist der intravenöse Konsum von Benzodiazepinen, der unregelmäßige Konsum von hohen Dosen und das kombinieren mit Alkohol oder Opiaten. Klinische Soziale Arbeit muss dieses riskante Verhalten im Rahmen der Safer Use Beratung in der niederschwelligen Drogenarbeit ansprechen, um die gesundheitsschonenden Konsummuster weiter zu stärken. 3 Abstract English Title: Blue Lips – Blue Veins. Subtitle: A Survey on the Benzodiazepin Use of Clients in the Low-threshold Drug Work. Background: Clients of the low-threshold drugwork in Vienna have a manifold of consumption patterns of benzodiazepines. The title „Blue Lips – Blue Veins“ refers to the two methods of consumption that are delt with in this survey: „blue lips“ are a result of sucking on or keeping the tablet in the mouth. „Blue veins“ allegorically represents the intravenous consumption of benzodiazepins. Some of the application patterns are a high risk for health, depending on the chosen way of use, dosage and the ingestion of other substances, such as alcohol and/or opiates. Methods: For this survey a quantitative method was appropriate. Hypotheses have been created based on literature research. The assessment took place with a standardized questionaire. After the sample size reached n=100, the inquiry was completed. The statistical analysis was calculated with SPSS 19. Results: The statistical analasys shows that low- risk consumption patterns prevail. Not to be disregarded are a section of clients that are attached to high risk consumption patterns: intravenous consumption is repeatedly observed, intake of benzodiazepines is vastly overdosed and combined with alcohol and opiates. Mainly fast-acting benzodiazepines such as flunitrazepam are used, followed by oxazepam. Analysis of data showed that sporadic users of the medication Somnubene® are likely to dose above the medically defined maximum. Besides the integrity of the product being used (medication in its original packaging contains no impurities), the sedative, anxiolytic and relaxing effects, got the most approval from the clients. Also the intoxicating effects are confirmed as a current cause of benzodiazepine use. Conclusion: Users of benzodiazepines have to have their attention drawn to the eventual high risk for their health. Even though most persons use benzodiazepines in a low- risk way, dangerous consumption patterns can be identified. That is the intravenous use of benzodiazepines, the irregular use in high dosages and the combination with alcohol and/or opiates. Clinical social work has to deal with for the purpose of Safer Use counselling in the low- theshold drug work to strengthen the lowrisk consumption patterns. 4 Erklärung Ich erkläre, dass die vorliegende Diplomarbeit/Masterarbeit von mir selbst verfasst wurde und ich keine anderen als die angeführten Behelfe verwendet bzw. mich auch sonst keiner unerlaubter Hilfe bedient habe. Ich versichere, dass ich diese Diplomarbeit/Masterarbeit bisher weder im In- noch im Ausland (einer Beurteilerin/einem Beurteiler zur Begutachtung) in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. Weiters versichere ich, dass die von mir eingereichten Exemplare (ausgedruckt und elektronisch) identisch sind. Datum: ................................ Unterschrift: ........................................................... 5 Inhaltsverzeichnis Kurzfassung Deutsch ......................................................................................2 Abstract English ...............................................................................................4 Erklärung ..........................................................................................................5 Inhaltsverzeichnis ............................................................................................6 1 Erkenntnisinteresse ......................................................................................9 2 Problemstellung .......................................................................................... 12 3 Begriffsdefinitionen .................................................................................... 14 3.1 Niederschwellige Drogenarbeit in Wien ...................................................... 14 3.2 Akzeptierende Drogenarbeit ....................................................................... 15 3.3 Soziodemographie ..................................................................................... 16 3.4 Benzodiazepine .......................................................................................... 16 3.4.1 Gründe für den Benzodiazepinkonsum .................................................... 17 3.4.2 Die wichtigsten Benzodiazepine .............................................................. 19 3.4.3 Konsumformen von Benzodiazepinen ..................................................... 20 3.4.3.1 Schlucken ............................................................................................. 20 3.4.3.2 Intravenöser Konsum ........................................................................... 21 3.4.3.2.1 Ischämie als Folge der versehentlichen intraarteriellen Injektion von Benzodiazepinen ................................................................................... 22 3.4.3.3 Aufnahme durch die Mundschleimhaut ................................................. 22 3.4.3.4 Nasaler Konsum von Benzodiazepinen ................................................ 23 3.4.4 Entzugssymptome ................................................................................... 23 3.5 Harm- Reduction ........................................................................................ 24 3.5.1 Harm- Reduction in der Klinischen Sozialen Arbeit: Das biopsychosoziale Modell als Grundlage............................................................................. 24 4 Literaturbearbeitung ................................................................................... 26 4.1 Drogenkonsum - wie unterschieden werden kann ...................................... 26 4.2 Konsummuster von Drogen in Österreich ................................................... 27 4.3 Abhängigkeit .............................................................................................. 27 4.3.1 Mehrfachabhängigkeit und polyvalenter Konsum .................................... 28 4.4 Drogenmissbrauch ..................................................................................... 29 4.4.1 Drogenmissbrauch nach DSM-IV ............................................................ 29 4.4.2 Drogenmissbrauch, nach Grenzmengen definiert .................................... 30 4.5 Folgen des Missbrauchverhaltens .............................................................. 31 4.5.1 Somatische Erkrankungen....................................................................... 31 4.5.2 Psychische Erkrankungen ....................................................................... 31 4.5.3 Soziale Folgen......................................................................................... 32 4.5.4 Suizid ...................................................................................................... 32 4.5.5 Prostitution .............................................................................................. 33 6 4.6 Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Konsumverhalten von Suchtmitteln .............................................................................................................. 33 4.6.1 Konsum illegaler Drogen ......................................................................... 33 4.6.2 Drogenkonsum und Männlichkeit: Risikoverhalten als spezifisch männliches Verhalten ............................................................................................... 34 4.6.3 Konsum psychotroper Arzneimittel .......................................................... 34 4.7 Geschlechtsunterschiede bei den Ursachen der Abhängigkeit – Ätiologie .. 35 4.7.1 Genetische Ursachen und familiäres Umfeld ........................................... 35 4.7.2 Gewalt und sexueller Missbrauch ............................................................ 35 5 Die Organisation.......................................................................................... 36 5.1 Die sozial-medizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt .......................... 36 5.2 Zielgruppe .................................................................................................. 36 5.3 Die Drogen- Straßenszene ......................................................................... 37 5.4 Die Drogen- Straßenszene in Wien ............................................................ 37 6 Forschungsdesign ...................................................................................... 38 6.1 Methode der Forschung ............................................................................. 38 6.2 Ethische Bewertung der Forschungsfrage .................................................. 39 6.3 Beschreibung des Fragebogens ................................................................. 39 6.4 Interviewsituation........................................................................................ 40 6.5 Stichprobenbeschreibung ........................................................................... 42 7 Datenauswertung ........................................................................................ 45 7.1 Konsummuster von Benzodiazepinen ........................................................ 45 7.1.1 Bezugsquellen der Benzodiazepine ......................................................... 45 7.1.2 Verschreibungen per Rezept ................................................................... 47 7.1.3 Straßenpreise .......................................................................................... 47 7.1.4 Konsumierte Arten und Mengen von Benzodiazepinen ........................... 48 7.1.5 Konsumformen ........................................................................................ 54 7.1.6 Alter beim erstem Benzodiazepinkonsum ................................................ 56 7.1.6 Alter beim ersten intravenösem Konsum allgemein und beim ersten, intravenösen Konsum von Benzodiazepinen ......................................... 57 7.1.7 Verwendung von sterilen Utensilien zum einmaligen Gebrauch für den intravenösen Konsum ............................................................................ 59 7.1.8 Gespräch über Risiken ............................................................................ 62 7.1.9 Konsumorte ............................................................................................. 63 7.1.10 Kombination mit anderen Substanzen – Alkohol und Opiate ................. 64 7.1.10.1 Alkohol und Benzodiazepine............................................................... 65 7.1.10.2 Opiate und Benzodiazepine ................................................................ 66 7.2 Momentane Ursachen des Benzodiazepinkonsums ................................... 68 7.2.1 Momentane Ursachen mit der durchschnittlich größten Zustimmung ....... 69 7.2.1 Prostitution als Ursache des Benzodiazepinkonsums .............................. 70 7.2.2 Blaue Lippen als Erkennungsmerkmal der Szene ................................... 70 7.2.3 Lutschen von Benzodiazepinen für eine schnellere Wirkung ................... 70 7.2.4 Benzodiazepine, um die Wirkung von Alkohol zu verstärken ................... 70 7 7.2.5 Benzodiazepine, um die Wirkung von Opiaten zu verstärken .................. 70 7.3 Wechselbeziehung zwischen Erstkonsum von Benzodiazepinen und erstem i.v. Konsum von Benzodiazepinen ......................................................... 71 8 Ergebnisse und Zusammenfassung .......................................................... 72 8.1 Konsummuster ........................................................................................... 72 8.1.1 ÄrztInnen und Szene selbst für Versorgung zuständig ............................ 72 8.1.2 Hohe Preisschwankungen in der Szene .................................................. 72 8.1.3 Somnubene®: das am häufigsten konsumierte Benzodiazepin ............... 73 8.1.4 Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum ................................................. 73 8.1.5 Hohe Risiken für die Gesundheit bei unregelmäßigen hohen Dosen ....... 73 8.1.6 Unproblematische Konsumformen sind vorherrschend............................ 75 8.1.7 Intravenöser Konsum von Benzodiazepinen ............................................ 75 8.1.8 Verwendung von sterilen Utensilien für den i.v. Konsum ausbaufähig ..... 76 8.1.9 Safer- Use Beratung zu Benzodiazepinkonsum hat nicht alle erreicht ..... 77 8.1.10 KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit sind auf Konsum in der Öffentlichkeit angewiesen ...................................................................... 78 8.1.11 Alkohol und Benzodiazepine ................................................................. 79 8.1.12 Opiate und Benzodiazepine ................................................................... 79 8.2 Momentane Ursachen ................................................................................ 79 8.2.1 Blaue Lippen als Erkennungsmerkmal der Szene ................................... 80 8.2.2 Benzodiazepinkonsum als Bewältigung der Prostitutionstätigkeit ............ 80 8.2.3 Wirkungskumulation von Benzodiazepinen und Alkohol .......................... 80 8.2.4 Wirkungskumulation von Benzodiazepinen und Opiaten ......................... 81 8.2.5 Schnellere Wirkung durch das Lutschen der Tabletten ist kein Mythos.... 81 8.3 Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum und Alter beim ersten i.v. Konsum von Benzodiazepinen korreliert ............................................................. 82 8.4 Zusammenhänge zwischen zwei Variablen sind nicht immer nachweisbar. 82 9 Ausblick ....................................................................................................... 83 10 Literaturverzeichnis .................................................................................. 84 11 Abkürzungsverzeichnis ............................................................................ 88 12 Tabellenverzeichnis .................................................................................. 89 13 Abbildungsverzeichnis ............................................................................. 90 14 Anhang ....................................................................................................... 91 15 Persönliche Daten ..................................................................................... 98 8 1 Erkenntnisinteresse Ob Karlsplatz, Wien Mitte oder U-Bahn Station Josefstädterstraße: Das Bild von drogenkonsumierenden Menschen ist aus der Stadt nicht wegzudenken. Ebenso die Diskussionen um die potenzielle Lösung des Problems, was heute oft mit einer strengeren Reglementierung und Kontrolle auf öffentlichen Plätzen und somit einer Vertreibung der Menschen mit abweichendem Verhalten gleichgesetzt wird. Diese Politik wird mit dem schwer strapazierten Begriff des „subjektiven Sicherheitsgefühls“ argumentiert. Dahinter steht die angebliche Sorge um die Sicherheit der BürgerInnen. Der Diskurs und die Problematik ist um den Aspekt über den Umgang mit Menschen erweitert worden, die einen offensichtlichen Benzodiazepinkonsum vorweisen. Die Soziale Arbeit allgemein und die Klinische Soziale Arbeit im speziellen, vor allem im Bereich der niederschwelligen Drogenarbeit ist in der täglichen Praxis mit den Auswirkungen dieses Konsumverhaltens konfrontiert. So finden wir in Beratungs- und Betreuungssituationen teilweise schwer sedierte KlientInnen vor, die außerdem noch mit gravierenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Will die Klinische Soziale Arbeit behandelnd tätig werden, wie es das sozialtherapeutische Modell suggeriert (vgl. Binner/ Ortmann 2008: 72), muss sie die Konsummuster, Risiken und Ursachen des Benzodiazepin Konsums verstehen. Zur Erklärung bietet sich das biopsychosoziale Modell (siehe Kapitel 3.5.1) an, das als eine der Grundlagen der Klinischen Sozialen Arbeit gilt. Aus den Erkenntnissen der Forschungsarbeit und mit dem Hintergrund dieser Modelle versucht die Klinische Soziale Arbeit Konzepte für die Stabilisierung und Verbesserung des Gesundheitszustandes ihrer KlientInnen abzuleiten. Auch hier geht es um Sicherheit, aber aus Sicht der DrogenkonsumentInnen. Um die komplexen Konsummuster zu beleuchten, werden Safer- Use Methoden und das Konzept der Harm- Reduction herangezogen. So ist die Fragestellung auch mit diesem Hintergrund zu betrachten. Hinzu kommt die akzeptierende Drogenarbeit als das Paradigma, mit dem den KlientInnen im Zuge dieser Forschungsarbeit begegnet worden ist. Mit dieser Grundlage soll schlussendlich auch die Interpretation der statistischen Analyse erfolgen. Im Gegensatz zum Abstinenzparadigma, das die Beendigung jeglichen Drogenkonsums zum Ziel hat, soll durch die AkzeptanzOrientierung ein Leben mit der Droge durch Schadensminimierung ermöglicht werden, in dem auch der Genuss eines Rausches Platz hat. Der Berauschung wird so eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Menschen zugesprochen. Um die Gruppen, die eventuell durch riskantes Konsumverhalten gefährdet sind, genauer eingrenzen zu können, soll unter anderem eine Differenzierung anhand der 9 sozialdemographischen Daten vorgenommen werden. So sollen, so weit als möglich, die Frage geklärt werden, ob sich das Konsumverhalten geschlechtsspezifisch oder nach dem Alter unterscheidet. Benzodiazepine gehören zu den meist verschriebenen Medikamenten in Österreich. Im Einsatz gegen Angsterkrankungen, Schlaflosigkeit und Muskelverspannungen haben sie sich bewährt. Die Anzahl an verschiedenen Substanzen dieser Gruppe scheint nahezu endlos zu sein. Häufig werden sie nur für eine gewisse Zeit konsumiert und dann wieder abgesetzt. Nicht so bei vielen KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit. So hat die Soziale Arbeit in den letzten Jahren immer Menschen betreut, die eine schwere Benzodiazepin- Abhängigkeit entwickelt haben. Doch um wie viele Tabletten es sich genau handelt und welche Substanzen vorrangig konsumiert werden, ist oft nur grob in der Dokumentation der betreuenden Einrichtungen erhoben worden. Ob mehrere Substanzen gleichzeitig konsumiert werden und Mehrfachabhängigkeiten vorhanden sind, bleibt unbekannt. Welche Ursachen der scheinbar intensive Benzodiazepin Konsum in der niederschwelligen Drogenarbeit hat, um dieses Thema sind von Praktikern viele Vermutungen geäußert worden. Diese und andere Fragen sind von der Sozialen Arbeit noch nicht genauer betrachtet worden. In Wien hat es zur Zeit der Erhebung zwei niederschwellige Einrichtungen der akzeptierenden Drogenarbeit gegeben, die vorrangig von Menschen aus der Straßenszene frequentiert werden. Das sind die sozial-medizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt und das TaBeNo gewesen. Beide Einrichtungen haben ein Tageszentrum und einen Spritzentausch als Angebot für intravenös konsumierende Menschen. Bereits 2008 sind alleine im Ganslwirt durchschnittlich 4158 Spritzen pro Tag getauscht worden (vgl. Bericht VWS 2008: 47). Bei der Tätigkeit als Vertretungsdienst im Ganslwirt hat der Autor folgende Beobachtung gemacht - auch dadurch lässt sich das Interesse des Forschenden für dieses Thema erklären: Es wird eine große Anzahl an Spritzen getauscht, die einen bläulichen Inhalt haben. Dies kann auf einen intravenösen Konsum von der Substanzgruppe der Benzodiazepine, insbesondere von dem Medikament Somnubene®, hindeuten. Besonders auffällig sind die Komplikationen, die durch den intravenösen Konsum im Speziellen auftreten: Bei einer fehlerhaften Injizierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Folgeschädigung. Beispielsweise haben KlientInnen eine Hand oder ein Bein durch die Applizierung in die Arterie verloren. Auch in Anbetracht des allgemeinen Benzodiazepinkonsums der Drogenszene kommt es in Verbindung mit Alkohol und/oder Opiaten, regelmäßig zu Überdosierungen die lebensgefährlich sein können. 10 Unter Berücksichtigung all dieser Prämissen hat sich folgende Fragestellung ergeben: Welche risikoreichen Konsummuster von Benzodiazepinen haben die KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit und gibt es einen Zusammenhang mit ihren soziodemographischen Daten? Ich werde in dieser Arbeit zunächst auf die spezifischen Begrifflichkeiten aus der Fragestellung, wie niederschwellige Drogenarbeit (Kapitel 3.1), akzeptierende Drogenarbeit (Kapitel 3.2), Soziodemographie (Kapitel 3.3), Benzodiazepine (Kapitel 3.4) und Harm- Reduction (Kapitel 3.5) eingehen. Danach werden im allgemeinen Literaturteil die Begriffe Drogenkonsum (Kapitel 4.1), Abhängigkeit und polyvalenter Konsum (Kapitel Literaturbearbeitung 4.3.1), soll Drogenmissbrauch auch auf die (Kapitel möglichen 4.4) definiert. In der Lebensbedingungen der DrogenkonsumentInnen und dessen biopsychosoziale Folgen näher eingegangen werden (Kapitel 4.5). Dabei werden geschlechtsspezifische Unterschiede in einem eigenen Kapitel (4.6) genauer betrachtet. Um den Rahmen der Erhebung besser nachvollziehen zu können, wird im folgenden Teil (Kapitel 5) sowohl die Organisation, der Ganslwirt, beschrieben, als auch die Drogen- Straßenszene von Wien definiert. Der anschließende Teil ist die Forschungsarbeit, anfangend mit der detaillierten Darstellung des Forschungsdesigns (Kapitel 6) und gefolgt von der statistischen Analyse der erhobenen Daten (Kapitel 7). Zum Schluss steht die Interpretation der Ergebnisse und die Zusammenfassung (Kapitel 8) im Mittelpunkt. 11 2 Problemstellung Die Zielgruppe der sozialmedizinischen Drogenberatungsstelle Ganslwirt sind schwerpunktmäßig Menschen aus der Drogen- Straßenszene. Grundsätzlich sind es aber alle Personen, die durch biopsychosoziale Folgen des Drogenkonsums betroffen sind (vgl. Suchthilfe Wien gGsmbH 2012: 4). Es ist davon auszugehen, dass die KlientInnen in unsicheren sozialökonomischen Status Wohnverhältnissen haben. Diese leben soziale und einen Ungleichheit niedrigen wird im Gesundheitszustand abgebildet: die Menschen weisen einen ausgeprägten und teilweise auch risikoreichen Drogenkonsum auf, der zu Mehrfachabhängigkeiten und zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Ein Paradigma der sozialen Ungleichheit lautet: Armut macht krank. Auch in die andere Richtung hat dieser Ursache- WirkungZusammenhang Gültigkeit. Krankheit verursacht Armut. Ein weiterer Faktor des sozialen Status ist die Bildung. KlientInnen des Ganslwirt weisen einen eher niedrigen Bildungsstand (siehe Stichprobenbeschreibung in Kapitel 6.5) auf. Je nachdem wie die hier genannten Faktoren zusammenwirken, ist die soziale Ungleichheit entscheidend für die Lebenslage der Menschen. (vgl. Mielck 2005: 48f und vgl. Binner/ Ortmann 2008: 73) Der Benzodiazepin-Konsum bei den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit kann somit als eine Manifestation von Sozialer Ungleichheit und Benachteiligung gesehen werden. Konsummuster von Drogen bilden den sozialen Status ab, somit auch geschlechtsspezifische und altersspezifische Unterschiede. Da diese Arbeit auch unter dem Blickwinkel der akzeptanzorientierten Drogenarbeit und der Schadensminimierung (Harm- Reduction) entstanden ist, sollen vorhandene, risikoreiche Konsummuster erfasst werden. Teilweise ist es durch den jahrelangen Konsum von Benzodiazepinen bei manchen KlientInnen zu beachtlichen Toleranzen, aber auch zu Abhängigkeiten und Mehrfachabhängigkeiten gekommen. Dabei spielt eine Rolle, welches Medikament genau konsumiert wird und in welcher Form. Des weiteren ist von Bedeutung, von wem die Substanz bezogen wird, seit wann konsumiert wird und wie viel, wie oft und in welcher Kombination mit anderen Substanzen. All diese Bedingungen, die in der Arbeit unter „Konsummuster“ subsumiert sind, sind entscheidend für den Gesundheitszustand der KlientInnen und machen teilweise Prognosen für ihre weiter Entwicklung möglich. So ist es bei einer Hochdosis- Abhängigkeit nicht unbedingt sinnvoll, eine komplette Abstinenz als oberstes Ziel anzustreben, sondern als ersten Schritt eine Verringerung der regelmäßig konsumierten Menge (vgl. Haltmayer/ Rechberger u.a. 2009: 295). 12 Es ist eine Herausforderung gewesen, diese Faktoren bei der Erstellung des standardisierten Fragebogens abzubilden. Entsprechende Fragen mussten gefunden werden, um die komplexen Konsummuster und die momentanen Ursachen des Konsums operationalisieren zu können. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen sind sehr komplex und oft nicht linearer Natur. Hinzu kommt, dass die Zielgruppe nicht einfach zu erreichen ist, da die Menschen meist unter Drogeneinfluss stehen und speziell durch die Benzodiazepine sediert sind. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind statistisch schwer belegbar, weil es ein Faktum ist, dass es weniger Frauen in der Wiener Drogenszene gibt. Gründe dafür sind die versteckte Wohnungslosigkeit von Frauen und die geringere Risikobereitschaft von Frauen, was sich auch in der Ausprägung des Drogenkonsums bemerkbar macht (Kapitel 4.6). 13 3 Begriffsdefinitionen Unter diesem Punkt finden sich die spezifischen Definitionen, die sich aus den Begrifflichkeiten der Fragestellung ergeben. Aus den Beschreibungen und Definitionen werden Hypothesen abgeleitet, die am Ende des Kapitels angeführt sind und in der Analyse auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Auch in dem nächsten Teil der Arbeit, der allgemeinen Literaturbearbeitung, wird diese Praxis fortgesetzt. 3.1 Niederschwellige Drogenarbeit in Wien Niederschwellige Drogenarbeit ist ein akzeptanzorientiertes Angebot, dass sozialraumbezogen und szenenahe agiert. Es richtet sich an drogenabhängige Menschen und ist in das allgemeine Sozial- und Gesundheitssystem eingegliedert. Ziel ist es die biopsychosozialen Schädigungen, die eine mögliche Folge des Drogenkonsums sein können, zu lindern oder sogar zu verhindern (Harm- Reduction). Bezeichnend sind auch die Sicherung des Überlebens und die Unterstützung bei Alltagsproblematiken, zu denen auch Wissen über die Problematiken des Drogengebrauches gehören. (vgl. Schneider/ Stöver 2005: 35f und vgl. 1) Niederschwelligkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass es möglichst wenige Hemmschwellen zur Nutzung und zum Zugang des Hilfsangebotes gibt. Das inkludiert benutzergerechte Öffnungszeiten, die Wahrung der Anonymität der KlientInnen, keine fixen Terminvereinbarungen und Angebote zur Befriedigung der Grundbedürfnisse. In Deutschland sind in niederschwelligen Drogeneinrichtungen oft Drogenkonsumräume integriert, nicht so in Österreich. (vgl. ebenda) Hypothese: In der niederschwelligen Einrichtung Ganslwirt haben die KlientInnen an einer SaferUse Beratung über die Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen teilgenommen. 1 Vgl. Schneider 2006: http://www.indro-online.de/nda.htm 14 3.2 Akzeptierende Drogenarbeit Die Grundgedanken zur akzeptierenden Drogenarbeit sind im Bereich der niederschwelligen Drogenarbeit entstanden. Diese ist eine Antwort auf die ineffiziente Abstinenzorientierung, die auf Drogenmythen wie der „Leidensdrucktheorie“ basiert. Die betroffenen Menschen wurden als generell „behandlungsbedürftig“ eingestuft. In den neu entstandenen Prinzipien ist Hilfe auch unabhängig vom Abstinenzgebot möglich geworden. So sind Personengruppen erreicht worden, die bis dahin als Hardto-reach- KlientInnen gegolten haben. (vgl. Schneider 1997: 15ff und vgl. Barsch 2010: 12) „Grundlage akzeptanzorientierter Drogengebraucher als mündige, Drogenarbeit zur ist es hingegen, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung fähige Menschen anzusehen.“ (Schneider 1997: 15) Zentral ist die menschenwürdige Behandlung, auch wenn die Selbstbestimmung durch die Illegalisierung der Konsumbedingungen eingeschränkt ist. Bezogen auf die Einrichtungen sind Stichworte wie Freiwilligkeit, Anonymität, Niederschwelligkeit sowie ein Verzicht auf fixierte Termine und Abstinenz Bestandteile dieses Modells. (vgl. ebenda) Durch die neuen Einblicke in die Lebenswelt der KlientInnen hat sich auch das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Konsummuster und dem Lebensstil radikal geändert. Es ist durchaus möglich von einem neuen Paradigma innerhalb der Drogentheorien zu sprechen. Diese Grundlagen des Denkens finden sich in der Herangehensweise der Forschung und in der Praxis der Drogenhilfesysteme wieder. Außerdem werden die Orientierung von Suchtprävention und Drogenpolitik in Frage gestellt, genauso wie die Mechanismen, die das Bestehen selbiger festigen. (vgl. Barsch 2010: 12f) Es lassen sich folgende Grundgedanken identifizieren. Ein Leben, das einen risikoarmen Umgang mit psycho- aktiven Substanzen pflegt, ist kein Widerspruch zu den Werten und Lebensmustern der Gesellschaft. Anders ausgedrückt: Ein Leben mit Drogen ist möglich. Es bedeutet nicht automatisch den Verfall der Person und des zugehörigen sozialen Umfeldes. (vgl. Barsch 2010: 13f) Drogenkonsum bedeutet nicht den Verlust aller persönlicher und sozialer Ressourcen zugunsten des Drogenkonsums. Der Mensch hat noch immer eine Chance. Selbststeuerung und Safer- Use Methoden können gelernt werden. Anforderungen 15 werden auch an die Klientinnen der akzeptierenden Drogenarbeit gestellt, sie werden nicht nur als Opfer wahrgenommen. (vgl. ebenda) Einer Infantilisierung wird durch Abgabe an Verantwortung entgegengewirkt. Das Selbstbestimmungsrecht im Umgang mit psycho- aktiven Substanzen wird respektiert und schließt das Recht auf Abstinenz mit ein. Erzwungene Abstinenz widerspricht aber dem grundlegenden Paradigma und dem Konzept der Menschenwürde. (vgl. ebenda) 3.3 Soziodemographie Soziodemographie meint die statistische Beschreibung und Aufgliederung einer Gruppe anhand von bestimmten sozialen und demographischen Merkmalen. Diese Statusmerkmale und Statuskriterien lassen sich anhand von Bildung, Einkommen, Alter, Familienstand, Berufsstand und Wohnort ermitteln. Je nachdem wie die Teilhabe an diesen Merkmalen vorhanden ist oder wie sehr sie bei dem jeweiligen Individuum ausgeprägt sind, lässt sich eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Lebenswelt oder einem Lebensstil ableiten. (vgl. Kaller 2001: 370) 3.4 Benzodiazepine Die Stoffgruppe der Benzodiazepine ist eine Form von Tranquilizer. Auf der einen Seite wirken diese vorwiegend entspannend und Angst mildernd. Es können auf der anderen Seite paradoxe, aggressive Reaktionen vorhanden sein. Das Medikament kann intravenös oder oral appliziert werden. Die Substanzgruppe zeichnet sich zudem durch eine lange Halbwertszeit im Körper aus. Bei übermäßigem Konsum birgt das die Gefahr der Anhäufung des Stoffes im Organismus. Es gibt noch viele andere, ähnliche Stoffe mit den unterschiedlichsten Handelsnamen. In Kombination mit Opiaten oder Alkohol entfalten sie fatale Wirkungen, zum Teil auch mit Todesfolge. Bei chronischem Gebrauch ist sowohl eine psychische, als auch eine körperliche Abhängigkeit zu beobachten. (vgl. Iwersen- Bergmann/ Plüschel 2005: 97f) Aus dem DOKLI- Bericht von 2009 geht hervor, dass 11% Tranquilizer und Hypnotika als Leitdroge angeben. 36% der insgesamt 3.591 befragten Personen geben an diese Stoffgruppe als Leitdroge oder als Begleitdroge zu konsumieren. Das Alter ist beim erstmaligen Konsum bei Frauen geringer als bei Männern: Bei Frauen sind es 18 Jahre, bei Männern sind es 20 Jahre. Benzodiazepine werden erst relativ spät erstmals 16 konsumiert. Besonders Frauen sind häufig von Alkohol- und Benzodiazepinabhängigkeiten betroffen. (vgl. DOKLI 2010: 42f und Finzen 2004: 53) Hypothesen: Frauen sind beim ersten Konsum von Benzodiazepinen jünger als Männer. Die KonsumentInnen nehmen Benzodiazepine wegen der entspannenden und Angst mildernden Wirkung. Benzodiazepine werden häufig in Kombination mit Alkohol und/oder Opiaten konsumiert. Anteilsmäßig kombinieren mehr Frauen als Männer Benzodiazepine und Alkohol. 3.4.1 Gründe für den Benzodiazepinkonsum Es gibt eine große Bandbreiten an Ursachen für den Benzodiazepinkonsum bzw. auch für den Beikonsum zu Opiaten und anderen Drogen. Allgemein wird die Substanzgruppe bei Schlafstörungen, psychoreaktive Störungen, die unter dem Begriff Traumata zusammengefasst sind, in Krisensituationen und bei den sogenannten „Anpassungsstörungen“ angewendet. Das Hauptanwendungsgebiet der Tranquilizer ist in den Bereichen, wo nach Finzen (2004) oft auch Psychotherapie gefordert wäre. (vgl. Finzen 2004: 58) Erwünschte Folgen des Benzodiazepinkonsums sind die angstlösende und sedierende Wirkung. Hinzu kommen muskelrelaxierende, krampflösende und antiaggressive Wirkungen. Viele DrogenkonsumentInnen verwenden Benzodiazepine um Entzugserscheinungen abzumildern. (vgl. Hormann, Winkler 2005: 261f und vgl. Brosch 1996: 126) Eigentlich sollte der Benzodiazepinkonsum eine Hilfestellung für phasenweise auftretende Angst- und Spannungszustände sein. Dann sind sie aber auch nur indiziert, wenn der Zustand außer Kontrolle geraten würde. Die Stoffgruppe kann so gesehen als Regulativ eingesetzt werden. Dem Körper und der Psyche soll eine eine zeitlich befristete Schonphase gegönnt werden. So lange, bis die betroffene Person aus eigenen Ressourcen heraus, mit Hilfe der Sozialen Arbeit oder von PsychotherapeutInnen wieder mit den Problemen fertig wird. Dabei muss bei den ÄrztInnen eigentlich immer auf die Verschreibungsdauer geachtet werden und auf die Höhe der Dosierung. Tranquilizer sind Teil der Gruppe von Medikamenten, die gerne auch selbständig von Personen konsumiert werden. (vgl. Finzen 2004: 59f) 17 Heute wird in folgende Bereiche der Angsterkrankungen differenziert (vgl. Finzen 2004: 59f): generalisierte Angststörungen Die Symptomatik lässt sich wie folgt beschreiben: sowohl eine übermäßige und unrealistische Sorge, als auch eine durchgängig angstvolle Erwartungshaltung in der alltäglichen Lebenswelt. Panikstörungen Panikstörungen sind gekennzeichnet durch eine plötzlich auftretende, sehr starke Angst. Zusätzlich treten auch körperliche Symptome auf, wie Herzrasen, Atemnot, Übelkeit, Schwindel, Brustschmerzen und Schweißausbrüche. Betroffene Personen beschreiben auch Todesängste. Agoraphobie Diese Form der Angst tritt auf beim Verlassen der gewohnten Lebenswelt. Neue Situationen und Räumlichkeiten können zu Ohnmachtsanfällen, Herzanfällen oder Inkontinenz führen. Befürchtet wird das Auftreten von Gegebenheiten, die das Gefühl der Hilflosigkeit und Peinlichkeit verursachen. Spezifische phobische Störungen und soziale Phobie Darunter fallen die irrationalen Ängste vor genau differenzierbaren Objekten oder vor bestimmten Handlungen und Situationen. So gehört beispielsweise die Spinnenphobie zu dieser Gruppe, aber auch die Spritzenphobie. Neben Angsterkrankungen werden Benzodiazepine auch bei akuten Psychosen oder Schizophrenie eingesetzt. Eine weitere Gruppe, die häufig Tranquilizer verschrieben bekommt, sind alte Menschen. Hier werden sie auch als Begleitmedikation bei körperlichen Erkrankungen eingesetzt. (vgl. ebenda) Außerdem werden Benzodiazepine werden im Rahmen der Substitutionsbehandlung von ÄrztInnen verschrieben. (vgl. Haltmayer/ Rechberger/ u.a. 2009: 295) Benzodiazepine werden auch in Kombination mit Alkohol und Opiaten konsumiert, um die euphorisierende Wirkung der anderen Rauschmittel zu verstärken. Da bei manchen Personen die beruhigende, reizabschirmende Wirkung überwiegt, werden Benzodiazepine auch zur Stimmungsaufhellung eingenommen und somit bevorzugt tagsüber. (vgl. Püschel, Iwersen-Bergmann 2005: 102f) Ein weiterer wichtiger Grund für den Konsum von Benzodiazepinen ist die Sicherheit beim Konsum. Dabei ist entscheidend, dass die Tabletten meist in einer gut erkennbaren Verpackung erhältlich sind. Die konsumierte Dosis kann, im Gegensatz 18 zu vielen verschiedenen Substanzen die illegal erhältlich sind, genau abgeschätzt werden. Dafür ist die Reinheit des Medikaments entscheidend. Menschen die auf den Kauf von Heroin angewiesen sind, sehen sich oft mit hohen Schwankungen in der Wirkstoffkonzentration konfrontiert, was einen erheblichen Risikofaktor für Überdosierungen darstellt (siehe Kapitel 5.4). Hypothesen: Benzodiazepine werden von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit zur Alltagsbewältigung eingesetzt als Schlafmedikation verwendet gegen körperliche Schmerzen eingesetzt (z.B.: muskelrelaxierende Wirkung) zur Aufrechterhaltung der biopsychosozialen Funktionalität und somit auch zur Vermeidung der Entzugssymptomatik konsumiert zur Erreichung eines speziellen Rauschzustandes eingesetzt, auch in Kombination mit Opiaten und Alkohol konsumiert, um den Rausch (bzw. Stimmungsaufhellung) zu genießen konsumiert, weil sie sicher sein können was und wie viel in der Tablette enthalten ist 3.4.2 Die wichtigsten Benzodiazepine Flunitrazepam (Somnubene®, Rohypnol®) ist ein schnell wirksames Benzodiazepin und ist deswegen in der Szene sehr beliebt. Der Missbrauch von Präparaten, die diese Substanz enthalten ist weiter verbreitet als jener von langsam anflutenden Wirkstoffen. Die rasche Anflutung von Flunitrazepam erhöht außerdem den abhängigkeitsfördernden Faktor. Die länger anhaltende Wirkung scheint, im Gegensatz zu Oxazepam (Praxiten® ), auch zu Wechselwirkungen und Überdosierungen zu führen. Es kann beim Konsum von mehreren Substanzen zu unberechenbaren, kumulativen Effekten kommen. Bei der Kombination von Opiaten und Benzodiazepinen ist es vor allem die dämpfende Wirkung, die verstärkt wird. (vgl. BMG- Leitlinie 2012: 5f) Grundsätzlich kann festgestellt werden: Qualitative Unterschiede zwischen den Präparaten sind nicht vorhanden. Unterscheidungen sind hauptsächlich anhand der Wirkungsdauer möglich. Die verschiedenen Wirkungen lassen sich durch die jeweils anders ausgeprägten Ausscheidungs- und Inaktivierungsgeschwindigkeiten erklären. 19 Durch diesen Faktor lassen sich auch die bereits erwähnten kumulativen Effekte beschreiben, die auch nach Tagen – in Kombination mit Alkohol oder Opiaten – eine additive Auswirkung haben können. Ob ein Benzodiazepin ermüdet oder nur beruhigt, ist eine Frage der Dosierung. (vgl. Finzen 2004: 57) Hypothese: Medikamente mit dem Wirkstoff Flunitrazepam werden am häufigsten von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit konsumiert. 3.4.3 Konsumformen von Benzodiazepinen Zuerst wird der allgemeine Wirkmechanismus beschrieben, bevor auf die einzelnen Konsumformen eingegangen wird. Benzodiazepine binden an Bindungsstellen des GABA- Rezeptors in den Synapsen und verformen diesen dadurch. Es kommt so zu einer verstärkten Wirkung bei einer gleichen Anzahl von GABA- Molekülen, weil die Öffnungshäufigkeit des Chloridionenkanals zunimmt. Das bedeutet, dass die bremsende Wirkung auf das Zentralnervensystem von GABA verstärkt wird. Benzodiazepine haben unterschiedlich lange Halbwertszeiten, weshalb bei häufiger Einnahme die Gefahr einer Wirkungskumulation im Körper besteht. Die Halbwertszeiten, inklusive der Metaboliten, für die zwei wichtigsten Benzodiazepine dieser Studie sind: Flunitrazepam - 15 bis 36 Stunden und Oxazepam - 6 bis 25 Stunden. (vgl. Finzen 2004: 31und vgl. Iwersen- Bergmann/ Plüschel 2005: 98) 3.4.3.1 Schlucken Werden Benzodiazepine geschluckt, gelangt die Substanz, die von der Mundhöhle bis zum Rektum resorbiert wird, über den Blutkreislauf direkt in die Leber. So werden die Benzodiazepine einem Stoffwechselvorgang unterworfen, bevor sie das Gehirn erreichen und somit die relevanten, neuronalen Verbindungen, die Synapsen. Der „first-pass-Effekt“ beschreibt den Umbau oder Abbau der Substanz durch die Leber. Allgemein wird unter der Aufnahme über die Schleimhaut des Verdauungstraktes die „enterale Reorption“ verstanden. (vgl. Brosch 1996: 66f) Hypothese: Benzodiazepine werden generell geschluckt, dafür sind sie von den Herstellern grundsätzlich auch konzipiert. 20 3.4.3.2 Intravenöser Konsum Bevor die Pillen gespritzt werden können, müssen sie in Flüssigkeit aufgelöst werden. In der Lösung sind auch die Tablettenhilfsstoffe enthalten. Diese können schädlich sein, wenn sie in den Blutkreislauf gelangen. Blauer Farbstoff, wie bei dem Medikament Somnubene® oder Maisstärke als Trägerstoff sind Beispiele dafür. Die Wirkung ist dieselbe wie beim Schlucken, nur tritt sie schneller ein. Auf einen wichtigen Aspekt der Harm- Reduction soll bei der Gelegenheit hingewiesen werden: Wird trotz aller Warnungen intravenös konsumiert, sollte die Flüssigkeit vorher gründlich gefiltert werden. (vgl. Hormann, Winkler 2005: 261f) Nicht nur wegen der Substanz an sich gilt der intravenöse Konsum von Benzodiazepinen als sehr risikoreich. Der intravenöse Konsum ist schon ein hohes Risiko an sich. In der Literatur werden einige Komplikationen beschrieben, die mit dem intravenösen Konsum in Verbindung stehen. Im folgenden Kapitel wird auf eine Komplikation eingegangen, die speziell auf den Versuch einer intravenösen Injektion von Benzodiazepinen zurückzuführen ist. Durch den intravenösen Konsum können STD wie Hepatitis C und HIV genauso übertragen werden wie Haut- und Weichteilinfektionen, die ebenfalls tödlich enden können. Neben unzähligen anderen Erkrankungen treten auch Pulmonalembolien und Endokarditis2 als Folge des intravenösen Konsums auf. (vgl. Coster/ Karner 2004: 30f und vgl. Reiter 2007: 142ff) Hypothesen: Eine gewisser Anteil der befragten Personen wird angeben, Benzodiazepine intravenös zu konsumieren. Ein Grund für den intravenösen Konsum von Benzodiazepinen ist die schnellere Wirkungseintritt der Substanz. Beratungsangebote zu den Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen, mit einer ÄrztIn oder einer SozialarbeiterIn, haben noch nicht alle KlientInnen des Ganslwirts erreicht. Das Handlungswissen zur Risikominimierung ist noch ausbaufähig, nicht alle TeilnehmerInnen der Studie verwenden beim intravenösen Konsum sterile Filter, Löffel, Tupfer und neues Spritzenbesteck. 2 Herzklappenentzündung 21 3.4.3.2.1 Ischämie als Folge der versehentlichen intraarteriellen Injektion von Benzodiazepinen In der Medizin werden immer wieder akute Extremitätenischämien beschrieben, die in der Regel embolische oder thrombotische Ursachen haben. Das stellt eine Notfallsituation dar. Kommt es beim beabsichtigten intravenösen Konsum zu einem schwerwiegenden Fehler, nämlich zum interarteriellen Konsum von Benzodiazepinen, ist das meist die Ursache für eine Ischämie. Unter einer Ischämie wird die Minderdurchblutung und, in der stärksten Ausprägung, ein vollständiger Durchblutungsausfall einer Gliedmaße oder eines Organs verstanden. (vgl. Pfabe 2009: 38f) Ist die Injektion in eine Arterie erfolgt, die in eine der Gliedmaßen führt, sind starke Schmerzen, Verfärbungen der Haut und Sensibilitätsstörungen Symptome der Ischämie. Wird die Symptomatik nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, kann es zum Absterben der betroffenen Körperstellen, sogenannten akralen Nekrosen, kommen. Amputationen sind die letzte Möglichkeit den Schaden zu begrenzen. (vgl. ebenda) Bleiben die interarteriellen Injektionen von anderen Substanzen wie Heroin oder Methadon meist ohne Folgen, verhält es sich bei Benzodiazepinen anders: Es sind genügend Fallstudien vorhanden um zu schließen, dass diese Präparate ausgeprägte Schädigungen verursachen. Bedingt durch die hervorgerufenen Entzündungen, Schwellungen und Mikorembolien, entstehen dauerhafte Gefäß- und GewebeSchädigungen. Für den Erfolg der medizinischen Therapie ist entscheidend, wie groß das Zeitintervall zwischen der Injektion und dem Beginn der Behandlung ist. (vgl. ebenda) Es werden in der Literatur Fälle von Personen im Alter zwischen 21 und 39 Jahren beschrieben. Als Ursache für den versehentlichen interarteriellen Konsum wird unter anderem der Wechsel in die Leistengegend wegen schlechter Venenverhältnisse angegeben. Außerdem gibt es Berichte, dass DrogenkonsumentInnen Benzodiazepine intravenös einsetzten wollten, um Entzugserscheinungen zu lindern. Dabei setzen sie sich einem gravierenden gesundheitlichem Risiko aus. (vgl. Hering, Angelkort 2006: 1377f) 3.4.3.3 Aufnahme durch die Mundschleimhaut Die Aufnahme über die Mundschleimhaut bewirkt einen Übertritt der Substanz in die Blutgefäße, die direkt in die Hohlvene münden und zum rechten Herzen führt. Dafür wird die Tablette unter die Zunge gelegt. Die Leberpassage wird umgangen, dadurch 22 kommt es zu einem schnelleren Wirkungseintritt. Nicht alle Arzneistoffe, unter anderem aber Opiate und Benzodiazepine können über diesen Weg in den Blutkreislauf gelangen. Dazu ist auch notwendig, dass im Speichel eine hohe Wirkstoffkonzentration entsteht. Ein Vorteil ist, dass kein Infektionsrisiko durch Blutkontakt besteht. (vgl. Heudtlass 2005: 121) Hypothese: Die schnellere Wirkung ist ein Grund für den häufigen Konsum über die Mundschleimhaut. 3.4.3.4 Nasaler Konsum von Benzodiazepinen Die Tablette wird zerkleinert und anschließend wird das Pulver mit einem Röhrchen in die Nase aufgezogen. Dazu wird das Pulver in einer Linie aufgelegt. Vorteile diese Konsumform ist der ebenfalls schnelle Wirkungseintritt, wobei bei richtiger Handhabung auch keine Schädigung des Gewebes eintritt. Außerdem gibt es keinen direkten Blut- zu Blut Kontakt, weshalb ein geringeres Infektionsrisiko im Vergleich zum intravenösen Konsum besteht. Auch hier besteht Gefahr beim Teilen von Konsumationsutensilien: Über das Röhrchen können Infektionskrankheiten übertragen werden. Deshalb sollte auf das sogenannte „Röhrchen-Sharing“ verzichtet werden. (vgl. Heudtlass 2005: 120) 3.4.4 Entzugssymptome Leichte Entzugssymptome treten in 50% der Fälle nach einer Langzeitmedikation auf. Die Substanz muss dazu regelmäßig in einem Zeitraum von 4-6 Wochen konsumiert werden. Symptome sind: „Angst, innere Unruhe, Schlaflosigkeit, Dysphorie, Übelkeit, Erbrechen, Pulsbeschleunigung, Schwitzen, Zittern, Kopfschmerzen, Muskelverspannung“ (Brosch 1996: 127) Schwere Entzugserscheinungen treten ebenfalls nach einer Langzeitmedikation auf und werden wie folgt beschrieben: „Krampfanfälle, Verwirrtheit, verzerrte Wahrnehmung unbewegter Objekte, Lichtüberempfindlichkeit, Verstärkung der Geruchs- und Hörwahrnehmung, […], ängstlich depressive Syndrome, delirante Zustände.“ (Brosch 1996: 127) 23 Gegenübergestellt zu einem Heroin- Entzug ist ein Benzodiazepin- Entzug von längerer Dauer, schwieriger und auch mit einem höheren Risiko verbunden. (vgl. Hormann/ Winkler 2005: 261) Hypothese: Ein gewisser Anteil der KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit konsumiert Benzodiazepine, um die Entzugssymptomatik zu vermeiden. So kann die Funktionalität aufrecht erhalten werden. 3.5 Harm- Reduction Der Terminus „Harm- Reduction“ wird von dem englischen Begriff „Drug-related Harm“ abgeleitet, der soviel wie „Drogenassoziiertes Leiden“ bedeutet und die negativen sozialen, psychischen und körperlichen Folgen der Drogenabhängigkeit beschreibt. In diesem Sinne und auch im Sinne der tertiären Prävention ist Harm- Reduction das Entgegenwirken der Ausbildung oder des Fortbestandes der negativen Folgen des Konsums, auch als „Safer- Use“ bezeichnet. Die Beratung über risikoarmen Konsum ist eine der Hauptaufgaben von SozialarbeiterInnen in der niederschwelligen Drogenarbeit. Die Maßnahmen der Harm- Reduction im Bereich Safer- Use sind unter anderem: Die Abgabe von sterilen Spritzen, Kanülen und Injektionsutensilien wie Wasser, Ascorbinsäure, Alkoholtupfern, Aufkochgefäßen und Filtern. Die Einrichtung von Konsumräumen ist hier ebenfalls essentiell. (vgl. Haltmayer 2007b: 166f) Hypothesen: Nicht alle StudienteilnehmerInnen werden sterile Filter und andere Utensilien für den intravenösen Konsum verwenden. Ein Anteil der Personen hat noch nie ein Safer- Use Gespräch über den intravenösen Konsum von Benzodiazepinen geführt. 3.5.1 Harm- Reduction in der Klinischen Sozialen Arbeit: Das biopsychosoziale Modell als Grundlage Nach dem biopsychosozialen Modell von Uexküll und Wesiack sind Menschen biopsychosoziale Einheiten. Gesundheitliche Probleme können so auch physischen, psychischen und sozialen Systemen zugeordnet werden. Diese Systemebenen sind untrennbar miteinander verwoben und kommunizieren untereinander. In diesem Modell sind Lebewesen eine Einheit aus Umwelt und Organismus. Dabei kommt es zu andauernden Assimilations- und Akkomodationsprozessen. Im Idealfall entsteht eine 24 Passung, indem die Anforderungen und Ressourcen des Gefüges ausgeglichen sind. (vgl. Binner/ Ortmann 2008: 74) Um mit der Umwelt kommunizieren zu können, muss das lebende System mit der Umwelt in Beziehung stehen. Informationen über Wirkung und Inhalt des Kommunizierten kann das lebende System an der Spiegelung des Gegenübers ablesen. Gesundheit lässt sich so als intaktes Beziehungsgefüge interpretieren und Krankheit als ein gestörtes Beziehungsgefüge. Sollen Passungsstörungen erst überhaupt nicht entstehen, müssen auf allen drei Ebenen, der biologischen, der psychischen und der sozialen, ständig Beziehungen aufrechterhalten werden. (vgl. ebenda) Passungstörungen sind im menschlichen Leben immanent. Durch Veränderung der Umwelt oder des Organismus kann es jederzeit zu Störungen oder sogar zu einem Verlust von Passungen kommen. Werden grundlegende soziale Bedürfnisse wie die Teilnahme an Gemeinschaft, Anerkennung, Gerechtigkeit, Autonomie und emotionale Zuneigung nicht erfüllt, kann das genauso gravierende Auswirkungen haben, wie unerfüllte biologische und psychische Bedürfnisse. (vgl. Binner/ Ortmann 2008: 75) Nach dem biobsychosozialen Modell kommen den sozialen Faktoren die gleiche Bedeutung zu wie den somatischen und psychischen Faktoren. Daraus lässt sich ein Auftrag für die Klinische Soziale Arbeit ableiten. Unter anderem sind es Konzepte wie die Harm- Reduction, die Schadensminimierung, mit der die Klinische Soziale Arbeit diese Grundlage in der Praxis umsetzten kann. Safer- Use Beratung ist Teil der Konzeption der niederschwelligen, akzeptierenden Drogenarbeit. Die Weitergabe von Informationen über Hilfemöglichkeiten, wie im Konzept der sozialen Unterstürzung und der Beitrag zur Gesundheitsförderung Profession.(vgl. Binner/ Ortmann 2008: 75f) 25 sind somit zentrale Bestandteile der 4 Literaturbearbeitung In diesem allgemeinen Teil werden die, für das Verständnis dieser Forschungsarbeit, zentralen Begriffe definiert. Auch hier finden sich die wichtigsten Hypothesen, die aus den Bestimmungen abgeleitet werden können, am Ende des jeweiligen Kapitels. 4.1 Drogenkonsum - wie unterschieden werden kann Der Begriff „Drogenkonsum“ kann auf vielfältige Weise unterschieden werden. Bezogen auf den theoretischen Hintergrund, anhand dessen die Thematik betrachtet wird, ergeben sich andere Muster und Problemlösungsstrategien: eine Möglichkeit ist die Unterscheidung nach der sozialen Inszenierung des Konsums. Eine andere ist die nach dem Bezug zum Alltag. Auch nach den Konsumgründen kann differenziert werden. Nicht zuletzt kann der Drogenkonsum auf Genuss, Gebrauch und problematischen Konsum überprüft werden. Nicht näher eingehen möchte ich auf rein biologische Hypothesen, die besagen, dass Menschen aufgrund von genetischen Ursachen oder aufgrund von pharmakologischen Wirkungen an Sucht erkranken und deswegen zum Schluss kommen: die Substanzen gehören prinzipiell verbannt. (vgl. Barsch 2010: 61ff) Unterschieden werden muss auch hinsichtlich der Begriffe „Drogenmissbrauch“ und „Sucht“. Hier ist in der Vergangenheit nicht differenziert worden, wobei das den vielfältigen Konsummustern der Menschen nicht gerecht wird. Es ist ein falsches Bild geschaffen worden, indem die unproblematischen Konsumformen ausgeblendet worden sind. Das ist geschehen, obwohl sowohl bei legalen als auch bei illegalen Substanzen die risikoarmen Konsummuster überwiegen. (vgl. Barsch 2010: 63f) Drogenkonsum lässt sich allgemein als Substanzkonsum beschreiben, der verschiedenste Konsummuster und Umgänge mit psycho-aktiven Substanzen inkludiert. Es ist nur die menschliche Handlung gemeint, die auf das Konsumgut ausgerichtet ist. Das ist der Verzehr oder der Verbrauch in welcher Form auch immer. (vgl. Barsch 2010: 64) Hypothese: Stimmt die Aussage von Barsch (2010- siehe oben), müssen auch bei den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit die risikoarmen Konsummuster überwiegen. 26 4.2 Konsummuster von Drogen in Österreich Nach dem DOKLI- Bericht für 2008 haben in Österreich, im niederschwelligen Bereich, 74% der betreuten Personen schon mindestens einmal intravenös Drogen konsumiert. Frauen scheinen noch früher mit dem intravenösen Konsum zu beginnen als Männer. In allen Betreuungssettings, die in dem Bericht vorkommen, spielen Opiate die bedeutendste Rolle als Leitdroge, gefolgt von Cannabis und Tranquilizern. Es zeigt sich auch, dass in Österreich Opiaten noch immer eine zentrale Bedeutung hinsichtlich des problematischen Drogenkonsums zukommt, im Gegensatz zu anderen EULändern. Der Altersmedian für den Erstkonsum liegt zwischen 17 und 20 Jahren. Die häufigste Einnahmeform von Heroin ist das „Sniffen“, mit 50%, gefolgt von der intravenösen Applikation. Viele beginnen nasal zu konsumieren und steigen erst später oder nie um. (vgl. DOKLI- Bericht 2010: 40ff) Hypothese: Frauen beginnen früher als Männer mit dem intravenösen Konsum. 4.3 Abhängigkeit Abhängigkeit ist kein einheitliches Phänomen. Es kann die unterschiedlichsten Symptome für Abhängigkeit geben. Verallgemeinerung ist nur auf das so genannte Craving, das starke Verlangen nach der Einnahme der Substanz möglich. Die Diagnose „Substanzabhängigkeit“ hat keine Aussagekraft bezüglich körperlichen, psychischen oder sozialen Folgeschädigungen. (vgl. Uchtenhagen 2000: 2) „Abhängigkeit wird übereinstimmend definiert als eine Gruppe von körperlichen Verhaltens- und kognitiven Phänomenen, bei denen der Konsum einer Substanz eine hohe Priorität hat. Ein entscheidendes Merkmal ist das dringende, oft übermächtige Verlangen nach der Droge sowie fortgesetztes Verhalten zur Erlangung der Droge. Die Auslöser sowie die Folgen können psychischer, biologischer oder sozialer Natur sein.“ (Uchtenhagen 2000: 2) Abhängigkeit oder „Sucht“ ist somit nicht nur als biosomatische oder psychiatrische Krankheit zu verstehen und nach den Grundlagen der Medizin zu behandeln. Dazu fehlt, wie bereits oben erwähnt, das einheitliche Muster und die Eigendynamik. So gibt es auch keine Hinweise, dass bestimmte Konsummuster unbedingt eine Verschlechterung der Lebenssituation bedeuten oder der Willen der Person davon kontrolliert wird. (vgl. Barsch 2010: 119) Zusammenfassend lässt sich der Begriff Abhängigkeit als ein komplexes Phänomen beschreiben, dass sich in den biopsychosozialen Lebenssituationen des Menschen 27 manifestiert. Diese Ebenen sind eng miteinander verknüpft (siehe biopsychosoziales Modell von Uexküll und Wesiack Kapitel 3.7.1) und durchdringen sich gegenseitig. Es lassen sich Symptomatiken in allen Bereichen des menschlichen Daseins gedanklich differenzieren: Entzugssymptome, Toleranzentwicklung, Craving und psychosoziale Vernachlässigung. (vgl. Barsch 2010: 137f) Hypothese: Die hohen Dosen an Benzodiazepinen, die regelmäßig von manchen KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit konsumiert werden, lassen auf eine bestehende Toleranz und somit auch auf eine bestehende Abhängigkeit schließen. 4.3.1 Mehrfachabhängigkeit und polyvalenter Konsum Verschiedene Drogen gleichzeitig zu konsumieren bedeutet, dass sich die KonsumentIn einem erhöhten Risiko aussetzt. Es steigt mit der Anzahl der kombinierten Substanzen. Die summierte Wirkung ist kaum abschätzbar. Neben der Substitution werden von der KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit vor allem jene Substanzen zusätzlich konsumiert, die leicht zur Verfügung stehen. Dazu gehört Alkohol genauso wie Medikamente aus der Reihe der Benzodiazepine. Bei dauerhaftem Konsum von mehreren Substanzen, kann es auch zur Mehrfachabhängigkeit kommen. (vgl. Poehlke 2005: 273) Mischkonsum kann, bei dauerhaftem Konsum einer Substanz, in der Situation eines Versorgungsengpasses auftreten. Ebenso kann als Mischkonsum definiert werden, wenn DrogenkonsumentInnen Substanzen zur Stimmungsmodulation wechseln. Wichtig dabei ist, dass mindestens zwei Substanzen in einem so engen Zeitraum konsumiert werden, sodass sich die Rauschwirkung überlagert. (vgl. Poehlke 2005: 274) So stellen Benzodiazepine, die während der Opioid- Substitution konsumiert werden, ein beachtliches gesundheitliches Risiko dar. Nicht nur wegen der Wirkung der Medikamente selbst, sondern auch wegen eventuell anderer eingenommer Präparate, wie sie bei einer chronischen Hepatitis oder einer HIV Infektion zum Einsatz kommen. Die Interaktionen der Medikamente untereinander ist kaum vorhersagbar. Zu unterschiedlich sind Halbwertszeiten und Anflutungszeiten im Körper. (vgl. Poehlke 2005: 275) Mittlerweile ist der Beikonsum von psychotropen Substanzen keine Kontraindikation der Substitutionsbehandlung mehr. Wegen der besonderen Risiken ist die sozialmedizinische Behandlung zur Schadensminimierung induziert. Erst wenn auf 28 allen biopsychosozialen Ebenen keine Veränderung festgestellt werden kann, sollte die Behandlung in Frage gestellt werden. (vgl. Haltmayer/ Rechberger/ u.a. 2009: 295) Hypothese: In der niederschwelligen Drogenarbeit gibt es einen gewissen Anteil an KlientInnen, die mehrere Substanzen gleichzeitig konsumieren. 4.4 Drogenmissbrauch Genauso wie beim Begriff „Abhängigkeit“, muss auch beim Begriff „Drogenmissbrauch“ nach Sichtweisen differenziert werden. Alle Zugänge haben gemeinsam, dass Drogenmissbrauch als problematische Konsum definiert wird. In der Literatur werden juristische, medizinische, therapeutische Betrachtungen des Themas, als auch Definitionen über Grenzmengen beschrieben. Im Folgenden wird auf die therapeutische Sichtweise und die medizinischen Grenzmengen näher eingegangen. (vgl. Barsch 2010: 93f) Grundsätzlich als problematisch angesehen werden Konsumformen von Substitutionsmitteln und Tranquilizern, die von der medizinisch verordneten Form abweichen. Ein Beispiel dafür ist der intravenöse Konsum der Benzodiazepintabletten. Hier gilt der Safer- Use Satz: „Pillen sind zum Schlucken da“ (vgl. Haltmayer/ Rechberger/ u.a. 2009: 296) 4.4.1 Drogenmissbrauch nach DSM-IV In der Definition des DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), die unter anderem in therapeutischen Settings benutzt wird, werden die komplexen Verflechtungen des Konsums von psychoaktiven Substanzen berücksichtigt. Drogenkonsum wird als eine Handlung gesehen, die nicht nur auf medizinischer und individueller Ebene, sondern auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche wirkt. Genauso ist der Einfluss des Konsums nicht nur für die Gesundheit der KonsumentInnen maßgeblich. Weitere Probleme geraten so in Verbindung zum Substanzkonsum. (vgl. Barsch 2010: 100) Nach dem DSM-IV müssen folgende Problemlagen vorliegen, um in die Kategorie Missbrauch zu fallen: Nicht Einhaltung der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen wie der Arbeit, in der Schule oder dem Haushalt 29 Substanzgebrauch in Situationen, die zu einer körperlichen Gefährdung führen können. Konflikte mit der Justiz aufgrund des Substanzgebrauchs Konflikte auf sozialer und zwischenmenschlicher Ebene, die durch die Wirkung der Substanz noch zusätzlich verstärkt werden oder in Zusammenhang mit dieser stehen. (vgl. Barsch 2010: 100) Hypothese: Speziell der intravenöse Substanzgebrauch ist bei einigen der KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit nach der Definition des DSM-IV als Missbrauch zu interpretieren. 4.4.2 Drogenmissbrauch, nach Grenzmengen definiert Mit medizinisch festgelegten Mengengrenzen sollen Empfehlungen zur Verfügung stehen, um darüber liegenden Konsum als Risiko für die Gesundheit einzustufen. Diese Richtlinien werden im Allgemeinen von Wahrscheinlichkeiten abgeleitet, mit der schädigende Ereignisse eintreten. Für diese Berechnungen werden unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsangaben verwendet. Umso niedriger die Grenze für das Restrisiko angesetzt wird, umso niedriger sind auch die Empfehlungen für den Konsum. So lassen sich auch die großen Schwankungen für die Grenzwerte des täglichen Alkoholkonsums begründen. Die WHO gibt für Männer 40g und für Frauen 20g reinen Alkohol täglich an. In den USA wird die Grenze anders definiert: 24g für Männer und 12g bei Frauen. Um auszuschließen, dass - welche Krankheit auch immer – auf Alkohol zurückzuführen ist, würde die Empfehlung lauten, gar keinen Alkohol zu trinken. (vgl. Barsch 2010: 95f) Mengenangaben werden vielfältig kritisiert. So hat die gleiche Menge einer Substanz nicht die gleiche Auswirkung auf den Organismus. Auch die gesundheitlichen Folgen sind aufgrund von unterschiedlichen Konstitutionen oder Toleranzen sehr unterschiedlich. Außerdem liegen den biomedizinischen Empfehlungen auch soziale Normative zugrunde, die Einfluss auf die Ergebnisse haben. Konsumformen werden so problematisiert, obwohl sie keine Schädigung verursachen. Teilweise werden einzelne Handlungen überbewertet. Die Bestimmung des Drogenmissbrauches anhand von Grenzmengen hat deshalb nur beschränkte Gültigkeit. (vgl. ebenda) Auch für die Benzodiazepine, die von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit am häufigsten konsumiert werden, finden sich Angaben zur Grenzmenge. Die Tages- Höchstdosis für Oxazepam, aufgeteilt auf drei Tagesdosen, liegt bei 300 mg. Äquivalent dazu sind 7,5 mg Flunitrazepam. Das entspricht 6 Stück 30 Praxiten® und 7 Stück Somnubene® oder Rohypnol®. (vgl. Haltmayer/ Rechberger/ u.a. 2009: 296) Da sich die Grenzmengen für eine statistische Analyse der Konsummuster anbieten, sind sie auch in der Forschungsarbeit zur Überprüfung des problematischen Konsums gewählt worden. Hypothese: Ein gewisser Anteil von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit wird über den medizinische festgelegten Grenzmengen für die jeweiligen Präparate liegen. 4.5 Folgen des Missbrauchverhaltens Die Folgen des Missbrauchsverhaltens werden auf verschiedenen Ebenen wirksam. Aufgezählt werden in der Literatur unter anderem somatische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, soziale Folgen und Suizid. Wichtig ist dabei, dass, auf lange Sicht, Dosis- und Wirkungszusammenhänge schwer zu erfassen sind. Außerdem sind Kausalitäten schwer zu erfassen, da es noch andere Faktoren außer der Substanzeinnahme gibt. (vgl. Bühringer/ Bauernfeind u.a. 2000: 140f) 4.5.1 Somatische Erkrankungen Je nach Substanz sind auch die somatischen Erkrankungen unterschiedlich. Infektionskrankheiten sind bei dem Konsum von illegalen Drogen sehr häufig. Das hängt unter anderem mit dem i. v. Konsum zusammen. (vgl. ebenda und siehe auch Kapitel 3.3.3.2) Hepatitis ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen durch den intravenösen Konsum. Durch die Abgaben von sterilen Spritzensets ist die Infektionsrate von HIV erfolgreich gesenkt worden, nicht aber von Hepatitis B und C. Die Prävalenzrate der intravenösen DrogenkonsumentInnen liegt in Wien bei Hepatitis B ungefähr bei 50%, die von Hepatitis C sogar bei 80,3%. (vgl. Haltmayer 2007a: 107) 4.5.2 Psychische Erkrankungen Außer der häufig beobachtbaren psychischen Abhängigkeit ist der Konsum von illegalen Drogen, Alkohol und psychotropen Medikamenten wie Benzodiazepinen verbunden mit psychischen Erkrankungen. Komorbiditäten sind zu Funktionsstörungen 31 nachgewiesen. Darunter fallen Wahrnehmungs-, Sprach- und Gedächtnis- störungen. Hinzu kommen schwerwiegende Erkrankungen wie akute Psychosen. (vgl. Bühringer/ Bauernfeind u.a. 2000: 140f) Hypothese: Benzodiazepine werden konsumiert um die Symptome (Unruhe, Anspannung) von psychischen Krankheiten zu behandeln. 4.5.3 Soziale Folgen Lang anhaltender Missbrauch von Drogen hat viele negative soziale Folgen. So kann dies bei Jugendlichen zum Schulabbruch führen und bei Erwachsenen zum Verlust des Arbeitsplatzes. Außerdem kommt es häufig zu Belastungen innerhalb der Familie. Ein Beispiel dafür sind Misshandlungen von Kindern und Ehepartnern und eine erhöhte Scheidungsrate. Finanzielle Schwierigkeiten und der Verlust der Wohnung sind ebenfalls soziale Folgen des missbräuchlichen Drogenkonsums. (vgl. Bühringer/ Bauernfeind u.a. 2000: 140f) Hypothesen: TeilnehmerInnen der Studie werden einen niedrigen Bildungsabschluss haben. TeilnehmerInnen der Studie werden häufig arbeitssuchend oder in Pension sein. 4.5.4 Suizid Es kann davon ausgegangen werden, dass ungefähr 10% aller Drogentodesfälle als Suizid zu betrachten sind. Diese Zahl hat sich aufgrund von gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergeben. (vgl. Bühringer/ Bauernfeind u.a. 2000: 140f) Im Bericht zur Drogensituation 2010 vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen wird die Zahl der Drogentoten, die an einer Intoxikation von Opiaten und „psychoaktiven Medikamenten“ gestorben sind, mit 75 Personen angegeben. Das ist ein großer Anteil, nimmt man im Vergleich dazu die Gesamtzahl von 187 Drogentoten im Jahr 2009. (vgl. ÖBIG 2010: 169) Hypothese: Von einem Großteil der befragten Personen wird beides konsumiert: Opiate in Kombination mit Benzodiazepinen. Diese gesundheitlichen Risiko aus. 32 Gruppe setzt sich einem hohen 4.5.5 Prostitution Drogenkonsum kann eine Bewältigungsstrategie der Prostitutionstätigkeit sein. Hier sind aussagekräftige Zitate von qualitativen Interviews einer Schweizer Forschungsarbeit (Gugenbühl/ Berger 2001) zum Thema Prostitution und Risikowahrnehmung: „ 'Es ist halt, wenn ich anschaffe, brauche ich schon, muss ich mich zuputzen, auch wenn ich das Methadon habe. Ich kenn keine Frau, die das nüchtern machen kann, den Strassenstrich.' “ (Gugenbühl/ Berger 2001: 79) Und außerdem: „ 'Weil die Gier nach dem nächsten Knall ist einfach stark und dann scheisst es dich halt auch an, wenn du einen Freier gemacht hast, nachher psychisch schaltest du gerne auch ab.' “ (Gugenbühl/ Berger 2001: 79) In der zitierten SexarbeiterInnen Studie Drogen kommen zum die ForscherInnen „abschalten“ nach zum der Ergebnis, Arbeit dass konsumieren. Benzodiazepine werden in diesem Fall aber nicht erwähnt. (vgl. Gugenbühl/ Berger 2001: 79) Hypothese: Unter den Frauen könnte es Personen geben, die Benzodiazepine nutzen um die Prostitutionstätigkeit zu bewältigen. 4.6 Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Konsumverhalten von Suchtmitteln 4.6.1 Konsum illegaler Drogen Bei einer Studie über den Konsum von illegalen Drogen mit adoleszenten Personen in München und Umgebung haben sich am Geschlecht differenzierbare Prävalenzen für Drogenabhängigkeit ergeben. Nach DSM-IV hat sich ein Anteil von 2% ergeben, wobei 1,6% Frauen und 2,5% Männer gewesen sind. Zahlen sind auch zum Drogenmissbrauch erhoben worden. 2,9% der Stichprobe haben nach der Definition des DSM-IV Drogenmissbrauch betrieben. Davon sind 1,8% Frauen und 4,1% Männer gewesen. Man kann von einem Geschlechterverhältnis von 1:1,5 ausgehen. So ergibt sich auch für die USA eine ähnliche Lebenszeitprävalenz für Drogenabhängigkeit: Für Frauen liegt sie bei 3,3% und bei Männern bei 4,9%. (vgl. DOKLI 2010: 50) 33 Im DOKLI- Bericht wird außerdem festgehalten, dass Frauen die Drogenberatungsstellen aufsuchen im Durchschnitt jünger sind als Männer. Hinzu kommt, dass sie eine schwerere Drogenproblematik aufweisen als Männer. (vgl. DOKLI 2010: 50) 4.6.2 Drogenkonsum und Männlichkeit: Risikoverhalten als spezifisch männliches Verhalten Die Gestaltung eines drogendominanten Lebensstils ist eingebettet in männliche dominierte Lebenswelten. Es geht darum eine Form von Männlichkeit herzustellen. Ein Beweis von Männlichkeit ist dort wichtig, wo ein Ausschluss von einer gesellschaftlich anerkannten Tätigkeit besonders stark erfolgt. Macht, Kontrolle, Status rücken so in den Vordergrund. Das ist für viele die letzte Ressource von Selbstwert. Wichtig ist aber, Drogenkonsum nicht nur als geschlechtsspezifisch männliches Phänomen wahrzunehmen. (vgl. Friedrichs 2006: 184ff) Allgemein kann die Funktionalität des Risikoverhaltens bestimmt werden als: Statushandlung und Stilbildung Konformitätsübung und Bewährungsprobe Bewältigungsversuch Kompensation und Betäubung Normverletzung als Ausdruck der Ablehnung Risikofreudigkeit Hypothesen: Blaue Lippen sind ein Stilmittel bei den befragten Personen und eine weitere Ursache für den oralen Konsum. Intravenöser Konsum ist der Ausdruck von Risikofreudigkeit bei Männern. Kompensation und Betäubung wird erreicht durch den Konsum von Benzodiazepinen. Die Substanz ist eine Bewältigungsstrategien von Schmerzen und Entzugserscheinungen. 4.6.3 Konsum psychotroper Arzneimittel Speziell im Bereich der Einnahme psychotroper Arzneimittel konnte nachgewiesen werden, dass Frauen höhere Konsumraten aufweisen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das für alle Konsumformen gilt, also auch für die nicht missbräuchliche 34 Verwendung und Niedrigdosis- Abhängigkeiten. Es konnte nachgewiesen werden, dass Frauen häufiger seelische Störungen haben und deswegen Benzodiazepine verschrieben bekommen. Von allen Benzodiazepin- Verschreibungen in Deutschland sind 70% für Frauen. Hinzu kommt, dass der Konsum von psychotropen Substanzen die Mortalität beeinflusst. Verlässliche Zahlen sind dazu nicht vorhanden. (vgl. Bischof/ John 2002: 345f) 4.7 Geschlechtsunterschiede bei den Ursachen der Abhängigkeit – Ätiologie 4.7.1 Genetische Ursachen und familiäres Umfeld Studien belegen, dass Männer ein höheres genetisches Risiko als Frauen haben alkoholabhängig zu werden. Männer reagieren allgemein eher auf die genetische Disposition als Frauen. Letztere scheinen unter einem stärkeren Einfluss des familiären Hintergrundes zu sein. Der Alkoholismus in der Herkunftsfamilie scheint für Frauen prädikativ für eine eventuelle spätere Abhängigkeitserkrankung zu sein. Bei Männern ist außerdem nachgewiesen worden, dass der sozialökonomische Status der Herkunftsfamilie ausschlaggebend ist. (vgl. Bischof/ John 2002: 347) 4.7.2 Gewalt und sexueller Missbrauch Frauen die eine Substanzkonsum Abhängigkeitserkrankung entwickeln, haben in ihrer oder einen Vergangenheit missbräuchlichen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sexuellen Missbrauch oder physische Gewalt erlebt. Hinzu kommen im Laufe des Lebens erworbene Faktoren wie niedriges Selbstwertgefühl, Depression, posttraumatische Belastungsstörungen, autoaggressive sexuelle Konflikte. (vgl. Bischof/ John 2002: 347f) 35 Verhaltensweisen und 5 Die Organisation Zieht man die Definition der niederschwelligen Drogenarbeit heran (siehe Kapitel 3.1) hat diese Begriffsbestimmung, zum Zeitpunkt der Erhebung, auf zwei Einrichtungen in Wien zugetroffen: die sozial- medizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt und das TaBeNo3. In diesem Kapitel soll nur auf die Einrichtung fokussiert werden, in der auch die Erhebung stattgefunden hat, nämlich im Ganslwirt. 5.1 Die sozial-medizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt In Wien gibt es derzeit zwei niederschwellige Einrichtungen der akzeptierenden Drogenarbeit, die vorrangig von Menschen aus der Straßenszene frequentiert werden. Das sind die sozial-medizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt und das TaBeNo. Beide Einrichtungen haben ein Tageszentrum und einen Spritzentausch als Angebot für intravenös konsumierende Menschen. 2011 wurden, alleine im Ganslwirt, durchschnittlich 4.357 Spritzen pro Tag getauscht. (vgl. Suchthilfe Wien gGmbH 2012: 8) Im Jahr 2011 haben 727 Personen die psychosoziale Leistungen im Ganslwirt in Anspruch genommen. Hinzu kommen 1.355 Personen, die auch medizinisch betreut worden sind. Der Frauenanteil liegt bei 27 Prozent im psychosozialen Bereich und 28 Prozent bei den medizinischen Angeboten. Dabei sind die Frauen mit einem Median von 28 Jahren wesentlich jünger als die Männer. Bei letzteren liegt der Median bei 31,1 Jahren. Umso älter die Personengruppe ist, umso größer ist auch der Anteil an Männern.(vgl. Suchthilfe Wien gGmbH 2012: 9) 5.2 Zielgruppe Im Tätigkeitsbericht des Ganslwirts über das Jahr 2011 ist die Zielgruppe folgendermaßen definiert worden: „Personen, die im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen psychische, körperliche und soziale Beeinträchtigungen erfahren. Schwerpunktmäßig handelt es sich dabei um Personen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. “ (vgl. Suchthilfe Wien gGmbH 2012: 8) Der Schwerpunkt betrifft somit die Drogen- Straßenszene von Wien. 3 Anm.: TaBeNo bedeutet Tageszentrum, Beratung, Notschlafstelle 36 5.3 Die Drogen- Straßenszene Die Drogen-Straßenszene ist dadurch gekennzeichnet, dass der Drogenkonsum im Freundes- oder Bekanntenkreis und in der Öffentlichkeit stattfindet. Es kann sich bei dem Ort genauso um ein Lokal, wie um einen Ort im Freien handeln. In manchen Fällen sammeln sich die Konsumpartner an bestimmten Konsumorten, was zur Bildung einer Drogenszene führt. Eine Eigenschaft dieser Szenen ist auch, dass sie über die direkt beteiligten Personen hinaus bekannt sind und auch genutzt werden um Drogen zu handeln. (vgl. Eisenbach- Stangl/ Pilgram/ Reidl 2008: 122f) 5.4 Die Drogen- Straßenszene in Wien Die Straßenszene, oder auch „offene Szene“, in Wien hat sich anfänglich in Diskotheken oder Parks aufgehalten. In den 80iger Jahren ist Straßenszene auch vermehrt an Verkehrsknotenpunkten wie dem Karlsplatz sichtbar geworden. Anfang der 90iger Jahre haben sich dort mehrere hundert Personen täglich aufgehalten. Im weiteren Verlauf hat sich die Drogen-Straßenszene, bedingt durch polizeiliche Repression, an mehreren Orten in der Stadt etabliert. Die offene Szene wurde dezentralisiert und sowohl auf U-Bahnstationen als auch auf die Umgebung von Drogenbetreuungseinrichtungen verteilt. Mobilität und Standortwechsel gehören zu den Merkmalen dieser Gruppe. (vgl. Eisenbach- Stangl/ Pilgram/ Reidl 2008: 122f) Die Drogenszene differenziert sich nach den gebrauchten Substanzen und der Marginalisierung der KonsumentInnen. Da in den 90iger Jahren die Qualität des Heroins abnimmt, greifen die Menschen gerne auf Substitutionsmittel zurück. Die Reinheit der Ersatzdrogen ist immer gleich. Gleichzeitig steigt der Mischkonsum von Substitutionsmedikamenten und Alkohol und Tabletten, um den gewünschten „Kick“ zu erzielen. Substitutionsmittel werden auch oft intravenös konsumiert. Der polyvalente Konsum verursacht, unter anderem, gesundheitliche Probleme. (vgl. ebenda) Hypothesen: Die Reinheit der Medikamente, nicht nur von den Substitutionsmitteln, sondern auch von Benzodiazepinen, ist ein Grund für deren Konsum. Sicherheit ist auch für die DrogenkonsumentInnen wichtig. Medikamente wie Benzodiazepine werden häufig auf der Straße gekauft. 37 6 Forschungsdesign Im folgenden sollen die methodischen Herangehensweise beschrieben werden. Das inkludiert die ethische Bewertung der Forschungsfrage, die Beschreibung des Fragebogens, die Interviewsituation und die Stichprobenbeschreibung. 6.1 Methode der Forschung Nach einer Literaturrecherche zur Bildung von Hypothesen beziehungsweise der Fragestellung und dem Einbringen von persönlicher Erfahrung ist in dieser Forschungsarbeit nach den Methoden der quantitativen Datenerhebung vorgegangen worden. Außerdem ist für die Generierung der Fragebogenitems eine explorative Vorerhebungen mittels Interviews mit der ärztlichen Leitung der sozialmedizinischen Drogenberatungsstelle Ganslwirt und den KlientInnen derselben Einrichtung durchgeführt worden. Nach der detaillierten Aufführung der Sachverhalte in den letzten Kapiteln wird nun der standardisierte Fragebogen genau beschrieben. Um vielfältige Variablen beschreiben zu können ist nach der Methode des Zuordnens von Rangordnungen in Form einer schriftlichen Befragung vorgegangen worden. Die Fragen sind in ausgedruckter Form den TeilnehmerInnen ausgeteilt und dann von denselben beantwortet worden. Vorteilhaft dabei ist die einfache Anwendung und das erfassen einer großen homogenen Gruppe. Es geht in dieser Forschung nicht um Ursachenforschung, sondern vorrangig um das Schätzen von bestimmten Merkmalen in einer klar definierten Population mittels Stichproben. (vgl. Raab-Steiner/ Benesch 2012: 44) Das Ausfüllen des Fragebogens ist meist alleine und ohne Hilfe erfolgt, aber im Beisein anderer Menschen im Tageszentrum des Ganslwirts. Hat es Verständnis- schwierigkeiten gegeben, die meist auf die Wirkung der konsumierten Substanzen zurückzuführen gewesen sind, hat der Interviewer erklärend gewirkt. Selten musste der Forscher die Fragen vorlesen, weil die befragte Person zu beeinträchtigt zum Lesen gewesen ist. Die Befragung hat voll standardisiert stattgefunden. Das bezieht sich sowohl auf die Reihenfolge der Fragen, als auch auf die Antwortmöglichkeiten und die Formulierung der Fragen. Die Fragen sind weitgehend durch das Ankreuzen der zutreffenden Antwort zu beantworten gewesen. Die Charakterisierung der Antwortoptionen erfolgte nach Häufigkeit, wie z.B. „täglich – mehrmals täglich – einmal pro Woche – mehrmals pro 38 Woche – mehrmals pro Monat – nie“. Die Kategorisierung ist somit sechsstufig erfolgt und ist verbal etikettiert worden. Außerdem ist bei bei den Fragen nach den Gründen die Intensität durch eine Ratingskala von 0 bis 10 abgefragt worden: „0 = gar nicht, 10 = trifft zu“. Ein Feld mit „Sonstiges“ und „Andere“ hat es als Ergänzung zu Antwortmöglichkeiten gegeben. 6.2 Ethische Bewertung der Forschungsfrage Die ethische Bewertung der Forschungsfrage bedarf einer eigenen kritischen Betrachtung. Es geht dabei um die Balance zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und der Achtung der Menschenwürde. Speziell in humanwissenschaftlichen Disziplinen stellt diese Fragestellung ein besonderes Problem dar. (vgl. Raab-Steiner/ Benesch 2012: 40) So betreffen auch die Themen dieser wissenschaftlichen Arbeit weitgehend den privaten Bereich der StudienteilnehmerInnen. Die Privatsphäre muss von den Forschenden unbedingt respektiert werden. Grundsätzlich ist der Schutz des Privaten auch in der österreichischen Gesetzgebung festgeschrieben. Um diesen Vorsatz gerecht zu werden, ist im Vorhinein große Sorgfalt über die Aufklärung des Zieles dieser Untersuchung gelegt worden. Das hat auch die Zusicherung der Anonymität inkludiert, genauso wie die Freiwilligkeit der Teilnahme betont worden ist. Außerdem ist auf dem Fragebogen die Absicht der Forschung, in der Anrede und der Instruktion, inkludiert gewesen. Einzig zur aufrichtigen Beantwortung der Fragen ist aufgefordert worden, wobei frei gestellt wurde, eventuell unangenehme Bereiche einfach auszulassen. Dies sind Fragestellungen gewesen, die sehr intime Bereiche betreffen, wie zu Benzodiazepinkonsum und Prostitution. Für die Teilnahme an der Erhebung ist sowohl Dank ausgesprochen worden, als auch das Angebot eines Essens und eines Kaffees hat bestanden. Bei letzterem ist die Einrichtung, in der die Erhebung stattgefunden hat, sehr hilfreich gewesen. 6.3 Beschreibung des Fragebogens Der Fragebogen umfasst 85 Variablen und ist in drei Teile gegliedert. Konsummuster Gründe für den Benzodiazepinkonsum Sozialstatistik/ Sozialdemographie 39 Im ersten Teil des Fragebogens ist nach Konsummustern gefragt worden. Das bedeutet Fragen nach der konsumierten Menge und Art der Benzodiazepine, dem Ursprung der Substanz, der Konsumform, nach dem Alter beim ersten Konsum von Benzodiazepinen, den unterschiedlichen Konsumorten und der Kombinationen mit anderen Substanzen (es ist nur nach Alkohol und Opiaten gefragt worden). Außerdem konnten von den TeilnehmerInnen Angaben zum Straßenpreis machen und es sind genaue Informationen zum Alter beim ersten intravenösen Konsum allgemein und zum Alter vom ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen im Speziellen erhoben worden. In dieser Hinsicht ist auch Teil des Erhebungsinstruments gewesen, Fragen zu Safer- Use Maßnahmen zu beantworten. So ist nach der Verwendung von frischen Kolben und Nadeln, sowie Aufkochgefäßen, sterilen Filtern und sterilem Wasser gefragt worden. Die Fragen sind weitgehend durch das Ankreuzen der zutreffenden Antwort zu beantworten gewesen. Im zweiten Teil des Fragebogens ist nach den aktuellen Gründen für den Benzodiazepinkonsum gefragt worden. Diese sind nach dem biopsychosozialen Paradigma der Klinischen Sozialen Arbeit unterteilt. Das heißt es sind Fragen nach körperlichen, seelischen und sozialen Ursachen zu finden. Zur subjektiven Beurteilung der Konsumursachen von Benzodiazepin ist jeweils eine numerische Ratingskala von 0 bis 10 zur Verfügung gestanden, wobei 0= gar nicht und 10= trifft zu bedeutet hat. Der letzte und dritte Teil umfasst die Fragen zur Sozialstatistik. Das beinhaltet die Fragen nach Geschlecht, Alter, Familienstand, höchsten Schulabschluss, Berufsstand, Einkommen und Lebensort. Die exakten Fragen und die Antwortmöglichkeiten sind am Beginn jedes Abschnittes in der Auswertung zu finden oder im Anhang dieser Arbeit. Dort ist der komplette Fragebogen beigefügt. 6.4 Interviewsituation Für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit sind nur zwei niederschwellige Einrichtungen in Betracht gekommen, die bei der Veröffentlichung der Arbeit bereits nicht mehr existiert haben: das TaBeNo und der Ganslwirt. Beide Einrichtungen werden von einer sehr ähnlichen KlientInnengruppe frequentiert. Die Entscheidung, die Erhebung im Tageszentrum des Ganslwirts durchzuführen, ist zum einen wegen der bestehenden Erfahrung durch die Arbeitspraxis als Sozialarbeiter zu begründen. Zum anderen hat sich das Tageszentrum als idealer Ort herausgestellt, um TeilnehmerInnen für die Studie zu finden. Während der Erhebungsphase haben sich 40 teilweise über 100 Personen pro Tag in den Räumlichkeiten aufgehalten, wovon ein gewisser Anteil zu der Zielgruppe der Forschungsarbeit gehört hat. Die Bereitschaft zur Teilnahme der in der Drogenberatungstelle anwesenden Personen ist sehr groß gewesen, wodurch der angepeilte Stichprobenumfang von n=100 Personen innerhalb von elf Tagen im Feld erreicht worden ist. Die Interviews sind entweder direkt im Tageszentrum, oder in einem der zwei Büros der Einrichtung durchgeführt worden. Manche StudienteilnehmerInnen wollten das Ausfüllen der Fragebögen alleine durchführen. Andere haben um Hilfe beim Lesen der Fragestellungen gebeten. Die Ursachen dafür sind sowohl mangelnde Sprachkenntnis, als auch schwerwiegende Sedierung gewesen. Je nachdem in welchem Zustand die befragte Person gewesen ist, oder in welchem Ausmaß das Bedürfnis nach einem Gespräch vorhanden gewesen ist, haben sich starke Schwankungen in der Interviewdauer ergeben. Es sind Zeiten von zehn Minuten bis hin zu einer Stunde registriert worden, wobei ein Interview im Durchschnitt 15 Minuten in Anspruch genommen hat. Nur in seltenen Fällen ist das Ausfüllen des Fragebogens abgebrochen worden. Schlechte Erfahrung sind hingegen mit der Mitgabe der Fragebögen gemacht worden. Von den zehn Exemplaren, die KlientInnen mitgegeben worden sind, ist kein Einziges wieder zu dem Forscher zurückgekehrt. Die Befragungen im Tageszentrum haben meist im Sitzen an den Tischen im Aufenthaltsbereich oder im Stehen an den hohen Tischen im Raucherbereich stattgefunden. Dabei ist die Erhebung meist 1:1 durchführt worden, das heißt auf einen Forscher ist eine KlientIn getroffen. In seltenen Fällen ist das Verhältnis 1:2 gewesen, wenn zum Beispiel ein Pärchen befragt worden ist und sie zeitgleich den Fragebogen ausfüllen wollten. Die Aufgabe des Forscher ist dann darin bestanden ein Abschweifen zu vermeiden und eine gegenseitige Einflussnahme auf die Antworten zu verhindern. Das Tageszentrum im Ganslwirt ist mit einer Theke ausgestattet gewesen, an der Essen,Tee und Kaffee ausgegeben worden sind. Dies wurde an den umliegenden Tischen konsumiert, wobei auch selbst mitgebrachte Speisen und nicht alkoholische Getränke erlaubt waren. Zum Zeitpunkt der Erhebung ist es nur in einem speziell gekennzeichneten Bereich, im hinteren Teil des Tageszentrums, erlaubt gewesen, Zigaretten zu rauchen. Trotz eines gut besuchten Tageszentrums ist es in den meisten Fällen möglich gewesen, die Erhebung mit der befragten Person alleine durchzuführen. Ist das nicht der Fall gewesen und wurde eine weitere Person als Störung empfunden, ist sie gebeten worden, das Interview nicht zu unterbrechen. Das hat immer Wirkung gezeigt. Im Ganslwirt ist eigentlich immer ein großer Geräuschpegel zu bemerken gewesen. Durch die vielen anwesenden Menschen und die meist auch laufende Musik kann die 41 Stimmung als unruhig beschrieben werden. Bedacht werden muss auch, dass in dem Tageszentrum ein ständiges Kommen und Gehen geherrscht hat. All diese Faktoren stellten aber keine gröbere Störung dar. Insgesamt war der Ort ideal für die Erhebung, da durch die Präsenz in dem Aufenthaltsbereich die Aufmerksamkeit der KlientInnen auf die Forschungsarbeit gelenkt worden ist und so viele Menschen für das Projekt gewonnen werden konnten. Sollte sich in einigen, wenigen Situationen herausstellen, dass das Tageszentrum nicht der geeignete Ort für die Befragung war, konnte auf eines der Büros ausgewichen werden. Die Atmosphäre dieser Räumlichkeiten war wesentlich entspannter. Die TeilnehmerInnen, die diese Ruhe benötigten, forderten sie auch selber ein. Beim Ausfüllen des Fragebogens sind nur wenige geschlechtsspezifische Themen zum Tragen gekommen. Da sich in der niederschwelligen Drogenarbeit generell weniger Frauen als Männer finden, ist der Forscher offensiver auf Personen des weiblichen Geschlechts zugegangen. Das hat das Ziel gehabt, zumindest einen Frauenanteil von 20% zu bekommen, um ein gewisses Maß an Aussagekraft zu erreichen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten Personen auf den Fragebogen sehr positiv und interessiert reagiert haben. Nur die Fragen nach der Ursache der blauen Lippen in Zusammenhang mit dem Benzodiazepinkonsum und nach der Prostitutionstätigkeit löste Verwunderung, Abscheu und Verwirrung aus. 6.5 Stichprobenbeschreibung Die Basis für die empirische Untersuchung ist die Stichprobe von 100 Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren. Davon leben die meisten in einer eigenen Wohnung. Bei der Auswahl der befragten Personen ist nach vorhandenem Benzodiazepinkonsum und nach Sprachkenntnis selektiert worden. Hat das zugetroffen, ist jede KlientIn im Tageszentrum befragt worden. Das durchschnittliche Alter ist 31 Jahre. In der jüngeren Altersgruppe zwischen 18 und 28 finden sich fast genau so viele Personen wie in der älteren Gruppe der 29 bis 55- Jährigen. So hat sich die Stichprobe aus 77 Männern (77%) und 23 Frauen (23%) zusammengesetzt. Die Differenz kann sich durch „versteckte Wohnungslosigkeit“ bei Frauen und einer höheren Risikobereitschaft bei Männern erklärt werden, was auch Auswirkungen auf das Konsumverhalten hat. Männer sind so in niederschwelligen Drogenberatungsstellen häufiger anzutreffen als Frauen. Der Anteil an Frauen in dieser Studie ist repräsentativ für den Ganslwirt. Im Jahr 2011 sind 27% der betreuten Personen Frauen gewesen. Nimmt man die Gesamtzahl der 42 namentlich bekannten KlientInnen, nämlich 727 Personen, dann ist bei dieser Erhebung fast ein Siebentel erfasst worden. (vgl. Suchthilfe Wien gGsmbH 2012: 9) Aus internen Daten der Suchthilfe Wien gGsmbH geht hervor, dass mindestens 67% der betreuten KlientInnen Benzodiazepine konsumieren (von n=623), wobei bei vielen Personen nicht dokumentiert ist, ob Vertreter dieser Substanzgruppe eingenommen werden. Diese Daten sind für den Zeitraum 2011/12 gültig.4 Die meisten StudienteilnehmerInnen sind ledig, nämlich 65%, gefolgt von verheirateten Personen bzw. von Personen in Lebensgemeinschaft. 21% fühlen sich dieser Gruppe zugehörig. Geschieden oder getrennt lebend sind elf Personen und drei TeilnehmerInnen haben „verwitwet“ angegeben. Das Bildungsniveau der Probanden der Stichprobe ist eher gering, was aber durchaus den Bereich der niederschwelligen Drogenarbeit abbildet. 4% haben keinen Schulabschluss und 44% haben die Pflichtschule abgeschlossen. Eine Lehre oder eine berufsbildende Schule haben 43% der TeilnehmerInnen fertig gemacht. Neun Personen, das sind 9% der Stichprobe, haben Matura oder höheres. Die meisten befragten Personen sind zum Zeitpunkt der Befragung arbeitssuchend gewesen, nämlich 70%. Eine relativ hohe Anzahl ist bereits in Pension, nämlich 17%, gefolgt von 7%, die voll berufstätig sind. Des weiteren sind 2% Teilzeit beschäftigt, 3% sind geringfügig beschäftigt und eine Person hat keine Angabe zum Erwerbsstatus gemacht. Das monatliche Einkommen der meisten Personen, das sind 67%, liegt bei bis zu 752€ (Mindestsicherungsrichtsatz 2011) und damit unter dem aktuellen Mindestsicherungsrichtsatz von 773€. 25% der StudienteilnehmerInnen haben angegeben, dass sie zwischen 753€ und 1000€ pro Monat an Einkommen zur Verfügung haben. Der Rest, das sind 5%, bekommt über 1000€ oder hat keine Angabe (3%) zum Einkommen gemacht. Mehr als die Hälfte der befragten Personen ist nicht in einer eigenen Wohnung zu Hause. 38% geben an in einer eigenen Wohnung zu leben. 27% haben angegeben wohnungslos und somit auf der Straße oder im Notquartier zu sein. Relativ viele haben die Kategorie „Sonstiges“ gewählt. Diese 15% haben auf Nachfrage Orte wie die Wohnung von Verwandten oder Freunden gemeint, oder sie halten sich in einem Hotel auf. Damit entfallen die restlichen Angaben mit 8% auf Bekannte und mit 1% auf einen Dauerwohnplatz. 4 Es kann hier keine Literaturangabe gemacht werden, da es sich um Daten aus der internen Dokumentation handelt, die dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden sind. 43 Stichprobenmerkmale Absolut % Männlich 77 77 Weiblich 23 23 18-28 48 48 29-55 52 52 Ledig 65 65 Verheiratet/ Lebensgemeinschaft 21 21 geschieden/getrennt lebend 11 11 verwitwet 3 3 kein Pflichtschulabschluss 4 4 Pflichtschule abgeschlossen 44 44 Lehre/ Berufsbildende Schule 43 43 Matura oder höheres 9 9 voll berufstätig 7 7 teilzeitbeschäftigt 2 2 geringfügig 3 3 arbeitssuchend 70 70 in Pension 17 17 fehlend 1 1 bis zu 752 € 67 67 zwischen 753-1000 € 25 25 über 1000 € 5 5 fehlend 3 3 Eigene Wohnung 38 38 Dauerwohnplatz 1 1 Übergangswohnheim/Betr. Wohnen 11 11 Notquartier/ Straße 27 27 Bekannte 8 8 Sonstige 15 15 N = 100 100 100 Geschlecht Altersgruppen Familienstand Höchster Bildungsabschluss Erwerbsstatus Einkommen Wohnsituation Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung 44 7 Datenauswertung Im Folgenden wird die Analyse der erhobenen Daten im Bezug zur Literatur und den Begriffsbestimmungen dargestellt, wie sie in den Kapiteln 3 bis 5 behandelt worden ist. Es wird dabei auf die Bereiche Konsummuster und Ursachen des Benzodiazepinkonsums eingegangen. 7.1 Konsummuster von Benzodiazepinen In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Fragen zu den Konsummustern von Benzodiazepinen geklärt werden. Dafür werden die Ergebnisse auch graphisch dargestellt. Zuerst wird auf die Fragen eingegangen, woher und unter welchen Bedingungen die KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit Benzodiazepine beziehen. Anschließend soll gezeigt werde, welche Benzodiazepine konsumiert werden und wie oft. Bei dieser Gelegenheit wird auch überprüft, ob dabei definierte Grenzmengen überschritten werden. Daraufhin werden die Konsumformen aufgelistet und nach der Dauer der risikoreichsten Konsumform, des intravenösen Konsums, gefragt. In dieser Hinsicht ist auch relevant, ob es Safer- Use Gespräche zwischen KlientInnen und SozialarbeiterInnen oder ÄrztInnen gegeben hat. So wird auch geklärt, ob und wie die verfügbaren Konsumutensilien verwendet werden. Unter welchen Bedingungen der Konsum stattfindet, ist auch maßgeblich von der Örtlichkeit bestimmt. Schlussendlich wird die Frage beantwortet, mit welchen Substanzen die Benzodiazepine häufig kombiniert werden. 7.1.1 Bezugsquellen der Benzodiazepine Um die Bezugsquellen der Benzodiazepine zu erfassen, ist folgende Frage gestellt worden: „Woher beziehen Sie ihre Benzodiazepine (Mehrfachnennung möglich)?“ Die Antwortmöglichkeiten sind gewesen: „von meinem/meiner Arzt/ ÄrztIn“, „von mehreren Ärzten/ÄrztInnen“, „Straße/Szene“, „Freunde“, „Bekannte“, „Familie“ und „Sonstiges“. Für die bessere Lesbarkeit wurde in der Grafik die Formulierung ÄrztIn und ÄrztInnen gewählt. Jede Kategorie ist eine eigene Frage, die durch Ankreuzen mit „ja“ beantwortet werden konnte. 45 Abbildung 1: Bezugsquellen der Benzodiazepine, jede Kategorie entspricht dem Anteil von n=100 90,00% 81,00% 80,00% 70,00% 60,00% 54,00% 50,00% 40,00% 28,00% 30,00% 24,00% 20,00% 12,00% 10,00% 4,00% 2,00% m ilie Fa tig n So n Är zt In es n ne e nt an Be k Fr eu nd e e /S ze n ße Vo n m eh re re St ra Vo n m ei ne rÄ rz tIn 0,00% Das Diagramm veranschaulicht die Bezugsquellen der Benzodiazepine bei den KlientInnen des Ganslwirts. Bei der Erhebung sind Mehrfachantworten möglich gewesen, die Prozentzahl bezieht sich auf die Anzahl der Personen die zu der entsprechenden Kategorie mit „Ja“ geantwortet haben (n=100). Wie in der Literatur beschrieben, werden Benzodiazepine sehr oft vom Arzt oder der Ärztin verschrieben. 81% der Personen haben angegeben, ihre Medikamente von dort zu beziehen. Zwölf Prozent haben außerdem geantwortet, dass sie mehrere ÄrztInnen in Anspruch nehmen. Die Straße oder die Szene ist eine wichtige Quelle von Benzodiazepinen: 54% der DrogenkonsumentInnen kaufen die Substanz auf der Straße. Persönliche soziale Kontakte sind als nächstes gereiht: Freunde, mit 28% und Bekannte, mit 24%, tragen zur Versorgung mit dem Medikament bei. Nur zwei Prozent beziehen Benzodiazepine über die Familie und vier von einer anderen Quelle (Sonstiges). Um herauszufinden wie die DrogenkonsumentInnen ihre Versorgung sichern, ist zusätzlich gefragt worden, ob die Benzodiazepine per Rezept verschrieben werden. 46 7.1.2 Verschreibungen per Rezept Zum Verständnis der Relevanz der Szene ist zusätzlich diese Frage gestellt worden: „Beziehen Sie Benzodiazepine über ein Rezept/ bekommen Sie die Medikamente verschrieben?“ Es sind die Kategorien „ ja“, „nein“, „teilweise“ zur Beantwortung verfügbar gewesen. So soll sichtbar gemacht werden, dass zwar ÄrztInnen zur Versorgung mit Benzodiazepinen eine wichtige Rolle spielen, es aber noch andere, informelle Wege zu den Tranquilizern gibt. Abbildung 2: Anteile der Verschreibung per Rezept, n=100 50% 46,00% 43,00% 40% 30% 20% 11,00% 10% 0% ja nein teilweise Hier zeigt sich, dass 43% ihre Benzodiazepine über Rezept beziehen. Weitere 46% versorgen sich zusätzlich über andere Quellen, auch wenn sie die Medikamente verschrieben bekommen. 11% haben angegeben über kein Rezept zu verfügen, das heißt sie beziehen die Droge ausschließlich außerhalb des Gesundheitssystems. Bei jenen Personen, die auf der Straße kaufen, kommt es zu einem erheblichen finanziellen Aufwand. 54% der StudienteilnehmerInnen kaufen die Medikamente zumindest zeitweise auf der Straße. Im folgenden soll die Frage geklärt werden, welcher Preise im Durchschnitt für einen Streifen gezahlt wird. 7.1.3 Straßenpreise Die Straßenpreise für Benzodiazepine sind durch die Frage „Falls Sie auf der Straße kaufen, was ist der übliche Preis für einen Streifen (im Durchschnitt)?“ ermittelt worden. Zur Beantwortung ist ein offenes Antwortformat vorgegeben gewesen. Ein Streifen beinhaltet bei allen in dieser Arbeit behandelten Medikamenten zehn Tabletten. 47 Abbildung 3: Preis pro Streifen auf der Straße, n=91 60,00% 49,00% 50,00% 40,00% 30,00% 18,00% 16,00% 20,00% 8,00% 10,00% 0,00% bis zu 10€ über 10€ bis 13€ über 13€ bis 15€ über 15€ Im Durchschnitt wird ein Streifen Benzodiazepine in der Szene um 13,74€ gehandelt. Die Standardabweichung beträgt 2,64€. Der Wert 15€ ist am häufigsten genannt worden, 47 Personen kaufen um diesen Preis. 8% der Personen haben angegeben, für zehn Tabletten über 15€ zu bezahlen. 16% zahlen bis zu 10€. Weitere 18% zahlen mehr als 10€ und bis zu 13€. Insgesamt haben 91 StudienteilnehmerInnen einen Preis genannt. Um genauere Angaben zu den einzelnen Medikamenten zu bekommen, hätte die Frage anders gestellt werden müssen. In diesem Fall ist nicht zwischen den Präparaten differenziert worden. 7.1.4 Konsumierte Arten und Mengen von Benzodiazepinen Da es viele verschiedene Präparate auf dem Markt gibt, ist es wichtig gewesen durch die folgende Frage die konsumierten Benzodiazepine zu spezifizieren: „Um welches Benzodiazepin handelt es sich genau und wie viel konsumieren Sie auf einmal (Mehrfachnennung möglich)?“ Am Fragebogen sind vier Medikamente und eine offene Kategorie aufgelistet gewesen: „Somnubene®“, „Praxiten®“, „Rohypnol®“, „Anxiolit®“ und „Andere“. Neben dem Benzodiazepin konnte die konsumierte Anzahl eingetragen werden. Um die Häufigkeit des Konsums festzustellen sind jeweils die Antwortmöglichkeiten „täglich“, „mehrmals täglich“, „einmal pro Woche“, „mehrmals pro Woche“, „mehrmals pro Monat“, und „nie“ zur Auswahl gestanden. Für die Analyse sind sowohl die Kategorien „täglich“ und „mehrmals täglich“ zu „zumindest 1x täglich“, als auch „einmal pro Woche“ und „mehrmals pro Woche“ zu „zumindest 1x Woche“ zusammengefasst worden. 48 Abbildung 4: Konsumierte Benzodiazepine - Medikamente, jede Kategorie jeweils n=100 80,00% 74,00% 70,00% 60,00% 60,00% 50,00% 40,00% 31,30% 28,00% 30,00% 15,00% 20,00% 10,00% e er no yp R oh An d l® t® ly An xio n® xit e Pr a So m nu be ne ® 0,00% Bei der Frage nach den konsumierten Benzodiazepinen sind Mehrfachnennungen möglich gewesen. So sind entspricht der jeweilige Prozentwert dem Anteil von n=100. Von den KlientInnen des Ganslwirts werden am häufigsten schnell anflutende Medikamente, wie Somnubene® konsumiert. 74% haben angegeben dieses Präparat, dass den Wirkstoff Flunitrazepam enthält, zu konsumieren. Außerdem häufig vertreten ist das Medikament mit dem Handelsnamen Praxiten®, das den Wirkstoff Oxazepam enthält. 57% konsumieren diese Art von Benzodiazepin. Den gleichen Wirkstoff enthält auch das Medikament Anxiolyt®, welches von 31% genannt worden ist. Rohypnol®, ein weiteres flunitrazepamhältiges Medikament, wird von 27% konsumiert. Auf andere Substanzen in der Gruppe der Benzodiazepine entfallen 15%. Durch die gewählten Fragestellungen bei der Erhebung, sind im folgenden nur Aussagen darüber möglich, wie oft die Benzodiazepine der jeweiligen Kategorie auf einmal konsumiert werden. 49 Abbildung 5: Häufigkeit des Somnubene® - Konsums, n=74 45,00% 40,00% 40,00% 35,00% 30,00% 26,00% 25,00% 22,00% 20,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00% 0,00% zumindest 1x täglich zumindest 1x Woche mehrmals pro Monat nie 40% der befragten Personen (n=74) konsumieren Somnubene® täglich oder mehrmals täglich. Mehrmals pro Woche oder zumindest einmal pro Woche ist von insgesamt 22 Personen, das sind gleichzeitig 22 % der StudienteilnehmerInnen, besagtes Medikament eingenommen worden. Die restlichen 12% nehmen es mehrmals pro Monat. 26% der BenzodiazepinkonsumentInnen greifen „nie“ auf Somnubene® zurück. Zur Darstellung der bei einem Konsumvorgang eingenommenen Menge wird folgendes Diagramm herangezogen, wobei n=73 zu berücksichtigen ist. Die Kategorien in der Grafik sind entsprechen der Quartilsabstände geordnet. Abbildung 6: Wie viel Somnubene® auf einmal, n=73 35,0% 30,0% 30,1% 26,0% 23,3% 25,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 bis 3 Stück 4 bis 5 Stück 50 7 bis 10 Stück 12 bis 50 Stück Das erste Quartil beschriebt die Kategorie „1 bis 3 Stück“. Diese Menge wird auf von 30,1% der Gruppe auf einmal konsumiert. Weitere 23,3% konsumieren vier bis fünf Stück auf einmal. „7 bis 10 Stück“ konsumieren 26%, diese Gruppe ist teilweise schon über der medizinisch definierten Tagesdosis (bis zu 7 Stück Somnubene® über den Tag verteilt), wie aus der nächsten Auswertung und Darstellung ersichtlich wird. Die restlichen 20,5% entfallen auf die Personen, die „12 bis 50 Stück“ der Tabletten Somnubene® konsumieren. Abbildung 7: Überprüfung der Einhaltung der Grenzmenge bei Somnubene®, n=73 80,0% Somnubene® - innerhalb der Tagesdosis Somnubene® - Tagesdosis überschritten 67,5% 70,0% 60,0% 50,0% 39,4% 40,0% 39,4% 30,0% 21,2% 20,0% 20,0% 12,5% 10,0% 0,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat Wie schon in der Beschreibung der Benzodiazepine erwähnt, liegt die TagesHöchstdosis von Somnubene® bzw. Rohypnol® bei 7 Stück pro Tag. n=73 Personen sind in der Gruppe der Somnubene®- KonsumentInnen. Davon sind 40 StudienteilnehmerInnen innerhalb der definierten Tagesdosis und 33 Personen haben Angaben über der Grenzmenge gemacht. Wie auch in der Grafik ersichtlich wird, ist die Dosis beim Medikament Somnubene® in 39,4% der Fällen „zumindest einmal täglich“ und 39,4% der Fälle „zumindest einmal pro Woche“ überschritten. Außerdem ist bei 21,2% „mehrmals pro Monat“ die empfohlene Grenzmenge überschritten. Innerhalb der Tagesdosis sind 67,5% „zumindest einmal täglich“ und 20% „zumindest einmal pro Woche“. Die restlichen 12,5% sind „mehrmals pro Monat“ im Rahmen der medizinischen Empfehlung. Es lässt sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Konsums und der Häufigkeit der Tagesdosisüberschreitung feststellen. Der ChiQuadrat- Test ist mit einem p-Wert von 0,055 nicht signifikant (0 Zellen haben eine 51 erwartete Häufigkeit kleiner als 5). Von diesen Daten sind nur für Somnubene® alleine gültig, der zusätzliche Konsum von anderen Benzodiazepinen ist nicht berücksichtigt. Abbildung 8: Häufigkeit des Praxiten®- Konsums, n=60 45,0% 41,0% 40,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 11,0% 8,0% 10,0% 5,0% 0,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat nie In dieser Gruppe (n=60) konsumieren 41% der befragten Personen Praxiten® täglich oder mehrmals täglich. 8% der StudienteilnehmerInnen nehmen das selbe Präparat zumindest einmal pro Woche oder öfter. 11% haben angegeben, dass sie das oxazepamhältige Medikament „mehrmals pro Monat“ konsumieren. Von 40% ist die Frage nach der Häufigkeit des Praxiten®- Konsums negativ beantwortet worden. Abbildung 9: Wie viel Praxiten® auf einmal, n=57 40,0% 35,0% 35,1% 30,0% 24,6% 25,0% 21,1% 19,3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 bis 3 Stück 4 Stück 5 bis 9 Stück 52 10 bis 35 Stück Bei der Anzahl der konsumierten Stückzahl von Praxiten® sind für die Darstellung die Kategorien nach den Quartilen geordnet worden. Die Stichprobe umfasst 57 Personen (n=57). So sind in der Kategorie „1 bis 3 Stück“ 35,1% zu finden. „4 Stück“ werden von 21,1% und „5 bis 9 Stück“ von 19,3% konsumiert. Das letzte Quartil, das sind 24,6%, konsumieren „10 bis 35“ Stück auf einmal. Im Anschluss wird hinsichtlich der konsumierten Anzahl von Praxiten® die Überschreitungen der maximalen Tagesdosis analysiert. Abbildung 10: Überprüfung der Einhaltung der Grenzmenge bei Praxiten®, n=57 90,0% 80,0% 80,0% Praxiten® - innerhalb der Tagesdosis Praxiten® - Tagesdosis überschritten 70,0% 60,0% 52,9% 50,0% 40,0% 29,4% 30,0% 20,0% 15,0% 10,0% 17,6% 5,0% 0,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat Von den 57 Personen, die Angaben zur Häufigkeit des Praxiten®- Konsums gemacht haben, sind 52,9% täglich über der maximalen Tagesdosis. Weitere 29,4% sind „zumindest einmal pro Woche“ und 17,6% „mehrmals pro Monat“ über der empfohlenen Stückzahl. Außer bei der Kategorie „zumindest einmal täglich“, bei der 80% der Personen innerhalb der Tagesdosis sind, liegen die Werte immer unterhalb des Wertes für „Tagesdosis überschritten“. So sind 5% „zumindest einmal pro Woche“ und 15% „mehrmals pro Monat“ bei der konsumierten Menge innerhalb der empfohlenen, maximalen Tagesdosis. Es lässt sich aber kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Konsums und der konsumierten Menge feststellen, da die Zellenbesetzung bei der Berechnung zu gering gewesen ist. Trotzdem kann anhand der Ergebnisse und der Darstellung angenommen werden, dass auch hier die Personen, die seltener konsumieren, häufiger über der empfohlenen Tagesgrenzmenge sind. 53 7.1.5 Konsumformen Bei der Frage nach den Konsumformen hat es vier Kategorien gegeben: „Oral schlucken“, „Oral lutschen“, „Intravenös“ und „Nasal“. Der Stichprobenumfang bei jeder Konsumart beträgt n=100. Es sind jeweils sechs zeitlich differenzierbare Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestanden. Dabei sind die Kategorien in sechs Abstufungen angegeben worden: „täglich“, „mehrmals täglich“, „einmal pro Woche“, „mehrmals pro Woche“, „mehrmals pro Monat“ und „nie“. Genau wie bei Punkt 7.1.4 sind die Kategorien zur Analyse nachträglich zusammengefasst worden. Abbildung 11: Häufigkeit des oralen Konsums, n=100 70,0% 60,0% 59,6% 50,0% 40,0% 30,0% 23,2% 20,0% 11,1% 6,1% 10,0% 0,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat nie Benzodiazepine werden am häufigsten Oral geschluckt, 76,8% konsumieren auf diese Weise. 48,5% der StudienteilnehmerInnen schlucken täglich und 11% mehrmals täglich die Medikamente. Einmal oder mehrmals pro Woche sind es insgesamt 11%. Eher selten wird von 6,1% der Personen Oral konsumiert, nämlich „mehrmals pro Monat“. Die restlichen 23,2% praktizieren diese Konsumart „nie“. 54 Abbildung 12: Häufigkeit des oralen Konsums - lutschen, n=100 60,0% 50,5% 50,0% 40,0% 30,0% 27,3% 17,2% 20,0% 10,0% 5,1% 0,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat nie Fast die Hälfte aller Personen (n=100), nämlich 49,5%, konsumieren indem sie die Tablette im im Mund behalten oder lutschen, das machen 27,3% täglich. Weitere 17,2% konsumieren, indem sie den Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufnehmen, einmal oder mehrmals pro Woche. Die restlichen 5,1% konsumieren so mehrmals pro Monat, eine Person hat keine Angabe gemacht. 50,5% verwenden diese Konsumart „nie“. Reiht man die Konsumformen nach ihrer Häufigkeit, ist an dritter Stelle der Abbildung 13: Häufigkeit des intravenösen Konsums, n=100 100,0% 86,9% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 4,0% 4,0% 5,1% zumindest 1x zumindest 1x pro mehrmals pro Monat 0,0% intravenöse täglich Konsum von Benzodiazepinen. Woche nie Insgesamt 13,1% haben angegeben, intravenös Benzodiazepine zu konsumieren. Vier Personen (4%) konsumieren täglich intravenös. Weitere vier StudienteilnehmerInnen 55 (4%) haben angegeben, die Tabletten zumindest einmal pro Woche aufzulösen und intravenöse zu applizieren. 5,1% wählen diese Form der Aufnahme mehrmals pro Monat und 86,9% der befragten Personen haben angegeben, nie intravenös Benzodiazepine zu konsumieren. Alle Angaben für die Konsumformen sind auf den Moment bezogen gewesen. Eine Person hat keine Kategorie gewählt. Abschließend ist auch nach dem nasalen Konsum von Benzodiazepinen gefragt worden. Dieser spielt aber nur eine marginal Rolle und steht bei der Häufigkeit der Nennungen an letzter Stelle. Abbildung 14: Häufigkeit des nasalen Konsums, n=100 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 94,0% 3,0% 2,0% 1,0% zumindest 1x täglich zumindest 1x pro Woche mehrmals pro Monat nie Die weitaus weniger schädliche Konsumform der nasalen Applikation wird nur von 6% aller befragten Personen angewandt. 3% Prozent der DrogenkonsumentInnen wenden diese Form täglich an, gefolgt von 2% die dies mehrmals pro Woche tun. „Mehrmals im Monat“ hat eine Person (1%) angegeben. 94% wenden diese Konsumart „nie“ an. 7.1.6 Alter beim erstem Benzodiazepinkonsum Zur Bestimmung des Alters beim ersten Benzodiazepinkonsum ist die Frage „Wann haben Sie zum ersten Mal Benzodiazepine konsumiert?“ gestellt worden. Zur Beantwortung ist ein offenes Format verwendet worden. Bei der folgenden Grafik sind zur Darstellung die Quartilsabstände abgebildet. 56 Abbildung 15: Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum, n=99 35,0% 32,3% 30,0% 26,3% 25,0% 21,2% 20,2% 19 bis 22 Jahre 23 bis 48 Jahre 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 7 bis 15 Jahre 16 bis 18 Jahre Das durchschnittliche Alter von n=99 Personen beim ersten Benzodiazepinkonsum ist 19,17 (Standardabweichung 6,43). Außerdem kann gezeigt werden, dass die Frauen beim ersten Konsum von Benzodiazepinen im Durchschnitt zwei Jahre jünger sind als Männer. Bei den 76 Männern liegt der Mittelwert bei 19,63 Jahren (Standardabweichung: 6,8) und bei den 23 Frauen ist der Altersdurchschnitt 17,65 Jahre (Standardabweichung: 4,8). Dieser Unterschied ist mit dem U-Test auf Signifikanz getestet worden. Da der p-Wert 0,511 beträgt muss die Nullhypothese beibehalten werden, der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist nicht aussagekräftig. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist zu groß. Dieses Testergebnis ist unter anderem auf den geringen Frauenanteil in der Stichprobe zurückzuführen. In der Gruppe „7 bis 15 Jahre“ finden sich 32,3% der Stichprobe. An zweiter Stelle findet sich das Quartil „16 bis 18 Jahre“, welches 26,3% ausmacht. Zwischen dem 19 bis zum 22 Lebensjahr konsumieren 21,2% der KlientInnen das erste Mal Benzodiazepine. In der Gruppe der ältesten Personen „23 bis 48 Jahre“, die diese Frage beantwortet haben, sind 20,2%. 7.1.6 Alter beim ersten intravenösem Konsum allgemein und beim ersten, intravenösen Konsum von Benzodiazepinen Nachdem alle Konsumformen abgefragt worden sind, ist auf den intravenösen Konsum näher eingegangen worden. Dazu ist die Frage „Seit wann konsumieren Sie intravenös?“ angeführt worden. Anschließend sind zwei offene Antwortformate zu bearbeiten gewesen: „Alter beim ersten intravenösen Konsum“ und „Alter beim ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen“. 57 Abbildung 16: Alter beim ersten intravenösen Konsum, n=86 35,0% 29,0% 30,0% 25,6% 25,0% 24,6% 19,8% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 13 bis 16 Jahre 17 bis 18 Jahre 19 bis 22 Jahre 23 bis 37 Jahre Das durchschnittliche Alter bei n=86 Personen, beim ersten intravenösem Konsum, ist 20 Jahre (Standardabweichung: 5,2). Die jüngsten Personen sind 13 Jahre alt gewesen, als sie diese Konsumform ausprobiert haben. Der Median ist bei 18 Jahren erreicht, das ist auch das Alter in dem die meisten StudienteilnehmerInnen das erste Mal intravenös konsumiert haben. Die älteste Person ist 37 Jahre bei der ersten intravenösen Applikation gewesen. Bei dem zugehörigen Diagramm sind die Quartilsabstände zur übersichtlicheren Darstellung gewählt worden. So findet man in der Gruppe der 13 bis 16 Jährigen 25,6% der befragten Personen. In der Zeitspanne zwischen 17 und 18 Jahren probieren 24,6% zum ersten Mal, gefolgt von 29% in der Gruppe der 19 bis 22 Jährigen. In der Gruppe der Ältesten, zwischen 23 und 37 Jahren, befinden sich 19,8% der Stichprobe. Da zu wenige Frauen an der Studie teilgenommen haben, ist ein Vergleich der Geschlechter nicht sinnvoll. Es kann nicht bewiesen werden, dass sich das Alter beim ersten intravenösem Konsum von Frauen und Männern signifikant unterscheidet. 58 Abbildung 17: Alter beim ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen, n=43 35,0% 30,0% 32,6% 27,9% 25,6% 25,0% 20,0% 14,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 bis 19 Jahre 20 bis 22 Jahre 23 bis 25 Jahre 26 bis 33 Jahre Es liegen durchschnittlich zwei Jahre zwischen ersten Intravenösem Konsum (20) allgemein und erstem intravenösem Konsum von Benzodiazepinen (21,8). Insgesamt haben n=43 StudienteilnehmerInnen intravenös Benzodiazepine konsumiert. Aktuellen intravenösen Konsum gibt es aber nur bei 13 Personen. Die jüngsten Personen sind 16 Jahre alt gewesen, der Median ist bei 21 Jahren erreicht. Das Maximum liegt bei 33 Jahren. So ergibt sich folgende Verteilung der Quartile: In der Gruppe „16 bis 19 Jahre“ sind 27,9% der Stichprobe. 25,6% haben angegeben zwischen 20 und 22 Jahren alt gewesen zu sein. Weitere 32,6% der Personen sind in der Kategorie 23 bis 25 Jahre und 14% in der ältesten Gruppe zwischen „26 bis 33 Jahre“ zu finden. 7.1.7 Verwendung von sterilen Utensilien zum einmaligen Gebrauch für den intravenösen Konsum Einer der wichtigsten risikomindernden Maßnahmen beim intravenösen Konsum von Benzodiazepinen ist die Verwendung von sterilen Filtern, damit die Bindestoffe der aufgelösten Tabletten nicht ins Blut gelangen und in den Venen ablagern. Meist wird nur der Spritzentausch als wesentliche Maßnahme der Harm- Reduction dargestellt. Die Rolle der sterilen Löffel und Filter, sowie die Abgabe von Tupfern zur Minderung von gesundheitlichen Risiken durch Infektionen gehört ebenfalls dazu. Die Frage nach den Spritzenutensilien ist allgemein gestellt worden und bezieht sich daher nicht nur auf den intravenösen Konsum von Benzodiazepinen. Es lassen sich jedoch Rückschlüsse auf die Verwendung von medizinischem Material in beiden Fällen ziehen. So ist die Frage „Treffen Sie folgende Maßnahmen beim intravenösen Konsum (Mehrfachantworten möglich)?“ Danach sind sechs Utensilien angeführt worden: „Einmalfilter (z.B. Sterifilt®)“, „steriles Wasser“, „steriler Löffel (z.B. Stericup®)“, „Tupfer“, 59 „frische Nadel“, „frischer Kolben“. Zur Beantwortung sind vier, zeitlich differenzierbare Kategorien zur Auswahl gestanden: „nie“, „manchmal“, „oft“ und „immer“. Abbildung 18: Verwendung von sterilen Einmalfiltern, n=77 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 46,8% 27,3% 14,3% 11,7% nie manchmal oft immer 46,8% der StudienteilnehmerInnen, die intravenös konsumieren, verwenden „immer“ sterile Einmalfilter, wie sie im Ganslwirt von der Marke Sterifilt® zur Verfügung gestellt werden. „Oft“ wird dieser von 14,3% der DrogenkonsumentInnen verwendet, gefolgt von „manchmal“ mit 11,7%. 27% und somit der zweitgrößte Anteil verwendet keine sterilen Einmalfilter beim intravenösen Konsum. Die fehlenden Werte sind entstanden, weil ein gewisser Anteil der Benzodiazepin KonsumentInnen nie intravenös konsumiert oder weil keine Angaben dazu gemacht worden sind. Abbildung 19: Verwendung von sterilen Löffeln, n=74 60,0% 52,7% 50,0% 40,0% 30,0% 27,0% 20,0% 10,0% 12,2% 8,1% 0,0% Von den insgesamt 74 Personen, die angegeben Löffel bei der nie manchmal oft haben, sterileimmer Vorbereitung des intravenösen Konsums zu verwenden, tun dies mehr als die Hälfte 60 „immer“. 52,7% sind in dieser Kategorie zu finden. Weitere 12,2% verwenden sterile Löffel (wie den „Stericup®“) „oft“ und 8,1% „manchmal“. Die restlichen 27% greifen nie auf dieses Utensil zurück. Abbildung 20: Verwendung von sterilem Wasser, n=78 33,3% 35,0% 30,0% 25,0% 26,9% 23,1% 20,0% 16,7% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% nie manchmal oft immer Von den n=78 Personen, die steriles Wasser verwenden, tun dies 33,3% „immer“. Die keimfreie Flüssigkeit wird in 16,7% der Fälle „oft“ zum aufkochen eingesetzt. In 26,9% der Fälle wird dies „manchmal“ getan und 23,1% der betroffenen Personen tun das „nie“. Abbildung 21: Verwendung von Tupfern, n=79 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 77,2% 2,5% nie 12,7% 7,6% manchmal oft immer Bei den Tupfern wird hinsichtlich der Verbreitung unter den KonsumentInnen ein deutlicher Unterschied ersichtlich: Von n=79 Personen verwenden 77,2% dieses desinfizierende Utensil „immer“. Hinzu kommen 12,7% werden die Tupfer „oft“ angewandt. 7,6% bereiten den intravenösen Konsum „manchmal“ mit desinfizierter Einstichstelle vor. Die übrigen 2,5% verwenden „nie“ einen Tupfer. 61 Abbildung 22: Verwendung einer frischen Nadel, n=79 100,0% 89,9% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 10,1% ist die Verfügbarkeit unter den StudienteilnehmerInnen Auch bei den frischen Nadeln 0,0% groß. Von n=79 Personen in dieser Kategorien verwenden 89,9% „immer“ eine frische oft immer Nadel. Hinzu kommen 10,1% die zur Infektionsprophylaxe „oft“ eine frische Nadel heranziehen. Abbildung 23: Verwendung eines frischen Kolbens, n=79 100,0% 83,5% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 3,8% 12,7% 0,0% manchmal oft Ganslwirt immer gemeinsam immer Obwohl Nadeln bei der Drogenberatungsstelle mit Kolben ausgegeben werden, sind die Anteile der Benutzung unterschiedlich. Bei gleicher Stichprobengröße verwenden 83,5% einen frischen Kolben vor jedem intravenösen Konsum. 12,7% haben einen neuen Kolben, bevor sie die jeweilige Substanz applizieren. Die restlichen 3,8% wechseln „manchmal“ diesen Teil des Spritzensets. 62 7.1.8 Gespräch über Risiken Bei der nächsten Frage ist wurde versucht herauszufinden, wie viele KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit mit einem Safer- Use Gespräch zum Thema „Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen“ bereits erreicht worden sind. Dazu sind die KlientInnen in den Mittelpunkt gestellt worden, die schon ein Gespräch über die Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen mit einer ÄrztIn oder einer SozialarbeiterIn geführt haben. Dem entsprechend lautete die Frage: „Haben Sie schon einmal ein Gespräch über die Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen mit einer ÄrztIn oder einer SozialarbeiterIn geführt?“ Zur Beantwortung ist ein dichotomes Antwortformat zur Verfügung gestanden: „ja“ und „nein“. Abbildung 24: Gespräch über die Risiken des i.v. Konsums von Benzodiazepinen, n=96 70,0% 61,5% 60,0% 50,0% 38,5% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ja nein Von den insgesamt n=96 der Stichprobe, die zu dieser Frage geantwortet haben, weisen 61,5% ein Gespräch über Safer- Use Maßnahmen beim intravenösen Konsum von Benzodiazepinen auf. 38,5% haben an noch keinem Gespräch dieser Art teilgenommen, sie haben die Frage mit „nein“ beantwortet. 7.1.9 Konsumorte Um zumindest eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, in welchem örtlichen Rahmen die Drogen der KlientInnen des Ganslwirts konsumiert werden, ist die Frage „Wo konsumieren Sie ihre Drogen im Moment (Mehrfachnennung möglich)?“ gestellt worden. Zur Beantwortung sind sechs Kategorien vorgegeben gewesen: „Wohnung“, „Straße“, „öffentliche Toiletten“, „Häusereinfahrten/ Stiegenhäuser“, „Parkanlagen“ und 63 „Sonstiges“. Dabei ist jede Kategorie durch Ankreuzen mit „ja“ oder durch Auslassen mit „nein“ zur definieren gewesen. Abbildung 25: Konsumorte, n=100 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 80,0% 29,0% 27,0% 17,0% 10,0% Wohnung öffentliche Toiletten Straße 9,0% sonstiges HäuserParkeinfahrten anlagen und StiegenBei der Frage nach den zutreffenden Konsumorten ist zuhäuser berücksichtigen, dass der Stichprobenumfang jeweils n=100 ist. Die Prozentwerte können deswegen nur auf die einzelnen Kategorien bezogen werden. So haben die Frage, ob momentan die Wohnung ein Konsumort ist, 80% von 100 Personen mit „Ja“ beantwortet. An zweiter Stelle bei den Konsumorten sind die öffentlichen Toiletten, dorthin ziehen sich 29% der StudienteilnehmerInnen für den Konsum zurück. 27% konsumieren ihre Substanzen auf der Straße. 17% haben angegeben an Orten zu konsumieren, die nicht auf dem Fragebogen angeführt gewesen sind. 10% der Personen haben einen Zugang zu Stiegenhäusern oder weichen auf Häusereinfahrten aus. Mit 9% kann man als kleinste Gruppe den Personenkreis identifizieren, der Parkanlagen für den Konsumvorgang nutzt. Nicht berücksichtigt ist bei dieser Fragestellung die Konsumform. 7.1.10 Kombination mit anderen Substanzen – Alkohol und Opiate Einleitend zu diesem Bereich ist die Frage „Wie oft konsumieren Sie Benzodiazepine gemeinsam mit anderen Drogen (Mehrfachnennung möglich)?“ formuliert worden. Anschließend ist mit einer Filterfrage in die zwei Stoffgruppen differenziert worden, wobei diese „Konsumieren Sie Alkohol gemeinsam mit Benzodiazepinen?“ gelautet hat. Zur Beantwortung sind die Kategorien „nie – weiter mit der Frage[...]“, „manchmal“, „oft“, „immer“ zur Auswahl gestanden. Ist die Antwort zum Alkoholkonsum positiv 64 ausgefallen, ist zur Frage nach der Menge weitergeleitet worden. Diese hat gelautet: „Wie viel Alkohol trinken Sie dann?“ Nun sind fünf Antwortmöglichkeiten vorgegeben gewesen, die so definiert worden sind: „Bier“, „Wein“, „Spirituosen“, „Soft Drinks (z.B: Eristoff Ice)“, „Andere“ und entsprechend dazu vier Mengenangaben, wie bei der Kategorie „Bier“: „ca. ½l“, „ca.1l“, „ca. 1 ½l“, „mehr“. 7.1.10.1 Alkohol und Benzodiazepine Hinsichtlich der Möglichkeit von Wechselwirkungen ist die Frage nach dem Konsum von Benzodiazepinen gemeinsam mit Alkohol und Opiaten gestellt worden. Wie im Literaturteil festgehalten, wird vor allem die dämpfende Wirkung der Benzodiazepine verstärkt. Individuelle Bedingungen und Konditionen machen Vorhersagen bezüglich der Auswirkung aber fast unmöglich. Abbildung 26: Konsum von Alkohol gemeinsam mit Benzodiazepinen, n=98 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,8% 24,5% 22,4% 12,2% nie manchmal oft immer In Berücksichtigung dieser Fragestellung haben 40,8% der n=98 Personen die Frage nach Alkoholkonsum mit gleichzeitigem Benzodiazepinkonsum negativ beantwortet. 24,5% haben angegeben „manchmal“ beide Substanzen gleichzeitig zu konsumieren. 12,2% tun dies „oft“ und bei 22,4% wirken sich beide Stoffgruppen „immer“ gleichzeitig aus. Von der Gruppe, die Benzodiazepine und Alkohol konsumieren, ist Bier als häufigstes Getränk angegeben worden. Andere alkoholische Getränke sind wegen der seltenen Nennung zu vernachlässigen. Zur Vereinfachung der folgenden graphischen Darstellung sind sowohl die Kategorien „oft“ und „immer“ zusammengefasst worden, als auch die Kategorien zur Mengenangabe. So ist die Unterscheidung in „bis zu 1l“ und „1 ½l oder mehr“ entstanden. 65 Abbildung 27: Bier und Benzodiazepine, n=32 60,0% 57,1% 55,6% 50,0% 44,4% 42,9% 40,0% 30,0% 20,0% Bier und Benz. – Manchmal Bier und Benz. – oft oder immer 10,0% Von 0,0% den 32 Personen, die Angaben zum Bierkonsum in Kombination mit bis zu 1l 1 1/2l oder mehr Benzodiazepinen und dessen Häufigkeit gemacht haben, trinken „manchmal“ 57,1% bis zu einem Liter und 42,9% trinken „manchmal“ 1 ½ Liter oder mehr. 55,6% trinken „oft oder immer“ bis zu einem Liter in Kombination mit Benzodiazepinen und 44,4% trinken „oft oder immer“ 1 ½ Liter oder mehr. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen, die Nullhypothese muss beibehalten werden. 7.1.10.2 Opiate und Benzodiazepine In der Analyse wird im Folgenden nur auf die Gruppe der Morphine innerhalb der Opiate eingegangen, da andere Substanzen kaum genannt worden sind. Ist die Frage nach dem Alkoholkonsum nicht zutreffend beantwortet worden, ist zu folgender Frage weitergeleitet worden: „Konsumieren Sie Opiate und Benzodiazepine?“ Als Antwortmöglichkeiten sind sieben Kategorien zur Auswahl vorgegeben worden: „Heroin“, „Opium“, „Morphin“, „L-Polamidon®“, „Subutex®“, „Codein“ und „Andere“. Dazu konnte in einem offenen Antwortformat die jeweilige Menge und auch die Häufigkeit des Konsums angegeben werden. Wieder sind zeitlich differenzierte Kategorien gewählt worden: „nie“, „manchmal“, „oft“ und „immer“. 66 Abbildung 28: Konsum von Morphin gemeinsam mit Benzodiazepinen, n=79 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,8% 11,1% nie 4,0% 5,1% manchmal oft immer Von n=99 Personen der Stichprobe haben 79 angegeben, dass sie „immer“ Benzodiazepine und Opiate, in diesen Fällen Morphin, kombinieren. Das entspricht 79,8%. Weitere 5,1% konsumieren „oft“ beide Substanzen gemeinsam. 4% sind der Gruppe zuzuordnen, die „manchmal“ in die betreffende Kategorie fällt. restlichen11,1% kombinieren diese Wirkstoffe „nie“. 67 Die Abbildung 29: Konsumierte Menge Morphin - gemeinsam mit Benzodiazepin, n=83 50,0% 43,4% 45,0% 40,0% 35,0% 27,7% 30,0% 25,0% 20,0% 14,5% 14,5% 15,0% 10,0% 5,0% Die konsumierte Menge an Morphinen variiert je nach KonsumentInnen stark 0,0% unterschiedlich. Bei180mg der Darstellung die Quartile der einzelnen Mengenangaben zwischen zwischen sind 700mg 800mg zwischen 900mg und 600mg und 720mg und 1000mg gewählt worden, diese sind aus n=83 berechnet worden. So findet sich die größte Gruppe mit 43,4% bei Mengen zwischen 180mg und 600mg. Zwischen 700mg und 720mg sind von 14,5% der MorphinkonsumentInnen dosiert. Bei 27,7% liegt der Anteil der Personen, die 800mg auf einmal einnehmen. Letzter Wert ist auch am häufigsten genannt worden, nämlich von 23 Personen. Die letzte Gruppe sind die 14,5% der StudienteilnehmerInnen, die zwischen 900mg und 1000mg Morphin einnehmen. Im Durchschnitt werden von den KlientInnen 659 mg konsumiert, die Standardabweichung hat einen Wert von 228mg. 7.2 Momentane Ursachen des Benzodiazepinkonsums Um die momentanen Ursachen des Benzodiazepinkonsums zu erfassen, ist eine Reihe von Begründungen gewählt worden. Diese lassen sich in die Bereiche biologische/physische, psychologische und soziale Gründe differenzieren. Es sind diese 19 möglichen Ursachen anhand der bearbeiteten Literatur aufgelistet worden. Die Zustimmung zu diesen Begründungen ist von den StudienteilnehmerInnen zwischen „0= gar nicht“ und „10= trifft zu“ bewertet worden. Der Übersichtlichkeit wegen sind in der folgenden Tabelle nur die Begründungen enthalten, welche die meiste Zustimmung bekommen haben. Alle vorgegebenen Begründungen sind im Anhang, in Kapitel 2. des Fragebogens, zu finden. Bei der Frage nach den momentanen Gründen für den Benzodiazepinkonsum sind die Mittelwerte der angegebenen Antworten zur Darstellung am geeignetsten erschienen. Dabei kann dieser nur zwischen „0“ und „10“ liegen, da als Antwortformat eine unipolare Ratingskala gewählt worden ist. „0“ bedeutet „gar nicht“ und „10“ bedeutet dabei „trifft zu“. 68 Momentane Gründe für den Benzodiazepinkonsum Mittelwert (zwischen 0 - 10) Standardabweichung weil die Wirkung immer gleich ist 6,99 3,79 um zu entspannen 6,94 3,32 um das Entstehen von Entzugserscheinungen zu verhindern 6,78 3,66 um tief schlafen zu können 6,62 3,95 weil es angenehm ist, meinen Alltag zu vergessen 5,9 3,8 um vorhandene Entzugserscheinungen abzuschwächen 5,87 3,82 weil ich mir sicher sein kann, was ich kaufe 5,39 4,37 5 4,05 weil sie leicht und immer verfügbar sind 4,38 3,8 weil meine körperlichen Schmerzen nachlassen (unabhängig von Entzugserscheinungen) 4,41 4,07 um den Rausch zu genießen Tabelle 2: Momentane Ursachen für den Benzodiazepinkonsum, nach Relevanz geordnet 7.2.1 Momentane Ursachen mit der durchschnittlich größten Zustimmung Die Analyse der Daten zeigt, dass die Ursache „weil die Wirkung immer gleich ist“ am meisten Zustimmung bekommen hat. Der Mittelwert bei von n=99 Antworten beträgt 6,99. Die Standardabweichung ist dabei 3,79. Ebenfalls große Zustimmung hat die Ursache „um zu entspannen“ bekommen. Hier beträgt der Mittelwert von n=98 Antworten 6,94 – die Standardabweichung ist mit 3,32 etwas geringer als bei der Ursache mit der meisten Zustimmung. An dritter Stelle steht die Ursache „um das Entstehen von Entzugserscheinungen zu verhindern“. Dabei liegt der Mittelwert von n=97 Antworten bei 6,78 und die Standardabweichung beträgt 3,66. Eine weitere hoch bewertete Ursache ist „um tief schlafen zu können“, mit einem Mittelwert von 6,62. Es haben hier n=100 Personen eine Antwort gegeben und die Standardabweichung beträgt 3,95. 69 Die folgenden Ursachen unterscheiden sich in folgender Hinsicht: der Mittelwert ist kleiner als 6 und die Standardabweichung ist in drei Fällen größer als vier. Das führt zu einer Einschränkung der Ergebnisse, da die Standardabweichung sonst größer als der Mittelwert ist. Somit beschränkt sich die Analyse auf insgesamt zehn Ursachen, die letzten sechs folgen nun. „Weil es angenehm ist, meinen Alltag zu vergessen“ ist die fünfte Ursache, gereiht nach dem Mittelwert und wurde von n=98 Personen gewertet. Der Mittelwert beträgt 5,9 und die Standardabweichung ist 3,8. „Um vorhandene Entzugserscheinungen abzuschwächen“ ist eine weitere, große Zustimmung erhaltende Ursache. Der Mittelwert aus n=99 Antworten beträgt 5,87 – bei einer Standardabweichung von 3,82. Ebenfalls einen Mittelwert größer als 5 hat die Ursache „weil ich mir sicher sein kann, was ich kaufe“, mit einem Wert von 5,39. Bei n=97 Antworten erreicht die Standardabweichung einen Wert von 4,37. Die nächste Ursache, „um den Rausch zu genießen“, hat einen Mittelwert der Zustimmung von genau 5, bei einer Standardabweichung von 4,05 und nähert sich so dem kritischen Bereich. Diese Ursache ist von n=98 Personen bewertet worden. Die letzten zwei Ursachen in der Tabelle (siehe oben) sind „weil sie immer und leicht verfügbar sind“ (Anm. Benzodiazepine) und „weil meine körperlichen Schmerzen nachlassen (unabhängig von Entzugserscheinungen)“. Der Mittelwert der Zustimmung zur Verfügbarkeit als Ursache des Benzodiazepinkonsums liegt bei 4,38 und die zugehörige Standardabweichung liegt bei 3,8. Als letzte Ursache in der Analyse findet sich die Behandlung von körperlichen Schmerzen mit einem Wert von 4,41 und einer Standardabweichung von 4,07. 7.2.1 Prostitution als Ursache des Benzodiazepinkonsums Nur zwei Personen (n=100), in beiden Fällen Frauen, haben angegeben Benzodiazepine zu konsumieren, um die Prostitutionstätigkeit durchführen zu können. Dabei ist die Aussage „weil es mir dann leichter fällt, auf den Strich/Anschaffen zu gehen“ bewertet worden. Die Zustimmung liegt einmal bei sechs von zehn Punkten und beim zweiten Mal bekommt dieser Grund die volle Punktezahl. Kein männlicher Studienteilnehmer hat diesen Grund in irgendeiner Weise als zutreffend bewertet. 7.2.2 Blaue Lippen als Erkennungsmerkmal der Szene Insgesamt sechs Personen (n=100) haben angegeben, dass die blauen Lippen mehr sind, als nur der Nebeneffekt des Lutschens. „Weil die blauen Lippen ein Erkennungsmerkmal der Szene sind“, wird der Konsum argumentiert. Vier Personen 70 stimmen voll dieser Ursache zu, die anderen zwei bewerten ihre Zustimmung mit zwei bzw. drei von zehn Punkten. 7.2.3 Lutschen von Benzodiazepinen für eine schnellere Wirkung Die Aussage: „weil ich die schnelle Wirkung durch das Lutschen mag“, haben insgesamt 38 StudienteilnehmerInnen (n=100) zugestimmt. Davon sind es 16 Personen, die diesen Grund mit „trifft zu“ die volle Zustimmung gegeben haben. Weitere zehn haben der Vorliebe dieser Konsumform zwischen fünf und neun zugewiesen. Die restlichen zwölf DrogenkonsumentInnen haben dem Zutreffen dieses Punktes nur eine geringe Relevanz zwischen eins und vier beigemessen. 7.2.4 Benzodiazepine, um die Wirkung von Alkohol zu verstärken 39 Personen (n=95) konsumieren Benzodiazepine, um „in Verbindung mit Alkohol eine stärkere Wirkung zu erreichen“. Bei 13 DrogenkonsumentInnen ist dieser Grund mit voller Zustimmung bewertet worden. Weitere 17 ordnen dieser Motivation eine Relevanz zwischen fünf und neun zu. Die restlichen neun finden sich in der Gruppe zwischen eins und vier wieder. 7.2.5 Benzodiazepine, um die Wirkung von Opiaten zu verstärken Um „in Verbindung mit Opiaten eine stärkere Wirkung zu erreichen“, ist für 15 StudienteilnehmerInnen ein Konsumgrund, der unter „trifft zu“ eingeordnet worden ist. Insgesamt haben n=99 KonsumentInnen Angaben zu dieser Aussagen gemacht, 52 (54,5%) davon haben sie in irgendeiner Weise befürwortet. 22 Personen finden sich in der Gruppe zwischen fünf und neun. Die restlichen 13 Befragten konnten sich nicht sehr stark mit diesem Punkt identifizieren und reihen sich zwischen eins und vier ein. 7.3 Wechselbeziehung zwischen Erstkonsum von Benzodiazepinen und erstem i.v. Konsum von Benzodiazepinen Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum Alter beim ersten Korrelation nach Pearson intravenösen Konsum von Benzodiazepinen 0,448 Signifikanz (1-seitig) 0,001 n 43 71 Tabelle 3: Korrelation zwischen dem Alter beim ersten Konsum von Benzodiazepinen und dem Alter beim ersten intravenösem Konsum von Benzodiazepinen, n=43 Die einseitige Hypothese hat in diesem Fall gelautet: Personen, die früher Benzodiazepine zu konsumieren begonnen haben, probieren auch früher das erste Mal intravenös Benzodiazepine. Eine mittelstarke Korrelation mit einem Wert von 0,448 lässt sich zwischen beiden Faktoren „Alter beim ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen“ und „Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum“ feststellen. Diese Korrelation ist mit einem p- Wert von 0,001 hoch signifikant. Diese Korrelation berechnet sich aus einer Stichprobe von n=43 Personen. A bbildung 30: Korrelation: Alter beim ersten i.v. Konsum von Benzodiazepinen zu Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum 72 8 Ergebnisse und Zusammenfassung 8.1 Konsummuster In dem ersten Teil werden die Ergebnisse und die Zusammenfassung der Konsummuster dargestellt. 8.1.1 ÄrztInnen und Szene selbst für Versorgung zuständig Die meisten Personen der Stichprobe beziehen ihre Benzodiazepine von ÄrztInnen. Noch immer spielt die Szene eine tragende Rolle in der Versorgung mit den Medikamenten. 54% der Stichprobe (n=100) beziehen Benzodiazepine über die Szene. Soziale Beziehungen, auch abseits des medizinischen Systems, erhalten die Strukturen des Konsums aufrecht. So stehen an dritter und vierter Stelle Freunde, mit 28% und Bekannte, mit 24% (von jeweils n=100). Ein beachtlicher Anteil, nämlich 12% (n=100), hat angegeben, dass sie die Benzodiazepine von mehreren ÄrztInnen beziehen, was durch eine geänderte Verschreibungspraxis verhindert werden sollte. Der Bedarf der Szene kann nur durch sie selber gedeckt werden. Außerdem hat die Analyse ergeben, dass nicht einmal die Hälfte aller KlientInnen des Ganslwirts, das sind 43% von n=100, ihre Benzodiazepine ausschließlich über Rezept beziehen. Jeder Zehnte bezieht die Medikamente ausschließlich über Freunde, Bekannte und Szene. Weitere 46% versorgen sich zusätzlich zu den verschriebenen Dosen der ÄrztInnen. Auf Nachfrage ist zu dieser Tatsache geantwortet worden, dass die ÄrztInnen unzureichende Mengen verschreiben würden oder kein Zugang zu einer Versorgung mit Benzodiazepinen möglich ist. 11% versorgen sich ausschließlich außerhalb des medizinischen Systems mit Benzodiazepinen. 8.1.2 Hohe Preisschwankungen in der Szene Mit Rückblick auf das letzte Kapitel lassen sich auch die Preise in der Szene erklären: 13,75€ wird im Durchschnitt für einen Streifen (10 Stück) bezahlt, wobei hier nicht nach der Substanz unterschieden worden ist. Die niedrigen Preise sind durch persönlich Beziehungen und durch ein anderes Ursprungsland erklärt worden. Manche KonsumentInnen reisen nach Ungarn, um dort das Medikament um 3€ pro Packung zu kaufen. Die maximalen Preise ergeben sich durch Angebot und Nachfrage: an Wochenenden oder wenn es einen Mangel an der Benzodiazepinen gibt, steigt der 73 Preis auf bis zu 20€ pro Streifen. Zu beachten ist in dieser Hinsicht auch, dass ein Großteil der KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit in Wien nicht mehr als rund 750€ pro Monat zur Verfügung haben (siehe Stichprobenbeschreibung, Kapitel 6.5). 8.1.3 Somnubene®: das am häufigsten konsumierte Benzodiazepin Am beliebtesten ist das Medikament Somnubene®, was vor allem an der schnellen Wirkung liegt. Eine weitere Eigenschaft dieses Präparates ist, das es eine sehr lange Halbwertszeit aufweist. Es wird von den meisten Personen konsumiert, das sind 74% (n=100). Auch sehr stark verbreitet ist das Medikament Praxiten®, das langsamer anflutet und eine kürzere Halbwertszeit im Körper hat. 60% der Stichprobe (n=100) haben dieses Präparat angegeben. Alle weiteren Medikamente, die von den KlientInnen des Ganslwirts konsumiert werden, spielen eher eine untergeordnete Rolle und haben die gleichen Wirkstoffe. Auf Nachfrage ist dem Forschenden mitgeteilt worden, dass diese teilweise nur als Ersatz für Somnubene® und Praxiten® konsumiert werden. 8.1.4 Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum Mit durchschnittlich 19,17 Jahren (Standardabweichung 6,43, n=99) werden das erste Mal Benzodiazepine von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit konsumiert. Rein deskriptiv betrachtet sind Frauen im Durchschnitt zwei Jahre jünger als Männer. Bei den 76 Männern liegt der Mittelwert bei 19,63 Jahren (Standardabweichung: 6,8) und bei den 23 Frauen ist der Altersdurchschnitt 17,65 Jahre (Standardabweichung: 4,8). Der U-Test zum Vergleich von Mittelwerten ist nicht signifikant ausgefallen, der Unterschied muss also kritisch betrachtet werden. In deskriptiver Hinsicht konnte aber die Hypothese bestätigt werden, dass Frauen früher mit dem Benzodiazepinkonsum anfangen als Männer. 8.1.5 Hohe Risiken für die Gesundheit bei unregelmäßigen hohen Dosen 40% aller Personen, die Somnubene® konsumieren, tun dies täglich. Es gibt also einen erheblichen Anteil an Personen, die nicht regelmäßig Benzodiazepine konsumieren. Unter diesen „GelegenheitskonsumentInnen“ sind Personen dabei, die bis zu 50 Stück Somnubene® auf einmal schlucken. Diese Personengruppe, die nur 74 gelegentlich hohe Dosen zu sich nimmt, trägt das höchste Risiko. Eine Toleranz ist nicht im gleichen Ausmaß vorhanden. Überdosierungen, auch in Verbindung mit Opiaten und Alkohol, können die Folge sein. Außerdem lässt sich durch die Analyse feststellen, dass ungefähr die Hälfte aller Personen auf einmal mehr Flunitrazepam konsumiert, als medizinisch als sinnvoll erachtet wird (7 Stk. aufgeteilt auf drei Tagesdosen). Bei Somnubene® lässt die Analyse der Daten außerdem schließen, dass genau die Personen, die unregelmäßig konsumieren, häufiger über der empfohlenen Tagesdosis liegen. Der Zugehörige Chi-Quadrat Test weist einen p-Wer von 0,055 aus und erreicht somit das Signifikanzniveau von p=0,05 nicht, es kann aber von einem Zusammenhang ausgegangen werden. Ähnlich Muster sind auch bei Praxiten® beobachtbar. In beiden Fällen sind die Ergebnisse aufgrund der zu kleinen Stichprobe nicht signifikant. Positiv ist aber hier anzumerken, dass die Personen, die einen regelmäßigen Konsum aufweisen und sich somit höchstwahrscheinlich in einer sozialmedizinischen Behandlung befinden, seltener über die Grenzmengen hinaus konsumieren. Das spricht für eine gezielte und kontrollierte Abgabe von Benzodiazepinen mit einer sozialen Unterstützung durch die klinische Sozialarbeit. Wie sich herausgestellt hat und später noch gezeigt werden soll, spielt dabei die beratende und somit auch behandelnde Funktion der Klinischen Sozialen Arbeit eine tragende und ausbaufähige Rolle. Vor allem die Personen, welche einen sehr ausgeprägten Konsum aufweisen, sind auf den existierenden Schwarzmarkt angewiesen. Gerade dieser Benzodiazepin- Beikonsum zur meist ebenfalls vorhandenen Opiat- Substitution, sollte eine kontrollierte, langsame Reduktion in einem ambulanten Setting erfahren. Dabei ist auch eine Benzodiazepin- Substitution in Betracht zu ziehen, wenn eine Benzodiazepin- Abstinenz nicht gelingt. Hier ist die soziale Betreuung durch die Klinische Soziale Arbeit von Bedeutung. (vgl. Haltmayer/ Rechberger/ u.a. 2009: 295f) Für Praxiten® lassen sich ähnliche Konsummuster vermuten, wie für Somnubene®, aber auch hier sind die Ergebnisse nicht signifikant. Trotzdem kann angenommen werden, dass auch bei dieser Substanz, die Personen, die nicht regelmäßig konsumieren, öfters über der empfohlenen Tagesdosis liegen. Somit entsteht auch hier ein größeres Risiko, weil nicht die gleiche Toleranz vorhanden ist. Da zu wenige Daten vorliegen, um diese Vermutung zu bestätigen, sollte diesem Thema noch eine eigene Untersuchung gewidmet werden. Andere Benzodiazepine sind zu selten genannt worden, um Aussagen zu den jeweiligen Konsumgewohnheiten zu treffen. 75 8.1.6 Unproblematische Konsumformen sind vorherrschend Es kann gezeigt werden, dass der Großteil der KlientInnen in der niederschwelligen Drogenarbeit Benzodiazepine auf die Art und Weise konsumieren, für die sie auch gedacht sind: oral. Somit kann die Hypothese bestätigt werden, dass unproblematische Konsumformen überwiegen. 76,8% von n=100 schlucken die Tabletten, fast 60% tun dies täglich. In dieser Hinsicht überwiegen die risikoarmen Konsumarten die risikoreichen. Dennoch sind die 13,1% der Stichprobe nicht zu vernachlässigen, die angegeben haben, intravenös zu konsumieren. Diese Gruppe setzt sich einem sehr starken gesundheitlichen Risiko aus. Insgesamt 8% konsumieren zumindest einmal pro Woche Benzodiazepine intravenös. Safer- Use Methoden, als Teil der HarmReduction, müssen gerade diesen Personen beigebracht werden, um Folgeschädigungen zu verhindern. Ebenfalls bemerkenswert ist der relativ hohe Anteil an Personen, die Benzodiazepine durch Lutschen konsumieren. 49,5% haben angegeben, diese Konsumform zu praktizieren. Die Vermutung des Forschenden, dass dies nicht nur mit der schnelleren Wirkung zusammenhängen kann, sondern auch soziale Ursachen hat, konnte nicht bestätigt werden, da zu wenige Personen Angaben dazu gemacht haben. Ob die blauen Lippen als Erkennungsmerkmal innerhalb der Szene dienen, bleibt somit unbeantwortet. Auch diese Frage könnte Gegenstand einer eigenen Forschungsarbeit sein, die ritualisierte Konsummuster bei der Einnahmen von Benzodiazepinen und Stilbildung in den Mittelpunkt stellt. 3% der Stichprobe (n=100) konsumieren täglich nasal und weitere 2% zumindest einmal pro Woche. Über die Nasenschleimhäute zu konsumieren ist somit nicht sehr weit verbreitet. Diese eher ungewöhnlich anmutende Konsumform für Benzodiazepine hat den Vorteil, dass sie nicht so gesundheitsschädigend ist, wie der intravenöse Konsum, vorausgesetzt es werden bestimmte Regeln beachtet. So sollte auch hier nicht das Röhrchen zum Aufziehen mit anderen Personen geteilt werden, da es zu Infektionen kommen kann. Eventuell stellt der nasale Konsum eine Alternative zur intravenösen Form dar. 8.1.7 Intravenöser Konsum von Benzodiazepinen Es soll hier noch genauer auf den intravenösen Konsum eingegangen werden, weil er als die risikoreichste aller Konsumformen gilt. Von den 86 Personen der Stichprobe, die bereits intravenöse Konsumerfahrungen verfügen, sind es insgesamt 43 Personen, die auch Benzodiazepine intravenös 76 konsumiert haben. Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen ersten, intravenösen Konsum und dem ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen beträgt zwei Jahre. Aus der Tatsache, dass von 43 Personen nur 13 aktuell Benzodiazepine intravenös konsumieren, kann geschlossen werden, dass diese Konsumpraxis in den meisten Fällen einen phasenartigen Verlauf hat oder nur ausprobiert wird. Trotzdem muss die Hypothese anhand des DSM-IV bestätigt werden, dass bei den eben diskutierten KlientInnen aufgrund des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen die Diagnose „Substanzmissbrauch“ zu stellen ist. 8.1.8 Verwendung von sterilen Utensilien für den i.v. Konsum ausbaufähig Wie sehr die DrogenkonsumentInnen über Safer- Use Praktiken und Methoden aufgeklärt sind, lässt sich auch an der Verwendung von sterilem Spritzenbesteck und dem Zubehör zum Aufkochen und Aufziehen der Substanz ablesen. So sollen im folgenden die Ergebnisse dieser Variablen- Analyse interpretiert werden: Die Verwendung von sterilen Filtern, wie sie im Ganslwirt zu erwerben und zu tauschen sind, ist relativ weit verbreitet. Mehr als die Hälfte aller intravenös konsumierenden Personen verwendet „oft“ oder „immer“ dieses sterile Zubehör. Dies ist besonders wichtig, da für die gesundheitliche Entwicklung der KlientIn von Bedeutung ist, ob die aufgelösten Substanzen und so auch Benzodiazepin- Tabletten gefiltert oder ungefiltert in das Blut gelangen. Nur die Einmalfilter garantieren die Reduktion der Tablettenträgerstoffe, unabhängig von der Substanz. Auch hier gibt es noch Potenzial für die Beratungstätigkeit der Klinischen Sozialarbeit: Safer- Use Methoden können im Gespräch vermittelt werden und so die Verwendung eingeübt und ritualisiert werden. Der Anteil an Personen, die sterile Filter beim intravenösen Konsum allgemein und beim intravenösen Konsum von Benzodiazepinen im Speziellen verwenden, kann gesteigert werden. Das gilt auch für die folgenden Utensilien. Es verwenden mehr als 50% der StudienteilnehmerInnen bei jedem Konsumvorgang sterile Löffel, um die Substanz aufzukochen. Doch der Anteil an Personen, die „nie“ oder „manchmal“ dieses Utensil verwenden, ist mit insgesamt 35,1% noch immer sehr groß. Wie bei allen anderen Gegenständen, die für den intravenösen Konsum von Bedeutung sind, birgt das ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit. Die KlientInnen beschweren sich über zu kleine sterile Löffel, die Menge an Flüssigkeit würde nicht ausreichen. Deswegen weichen sie immer wieder auf die gewölbten Böden von Getränkedosen aus. Diese werden teilweise mehrfach verwendet. In der Praxis könnte öfters darauf hingewiesen werden, dass die Stericups® kostenlos getauscht werden können und das bei jedem Konsumvorgang ein neuer oder gut sterilisierter Löffel verwendet werden sollte. 77 Ein Drittel der intravenös konsumierenden Personen verwendet „immer“ steriles Wasser, wie es bei der Drogenberatungsstelle Ganslwirt zu erwerben ist. Die geleerte Verpackung der sterilisierten Flüssigkeit kann nicht gegen eine neue getauscht werden. Das erklärt eventuell auch, warum mehr als die Hälfte der befragten Personen, „manchmal“ oder „nie“ steriles Wasser verwenden. Viele KlientInnen glauben, dass auch das Wasser aus der Leitung steril ist, wenn man es lange genug laufen lässt. Nur so kann der relativ große Anteil an Personen angegeben haben, steriles Wasser zu verwenden. Auch hier ist die Klinische Sozialarbeit gefordert, Aufklärungsarbeit zu leisten. Da beim Kauf und beim Tausch von Spritzensets immer Alkoholtupfer zur Desinfektion der Einstichstelle dabei sind, ist auch die Verwendung relativ weit verbreitet. Fast 90% der intravenös konsumierenden Personen verwenden „oft“ oder „immer“ dieses Utensil. Ebenfalls etabliert ist die Verwendung von frischen Kolben und frischen Nadeln bei jedem Konsumvorgang, was sicherlich durch das Spritzentauschprogramm des Ganslwirts bewirkt worden ist. Trotzdem Beachtung finden sollten die 10,1%, die angegeben haben, „oft“ eine neue Nadel zu verwenden. Warum eine Nadel öfters verwendet wird, kann hier nicht beschrieben werden. Die Vermutung liegt nahe, dass der Konsumdruck manchmal zu groß ist oder die Dichte an Einrichtungen mit Spritzentausch nicht ausreicht, um die lückenlose Versorgung jederzeit zu sichern. Auch Spritzentauschautomaten können ein wirkungsvolles Angebot sein. Noch deutlicher wird das bei der Statistik zur Verwendung von sterilen Kolben. Hier haben insgesamt 16,5% angegeben „manchmal“ oder „oft“ frische Kolben zu verwenden. Wieso diese Differenz zu den Nadeln entsteht, wo doch Nadeln und Kolben meistens in Sets abgegeben werden, ist nicht bekannt. Immerhin verwenden 83,5% „immer“ einen neuen Kolben. Es besteht die Vermutung, dass die Scheu der DrogenkonsumentInnen größer ist, eine gebrauchte Nadel wieder zu verwenden, als einen gebrauchten Kolben. Die Gefahr einer Infektion ist deswegen nicht geringer. 8.1.9 Safer- Use Beratung zu Benzodiazepinkonsum hat nicht alle erreicht Mehr als ein Drittel, nämlich 38,5% (n=96), aller befragten Personen haben noch nie ein Gespräch über die Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen mit einer ÄrztIn oder SozialarbeiterIn geführt. Das ist bei die der Verbreitung des Benzodiazepinkonsums innerhalb der Szene durchaus verwunderlich. Auch die Tatsache, dass bereits die ersten Notfälle durch die interarterielle Injektion in Gliedmaßen vorgekommen sind, hat offenbar nicht zu einer intensiven Beratungstätigkeit im Bezug auf den intravenösen Benzodiazepinkonsum geführt. Zwar 78 hat sich während der Befragung herausgestellt, dass sich viele KlientInnen der Risiken bewusst sind, trotzdem wird die intravenöse Applikation der Tranquilizer von vielen probiert. Gerade junge Menschen, die mit dem Umgang mit dem Injektionsbesteck noch unerfahren sind, machen viele Fehler. Auf sie sollte das Hauptaugenmerk der Beratungstätigkeit gelegt werden. Das ist auch unter dem Blickwinkel zu betrachten, dass durchschnittlich nur zwei Jahre zwischen dem ersten intravenösen Konsum allgemein und dem ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen liegen. 8.1.10 KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit sind auf Konsum in der Öffentlichkeit angewiesen Die Frage nach den Konsumorten zeigt die gesundheitlich-prekäre Lage der DrogenkonsumentInnen auf. Zwar geben 80% an, dass sie in einer Wohnung konsumieren. Auf Nachfrage haben aber einige Personen auch angegeben, dass damit auch Notschlafquartiere gemeint sind. Die KlientInnen haben somit einen sehr weiten Begriff von „Wohnung“. 29% haben angegeben, ihre Drogen auf öffentlichen Toiletten zu konsumieren, 27% gar auf der Straße. Das gesundheitliche Risiko einzugehen, unter diesen unhygienischen und ganz und gar nicht stressfreien Bedingungen zu konsumieren, kann nur als Zwang interpretiert werden: die KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit haben keine andere oder bessere Wahl. Sie sind auf den öffentlichen oder halböffentlichen Raum angewiesen, da der Konsum sonst nicht geduldet wird. So ist auch angegeben worden, dass 10% in Stiegenhäusern/ Häusereinfahrten und 9% in Parkanlagen konsumieren. 8.1.11 Alkohol und Benzodiazepine Als nächstes sollen die Kombinationen von Benzodiazepinen mit Alkohol und Opiaten in den Blick genommen werden. Es konnte gezeigt werden, dass mehr als die Hälfte aller erfassten Personen zumindest „manchmal“ Alkohol und Benzodiazepine kombinieren. Da Alkohol die dämpfende Wirkung der Tranquilizer verstärkt, ist dieses Ergebnis besonders beachtenswert. Fast jeder Vierte hat angegeben, „immer“ Benzodiazepine und Alkohol gemeinsam zu konsumieren, wobei es sich bei dem alkoholischen Getränk meistens um Bier handelt. Der Bierkonsum geht bei einigen Personen über die 1½ Liter Grenze hinaus, in Kombination mit Benzodiazepinen hat diese Menge noch eine viel stärkere Wirkung. Alle anderen alkoholischen Getränke sind wegen der seltenen Nennung zu vernachlässigen. Keine Aussage kann darüber 79 gemacht werden, wie oft und wie viel Benzodiazepine, Alkohol und Opiate gleichzeitig konsumiert werden. Dies bedarf einer eigenen Fragestellung. 8.1.12 Opiate und Benzodiazepine Bei den Opiaten sind vor allem die Morphine von Bedeutung. Heroin spielt kaum noch eine Rolle in der Wiener Straßenszene. 79,8% der Stichprobe (n=99) haben angegeben, Benzodiazepine und Morphin „immer“ gemeinsam zu konsumieren. Dabei variiert die Dosis des Morphins stark, je nach Toleranzen. Mehr als 50% der befragten Personen konsumieren mehr als 700mg Morphin (Substitol®). Die am häufigsten genannte Menge ist 800mg (27,7%) gewesen. Welche Wirkung es auf die KonsumentInnen hat, wenn Benzodiazepine mit diesen Mengen Morphin gemeinsam konsumiert werden, ist nicht vorhersagbar, da dies stark von der Toleranz der jeweiligen Person abhängig ist. Hinzu kommt, dass eine unbekannte Anzahl an Personen Alkohol, Morphine und Benzodiazepine gemeinsam kombinieren – eine Mischung die vermutlich für einen Großteil an Überdosierungen in Österreich verantwortlich ist. 8.2 Momentane Ursachen Bei den KlientInnen stehen die Sicherheit beim Konsum und die erwünschte Wirkung des Medikaments im Vordergrund. Es ist ihnen wichtig zu entspannen und tief schlafen zu können. Genau dafür sind Benzodiazepine konzipiert. Außerdem werden Benzodiazepine attraktiv, weil sie durch die Verpackung auch am Schwarzmarkt leicht zu identifizieren sind und Fälschungen von Blistern (Sichtverpackungen von Tabletten) eher die Ausnahme sind. Die Menschen in der Szene wollen genau wissen was sie konsumieren. Aber auch der Genuss des Rausches spielt eine Rolle: Für viele KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit ist es angenehm den Alltag zu vergessen. Benzodiazepine sind auch hier wirksam, speziell in Kombination mit Alkohol und Opiaten. Es ist beabsichtigt, die Stimmung so positiv zu beeinflussen. Durch den, teilweise langjährigen, Konsum der Tranquilizer kommt es auch zu Abhängigkeitssymptomen. Befragte Personen haben angegeben, Benzodiazepine nur zu konsumieren, um Entzugserscheinungen zu vermeiden. Auch als Schmerzmittel finden Benzodiazepine in der Szene Verwendung. Eine weiterer Faktor für die momentanen Ursachen des Konsums ist die relativ gut Verfügbarkeit. Ob von der ÄrztIn, aus der Szene, oder aus dem Ausland: vergleichsweise leicht zu bekommen zu sein. 80 Benzodiazepine scheinen Es konnten mehrere Hypothesen, die sich aus der Literaturrecherche ergeben haben, bestätigt werden: Die KonsumentInnen nehmen Benzodiazepine wegen der entspannenden und angstmildernden Wirkung. Benzodiazepine werden zu Alltagsbewältigung eingesetzt. Von den KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit werden Benzodiazepine als Schlafmedikation eingesetzt. Um die Funktionalität aufrecht zu erhalten, werden Benzodiazepine zur Vermeidung von Entzugserscheinungen konsumiert. Benzodiazepine werden konsumiert, weil die Personen sicher sein können was und wie viel konsumiert wird. Die Sicherheit steht im Vordergrund. 8.2.1 Blaue Lippen als Erkennungsmerkmal der Szene Benzodiazepine werden von einigen KonsumentInnen konsumiert, um sich der Szene zugehörig zu fühlen bzw. um stilbildend zu sein. Dieser Grund ist im allgemeinen Ranking nicht angeführt, weil die Standardabweichung zu groß gewesen ist. Rein deskriptiv finden sich aber doch sechs Personen, die dieser Begründung zustimmen, vier davon voll. Für ein präziseres Ergebnis ist eine qualitative Studie zur Beschreibung der Sinnhaftigkeit dieses Verhaltens angebracht. 8.2.2 Benzodiazepinkonsum als Bewältigung der Prostitutionstätigkeit Zwei Frauen haben diesem Grund Zustimmung gegeben, eine davon mit der höchsten Punktezahl. Nähere Angaben zu diesem Thema können nicht gemacht werden. Es konnte einzig und alleine bestätigt werden, dass diese Bewältigungsstrategie auch in Zusammenhang mit Benzodiazepinen existiert. 8.2.3 Wirkungskumulation von Benzodiazepinen und Alkohol 39 Personen (n=95) der Stichprobe konsumieren Benzodiazepine, um „in Verbindung mit Alkohol eine stärkere Wirkung zu erreichen“. Für 13 Personen ist dieser Grund von besonderer Relevanz, sie haben ihm volle Zustimmung gegeben. Der Konsum von Alkohol und Benzodiazepinen ist sehr riskant, da die Wirkung kaum abgeschätzt 81 werden kann und teilweise erst mehrere Stunden nach der Einnahme eintritt. Nicht berücksichtigt ist, dass viele KlientInnen der niederschwelligen Drogenarbeit noch mindestens eine weitere Substanz konsumieren, meist aus der Gruppe der Opiate. In diesen Fällen könnte die Toleranzentwicklung lebensrettend sein. Ein regelmäßiges Unterbrechen und Fortsetzen dieser Konsumpraxis ist lebensbedrohlich. Ähnliches gilt für die folgenden Ergebnisse, in Bezug auf den Beikonsum zu Opiaten. 8.2.4 Wirkungskumulation von Benzodiazepinen und Opiaten Benzodiazepine werden auch konsumiert, um kumulative Effekte mit Opiaten zu erzeugen. Insgesamt 52 (54,5%) von 99 Personen haben die verstärkende Wirkung als Konsumgrund angegeben. Das heißt auch, dass die Wirkung in Verbindung mit Alkohol weniger beliebt ist, als mit Opiaten. 15 Personen der Stichprobe stimmen diesem Konsumgrund voll zu. So lange der Beikonsum unterhalb der empfohlenen Grenzmengen geschieht und die Benzodiazepine nicht intravenös konsumiert werden ist kaum ein höheres Risiko für die Gesundheit vorhanden. Auch hier sind die Personen gefährdet, die phasenweise große Mengen Benzodiazepine neben der regelmäßigen Substitution konsumieren (siehe auch 8.1.5). 8.2.5 Schnellere Wirkung durch das Lutschen der Tabletten ist kein Mythos Wie im einleitenden Literaturteil erwähnt, ist die schnellere Wirkung durch die Aufnahme des Wirkstoffes über die Mundschleimhaut begründbar. Dieser Effekt äußert sich auch in der Beliebtheit der Konsumform und der Zustimmung als Begründung des Konsums. So haben 38 StudienteilnehmerInnen (n=100) der Aussage „weil ich die schnelle Wirkung durch das Lutschen mag“ zugestimmt. 16 Personen haben diesem Punkt die volle Zustimmung gegeben. Dieses Ergebnis kann durchaus als positiv bewerte werden, da der orale Konsum, egal ob geschluckt oder gelutscht, die Gesundheit schont. Vielleicht kann manchen KlientInnen diese Konsumform als Alternative zum intravenösen Konsum angeboten werden, wenn die schnellere Wirkung von Bedeutung ist. Eine andere Frage ist der Umgang mit dem eventuell blau gefärbten Speichel, der von manchen StudienteilnehmerInnen dezidiert erwünscht, aber doch von der Mehrheit abgelehnt worden ist. Die meisten BenzodiazepinkonsumentInnen wollen identifiziert ausgesetzt sein. 82 in der werden, Öffentlichkeit oder einer nicht als Stigmatisierung 8.3 Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum und Alter beim ersten i.v. Konsum von Benzodiazepinen korreliert Es hat sich gezeigt, dass es eine mittelstarke, positive Korrelation zwischen dem Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum und dem ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen gibt. Das bedeutet: umso früher die KlientInnen der niederschwellige Drogenarbeit beginnen, Benzodiazepine zu konsumieren, umso früher wird auch der intravenöse Konsum dieser Substanz probiert. In diesem Fall war die Hypothese einseitig und der Korrelationseffizient hat einen Wert von 0,448. Der p-Wert ist mit 0,001 hoch signifikant gewesen. Die Berechnung wurde aus einer Stichprobe von n=43 durchgeführt. 8.4 Zusammenhänge zwischen zwei Variablen sind nicht immer nachweisbar Weitere Überprüfungen von Zusammenhängen sind nicht sinnvoll, weil die Stichprobe nicht die Voraussetzungen erfüllt. So sind zu wenige Frauen in der Stichprobe enthalten und die Stichprobe ist zu klein. Die Zusammenhänge sind außerdem nicht linear. Zu komplex sind Ursachen und Wirkungen miteinander verflochten. 83 9 Ausblick Im Juli 2012 ist der Ganslwirt geschlossen und die neue, wesentlich größere Einrichtung der Suchthilfe Wien gGsmbH, der Jedmayer eröffnet worden. Für die KlientInnen hat sich dadurch anfänglich wenig bis gar nichts an ihren Gewohnheiten geändert, außer dass sie nun zu der Ecke Gumpendorferstraße und Gürtel kommen, um Beratung, Spritzentausch, Essen, Kleidung und medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Ob und wie sich die neue Struktur auf das Konsumverhalten der KlientInnen auswirkt, ist noch nicht absehbar. Sicher ist nur, dass die KlientInnen er niederschwelligen Drogenarbeit weiterhin Benzodiazepine konsumieren werden, manche von ihnen mit hohem Risiko für ihre Gesundheit. Die MitarbeiterInnen und die Klinische Soziale Arbeit im Speziellen sind angehalten, die gefährdeten Personen zu begleiten und ein Leben mit Benzodiazepinkonsum langfristig möglich zu machen. Um geschlechtsspezifische Unterschiede beim Risikoverhalten hinsichtlich des Benzodiazepinkonsums besser beschreiben und verstehen zu können, sind qualitative als auch quantitative Studien zu empfehlen. Aufgrund der im Literaturteil beschriebenen Sachverhalte liegt die Vermutung nahe, dass Ursachen des Benzodiazepinkonsums je nach Geschlecht differenzierbar sind. Speziell die stilbildenden Faktoren des Drogenkonsums, zum Beispiel zur Herstellung von Männlichkeit, sind in diesem Zusammenhang noch ein weißer Fleck auf der wissenschaftlichen Landkarte. Eine weitere Aufgabe für kommende Forschungsarbeiten ist auch, die Darstellung von Konsummustern von Benzodiazepinen noch detailreicher zu gestalten. Um die phasenartigen Verläufe von risikoreichen Konsummustern darzustellen, sind follow-up Studien notwendig. Eine Gruppe von BenzodiazepinkonsumentInnen kann in einer Einrichtung wie dem Jedmayer über Jahre hinweg begleitet und anonymisiertes Datenmaterial aufgezeichnet werden. So könnte der Einfluss von Critical Life Events und der Tranquilizergebrauch als und Bewältigungsstrategie beschrieben werden. Außerdem ist es in dieser Arbeit nicht möglich gewesen, weil die entscheidende Frage nicht gestellt worden ist, detaillierte Aussagen zum mehrfachen, gleichzeitigen Substanzkonsum zu machen. So bleibt unbekannt, wie groß der Anteil der Personen ist, die Benzodiazepine, Alkohol und Opiate gleichzeitig konsumieren. 84 10 Literaturverzeichnis Barsch, Gundula (2010): Drogen und soziale Praxis. Teil 1: Menschenbilder akzeptierender Drogenarbeit und wie sie sich in Grundbegriffen wiederfinden. Leipzig: Engelsdorfer Verlag Binner, Ulrich/ Ortmann, Karlheinz (2008): Klinische Sozialarbeit als Sozialtherapie. In: Ortmann, Karlheinz/ Röh, Dieter (Hrsg.): Klinische Sozialarbeit. Konzepte, Praxis, Perspektiven. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag Bischof, Gallus/ Ulrich, John (2002): Suchtmittelabhängigkeit bei Männern und Frauen. In: Hurrelmann, Klaus/ Kolip, Petra (Hrsg.): Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Männer und Frauen im Vergleich. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber Verlag BMG, Bundesministerium für Gesundheit (2012): Leitlinie zum Umgang mit dem schädlichen Gebrauch und der Abhängigkeit von Benzodiazepinen bei Patientinnen und Patienten in Erhaltungstherapie mit Opioiden. Wien: BMG Bühringer, Gerhard/ Bauernfeind, Rita/ Kraus, Ludwig/ Simon, Roland (2000): Folgen des Mißbrauchverhaltens. In: Uchtenhagen, Ambros/ Zieglgänsberger, Walter (Hrsg.): Suchtmedizin. Konzepte, Strategien und therapeutisches Management. München: Urban & Fischer Verlag Brosch, Werner (1996): Psychopharmaka. Eine Einführung für Psychotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter und andere professionelle Helfer. Wien: Orac Verlag Coster, Ben/ Karner, Robert (2004): Konsumräume, ein Situationsvergleich. WienInnsbruck-Amsterdam-Zürich. „Sinnvolle Prävention oder leichtfertiger Umgang mit Drogen?“. Diplomarbeit, Wien: Bundesakademie für Sozialarbeit DOKLI- Bericht (2010): Einheitliche Dokumentation der Klientinnen und Klienten der Drogeneinrichtungen (DOKLI 2009). Wien: GÖG/ÖBIG Eisenbach-Stangl, Irmgard/ Pilgram, Arno/ Reidl, Christine (2008): Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außen- und Innenansichten. Wien: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung 85 Finzen, Asmus (2004): Medikamentenbehandlung bei psychischen Störungen. Einführung in die Therapie mit Psychopharmaka. Bonn: Psychiatrie- Verlag Friedrichs, Jürgen (2006): Konstruktion von Männlichkeiten – Nutzen und Risiken des Konsums von Drogen. In: Zander, Margherita/Hartwig, Luise/ Jansen, Irma (Hrsg.): Geschlecht Nebensache? Zur Aktualität einer Gender-Perspektive in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: VS-Verlag Guggenbühl, Lisa/ Berger, Christa (2001):Subjektive Risikowahrnehmung und Schutzstrategien sich prostituierender Drogenkonsumentinnen . Eine qualitative Studie unter besonderer Berücksichtigung HIV-relevanten Risiko- und Schutzverhaltens. Zürich: Forschungsbericht aus dem Institut für Suchtforschung , Nr. 134 Haltmayer, Hans (2007a): Prophylaxe und Therapie der Hepatitis A, B und C. In: Beubler, Eckhard/ Haltmayer, Hans/ Springer, Alfred (Hrsg.): Opiatabhängigkeit. Interdisziplinäre Aspekte für die Praxis. Wien, New York: Springer Verlag Haltmayer, Hans (2007b): Schadensminimierende Aspekte - „Harm- Reduction“. In: Beubler, Eckhard/ Haltmayer, Hans/ Springer, Alfred (Hrsg.): Opiatabhängigkeit. Interdisziplinäre Aspekte für die Praxis. Wien, New York: Springer Verlag Haltmayer, Hans/ Rechberger, Gerhard/ Skriboth, Peter/ Springer, Alfred/ Werner, Wolfgang (2009): Opioidabhängiger“. Konsensus In: Soyka, Statement Michael/ „Substitutionsgestützte Backmund, Markus Behandlung (Hrsg.) (2009): Suchmedizin in Forschung und Praxis. Hering, J./ Angelkort B. (2006): Akute Ischämie der Hand nach interarterieller Flunitrazepaminjektion. Stuttgart: Georg Thieme Verlag Herzig, Michael/ Feller, Andrea (2005): Drogenpolitik der Stadt Zürich. Strategien – Maßnahmen – Perspektiven. Stadt Zürich: Sozialdepartement Heudtlass, Jan- Hendrick (2005): Safer- Use – Gesundheitstipps für Drogengebraucher. In: Heudtlass, Jan-Hendrik/ Stöver, Heino (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt am Main: Fachhochschulverlag Hormann, Bernd/ Winkler, Petra (2005): Safer- Use: „Pillen“- Informationen und Ratschläge. In: Heudtlass, Jan-Hendrik/ Stöver, Heino (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt am Main: Fachhochschulverlag 86 Iwersen- Bergmann, Stefanie/ Püschel, Klaus (2005): Drogen – Ihre Wirkungen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen. In: Heudtlass, Jan-Hendrik/ Stöver, Heino (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt am Main: Fachhochschulverlag Kaller, Paul (2001): Sozialer Status. In: Kaller, Paul (Hrsg.): Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Mielck, Andreas (2005): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Einführung in die aktuelle Diskussion. Bern: Hans Huber Verlag Ortmann, Karlheinz/ Röh, Dieter (2008): Klinische Sozialarbeit. Konzepte – Praxis Perspektiven. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag ÖBIG (2010): Bericht zur Drogensituation 2010. Wien: Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen Pfabe, Peter-Frank (2009): Die akute Extremitätenischämie – der besondere Fall. Gablitz: Krause & Parchernegg Gmbh, Verlag für Medizin und Wirtschaft Poehlke, Thomas (2005): Problematik des polyvalenten Konsums unter besonderer Berücksichtigung Substituierter und/oder HIV-/Hepatitis- Infizierter. In: Heudtlass, JanHendrik/ Stöver, Heino (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt am Main: Fachhochschulverlag Raab-Steiner, Elisabeth/Benesch, Michael (2012): Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung. Wien: Facultas Verlag Reiter, Susanne (2007): Kardiologische und pulmologische Komplikationen bei Opiatabhängigkeit. In: Beubler, Eckhard/ Haltmayer, Hans/ Springer, Alfred (Hrsg.): Opiatabhängigkeit. Interdisziplinäre Aspekte für die Praxis. Wien, New York: Springer Verlag Schneider, Wolfgang (1997): Perspektiven akzeptanzorientierter Drogenarbeit. In: Schneider, Wolfgang/ Buschkamp, Rolf/ Follmann, Anke (Hrsg.): Heroinvergabe und Konsumräume. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung Stöver, Heino/ Schneider, Wolfgang (2005): Die Bedeutung des Konzepts „Gesundheitsförderung“ für die Drogenhilfe – Einbezug von Betroffenenkompetenz und Entwicklung von Drogenberatung. In: Heudtlass, Jan- Hendrik/ Stöver, Heino (Hrsg.): Risiko mindern beim Drogengebrauch. Frankfurt am Main: Fachhochschulverlag 87 Suchthilfe Wien gGmbH (2012): Tätigkeitsbericht Ganslwirt. Wien: Suchthilfe Wien gGmbH Uchtenhagen, Ambros/ Zieglgänsberger, Walter (Hrsg.): Suchtmedizin. Konzepte, Strategien und therapeutisches Management. München: Urban & Fischer Verlag VWS (2008): Bericht 2008. Wien: Verein Wiener Sozialprojekte Literatur aus dem Internet: Dokli – Bericht: http://www.goeg.at/de/BerichtDetail/Einheitliche-Dokumentation-derKlientinnen-und-Klienten-der-Drogeneinrichtungen-DOKLI214.html, abgerufen am 1.11.2011 um 15:00 INDRO e.V.: Schneider, Wolfgang (2006): Was ist Niedrigschwellige Drogenhilfe? http://www.indro-online.de/nda.htm, abgerufen am 9.9.2012, abgerufen am 9.9.2012, 88 11 Abkürzungsverzeichnis bzw. beziehungsweise DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders gGsmbH gemeinnützige Gesellschaft mit begrenzter Haftung HIV Human Immmunodeficency Virus i.v. Intravenös n Stichprobe p Irrtumswahrscheinlichkeit s Standardabweichung STD Sexual Transmitted Diseases 89 12 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung ........................................................................... 44 Tabelle 2: Momentane Ursachen für den Benzodiazepinkonsum, nach Relevanz geordnet ...................................................................................................................... 68 Tabelle 3: Korrelation zwischen dem Alter beim ersten Konsum von Benzodiazepinen und dem Alter beim ersten intravenösem Konsum von Benzodiazepinen, n=43 .......... 71 90 13 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Bezugsquellen der Benzodiazepine, jede Kategorie entspricht dem Anteil von n=100 ................................................................................................................... 46 Abbildung 2: Anteile der Verschreibung per Rezept, n=100 ....................................... 47 Abbildung 3: Preis pro Streifen auf der Straße, n=91 .................................................. 48 Abbildung 4: Konsumierte Benzodiazepine - Medikamente, jede Kategorie jeweils n=100 .......................................................................................................................... 49 Abbildung 5: Häufigkeit des Somnubene® - Konsums, n=74 ...................................... 50 Abbildung 6: Wie viel Somnubene® auf einmal, n=73 ................................................. 50 Abbildung 7: Überprüfung der Einhaltung der Grenzmenge bei Somnubene®, n=73 .. 51 Abbildung 8: Häufigkeit des Praxiten®- Konsums, n=60.............................................. 52 Abbildung 9: Wie viel Praxiten® auf einmal, n=57 ....................................................... 52 Abbildung 10: Überprüfung der Einhaltung der Grenzmenge bei Praxiten®, n=57 ...... 53 Abbildung 11: Häufigkeit des oralen Konsums, n=100................................................. 54 Abbildung 12: Häufigkeit des oralen Konsums - lutschen, n=100 ................................ 55 Abbildung 13: Häufigkeit des intravenösen Konsums, n=100 ...................................... 55 Abbildung 14: Häufigkeit des nasalen Konsums, n=100 .............................................. 56 Abbildung 15: Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum, n=99 .................................... 57 Abbildung 16: Alter beim ersten intravenösen Konsum, n=86...................................... 58 Abbildung 17: Alter beim ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen, n=43 ... 58 Abbildung 18: Verwendung von sterilen Einmalfiltern, n=77 ........................................ 60 Abbildung 19: Verwendung von sterilen Löffeln, n=74 ................................................. 60 Abbildung 20: Verwendung von sterilem Wasser, n=78............................................... 61 Abbildung 21: Verwendung von Tupfern, n=79 ............................................................ 61 Abbildung 22: Verwendung einer frischen Nadel, n=79 ............................................... 62 Abbildung 23: Verwendung eines frischen Kolbens, n=79 ........................................... 62 Abbildung 24: Gespräch über die Risiken des i.v. Konsums von Benzodiazepinen, n=96 ............................................................................................................................ 63 Abbildung 25: Konsumorte, n=100 .............................................................................. 64 Abbildung 26: Konsum von Alkohol gemeinsam mit Benzodiazepinen, n=98 .............. 65 Abbildung 27: Bier und Benzodiazepine, n=32 ............................................................ 66 Abbildung 28: Konsum von Morphin gemeinsam mit Benzodiazepinen, n=79 ............. 67 Abbildung 29: Konsumierte Menge Morphin - gemeinsam mit Benzodiazepin, n=83 ... 67 Abbildung 30: Korrelation: Alter beim ersten i.v. Konsum von Benzodiazepinen zu Alter beim ersten Benzodiazepinkonsum ............................................................................. 71 91 14 Anhang Hier findet sich das Erhebungsinstrument, der standardisierte Fragebogen. Es ist ausschließlich das Layout geändert worden, um ihn hier einfügen zu können. Guten Tag, ich bin Student der Klinischen Sozialen Arbeit und forsche zum Thema Benzodiazepinkonsum. Ich bitte Sie um Ihre persönlichen Einschätzungen. Ihre Auskünfte bleiben völlig anonym. Bitte kreuzen Sie das Kästchen (□) neben der entsprechenden Antwort an. Falls Sie sich geirrt haben sollten, machen Sie bitte um das falsche Kästchen einen Kreis. Den Fragebogen auszufüllen, dauert ungefähr zehn Minuten. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 1. Konsummuster 1.1 Woher beziehen Sie ihre Benzodiazepine (Mehrfachnennung möglich)? Von meinem/meiner Arzt/ÄrztIn ...................................... □ Von mehreren Ärzten/ÄrztInnen ..................................... □ Straße/Szene ................................................................. □ Freunde .......................................................................... □ Bekannte ........................................................................ □ Familie............................................................................ □ Sonstiges ____________________________________ □ 1.1.2 Wann haben Sie zum ersten Mal Benzodiazepine konsumiert? Alter beim ersten Konsum von Benzodiazepinen:_____________ 1.1.3 Beziehen Sie Benzodiazepine über ein Rezept/ bekommen Sie die Medikamente verschrieben? ja □ nein □ teilweise □ 1.1.4 Falls Sie auf der Straße kaufen, was ist der übliche Preis für einen Streifen (im Durchschnitt)? Preis für einen Streifen:____________________ 92 1.2 Um welches Benzodiazepin handelt es sich genau und wie viel konsumieren Sie auf einmal (Mehrfachnennung möglich)? Somnubene® Anzahl:_______ täglich ....................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche..................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat................................................................. □ nie ............................................................................................ □ Praxiten® Anzahl:_______ täglich ....................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche..................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat................................................................. □ nie ............................................................................................ □ Anzahl:_______ täglich ....................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche..................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat................................................................. □ nie ............................................................................................ □ Anzahl:_______ täglich ....................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche..................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat................................................................. □ nie ............................................................................................ □ Anzahl:_______ täglich ....................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche..................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat................................................................. □ nie ............................................................................................ □ Anxiolit® Rohypnol® Andere: _________ 1.3 In welcher Form konsumieren (Mehrfachnennung möglich)? nasal oral schlucken oral lutschen Sie Benzodiazepine täglich ...................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche .................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat ................................................................ □ nie ............................................................................................ □ täglich ...................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche .................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat ................................................................ □ nie ............................................................................................ □ täglich ...................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche .................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat ................................................................ □ 93 nie ............................................................................................ □ intravenös täglich ...................................................................................... □ mehrmals täglich ...................................................................... □ einmal pro Woche .................................................................... □ mehrmals pro Woche ............................................................... □ mehrmals pro Monat ................................................................ □ nie ............................................................................................ □ 1.3.1 Seit wann konsumieren Sie intravenös? Alter beim ersten intravenösen Konsum:___________ Alter beim ersten intravenösen Konsum von Benzodiazepinen:___________ 1.3.2 Treffen Sie folgende Maßnahmen beim intravenösen Konsum (Mehrfachantworten möglich)? Einmalfilter (z.B. Sterifilt®) nie □ immer □ manchmal □ oft □ steriles Wasser nie □ immer □ manchmal □ oft □ steriler Löffel (z.B. Stericup®) nie □ immer □ manchmal □ oft □ Tupfer nie □ immer □ manchmal □ oft □ frische Nadel nie □ immer □ manchmal □ oft □ frischer Kolben nie □ immer □ manchmal □ oft □ 1.3.3 Haben Sie schon einmal ein Gespräch über die Risiken des intravenösen Konsums von Benzodiazepinen mit einer ÄrztIn oder einer SozialarbeiterIn geführt? ja □ nein □ 1.3.4 Wo konsumieren Sie (Mehrfachnennung möglich)? ihre Drogen im Moment Wohnung ...................................................................... □ Straße ........................................................................... □ öffentliche Toiletten ....................................................... □ Häusereinfahrten/ Stiegenhäuser .................................. □ Parkanlagen.................................................................. □ Sonstiges_________________..................................... □ 1.4 Wie oft konsumieren Sie Benzodiazepine gemeinsam mit anderen Drogen (Mehrfachnennung möglich)? 1.4.1 Konsumieren Sie Alkohol gemeinsam mit Benzodiazepinen? nie □ - weiter mit Frage 1.4.2 manchmal □ 94 oft □ immer □ 1.4.1.2 Wie viel Alkohol trinken Sie dann? Bier ca. ½l □ca. 1l □ ca. 1½l □ Wein ca. ¼l □ca. ½l □ca. ¾l □mehr □ Spirituosen ca. 6cl □ ca. 12cl □ mehr □ ca. 18cl □ Soft Drinks (z.B:Eristoff Ice) ca. ½l □ca. 1l □ ca. 1½l □ mehr □ ca. ½l □ca. 1l □ ca. 1½l □ mehr □ Andere:___________ mehr □ 1.4.2 Konsumieren Sie Opiate und Benzodiazepine? Heroin Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ Opium Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ Morphin Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ L-Polamidon® Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ Subutex® Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ Codein Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ Andere:______________ Menge:___________ nie □ manchmal □ immer □ oft □ 2. Gründe für den Benzodiazepinkonsum 95 2.1 Ich konsumiere Benzodiazepine... (0-10, inwieweit trifft das zu? 0= gar nicht 10= trifft zu) ..., weil meine körperlichen Schmerzen dann nachlassen (unabhängig von Entzugserscheinungen). gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., um das entstehen von Entzugserscheinungen (Krachen) zu verhindern. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …, um vorhandene Entzugserscheinungen abzuschwächen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil ich die schnelle Wirkung durch das Lutschen mag. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …, weil ich die schnelle Wirkung durch den intravenösen Konsum mag. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., um in Verbindung mit Alkohol ein stärkere Wirkung zu erreichen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., um in Verbindung mit Opiaten ein stärkere Wirkung zu erreichen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil mir die Substitutionsmedikamente zu niedrig dosiert sind. gar nicht □ 0 trifft zu □ 1 □ □ □ 2 3 4 □ □ 5 6 □ □ □ 7 8 9 □ 10 ..., weil es mir dann leichter fällt, auf den Strich/ Anschaffen zu gehen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 ..., weil ich sie von meinen Freunden/ Bekannten bekomme. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil die Blauen Lippen (wie beim Medikament Somnubene®) ein Erkennungsmerkmal der Szene sind. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil ich sie mir leisten kann – Substitutionsmedikamente sind am Schwarzmarkt zu teuer. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil es angenehm ist meinen Alltag zu vergessen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., um zu entspannen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..., weil ich mir sicher sein kann, was ich kaufe. Ich erkenne an der Verpackung den Inhalt. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …, weil die Wirkung der Tabletten immer gleich ist – ich weiß wie viel ich davon nehmen muss. Gar nicht Trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …, um den Rausch zu genießen. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …,um tief schlafen zu können. gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 ..., weil sie leicht und immmer verfügbar sind gar nicht trifft zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Sozialstatistik 3.1 Geschlecht männlich……………………□ weiblich…………………….□ 3.2 Wie alt sind Sie? Alter in Jahren: __________ 3.3 Familienstand: ledig .......................................................................................................................................□ verheiratet / in Lebensgemeinschaft lebend ...........................................................................□ geschieden / getrennt lebend ................................................................................................□ verwitwet ................................................................................................................................□ 3.4 Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? keinen Pflichtschulabschluss ..................................................................................................□ Pflichtschule abgeschlossen ..................................................................................................□ Lehre / berufsbildende mittlere Schule ...................................................................................□ Matura (und Höheres) ............................................................................................................□ 3.5 Wie ist Ihr derzeitiger Berufsstand? Sind Sie...? voll berufstätig ........................................................................................................................□ teilzeitbeschäftigt ....................................................................................................................□ geringfügig beschäftigt ...........................................................................................................□ arbeitssuchend .......................................................................................................................□ in Pension ..............................................................................................................................□ 3.6 In welcher Höhe liegt Ihr monatliches Einkommen? bis zu 752€ .............................................................................................................................□ zwischen 753- 1000€ .............................................................................................................□ über 1000€ .............................................................................................................................□ 3.7 Wo leben Sie? eigene Wohnung ....................................................................................................................□ Dauerwohnplatz .....................................................................................................................□ Übergangswohnheim/Betreutes Wohnen ...............................................................................□ Notquartier/Straße ..................................................................................................................□ Bekannte ................................................................................................................................□ 98 Sonstiges: _________________ ............................................................................................□ 99 15 Persönliche Daten Name: Fabian Grümayer Geburtsdatum: 7.9.1987 Geburtsort: Wien Nationalität: Österreich Schulbildung Schule: Oberstufenrealgymnasium Schwerpunkt Hochschulzugang: AHS Matura Abschlussdatum: Juni 2006 Leistungskurse: k.A. mit biologischem Studium Dauer: 2 ½ Jahre Hochschule: FH Campus Wien Abschluss: Frühjahr 2013 Titel der Diplomarbeit/ Masterarbeit: Blaue Lippen – blaue Venen BetreuerIn der Diplomarbeit/ Masterarbeit: FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Raab-Steiner Studienfächer: Studiengangsleitung; quantitative Methoden, Soziale Diagnose, Psychologie; Eine Studie zum Benzodiazepinkonsum bei den KlientInnen der akzeptierenden, niederschwelligen Drogenarbeit Berufspraxis Sozialmedizinische Drogenberatungsstelle Ganslwirt Vertretungsdienste Vertretungsdienste seit 2010 Suchthilfe Wien gGsmbH, Jedmayer 100