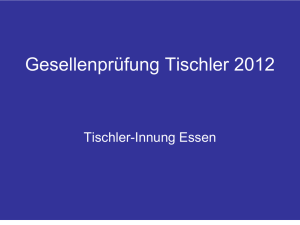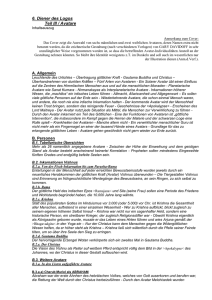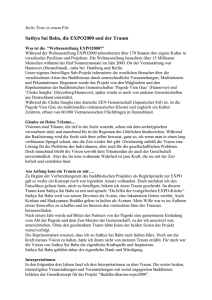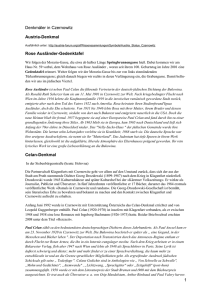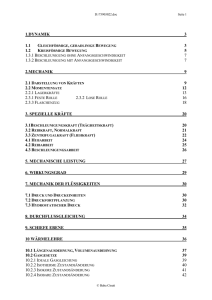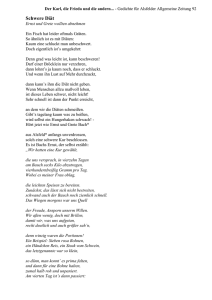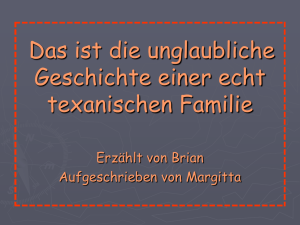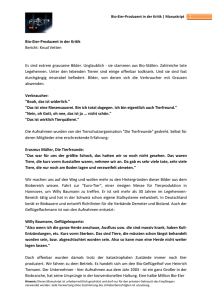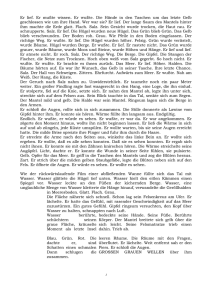Kapitel 7
Werbung
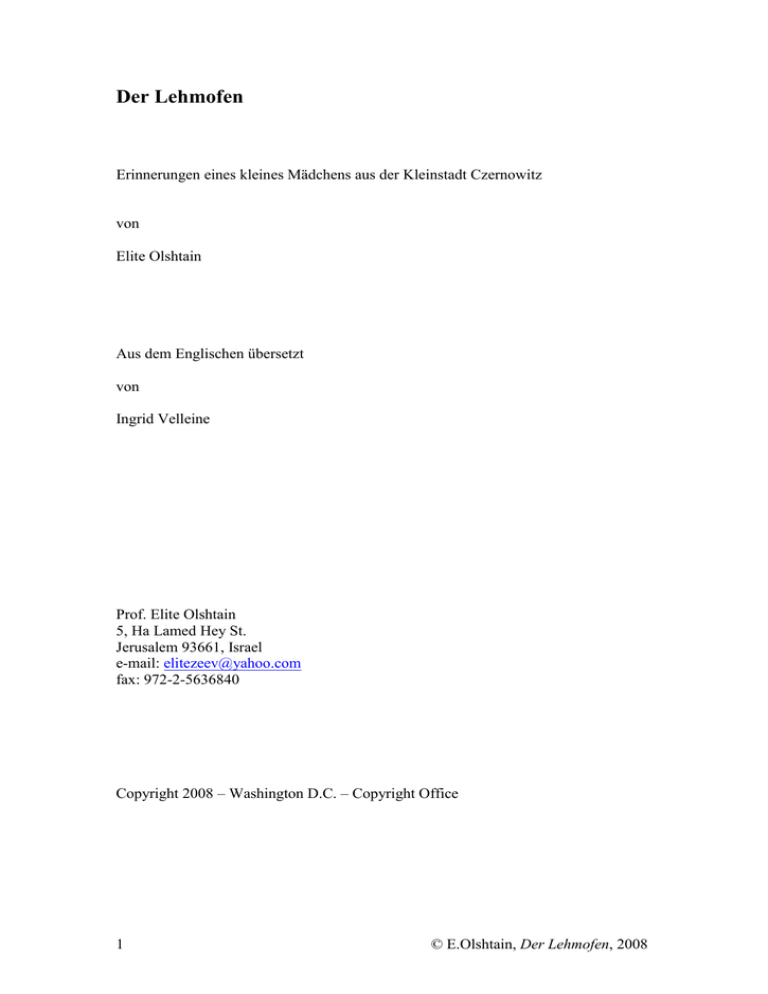
Der Lehmofen Erinnerungen eines kleines Mädchens aus der Kleinstadt Czernowitz von Elite Olshtain Aus dem Englischen übersetzt von Ingrid Velleine Prof. Elite Olshtain 5, Ha Lamed Hey St. Jerusalem 93661, Israel e-mail: [email protected] fax: 972-2-5636840 Copyright 2008 – Washington D.C. – Copyright Office 1 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Der Lehmofen 1. Leben in der Idylle 2. Die Russen kommen! 3. Die Rumänen sind wieder da und die Nazis sind mit dabei! 4. Baba - Das Leben bei meiner Großmutter 5. Bei Tante Rosa 6. Der gelbe Davidstern 7. Wir sind wieder daheim, in unserer Wohnung 8. Die Russen sind wieder da! 9. Frieda 10. Willy 11. Die große Enttäuschung meines Vaters 12. Ich lerne, mit Gleichaltrigen zu spielen 13. Abschied von Czernowitz 14. Können wir wieder eine Familie werden? 15. Erster Schultag 16. Leben unter den Kommunisten 17. Lange Reise in ein neues Land 18. Neuer Anfang 19. Ich werde eine Sabra Epilog – Besuch in Czernowitz, 60 Jahre später (2006) 2 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Vorwort Jahrelang habe ich meine Kindheitsgeschichte nicht erzählen wollen. Ich hatte den Holokaust überlebt, wie viele andere, und meine Geschichte war nicht der Rede wert. Ich hatte die Kriegszeit heile überstanden, und, wie durch ein Wunder hatte meine Familie es ebenfalls überstanden. Was sollte es da schon zu erzählen geben? Es war eine einfache Geschichte des Überlebens in harten Zeiten; ich habe weder dem Tod ins Gesicht blicken müssen, noch habe ich jemals mit eigenen Augen erlebt, wie andere Menschen umgebracht wurden; ich habe immer nur davon gehört. Wie hätte ich meine persönliche Geschichte mit den Schauergeschichten vergleichen können, von denen Überlebende im Laufe der fünfzig Jahre nach Kriegsende berichteten? Allein der Gedanke an eine Erwähnung dessen, daß ich selber eine Holokaustüberlebende war, erzeugte in mir Schuldgefühle; niemand sollte etwas davon wissen. Ich versuchte sogar vorzugeben, eine Sabra (in Israel geboren) zu sein und daß ich eine ganz normale Kindheit gehabt hätte, wie alle anderen Kinder in meiner Klasse oder in meiner Umgebung. Ich hätte alles vergessen wollen, aber trotzdem erinnerte ich mich. Ich hatte sehr deutliche Bilder aller erlebten Ereignisse vor Augen. Einige sagten mir, daß Kinder unter vier Jahren keine Erinnerungen haben können. Ich hörte hin, wußte jedoch innnerlich, daß ich Erinnerungen aus der Zeit hatte, als ich zwei oder zweieinhalb Jahre alt war. Es waren zwar nur Bilder aus der Perspektive eines Kleinkindes, aber diese Bilder waren deutlich und lebhaft, und niemand anders hätte etwas von deren Existenz wissen können. Eines Tages sah ich den Film "Hope and Glory – der Krieg der Kinder"1, und kam daraufhin zu dem Schluß, daß sogar eine Lebensgeschichte ohne ausgesprochen tragischen Vorkommnissen von Bedeutung sein kann, wenn sie aus dem Standpunkt eines Kindes erzählt wird. Nun kam ich auf den Gedanken, vielleicht doch eine Geschichte zu erzählen zu haben. Doch solange meine Mutter und mein Vater noch am Leben waren, konnte ich sie nicht erzählen. Es hätte meinen Eltern einen zu großen Schmerz bereitet und es wäre mir nicht möglich gewesen, die volle Wahrheit darzustellen. Die Beziehung zu meinen Eltern war immer belastet; es war mein Gefühl, daß sie das Buch, daß ich schreiben wollte, nicht ertragen hätten. "Hope and Glory – der Krieg der Kinder", ein Spielfilm des britischen Regisseurs John Boorman (1987), der über den Bombenangriff Londons in 1939 aus der Sicht eines Kindes berichtet. 1 3 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Dabei hatte ich auch das Bedürfnis, einige Erforschungen durchzuführen und herauszufinden, ob die Dinge, an die ich mich erinnerte, in irgend einem Bezug zu den allgemeinen geschichtlichen Ereignissen standen. Orly, die jüngste meiner drei Töchter, widmete sich der Aufgabe, die Ereignisse, auf die dieses Buches sich bezieht, zu erforschen. Wir waren immer wieder verblüfft festzustellen, wie genau die Kindheitserinnerungen den historischen Ereignissen entsprachen. Hier also die Geschichte – so wie ich mich daran erinnere: die Ereignisse des 2. Weltkriegs aus der Sicht eines kleinen Mädchens. 4 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 1 Ein idyllisches Leben Ich wurde am 26. März 1938 in der reizenden Stadt Czernowitz geboren. Der Frühling gab bereits seine ersten Anzeichen, die Straßen waren mit Schneeschlamm bedeckt. In der Wohnung meiner Eltern, auf der zweiten Etage eines modernen Wohngebäudes auf der Franzensgasse, war es angenehm warm. In dem großen braunen Lehmofen brannte ein helles Feuer. Am 26. März, zu früher Morgenstunde, erblickte ich mit Dr. Segals Hilfe das Licht der Welt, nachdem er den vorigen Abend mit seiner Frau und meinen Eltern beim Kartenspielen, den hochgeschätzten Fluden2 genießend, den meine Großmutter zu backen pflegte, verbracht hatte. Die Segals waren jüdische Nachbarn meiner Eltern, die eine Etage über uns wohnten. Beide Ehepaare, so wie die meisten Bewohner unseres Gebäudes, gehörten der czernowitzer Mittelschicht an. Es waren junge Leute, die es zu einem bequemen Leben gebracht hatten und Pläne für die Zukunft hatten. Wie üblich bezog sich das Gespräch an diesem Abend vor allem auf die beunruhigende Lage in der Welt. Meine Mutter Frieda, die Realistin der abendlichen Gesellschaft, war der Meinung, daß es für Juden keinen besseren Ort in der Welt gäbe als Czernowitz. Trotz der rumänischen Randalierer, die die Straßen nachts unsicher machten, und trotz des zunehmenden Antisemitismus, war das Leben dort schön. Innerlich hatte meine Mutter bereits den Plan geschmiedet, nach Amerika auszuwandern, falls die Lage sich verschlimmern sollte. Mein Vater, kurz Willy genannt (Wilhelm), war der Idealist in der Gruppe. Der Besuch seines Schwagers Tarzan (Srul), der Bruder meiner Mutter, der vor nicht langer Zeit in Czernowitz gewesen war, hatte ihn stark beeinflußt. Tarzan (Srul - Jiddisch für den männlichen Vornamen "Israel") lebte damals in einem Kibbuz in Palästina; er hatte nun ein Jahr als "Schaliach" (zionistischer Delegierter) aus Palästina in Czernowitz verbracht. Alle nannten ihn Tarzan, wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Filmschauspieler, der in den damaligen Filmen die Rolle des Tarzans spielte3. Er war ein echter Sozialist, mit außergewöhnlichem Charm und 2 Osteuropäischer Schichtkuchen mit Obst und Nüssen. Johnny Weismueller (1904-1984), in Österreich geboren. In 1924 und 1928 gewann er als Schwimmsportler der USA mehrere olympische Medaillen. 1929 wurde er Filmschauspieler in Hollywood und ist bis heute der berühmteste Tarzandarsteller. 3 5 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Begeisterung. Die drei Brüder meines Vaters und auch Srul, der älteste Bruder meiner Mutter, waren alle vor zehn Jahren als ergebene Mitglieder der "Schomer Hatzair"-Bewegung4 ausgewandert. In Palästina hatten sie sich bei der Gründung und dem Aufbau von neuen KibbutzSiedlungen (sozialistische Agrarkommunen) beteiligt. Mein Vater war der einzige in seiner Familie, der in Czernowitz zurückgeblieben war. Er war dort geblieben, um das Familiengeschäft für Marmorsteine weiterzuführen, so wie er es seinem Vater auf dessen Sterbebett versprochen hatte. Es war ein Geschäft, daß von Generation zu Generation weitergereicht worden war und nun war Willy dafür zuständig. So sprach mein Vater, auf seiner gelassenen Art, von Palästina und von der Gelegenheit, eine neue und gerechte Gesellschaft im Land der Väter aufzubauen. Seine Worte klangen romantisch und es lagen Welten zwischen ihnen und den Grausamkeiten, die Hitler an den Juden in Deutschland und Österreich verübte. Es dauerte nicht lange, bis meine Mutter alle daran erinnerte, daß Palästina ein Land der Mühsal und der Öde sei. Die Juden dort waren arm, sie mußten mühselige Körperarbeit leisten und sich den Rücken zerschinden, und dies alles für einen Traum, der vielleicht niemals Wirklichkeit werden würde. Auch sie erwähnte ihren Bruder, stellte ihn aber als einen vielversprechenden jungen Mann dar, der alle guten Dinge in seinem Leben aufgegeben hatte: die Gelegenheit auf ein Medizinstudium in Wien, die Heirat mit einer wohlhabenden Frau und auch darauf, ein führendes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Czernowitz zu werden. Und das alles wozu? Für Malaria und ein kärgliches Leben in einem Kollektiv in einem Wüstenland, mit einer wortkargen und zurückhaltenden Frau, die bei Weitem nicht das Niveau besaß, daß ihrem großartigen Bruder gebührte. Das Ehepaar hatte zwar einen hübschen Sohn, der aber kein Wort Deutsch sprach: was für eine Ausbildung könne dieser Junge später erhalten? Für sie stand fest, daß, falls sie Czernowitz verlassen müßten, nur eine Auswanderung nach Amerika in Frage käme. Dort könnten sie eine neue Existenz in der freien Welt aufbauen. Dr. Segal war der Pessimist der Gruppe. Er hatte nicht vor, Czernowitz zu verlassen, obwohl er sich durchaus gut vorstellen konnte, wie Hitler, dem Wahn verfallen, die Welt erobere und den Juden das Leben sogar hier in der Bukowina, der Provinz Czernowitzs, in der sie bisher ein relativ sorgenfreies Leben genossen hatten, unerträglich mache. Es hatte sich 4 6 "Schomer Hatzair", wörtlich "der junge Wächter", war eine jüdisch-sozialistische Jugendbewegung. © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 herausgestellt, daß der rumänische König Carol mit den Deutschen auf sehr gutem Fuße stand. So sah die Zukunft nach Dr. Segals Meinung sehr ungewiß aus. Frau Segal war eine stille Frau, die wenig sprach. Da sie aus einer armen Familie kam, fühlte sich vom Schicksal gesegnet, da sie das Glück gehabt hatte, einen erfolgreichen Frauenarzt zu heiraten und in einer Wohnung in der Stadtmitte zu leben, die mit Strom, fließendem Wasser und allen Bequemlichkeiten der damaligen Zeit ausgestattet war. Dann und wann sprach sie halb flüsternd zu sich selbst: "Letzten endes haben wir doch ein bequemes Leben hier. Ich möchte das alles nicht aufgeben. Hitler wird nicht ewig an der Macht bleiben; außerdem befindet er sich doch weit weg von uns. Czernowitz war schon immer eine jüdische Stadt. Könnt ihr euch diese Stadt ohne Juden vorstellen? Hier müssen wir bleiben und das Beste daraus machen." So endete in dieser Nacht das Gespräch damit, daß alle lächelten und sich wünschten, daß auch sie so optimistisch sein könnten. Meine Eltern heirateten 1935 in Czernowitz. Meine Mutter kam aus einer einfachen und armen Familie, die Furmans, die im ärmsten Teil der Stadt lebte. Mein Vater kam aus einer Familie aus dem oberen Mittelstand, die ein wohletabliertes Geschäft in der Stadtmitte, auf der "Russischen Gasse", besaß. Sein Vater war Inhaber einer Marmor-Werkstatt, die bereits vor dem ersten Weltkrieg, zur Zeit des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches, einen gewissen Erfolg genoß; das Geschäft blühte auch nach dem 1. Weltkrieg weiterhin, dank der Aufträge, die von der rumänischen Stadtverwaltung kamen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Firma einen Auftrag zum Aufbau der Fassade des neuen Theatergebäudes erhalten, der sich später als sehr bedeutend erwies, da das Theatergebäude mit der Zeit als ein Juwel der Architektur dieser Gegend betrachtet wurde. Von da an genossen die Zellers den Ruf einer der feinsten Marmor-Werkstätte der Stadt, den nur eine einzige andere Firma mit ihr teilte, nämlich die Marmor-Werkstatt Moskaliuk. Kurz nachdem meine Eltern geheiratet hatten, im Frühling 1936, erlag mein Großvater Simcha einem Herzinfarkt. Auf seinem Sterbebett ließ er meinen Vater schwören, Czernowitz nicht zu verlassen und das Familienunternehmen zu übernehmen: "Wir haben bewiesen, daß unsere jüdische Handwerkkunst genauso gut ist, wie die der berühmten Moskaliuks. Sorge dafür, daß diese Tradition weiterhin aufrechterhalten bleibt". 7 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Sarah, die Mutter meines Vaters, verließ kurz nach dem Tod ihres Mannes das Land und zog nach Palästina zu ihren drei Söhnen. Obwohl sie immer eine sehr fromme Frau gewesen war, trat sie einem sekulären Kibbutz aus der Schomer Hatza'ir-Bewegung bei, in dem keine religiöse Traditionen eingehalten wurden. Anfangs war sie sehr bestürzt und betroffen von dieser Tatsache; nachdem sie jedoch einen Rabbi in der Nachbarstadt aufgesucht hatte, gründete sie eine koschere Abteilung in der großen Kibbutzküche, in der sie für sich und für die älteren Kibbutzmitglieder kochte. So sprach sich bald herum, daß die erste koschere Abteilung in einer Kibbutzküche entstanden war. Nun war mein Vater der einziger Nachkomme der Zeller Familie in Czernowitz und führte ein sehr erfolgreiches Marmorgeschäft. Zum größten Teil bestand seine Arbeit darin, Grabsteine aus Granit für den jüdischen Friedhof herzustellen. Er sah sein Werk als eine besondere jüdische Kunst, die ihm von seinen Vorfahren überliefert worden war. Er war sehr erfahren und verstand es, sowohl auf Deutsch, als auch auf Hebräisch, wunderschöne Buchstaben in den Stein einzugravieren. Granit-Grabsteine, die in seiner Werkstatt angefertigt worden waren, galten als einmaliges Werk und als Kunststück. Er war sehr stolz auf sein Werk und pflegte meistens seinen Namen, 'Wilhelm Zeller', am unteren Ende des Grabsteins als Signatur einzugravieren. Beide meiner Eltern waren in ihrer Jugend Mitglieder der SchomerHatsa'ir-Bewegung5 gewesen. Oft begegneten sie sich zum Anlaß zionistischer Reden, die im jüdischen Kulturzentrum, einem gewaltigen Gebäude in der Nähe des Theaters, gehalten wurden. Dort hatten sie sich die Reden von Persönlichkeiten wie Ussishkin6, Sokolov7 und Jabotinsky8 angehört. Sie beherrschten beide recht gut die hebräische Sprache, obwohl sie keine ergebenen Zionisten waren; wichtiger waren ihnen ihre zukünftige Karriere und ihr Wohlergehen. Mein Vater hatte während des Jahres 1929-1930 kurz in Wien studiert. Meine Mutter hatte ein Lehrerzertifikat von dem berühmten "Safa Ivrit" Lehrerseminar in Czernowitz erhalten. Kurz nachdem sie geheiratet hatten, erwarben meine Eltern die Wohnung auf den Franzensgasse, in einem erst vor kurzem angefertigtem Bauhaus-Gebäude. Danach stieg meine Mutter als volle 5 Die Schomer-Hatza'ir-Bewegung war eine jüdisch-sekuläre europäische Jugendbewegung, die sich rasch zu einer zionistischen Bewegung entwickelte und zur Auswanderung nach Palästina aufrief. 6 Avraham Menachem Mendel Ussishkin (1863-1941), prominenter zionistischer Anführer, setzte sich aktiv für die Gründung von Agrarsiedlungen, Erziehungs- und Kulturanstalten in Palästina ein. 7 Nahum Sokolow (1859-1936), in Wyszegrad (Rußland, heute Wyszogrod, Polen), als Sohn einer Rabbinerfamilie geboren, war von 1931 bis 1934 Präsident des jüdischen Kongresses. 8 Ze'ev Jabotinsky (1880-1940), in Odessa (Rußland) geboren. Nach den Progromen in Kishinew (1903) trat er der zionistischen Bewegung zu und befürwortete jüdische Selbstverteidigung. 1923 gründete er seine eigene Partei, die rechte revisionistische Zionistische Allianz. 8 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 und aktive Partnerin in die Marmorfirma meines Vaters ein. Sie hatte ein natürliches Talent für Geschäfte und lernte schnell, die Kontakte mit allen wichtigen Stadtverwaltungsposten und den Baufirmen zu pflegen; das Geschäft blühte auf. Als die Zeit der Niederkunft näher kam, stellte meine Mutter, wie viele andere jüdischen Frauen aus der Mittelschicht es taten, ein deutsches Kindermädchen ein, daß mich betreuen sollte. Sie hatte nicht vor, das Haus zu hüten und wollte nach wie vor ihrer Arbeit im Familiengeschäft nachgehen. Nach mehreren Bewerbungsgesprächen fand sie das perfekte Kindermädchen, eine junge Frau namens Erika, die ein makelloses Deutsch sprach und immer ein Dirndlkleid trug. Die Wohnung in der Franzensgasse war nicht sehr geräumig, aber sie war bequem. Es gab ein großes Wohnzimmer mit drei großen Fenstern zur Straße hinaus. Es war mit modernen und bequemen Möbeln eingerichtet; meine Eltern besaßen sogar ein Radio und ein großes Klavier. Das Schlafzimmer war das zweitgrößte Zimmer, mit einem Balkon zum Hinterhof. Beide Zimmer waren mit großen Lehmöfen ausgestattet, die im Winter große Mengen von Brennholz verbrauchten. In der Küche stand ein riesiger Küchenherd und ein großer Eßtisch für die ganze Familie. Aus der Küche führte eine Tür in ein Zimmer, das für das Kindermädchen oder die Hausmagd bestimmt war, und eine weitere Tür führte in einen Abstellraum. Doch das allerwichtigste in der Wohnung war die separate Toilette mit fließendem Wasser, wie in jedem modernen Gebäude. Wer in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts eine solche Wohnung in der Stadtmitte besaß, war vermögend, und meine Mutter war sehr stolz darauf. Am Morgen meiner Geburt wurde meine Großmutter Sabine, die Mutter meiner Mutter, zur Hilfe gerufen. Sie war eine sehr weise und erfahrene Frau, und sie übernahm sofort die Leitung der Dinge. Erika, das Kindermädchen, würde in einigen Tagen ihre Arbeit aufnehmen und bis dahin sollte alles in Stand gebracht werden, damit sie sich in ihrem kleinen Zimmer wohl fühle; ich sollte die komplette Ausstattung bekommen, die damals für Säuglinge erhältlich war. Meine Großmutter Sabine – von vielen Sima genannt – und mein Vater sorgten für alles, während meine Mutter die ganze Woche lang das Bett hütete, sich ausruhte und sich dem Stillen widmete. Nach Dr. Segal hätte sie mindestens zehn Tage im Bett bleiben sollen, aber nach einer Woche gab er meiner Mutter nach, da sie sich schon erholt hatte und wieder bei 9 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 vollen Kräften war; sie wollte ihre üblichen Beschäftigungen wieder aufnehmen. Meine Großmutter war aufgeregt und freute sich sehr über meine Ankunft; sie tanzte unentwegt, während sie mich in ihren Armen hielt. "Dieses kleine Mädchen wird ein gutes Leben haben. Sie ist von Anfang an in bequemen Verhältnissen geboren, nicht so wie ihre Mutter, die ein Jahr vor dem großen Krieg geboren wurde. Sie wird nie einen Krieg erleben müssen wie den, den wir erlebt haben." Sie ahnte nicht, was auf uns zukam. Erika war eine sehr anständige junge Frau, äußerst höflich, von penibler Sauberkeit und mit einer strengen deutschen Erziehung. Jeden Morgen badete sie mich mit großer Sorgfalt, kleidete mich mit den allerschönsten Babykleidern und legte mich in den Kinderwagen, um mich zu meiner Mutter ins Geschäft zu bringen; dort stillte meine Mutter mich, danach kehrte sie zu ihrer Arbeit zurück. Zweimal am Tag ging Erika den Weg hin und her mit mir im Kinderwagen. Glücklicherweise waren die ersten Monate meines Lebens im Frühling und im Sommer, eine wunderbare Zeit für Spaziergänge auf den Straßen von Czernowitz. Erika war auf den ersten Blick von mir hingerissen gewesen und behandelte mich wie eine kleine Königin. "Sieht die Kleine nicht wie ein Fürstenkind aus?" pflegte sie Freunde und Nachbarn zu fragen. "Sie wird sicher mal eine sehr vornehme Dame werden!". Zu dieser Zeit war es Erikas Lebensziel, mich als hochprivilegiertes kleines Mädchen großzuziehen. Aus Deutschland kamen weiterhin böse Nachrichten, eine nach der Anderen. Im April 1938 wurden die letzten Firmen, die noch in jüdischen Händen waren, geschlossen und sämtliche jüdische Geschäfte an Deutsche überführt. Im Juli wurde jüdischen Ärzten das Berufsverbot ausgeteilt und jüdische Schüler wurden aus den Schulen ausgewiesen. Juden durften keine deutschen Namen tragen und mußten einen vorgeschriebenen Mittelnamen hinzufügen: Israel für das männliche, Sarah fürdas weibliche Geschlecht. Zu Jom Kippur in 1938 sprach der berühmte Rabbiner Leo Baeck9 aus Berlin vor seiner Gemeinde: "Vor Gott beugen wir uns, aber vor den Menschen bleiben wir mit erhobenem Haupt stehen." Die Juden in Czernowitz, jedoch, führten ihr gewöhnliches Leben weiter, in der Hoffnung daß dieser Albtraum bald zu 9 Leo Baeck (1873–1956) war ein Rabbiner und jüdischer Gelehrter; 1933 gründete er als letzter hoher Repräsentant des Judentums in Deutschland die "Reichsvertretung der Deutschen Juden" in Berlin, ein Dachverband der jüdischen Organisationen und israelitischen Landesverbände. 10 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Ende sei – es mußte so sein, das deutsche Volk würde diese Lage doch nicht länger gewähren lassen... Dabei schien aber kein Mensch den Greueltaten ein Ende setzen zu wollen, als ob die Welt sich damit abgefunden hatte, das Naziregime als notwendiges Übel zu akzeptieren; da die meisten der Leute der Meinung waren, daß die Juden durchaus einige Einschränkungen verdient hatten, versuchte niemand, die Deutschen zu behindern. Dann, im November 1938, kam die schreckliche Kristallnacht, gerade zu der Zeit, wo ich meine ersten Laute von mir gab, auf allen Vieren durch die große Wohnung sauste und jeden mit einem fröhlichem Lächeln anstrahlte. Alle waren von der Kristallnacht erschüttert. Auch Erika hörte davon. Bis dahin war sie immer sehr stolz darauf gewesen, bei einem jüdischen Ehepaar in der czernowitzer Stadmitte angestellt zu sein; nun wurde sie auf einmal etwas argwöhnisch. Sie ging ihrer Arbeit weiterhin mit Gründlichkeit und Anstand nach und mochte mich nach wie vor, aber es schwebte nun ein leichtes Unbehagen in der Luft. Nach der Kristallnacht wurde meine Mutter rastlos. Einmal in der Woche fuhr sie nun den ganzen Tag durch kleine Dörfer und Gemeinden in der Umgebung von Czernowitz und kaufte dort Blusen, Nachthemden und Tischdecken mit rumänischer Stickerei, die sie in sorgfältig verpackten kleinen Päckchen an die Schwester meines Vaters nach Los Angeles verschickte. Woche für Woche brachte sie die Päckchen zur Post. Abends sagte sie dann zu meinem Vater: "Mach dir keine Sorgen, bald werden wir bei deiner Schwester in Amerika viel Geld haben. Sie ist eine gescheite Frau, sie wird die Stickereien für gutes Geld verkaufen. Ich habe gehört, daß die Leute in Amerika Handgemachtes sehr schätzen. Irgendwann wird sie uns ein Affidavit zuschicken können, dann verlassen wir diesen Ort für immer und bauen uns ein neues Leben in Amerika auf." Mein Vater hörte zu, ohne etwas dazu zu sagen. Er dachte immer nur an das Versprechen, daß er seinem Vater gegeben hatte, Czernowitz niemals zu verlassen. Meine Eltern liebten es, die Tagesereignisse kurz vor dem Einschlafen zu besprechen; jede Nacht gab ihnen der Gedanke an eine baldige Ausreise nach Amerika den Mut, weiter zu machen und ihr bequemes Leben in Czernowitz aufrecht zuerhalten. 11 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 2 Die Russen kommen! Am 28. Juni 1940, an einem schönen Sommermorgen - ich war etwas über zwei Jahre alt - wachte ich in meinem Bettchen im Wohzimmer auf und wunderte mich darüber, daß rundum alles ganz still war. Das Sonnenlicht erfüllte das ganze Wohnzimmer und alles sah so seltsam klar und deutlich aus, doch gab es kein einziges Geräusch zu hören. Auf der Straße war alles ruhig, das Haus war still. Wo war Erika? Auf einmal war sie aus meinem Leben verschwunden. Ich saß auf meinem Bettchen und horchte in die Stille. Plötzlich traten beide meine Eltern ins Wohnzimmer herein. Sie hatten beide ein breites Lächeln auf dem Gesicht und wirkten fröhlich. Mein Vater nahm mich aus dem Gitterbett heraus und brachte mich in die Küche. Er hatte das Frühstück für mich vorbereitet. Was ging hier vor? Wie kam es, daß meine Eltern beide zu Hause waren und Zeit für mich hatten? Nach dem Frühstück setzten sie sich im Wohnzimmer an den kleinen Tisch mit einigen Zetteln und Büchern und begannen, in einer fremden Sprache zu singen. Ich wollte mitsingen, also brachten sie mir einige der fremdartigen Wörter bei, die so anders klangen als die deutschen Wörter, die ich kannte: "Maguchaya, Kipuchaya….”. Wir saßen alle drei beieinander und sangen fröhlich Lieder auf Russisch. Im Juni 1940, ein außergwöhnlich heißer Sommer in Czernowitz, kamen die Russen an die Macht. Dies war die Folge des berüchtigten MolotovRibbentropp-Abkommens, nach dem Rußland und Deutschland sich über die Zweiteilung Polens geeinigt hatten; demnach erhielt Rußland auch die Macht über die Bukowina und Bessarabien. So wurde Czernowitz zu einem wichtigen Zentrum der russischen Besatzung. Die Juden, die unter der antisemitischen rumänischen Regierungen gelitten hatten, hofften, daß die Russen ihnen besser gesonnen waren. Die ersten Tage liefen friedlich ab; die Leute blieben zu Hause und warteten ab, um zu sehen, was nun geschehen würde. Zu Hause waren wir nun eine dreiköpfige Familie: mein Vater, meine Mutter und ich. Erika, mein treues Kindermädchen, hatte uns einige Wochen zuvor verlassen. Sie kam eines Tages zu meinen Eltern und gab vor, sofort die Stadt verlassen zu müssen, um eine alte Tante zu 12 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 verpflegen, die im Sterben lag. Sie verschwand, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen und ließ nie wieder von sich hören. Für meine Mutter bedeutete dies, daß sie nicht mehr so regelmäßig zur Arbeit gehen könnte, wie sie es sich gewünscht hätte, aber meine Großmutter Sabine würde einspringen und helfen. Als die Russen in Czernowitz einmarschierten, war alles friedlich und gelassen, oder so kam es mir, aus der Sicht einer Zweijährigen, jedenfalls vor. Meine Eltern blieben nun zu Hause und gingen nicht mehr ins Geschäft. Ihr Konkurrent, der berühmte Moscaliuk, war inzwischen verschwunden und sein Geschäft sah verlassen aus. In der kommunistischen Welt war es keine gute Sache, ein erfolgreiches Geschäft zu besitzen; also hatten meine Eltern ihr Geschäft geschlossen, das Schild mit dem Namen "Zeller" abgenommen und begnügten sich damit, das Leben mit mir zu Hause zu genießen. Der Gedanke, daß wir nun zur UdSSR gehörten, hatte die sozialistischen Ideale, die beiden meiner Eltern aus der Zeit im Schomer-Hatzair wohl vertraut waren, und an die mein Vater sogar wirklich glaubte, in ihnen wieder aufgelebt. Sie beschlossen sofort, Russisch zu lernen. Mein Vater ging für einige Stunden aus dem Haus und kehrte mit einem ganzen Stapel von Büchern auf Russisch zurück, mitsamt Lehrmaterial. Täglich saßen wir stundenlang am Wohnzimmertisch, übten Sätze auf Russisch und sangen viele russische Lieder. Auch ich lernte, einige Lieder mit meiner Kindesstimme zu singen und lernte die Sprache; bis heute noch kann ich mich an einige Wörter erinnern. Mein Vater hatte eine hübsche Stimme und er brachte mir bei, die russischen Vokabeln nachzusprechen. Äußerlich schien das Leben ruhig und friedlich abzulaufen, doch unter den Juden gab es zwei Gruppen, denen es äußerst schlecht ging: die Kommunisten, die erst gemeint hatten, daß nun gute Zeiten für sie gekommen waren, jedoch bald als "gefährliche Elemente" nach Sibirien deportiert wurden, und die Bürgerschicht, die als reich und dekadent galt. Welcher der beiden Gruppen gehörten meine Eltern an? Mein Vater glaubte an die kommunistisch-sozialistischen Ideale und wünschte, an dem neuen System teilzunehmen. Während seiner Studienjahre in Wien war er in der sozialistischen Bewegung aktiv gewesen. Meine Mutter, die Pragmatikerin, war der Meinung, daß wir unseren Lebensunterhalt irgendwie verdienen und in der neuen Gesellschaft annehmbar sein mußten. Sie sollte bald eine geniale Idee haben. 13 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Sobald die Russen in Czernowitz einmarschiert waren, wurden sämtliche öffentliche Zeichen des rumänischen Staates durch kommunistische Symbole ersetzt. Auf dem Ringplatz wurde ein Riesenbild Stalins aufgestellt. Eine Säule mit dem russischen Sternzeichen am oberen Ende wurde gebaut und überall erschienen nun Porträtbilder von Lenin, Stalin, Marx und Engels. Meine Eltern betrachteten widerwillig die hastig gemalten Figuren, die allgemein zu sehen waren, und mein Vater begann, einige davon abzuzeichnen. Er machte hervorragende Bleistiftzeichnungen; er hatte schon immer gezeichnet, sowohl für seine Marmorfassaden-Entwürfe, als auch in seiner Freizeit. Meine Mutter begab sich zu den Behörden und schlug ihnen vor, meinen Vater als "chudoznik" (Kunstmaler) einzustellen, um Portraitbilder der großen Anführer, wie Lenin, Stalin und andere, zu malen. Sie hatte eine Mappe mit einigen seiner Zeichnungen mitgebracht und die Leute waren sehr beeindruckt. "Gut," sagten sie, "wir werden ihn für uns arbeiten lassen; wir werden ihm Farben und Papier geben, so viel er braucht." Nun war mein Vater bei den Russen eingestellt und für uns schien soweit alles gut zu gehen. Auf der Arbeit lernte mein Vater andere Leute kennen und bald fanden sie heraus, daß er russische Lieder recht schön singen konnte. Man lud ihn zu den Feiern der wichtigen Anführer ein. Fast ein ganzes Jahr lang sah das Leben für uns gut aus, bis auf die Tatsache, daß meine Mutter nun viel Zeit mit mir zu Hause verbringen mußte, was sie etwas unglücklich machte. Aber in den gegebenen Umständen hatten wir keinen Grund zur Klage. Die Nachrichten über den Krieg in Europa waren äußerst schlecht. Den Russen wurde klar, daß sie sich auf den Krieg vorbereiten und ein kampftüchtiges Heer aufstellen mußten. Sämtliche junge Männer in Czernowitz wurden nach und nach in die Rote Armee rekrutiert. Sogar Dr. Segal, der in einem Krankenhaus arbeitete, wurde einbezogen und mein Vater ebenfalls. Sie fanden sich alle im Übungslager in Rosch10 wieder, ein großes Areal mit Wäldern und offenen Feldern. Der czernowitzer "jüdische Trupp" war wohlbekannt, da viele unter den Soldaten ehemalige Mitglieder der Jugendbewegungen waren, die in der Maccabia aktiv gewesen waren. Sie waren jung, kräftig und sie unterstüzten sich gegenseitig. Mein Vater, Tata, wie ich ihn damals nannte, war von allen beliebt: seine Russischkenntnisse waren 10 Rosch, eine Vorstadt Czernowitzs, auch Czernowitz-Rosch benannt. 14 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 zwar begrenzt, aber er wußte viele wunderschöne Lieder auf Russisch zu singen und seine klare Tenorenstimme rührte manchen bis zu den Tränen. Am meisten wurde er aber für seine körperliche Kraft geschätzt. Obwohl er kein großgewachsener Mensch war, war er außergewöhnlich stark. Meine Mutter hatte sich in ihn verliebt, als sie ihn beim Athletikertraining im Maccabiclub in Czernowitz zugesehen hatte. Auch viele der russischen Soldaten, die ohne tägliche Ration Alkohol nicht auskommen konnten, mochten ihn sehr: mein Vater pflegte nämlich, als ehemaliges Mitglid des Schomer Hatzair, keinen Alkohol zu trinken und er war immer bereit, seine Wodkaration einem ukrainischen oder russischen Freund abzutreten. Einmal in der Woche besuchten meine Mutter und ich meinen Vater. Wir gingen zu Fuß nach Rosch hinunter, am Schillerpark entlang. Jedesmal erwartete uns Tata am unteren Ende des Hangs mit ausgestreckten Armen, um mich aufzunehmen. Ich rannte den ganzen Hügel hinunter, um seine Umarmung entgegen zu nehmen. Er freute sich immer so sehr, mich zu sehen! Meiner Mutter sagte er auf Deutsch: "Sie ist ja dermaßen gewachsen, sie ist so hübsch, sie redet so schön!". Immer hatte mein Vater ein kleines Geschenk für mich dabei, meistens einen geschnitzten Stein in Form eines Tieres, oder einer Puppe. Er ging mit mir mir in den Wald spazieren, warf mich hoch und spielte mit mir während des ganzen Besuches. Wir setzten uns unter die Apfelbäume und verzehrten Butterbrote, die wir von zu Hause mitgebracht hatten, und vom Baum gepflückte Äpfel. Oft erzählte er mir auch eine Geschichte und brachte mir neue russische Lieder bei. Manchmal war meine Mutter etwas verärgert darüber, daß er ihr nicht mehr Zuwendung gab. Sie hätte so gerne die Lage, die Schwierigkeiten, die Sorgen über die Zukunft mit ihm besprochen; er aber sagte immer wieder nur: "Frieda, wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt, laß uns den heutigen Tag genießen". Nach jedem Besuch in Rosch kehrten wir leicht traurig nach Hause. Ich war traurig, weil ich mich nicht von Tata verabschieden wollte; meine Mutter war traurig, weil sie ihre Sorgen nicht mit meinem Vater teilen konnte. Manchmal gingen wir direkt nach Hause in die Franzensgasse, wo jetzt nur noch wir beide wohnten. Die Wohnung wirkte jetzt völlig leer und wir benutzten nicht mehr das Schlafzimmer. Stattdessen schliefen wir beide zusammen im Wohnzimmer neben dem Radio. Andere Male gingen wir zu meiner Großmutter, wo wir immer leckeres Essen serviert bekamen. Damals war mir nicht bewußt, daß es eigentlich eine sehr ärmliche Kost war, wie süßes Bohnenpüree als Brotaufstrich auf einer Scheibe Graubrot. Für meinen Geschmack war es köstlich. 15 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Ich liebte es, meine Großmutter zu besuchen. Meistens schlief mein Großvater in seinem großen Bett und beachtete uns kaum. Meine Mutter und meine Großmutter hatten immer viel zu besprechen und ich durfte währenddessen auf dem riesengroßen Hof spielen, wo Hühner und Gänse frei herumliefen. Dort gab es auch Kinder, die keine Juden waren; sie liefen barfuß und spielten mit großen Rädern, die sie vor sich hin schoben. Sie waren laut und sprachen eine fremde Sprache, die ich zu Hause nie gehört hatte: es war Rumänisch. Aber es machte Spaß, ihnen beim Spielen zuzuschauen. Meine Großmutter - ich nannte sie Baba - hatte ein winziges Häuschen mit zwei Zimmern, daß Teil einer Reihe von Kleinhäusern war, die um einen großen Hof angelegt waren. Diese Häuserreihe lag am Stadtrand, oberhalb eines breiten und grünen Tals, das von den Zügen durchquert wurde. Die Bewohner gingen mehrmals am Tag an den Nachbarhäusern vorbei, so daß jeder genau wußte, was bei jedem vorging. Für mich war es ein Paradies – so lebendig und ganz anders, als unsere saubere und anständige Wohnung in der Stadt. Die Leute teilten sich alle eine Latrine im Offenen, die aus zwei in der Erde gegrabenen Löchern bestand und mit einem Holzhäuschen überbaut war. Ich hatte es nicht nötig, dorthin zu gehen, da es bei meiner Großmutter im Hause ein Töpfchen für mich gab. Während unserer Besuche bei Baba saß meine Mutter stundenlang mit ihr am Küchentisch und die Beiden unterhielten sich mit gedeckter Stimme. Jedesmal wenn wir dorthin gingen, brachte meine Mutter ein Paket von zu Hause mit und Baba steckte es in einen ihrer kleinen Schränke. Nach und nach füllten sich die leeren Schränke mit den Sachen, die wir aus unserer Wohnung mitgebracht hatten: Bettwäsche, Tischdecken, Silberbesteck, teure Kleider, Pelze, usw. Ich wußte nicht, warum meine Mutter dies tat, aber ich freute mich immer, dorthin zu gehen und liebte es, bei meiner Großmutter zu bleiben, während meine Mutter einige Geschäfte erledigte. Die Tage verstrichen langsam, die Gesichter der Erwachsenen wurden immer trauriger, während sie sich die Nachrichten im Radio anhörten und sich anschließend gegenseitig mitteilten, was sie dort erfahren hatten. Ich, dagegen, genoß meine Bewegungsfreiheit bei Baba und genoß unsere Besuche in Rosch. 16 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 3 Die Rumänen sind wieder da und die Nazis sind mit dabei! Eine Reihe von schreckenerregenden Explosionen und ein großer Lärm riß meine Mutter und mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Alle paar Sekunden hörte man ein Pfeifen oder eine Explosion, dann ging das Licht in der Wohnung aus. Wir hatten einige Kerzen, die meine Mutter mit zitternder Hand anzündete, während ich ganz stille hielt und es nicht einmal wagte, Atemgeräusche von mir zu geben. Ich war nun schon drei Jahre alt und ich verstand sehr wohl, daß etwas Schlimmes vorging. Plötzlich klopfte jemand laut an der Eingangstür. Unsere Nachbarin, Frau Segal, stand zitternd vor uns, mit Tränen im Gesicht: "Die Deutschen sind in Russland einmarchiert. Unsere Männer werden umkommen. Was sollen wir tun?" Inzwischen kam ein anderer Nachbar die Treppe heruntergelaufen und sagte: "Sperren Sie jetzt Ihre Wohnung ab und laßt uns alle so schnell wie möglich über die Straße in den Schutzkeller rennen! Die Bomben fallen überall...". Meine Mutter sagte kein Wort. Sie nahm mich auf den Arm, schloß die Wohnung ab und wir eilten die Treppe hinunter. Wir liefen über die Straße, immer weiter rennend, und sahen viele andere Menschen, die in die gleiche Richtung rannten. Es war ein frischer, nicht wirklich kalter Junimorgen; deswegen hatte meine Mutter weder Pullover, noch Decken mitgenommen, aber die Anderen trugen ganze Bündel davon mit. Ich dachte mir: "Warum haben alle so sehr Angst? Was sind Bomben? Ich muß unbedingt sehen, was eine Bombe ist!". Ich blickte aufwärts in den Himmel, konnte aber nur flackernde Lichter und Baumäste wahrnehmen, die auf uns hinunterfielen. Jahrelang habe ich in der Vorstellung gelebt, daß eine Bombe ein großer Baum ist, der aus dem Himmel auf die Menschen hinunterfällt. Es war die letzte Woche im Juni des Jahres 1941, als die Deutschen in die Sowjetunion einmarschierten; die Russen mußten aus Czernowitz fliehen. Die russischen Heereseinheiten, die in Rosch stationiert waren, mitsamt meinem Vater, Dr. Segal und vielen anderen jungen czernowitzer Juden, wurden über Nacht evakuiert. Das rumänische und das deutsche Heer übernahmen die Macht über die Bukowina, und damit auch über Czernowitz. Während der Machtübernahme gab es einige Tage lang Bombenangriffe, doch die Machtübernahme war rasch und erschreckend. 17 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Nachdem die Lage sich etwas beruhigt hatte, begaben meine Mutter und ich nach Rosch, um zu versuchen, herauszufinden, was mit meinem Vater geschehen war; die Russen jedoch waren fort und nun waren dort rumänische Soldaten stationiert. Die roten Fahnen waren durch rumänische und deutsche Fahnen ersetzt worden. Es gab dort niemanden, den man ansprechen konnte und so waren wir auf Gerüchte angewiesen. Meine Mutter fragte jeden, den sie kannte, doch konnte sie nichts herausfinden. Im Laufe des kommenden Monates pendelten wir zwischen unserer Wohnung und Babas Haus hin und her. Ich verbrachte mehr und mehr Zeit bei ihr, während meine Mutter versuchte, Auskunft über meinen Vater zu erhalten. Schließlich kam eines Tages ein jüdischer Soldat, der der Evakuierung nach Rußland entgangen war, und berichtete der jüdischen Gemeinde, daß alle Juden, die von der roten Armee rekrutiert worden waren, sich in einem Zug befunden hatten, der einen schweren Bombenangriff der Deutschen erlitten hatte und daß alle Männer dabei umgekommen seien. Er sagte, er sei der einzige Überlebende aus dem "jüdischen Regiment". Meine Mutter kam zurück zu Baba mit der Nachricht, sagte aber sofort: "Ich glaube es nicht, daß Willy tot ist. Ich bin sicher, daß er irgendwie entkommen ist und wir müssen einen Weg finden, mit ihm Kontakt aufzunehmen". Zu dieser Zeit hatte die jüdische Gemeinde in Czernowitz bereits viele ihrer Mitglieder verloren. Mindesten 10.000 Juden waren durch die Sowjets nach Sibirien deportiert worden. Andere waren umgebracht worden oder waren geflüchtet. Einige Tausend junge Leute waren in die Rote Armee zwangsrekrutiert worden. In den ersten Tagen nach ihrer Invasion im Juni 1941 ermordeten die Rumänen und die Nazis ungefähr 1000 Juden. Ukrainische Randalierer trieben sich in der Stadt herum und bestahlen und plünderten zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohnungen. Die Juden bemühten sich, zu Hause zu bleiben und sich so still wie möglich zu verhalten. Ich blieb gerne bei meiner Großmutter; dort verbrachte ich die meiste Zeit des Tages auf dem großen Hof, wo ich mit den anderen Kindern spielte. Meine Baba hatte immer etwas Leckeres für mich zu essen da, obwohl damals schon vielen jüdische Familien an Nahrungsmangel litten. Sie hatte viele Freunde unter den ukrainischen Dorfbewohnern, sie zu ihr nach Hause kamen und ihr etwas Butter, Käse und Brot verkauften, so daß wir recht gut zurecht kamen. 18 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Gegen Ende des Sommers wohnten meine Mutter und ich bereits ganz bei meiner Großmutter und wir besuchten nicht einmal mehr unsere Wohnung. Später erfuhr ich, daß die Wohnung von dem rumänischen Heer beschlagnahmt worden war. Dann, eines morgens, am 11. Oktober, kamen Juden in großen Scharen in den großen Hof hinter dem Haus meiner Großmutter hineingeströmt – Frauen, Männer, Kinder und Greise. Das Wohnviertel am Stadtrand wurde nun zum jüdischen Getto. Am frühen Morgen dieses Oktobertages wurden die Vorstehende der jüdischen Gemeinde in das Büro des rumänischen Militärgouvernörs der Stadt, General Vasily Ionescu, vorgeladen. Dort gab der Gouvernör Anweisungen, ein Getto im nördlichen, niederen Teil der Stadt zu gründen, wo bereits an die 10.000 Juden (und auch viele Nicht-Juden) aus besonders niedrigen Verhältnissen lebten. Sämtliche Bewohner Czernowitz jüdischer Konfession wurden aufgefordert, sich sofort dorthin zu begeben, mit nur den wenigen Habseligkeiten, die sie selber tragen konnten. Ab Tagesende um 18:00 Uhr würde jeder Jude, der sich außerhalb des Gettos befände, auf der Stelle hingerichtet werden. Während des ganzen Tages schlossen sich 40.000 Juden aus der ganzen Stadt den 10.000 an, die sich bereits dort befanden. Um punkt 18:00 Uhr umzingelten die rumänischen Soldaten das Getto, bauten einen provisorischen Holzzaun um das ganze Getto auf und fügten einen Stachelzaun oben hinzu. Bewaffnete Wachsoldaten wurden vor den Gettoeingang aufgestellt. Babas Häuschen wurde zu einem Zufluchtsort für viele Frauen. Einige unter ihnen waren Verwandte, Kusinen und Tanten, während Andere einfach nur Nachbarinnen oder Fremde waren. Neben dem großen Bett standen weitere Betten und Matrazen und das ganze Haus erschien mir wie ein einziger großer Teppich von Frauen. Mein Großvater Lejzer den ich Djadja nannte - wurde gebeten, mit den anderen Männern im Schuppen zu schlafen. Die Frauen waren hübsch gekleidet in das Getto gekommen, mit Koffern und Taschen in den Händen. Ihre Gesichter sahen traurig aus und sie sprachen kaum. Einige der Kusinen meiner Mutter, an die ich mich noch erinnern konnte und die früher sonst immer so nett zu mir gewesen waren, nahmen mich jetzt gar nicht wahr. Genau genommen achtete kein Mensch auf mich, außer meiner Großmutter. Nicht einmal meine Mutter kümmerte sich um mich. So kam es, daß niemand mir Vorschriften machte. Ich genoß es, unghindert herumzurennen, zu spielen, zu singen, an dem Gettozaun zu stehen und die rumänischen Soldaten beim Marsch zwischen den Spalten des Holzzaunes zu beobachten. Bald lernte ich 19 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 einige ihrer Lieder und stand dort, mit den Soldaten mitsingend. Einige von ihnen wurden auf mich aufmerksam und lächelten mir zu. Ich liebte es, unter den anderen Kindern dort zu stehen und mich so aufzuspielen, als ob ich ein Anführer sei, da ich ja ihre Lieder kannte. Von Zeit zu Zeit bemerkte mich meine Großmutter und zerrte mich vom Zaun weg: "Verstehst du denn nicht, wie gefährlich das ist? Die Soldaten dürfen dich nicht sehen! Es ist nicht erlaubt, neben dem Zaun zu stehen." Ich schaute dann auf sie auf und sagte: "Aber Baba, die sind doch so nett und sie lächeln mich an." Baba schaute mich jedes mal händeringend an, dann säufzte sie tief: "Oj wej!" und ließ mich wieder gehen. Während des Tages, wenn die meisten der Frauen sich nach draußen begeben hatten, um etwas frische Luft zu atmen, pflegte ich von einer Matratze zur Anderen herum zu hüpfen. In meiner Wahrnehmung war die schlechte Lage durch die Verhaltensweise der Erwachsenen bedingt; ich wünschte nichts Anderes, als die Freude am Zusammensein zu genießen, sowie die wundersame Tatsache, daß all diese Leute nun in Babas winzigem Häuschen übernachteten, daß sich gestreckt und dermaßen verändert hatte. Ich empfand Mitleid für viele dieser eleganten Damen, die jetzt völlig grau, mitgenommen und erschrocken aussahen. Sie hatten das Meiste ihrer schönen Kleider gegen Nahrungsmittel verkauft und wirkten jetzt schäbbig und ungepflegt. Ich hätte gerne mit ihnen geredet, um sie zum Lachen zu bringen und zu erheitern, aber wenn ich mich einer von ihnen annäherte und ihr trauriges und verschlossenes Gesicht erblickte, konnte ich kein Wort hervorbringen. Außer den rumänischen und deutschen Soldaten, die auf den Straßen Parade hielten, sahen wir auch zahlreiche Juden, mit Bündeln und Koffern in der Hand, die stumm in Richtung des Bahnhofs, der sich ganz in der Nähe des Gettos befand, schritten. Sie liefen mit hängendem Haupt, ohne um sich herum zu schauen und fröstelten in der kühlen Oktoberluft. Ihr Anblick machte mir Angst und ich lief gewöhnlich zu Baba und sagte ihr: "Wir werden immer hier in deinem Häuschen bleiben, nicht war?". Sie pflegte mich zu umarmen und zu hätscheln, ohne dabei ein Wort zu sagen. Täglich sammelten Menschenscharen ihre Habseligkeiten zusammen, verließen das Getto und begaben sich zum Bahnhof. Sie trugen alle einen gelben Davidstern auf ihren Kleidern. Oft sah ich, wie meine Großmutter solche Davidsterne nähte und sie an die Leute verteilte. Sie schnitt jedesmal zwei Dreiecke aus Karton, bedeckte jedes Dreieck mit gelbem Stoff und nähte die zwei Stücke zusammen. Es lagen immer einige Stück dieses gelben Stoffes herum, doch sie erlaubte mir nicht, es anzurühren. 20 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Einige der älteren Männer begannen, Sterne aus Holzstücken herzustellen, die sie dann mit gelber Farbe bemalten. Manche erlaubten mir, die Holzstücke zu bemalen und ich war froh, mit den älteren Männern zusammen zu arbeiten. Eines Morgens sah ich meine Mutter einen gelben Davidstern tragen. Sie wirkte ernstvoll und blickte mich nicht an. Sie und Baba sahen beide so aus, als ob sie die ganze Nacht hindurch nicht geschlafen hätten. Meine Mutter trug ihren warmen Mantel, der innen mit Pelz gefüttert war und von außen her sehr schlicht aussah. Sie trug einen warmen Hut auf dem Kopf und hatte einen Schal um den Hut und ihre Schultern gewickelt. Sie trug braune Stiefel mit schweren Sohlen, die alt aussahen, und Wollhandschuhe. Sie hatte einen kleinen Koffer und einen Rucksack mit Kleidern, die sie auf einen großen offenen Wagen legte, der an einem Pferd gespannt war und auf dem Hof stand. Viele andere Leute legten ihr Gepäck auf den Wagen. Alle waren sehr schweigsam. Sie blickten einander besorgt an und sprachen kein Wort. Dann stieg meine Mutter auf den Wagen und setzte sich auf das Gepäck, und einige andere Frauen taten das Gleiche. Der Kutscher trieb das Pferd an und der Wagen kam langsam in Bewegung. Ich stand daneben, meine Mutter anblickend und eine Erklärung abwartend. Meine Mutter wandte sich zu mir und sagte mit einem großen Lächeln: "Littika, ich verreise für kurze Zeit, um deinen Vater zu treffen. Ich werde bald zurück sein. Bleib bei Baba und sei schön brav". Sie stieg weder aus dem Wagen, noch umarmte sie mich. Sie winkte mir einfach zu und ich winkte zurück. Baba und folgten mit den Augen dem Wagen nach, der das Getto verließ und in der Ferne verschwand. Baba wandte sich zu mir und sagte: "Laß uns reingehen; wir machen uns eine Tasse Tee mit etwas Marmeladenbrot." Ich folgte ihr schweigend. All die Juden, die sich an diesem Tag zum Bahnhof begaben, wurden nach Transnistrien geschickt. Transnistrien war der Name, den die Rumänen einer Gegend um Moghilev herum, in der Ukraine, gegeben hatten, eine Gegend, die zwischen dem Dniester-Fluß im Westen, dem Bug-Fluß im Osten und dem Schwarzen Meer im Süden entlangstreckte. Dort gabe es zahlreiche kleine Dörfer, von ukrainischen Bauern, darunter auch eine beträchtliche Menge von jüdischen Familien, bewohnt; vor dem Krieg lebten dort 300.000 Juden; nach dem Krieg überlebten nur 485 – alle Anderen waren im Krieg ermordet worden. Die Juden aus Czernowitz und aus der ganzen Bukowina – und später auch aus Bessarabien und aus Moldawien – wurden nach Transnistrien deportiert, wo sie zu schwerer Körperarbeit für die örtlichen Gemeinden gezwungen 21 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 wurden. Die Deportationen fanden zwischen Herbst 1941 und Herbst 1942 statt. Die Rumänen schoben die Juden ohne jegliche vorausgehende Planung ab; die Leute mußten in Zeiten von Hunger und Unterkunftsnot, dem kalten Wetter ausgesetzt, für sich selbst sorgen. Viele verhungerten, starben an Typhus oder an den Verhältnissen in den Arbeitslagern. Meine Mutter wurde in einem der ersten Tranporte nach Transnistrien deportiert Nachdem meine Mutter uns verlassen hatte, wurde das Getto immer kleiner. Manche gingen zu Fuß, mit Taschen in den Händen, zum Bahnhof, von wo aus die Aussiedlung organisiert wurde. Andere erhielten eine Genehmigung, nach Hause zurückzukehren. Der Bürgermeister von Czernowitz, Dr. Popovici, hatte es nämlich fertiggebracht, die Rumänen dazu zu überreden, 20.000 Juden zu erlauben, in der Stadt zu bleiben und nicht ausgesiedelt zu werden. Es waren Leute,die für die Kriegsleistung erforderlich waren, wie Ärzte, Elektriker und weitere wichtige Fachleute. Einige Personen über sechzig und schwangere Frauen durften ebenfalls bleiben. Unter den Leuten, die eine Bleibegenehmigung erhalten hatten, befand sich auch mein Onkel Jossel. Er war Elektriker und arbeitete für die Stadtverwaltung. In der Familie galt er zwar als das am wenigsten begabte Kind meiner Baba – Srul, alias Tarzan, der älteste Sohn, der in Palästina lebte, hatte in Wien Medizin studiert und war der Star der Familie; meine Mutter galt als hochintelligente Tochter und mein Onkel Bjumin (Benjamin), den ich nie kennen gelernt hatte, galt als der Fleißigste von allen. Jossel, dagegen, war ein schweigsamer Mensch, der immerfort lächelte und seinem Vater, Lejser, ähnlich war, mehr als alle anderen Geschwister. Er besaß nicht viel mehr als eine Grundschulausbildung und ich habe ihn nie lesen oder schreiben gesehen. Baba, meine Großmutter, dagegen, war eine echte Autodidaktin: obwohl sie schon in der 2. Klasse die Schule verlassen hatte, konnte sie fließend Deutsch und Jiddisch lesen. Ich sah sie oft die Zeitung, ein Buch oder sogar ein Gebetsbuch auf Hebräisch lesen. Sie hatte alles Mögliche getan, um ihren Kindern die beste Erziehung zu verschaffen; doch Jossel hatte große Schwierigkeiten auf der Schule, war aber technisch sehr begabt. So erlernte er seinen Beruf als Jüngling. Er wurde zu einem hervorragenden Elektriker und erhielt eine Stelle beim czernowitzer Bürgeramt. Auch Rose Holzhaker, die Schwester meiner Großmutter, und ihre Familie, erhielten eine Bleibegenehmigung, was für uns ein gewisser Trost war. Sie galten als eine wohlhabende Familie aus der Stadtmitte. Natan Holzaker, Roses Ehemann, war ebenfalls Elektriker, der zusammen mit Jossel arbeitete. Zwei der drei Söhne von Rose und Natan, namens Turi und Herbert, lebten bei ihren Eltern zu Hause. 22 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Nachdem all die fremden Menschen das Getto verlassen hatten, blieben meine Großeltern in ihrem kleinen Haus. Jossel hatte eine Bleibegenehmigung für seine Eltern - meine Großeltern - ergattern können, und sie waren momentan in Sicherheit. Er war nun der einzige Sohn, der noch in Czernowitz war und es gelang ihm, seine Eltern vor der schrecklichen Aussiedlung zu schützen. Jossel besuchte seine Eltern jeden Tag; dabei spielte er mit mir, erzählte mir Geschichten und Witze. Er brachte mir auch immer ein paar Süßigkeiten mit, oder sogar ein Stück Kuchen, was für mich die Freude des Tages bedeutete. Dann sagte er eines Tages zu Baba: "Vielleicht sollte ich Littika zu mir nach Hause nehmen. Sie ist ja sowieso als meine Tochter angemeldet. Bei uns zu Hause ist es warm und wir haben ein Badezimmer mit fließendem warmen Wasser. Bald wird der Winter noch viel kälter werden. Für die Kleine wird es einfacher und besser sein, und auch dir wird es das Leben erleichtern." Ich nahm eine Träne im Augenwinkel meiner Großmutter wahr, doch nach einigen Minuten gab sie ihre Zustimmung und packte meine wenigen Habseligkeiten ein: ein paar Kleider, aus denen ich schon fast völlig herausgewachsen war, zwei paar Schuhe, ein paar Wollpullover und einen warmen Mantel. Ich ging auf sie zu, umarmte sie und saß eine Weile auf ihrem Schoß. Ich flüsterte ihr zu: "Wan wird meine Mammi zurück kommen?". Sie gab mir keine direkte Antwort und sagte nur: "Deine Mutter wird dich von Jossels Wohnung abholen." Das klang für mich sehr vielversprechend und ich war bereit, mich auf den Weg zu machen. Ich ging erfreut mit Jossel weg. Ich liebte meinen Onkel und ich wußte, daß ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Als wir bei ihm zu Hause, eine große und gut geheizte Wohnung in der Stadtmitte, ankamen, stand das Wohnzimmer voll mit Leuten. Es befanden sich dort meine Tante Regine, die nun Jossels Ehefrau war - seine Kusine und die meiner Mutter (ihr Vater war einer der zahlreichen Brüder meines Großvaters Lejser). Die beiden Vetter hatten mit dem Zuspruch der ganzen Familie geheiratet, da beide bereits fünfundzwanzig Jahre alt waren und noch keinen Partner gefunden hatten, wobei sie gute Freunde zu sein schienen, obwohl nicht wirklich ineinander verliebt. In dem großräumigen Wohnzimmer erkannte ich Reginas beide Schwestern wieder: Nora, die noch älter als Regina, aber unverheiratet, war und Mina, die jüngste und die hübscheste der drei Schwestern. Außerdem saßen dort auch noch drei junge Männer auf dem Sofa, äußerst entspannt und gesellig. Nachdem Jossel die Tür mit zwei Schlüsseln aufgeschlossen hatte, machte jemand uns von innen die Tür auf; wir traten in die Wohnung 23 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 hinein und alle grüßten uns; Regina wirkte überrascht und sagte: "Oh, die Kleine bleibt jetzt bei uns. Ihre Mutter würde sich sicher sehr freuen. Endlich können wir einmal etwas für sie tun." Ihre Worte klangen wohlwollend, doch als ich ihr Gesicht erblickte, nahm ich einen merkwürdigen Ausdruck wahr. Ich sagte mir in meinem Inneren, daß ich mir ihre Worte merken und bei Gelegenheit Baba fragen müßte, warum Reginas Gesichtsausdruck dermaßen unfreundlich wirkte. Jossel führte mich an den Tisch und gab mir etwas zu essen. Er legte meine Sachen ab und bereite mir ein Bett in dem gleichen Zimmer vor, in dem Mina und Nora schliefen. Kein Mensch außer ihm schien sich Gedanken um mich zu machen, aber ich war zufrieden, weil das Haus voller Gelächter und Gespräche war, ganz anders als in dem stillen Haus meiner Großmutter. Regina, Nora und Mina, die Kusinen meiner Mutter, kannte ich aus Familientreffen und aus dem Getto. Sie hatten nie besonders viel Interesse für mich gehabt, so daß ich meinem Onkel Jossel zugetan war. Am nächsten Morgen wachte ich auf und sah meine beiden Tanten Nora und Mina in ihren Betten schlafen. Leise zog ich mein Kleid und meine Schuhe an und ging ins Wohnzimmer. Ich war damals noch nicht im Stande, meine Schnürsenkel zu zuschnüren und ließ sie lose hängen. Die drei Männer vom vorigen Abend saßen nun am Eßtisch, tranken Tee und unterhielten sich untereinander in einer fremden Sprache. Später erfuhr ich, daß sie Polnisch sprachen. Es waren Juden, die aus de warschauer Getto geflüchtet waren und die über Czernowitz auf dem Weg nach Palästina waren. Die jüdische Gemeinde in Czernowitz half ihnen dabei, wobei sie ein großes Risiko einging, da ertappte Flüchtlinge auf der Stelle umgebracht wurden und die Familien, die ihnen Unterschlupf gewährt hatten, wurden bestraft oder deportiert. Ich wußte nicht, wer diese Menschen waren und warum sie sich bei meinem Onkel aufhielten. Ich suchte nach Jossel, aber er war bereits zur Arbeit gegangen. Nach einer Weile sprach mich einer der Männer in einem Deutsch an, das eher wie Jiddisch klang: "Wie ist dein Name, schejne Mejdale11?" Ich sagte, ich heiße Littika und daß ich dreieinhalb Jahre alt sei. Der Mann griff mich auf, setzte mich auf seinen Schoß und sagte: "Ich habe eine Schwester, die etwas älter ist als du. Ich hab ihr beigebracht, ihre Schnürsenkel zu zubinden. Soll ich es dir auch beibrigen?" Ich war sehr erfreut darüber, weil ich schon so oft versucht hatte, meine Schuhe selber zu zuschnüren. Dann fügte er noch hinzu: 11 "Schönes Mädchen" auf Jiddisch. 24 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 "Meine Schwester kann auch bis zehn zählen; kannst du bis zehn zählen?" Dann begann er mit mir zu zählen und wir hatten große Spaß. Wir zählten natürlich auf Deutsch, wobei seine Aussprache etwas komisch klang. Ich mußte besonders lachen, wenn er "finf" sagte. Schließlich kam Regina ins Wohnzimmer hinein und sagte: "Oh, du bist ja schon auf! Hast du Hunger? Was gibt dir deine Mutter denn gewöhnlich morgens zu essen? Du weißt, wir haben jetzt schwierige Zeiten und wir haben nur Schwarzbrot und Marmelade, das ist es, was ich dir geben werde." Ich sagte nichts, da mir nicht klar war, was für eine Antwort sie von mir erwartete. Ich blieb still; dann fingen die jungen Männer an, mir Fragen zu stellen und Witze zu erzählen, und ich freute mich über ihre Gesellschaft. Plötzlich klingelte es an der Tür; ich war fest davon überzeugt, daß es meine Mutter war. Ich rannte zur Tür und versuchte, sie zu öffnen, was mir natürlich nicht geling. Ehe ich es versehen konnte, stand Regina über mir und schlug mich vor dem Kopf und ins Gesicht, während sie mich ins Wohnzimmer zerrte. "Du sollst nie, aber niemals an die Tür gehen, verstanden?" Ich weinte bitterlich und rannte auf mein Bett zu. Meine zwei Tanten waren sogleich aus ihren Betten gesprungen, als sie die Türklingel gehört hatten und standen dort, kreidebleich und erschrocken, in ihren Nachthemden. Die drei Männer, indessen, waren verschwunden; mir fiel nur auf, daß dort, wo sich vorhin noch eine Tür zu einem weiteren geräumigen Zimmer befunden hatte, nun eine Holzwand und ein großer Schrank standen. Schließlich öffnete Regina die Eingangstür einen kleinen Spalt, um zu sehen, um wen es sich handelte: es war ein Nachbar, der nur kurz etwas sagte und wieder fort ging. Regina zerrte mich zurück ins Wohnzimmer und sprach mich laut an: "Du darfst auf keinen Fall an die Tür gehen. Ist dir das klar? Niemand darf in dieses Haus hinein und du darfst mit niemandem reden, egal worüber. Verstehst du das? Du hast jetzt ein paar Schläge von mir bekommen, weil ich so wütend auf dich war; aber wenn du mir nicht gehorchst, werde ich dir eine noch viel größere Tracht Prügel verpassen." Ich konnte gar nicht mehr aufhören, zu schluchzen. Bis dahin hatte mich noch nie jemand geschlagen oder so angesprochen, wie Regina es getan hatte. Die drei Männer waren aus ihrem Versteck zurückgekehrt und saßen im Wohnzimmer. Ich jedoch kehrte zu meinem Bett zurück und spielte eine ganze Weile alleine. Nachdem meine Augen endlich wieder trocken geworden waren und sich mein Atem beruhigt hatte, betrat ich das Wohnzimmer und kündigte allen an: "Meine Mutter wird mich abholen und ich warte auf sie." Alle blickten mich lächelnd an und ich 25 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 hörte, wie Regina einem der Männer zuflüsterte: "Ihre Mutter ist in Transnistrien." Am Abend kam endlich mein Onkel Jossel nach Hause. Für mich war es, als ob mein Retter endlich angekommen sei. Er hatte mir ein großes Stück Pekannuß-Kuchen mitgebracht, das köstlich schmeckte. Eigentlich hatte ich keinen dermaßen großen Appetit, aber ich aß das ganze Stück auf, weil ich meinem Onkel eine Freude machen wollte. Bevor er mich ins Bett brachte, fragte ich ihn: "Wann glaubst du, daß meine Mutter mich abholen kommt?" Er blickte mich an und sagte: "Warum, hast du es nicht gut bei uns?"; ich sagte nur: "Ich vermisse meine Mutter" und schlief ein. Es verstrichen einige Tage; ich verbrachte weiterhin die meiste Zeit zusammen mit den polnischen Flüchtligen. Dann kam eines Tages meine Großmutter, um mich zu besuchen. Ich war so glücklich! Ich umarmte sie in einem fort und klammerte mich an sie. Schließlich sagte sie: "Du sollst schön brav sein und auf deine Tanten hören. Dieses Haus ist gut für dich, hier hast du alles, was du brauchst."; ich aber wollte nur wissen, wann meine Mutter mich abholen und nach Hause nehmen würde. Eines Tages beschloß meine Tante Nora, daß ich schmutzig sei und eine gründliche Wäsche nötig habe. "Schmutzig" war das Wort, das sie benutzte und ich war zutiefst gekränkt, weil ich verstand, daß es etwas schlechtes bedeutete. Sie streifte meine Kleider ab, steckte mich in eine große, mit Wasser gefüllte Wanne und begann, an mir herum zu rubbeln. Das Wasser war kalt, sie tat mir weh und ich fing an zu weinen. Sie geriet außer sich vor Wut und befahl mir, sofort mit dem Weinen aufzuhören, sonst würde sie mich ordentlich prügeln und dann hätte ich einen guten Grund, zu weinen. Sie trocknete mich mit einem rauhen Badetuch ab und sagte: "Jetzt wollen wir uns mal um dein verfilztes Haar kümmern." Sie brachte einen kleinen Eimer Wasser und stellte sich hinter mir; sie klemmte meinen Körper zwischen ihre beiden kräftigen Beine und drückte mir den Kopf in den Eimer; dabei biegte sie mich um und scheuerte meinen Kopf mit voller Wucht. Ich erstarrte völlig, mein Körper war von der Kälte und von ihrem Griff wie versteinert; ich hielt meinen Atem an. Schließlich endete die Qual. Sie half mir in saubere Kleider hinein und bürstete mein Haar mit einer großen Bürste, mit heftigen Bewegungen; danach führte sie mich voller Stolz ins Wohnzimmer und sagte: "Jetzt haben wir ein sauberes Mädchen hier. Es mußte sich ja mal jemand um sie kümmern"; sie setzte mich auf eins der Sofas, neben einem der drei Polen. Ich konnte ihm ansehen, daß ich ihm leid tat. Er nahm mich in die Arme, setzte mich auf seinen Schoß und sagte zu mir: "Weißt du was, hübsches Mädel, ich hab ein Geschenk für 26 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 dich." Er holte eine Kästchen hervor, in dem ein paar kleine Ohrringe lagen, die mit drei winzigen blauen Steinen versetzt waren. "Das wird dir Glück bringen." Mit sanften Bewegungen steckte er mir die Ohrringe in die Ohrlöcher – bei uns war es Tradition, kleinen Mädchen kurz nach der Geburt Löcher in die Ohren zu stechen – und ich war wieder glücklich. Ich habe diese reizenden Ohrringe lange Zeit nicht abgenommen, bis im Alter von sechs Jahren, als mir einer von ihnen verloren ging. Als ich eines Morgens aufwachte, hatten die drei Männer das Haus verlassen und es saßen nun zwei andere Männer dort. Sie wirkten traurig, verängstigt und nahmen mich nicht einmal wahr. Nach Ende der täglichen Sperrstunden - Juden durften sich nur für einige Stunden am Tag auf den Straßen Czernowitzs bewegen -, kam meine Großmutter zu Besuch. Dieses Mal weinte ich bitterlich und bat sie, mich wieder mitzunehmen: "Ich möchte nicht bei meinen Tanten hier leben. Ich möchte mit dir und mit Großvater zusammen sein". Sie erklärte mir, daß ihr Haus im Winter kalt sei und daß ich mich sehr langweilen werde, in der Gesellschaft zwei alter Menschen, die nichts haben und bei denen das Essen nicht besonders gut ist. "Wer wird dir abends leckeren Kuchen mitbringen? Und wer wird den ganzen Tag mit dir spielen?" Ich weinte und schluchzte immer fort weiter und sagte: "Das macht mir nichts aus, ich möchte bei dir sein." Baba konnte es nicht ertragen, mich in diesem Zustand zu sehen und schließlich nahm sie mich mit in ihr Haus. Den ganzen Weg entlang versuchte sie mir klar zu machen, welch ein Glück ich habe, daß Onkel Jossel und Tante Regina für mich wie Eltern waren. Ich hörte nur zu und sagte nichts. 27 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 4 Das Leben bei Baba Das Leben in dem kleinen Haus meiner Großeltern im Getto, das inzwischen menschenleer geworden war, war ruhig und ohne besondere Eeignisse. Es war ein kalter und bitterer Winter und wir verließen nur selten das Haus. Die meiste Zeit hockte ich neben dem Heizofen, in Decken zusammengerollt. Draußen stapelte sich der Schnee bis zur Tür hinauf, die Fensterscheiben waren morgens zugefroren und sahen wie schillernde Kristalle in verschlungenen Formen und wie aus Eis geschnitzte Figuren aus. Stundenlang betrachtete ich diese Formen und malte mir dabei Menschen, Tiere und Bäume aus. Kleider, die nach der Wäsche draußen zum trocknen aufgehängt worden waren, wurden über Nacht zu Eiszapfen und mußten erst neben dem Ofen wieder aufgetaut werden. Ich hörte die Leute sagen, daß dies der kälteste Winter sei, den sie je erlebt hatten. Von Zeit zu Zeit verließ meine Großmutter das Haus während der Stunden, in denen es keine Ausgangssperre gab, um ein paar Einkäufe zu machen, oder ihre Schwester Rosa oder ihren Sohn Jossel zu besuchen. Es kam nie jemand uns besuchen; ich wollte immer mit ihr gehen und nicht alleine mit meinem Großvater bleiben, aber es war zu kalt; meine guten Schuhe waren mir allmählig zu klein geworden und mein Wintermantel war nun zu kurz; so blieb mir nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Ein oder zwei mal in der Woche pflegte Maria, die früher, als die Zeiten noch besser waren, einmal bei meiner Großmutter als Magd gearbeitet hatte, uns einen Besuch abzustatten. Sie brachte jedesmal etwas Arbeit für meine Großmutter mit, die sie von verschiedenen Leuten aufgesammelt hatte, wie alte, flickbedürftige Kleidung, Sachen, die aus Altstoff geschneidert werden sollten oder Kleider, die gekürzt oder verlängert werden mußten. In Gegenbezahlung für die kostbare Handarbeit meiner Großmutter brachte Maria uns meistens Schwarzbrot und frische Butter mit, manchmal auch etwas Marmelade. Wir aßen täglich Mamaliga (die rumänische Bezeichnung für Mais-Polenta), und zwar morgens, mittags und abends: morgens kalte Mamaliga-Scheiben mit Marmelade, mittags heiße Mamaliga mit etwas Butter und abends nochmals etwas Mamaliga. Manchmal kochte meine Großmutter Kartoffeln, das schmeckte köstlich. 28 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Wenn Maria uns das Schwarzbrot brachte, war es ein wahrer Schmaus. Dann schnitt Baba jedesmal eine gute dicke Scheibe für mich ab, bestrich sie reichlich mit Butter, teilte die Scheibe in ganz kleine Vierecke auf und garnierte jedes Viereck mit einem kleinen Knoblauchwürfel. Das eignete sich besonders gut für die tägliche Jause, unseren Nachmittagstee. Es gab zwar weder Zucker, noch Kuchen, Kaffee oder Tee, doch Baba bestand darauf, jeden Tag eine Jause aus dem vor zu bereiten, was gerade erhältlich war. Für jedes Brotviereck, das mit Butter und Knoblauch garniert war, nahm ich mir jedesmal viel Zeit, den Geschmack genießend; ich war sehr bemüht, mich noch Tage später an deren Geschmack zu erinnern, wenn wir überhaupt kein Brot mehr hatten. Die Jause war auch die Tageszeit, zu der Baba mir eine meiner Lieblingsgeschichten erzählte: deutsche Märchen, wie Rotkäppchen, Schneewittchen oder Aschenputtel – meine Lieblingsgeschichten – oder Geschichten aus der Bibel, wie Joseph und der bunte Leibrock, die Geschichten von Jakob, Rachel und Lea, von David und Goliath, oder von dem heldenhaften Samson. Baba war eine hervorragende Geschichtenerzählerin und verstand es, alles immer interessant und geheimnisvoll wirken zu lassen. Baba war einmal eine hübsche junge Frau gewesen, bevor sie heiratete. Sie war die älteste von drei Schwestern der Familie Rosenbaum, die in einem Vorort Czernowitzs wohnte; alle drei waren sie kräftig, intelligent und selbstständig. Zu Hause wurde Deutsch gesprochen und alle Töchter, außer meiner Großmutter Sabine, hatten studiert und gut geheiratet. Tante Sofie war die mittlere Schwester und sie war die intelligenteste. Sie erhielt ihre Matura und brachte es zu einem Hochschulabschluß; sie beherrschte Deutsch, Rumänisch und Französisch und wurde von allen geschätzt und geliebt. Sie hatte einen wohlhabenden Mann geheiratet und das Ehepaar war der Stolz der ganzen Familie. Von jeher war es der Traum meiner Mutter gewesen, so wie Tante Sofie zu werden. Leider erkrankte Tante Sofie an Krebs und starb kurz vor meiner Geburt. Tante Rosa, die jüngste der drei Schwestern, war die klügste; sie war für ihre Selbstsucht und ihre Rücksichtslosigkeit berüchtigt. Sie hatte einen schweigsamen und zurückhaltenden Elektriker geheiratet, der, wie mein Onkel Jossel, bei der Stadtbehörde angestellt war. Tante Rosa führte ein Elektrogeschäft und verdiente gut. Ihre Familie war allgemein wohlhabend und besaß ein großes, drei Etagen Gebäude in der Stadtmitte. Baba Sabine, ihrerseits, hatte nur eine sehr geringe Schulerziehung erhalten, da sie, als sie im zweiten Schuljahr war, eines Tages beschloß hatte, mit Freunden an den Pruth-Fluß zu gehen, statt zur Schule. Am nächsten Tag wurde sie in der Schule gescholten und nach Hause geschickt; danach schämte sie sich zu sehr, um in die Schule 29 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 zurückzukehren. Ihre Mutter war zwar der Meinung, daß eine Schulausbildung sogar für Mädchen wichtig sei, aber da Sabine bereits Deutsch lesen und schreiben konnte und auch gute Grundkenntnisse im Rechnen besaß, war die Mutter der Meinung, daß die Tochter zu Hause bleiben könne, um ihr bei der Pflege der jüngeren Kinder und bei den vielen Arbeiten auf dem Bauernhof behilflich zu sein. Besonders wichtig war ihre Hilfe bei der Betreuung des kleinen Bruders, Hermann. Sabine gab jedoch nie das Lernen auf: sie war eine Autodidaktin. Sie besserte ihre Deutschkenntnisse auf, las Bücher und studierte Rumänisch und Ukrainisch. Sie bat auch ihren Vater, ihr die hebräischen Buchstaben beizubringen, damit sie auf Jiddisch lesen und schreiben könne und sie las zahlreiche Bücher der damaligen jiddischen Autoren. Sabine war die stille und ergebene Schwester, die von morgens bis abends auf dem elterlichen Bauernhof und im Haus arbeitete, während ihre Schwestern sich die meiste Zeit in der Stadt aufhielten. So war es selbstverständlich, daß ihre beiden jüngeren Schwestern vor ihr heirateten. Bald wurde sie als "alte Jungfer" angesehen. Dann, eines Tages, machte ein ausgesprochen ansehnlicher junger Soldat in ihrem Dorf halt und bat um Hilfe wegen seines Pferdes. Er war Kavallerist bei der Österreichischen Armee und hieß Lieser Furman. Er hatte wenig Bildung und konnte eigentlich kaum lesen, aber er sprach sehr nett mit Sabines Eltern und machte den Eindruck, ein guter Jude zu sein. Er hatte Sabine bei den Haushaltsarbeiten beobachtet und sich in sie verliebt. Bald darauf heirateten sie und Sabines Eltern waren froh, ihre älteste Tochter nun endlich fortzuschicken, damit sie sich eine eigene Existenz aufbaue. Es war eine recht unglückliche Ehe. Doch solange Lieser einen Sold von dem österreichischen Heer erhielt, waren sie im Stande, ihre vier Kinder, Bjumin, Srul, Jossel und Frieda, in einem gewissen Wohlstand großzuziehen. Auf diese Weise überstanden sie den Großen Krieg - den 1. Weltkrieg -, doch danach stellte das österreichische Heer den guten Sold ein und Lieser wurde zum Pferdehändler. Er war kein besonders fleißiger Mensch; er verdiente kaum etwas und war nicht im Stande, für den Unterhalt seiner Familie zu sorgen. Die Last der Existenzabsicherung fiel auf Sabine ab; sie war intelligent und tüchtig und fand immer einen Weg, hier und da etwas Geld zu verdienen: sie kaufte, verkaufte und handelte mit allerlei Waren, sie schneiderte und flickte und nahm viele verschiedene Arbeiten an, die es ihr ermöglichten, ihre vier Kinder großzuziehen. Sie brachte es sogar fertig, allen Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, mit allen damals erforderlichen Grundkenntnissen. Doch jederman wußte, daß die Furmans eigentlich sehr arme Leute waren. Bjumin, der sich für Landwirtschaft interessierte, 30 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 kaufte sich einen eigenen Bauernhof in einem der Dörfer in der Umgebung von Czernowitz und gründete dort seine Familie. Srul war ein hervorragender Schüler auf der Schule und Sabine hatte jahrelang jeden Pfennig, den sie beiseite legen konnte, gespart und schickte ihn später nach Wien, damit er dort Medizin studiere. Er brach jedoch sein Studium ab und verließ das Land, um nach Palästina auszuwandern und dort einen Kibbuz zu gründen. Er hatte sich von den zionistischen Anführern anfeuern lassen, die in Wien vor jüdischen Studenten ihre Reden hielten; er fühlte sich eher dazu berufen, in Palästina ein Landwirt zu werden, zum Wohl der zionistischen Sache, als Arzt zu werden und in Europa zu bleiben. Jossel wurde ein fachmännisch ausgebildeter Elektriker und Frieda schloß ihr Studium am "Safa Ivrija" ab, einem MädchenLehrerseminar für Hebräisch. Meine Großmutter Sabine konnte auf ihre Familie stolz sein. Nun, nach der Machtübernahme der Nazis, waren ihre Kinder an sehr verschiedenen Orten zerstreut, wie in vielen anderen Familien in Czernowitz: Bjumin und Frieda befanden sich beide in Transnistrien; Srul lebte in Palästina und nur Jossel war in der Stadt zurückgeblieben, so daß sie ihn von Zeit zu Zeit sehen konnte. Meine Großeltern waren die einzige jüdische Familie, die noch im Gettoviertel, eines der ärmlichsten Viertel der Stadt, lebte. Die anderen Familien, die dort gelebt hatten, waren zum größten Teil nach Transnistrien deportiert worden. Ich, meinerseits, empfand es als ein Glück, bei meinen Großeltern zu sein, ganz besonders bei meiner Baba, die ich innig liebte. Da ich kein richtiges Spielzeug zum spielen hatte, pflegte meine Großmutter für mich Puppen und Stofftiere aus Lumpen und Stoffresten aus alten Kleidern herzustellen. Sie brachte mir deutsche Kinderlieder und einige kurze Kinderreime bei. Mein Großvater, dagegen, verbrachte die meiste Zeit des Tages im Schlaf oder verrichtete verschiedene Arbeiten um das Haus herum. Er sprach nur selten mit mir und wenn er mich anblickte, hatte ich dabei immer das Gefühl, als ob er sagen wollte: "Wer ist denn dieses kleine Mädchen? Was hat es hier zu suchen? Warum ist es nicht bei seinen Eltern?". Es betrübte mich nicht weiter, da ich glücklich war, bei meiner Baba zu leben; ich vermisste jedoch meine Eltern, besonders meine Mutter. "Wann kommt meine Mutter zurück?" fragte ich immer wieder meine Großmutter. "Und warum ist sie weggegangen, ohne sich zu verabschieden?". Meine Großmutter erklärte mir, daß meine Mutter keine andere Wahl gehabt hatte und daß sie sich nicht verabschiedet hatte, weil sie mich nicht traurig machen wollte. "Ich weiß, daß sie jede 31 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Minute an dich denkt und ich weiß, daß sie eines Tages zu dir zurückkehren wird. Wir müssen durchhalten, gesund bleiben und diesen Tag abwarten." Ich hörte ihr zu und hatte das Gefühl, daß sie recht hatte. Oft habe ich mir vorgenommen, so weise und so stark wie meine Baba zu sein. Während der kalten Nächte dieses Winters schlief ich in der Mitte des großen Bettes, mit meiner Großmutter zur einen Seite und meinem Großvater zur anderen. Das hielt mich warm und zufrieden. Wir gingen alle drei kurz nach Anbruch der Dunkelheit ins Bett und wachten bei Tagesanbruch auf. Und doch, trotz aller Armut um mir herum und trotz der Trennung von meinen Eltern, war ich ganz und gar nicht unglücklich, ganz im Gegenteil. Dann, eines Nachts, wachte ich auf und stellte fest, daß mir sehr kalt war. Ich war ganz alleine in dem großen Bett. Ich hörte ein furchtbares Geschrei und merkwürdige, laute Stimmen. Ich richtete mich auf, um zu sehen, was vorging und spürte, wie mein Körper vor Schrecken erstarrte. Meine Großmutter stand in ihrem dünnen Nachthemd vor einem der Fenster. Die Glasscheibe war zerschmettert; Baba kramte die Sachen meiner Mutter aus ihrem Schrank heraus und reichte sie jemandem in die Arme, der durch das Fenster hineinragte. Ich sah das Silber der Kerzenständer im Dunkeln glitzern und die wunderschönen bestickten Tischdecken. Jedesmal wenn sie zögerte, drang ein langes Rohr durch das Fenster hinein, von eine fremden Hand hineingeschoben, das Baba einen Hieb erteilte. Dabei stoß sie jedesmal einen Schmerzschrei aus und reichte noch mehr Sachen hinaus. Meine Augen suchten nach meinem Großvater, den ich andauernd "Gewalt, gewalt!"12 schreien hörte. Er stand vor der Tür, stapelte verschiedene Möbelstücke aufeinander und versuchte, den Hieben von außen standzuhalten. Es war ein schrecklicher Anblick, und ich konnte nichts machen! Ich riß die große Daunendecke über meinen Kopf und blieb im Bett liegen, ohne mich zu rühren. Mir war klar, daß ich stillehalten mußte, damit niemand auf mich aufmerksam würde. Das Geschrei ging noch lange Zeit weiter; dann kam plötzlich eine aufbrüllende Stimme vom Gipfel des Hügels: "Hört sofort auf, oder ich rufe die Polizei!". Die Täter rissen alles an sich, was meine Großmutter ihnen durch das Fenster gereicht hatte und machten sich davon. Danach wurde es sehr ruhig und ich konnte die Schluchzer meiner Großmutter und das kindliche Weinen meines Großvaters hören. Langsam ließ ich die Decke hinuntergleiten und kroch aus dem Bett hinaus, um einen Überblick zu erhalten. Baba saß 12 Auf Jiddisch soviel wie: "O je, o je!". 32 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 auf dem Boden, mitten in einem Haufen von Glasscherben und schluchzte so tief, daß ihr ganzer Körper bebte. Mein Großvater saß auf einem Stuhl, mit einer großen Heugabel in der Hand und weinte leise, mit tiefen und gedämpften Seufzern. Ein kalter Wind wehte durch das eingeschlagene Fenster; ich war besorgt und erschrocken, weil sie mich beide gar nicht wahrzunehmen schienen. Alle drei blieben wir eine ganze Weile so sitzen und ich war zu sehr beängstigt, um irgend etwas zu sagen. Auf einmal richtete meine Großmutter sich auf und blickte mich an, als ob sie mich zum ersten mal wahrnehmen würde. Sie ging auf mich zu, umarmte mich und sagte: "Mein Schatz, mein Ojtzer13! Wir müssen dich retten. Du sollst leben und geborgen sein." In Momenten der Aufregung ging meine Großmutter von einer Sprache zur anderen über. Dabei machten mir ihre Worte erst recht Angst, weil ich nicht so recht verstand, was sie meinte. Im Nu waren wir alle Drei angezogen und auf dem Bett lagen zwei kleine Kleiderbündel. Der graue Wintermorgen war gerade angebrochen, als jemand an der Tür klopfte. Wir erschraken alle drei zutiefst und unser Herz pochte heftig auf. Es stellte sich heraus, daß es Maria war, die heute ungewöhnlich früh ankam. "Was ist denn hier passiert?" fragte sie staunend. Meine Großmutter erklärte ihr, daß rumänische Rabauken uns überfallen und unsere ganze Habe weggenommen hatten. Erst zeigte sie ihr die leeren Schränke, dann die blauen Flecken, die die Hiebe an verschiedenen Stellen ihres Körpers hinterlassen hatten. Maria stand händeringend da. "Ivan, unser Nachbar, der oben auf dem Hügel wohnt, hat uns gerettet. Er hat die Rabauken angeschrien und verjagt." Schließlich sagte Baba, daß sie Maria die Schlüssel des kleinen Hauses geben wolle, da wir dabei waren, das Haus zu verlassen, um bei Verwandten in der Stadt unterzukommen. Nachdem Maria das Haus verlassen hatte, sagte Baba zu Großvater: "Ich habe ein starkes Gefühl, daß Maria die Rabauken zu uns geschickt hat, um uns Angst zu machen und uns zu berauben. Wahrscheinlich hätten sie uns nicht umgebracht, aber Gottseidank ist Ivan ein gutmütiger Mensch und hat eine kräftige Stimme. Kein einziger von unseren Nachbarn, die wesentlich näher wohnen, hat auch nur einen Ton von sich gegeben oder etwas unternommen. Es ist ohne Zweifel Ivans Stimme zu verdanken, daß sie davongelaufen sind." 13 "Ojzer": Jiddisch für "Schatz". 33 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Draußen war es noch ziemlich dunkel und sehr kühl, doch sagte Baba, daß sie sich sofort mit mir auf den Weg machen müsse, ohne das Ende der Ausgangssperre abzuwarten, wenn die Juden sich nach draußen begeben durften. Großvater würde später nachkommen. "Wo gehen wir hin?" fragte ich besorgt, befürchtend, daß wir wieder zu Jossel und Regina gehen würden. "Wir gehen zu Tante Rosa. Ich hoffe, daß sie uns ein kleines Zimmer in ihrem großen Haus freimachen kann. Wir haben keine andere Wahl." Ich kannte Tante Rosa nicht, wußte aber, daß sie Babas jüngste Schwester war und das klang schon mal gut. Lautlos verließen wir das Haus und den Hof. Baba führte mich durch Nebenstraßen, auf denen zu dieser frühen Tagesstunde kein einziger Mensch weit und breit zu sehen war. Sobald wir Schritte oder Pferdetraben hörten, versteckten wir uns schnell in einem Durchgang oder auf einem Hof. Deutsche und rumänische Soldaten patrouillierten durch die Straßen und sorgten dafür, daß kein einziger Jude die Ausgangssperre überschritt. Auf diese Weise kamen wir langsam und qualvoll voran; Baba hinkte, weil sie auf einen Glassplitter getreten und ihr Knöchel angeschwollen war; ich hinkte, weil meine Schuhe zu klein waren und meine Zehen schmerzten. Schließlich erreichten wir Tante Rosas Haus. Es war ein großes dreistöckiges Gebäude, an einer der schönsten Straßen Czernowitzs gelegen. Obwohl wir zwei Stunden lang gegangen waren, war es noch frühe Morgenstunde und die Ausgangssperre war noch nicht beendet. Wir stiegen die Treppen auf zur ersten Etage, auf der Tante Rosa mit ihrer Familie wohnte, und klopften an der Tür. Es dauerte ein paar Minuten, bis schließlich jemand die Tür öffnete. Tante Rosa stand im Türrahmen, in Nachthemd und Morgenrock. Sie schien äußerst überrascht, uns zu sehen und zögerte einen Augenblick, doch dann ließ sie uns in ihr Wohnzimmer hinein. Es war ein großes Zimmer mit einem wunderschönen Kronleuchter in der Mitte und einem großen Eßtisch mit Stühlen darunter. Bald war die ganze Familie im Wohnzimmer angesammelt: Onkel Nathan, Tury, 19, und Herbert, 17 Jahre alt. Baba erzählte ihre Geschichte und zeigte ihnen die blauschwarzen Flecken, von denen ihr ganzer Körper übersäht war. Ich fand es etwas verwunderlich, daß sie sich nicht schämte, ihre Bluse und ihren Rock hoch zu heben und die blauen Flecken zur Schau zu geben, aber scheinbar war sie viel zu aufgeregt, um auf irgend eine meiner Fragen einzugehen. Alle hörten ihr zutiefst erschüttert zu, doch ging keiner auf sie zu, um sie etwa zu umarmen oder zu trösten. Schließlich sagte Tante Rosa: "Wie du weist, leben Nathan und ich jetzt hier mit unseren beiden Söhnen, Tury und Herbert. Wir haben nicht viel Platz, aber Tury könnte zu Herbert ins 34 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Zimmer ziehen und ihr könntet vorerst in Turys Zimmer wohnen." Baba zog ihren linken Schuh aus, ihr Fuß sah schlecht aus, er war ganz rot angelaufen und angeschwollen. Tury und Herbert eilten in das Zimmer und bereiteten das Bett für Baba zu. Danach legte sie sich hin und schloß die Augen. Ich stand dort herum und wartete ab, daß jemand auf mich aufmerksam würde. Tury kam als erster auf mich zu; er half mir aus meinem Mantel und aus den nassen Schuhen heraus; dann setzte er mich auf einen Stuhl in der Küche und bereitete mir ein Spiegelei zu, mit etwas Brot und Butter. Ich hatte seit Langem keine Eier mehr gegessen und genoss jeden einzelnen Bissen von dem Brot, daß ich in das Eigelb tunkte. Danach kehrte ich zu Baba zurück und setzte mich neben sie auf das Bett. "Jetzt erzähle ich dir Geschichten und du kannst dich ausruhen", sagte ich zu ihr. Gegen Mittag kam mein Großvater an und wir richteten uns alle drei in Turys Zimmer ein, das angenehm und schön warm war und ein Fenster mit Ausblick zur Straße hatte. Ich hatte das Gefühl, daß ich mich dort glücklich und wohl fühlen würde. Über Tante Rosa machte ich mir keine Illusionen, doch hatte ich das Gefühl, daß Tury und Herbert mich mochten.Ich wußte schon, daß die beiden bald meine besten Freunde sein würden. Meine Großeltern kehrten nie wieder in ihr kleines Haus zurück und wir hörten nie wieder etwas von Maria. Dieses Kapitel in unserem Leben war nun zu ende. 35 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 5 Das Leben bei Tante Rosa Die Nacht nach unserer Ankunft bei Tante Rosa war schlaflos. Wir lagen alle drei in einem Bett, das wesentlich kleiner war als das Bett, daß wir in dem kleinen Hause gehabt hatten. Baba stöhnte die ganze Nacht hindurch – sie erlitt fürchterliche Schmerzen und konnte nicht schlafen. Mein Großvater saß den größten Teil der Nacht auf einem Stuhl; hier und da nickte er ein, dann fuhr er plötzlich aus seinem Schlaf auf, tief stöhnend. Wir ließen die Stromlampe die ganze Nacht brennen, weil wir, nach so langer Zeit mit einer Gaslampe in dem kleinen Haus, es genossen, endlich wieder Stromlicht zu haben. Ich konnte nicht schlafen, weil ich mir Sorgen um meine Baba machte und dachte, beten zu müssen. Ich hatte Leute zu Gott beten gehört, wußte aber nicht, wie es gemacht wird. Es war ende Februar 1937 und ich war fast 4 Jahre alt, und ich wußte nicht, wie man zu Gott betet. Am nächsten Morgen kam Tante Rosa herein, um nachzusehen, wie es ihrer Schwester ging. Sie rührte Babas Stirn an und ließ einen Schrei aus: "Mein Gott, du glühst ja! Du hast sehr hohes Fieber, wir müssen sofort Dr. Pistiner rufen". Gegen Mittag kam der nette jüdische Arzt an. Er war ein lächelnder Mann mit einem gestutzten weißen Bart. Er brachte Medikamente für Baba mit und untersuchte ihr verletztes Bein. Schließlich bat er Tante Rosa, eine große Schüssel warmes Wasser zu bringen und gab Baba darin ein Fußbad. Er verordnete eine tägliche Wiederholung des Fußbads und er würde in einige Tagen nochmals vorbeikommen, um den Stand der Dinge festzustellen. Zu Baba sagte er, während er mit dem Blick über das Zimmer streifte: "In diesen schlechten Zeiten sollten Sie froh sein, so ein hübsches Zimmer zu haben, in dem sie sich ausruhen können, und eine Schwester, die Sie verpflegen kann. Versuchen Sie doch, zu schlafen, zu essen und Ihr Bein zu schonen, bis der Glassplitter herauskommt." Dan blickte er zu mir und sagte lächelnd: "Kleines Mädchen, kannst du tanzen und singen? Sie zu, daß du deine Großmuter bei guter Laune hälst, damit es ihr bald wieder besser geht." Als der Arzt uns verließ, fühlte ich mich sehr erfreut; ich umarmte Baba und sagte zu ihr: "Meine Gebete sind erhört worden und du wirst wieder gesund werden. Tante Rosa betrachtete mich und sagte, mit einem traurigen Gesichtsausdruck: "Gerade erst vier Jahre alt und redet schon wie eine Erwachsene. So ein vorkluges Kind, wie schrecklich!". Tante Rosas Worte "sie redet ja wie eine alte mojd" hallten in meinem Kopf wider. Mir war klar, daß sie mich nicht mochte. 36 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Den ganzen Tag lang bemühte ich mich, für meine Baba zu tanzen und zu singen und ihr all die Geschichten zu erzählen, an die ich mich erinnern konnte. Schließlich blickte mein Großvater mich verärget an und sagte: "Jetzt sei doch mal ruhig, du machst so viel Lärm, daß nicht schlafen kann.". Also ging ich ans Fenster und saß dort lange Zeit, die Leute betrachtend, die sich mit raschen Schritten in der Kälte bewegten. Sämtliche Häuser auf der gegenüberliegende Straßenseite waren mit Schnee bedeckt und sahen wie Märchenschlösser aus. Ich war nur etwas traurig; ich dachte mir, daß wenn meine Mutter da gewesen wäre, sie sich um Baba und um mich gekümmert hätte und daß wir dann alle glücklich hätten sein könnten. Den ganzen Tag wartete ich auf Turys und Herberts Heimkehr. Als sie endlich ankamen, merkte ich, daß Herbert unruhig war. Er erzählte allen, daß er hoffte, daß seine Freundin Sylvia in dieser Nacht vorbei kommen würde, obwohl es sehr gefährlich sei, nachts auf der Straße zu gehen. Tury war wieder derjenige, der zu mir nett war. Er stellte Käse, Geschnetzeltes und frisches Brot auf den Tisch und die ganze Familie setzte sich um den Tisch, um zu essen. Meine Großeltern nahmen an diesem Festessen nicht Teil. Während des Tages hatten sie etwas Suppe zu sich genommen und blieben die meiste Zeit in ihrem Zimmer; ich, dagegen, hatte das Gefühl, zur Familie zu gehören, weil Tury mir zu essen gab, mit mir redete, mir lustige Kinderreime auf Deutsch rezitierte und mich allgemein sehr heiter stimmte. Plötzlich hörte man ein lautes und ungeduldiges Pochen an der Tür und Sylvia trat weinend und schluchzend in die Wohnung. Sie war von ihrem Haus aus zu Tante Rosa zu Fuß gegangen, als sie auf einmal gemerkt hatte, daß zwei rumänische Soldaten ihr folgten. Sie waren betrunken und warfen ihr obszöne Bemerkungen zu; sie rannte so schnell sie konnte und es gelang ihr, davon zu kommen. Herbert nahm sie bei der Hand und saß lange mit ihr auf dem Sofa im Wohnzimmer. Tury merkte, daß ich gar keine Lust hatte, schlafen zu gehen. Also nahm er mich mit auf sein Zimmer, rückte zwei Stühle aneinander und bereitete mir ein kleines Bett vor, auf dem ich schlafen konnte. Dann sagte er: „Mach dir keine Sorgen um Baba, sie hat ein paar Tabletten genommen und sie wird jetzt gut schlafen; du kannst diese Nacht bei uns bleiben, so lange, wie du willst.“ Ich hatte gut gegessen, das lebendige Tischgespräch, bei dem Stromlicht, das in der ganzen Wohnung brannte, genossen und war zufrieden. In jener Nacht schlief ich besonders gut. 37 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Während der darauffolgenden Tage und Nächte ging es ähnlich so weiter. Baba war noch immer bettlägerig und konnte nicht gehen. Mein Großvater schlummerte auf seinem Stuhl, während die Anderen ihrer Arbeit, Erledigungen oder was auch immer außerhalb des Hauses erledigten. Onkel Nathan, Tante Rosas Ehemann, begab sich jeden Morgen zur Arbeit auf der Elektrofabrik. Tury und Herbert gingen zur Zwangsarbeit in einem Lager in der Nähe von Czernowitz. Sie verließen jeden Tag früh morgens das Haus und kamen spät abends zurück. Der Arzt kam wieder und versuchte, Babas Knöchel zu drücken, um den Glassplitter herauszupressen, doch ohne Erfolg. Weitere Tage verstrichen; nun wurde Baba allmählig sehr ungeduldig und sagte immer wieder: “Ich kann doch nicht die ganze Zeit im Bett bleiben und verpflegt werden. Ich muss aufstehen und irgend etwas tun, aber ich kann nicht auf meinem Fuss auftreten”. Mein Geburtstag verstrich, ohne daß jemand sich daran erinnerte, außer Tury, der mir eine Puppe schenkte. Diese Puppe wurde meine beste Freundin, und ich erzählte ihr alles. Ich saß studenlang vor dem Fenster, während ich mich mit ihr unterhielt und die Menschen auf der Strasse beobachtete. Ich wartete jedesmal ungeduldig auf den Abend, wenn Tury und Herbert zurück nach Hause kamen, etwas Leckeres zu essen mitbrachten und aufregende Geschichten erzählten. Manchmal kam mein Onkel Jossel für einen kurzen Besuch vorbei und brachte der Familie etwas zu essen. Jedesmal hatte er ein Stück Kuchen für mich dabei. Eines Abends, während wir mal wieder sitzend Turys und Herberts Heimkehr abwarteten, schrie Baba fröhlich auf, nachdem sie wie immer nach dem Fussbad ihren Fuss gequetscht hatte: “Das Glas ist raus, das Glas ist raus!”; sie hielt dabei den Glassplitter in der Hand, der etwa so gross wie eine Olive war. Alle eilten herbei zu ihrem Bett und freuten sich. “In ein paar Tagen”, sagte Tante Rosa, “kannst du wieder auf eigenen Füssen stehen, dann sollten wir beide Pläne machen; aber erst wollen wir gemeinsam den Seder feiern”. Am nächsten Tag sah Baba so glücklich aus wie schon lange nicht mehr. Mit viel Geduld versuchte sie, mein verfilztes Haar durchzukämmen. Sie sprach wieder mit mir, so wie sie es früher in ihrem kleinen Haus zu tun pflegte. Dies schien mir der richtige Moment zu sein, um ihr ein paar Fragen über unsere Familie zu stellen, die mich beschäftigten: warum waren einige der Frauen in der Familie so streng und böse mit mir – ich dachte dabei an Tante Regina, Tante Nora und an Tante Rosa. Baba betrachtete mich lange, dann stoß sie einen Seufzer aus und sagte: "Littika, du bist erst vier Jahre alt und noch ein kleines Kind, aber ich 38 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 glaube, ich muß dir ein paar Sachen erklären. Frieda, deine Mutter, ist immer schön und klug gewesen. In Allem, was sie unternahm, war sie erstklassig: sie war eine sehr gute Schülerin, in Deutsch und Geschichte hat sie Preise erhalten; sie beherrschte gut Rumänisch und sie lernte Französisch und Hebräisch. Von allen Nichten und Neffen hat Tante Sofie sie immer bevorzugt; von ihren häufigen Reisen nach Wien brachte sie ihr immer hübsche Kleider mit. Frieda ging als einziges Mädchen der ganzen Familie zum Schomer Hatsair; Srul stellte sie den vornehmsten Jungen und Mädchen der Stadt vor. Obwohl deine Mutter aus einer sehr armen Familie kam, verkehrte sie immer mit den Reichen und Einflußgebenden. Dann lernte sie Willy kennen, eine sehr gute Partie, den sie heiratete und dadurch stieg ihr sozialer Rang. Schau dir Nora an, sie ist schon über dreißig und hat noch nie einen Freund gehabt; Regina heiratete schließlich den Jossel, ihr Vetter, der nicht gerade der erfolgreichste Mensch in der Familie ist. Und Mina wünscht sich sehnlichst, einen Mann zu finden; deswegen verbringt sie ihre ganze Zeit in Unterhaltungen mit den Polen in Reginas und Jossels Wohnung, in ihren schönsten Kleidern und mit ihrem besten Schminkzeug. Dies sind drei Vetter deiner Mutter, die sie seit ihrer Kindheit hoch beneidet haben. Dann sehen sie dich und werden daran erinnert, daß du Friedas Tochter bist, also werden sie dich nicht besonders gerne haben". Ich mußte sofort an Aschenputtel und an ihre unbarmherzigen Schwestern denken; mir schien, daß ich verstehen konnte, was meine Großmutter mir gesagt hatte. Baba versuchte mir zu erklären, daß wir nicht ewig bei Tante Rosa bleiben könnten. "Sie ist zwar meine Schwester, aber sie hat mich immer wie der arme Teil der Familie behandelt. In ihren Augen bin ich sowohl in meiner Ehe, als auch in meinem persönlichen Leben, erfolglos gewesen. Ihrer Meinung nach habe ich das alles mir selbst zu verschulden. Sie wußte es besser und hat es zu etwas Besserem gebracht. Nun sind wir hier und verzehren ihr Essen, schlafen in ihren Betten und dann muß sie mich auch noch verpflegen, da ich mit diesem verletzten Fuß hilflos bin. Das mag sie ganz und gar nicht und sie kann es kaum noch abwarten, bis wir eine andere Lösung finden". Das Wort "Lösung" verstand ich nicht, aber ich wußte, daß Baba sicher ein Lösung finden würde. Dabei dachte ich mir auch, daß meine wunderbare Baba, die klug, schön, lieb und weise war, von allen geliebt werden sollte. Wie konnte ihre Schwester nur so gemein zu ihr sein? 39 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Die Woche darauf war voller Aufregungen. Irgendwie brachte Rosa es fertig, irgendwo Mazen für den Seder zu kaufen; sie ergatterte sogar ein Stück Fisch. Am Seder-Abend versammelte sich die ganze Familie um den großen Tisch im Wohnzimmer. Onkel Nathan und mein Großvater saßen jeder auf einem großen Kissen, daß auf deren Stuhl gestopft worden war, je an einem Ende des Tisches. Auf dem Tisch lag ein großes, weißes, wunderschönes Tischtuch und alles sah sehr feierlich aus. Ich saß zwischen Tury und Herbert und wir teilten uns ein Haggadah-Buch zu dritt. Tury zeigte mir die Illustrationen und gab mir Erklärungen zur Geschichte. Er sagte mir, die Haggadah sei ein schönes Buch; er befahl mir, dieses Buch für mich zu behalten und darin herumzublättern, wannimmer ich mich traurig fühlte. So wurde mir das Haggadah-Buch viele Jahre lang ein guter Freund. Baba begann nach und nach wieder zu gehen; bald war sie wieder ganz bei Kräften und hatte ihr alte gute Laune zurückgewonnen. Ich nahm mir vor, immer sehr vorsichtig mit zerbrochenem Glas umzugehen, weil es so schlimme Folgen haben kann. Bis heute werde ich sehr unruhig, wenn irgend etwas imHause zerbricht. Nun verließ Baba täglich das Haus, während der freien Stunden, und suchte anch Möglichkeiten, etwas Geld zu verdienen. Dabei trug sie immer ihren gelben Davidstern auf ihrem Mantel. Ich, dagegen, mußte zu Hause bleiben, da ich weder Schuhe, noch warme Kleidung besaß. Der Frühling ließ auf sich warten und obwohl der Schnee zum Teil schon verschmolzen war, war es draußen immer noch sehr kalt. Eines Tages saß ich am Fenster, wie immer mit meiner Puppe auf dem Arm. Ich betrachtete die großen Bäume draußen, die jetzt voller neuer grellgrüner Blätter waren. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite konnte ich einen herrlichen Fliederstrauch sehen, der ganz mit lila Farbe geschmückt war. Wie sehr sehnte ich mich danach, dieses Lila zu betasten und zu riechen! Der Flieder war in voller Blüte, aber ich konnte nicht das Haus verlassen. Ich konnte die Schmetterlinge in der Sonne tanzen sehen und alles sah so schön und fröhlich aus. Meine Großmutter buk Brötchen in der Küche – dies war jetzt ihre neueste Beschäftigung -, während mein Großvater, wie immer, schlief. Ich war mir selbst überlassen in meiner Betrachtung dieser wunderschönen Welt dort draußen, die ich nicht anfassen konnte. Ich fühlte mich wie in einem Käfig eingesperrt – ein Glaskäfig, aus kaltem Glas, auf dessen Außenwand dieses trügerische Bild angeheftet war. Waren die Schmetterlinge echt? War es draußen warm oder kalt? Werde ich jemals 40 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 diese grünen Blätter draußen berühren und den blühenden Fliederstrauch riechen können? Am Abend wartete ich wie immer auf Herbert und Tury. Aber dieses Mal kamen sie besonders schlecht gelaunt nach Hause und sprachen kaum ein Wort mit mir. Ich spürte, daß ich mich still halten und mich unbemerkbar machen mußte. Tante Rosa weinte und lief aufgeregt hin und her in dem Wohnzimmer. Baba saß auf einem Stuhl in einer Ecke und preßte ihre Hand fest auf ihrem Mund. Es ging etwas sehr Böses vor. Ich saß einfach da und beobachtete die Erwachsenen. Schließlich ergriff Tante Rosa das Wort und sagte: "Tury und Herbert, ihr müßt schlafen gehen, weil ihr morgen aufstehen und zur Arbeit gehen müßt, wie immer. Während des Tages werde ich eure Sachen einpacken und wir werden alle bereit sein". Am nächsten Tag wollte kein Mensch mit mit reden, alle sagten nur: "Bleib still, du bist ein kleines Mädchen und du sollst nicht so viele Fragen stellen!". Baba kehrte von ihrer Verkaufstour heim, auf der sie ihre Brötchen absetzte und diesmal hatte sie mir ein paar Schuhe mitgebracht. Sie erzählte mir, daß sich in einem der Häuser, in dem sie Brötchen verkaufte, ein kleines Mädchen befand, daß etwas größer war als ich; sie hatte die Dame des Hauses gefragt, ob sie etwa alte Schuhe hätte, die ihrer jungen Tochter schon zu klein seien. Ich probierte sie aus und fand, dass sie mir paßten. Ich war so glücklich, daß ich mit meinen neuen Schuhen durch das ganze Haus tanzte, doch sehr bald wurde ich in eine Ecke geschickt, mit der Anweisung, stille zu halten. Tante Rosa war den ganzen Tag damit beschäftigt, zu packen, zu nähen und Plätzchen zu backen. Als Tury und Herbert heimkehrten, wechselten sie schnell ihre Kleider, aßen eine Kleinigkeit in der Küche und schienen nun für ein geheimes Erlebnis bereit zu sein. Jetzt erklärte mir Baba, daß die beiden auf dem Weg nach Palästina waren, aber dass niemand es erfahren dürfe. "Es ist ein großes Geheimnis!" sagte sie mir. Spät in der Nacht, als Tury und Herbert bereit waren, sich auf den Weg zu machen, waren Tante Rosa und Baba auch bereit, um sie zu begleiten. "Ich möchte auch mitkommen, ich möchte Tury und Herbert auch begleiten!" schrie ich weinend; Baba sagte schnell, daß, da ich nun Schuhe hätte, ich mitkommen dürfe. Wir gingen leise aus dem Haus und liefen schweigend durch die dunklen Straßen bis zum Bahnhof. Der Zug war startbereit, auf dem Weg zur Meereshafen, wo Tury und Herbert auf ein Schiff nach Palästina steigen sollten. Wir verabschiedeten uns sehr leise von ihnen. Dicke Tränen liefen über Tante Rosas Gesicht, aber sie sagte kein Wort. Tury und Herbert befanden sich schon längst auf dem Zug, aber der Zug bewegte sich lange Zeit nicht, obwohl sämtliche Fenster und Türen des Zuges geschlossen waren, wobei das Aufheulen des Lokomotivmotors 41 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 den Eindruck erweckte, daß der Zug jeden Moment losfahren würde. Es verstrichen endlos lange Minuten und der Zug bewegte sich immer noch nicht. Tante Rosa begann zu schluchzen und plötzlich heulte eine Alarmsirene auf. Wir verdrückten uns alle drei in eine Ecke. Alles blieb still und man hörte aus der Ferne Artilleriegeräusche. Tante Rosa sagte: "Oh mein Gott, sie werden den Zug bombardieren und meine beiden Jungen werden umkommen!". Aber plötzlich ging der Zug langsam in Bewegung, gab einen lauten und schrillen Pfiff von sich und innerhalb weniger Minuten war er verschwunden. Wir atmeten alle erleichtert auf und machten uns auf den Weg nach Hause im Dunkeln der Nacht. Erst später verstand ich, daß Tury und Herbert auf illegalen Wegen nach Palästina reisten. Sie hatten sich Dokumente verschafft, die ihnen erlaubten, sich innerhalb Rumäniens zu bewegen und sich dann auf ein Schiff nach Palästina zu begeben, um sich meinem Onkel Srul auf seinem Kibbuz anzuschließen. Diese Nacht würde ich niemals vergessen. 42 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 6 Der gelbe Davidstern Tante Rosas Haus war jetzt still und leer. Alle waren traurig und ich vermisste Tury und Herbert. Die Nazis und die rumänische Armee bedrängten die Juden, noch mehr Transporte nach Transnistrien zu schicken. Jedesmal wenn von diesen Tranporten die Rede war, sagte Tante Rosa: "Gott sei Dank sind meine Jungen weggegangen, bevor man sie festgenommen hätte". Eines Tages kamen einige Polizisten zu uns nach Hause, um nach Tury und Herbert zu fragen. Als sie ihnen sagte, daß sie nicht wüßte, wo die beiden seien, brüllten sie Tante Rosa an und schlugen auf sie ein. Daraufhin öffnete sie eine Kommode, nahm etwas Geld aus der Schublade und legte es auf den Tisch. Die Polizisten steckten das Geld ein und verließen das Haus, ohne ein Wort zu sagen. Einige Wochen später erhielten wir eine Postkate aus Palästina. Srul kündigte an, daß die "Lieferung erledigt" sei und auf diese Weise erfuhren wir, daß Tury und Herbert dort gut angekommen waren. Wir lebten immer noch zu dritt in demselben Zimmer; Baba wurde von Tag zu Tag unruhiger und sagte, daß wir unbedingt eine andere Lösung finden müßten. Sie kaufte Mehl und Hefe auf dem Markt und buk jeden Tag Brötchen, die sie dann von Haus zu Haus und Tür zu Tür verkaufte. Eines Sommertages sagte ich ihr, daß ich mitkomme, da ich nicht mehr zu Hause bleiben wollte. Nach vielem Weinen und langem Hinundher sagte sie schließlich: "Gut, du darfst mit mir kommen, aber ich warne dich, du wirst unterwegs müde werden und ich werde dann keine Zeit haben, um mich aufzuhalten. Ich muß unbedingt alle Brötchen vor der Ausgehsperre verkauft haben!". Ich war glücklich und zog eines meiner Frühlingskleider an, daß Baba mit einem angenähten Stoffstreifen für mich verlängert hatte. Ich zog meine neuen Schuhe an und wir machten uns auf den Weg, um die Brötchen zu verkaufen. Als wir auf der Straße standen, fiel Baba plötzlich ein, daß ich keinen gelben Davidstern trug. Sie sagte daraufhin: "Bleib etwas hinter mir, so daß die Polizisten nicht merken werden, daß wir zusammen gehören". Ich blickte sie an und fühlte mich zutiefst beleidigt. Wie konnte meine Baba so tun, als ob wir nicht zusammen gehören? Ich sagte nichts, warf ihr aber einen anklagenden Blick zu. Schließlich kamen wir an der Straße an, auf der die reichen Leute wohnten; dort klopfte sie an jede Tür an und bot ihre Brötchen an. Ich stand hinter ihr und beobachtete die wohlhabenden Damen, die nicht besonders nett zu Baba waren. Bald wurde ich sehr müde und flehte sie an, mir zu erlauben, mich nur für einen kleinen Moment auf den Bordstein setzen zu dürfen. "Ich habe dir doch gesagt, 43 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 daß ich meine Brötchen ausverkaufen muß und daß ich mich jetzt nicht aufhalten kann. Du mußt dich jetzt bemühen, trotz Müdigkeit weiterzugehen". Schließlich verkaufte sie ihre letzten Brötchen, so daß wir noch etwas Zeit hatten, auf den Markt zu gehen, um dort etwas Mehl und ein Stück Brot zu ergattern. Wir waren beide guter Laune, so daß wir die Angelegenheit mit dem Davidstern völlig vergaßen. Sie nahm mich an der Hand und wir liefen durch die engen Durchgänge auf dem Markt. Es war ein warmer Tag und die Sonne blendete mich. Pltötzlich hörte ich eine laute Stimme, die meine Großmutter ansprach und als ich aufblickte, sah ich einen großen Polizisten mit einem langen Schnurrbat, der sie anzischte: "Na, wo ist denn der gelbe Davidstern der Kleinen?". Meine Großmutter fing an zu zittern und versuchte zu erklären, daß der Davidstern unterwegs abgefallen war. Er fing an, sie anzubrüllen: "Ich kann euch für so etwas nach Transnistrien ausweisen lassen!". Meine Großmutter nahm sofort das ganze Geld, das sie an diesem Tag von dem Verkauf der Brötchen verdient hatte, und drückte es dem Polizisten in die Hand. Er steckte das Geld schnell ein und sagte: "Geh nach Hause, Weib, und mach dir neue gelbe Davidsterne. Nächstes mal wirst du nicht so leicht davonkommen". Wir liefen beide so schnell wir konnten, um uns von dem Markt zu entfernen und kehrten über Hinterstraßen zu Tante Rosas Haus zurück. Baba sagte kein Wort, aber ich hatte dabei ein elendes Gefühl. Mir war klar, daß ich ihr den Tag verdorben hatte – erst war ich ihr ein Hindernis beim Vermarkten ihrer Brötchen gewesen und dann mußte sie auch noch den ganzen Ertrag an den Polizisten abgeben. Wäre ich zu Hause geblieben, dann wäre nichts von dem vorgekommen. Danach ging ich nie wieder mit ihr auf ihre Brötchen-Runde. Als wir zu Hause ankamen, griff Baba sofort nach einem Stück Pappe und schnitt mehrere Dreiecke heraus. Dann nahm sie ein Stück gelben Stoff und zeigte mir, wie man es aufnäht und daraus einen Davidstern herstellt. "Von nun an werden wir immer einen zusätzlichen Davidstern in der Tasche tragen, damit das, was uns heute passiert ist, nie wieder vorkommt", sagte sie. Einige Wochen später kam Tante Rosa auf eine Idee. Auf der Dachetage ihres Hauses gab es eine kleine Wohnung. Sie mußte aufgeräumt und gesäubert werden, und man müßte einige fehlende Möbelstücke einrichten, doch könnten wir dort einziehen und bis zum Ende des Krieges verbleiben. Auch an eine kleine Einkommensquelle für unsere Familie hatte sie gedacht: wir könnten eines der Zimmer an einen älteren Herrn vermieten; er würde uns für Kost und Logis bezahlen und Baba 44 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 könnte für ihn kochen und putzen. Ein kleiner Teil des Ertrags würde an Tante Rosa abgehen; der Rest würde uns erlauben, diese harten Zeiten zu überleben. Also zogen wir nochmals um und es begann eine neue Zeit. Baba war mit diesem Arrangement zufrieden und flüsterte mir zu: "Srul hilft Tante Rosas Söhnen in Palästina und sie hilft uns hier". Die Dachwohnung war recht bequem. Es gab dort zwei kleine Schlafzimmer und einen relativ großen Wohnraum mit Flur und Kochecke und ein kleines Badezimmer. Sobald wir eingezogen waren, zog ein mürrischer älterer Herr zu uns, der das Zimmer mit dem Fenster zur Hauptstraße übernahm. Er hieß Herr Katz und war ein frommer Mann. Er blieb fast immer in seinem Zimmer, den ganzen Tag lesend und betend. Dreimal am Tag brachte meine Großmutter ihm etwas zu essen. Von Zeit zu Zeit kam er aus seinem Zimmer heraus, damit meine Großmutter dort putzen konnte. Herr Katz sah immer gereizt und wütend aus. Mich sprach er nie an, es sei denn, um mich zu schelten und mir Vorwürfe zu machen, daß ich zu viel Lärm mache und er sich deswegen nicht konzentrieren könne. Meiner Großmutter gegenüber war er weder besonders nett, noch höflich, aber sie schien sich nichts daraus zu machen. Eines Tages saß ich an dem Tisch, während meine Großmutter für ihn Essen vorbereitete und sich um seine Hemden kümmerte; da fragte ich sie: "Warum müssen wir mit diesem Herrn Katz leben, der doch immer so unfreundlich ist?". Sie schaute mich mit einem etwas traurigen Blick an und sagte: "Eigentlich ist er ein guter Mensch; er hat seine Familie verloren und ist jetzt ganz alleine. Wir kümmern uns um ihn und er bezahlt uns eine sehr anständige Miete; so können wir Essen kaufen und in dieser Wohnung bleiben. Dies ist der Grund, warum wir sehr nett zu ihm sein müssen. Wenn er aus seinem Zimmer herauskommt, solltest du in unser Schlafzimmer gehen und ruhig bleiben. Und wenn du hier im Wohnzimmer spielst, vergiß nicht, daß er dich durch die Tür hören kann". "Aber ich möchte singen und tanzen, wie immer!" protestierte ich. "Dann sing halt flüsternd und tanz auf den Zenspitzen, damit er dich nicht hören kann!" erwiderte sie. So lebten wir mehr als eineinhalb Jahre lang. Grundsätzlich hatten wir es recht gemütlich und es gab immer etwas zu essen. Meine Großmutter kochte ihr bestes Essen für Herrn Katz und für uns kochte sie meistens Mamaliga. Anfangs liebte ich Mamaliga, besonders, wenn sie frisch gekocht war und wir Butter hatten, die wir darüber zergehen lassen konnten. Aber nach einiger Zeit begann ich es zu hassen. Wir aßen davon morgens, mittags und abends. Meistens in kalten Scheiben mit etwas Marmelade. Ich konnte den Anblick davon nicht mehr ertragen. 45 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Im Laufe dieser eineinhalb Jahre wurde ich langsam ein blasses und dürres kleines Mädchen, das fast sechs Jahre alt war. Ich verließ nur selten das Haus und traf nie gleichaltrige Kinder. Ich saß immer bei meiner Großmutter, die mir viele Reime und Lieder auf Deutsch beibrachte. Ich konnte zählen und kannte das Alphabet auf Deutsch und auf Jiddisch. Meine einzige Puppe entwickelte sich so langsam zu einer scheußlichen Vogelscheuche; oft bemalte ich mir ein Gesicht aufs Knie und wickelte einen Kopftuch drumherum, damit es wie eine Puppe aussah. Da ich nun schon etwas älter war, erzählte mir meine Großmutter etwas mehr über meine Eltern. Sie erklärte mir, daß wir nicht wußten, ob mein Vater noch am Leben war oder nicht, da wir seit Kriegsbeginn keine Nachricht von ihm erhalten hatten. Meine Mutter befand sich in einem Lager namens "Transnistrien" und auch von ihr hatten wir keinerlei Nachricht. Dann und wann kam ein Nachbar oder ein Bekannter vorbei und berichtete meiner Großmutter daß "dieser oder jener verschollen war, nachdem man ihn über den Bug genommen hatte". Ich versuchte mir auszumahlen, was dieser Satz bedeutete. Ich dachte, der Bug sei eine Brücke und daß einige Leute zur anderen Seite der Brücke gebracht worden waren und dort verloren gegangen waren. Erst Jahre später erfuhr ich, daß der Bug ein Fluß ist, der nördlich von Transnistrien liegt, wo Hunderte von Juden umgebracht wurden, indem man sie über eine Felsenklippe hinunterwarf. Eines Tages fragte ich meine Großmutter: "Baba, werden sie meine Mamma über der Bug nehmen?". Sie blickte mich erschrocken an und sagte schnell, daß sie sicher sei, daß Frieda, meine Mutter, in Sicherheit war und daß wir bald von ihr hören würden. Dann kam eines Tages eine Postkarte an und meine Baba war so glücklich, daß sie vor lauter Freude gleichzeitig weinte und lachte. "Deine Mutter ist am Leben, es geht ihr gut" sagte wie immer wieder, während sie die Postkarte unter das Licht hielt und versuchte, zu lesen, aber es war unmöglich. Ich konnte damals noch nicht lesen, aber ich konnte erkennen, daß oben am Anfang und unten am Ende jeweils eine kurze Zeile geschrieben stand; alle übrigen langen Zeilen waren mit schwarzer Tinte durchgestrichen worden. "Deine Mutter hat "liebe Familie" geschrieben und unten mit "eure Frieda" unterschrieben; der Rest ist unleserlich, weil der Zensor es durchgestrichen hat, aber das macht nichts. Wir wissen, daß sie lebt und bald ist der Krieg zuende und sie wird zu dir zurückkehren". Ich war glücklich, aber gleichzeitig auch traurig. Ich konnte nicht so lange auf meine Mutter warten. Ich wünschte mir so sehr, daß sie jetzt sofort nach Hause käme. 46 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Eines Tages heulten die Alarmsirenen lauter als gewöhnlich auf. Wir konnten Flugzeuge im Himmel und Explosionen in der Ferne hören. Es war ende Dezember 1943. Tante Rosa kam herauf zu unserer Wohnung, was sie sonst nie tat, und sagte uns, daß wir uns alle in den Schutzkeller in dem gegenüberliegenden Haus begeben mußten, da es in unserem Haus keinen Schutzkeller gab. Alle sahen erfreut aus: "Die Deutschen ziehen zurück, sie sind dabei, den Krieg zu verlieren und sie greifen die Stadt mit Bomben an im Laufe ihres Rückzuges". Wir gingen alle in den Schutzkeller, mehr lächelnd als fürchtend, weil dies das Zeichen des Kriegendes war. Nur Herr Katz wollte nicht in den Schutzkeller gehen: "Ich werde in meinem Zimmer bleiben, egal was mir passiert", sagte er. Wir saßen in dem Schutzkeller und hörten schreckliche Geräusche. Niemand schlief. Die Frauen hatten etwas Essen mitgebracht; sie unterhielten sich und erzählten sich Geshichten, und alle schienen sich über die Explosionen, die wir hörten, zu freuen. Tante Rosa sagte: Ich hoffe, daß es nicht unser Gebäude treffen wird, mit Herrn Katz darin". Mir kam es lustig vor: ich malte mir aus, wie das Gebäude über unsere Köpfe zerfällt und der mürrische Herr Katz in der Luft herumfliegt. Nachdem Baba mehrere Tage mehrmals in unsere Wohnung auf und ab ging, um dem Herrn Katz sein Essen zu bringen, während wir im Schutzkeller blieben, fingen die Leute an zu sagen, daß man die Deutschen durch die Stadt laufen sehen könne: "Sie sehen schlecht aus und krank. Einige der Offiziere haben kein Auto mehr und sitzen auf Karren, die von Pferden gezogen werden. Sie sehen aus wie eine besiegte Armee, von der nichts übriggeblieben ist". Schließlich gewöhnten sich alle an das Getöse der Alarmsirenen und der Bombenangriffe und wir beschlossen alle, wieder in unsere Wohnung zurückzukehren. Das neue Jahr hatte begonnen, ohne daß wir es gemerkt hatten. Es war nun Januar des Jahres 1944. Dann sagte Baba eines Tages: "Der Krieg ist fast zu Ende und wir müssen sicherstellen, daß wir die Wohnung deiner Eltern auf der Franzensgasse zurückbekommen". 47 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 7 Zurück in unserer Wohnung Eines Abends im Januar 1944 gingen Baba und ich zur Wohnung auf der Franzensgasse. Draußen war es dunkel und kalt und wir liefen eines raschen Schrittes. Baba war still und sprach während dieser ganzen Zeit kein einziges Wort zu mir. Ich hatte keine Ahnung, wo wir hingingen, aber ich spürte, daß es um eine sehr wichtige Angelegenheit ging, da sie mich mit sorgfältig angezogen hatte, mein Haar gekämmt hatte und mir Schleifen um die Zöpfe gebunden hatte. Ich war fast sechs Jahre alt und erlebte zum erstenmal das Gefühl, hübsch angezogen zu sein. Anfangs erkannte ich die Straße nicht wieder, aber als wir anfingen, die Treppen hochzusteigen, begann mein Herz, ganz wild zu klopfen. Dies war die Wohnung meiner Eltern. Wir erreichten die Tür auf der zweiten Etage und lauschten schweigend. Es schien alles sehr ruhig zu sein. Dann klopfte meine Großmutter einige Male an die Tür. Die Tür öffnete sich und ein junger deutscher Soldat stand dort und blickte uns an. Baba sagte: "Ich möchte gern mit dem Offizier sprechen". Selbstverständlich sprach sie in perfektem Deutsch. Der Soldat bat uns hinein. Als wir durch den Flur liefen, bemerkte ich dort eine merkwürdige und fremd anmutende Hutablage. Auf einmal füllten sich meine Nasenlöcher von dem Geruch in Butter gebratener Eier. Welch herrlicher Duft! Ich fühlte mich wie berauscht davon. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen, aber drinnen war es dunkel und als ich hineinschaute, sah ich, daß das Zimmer völlig leer stand. Dann blickte ich auf in die belichtete Küche und sah dort den Soldaten von vorhin, der vor unserem großen Herd stand und Eier in einer Pfanne bratete. Auf dem Küchentisch lagen ein Teller und Besteck. Während wir dort standen, trat auf einmal der deutsche Offizier aus dem Schlafzimmer meiner Elten heraus. Er war großgewachsen und sehr gutaussehend, aber er hatte einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Er schaute uns an und lächelte nicht. Meine Großmutter sagte schnell auf Deutsch: "Dieses kleine Mädchen wurde hier, in dieser Wohnung geboren. Die Wohnung gehört ihren Eltern und wir möchten gerne hierhin zurückziehen, wenn sie weggehen". Der Offizier betrachtete uns lange ohne irgendetwas zu sagen. Erst dachte ich, er hätte die Worte meiner Großmutter nicht verstanden. Dann antwortete er sehr laut: "Alte Frau, nehmen Sie das Kind und machen Sie sich aus dem Staub. NOCH kann ich sie nach Transnistrien ausweisen". Meine Baba lächelte höflich und wir brachen sofort auf. Ich versuchte noch weiter, den Geruch der Rühreier 48 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 einzuatmen. Bis heute noch, nach sechzig Jahren, kann ich diesen Geruch nachvollziehen. Es bringt mir immer gute Laune und stimmt mich froh und optimistisch. Wir gingen rasch zu Tante Rosas Haus zurück. Baba sagte: "Das war sehr gut, was wir da gerade gemacht haben. Er kann uns gar nicht nach Transnistrien ausweisen, der Krieg ist ja bald zu ende. In ein paar Tagen müssen wir zurückkehren und sicherstellen, daß niemand anders vor uns in die Wohnung einzieht. Sie gehört deinen Eltern und sie sollen sie wiederbekommen, wenn sie zurückkehren. Gott sei Dank wissen wir, daß deine Mutter lebt." Ich hörte ihr zu, dabei mußte ich aber immer wieder an diese bedrohliche Hutablage und an den herrlichen Geruch der Rühreier denken. Bis heute überkommt mich flüchtig dieses Suchtgefühl, wenn ich Rühreier zubereite. Aber jedesmal wenn ich eine Hutablage sehe, höre ich wieder die Stimme dieses deutschen Offiziers, der uns herausjagte. Ich habe nie eine Hutablage in meinem Haus haben wollen, obwohl die meisten meiner Freunde eine solche Hutablage in ihrem Haus hatten. Schließlich verschwanden die Deutschen mit ihren Wagen und wurden durch die Russen ersetzt, mit deren verkommenen Wagen. Die Bombenangriffe gingen immer weiter und jemand sagte dazu: "Die Deutschen haben auf dem Weg nach draussen Bomben auf uns geworfen, und die Russen werfen auf uns Bomben auf dem Weg nach drinnen". Sobald Baba davon gehört hatte, packte sie ein paar Sachen ein, packte mich an der Hand und so marschierten wir auf die Franzensgasse zu. Die Wohnung stand leer und die Hutablage war verschwunden. Mit Ausnhame einiger kleinen Möbelstücke war die Wohnung ganz und gar leer geräumt worden. Doch innerhalb weniger Tage hatten wir bereits ein Bett auf dem wir schlafen konnten – ein großes Doppelbett für uns drei, im Schlafzimmer - sowie einen Tisch mit einigen Stühlen im Wohnzimmer. Mein Großvater zog zu uns ein und wir waren alle glücklich. Die Bombenangriffe gingen dabei immer noch weiter und nachts durfteb wir kein Licht in der Wohnung anzünden. Während des Tages hielten Baba und ich uns draußen auf, ohne uns an die Ausgehsperre zu halten. Der Krieg war zwar noch nicht zu Ende, aber es schwebte bereits ein Gefühl von Freiheit in der Luft. Mir scheint, dass die meisten der Juden, die noch in Czernowitz geblieben waren, nun ihren gelben Davidstern abnahmen, und auch wir taten es. Wenn wir uns in der Wohnung aufhielten, rannte ich hin und her, von einem Zimmer zum anderen. Die Lehmöfen brannten frühmorgens und abends. Mein 49 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Großvater brachte das Holz ins Haus und zündete die Öfen täglich an. Ich liebte es, mit dem Rücken an dem großen Ofen angelehnt im Wohnzimmer zu sitzen und zu spüren, wie die Wärme meinen ganzen Körper durchdringte. Aber am allerliebsten saß ich im Toilettenraum. Es war ein kleiner Raum, den ich ganz für mich hatte. Auf der Toilette bei angeknipstem Licht zu sitzen, war für mich ein wundervolles Erlebnis. Ich träumte von einigen der Geschichten, die ich kannte und ich unterhielt mich mit Phantasiespielen. Die Wände des kleinen Raumes waren weiß angestrichen und sauber; in meiner Phantasie füllte ich diese Wände mit Märchenbildern und Tieren. Es war so schön, alleine für sich zu sein und nicht gescholten zu werden. Die Nachbarn im Gebäude waren alle neu hinzu gezogen. Ich hörte Baba sagen, daß Dr. Segal beim Kampf in der Roten Armee umgekommen und Frau Segal in Transnistrien an Thyphus gestorben sei. Die Familie, die neben uns auf der gleichen Etage wohnten, waren wohlhabende Juden, die Freunde in der russischen Armee hatten; sie nahmen laufend Gäste in ihrer Wohnung auf und waren ausgesprochen laut. Die Familie hatte eine kleine Tochter namens Karin, die ungefähr so alt war wie ich. Sie lud mich ein, mit ihr zu spielen. Während Baba sich regelmäßig auf die Suche nach neuen Sachen zur Ausstattung unserer Wohnung begab, blieb ich derweilen bei Karin. Sie hatte ein eigenes Zimmer, mit einer großen Vielfalt von Kleidern,Spielzeugen, Bildern und Büchern. Ich hatte bis dahin noch nie mit einem Mädchen gespielt und tat immer genau das, was sie mir vorschrieb. Ich konnte ihr ansehen, daß es ihr Spaß machte, mich herumzukommandieren, aber ich konnte nicht umhin und hing an ihren Fersen wie ein Schatten. Karin war der erste Mensch, der mir jemals ein Stück Schokolade angeboten hat und mir war klar, daß ich nett zu ihr sein mußte. Eines Nachmittags, anfang Februar 1944, als ich mich bei Karin und ihrer Familie befand und meine Großeltern außer Hause waren, kam ein Nachbar herangestürzt und rief aufgeregt: "Littika, Littika, komm und schau, wer da gerade angekommen ist!". Mein Herz pochte auf wie ein Hammer und meine Füße wurden auf einmal ganz schwach. Langsamen Schrittes begab ich mich auf das Treppenhaus hinaus. Eine hübsche Frau mit schwarzem Haar und einem schweren Mantel stand dort und beobachte mich. Ich wußte, es war meine Mutter, aber ich konnte nichts fühlen. Sie nahm mich in ihre Arme und betrachtete mich. Die Nachbarn um uns herum riefen mir zu: "Das ist deine Mutter, du sollst sie küssen, du sollst sie umarmen!". Aber ich war wie versteinert und völlig sprachlos. Dann sagte meine Mutter: "Laßt sie doch in Ruhe, sie muß sich erst wieder an mich gewöhnen". Zum Glück wurden wir durch meine 50 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Großmutter "erlöst", die gerade die Treppe hinauf rannte. Meine Mutter setzte mich ab und die beiden Frauen umarmten sich lange, wobei meine Großmutter schluchzte. Wir traten in unsere Wohnung hinein und schon heulten die Sirenen wieder auf. "Was macht ihr, wenn die Bombenangriffe anfangen?" fragte meine Mutter. "Nicht viel, wir sitzen einfach hier im Dunkeln" antwortete meine Großmutter. In dieser Nacht saßen Baba und ihre Tochter Frieda stundenlang am Küchentisch und redeten unentwegt. Ich saß mit dabei, mit dem Kopf auf Babas Schoß gelehnt. Ich verstand nicht alles, was sie sagten oder meinten, aber ich hörte Baba sagen: "Was konnte ich da machen? Ich mußte ihnen alles weggeben, sonst hätten sie uns umgebracht. Nichts ist übriggeblieben, ich hatte kein Geld, um dem Kind Essen oder Kleider zu kaufen". Ich hatte das Gefühl, daß meine Mutter Baba einen mißbilligenden Blick zuwarf, als ob sie ihr etwas vorwerfen würde. Ich war dabei unglücklich, ohne zu wissen warum. Dann nahm meine Mutter irgendwann Geld aus ihrer Tasche heraus und legte es auf den Tisch. Kurz vor Tagesanbruch steckte meine Mutter etwas Nahrung in ihren Rucksack; dann gab sie mir einen raschen Kuss und ging davon. Ich sollte sie ein ganzes Jahr lang nicht wiedersehen. Ich hatte schon so lange auf meine Mutter gewartet - zweieinhalb Jahre. Diese ganze Zeit hatte ich sie mir immer auf einem Stapel Koffern auf dem Karren sitzend, der sie mir weggenommen hatte, vorgestellt. Wie konnte sie mich nochmals verlassen? Bedeutete ich ihr überhaupt etwas? Vermisste sie mich denn überhaupt nicht? Wollte sie mich jetzt nicht an ihrer Seite haben? Ich umarmte Baba mit all meiner Kraft. Das Leben ging so weiter wie vorher und bald hörte ich auf, an meine Mutter zu denken. 51 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 8 Die Russen sind wieder da Die Bombenangriffe waren nun vorbei und die Russen füllten unsere Stadt. Wir waren von den Deutschen befreit, und doch schienen die Leute unglücklich. Alle erinnerten sich noch an die Russen von der ersten Besetzung unserer Stadt und sie trauten ihnen nicht. Baba und ich gingen oft aus. Die Straßen waren dreckig und rochen nach Sauerkraut ("Kapusta") und Hering. Diese Gerüche waren mir verhaßt. Die Strassenbahn war wieder in Verkehr; oft stiegen wir in die Strassenbahn ein zum Spaß, doch war das größte Erlebnism das wir dabei erlebten, der Anblick eines russischen Soldaten, der sich in einer Ecke des Wagens übergab, weil er zuviel Alkohol getrunken hatte. Viele junge Frauen in unserem Gebäude und in der Nachbarschaft klagten darüber, daß diese Soldaten sie drangsalierten. Abgemergelte und verhungert aussehende Juden kehrten nach und nach in die Stadt zurück, aus Transnistrien; Baba erwartete die Rückkehr ihres Sohnes Bjumin. Sie hatte von jemandem gehört, daß er lebte und die Jahre in einem Zwangsarbeitlager verbracht hatte. Aber dann erhielten wir die schreckliche Nachricht: auf dem Weg vom Lager nach Hause hatte Bjumin irgendwo Halt gemacht, um Wasser aus einem Brunnen zu trinken; dort überfiel ihn ein rumänischer Soldat von hinten und schlug ihn mit großer Wucht auf den Rücken mit einer großen Flasche. Bjumins Lungen kollabierten und wenige Stunden später starb er. Tagelang weinte Baba ununtrebrochen. Sie blieb im Bett oder saß auf einem Stuhl im Wohnzimmer; sie kochte nicht mehr und ging auch nicht mehr aus. Sie wirkte völlig "zusammengebrochen" und ich wußte nicht, wie ich ihr helfen konnte. Ich setzte mich neben sie und streichelte ihr den Arm und das Gesicht. Mein Großvater saß auf seinem Stuhl und schluchzte. Ich hatte ihn noch nie in einem solchem Zustand gesehen und er tat mir schrecklich leid. Ich dachte mmer wieder an meine Mutter. Warum war sie nicht bei uns? Warum mußte sie wieder weggehen? Eines Morgens stand Baba auf und sagte: "Mein Gott, wieviel Leid kann ein Mensch ertragen? Haben wir nicht schon genug gelitten? Aber das Leben muß weiter gehen, ich muß dich versorgen und dir Essen vorbereiten" sagte sie, mich mit einem sorgevollen Blick betrachtend. Sie zog sich an und ging aus dem Haus, um Einkäufe zu machen. An diesem Tag aßen 52 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 wir eine ordentliche Mahlzeit und obwohl Baba noch immer sehr traurig war, schien es, dass alles wieder beim Alten sei. Ich hatte es inzwischen aufgegeben, Baba über meine Mutter auszufragen und warum sie wieder weggegangen war. Meine Großmutter hatte mir erklärt, daß Frieda wieder weggehen mußte, um wichtige Leute zu treffen, daß es wegen des Krieges nun eine neue Grenze gäbe, sie nun in Rumänien war, während wir uns in Rußland befanden, und daß es eine Weile dauern würde, bis wir zu ihr ziehen könnten, dorthin wo sie sich nun befand. Baba sagte: "Wir wollen nicht wirklich in Rußland bleiben und wir wollen ihr so bald wie möglich nachfolgen". Ich konnte nicht verstehen warum, nachdem wir uns so sehr darüber gefreut hatten, wieder in der Wohnung auf der Franzensgasse zu sein, wir wieder wegziehen sollten. Wir erhielten von Frieda mehrere Postkarten, aus einer Stadt namens Bukarest. Es ginge ihr gut und sie warte darauf, daß wir uns ihr anschließen. Ich dachte nicht mehr an sie, aber ich glaube, daß ich es ihr nie wirklich verziehen habe, daß sie mich ein zweitesmal verlassen hatte. Jahre später, im Sommer 2002, saß ich in unserer Wohnung in Jerusalem und schaute mir ein Fernsehprogramm an. Es wurde eine afrikanische Frau aus Angola gezeigt, die ihren Sohn vier Jahre lang nicht gesehen hatte, nachdem sie ihn im Laufe der Unruhen und der Kämpfe aus den Augen verloren hatte. Auf einmal wurde ihr angekündigt, daß ihr Sohn gefunden worden sei. Er war zwölf Jahre alt, gesund und in guter Verfassung. Man gab ihr ein Bild von ihm. Die Frau fing an zu tanzen, zu lachen und zu weinen. Sie war außer sich vor Freude. Ich saß dort in meinem Wohnzimmer und hatte Tränen in den Augen. Ich war 64 Jahre alt und bereits Großmutter; dieses Fernsehprogramm brachte mich zurück zu meiner Begegnung mit meiner Mutter, als sie aus Transnistrien zurückkehrte, und erweckte in mir einen dumpfen Schmerz in der Brust. Die Fragen brannten immer noch in meinem Kopf: "Warum schien sie sich nicht zu freuen, als sie mich sah? Stand ich ihr im Wege? War ich nur eine zusätzliche Last für sie? Wie konnte sie mich so gleichgültig betrachten, nachdem sie mich drei Jahre lang nicht gesehen hatte? Wie konnte sie mich nochmals verlassen?". Nun da die Russen in der Stadt waren, durften wir uns überall frei bewegen. Ich lief mit Baba zum Ringplatz und dort erblickten wir einen großen goldenen Stern auf dem Gipfel einer riesengroßen Säule. Und ein Riesenporträt von Stalin gab es dort auch. Überall befanden sich zahlreiche lauthalsige russische Soldaten, aber wir fürchteten uns nicht vor ihnen und wir mußten nicht mehr den gelben Davistern tragen. 53 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Baba war auf eine Idee gekommen, von der sie mir nichts erzählte. Sie begab sich zu den russischen Behörden, gab den Namen meines Vaters an, sowie weitere Angaben, und bat sie, nachzuforschen, was ihm zugestoßen sei. Sie wartete auf eine Antwort ohne sich dabei etwas anmerken zu lassen. Sie hoffte auf seine Rückkehr und wußte, daß wir von der russischen Armee Unterhaltsgelder für mich erhalten würden, so daß wir alle damit versorgt wären. In der Zwischenzeit suchte sie weiterhin nach allerlei Arbeitsgelegenheiten, um unsere Existenz abzusichern. Sie backte und setzte einen Teil ihrer Produkte ab, sie nähte und flickte Kleider; oft krämpelte sie Herrenkragen um und erzeugte den Anschein eines neuen Kragens. Sie strickte auch, aber nur für Familienangehörigen. Sie nahm alte Pullover auseinander und ich half ihr beim Wickeln des Wollgarns, indem ich die Arme zu ihr hinstreckte, während sie das Garn um meine Hande aufspulte. Ich liebte es in diesen Momenten in ihrer Gegenwart zu sein. Nahrungsmittel waren jetzt viel leichter erhältlich als vorher, doch war Fleisch sehr teuer. Es hieß, daß wenn man Fleisch kaufe, es meistens Pferdefleisch sei, das wie Rindfleisch aussah14. So kam Baba auf eine neue Einkommensquelle: sie hatte einen Bauern gefunden, der größere Mengen Rindfleisch in die Stadt lieferte, das sie dann den Nachbarn in unserer Küche verkaufte. Eines Tage hatten wir eine halbe Kuh auf unserem Küchentisch liegen; die Leute strömten ein und aus und kauften je ein Kilo oder ein halbes Kilo Fleisch. Baba schnitt das Fleisch ab und legte den Preis fest, während mein Großvater es auf einer Waage abwog, wobei auf der einen Seite der Waage, Steine, und die Fleischstücke auf der anderen Seite lagen. Da viele Leute hinein und heraus kamen, war ich für die Tür zuständig. Ich öffnete die Tür und sagte auf Deutsch: "Bitte gehen Sie in die Küche". Irgendeinmal kam es vor, daß ich die Tür öffnete und ich einen sehr hübschen russischen Soldaten vor mir stehen sah, der einen schweren Mantel trug; er hielt an und blickte mich an. Er hatte ein breites Lächeln auf seinem Gesicht und auch seine blauen Augen lächelten. Er sprach mich an: "Littika, bist du es? Ist das meine kleine Tochter?". Ich blieb eine Weile still, dann stürzte ich mich in die Küche zu meiner Baba und rief laut: "Es ist Tata, Tata ist wieder zu Hause, Tata ist wieder zu Hause!". Langsam schritt er durch den Flur, leicht hinkend. 14 Pferdefleisch, im Gegensatz zu Rindfleisch, ist für Juden unkoscher. Die meisten Juden hätten das Fleisch nicht gekauft, falls sie wüssten, dass es eigentlich Pferdefleisch sei. 54 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 9 Frieda Frieda, meine Mutter, war schon immer eine sehr einfallsreicher und kluge Frau gewesen. In unserer Familie hieß es, daß Frieda wie eine Katze war, die "immer auf ihren Füßen landet". An diesem grauen Oktobermorgen, da sie auf dem mit Säcken und Koffern beladenen Karren saß, war sie auf dem Weg nach Transnistrien, in einem der ersten Ausweisungstransporte, wie so viele andere Juden aus dem Getto. Eine Reihe von Karren bewegten sich mühselig auf den holprigen Straßen, auf den Bahnof zu. Einige Leute liefen nebenher mit ihren kleinen Taschen auf dem Rücken oder in der Hand. Alle waren still und gingen mit vor lauter Angst und Sorge gekrümmten Rücken. Frieda, die jung und bei guter Gesundheit war und sich gut auf dieses Schicksal vorbereitet hatte, war tief in Gedanken versunken,ohne aber verzweifelt zu sein. Sie hatte Vertrauen in ihre Fähigkeit, das Beste aus der Lage zu machen und sie gute glaubte auch, daß sie gute Chancen hatte, meinem Vater zu begegnen. In der Nacht vor der Deportation hatte mein Großvater ihr seine alten Soldatenstiefel gegeben, die ihr genau paßten und in denen ihre Füße warm und bequem lagen. Erst hatte er sorgfältig einen kleinen Schlitz in die Sole aufgeschnitten; Baba brachte ein paar amerikanische Dollarnoten, die sie in die Sole steckten, dann richtete er die Öffnung so her, daß niemand sie erkennen könnte und der Hohlraum damit abgesichert war. Danach verbrachte Baba den größten Teil der Nacht damit, russische Rubel in das Futter des Wintermantels einzunähen. Sie hatte ihre Arbeit dermaßen gut verrichtet, daß es unmöglich zu erkennen war, daß etwas in dem Mantel versteckt war. Sie verpackte auch etwas Brot und Käse und füllte eine Thermosflasche mit heißem Tee. All dies nahm Frieda mit und fühlte sich für die Reise gewappnet. Als sie sich dem Bahnhof annäherten, kamen immer mehr Menschen in Scharen zusammen, ganze Familien, die sich einander festhielten und bemüht waren, einander in dem immer größer werdenden Menschengewühl nicht aus den Augen zu verlieren. Das schöne Bahnhofsgebäude, nach klassischer österreichischer Tradition gebaut, war noch immer dasselbe, aber anstatt ein Ort zu sein, an dem sich die Leute mit Verwandten und Freunden treffen, der Ausgangspunkt zu neuen Gegenden und aufregenden Erlebnissen, war er nun ein Ort der Angst, der Unsicherheit und der Verzweiflung. Es war all denjenigen, die den 55 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 gelben Davidstern auf ihren Mänteln trugen, klar, daß sie einer Katastrophe entgegengingen, wenn sie auch noch nicht wußten, was es wirklich bedeutete. Frieda erkannte in der Menge ihren Onkel, Herman Rosenbaum, Babas jüngsten Bruder, seine Frau Kutza und deren Sohn Freddy, der ungefähr achtzehn Jahre alt war. Sie waren ihr immer sympathisch gewesen. Kutza war eine der belehrtesten Frauen in der Familie; sie hatte ihre Matura in Wien erhalten und später Pharmakologie studiert. Frieda packte ihre Sachen aus dem Karren und schloß sich ihnen rennend an. Sie freuten sich, Frieda zu sehen und alle vier beschlossen sie, zusammenzubleiben. Während Frieda und die Rosenbaums sich umarmten, brüllten rumänische und deutsche Soldaten und zerrten die Leute in den Zug. Frieda warf einen Blick auf den Zug und konnte ihren Augen nicht glauben: es wurde von ihnen verlangt, in leere Viehwagons zu steigen. Ehe sie sich umblicken konnte wurde sie auf den Wagon emporgehoben und sie mußte sich bemühen, dabei ihren Koffer und ihren Rucksack an sich zu klammern und Onkel Herman und seine Familie wiederzufinden. Schließlich gelang es ihr, innerhalb des Wagens zu ihnen zu stoßen; dort standen sie, sich an der Wagonwand festhaltend, an der sich ein enger Schlitz mit etwas Luft und Licht befand. Nachdem die große, schwere Wagontür zugesperrt worden war, wurde ihnen erst richtig bewußt, was für ein Glück sie hatten, sich neben der einzigen Luftquelle zu befinden. In den ersten paar Stunden standen oder saßen die Menschen eng beieinander. Kinder und alte Leute hatten es besonders schwer. Viele der Kinder weinten, die alten Leute jammerten oder schluchzten. Es war schwierig, klare Gedanken zu behalten. Die Leute packten das Reiseproviant heraus, das sie mitgebracht hatten. Sie aßen schweigend, jeder für sich. Da dachte Frieda sich: "Wie klug es war, Littika bei meiner Mutter zu lassen, sie wird sich um sie kümmern – was hätte ich mit ihr hier gemacht?" Nach einer Weile spitzte sich die Lage zu, weil alle auf die Toilette mußten. Es gab ein paar Töpfe, die vom Einen zum Anderen weitergereicht wurden, in denen jeder seine Bedürfnisse herrichtete; dann wurde der Inhalt durch eine kleine Öffnung in der Tür ausgeschüttet. Trotzdem wurde der Gestank nach und nach unerträglich und es wurde immer schwieriger, zu atmen. Frieda preßte sich an die Wagenwand und an die kleine Luftöffnung heran. Sie konzentrierte ihre Gedanken nur auf Eines: "Ich muß diese schreckliche Situation überleben, um jeden Preis". Nach vielen Reisestunden – niemand wußte genau, wieviel – blieb der Zug stehen und alle mußten unter dem Gebrüll der rumänischen und der deutschen Soldaten aussteigen. Draußen war es kalt und finster. Keiner 56 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 wußte, wo sie sich befanden, sie wußten nur, daß sie irgendwo in der Ukraine waren. Es sprach sich herum, daß sie sich in Ataki befanden, in der Nähe des Flusses Dniester. Plötzlich wurden sie bei lautem Gebrüll durch die deutschen Soldaten aufgefordert, in Richtung des Flusses zu gehen. Die große Menschenmenge begann sich langsam in tiefem Matsch in Bewegung zu setzen, als es gerade anfing zu regnen. Die alten Leute waren nicht in der Lage, ihr Gepäck selber zu tragen und die Kinder hatten nicht die erforderliche Kraft, sich in dem dicken Morrast zu bewegen. Zahlreiche Menschen fielen einfach um und konnten sich nicht mehr aufrichten. Frieda trug ihren Rucksack auf dem Rücken und ihren Koffer in der Hand, in dem sich viele Kleider meines Vaters befanden. Sie ging so rasch wie sie nur konnte, um diese Qual so schnell wie möglich hinter sich zu haben. Die Rosenbaums hielten sich so nah an sie, wie sie konnten. Als sie den Fluß erreicht hatten, wurden die Leute nach und nach in kleine Boote gehievt, um nach Moghilev, auf dem anderen Flußufer, zu kommen. Die Rosenbaums waren in ein Boot gestiegen und riefen Frieda zu, zu ihnen einzusteigen. Sie brachte es nicht fertig, ihre Balance mit dem großen Koffer in der Hand zu behalten und so bat sie einen der deutschen Soldaten, ihr mit ihrem Koffer zu helfen. Er blickte sie eine Weile mit einem bösartigen Grinsen an, dann riß er ihr den Koffer weg und warf ihn auf den Boden, während er sie voran schubste. All ihr geliebtes Eigen lag nun auf dem Schlamm zerstreut. Dies war für sie ein ernüchterndes Erlebnis. Sie begab sich schnell auf das Boot und beobachtete etwas später, wie einige ukrainische Kinder sich auf ihre zerstreuten Sachen stürzten. Ihre Ernüchterung wurde in eine Entscheidung umgesetzt: "Diese Menschen haben vor, uns umzubringen. Ich muß gut auf mich aufpassen. Ich muß überleben und alles tun, was ich kann". Später bemerkte sie zu diesem Vorfall: "Dies war der Augenblick, in dem ich aufgehört habe, naiv zu sein und von da an habe ich mich auf keinen Menschen mehr verlassen. Mein ganzes Leben habe ich ...., ich schulde niemandem etwas". Dies waren Worte, die sie sich selbst und Anderen immer wieder sagte. Als das Boot in Moghilev ankam, fing es an zu schneien und es war eiskalt. Frieda hatte ihren langen Schal, den Baba für sie gestrickt hatte, fest um ihren Körper gewickelt. Ihre Stiefel waren lebensrettend, da sie innen warm gefüttert waren, und sie waren ausreichend dick, um dem Schlamm und dem Wasser standzuhalten. Als sie aus dem Boot ausstiegen, hörten sie wieder das Gebrüll der deutschen und der rumänischen Soldaten; sie wurden wie Tiere auf das Flußufer gepfercht. Gleichzeitig hörte man rundum Leute schluchzen und leise weinen. 57 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Einige waren in den Dniester gefallen und ertranken noch ehe sie in Moghilev ankamen; andere hatten es aufgegeben und blieben im Schlamm liegen, wo sie dann von den Soldaten zu Tode geschlagen wurden. Auch hier waren es die Alten und die Kinder, die als erste mit ihrem Leben zahlten. Onkel Herman hatte sich mit einigen wichtigen jüdischen Persönlichkeiten unterhalten und von ihnen erfahren, daß man Moghilev am besten sofort verlassen solle. Um den heruntergekommenen und völlig erschöpft aussehenden Juden herum, die gerade aus den Booten gestiegen waren, hatte sich ein Ring von kleinen Kutschen, Pferdekarren und ukrainischen Fahrern gebildet. Dort standen sie, grinzend und abwartend. Onkel Herman ging auf einen von ihnen zu und bat ihn, sie nach Murafa zu bringen, ein Dorf von dem er gehört hatte, daß es schön sei, und nicht zu nah an Moghilev gelegen. Die Rosenbaums hatten russische Rubeln dabei und sie zahlten auf der Stelle; nun stiegen die Drei mit Frieda auf den Wagen. Sie saßen sehr eng an einander, aber sie konnten noch zwei Personen mitnehmen; sie sahen ein Ehepaar, daß sie kannten und luden es ein, mit einzusteigen. Alle sechs saßen sie auf dem offenen Wagen, der mit alten Decken bedeckt war, während es den ganzen Weg lang bis nach Murafa auf sie schneite. Doch war Schnee besser als Regen, weil er sie nicht durchnäßte. Während der Reise hielten alle still, außer das bei einigen von ihnen der Magen zu knurren anfing – sie hatten nichts gegessen, seitdem sie aus dem Zug gestiegen waren und sie hatten keine Nahrung mehr übrig. Die Reise dauerte fast die ganze Nacht und sie erreichten Murafa am frühen Morgen. Als der Wagen mitten in dem kleinen Dorf anhielt, unweit einer hübschen katholischen Kirche, kamen weitere Wagen nach, mit noch mehr Leuten. Alle stiegen aus und fingen an, auf und ab zu springen, um Füße und Beine aufzuwärmen und um sich wieder lebendig zu fühlen. Sie wußten, daß sie Glückspilze waren, da Murafa als das Sauberste und das Beste unter den Gettos in Transnistrien galt. Während sie in der Kälte standen, kamen einige rumänische Soldaten an, die sie aufforderten, sich einen Ort zur Übernachtung zu finden und sich am nächsten Morgen zur Arbeit zu melden. Frieda wurde auf eine ukrainische Frau aufmerksam, die sich in ihrer Nähre befand. Sie hatte ein großes Lächeln auf ihrem Gesicht und hielt in ihren Armen ein breites Faß mit heißer Suppe. Die Leute kamen auf die Frau zu und für ein paar Kopeken verkauften sie ihnen eine Tasse Suppe. Auch die Rosenbaums nahen etwas Suppe zu sich; dann flüsterte Frieda der Frau etwas ins Ohr in ihrem gebrochenen Ukrainisch,worauf die Ukrainierin mit einem Lächeln und einem Nicken erwiderte. Alle vier, Onkel Herman, seine 58 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Frau Kutza, Freddy und Frieda, warteten, bis die Frau ihre Suppe ausverkauft hatte, danach folgten sie ihr. Sie führte sie in ihr Haus; dort bat sie ihnen einen kleinen Raum an, der mit einigen auf dem Boden liegenden Matratzen ausgestattet war. Das Zimmer hatte zwei Fenster, wovon das Eine zerbrochen war und durch das ein eiskalter Wind zog. Es gab eine Toilette auf dem Hof, nicht sehr weit weg. Nachdem sie mit der Besitzerin einen Preis für die wöchentliche Miete ausghandelt hatten, begannen sie, sich einzurichten. Onkel Herman benutzte den Deckel einer der Koffer, um das zerbrochene Fenster zuzustopfen. Alle waren erschöpft, doch freuten sie sich darüber, daß sie nun im Liegen schlafen konnten. Sie waren sich alle dessen bewußt, daß sie viel Glück in der Not hatten. Es war ihnen auch klar, daß jeder Pfennig in ihren Überlebensanstrengungen zählte. Meine Mutter zog ihre Stiefel aus und legte sie unter ihren Kopf; sie dachte sich, daß sie solange wie möglich warten würde, ehe sie von dem Geld, das darin steckte, Gebrauch machen würde. Aber sie nahm ein paar Rubel aus dem Mantelfutter heraus für die nächsten paar Tage. Dies war die erste Nacht in Murafa, irgendwann ende Oktober 1941. Frieda verbrachte fast zweieinhalb Jahre in Murafa. Sie wohnte fast ein ganzes Jahr lang mit den Rosenbaums in diesem kleinen Zimmer. Die Hausbesitzerin war eine einsame Frau, dessen Eheman und Söhne im Krieg waren; sie lebte von dem Einkommen der Miete. Am Morgen nach der Ankunft in Murafa wurden alle Juden auf dem kleinen Platz in der Dorfmitte aufgerufen; von dort wurden sie auf verschiedene schwere Arbeiten geschickt. Die deportierten Juden standen zusammengedrängt auf dem Platz, während ortsansässige Ukrainer, die Arbeitskräfte brauchten, sie bemusterten. Unter ihnen befand sich auch der Direktor des kleinen Krankenhauses in Murafa, daß nun für die medizinische Versorgung des rumänischen und des deutschen Heeres zuständig war. Er wurde auf Frieda innerhalb der Menschenmenge aufmerksam – sie war eine hübsche Frau, die jung und gesund aussah und eine gewisse Art von Selbstsicherheit ausstrahlte. Er näherte sich ihr an und sprach sie erst auf Rumänisch und dann auf Deutsch an. Sobald er erkannt hatte, daß sie deutschsprachig war, lächelte er und sagte ihr: "Mir scheint, ich habe etwas Arbeit für Sie im Krankenhaus". Auf diese Weise hatte Frieda das Glück, an eine Arbeit zu kommen, bei der sie sich in einem Raum aufhielt, vor der Kälte geschützt, und wo sie sogar eine Mahlzeit erhielt und sich nach der Arbeit waschen konnte. Anfangs wurde sie gebeten, den Fußboden zu wischen und die Waschräume zu putzen. Dies war eine harte Arbeit für die junge Frau, aber sie war kräftig und gesund, und sie war flink bei der Arbeit. Bald schlug die Chefärztin, 59 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 eine Ukrainerin, vor, daß Frieda ihr Büro und ihren Arbeitsareal in Stand halten solle; so entstand eine gewisse freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Frieda kam sich recht privilegiert vor. In den späten Abendstunden, wenn Frieda zu den Rosenbaums zurückkehrte, brachte sie immer etwas zu essen mit – ezwas Brot oder ein paar Kartoffeln. Die meisten Leute in Murafa leideten an Hunger. Die typische Mahlzeit bestand aus Kartoffelschalen, die zu Suppe gekocht worden waren. Besonders im Winter gab es kein Gemüse und keine Molkereiprodukte. Nur Leute mit guten Beziehungen und etwas Geld konnten hier und da Eier erhalten und manchmal auch etwas Butter. Bald besaß Frieda zahlreiche Beziehungen. Über den ukrainischen Arzt lernte sie den Kommandanten des Gettos in Murafa kennen. Er war ein Deutscher und mochte Frieda beim ersten Blick. Er hatte immer einen Witz oder eine Geschichte für sie parat, wenn er sich ins Krankenhaus begab. Einmal sagte er ihr: "Wenn Sie jemals Hilfe brauchen oder in Not sind, kommen Sie zu mir ins Büro, ich werde meinen Soldaten Anweisungen geben, Sie hereinzulassen". Bald hatte Frieda heraus gefunden, wo man Kleider, Nahrungsmittel, Möbel und Sonstiges erhalten konnte.Die meisten der jungen Männer wurden in Zwangsarbeitlager geschickt, von denen sie nie wieder zurückkehrten. Die Familien, die junge Söhne hatte, lebten in ständiger Angst, daß die Söhne ihnen weggenommen würden. Viele wendeten sich an Frieda, da es sich inzwischen herumgesprochen hatte, daß sie Beziehungen zum Kommandanten hatte. Sie steckten ihr Uhren, Armbänder, Goldmünzen und Diamanten in die Hand, um sie dem Kommandanten zu geben und um sicherzustellen, daß ihr Sohn nicht weggenommen würde. Sie pflegte, sich ins Büro des Kommandanten zu begeben, sich ihm gegenüber zu setzen und ihm die Wertsachen vorzulegen. Dann erwähnte sie den Namen des jungen Mannes und verließ den Raum. Meistens gelang es ihr, diese jungen Männer, für die sie den Familienschmuck und deren Gold abgegeben hatte, zu retten. Es war ein wahres Wunder, wie die armen Leute es fertiggebracht hatten, Wertsachen in ihren Kleidern, Korsetten, Mänteln, Schuhen, Töpfen und Pfannen zu verbergen. Eines Tages hatte Frieda eine aufregende Begegnung mit Tanja, die Ärztin, bei der sie im Krankenhaus arbeitete. Tanja rief sie in ihr Arbeitszimmer hinein und erzählte ihr unter dem Siegel des Geheimnisses, daß sie bald heiraten würde, aber leider kein Hochzeitskleid habe. Friedas Augen funkelten auf – dies war nun die Gelegenheit, ihrer Vorgesetzten behilflich zu sein. Frieda fand eine Ukrainerin, die weißen Leinenstoff vorrätig hatte und eine andere Frau, 60 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 die Schneiderin war. Innerhalb einer Woche erhielt die Ärztin ein wunderschönes Hochzeitskleid und diese Gefälligkeit blieb ihr immer in Erinnerung. Nun hatte Frieda eine Freundin unter den Leitern des Lagers. Viele der Juden himmelten Frieda an, wegen ihrer Geschicklichkeit und wegen ihrer ungewöhnlichen Fähigkeiten; andere wiedrum haßten sie. Die Mitglieder verschiedener Gremien, die für die Judenangelegenheiten gegründet worden waren, die örtlichen Anführer der Religionsgemeinschaften und Andere spürten, daß Frieda ihnen immer mehr im Weg stand. Die Glaubensanführer erwarteten, daß die Leute sich in ihrer Not an sie wendeten. Sie sprachen gegen diese einzelnen Arrangements und privaten Abmachungen, in denen Frieda sich auszeichnete. Gewöhnlich ignorierte sie sie und wenn sie mit dem Thema konfrontiert wurde, sagte sie immer: "Laßt sie ihr Bestes für die Gemeinschaft tun – ich verlasse mich nur auf mich selbst. Also habe ich meine eigenen Beziehungen und meine eigene Art und Weise, die Dinge zu erledigen". Eines Tages kam Frau Druckman, eine ehemalige Nachbarin meiner Großeltern, zu ihr. Ihr Sohn war 30 Jahre alt und bisher hatte er in einer kleinen Schuhfabrik vor Ort gearbeitet. Nun war die Rede davon, daß sie ihn auf ein Zwangslager schicken wollten. Ob Frieda ihn retten könne? Frau Druckman drückte ihr ein wunderschönes Goldarmband in die Hand. Frieda begab sich nochmals zum Kommandanten. Diesmal war er aufgebracht. Er behauptete, diese Leute seien als Arbeitskraft für den Krieg erforderlich und daß sie ihre Aufgabe erfüllen sollten. Wie gewöhnlich legte sie ihm das Armband auf den Tisch und sprach ruhigen Tones den Namen aus. Dann verließ sie den Raum. Sie war unsicher, ob sie dieses mal Erfolg haben würde. Sie begab sich schnurstraks zu den Druckmans. Sie teilte ihnen mit, daß sie nicht sicher sie, den Kommandanten überzeugt zu haben. Daraufhin brachen sie in heftiges Weinen aus und waren sehr bedrückt, doch waren ihr sowohl die Eltern, als auch der junge Poldy Druckman höchst dankbar. Sie baten Frieda, diese Nacht bei ihnen zu verbringen und mit ihnen zu sammen auf den nächsten Morgen zu warten. Poldy und Frieda saßen die ganze Naht durch und unterhielten sich. Frieda erzählte von Willy, der wahrscheinlich tot war, und von ihrer kleinen Tochter, die sie in Czernowitz zurück gelassen hatte. Zwischen den beiden entstand ein besonderes Verständnis füreinander und Verbundenheit. Bei Morgenanbruch hielt Poldy ihre Hand und streichelte sie sanft. Plötzlich hörten sie das Gebrüll der Soldaten, die gerade eine andere Gruppe von jungen Männern abschleppte, um sie ins Zwangslager 61 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 auf der anderen Seite des Bugs zu schicken. Frieda und Poldy saßen umschlungen, mit den Augen auf die Tür gerichtet und erwarteten das Klopfen an der Tür, aber es kam nie dazu. Es war ich also nochmals gelungen, einen jungen Mann zu retten. Nachdem sich alles wieder beruhigt hatte, umarmten und küssten sich die Friedmans und Frieda, und sie waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. In Anerkennung und aus Dankbarkeit bot Frau Druckman Frieda an, zu ihnen einzuziehen. Die Bedingungen dort waren etwas besser als bei den Rosenbaums und letzten Endes nahm sie das großherzige Angebot an. Während der nächsten anderthalb Jahre wohnte Frieda bei der Familie Druckman. Aus der Annäherung, der Angst und den jungen Herzen entstand sehr bald eine Liebesgeschichte. Frieda und Poldy wurden zu einem Liebespaar, und ihre Liebe bereitete ihnen viel Trost in schwierigen Zeiten. Beide arbeiteten mit großem Fleiß und nährten sich von den mageren Mahlzeiten, die die Familie zuammenbringen konnte; aber die Tatsache, daß dauernd die Gefahr über ihnen schwebte, über den Bug geschickt zu werden oder an einer der vor Ort grassierenden Krankheiten zu sterben, und daß sie einander hatten, das alles, gab ihnen Hoffnung für die Zukunft. Frieda und Poldy wußten, daß sie Glück hatten, sich in Murafa zu befinden. An anderen Orten in Transnistrien ging es viel schlimmer zu. In Murafa, wie auch in den anderen Orten, starben zahlreiche Menschen vor Hunger und vor Kälte, und viele wurden über den Bug geschickt. Doch waren die Sanitäts- und allgemeinen Grundlagen dort besser als in all den anderen Orten; dort verbreiteten sich das Typhusfieber und die typhoide Edpidemie nicht so schnell, wie in den anderen Orten. Die meisten der Überlebenden hatten eine feste Arbeiststelle, auf die sie sich täglich begaben; obwohl sie nicht entlohnt wurden, erhielten sie eine Bleibe für ihre Arbeit. Nahrungsmittel, obwohl nur wenig vorhanden war, waren bei den ukrainischen Bauern erhältlich, für Geld oder im Tauschhandel; viele der Juden hatten etwas Geld und Wertsachen mitgebracht. Frieda gab fast sämtliche Rubel aus,die in ihrem Mantel eingenäht waren, aber die Dollarnoten in ihren Stiefeln behielt sie bis zum Ende. Die Zeit verstrich und Nachrichten von der Front erreichten die kleinen Gettos in Transnistrien. Die deutsche Niederlage in Stalingrad gab allen erneut Hoffnung. Die Deustchen jedoch brachten Juden immer weiter um, in dem sie sie über den Bug warfen, in Zwangsarbeitlager schickten oder einfach diejenigen erschossen, die sich nicht an die Anordnungen hielten. 62 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Poldy hatte zwei gute Freunde, die unbedingt versuchen wollten, aus Transnistrien zu flüchten. Sie hatten das Gefühl, daß es sie ihr Leben kosten könne, wenn sie dort bis zum Ende blieben; im Winter, wenn die Deutschen selber zu abgeschwächt und unglücklich, und die Rumänen ihrereseits zu faul waren, um genau aufzupassen, wollten sie den Versuch machen, auszubrechen. Der Plan war, daß alle Vier, Poldy, seine beiden Freunde und Frieda, sich zusammen auf die Flucht begeben sollten. Frieda war die einzige Frau in der kleinen Gruppe, aber alle schätzten ihre Fähigkeiten und ihre praktische Denkweise und hatte das Gefühl, daß sie für die Gruppe ein Trumpf sei. Während die Deutschen und die rumänischen Soldaten Silvester im trinken feierten, machten sich die Vier anfang Januar 1944 auf den Weg. Zu diesem Anlaß hatte Frieda die Dollarnoten aus ihrem Stiefel herausgenommen und wechselte den größten Teil davon in Rubel ein. Es war ein kleiner Schatz, der für einige Zeit halten würde. Mit kleinen Rucksäcken auf ihren Schultern gingen die Vier erst zu Fuß los, dann mit einem Pferdekarren und schließlich auf einem Lastwagen, auf dem Weg nach Czernowitz, das zu dieser Zeit gerade schwere Bombenangriffe von den Deutschen, die auf dem Rückzug, und von den Russen, die auf dem Einzug waren, erlitt. Sie bezahlten jedesmal für ihre Mitreise und wurden von niemandem mit Fragen belästigt. Die Bauern wußten sehr wohl, daß Deutschland dabei war, den Krieg zu verlieren, und selbst wenn sie erraten hätten, daß diese Leute Juden waren, die auf der Flucht aus einem Lager in Transnistrien waren, war das Geld das Einzige, was sie interessierte. Als die Vier an einem kalten Januar Nachmittag in Czernowitz ankamen, beschlossen sie, daß jeder diejenigen seiner Familienangehörigen, die in der Stadt geblieben waren, aufsuchen würde und versuchen sollte, dort die Nacht zu verbringen. Abgemacht war, daß sie sich am nächsten Morgen treffen und zusammen nach Süden weitergehen, in Richtung Bukarest. Dies ist der Grund, warum Frieda nur diese eine Nacht mit Baba und mir verbrachte, etwas Geld hinterließ und am nächsten Morgen wieder aufbrach. Sie hatte einen Liebhaber, sie hatte einen engen Freundeskreis, der Krieg war bald zu ende und sie hoffte, sich eine neue Existenz aufzubauen. Sie war davon überzeugt, daß mein Vater im Krieg gefallen war. Und wo kam ich vor, in diesen Plänen? Wahrscheinlich wußte sie nicht, wie sie mich einbringen sollte und es schien ihr das Beste zu sein, mich bei Baba zu lassen, die sich so gut um mich gekümmert hatte und die nun in Sicherheit in der alten Wohnung auf der Franzensgasse war. 63 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapite 10 Willy Mein Vater, Willy, wurde im März 1941 von der Roten Armee einbezogen. Er wurde zu Militärübungen in ein großes Militärlager am Rande von Rosch geschickt, wo meine Mutter Frieda und ich ihn jeden Sonntag besuchten. Beide freuten wir uns jedesmal auf diese Besuche; oft brachten wir ihm etwas leckeres zu essen mit und manchmal gab meine Mutter ihm auch einige Bücher zum lesen. Er hatte schon immer gerne Bücher gelesen und Geschichten erzählt. Der lange Weg von unserer Wohnung aus nach Rosch war angenehm, da wir jedesmal im Schillerpark Halt machten, wo ich etws Zeit hatte, um herumzulaufen und zu spielen. Am Sonntag den 22. Juni sollten wir wie immer meinen Vater besuchen kommen, aber die Geschichte bereitete uns eine große Überraschung vor. Am Samstag, den 21. Juni 1941, spielten die ukrainischen und die jüdischen Soldaten Fußball, mit den üblichen Zankereien und Wettrennen. Es war ein sonniger Nachmittag und alle befanden sich draußen auf dem Feld. Willy stand wie immer in der Mitte. Inzwischen hatten alle Soldaten herausgefunden, daß er besonders stark und bei kräftiger Gesundheit war. Als geübter Turner machte er regelmäßig seine Übungen auf den Stangen. Plötzlich kehrten sich die üblichen Hänseleien der Ukrainier um in einen regelrechten Angriff gegen die Juden. Antisemitische Hetzparolen wurden herumgeworfen und die Spannung stieg an. Einer der Ukrainer ging auf den jüdischen "Anführer" zu und sagte: "Ihr Juden, ihr redet viel, aber eigentlich seid ihr doch nur Feiglinge. Laßt uns doch sehen, ob einer von euch dazu fähig ist, Sascha, unseren starken Mann, zu fassen. Wetten, daß ihr niemanden habt, der sich mit ihm messen kann". Sascha war 1,80 m. groß, ein Schwergewicht mit aufbrausendem Charakter. Die Juden blickten ihn an und baten um etwas Zeit, um sich untereinander zu beraten. Sie entfernten sich, stellten sich im Kreis, auf Deutsch flüsternd und berichteten einander über ihre Besorgnis. "Was machen wir jetzt? Wenn wir uns jetzt nicht auf die Konfrontierung mit Sascha einlassen, werden sie nie Ruhe geben. Wer kann ihm standhalten?" Dann rief einer der Männer laut: "Willy, du bist zwar sehr viel kleiner als Sascha, aber du bist der Stärkste von uns allen; was sagst du dazu?". Willy blickte ihm mit einem großen Lächeln entgegen. "Natürlich, es wird genauso wie bei David und Goliath aussehen, und das Ende der Geschichte kennst du ja". Willy schaute blickte etwas bedrückt 64 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 nach Sascha, aber er wußte, daß er seine Freunde jetzt nicht im Stich lassen konnte. Ihre Ehre lag jetzt in seinen Händen. Sobald Willy sich bereit erklärt hatte, sich auf den Kampf einzulassen, begannen die Soldaten zu jubeln und alle rannten sie auf das offene Trainiergelände. Sie stellten sich in einen breiten Zirkel auf und machten Sascha und Willy in der Mitte Platz. Willy und Sascha begannen, miteinander zu kämpfen. Sascha war zwar stark, aber Willy war sehr flink und verstand es, den heftigen Hieben auszuweichen. Die Ukrainer riefen ihrem Held Unterstützungsrufe zu, während die Juden ruhig blieben, ohne wirklich daran zu glauben. Nach einer Weile begannen sie jedoch "Willy, Willy" zu brüllen. Dies gab meinem Vater einen neuen Anstoß von Energie und plötzlich packte er Sascha im Zangengriff mitten im Körper und hob ihn in die Luft. Sascha schrie auf und fiel besiegt zu Boden, aber diesmal wich Willy nicht schnell genug aus und der große Ukrainer landete auf seinem linken Bein. Die ganze Ansammlung der Soldaten brüllte wild "Willy, Willy" und Sascha entfernte sich mismutig. Als die jüdischen jungen Männer auf ihn zukamen, um ihn abzuholen und um im ihre Freude zu bekunden, wurde ihnen auf einmal bewußt, daß er unter fürchterlichen Schmerzen litt. Sein Fuß war am Knöchel gebrochen. Willz wurde ins Lazarett gebracht und sein Bein wurde mit einer Schiene stillgelegt. Der Arzt sollte am nächsten Morgen kommen und dann entscheiden, was gemacht werden sollte. In der Zwischenzeit brachten sie ihm eine Flasche Wodka, um die Schmerzen zu stillen und seine Laune aufzubessern. Obwohl er bis dahin nie starken Alkohol getrunken hatte, nahm er ein ganzes Glas zu sich und fühlte sich danach gleich besser. All seine jüdischen Freunde saßen um ihm herum und strahlten vor Freude. Es war so herrlich, daß er diese bösen ukrainischen Schweine besiegt hatte. Und für eine kurze Weile war Willy der Held seiner Heereseinheit. Als es Nacht wurde und er von dem Wodka betäubt war, gelang es Willy, trotz Schmerzen etwas Schlaf zu finden. Gegen 5 Uhr morgens brach plötzlich die Hölle aus. Die ganze Gegend stand unter Bombenangriff und die Geschosse flogen durch die Gegend. Das ganze russische Militärlager geriet in Panik. Bald wurden Anweisungen ausgeteilt und man beschloss, das Lager sofort völlig zu evakuieren. Sämtliche Soldaten, die jüdische Truppe aus Czernowitz inbegriffen, wurden in den Zug gesetzt und weit weg ins Landinnere nach Rußland geschickt. Alle außer Willy, der mit dem Feldlazarett in ein Militärkrankenhaus in die Stadt Gorky geschickt wurde, weit entfernt von der rasch voranschreitenden Front. 65 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Die Artillerie und die Bombenangriffe wurden immer heftiger; bei Tagesanbruch wurde der Zug mit den jüdischen Soldaten getroffen und restlos zerstört. Sämtliche Passagiere kamen um, unter ihnen auch die jüdischen jungen Männer aus Czernowitz. Nur einem einzigen jüdischen Mann gelang es, zu überleben; er kam in die Stadt zurück und teilte allen mit, daß die jüdische Truppe verschollen war; dabei wußte niemand, daß Willy nicht in diesen Zug mit eingestiegen war. Was an diesem Sonntag den 22. Juni passiert war, war der Anfang der "Aktion Barbarossa", der deutsche Kodename für den Einmarsch in die Sowjetunion. Der Angriff der Deutschen überraschte die russische Armee. Die Geschwindigkeit und die Gewalt des Angriffs zerstörten die Abwehrpläne der Russen ganz und gar. Ein schneller Rückzug war unumgänglich. Willy kam in ein großes Militärlager in der Nähe der Stadt Gorky. Es lag weit weg von der Front und die Soldaten trainierten dort und bereiteten sich auf einen brutalen Krieg gegen das voranschreitende deutsche Heer vor. Er wurde ins Militärkrankenhaus eingeliefert, daß wesentlich besser ausgestattet war als das, was es in Rosch gab. Sein Bein wurde eingegipst und man gab ihm ein paar Holzkrücken. Er ahnte nicht, was mit seinen Freunden geschehen war. Um ihm herum sprachen alle ausschließlich Russisch. Obwohl seine Russischkenntnisse rudimentär waren, entdeckte er bald die russische Bibliothek im Lager; auf diese Weise begann er, auf Russisch zu lesen - erst Magazine, dann Bücher. Nach und nach erweiterten sich seine Russischkentnisse und er gewann neue Freunde unter den Leuten, die ins Lazarett hinzukamen. Er hatte keine Nahricht von seiner Familie. Er schickte zwar mehrere Briefe an Frieda, aber sie kamen nie an und bald gab er jede Hoffnung auf. Nach dem, was er erfahren hatte, stand für ihn klar, daß die Deutschen alles, was sie nur konnten, verbrannten und sämtliche Juden auf ihrem Weg umbrachten. Daher dachte er, daß seine Familie keine Überlebenschancen hätte. Das Lazarett wurde von einer Ärztin geleitet, eine strenge Frau, die sich ganz auf ihre Arbeit konzentrierte. Doch bald fing sie an, sich für den hübschen jungen Mann zu interessieren, der mit der russischen Sprache ringte. Ihr fiel auf, daß er lateinische Vokabeln mit großer Leichtigkeit ablesen konnte; noch ehe sein Bein wieder heilte, bat sie ihn, für sie im Lazarett zu arbeiten. So wurde Willy zum Feldscher15 ernannt. Er schrieb die Namen der verschiedenen Medikamente ab und führte täglich Buch über die eintreffenden und herausgegebenen Arzneimittel. Er hatte eine 15 Handwerksarzt beim Heer oder ungelernter Azt. 66 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 schöne Handschrift und seine Chefin war sehr zufrieden mit ihm. Sie begann, ihn zu mögen und vertraute ihm die ganze Ausstattung und die Arzneimittel im Lazarett an. Gegen ende Oktober 1941 war sein Bein geheilt, aber er hinkte immer noch und brauchte einen Gehstock, um sich zu bewegen. Er arbeitete weiterhin im Lazarett. Dies waren Willys schönste Monate im Heer. Er mußte sich nicht, wie die anderen Soldaten, stundenlang draußen in der bitteren Kälte aufhalten und hatte viel Zeit zum Lesen. Das Essen im Lazarett war besser als das, was das gewöhnliche Heer erhielt und meistens durfte er die Nacht durchschlafen. Willys russische Freunde fanden ihn sehr sympathisch. Gewöhnlich überließ er ihnen seine Portion Wodka und in manchen Fällen, wenn jemand einen ganz besonderen Drang nach Alkohol empfand, erlaubte er demjenigen, sich etwas Alkohol aus der Lazarettapotheke zu Gemüte zu führen. Bald hatte er bereits viele russische Lieder gelernt und jeden Abend baten ihn seine Kumpel, halb nüchtern, halb besoffen, für sie zu singen. Monate verstrichen, die Kriegsfront lag immer noch weit weg. Was war wohl aus Czernowitz geworden? Was war aus seiner Frau und seiner Tochter geworden, die er dort hinterlassen hatte und zu denen er jetzt keinerlei Kontakt hatte? Er wußte überhaupt nichts, außer, daß die Kämpfe in der Ukraine sehr heftig gewesen waren. Alle wußten jedoch, daß das deutsche Heer jetzt im russischen Winter festhing und nicht in der Lage war, plangemäß voranzuschreiten. Die enormen Verluste des deutschen Heeres und die Schwierigkeiten in Rußland, seit der Aktion Barbarossa, hatten Hitler trotzallem nicht von seinen Plänen abgebracht. Bei Anbruch des Frühlings im Jahre 1942 wurde klar, daß die Deutschen ihren Blitzkrieg wieder aufnehmen würden. Willy wurde klar, daß er nicht ewig im Lazarett bleiben könnte; da er noch jung und gesund war, würde man ihn bald wieder an die Front schicken. Im Mai 1942 wurde er einer Artillerieeinheit zugeteilt und er begann ein intensives Training. Die schönen Tage waren nun vorbei. In der Artillerieeinheit war das Training hart. Die Soldaten wurden jeden Morgen um 4 Uhr aufgeweckt. Man verteilte ihnen je eine große Schüssel heißer Suppe mit Speck, dann wurden sie zum Trainieren bis zum Sonnenuntergang herausgeschickt. Anfangs konnte Willy am frühen Morgen diese dicke Suppe nicht anrühren, aber dann stellte er sehr schnell fest, daß es den ganzen Tag nichts anderes zu Essen gab und so lernte er bald, diese Morgensuppe zu "genießen". Im Juni 1942 traten die Deutschen eine neue Offensive an und gingen rasch auf Stalingrad zu. Es wurden Einheiten aus dem Militärlager bei Gorki als Stützkräfte für das russische Heer zur Abwehr Stalingrads 67 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 geschickt. Im Oktober 1942 wurde Willys Artilleriebattalion in Richtung Stalingrad abkommandiert. Anfangs hielt seine Einheit sich in einer kleinen Baracke auf, etwas abseits von der Front, wobei Russen und Deutsche in direkter Nähe gegeneinander kämpften. Die Wochen verstrichen und es wurde immer kälter. Die Soldaten saßen dich aneinander gedrängt in der Baracke; abends tranken sie ihre Ration Wodka und sangen dabei Lieder. Dann endlich, im Dezember, wurden sie näher an Stalingrads Vororte geschickt. Die Kämpfe waren heftig und sie konnten mit eigenen Augen sehen, wie die Stadt zu einem Trümmerhaufen geworden war. Die russischen Soldaten verschanzten sich in tiefen Gräben, die die ganze Stadt umringten, und legten Baumäste zur Vertarnung über den Graben. Der Schnee hatte alles überdeckt und hielt sie irgendwie warm innerhalb ihrer in der Erde gegrabenen Löchern. Während sie dort saßen, sich beim Artilleriekampf gegen die Deutschen ablösend, konnten sie sogar die deutsche Soldaten hören, die sich in ihren Gräben oder in den Einhöhlungen unter zerfallenen Häusern befanden. Oft riefen die Deutschen den russischen Soldaten auf Deutsch über Lautsprecher zu: "Ihr tapferen russische Soldaten, Deutschland ist nicht euer Feind! Ergebt euch und wir werden dafür sorgen, daß ihr ein viel besseres Leben führen könnt als unter eurer Bolschevikenregierung". Willys Kumpanen baten ihn jedesmal, die deutschen Parolen für sie zu übersetzen, dann brüllten sie den Deutschen entgegen: "Wir werden uns niemals ergeben! Wir werden euch einer nach dem anderen umbringen!". Manchmal ließen die Deutschen Musik mit deutschen Liedern spielen und Willy hörte mit Freude hin und summte leise mit. Täglich kamen immer mehr Russen und Deutsche unter den Bomben, den Splittern und durch Scharfschützen beider Seiten um. Aber die wirklichen Feinde der deutschen Soldaten waren die Läuse und die extreme Kälte. Sie waren nicht an dermaßen rauhe Umstände gewohnt und viele unter ihnen brachen einfach zusammen. Eines Tages hörte Willy, daß die Deutschen ihren Posten in seiner Nähe verlaßen hatten. Er wartete ab, bis alle ganz still wurde, steckte seinen Helm auf die Spitze seines Gewehrs auf, als ob er auf seinem Posten Wache halten würde und kroch auf allen Vieren zu dem verlassenen deutschen Posten über. In der Tat fand er dort, so wie er es gehofft hatte, eine Felddusche und ein paar deutsche Zeitungen. Er fand sogar ein Badetuch, etwas Seife und saubere Unterhosen. Welch eine Freude! Nun konnte er endlich mal wieder duschen, nach all diesen Wochen in denselben Kleidern. Er nahm sich viel Zeit und genoß das fließende Wasser, das Gefühl der Freiheit und der Sauberkeit. Er vergaß ganz und gar das unaufhörliche Geschiesse und die 68 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Bombardierung rund um ihn herum; nachdem er sich wieder angezogen hatte, erfrischt und sauber, setzte er sich hin, um ein paar Zeitungen, die dort herumlagen, zu lesen. Es bereitete ihm eine große Freude, die deutschen Worte zu lesen. Es erinnerte ihn an alte Tage, die er fast schon vergessen hatte. Schließlich raffte er sich zusammen, die Annehmlichkeiten des deutschen Postens aufgebend und kroch vorsichtig zu seinem Posten zurück. Er inspizierte seinem Helm, der immer noch dort war, wo er ihn gelassen hatte, aber mit einm Loch in der Mitte des Helms. "Nochmal knapp davongekommen!" dachte er für sich. Mehrere Tage später erhielt Willys Einheit die Erlaubnis, sich in ihre Baracke zurückzuziehen, außer Reichweite der Front, um sich für ein paar Tage auszuruhen. Sie stießen auf einen fürchterlichen und massiven Artilleriebeschuß von Seiten der Deutschen und die Barracke erlitt einen Volltreffer. Nachdem sich alles beruhigt hatte, waren einige der Soldaten tot, einige waren verwundet und Willy war genau in der gleichen sitzenden Position geblieben. Plötzlich durchlief ihn ein heftiger Schmerz genau an der Stelle, an der er sich das Bein in dem Kampf gegen Sascha, den großen Ukrainer, gebrochen hatte. Er betrachtete sein Bein in dem dicken Winterstiefel und konnte nichts sehen. Er machte einen Versuch, sein Bein zu heben, wobei er durch den unerträglichen Schmerz in Ohnmacht fiel. Als Willy aus seiner Ohnmacht wieder aufwachte, lag er in einem Krankenwagen, der ihn schnellstens in ein Feldlazarett beförderte. Die Schmerzen im Bein waren heftig. Er blickte auf sein Bein hinunter und stellte fest, daß sein Stiefel und die Socke entfernt worden waren. Sein Bein war angeschwollen und er nahm auf jeder Seite seines Knöchels eine kleine Wunde wahr, beide in perfekter Symmetrie zueinander. Der Sanitäter, der neben ihm saß, lächelte: "Ja, ist das nicht komisch? Der Splitter ist zu einer Seite eingedrungen und zur anderen wieder herausgekommen". Im Krankenhaus herrschten arge Zustände. Hunderte von Betten standen eng aneinander aufgereiht, von stöhnenden Soldaten besetzt, die von einigen wenigen Krankenschwestern verpflegt wurden. Willy wurde ins Operationssaal-Areal gebracht. Er wurde von zwei Chirurgen untersucht. Sie waren flink und trafen rasche Entscheidungen. Sie waren sich darüber einig, daß Willy sofort operiert werden müsse; dabei sagte der Ältere: "Wir müssen ihn amputieren", worauf der jüngere Chirurg wiederholt betonte: "Er ist noch so jung, versuchen wir es doch, sein Bein zu retten". Während diese Sätze in seinen Ohren widerhallten, verfiel Willy der Narkose-Gasmaske. Einige Stunden später wachte er mit dem 69 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 panikerregenden Gedanken auf: "Mein Bein ist weg!" Er streckte die Hand in Richtung seines verletzten Beines und spürte den kalten Gips. Er beruhigte sich – ein Gips bedeutete ja, daß das Bein gerettet worden war. Die Genesung war langsam, aber im Vergleich zu all den schrecklichen Verletzungen, die er um ihn herum wahrnahm, war Willy sich dessen bewußt, daß er sehr viel Glück gehabt hatte. Bald fing er an, sich auf Krücken herumzubewegen; er erzählte den Soldaten schöne Geschichten und sang mit ihnen Lieder. Das Wichtigste für ihn war, daß er nicht mehr nach Stalingrad zurückkehren müßte. Für ihn war der Krieg zu ende. Im Februar 1943, zwei Monate nachdem Willy verwundet worden war, gelang es den Russen, Stalingrad zu befreien. Willy ging nun mit einem Spazierstock und fühlte sich wieder in gutem Zustand. Der Offizier, der für die Entlassung der verwundeten Soldaten aus dem Krankenhaus zuständig war, lud ihn zu einem Gespräch vor. Er sagte: " Soldat, du hast deine Aufgabe erfüllt, nun wollen wir dich entlassen. Was möchtest du machen?" Willy mußte bei dieser Äußerung lächeln. Er wußte sehr wohl, daß Veteranen, oder wer auch sonst immer, in der Sowjetunion weder frei herumreisen, noch das machen konnten, was sie wollten. Man mußte sich mit dem zufrieden geben, was einem angeboten wurde, sonst lief man die Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten. Außerdem ging der Krieg an der ganzen Westfront entlang noch immer weiter. Trotz allem beschloß er, den Offizier um einen persönlichen Gefallen zu bitten. Willy hatte von der neuen Untergrundbahn gehört, die in Moskau gebaut wurde; er bat darum, dorthin geschickt zu werden, wo er seine Fachkenntnisse in Marmorverarbeitung anwenden könne. Der Offizier lächelte und gab ihm einen Zettel und Anweisungen, mit dem Zug in ein kleines Dorf nach Osten zu fahren. Willys Bitte war scheinbar nicht beachtet worden. Er hatte nun keine andere Wahl, als den Anweisungen zu folgen. Er kam in den ersten Stunden des Nachmittags in diesem Dorf an und begab sich sofort zu dem zuständigen "Nachalnik"-Offizier. Der Mann bemusterte ihn und seine Papiere und befahl ihm, sich hinzusetzen und zu warten. Bald kehrte er zurück, in der Gesellschaft einer älteren, streng aussehenden Dame. Die Frau streckte ihm die Hand zu und stellte sich vor: "Ich bin die Direktorin der örtlichen Oberschule", sagte sie; dann fügte sie hinzu: "Und wir brauchen Lehrer. Was können Sie unterrichten?" Willy überlegte eine Weile, dann sagte er: "Vielleicht Zeichnen?" Die Frau lächelte wieder und sagte: "Gut, aber Sie sprechen auch Deutsch und wir wollen, daß sie unseren Jungen Deutsch 70 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 beibringen". Danach erklärte sie ihm, daß das Dorf sich in einer sehr schwierigen Lage befände, da es keine Männer gab, um die Arbeit auf den Feldern und in den Werkstätten zu verrichten. Die Frauen taten ihr Bestes, die Arbeit zu erledigen, aber es fehlte an Nahrungsmitteln und Geld. Sein Gehalt könne nicht in bar ausgezahlt werden, aber man würde ihm Holz zum Heitzen geben. Das Holz könne er zur Zahlung von Zimmermiete und Versorgung in einem örtlichen Haushalt benutzen. Gerade als sie dabei war, ihm zu zeigen, wo er sich seine Ladung Holz holen sollte, kam eine lächelnde, kleinwüchsige junge Frau auf ihn zu: "Ich habe ein hübsches Zimmer für Sie und ich kann für Sie kochen". Sie hatte ein freundliches Lächeln und ihre braunen Augen funkelten, und so ging Willy hinter ihr her. Sie stellte sich als Natascha vor. Natascha führte Willy in ihr kleines Haus. Es war ein Bauernhaus, von einem Hof umringt, mit ein paar Hühnern, die frei herumliefen. Drinnen gab es ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche mit einem Ofen, in den Natascha die Holzstücke, die Willy mitgebracht hatte, sofort hineinwarf. Der Raum wurde warm und gemütlich. Natascha zündete ein paar Kerzen und eine Öllampe an. In dem Haus gab es weder ein Badezimmer, noch eine Toilette, aber draußen auf dem Hinterhof gab es ein kleines Toilettenhaus. Die Frau kochte Willy etwas Suppe und schnitt eine dicke Scheibe von dem schweren Schwarzbrot für ihn ab. Sie setzte sich hin und schaute ihm beim Essen zu. Er fragte, ob sonst noch jemand in dem Hause lebe; sie erklärte ihm, daß ihr Mann in den Kämpfen um Stalingrad umgekommen war, daß sie keine Kinder hatten und sie alleine in dem Haus lebte. Natascha zeigte Willy sein Zimmer, das mit einem bequemen Bett mit einem Schlafanzug, der ihrem Mann gehört hatte, ausgestattet war. Es gab einen kleinen Schrank, in dem er seine Sachen aufbewahren könne. Er blickte sie an und sagte: "Das ist wirklich sehr schön; ich glaube, ich werde es hier sehr bequem haben. Aber da ist etwas, das ich unbedingt nötig habe: ein heißes Bad". Sie lächelte verlegen und lief nach draußen, dann kehrte sie zurück mit einem großen Holzbottich, in dem man bequem sitzen konnte. Sie holte Wasser von dem Brunnen, füllte es in mehrere große Töpfe, die sie auf den Herd stellte. Im Nu war der Bottich mit heißem Seifenwasser aufgefüllt, mit einigen daneben gelegten Badetüchern. Natascha kündigte Willy an, daß er nun sein heißes Bad haben könne und daß sie sich solange in ihrem Zimmer aufhalten würde. Willy zog seine schwere Uniform aus und setzte sich ins heiße Wasser. Welch eine Genuß! Er entspannte sich und genoß die Wärme, die durch seinen ganzen Körper strömte. Nachdem er sein Bad beendet hatte, zog er 71 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 den Schlafanzug an und kroch in sein Bett hinein. Er fühlte sich wie ein neuer Mensch. Die einfachen Dinge des Lebens konnten so herrlich sein. Er wollte überhaupt nicht mehr an den Krieg denken. Er schlief lächend ein. Einige Stunden später wachte Willy plötzlich auf. Natascha, in dünnem Nachtkleid, war zu ihm ins Bett gekrochen und lag kauernd neben ihm. Es war lange her, seitdem er mit einer Frau zusammengewesen war. Er hatte fast vergessen, wie es sich anfühlt. "Hier wird das Leben schön sein" flüsterte er zu sich auf Deustch. Die Tage verstrichen angenehm. Morgens unterrichtete Willy Deutsch und Zeichnen. Es machte ihm wenig Spaß. Seine Schüler waren eingebildet und lernten nicht von sich aus. Während des Unterrichts mußte er für Beschäftigung sorgen und ihr Interesse erwecken, da sie keinen Spaß am Studieren hatten. Jeden Morgen brachten sie ihm die letzten Nachrichten zu den foranschreitenden Krieg. Die Russen drängten die Deutschen immer wieder in den Rückzug. Viele seiner Schüler spielten mit dem Gedanken, bald zur Armee zu gehen. Nach dem Unterricht machte er lange Spaziergänge in den Wäldern in der Umgebung des Dorfes. Sein Fuß tat noch immer weh, aber es wurde immer besser. Abends verbrachte er die Zeit mit Natascha. Sie wollte ihm gefällig sein und machte alles für ihn. Sie war eine gute Köchin und ein warmherziger und liebevoller Mensch. Er war glücklich und dachte sich, daß er vielleicht länger in diesem kleinen Dorf bleiben würde. Er war sich ziemlich sicher, daß seine Familie in Czernowitz umgekommen war und daß es ihn daher nicht dorthin drängte. Ein ganzes Jahr verstrich. Die russische Armee hatte die Überhand an sämtlichen Fronten. Mehr und mehr Städte wurden befreit; im April 1944 hörte Willy, daß Czernowitz und die Bukowina befreit worden waren und die Nord-Bukowina an die Sowjetunion zurückgegeben worden war. Ob er sich die Mühe machen sollte, eine Genehmigung zu beantragen, dorthin zu reisen und seiner Geburtsstadt einen Besuch abzustatten? Nach dem, was er aus den Nachrichen entnommen hatte, war er sicher, daß seine Familie umgekommen war. Er sah keinen Grund, Natascha und sein bequemes Leben aufzugeben. Dann, eines Tages, gegen Ende des Sommers 1944, kam ein Bote der Roten Armee und bat darum, mit Willy zu sprechen. Sie saßen im Wohnzimmer und Natascha servierte ihnen heißen Tee aus dem Samovar. Der Bote schaute umher und seufzte tief: "Ich sehe, Sie führen hier ein 72 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 bequemes Leben als Paar. Nun ja, es tut mir leid, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Hier ist ein Brief von Ihrer Familie aus Czernowtzy (Russisch für Czernowitz)". Nataschas Hände begannen zu zittern und sie war nicht mehr im Stande, ihre Tasse Tee in der Hand zu halten. Willy nahm den Brief gelassen entgegen und las ihn durch, ohne ein Wort zu sagen. Es war der Brief meiner Baba, in dem sie ihm mitteilte, daß ich am Leben war und daß es mir gut ging, daß ich mit ihr und Großvater in unserer Wohnung auf der Franzensgasse lebte, und das meine Mutter das Konzentrationslager überlebt hatte und nach Bukarest geflüchtet war. Sein Herz sprang auf – sie hatten überlebt, seine Frau und sein Kind lebten, aber an getrennten Orten. Konnte er jetzt zurückkehren und seine Familie wieder zusammenbringen? Konnte er Natascha verlassen und sein jetztiges Leben vergessen? Willy blieb eine Weile ganz still, dann blickte er auf auf Natascha und sagte: "Nun, meine Familie hat den Krieg überlebt. Ich muß mit meiner Familie reden". Der Militärbote verließ das Haus, nachdem er Natascha einen mitfühlenden Blick zugeworfen hatte. Sobald er weggegangen war, rannte Natascha zu Willy in Tränen. Er versuchte, sie zu besänftigen und sagte: "Ich werde nicht sofort losgehen, aber ich denke, ich muß dorthin und sie sehen, vielleicht in ein paar Wochen". Dies war typisch für Willy: "Schwere Entscheidungen muß man nicht sofort treffen, man kann es langsam auf einen zukommen lassen!" Eines Tages im Oktober 1944 stand Willy am Eingang der Wohnung auf der Franzensgasse, seine kleine Tochter betrachtend. . 73 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 11 Die große Enttäuschung meines Vaters Die ersten paar Tage nach der Rückkehr meines Vaters waren schmerzvoll. Er schaute mich betroffen an und gab seiner großen Enttäuschung Ausdruck: "Wo ist das süße kleine Mädchen, daß ich hier hinterlassen habe, als ich zur Armee gegangen bin? Sie war so aufgeweckt, fröhlich und voller Leben". Dann schaute er Baba an und sagte: "Ich kann es kaum glauben, daß dieses blasse, traurig blickende und dürre Mädchen Littika ist". Er betastete meine dünnen Zöpfe mit einem Ausdruck, der mir wie Ekel vorkam. Er betrachtete meine Kleider und sagte, daß wir unbedingt neue, für eine Sechsjährige passende Kleider kaufen müssten. Schließlich, nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, begann er, seine Geschichten über den Krieg und seine Verwundungen zu erzählen. Alle staunten, als sie hörten, wie er zweimal genau an der gleichen Stelle an seinem linken Knöchel verletzt wurde. Viele Menschen suchten ihn auf und behandelten ihn wie einen Held. Ich bemühte mich dabei, diese Ereignisse zu genießen, aber die meiste Zeit fürchtete ich mich, irgend etwas zu sagen, daß ihn noch mehr enttäuschen könnte, also blieb ich still. Der Winter war kalt; endlich erhielt ich warme Kleider, die Baba und mein Vater für mich gekauft hatten. Nun konnte ich das Haus verlassen, um mit meinem Vater spazieren zu gehen; einmal nahm er mich sogar ins Kino. Es war das erste mal, daß ich einen Film sah und ich war sehr aufgeregt, fühlte mich aber noch immer verlegen und benommen in der Anwesenheit meines Vaters. Ich wußte nicht, was er von mir erwartete und wie ich mich verhalten sollte, und schämte mich zu sehr, um ihm zu sagen, wie es mir erging. Ich konnte ihm nicht einmal mitteilen, daß ich Hunger hatte oder daß mir kalt war. Ich saß einfach neben ihm un hörte zu, wenn er zu mir sprach. Dann geschah etwas ganz schlimmes: gerade als der Film begann und ich von dem Film hingerissen war (er war in russischer Sprache, die ich nicht verstehen konnte, doch konnte ich den Bildern entnehmen, worum es ging), mußte ich plötzlich ganz dringend auf die Toilette gehen. Es war mir ganz und gar unmöglich, irgend etwas davon meinem Vater mitzuteilen; also hielt ich meinen Atem an und versuchte, mich zurückzuhalten. Ich spürte, daß ich bald platzen würde und ehe ich mir dessen bewußt wurde, spürte ich auf einmal den warmen Urin an meinen Beinen und auf den Sitz hiunter laufen. Es war sehr dunkel im Kino und man hörte nur den Film. Niemand sah oder hörte, 74 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 was mir passiert war, und mein Vater, der neben mir saß, schon gar nicht. Ich änderte leicht meine Haltung und entspannte mich. Welch eine Erleichterung! Ich war entsetzt bei dem Gedanken, daß er es herausfinden könnte, aber gleichzeitig fühlte ich mich wohl. Bald schlug das Wärmegefühl in eiserne Kälte um. Mir frierte an den Beinen und mein Rock wurde ganz steif, aber ich ignorierte es. Der Film war lang und ich gewöhnte mich nach und nach daran, etwas naß zu sein. Als der Film zu ende war, standen wir auf, um aufzubrechen. Ich zog meinen langen Mantel an, der alles verbarg. Mein Vater sagte nichts und ich auch nicht. Wir gingen auf die Straße hinaus. Nun fror ich wieder. Wir stiegen in die Straßenbahn und fuhren nach Hause. Als ich in die Wohnung eintrat, lief ich zu Baba und erzählte ihr, was passiert war. Ich erfuhr niemals, ob mein Vater etwas von meiner schrecklichen Qual gemerkt hatte. Eines Tages erhielt meine Vater einen Brief mit einer Vielzahl von Briefmarken auf dem Umschlag. Er öffnete schnell den Brief und las ihn mehrmals durch. Dann rief er Baba und bat sie, sich hinzusetzen. Ich saß still in meiner Ecke, in der ich es mir angewöhnt hatte, mir die Zeit zu vertreiben, wenn ich meinem Vater nicht im Wege stehen wollte. Leise begann er Baba mit tiefer Stimme von Natascha zu erzählen. Ich bemühte mich, zu verstehen, was er sagte. Wer war Natascha? Weshalb war sie wichtig? Warum wirkte Baba dermaßen aufgebracht und warum steckte sie ihre Hand auf den Mund, mit solch einem schmerzvollen Ausdruck? Als er seine Geschichte beendet hatte, sagte er plötzlich betont lauter: "Also, Natascha kommt morgen an und sie wird hier ein paar Tage mit mir verbringen. Ich bitte dich und Lejser (mein Großvater) mit Littika ins Wohnzimmer zu ziehen, und mir und Natascha das Schlafzimmer zu überlassen". Baba war dermaßen entsetzt, daß sie kein Wort sagte. Dann zog Willy seinen Mantel an und verließ das Haus. Baba hatte sich nicht von dem Sofa gerührt, auf dem sie gesessen hatte. Ich stand auf und schmiegte mih an sie. Sie umarmte mich und seufzte: "Mein Schatz, wir haben einige Schwierigkeiten, die wir gemeinsam lösen müssen". Dann stand sie auf und wurde erst richtig wütend: "Wie wagt er es, darum zu bitten, daß ich ihm das Schlafzimmer überlasse, damit er dort mit seiner Russin schlafen kann? Dies ist doch auch Friedas Wohnung. Wie kann ich so etwas geschehen lassen?" Sie ringte mit den Händen und ging auf und ab. Dann rief sie meinen Großvater aus dem Schlafzimmer heraus und berichtete ihm die ganze Geschichte. Er saß dort und sagte kein Wort. Sie schloß das Gespräch ab, indem sie sagte: "Schaut was der Krieg uns allen angetan hat. Die Leute sind verrückt!" Daraufhin trat sie ins Schlafzimmer und begann, die Bettücher abzunehmen. Ich lief ihr hinter her, um ihr dabei zu helfen. 75 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Ich wußte nicht, was ich zu all dem sagen sollte, und so verstummte ich noch mehr. Am nächsten Morgen kam Natascha an. Sobald sie Willy geküßt und umarmt hatte, kam sie auf mich zu und umarmte mich ebenfalls. Sie holte ein kleines Päckchen heraus und sagte mir auf Russisch, das es für mich war und daß ich es öffnen sollte. Drinnen lag eine Halskette mit feinen roten Perlen. Sie steckte mir die Kette um den Hals und ich fühlte mich glücklich. Dies was das erste richtige Geschenk, daß ich bekam, seitdem man mir die Türkisstein-Ohrringe gegeben hatte, die ich immer noch trug. Natascha sah so lieb und nett aus und ich mochte sie. Baba sprach ein paar freundliche Worte zu ihrem Gast, brachte Tee und Kekse, die sie gebacken hatte. Dann trat mein Vater mit Natascha in das Schlafzimmer und drei Tage lang hielten sie sich die meiste Zeit dort auf. Am Morgen des vierten Tages kamen sie beide heraus und ich konnte an Nataschas Gesicht erkennen, daß sie geweint hatte. Sie kam zu mir, umarmte mich wieder und sagte etwas auf Russisch, daß ich nicht verstand und sie verließ zusammen mit meinem Vater das Haus. Eine Stunde später kam Willy zurück und kündigte Baba an: "Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, Natascha ist weg und wird nie wieder zurückkommen!" Ich glaube, daß meine Großmutter mit dieser Nachricht sehr zufrieden war, aber ich war etwas traurig. Einige Tage nach Nataschas Abreise kündigte meine Vater an, daß wir bei Tante Regina zum Mittagessen eingeladen waren. Ich wollte eigentlich nicht hingehen, aber mein Vater bat Baba, mich schön anzuziehen und mir die Haare schön zu kämmen; dann gingen wir gemeinsam den ganzen Weg zu Reginas und Jossels Wohnung. Jossel war auf der Arbeit und wir saßen zu Tisch mit Regina, Nora, Mina und einem Vetter, einen älteren Herrn, den ich nicht kannte. Mina, die jüngste der drei Schwestern, trug ein hübsches dunkelblaues Kleid, mit einer langen Perlenkette um den Hals geschlungen, in einem Knoten zusammengebunden, der auf ihrer Brust lag. Ihr Haar war elegant in einem Knoten auf ihrem Kopf gewickelt. Sie trug Lippenstift und sah wunderschön aus. Ich konnte mich an sie erinnern, aus der Zeit, als ich dort mit ihnen in der Wohnung gelebt hatte und konnte es nicht fassen, daß dies der gleiche Mensch wie damals war. Sie wirkte nun freundlich und fröhlich; die meiste Zeit redete und kicherte sie. Nach dem Mittagessen ging sie auf Willy zu und umschlang lachend sein Genick von hinten. Was führte sie im Schilde? Sogar zu mir war sie nett. Ich blickte meinen Vater an. Er schien sehr zufrieden mit sich selbst zu sein. Dann baten ihn alle, ein paar Lieder zu singen. Mein Vater richtete sich auf und begann zu singen; erst ein paar deutsche Lieder, dann ein Lied auf Italienisch und schließlich ein paar Lieder auf Russisch. Er hatte eine 76 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 angenehme Tenorstimme und alle klatschen ihm Beifall. Ich war sehr stolz auf meinen Vater, obwohl ich die meiste Zeit während unseres Besuches ein Gefühl des Unwohlseins empfunden hatte. Regina hatte kein einziges Wort zu mir gesprochen, und auch Nora nicht. Waren sie mir immer noch böse, weil ich zur Tür gelaufen war, um dort auf meine Mutter zu warten, als ich bei ihnen gelebt hatte? Schließlich ging der Besuch auf sein Ende zu. Bevor wir weggingen, umarmte Mina meinen Vater und gab ihm einen großen Kuß. Als wir auf die Straße hinausgingen, sagte Willy: "Wir sind nicht weit weg vom Volksgarten; das Wetter ist gerade schön, laß uns doch dort etwas spazieren gehen". Ich freute mich sehr darüber, daß er mit mir spazieren gehen wollte und lächelte fröhlich. Als wir unseren Spaziergang auf abgelegenen Wegen des Parks antraten, sagte er plötzlich: "Littika, kannst du dich an den Film erinnern, den wir zusammen gesehen haben?" Mein Herz erstarrte – hatte er etwa meinen Vorfall wahrgenommen? Wollte er mir jetzt Schelte geben? Aber stattdessen lächelte er und sagte: "Kannst du dich erinnern? Die Frau des Piloten, in dem Film, die darauf wartete, daß er aus dem Krieg zurückkehrt? Er hatte beide Beide verloren, doch ist sie ihm treu geblieben und war so glücklich ihn wiederzusehen, als er zu ihr zurückkehrte. Aber bei deine Mutter, Frieda, ist da ganz anders. Ich bin in den Krieg gezogen, bin verwundet worden und sie hat überhaupt nicht auf mich gewartet. Ganz im Gegenteil, sie hat einen Liebhaber, mit dem sie jetzt in Bukarest lebt. Das ist keine Benehmen für eine anständige Ehefrau, und wir werden sie nicht mehr "Mamma" nennen. Von nun an ist sie nur noch Frieda". Ich war zutiefst erschrocken und spürte meine Wangen brennen. Ich wußte nichts dazu zu sagen, aber mir war klar, daß ich niemals meine Mutter Frieda nennen würde. Für mich war sie für immer meine "Mamma". Wir kamen abends zu Hause an. Baba erwartete mich. Großvater und sie hatten wieder das Schlafzimmer bezogen. Sie nahm mich mit ins Bett und wollte alles von mir höhren und erfahren, was bei Regina geschehen war. Nachdem ich es ihr erzählt hatte, seufzte sie: "Siehst du, Littika, Mina war schon immer auf deine Mutter neidisch und jetzt möchte Frieda deinen Vater wegschnappen. Deswegen hat sie sich heute so aufgeführt. Aber wir dürfen das nicht geschehen lassen. Dein Vater muß zu Frieda zurückkehren und ihr drei sollt wieder eine Familie werden". Ich hörte ihr zu und beschloß, ihr nichts von dem zu erzählen, was Willy mir in dem Volksgarten gesagt hatte. Ich hatte mir eigentlich fest versprochen, 77 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 niemanden irgend etwas davon zu sagen. Ich wußte, daß meine Baba recht hatte und das die Dinge sich irgendwie regeln würden. 78 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 12 Ich lerne, mit Gleichaltrigen zu spielen Ich war es gewöhnt, mich immer in der Gesellschaft von Erwachsenen zu befinden. Die einzigen Spiele, die ich kannte, waren Spiele, die ich mit Erwachsenen spielen konnte, so wie Domino oder einfache Kartenspiele. Diese waren in jedem Haushalt erhältlich, auch wenn es überhaupt kein Spielzeug gab; oft freuten sich die Erwachsenen, mit mir zu spielen. Gewöhnlich ließen die Erwachsenen mich gewinnen und redeten mir gut zu, es gab keinen wirklichen Wettstreit. Kinder meines Alters machten mir etwas Angst. Karin, meine Nachbarin, wirkte so selbstsicher und stark; ich gehorchte imme wieder ihren Befehlen, ohne ein Wort zu sagen. Mir war bewußt, daß dieses Verhalten ihr gegenüber nicht das ideale war, aber ich konnte nicht anders handeln. Trotz allem war ich gerne in ihrer Gesellschaft und spielte gerne mit ihren Spielzeugen. Es war für mich eine neue Welt und ich war neugierig. Eines Tages folgte ich ihr auf den Hinterhof unseres Gebäudes. Es spielten dort andere Kinder – mit Steinen, mit Rädern und weiteren zerbrochenen oder gebrauchten Geräten. Ich war wie immer auf Karins Fersen. Ich konnte sehen, daß sie einem älteren Jungen etwas ins Ohr flüsterte, mich anschauend und lachend. Ich merkte, daß sie sich über mich lustig machten, aber ich beschloß, es zu ignorieren. Dann, als wir gerade einem Kätzchen hinterherliefen, schubste der Junge mich und ich fiel auf Glasscherben, die mir Knie und beide Hände verletzten. Das Blut strömte aus allen Schnittwunden und ich lief weinend und schluchzend die Treppen hinauf zu meiner Großmutter. Ein paar Tage lang vermied ich die Kinder aus unserem Gebäude und verbrachte die meiste Zeit bei Baba, aber in meine Seele wollte ich wieder draußen sein mit den Anderen. Mein Vater blickte mich an und lachte: "Du bist wie ein verwundeter Soldat, der aus dem Krieg zurückgekehrt ist". Ungef'ähr ein Monat nach der Heimkehr meines Vaters zogen Karin und ihre Familie weg. Nun verbrachte ich wieder sehr viel Zeit mit meiner Großmutter. Ich begleitete sie auf Tagesausflüge in verschiedene Teile unserer kleinen Stadt. Eines Tages entdeckten wir eine große Karikatur auf einer Wand. Sie stellte Hitler da, dessen Kopf unter einer Axt lag, mit einem großen Fragezeichen um ihn herum. Ich fragte Baba, was mit dieser Zeichnung gemeint war und sie erklärte mir, daß alle glaubten, daß Hitler gestorben sei, aber daß niemand seine Leiche gefunden habe, so daß man sich der Sache nicht ganz sicher sei. Ich dachte mir: "Er ist 79 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 sicher tot. Gott könnte ihn doch nicht am Leben lassen, nach all dem Leid, das er in dieser Welt verursacht hat". Eines Morgens weckte meine Großmutter mich früher auf als gewöhnlich und sagte: "Heute kommst du in den Kindergarten. Ich habe dir ein paar neue Kleider gekauft und ich werde dich dorthin bringen". Ich war erschrocken und besorgt, aber gleichzeitig freute ich mich auch. Ich wußte, daß Kinder meines Alters gewöhnlich zur Schule oder in den Kindergaren gingen. Ich freute mich darauf, wie alle anderen zu sein. Wir kamen an einem alten Gebäude an, mit einem großen Hof und hohen Bäumen. Neben jedem Baum standen ein Holztisch und mehrere Stühle. Auf dem Hof rannte Jungen herum, die auf Russisch schrien. Ich erkannte die Sprache, aber ich kannte nur wenige Worte auf Russisch. Ich klammerte mich an meine Großmutter fest. Wir traten in das Gebäude hinein und eine große Russim lächelte uns an. Sie stellte sich mit dem Namen Katja vor und sofort zog sie mir eine kleine weiße Schürze an. Meine Großmutter gab mir einen schnellen Kuß und machte sich davon. Katja sprach mich auf Russisch an, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Sie zeigte mit dem Finger auf ein paar Spielzeugen in einer Ecke und ich begann, alleine zu spielen. Nach einer Weile setzte sich ein Mädchen mit einer tropfenden Nase neben mich und wir spielten ohne zu sprechen. Dann sprach sie mich von Zeit zu Zeit auf Russisch an, aber ich zuckte nur mit den Schultern und spielte weiter. Ich konnte nicht verstehen, wie man do unbekümmert mit einer ständig laufenden Nase weiterspielen konnte. Ich nahm mein Taschentuch heraus und wischte mir die Nase. Dann gingen wir alle hinaus auf den Hof und setzten uns an die Tische. Jeder von uns erhielt ein Glass Milch und ein Stück Schwarzbrot. Einige der Jungen balgten sich miteinander. Einige rannten neben den Mädchen her, zogen ihnen an den Zöpfen oder schnappten ihnen das Brot weg. Katja war zu beschäftigt, um alle in ihrem Blickfeld zu haben. Irgendwie ergab es sich, daß sie mich anblickten und mich dann in Ruhe ließen. Wahrscheinlich wirkte ich schmächtig, armselig und dumm, da ich den ganzen Tag kein Wort von mir gab. Ich merkte aber, daß die Mädchen, die sich über die Jungen ärgerten, sie zurück anschrien und sagten: "Ja razkažu tebja"; bald fand ich heraus, was es bedeutete: "Ich werde dich verpetzen". Ich bemühte mich, mir diesen Satz zu merken, für den Fall, daß ich ihn mal brauchen würde. Wir aßen gemeinsam zu Mittag, dann spielten wir noch eine Weile und schließlich kam Baba, um mich abzuholen. Der Kindergarten lag nicht weit von unserer Wohnung und wir liefen schweigend. 80 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Eine ganze Woche lang ging ich in den Kindergarten. Von Tag zu Tag wurde es unerträglicher. Die Junge begannen, mich zu hänseln und zu schlagen. Ich widerholte immer wieder den Satz: "Ja razkažu tebja", aber mit wenig Erfolg. Ich konnte immer noch nicht verstehen, was die Mädchen mir sagten; einige der älteren Mädchen versuchten, mich vor den Jungen in Schutz zu nehmen, aber auch sie kommandierten mich herum und zwangen mich, Spiele mitzumachen, die ich nicht ausstehen konnte. Es strömte ein unangenehmer Geruch von ihnen aus, sie sahen schmutzig aus und ich wollte die ganze Zeit nur noch weinen, aber ich beschloß, meine Schwäche nicht preiszugeben. Katja sprach mich fast nicht an, da sie inzwischen festgestellt hatte, daß ich sie sowieso nichts verstehe. Meine Lage sah ziemlich aussichtslos aus. Dann, als Baba mich eines Morgens gerade vorbereitete, um mich in den Kindergarten zu bringen, begann ich zu weinen; ich erzählte ihr, wie unglücklich ich dort sei und daß ich nicht mehr dahingehen wollte. Sie hörte mir aufmerksam zu un nach einer Weile sagte sie: "Weißt du was? Du must nicht mehr dahingehen. Du kannst mit mir zu Hause bleiben". Ich saß auf meinem Bett und fühlte mich plötzlich sehr traurig. Eine große Leere öffnete sich in meinem Bauch. "Warum bringt Baba mich nicht in den Kindergarten? Ich weiß, daß ich gehen sollte, aber ich habe nicht die Kraft, mich selbst dazu zu zwingen. Sie sollte mich zwingen! Sie war doch für mich zuständig. Mein Vater hatte gesagt, es sei ihm egal, ob ich in den Kindergarten gehe oder zu Hause bleibe, also würde er mir nicht behilflich sein. Der einzige Mensch, der mir helfen konnte, war Baba. Aber wenn sie, vor lauter Warmherzigkeit und Fürsorge, beschloß, meiner kindlichen Rebellion nachzugeben, was sollte dann aus mir weden?" Ich blieb lange auf dem Bett sitzen, leise schluchzend. Ich fürchtete, daß ich niemals zur Schule gehen und nie lesen lernen würde. Dann traf ich einen Entschluß und versprach mir selbst: "Ich werde stark sein und meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich werde nie etwas auf halbem Weg aufgeben. Ich muß lernen, mich dazu zu zwingen, das zu tun, was ich machen soll". Ich beschloß, mich am nächsten Tag dazu zu zwingen, in den Kindergarten zu gehen und meine Baba zu bitten, auf meine Klagen keine Rücksicht zu nehmen. Etwas später, am gleichen Tag, wurde mein Gesicht ganz rot und aufgeschwollen. Bald hatte ich ganz viele Bläschen um den Mund herum. Meine Großmutter war zutiefst besorgt und rief den Arzt. Er untersuchte mich und sagte: "Ich meine zu wissen, was es ist, abe dieshier ist ein besonders arger Fall. Sie wird für einige Zeit das Bett hüten müssen und ein Salbe um den Mnd herum auftragen müssen. Die Blasen werden noch etwas wachsen und es wird noch schlimmer aussehen, ehe sich ihr Zustand verbessert". Letzten endes 81 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 verbrachte ich eine sehr lange Zeit im Bett. Der Arzt kam alle paar Tage vorbei und trug mir andere Medikamente aufs Gesicht auf. Ich mußte sehr leiden. Aber schließlich wurde ich wieder gesund und ich ging nie wieder in den Kindergarten. Nun verbrachte ich wieder sehr viel Zeit in Gesellschaft der Erwachsenen meiner Familie. Ich liebte es, allein auf dem Hof zu spielen; ich suchte Zigarettenstümmel für meinen Großvater. Er pflegte sie dann aufzuschneiden und den Tabak in eine kleine Dose zu füllen. Manchmal griff er nach einem dünnen Stück Papier, von der Größe einer Zigarette, stopfte es mit etwas Tabak aus seiner Dose voll und rollte sich eine Zigarette, die er dann rauchte. Wenn er gut gelaunt war, erlaubte er mir, ihm eine Zigarette zu rollen. Meine Russischkenntnisse bestanden weiterhin aus diesem einen Satz, von dem ich im Kindergarten Gebrauch gemacht hatte; mein Entschluß jedoch, in Zukunft für mich selbst zu entscheiden, wurde zu einer persönlichen Entscheidung für den Rest meines Lebens. 82 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 13 Wir verlassen Czernowitz Eines Tages nahm Baba mich auf ihren Schoß und sagte: "Littika, es ist an der Zeit, daß du und dein Vater euch nach Bukarest begebt und euch mit deiner Mutter vereinigt. Ihr drei müßt wieder eine Familie werden. Und du, Littika, du mußt deinen Eltern helfen, sich wieder zu vereinigen und wieder gemeinsam leben zu wollen. Du bist ihnen sehr wichtig!" Ich hörte aufmerksam zu. Es kam mir vor, als ob Baba mir soeben einen große Sack auf die Schultern gelegt hatte. Mir war nicht klar, was ich machen sollte, aber ich konnte mich an den Spaziergang im Park mit meinem Vater erinnernn und ich freute mich sehr darüber, daß er bereit war, dorthin zu reisen und meiner Mutter zu begegnen. Plötzlich begriff ich, daß ich meine Großmutter verlassen müßte, ohne zu wissen, wann ich sie wiedersehen würde. Das machte mir Sorgen und große Angst, aber ich beschloß, nichts zu sagen, um Baba nicht noch mehr Sorgen zu verursachen. Mir war klar, daß dies der rechte Weg sei und daß ich mein Bestes dazu beitragen sollte, Babas Anweisungen zu befolgen. Ich preßte ihre Schultern und steckte meinen Kopf in ihre Brust, während mir die Tränen geräuschlos an den Wangen hinunterglitten. Es war einem Veteranen der Roten Armee nicht erlaubt, die Sowjetunion zu verlassen und sich in ein anderes Land wie Rumänien zu begeben. Also hatte Baba gefälschte Dokumente und Pässe für meinen Vater, für mich und für zwei andere junge Frauen (angeblich die Schwestern meines Vaters) besorgt. Schließlich trafen wir uns mit zwei fremden Frauen, die zusammen mit uns, mit Hilfe der gemeinsamen Dokumente, auf die Reise gehen sollten. Wir mußten uns alle unsere neuen Namen und unsere neuen Familienbeziehungen merken. Es war sehr merkwürdig; mein Vater erklärte mir, daß wir nichts gemeinsam mit diesen beiden Frauen hatten, aber das wir gezwungenermaßen zusammen mit ihnen mit den gemeinsamen Dokumenten reisen mußten, aber nur bis über die Grenze nach Rumänien. Der Tag unserer Abreise kam. Baba und mein Großvater umarmten und küßten mich. Baba sagte mir, als ob sie meine Gedanken gelesen hätte: "Mach dir keine Sorgen, Littika, wir kommen euch bald nach". Ein kleiner Pferdewagen mit einem kleinwüchsigen Pferd erwartete uns an der Straßenecke, unweit von uns. Mein Vater trug einen großen Kartoffelsack, vollgestopft mit Kleidern, und einen kleinen Koffer. Der 83 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Wagen nahm uns alle mit – die beiden Frauen, meinen Vater und mich, bis an die Grenze eines Städtchens namens Siret. Es war früher Nachmittag und alle hofften wir, bis vor Anbruch der Nacht über die Grenze gekommen zu sein. Es schwebte Spannung in der Luft und eine große Stille herrschte in unserem kleinen Wagen. Niemand sprach ein Wort und es kümmerte sich niemand um mich. Ich fühlte mich etwas einsam, aber ich war gleichzeitig auch sehr aufgeregt. Dies war meine erste Reise außerhalb Czernowitzs. Mir war nicht klar, daß wir uns in ein anderes Land begaben, mit einer anderen Sprache und einer anderen Kultur. Es war anfang Juni des Jahres 1945 und der Krieg war nun endlich auch in Deutschland zu ende. Alle hofften auf ein besseres Leben und auf einen neuen Anfang. Als wir endlich an dei Grenze angelangt waren, sahen wir eine große Menge von Wagen Schlange stehen. "Die Grenze war mehrere Tage gechlossen und Sie werden hier warten müssen" sagte uns ein Polizist. Sie können alle in dem Schulgebäude dort drüben die Nacht verbringen. Wir nahmen alle unser Gepäck heraus und gingen hinüber zu dem Schulgebäude. Drinnen gab es eine riesige Halle, in der jede Familie sich eine Ecke aussuchte, in der sie aneinandergedrückt schlafen konnten. Die beiden Frauen verschwanden in der Menge. Mein Vater und ich fanden einen Fleck zwischen zwei anderen Familien; er legte seinen Mantel auf den Boden, sowie den Kleidersack und sagte mir: "Hier werden wir heute Nacht schlafen". Er gab mir ein Stück hausgebackenes Brot, daß Baba uns mitgegeben hatte, und entfernte sich. Es kam mir so vor, als ob viele Stunden verstrichen, bis ich ihn wiedersah. In der Zwischenzeit unterhielt ich mich etwas mit den Leuten zu unserer Rechten; sie hatten eine Tochter, die etwas jünger war als ich, und wir begannen zusammen mit einigen Drahtstücken zu spielen. Die Leute gaben mir auch ein hartgekochtes Ei und ein Stück Kuchen zu essen. Zu unserer linken saß ein älteres Ehepaar, daß sehr ruhig und traurig wirkte. Später erfuhr ich, daß die Frau Thea hieß und daß ihre Tochter in Transnistrien gestorben war. Spät am Abend, als die meisten Leute schon am schlafen waren, kam mein Vater zurück und legte sich neben mich. Er fragte mich, ob ich Hunger habe; ich erzählte ihm ,daß die Nachbarn mir etwas zu essen gegeben hatten; er lächelte und sagte: "Gute Nacht". Am nächsten Morgen wachten wir alle früh auf, packten unsere Sachen zusammen und warteten darauf, unsere Reise weiterzuführen. Schließlich öffnete ein Polizist die Tür, trat hinein und kündigte an: "Die Grenze wird noch für ein paar Tage geschlossen bleiben". Ein lautes Murmeln ging durch die 84 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Menge. Dann sagte er noch: "Ihr könnt hier bleiben und in dieser Halle übernachten, oder ihr könnt Zimmer bei den Dorfbewohnern finden". Mein Vater und ich, sowie unsere Scheinfamilie, beschlossen, zwei Zimmer bei einem Bauern zu mieten; dort verweilten wir eine ganze Woche, bis man uns erlaubte, weiter zu reisen. An dem Tag, an dem die Grenze geöffnet wurde, sah es so aus, daß Hunderte von Menschen auf den Grenzposten zumarschierten, sowie einige Pferdewagen. "Unsere Familie", Thea und ihr Mann, und noch ein paar andere Frauen, die ich nicht kannte, wir teilten uns alle eine Pferdewagen. All unser Gepäck war auf dem Wagen geladen, während wir zu Fuß nebenher gingen. Plötzlich zog Thea mich zur Seite und sprach zu mir, als ob ich ein Erwachsener sei: "Du weißt, daß sie uns an der Grenze alle den Leib nach Geld und Wertsachen abtasten werden, da wir nichts mitnehmen dürfen. Aber du bist ein Kind, und dich werden sie nicht durchsuchen. Also werde ich mein Geld in deinen Kleidern verstecken". Dabei steckte sie mir ein Bündel Geldnoten unter die Bluse. Da ich einen Trainingsanzug mit einem Gummizug unten dran trug, blieb das Bündel überhalb des Gummizuges stecken. Auf einmal kamen all die anderen Frauen zu mir und sagten: "Wir möchten auch, daß du unser Geld aufbewahrst". Ehe ich es versehen konnte, war ich mit lauter kleinen Geldbündeln, in der Hose und im Hemd, vollgestopft; ich war zu schüchtern, um irgend etwas zu sagen. Wobei ich tief in meinem Inneren auch meine Freude daran hatte, daß alle auf einmal so nett zu mir waren. Mein Vater schien von all diesen Geschäften nichts weiter bemerkt zu haben und ich erzählte ihm nichst davon. Als wir uns der Grenze annäherten, wurden sämtliche Männer zur einen Seite gebeten und die Frauen zur anderen. Thea sagte mir: "Stell dich krank und bleib auf dem Wagen sitzen". Aber eine Polizistin kam heran und bat mich, mich den Frauen anzuschließen. Ich schritt neben diesen fremden Frauen und mein Gesicht war brennend heiß. Ich sagte zu mir selbst: "Ich werde versuchen, langsam an dem Grenzposten vorbeizugehen, ohne die Polizistin anzublicken". Falls sie mich festnehmen und ausziehen, werde ich so tun, als ob ich weine und behaupten, daß ich nicht weiß, wem dieses Geld gehört". Obwohl ich Angst hatte und besorgt war, fühlte ich mich wichtig. Ich hatte eine Aufgabe auszuführen und Leute waren auf mich angewiesen – nur mein Vater nicht; es tat mir Leid, daß er nichts von dieser Aufgabe wußte, aber ich wollte es ihm nicht mitteilen. Als ich ihm Jahre später diese Geschichte erzählte, konnte er es nicht fassen. 85 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Als wir uns dem Grenzposten annäherten, erblickte ich Thea, die splitternackt entblößt wurde. Sie war ganz bleich und zitterte am ganzen Leib; ich dachte, daß sie jeden Augenblick zusammenbrechen würde.Dann gingen einige weitere Frauen durch die Kontrolle. Ich betrachtete ihre Gesichter, wobei meine eigene Angst immer mehr zunahm. Als ich mich der Polizistin, die die Frauen durchsuchte, annäherte, schritt ich langsam hinter ihnen her und plötzlich befand ich mich auf der anderen Seite. Niemand hatte mich angehalten, niemand hatte nach mir geschaut. Ich hatte die Grenze überschritten! Die Frauen wurden alle in Richtung einer großen Halle geschickt, wo die Familien wieder zusammenkamen und jeder seine persönlichen Sachen zurück erhielt. Bald kamen die verschiedenen Frauen zu mir und jede griff nach ihrem kleinen Geldbündel. Einige umarmten mich und sagten: "Braves Mädchen!". Innerhalb einiger Minuten war ich wieder mit meinem Vater zusammen und der Apltraum war vorbei. Mein Vater trug den Kartoffelsack, als er plötzlich darauf aufmerksam wurde, daß einige Rubelnoten herausragten. Er lachte auf: "Deine Baba hat das Geld nicht allzu sorgfältig eingenäht, aber wir sind über die Grenze gekommen und niemand hat es gemerkt. Jetzt sind wir frei und wir brauchen keine Scheinfamilie mehr. Laß uns gehen und zusehen, wie wir nach Bukarest kommen". Schließlich landeten wir auf einem offenen Lastwagen, der auf dem Weg nach Bukarest war. Wir waren Teil einer großen Gesellschaft von Leuten, mit denen wir eine ganze Woche lang zusammensaßen. Der Lastwagen machte unterwegs mehrmals Halt und wir übernachteten in Schulgebäuden und anderen öffentlichen Gebäuden. Eine Woche später kamen wir in Bukarest an, wo Frieda uns bei den Spazirers, Vetter meiner Mutter, erwartete. 86 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 14 Ob wir wieder eine Familie werden können? Ich war sehr aufgeregt und gespannt auf das Wiedersehen mit meiner Mutter. Als bei der Familie Spazirer die Tür aufging, sah ich einen Raum, der mit Leuten gefüllt war, die mir unbekannt waren. Meine Mutter kam zur Tür und begrüßte uns. Sie war nach schöner, als ich in Erinnerung hatte. Sie betrachtete mich und meinen Vater einen langen Moment, dann sagte sie: "Kommt herein, alle warten auf euch". Es gab weder Umarmungen, noch Küsse, nur Blicke und angedeutete Lächeln. Ich hatte keine Ahnung, was meine Eltern füreinander empfanden; ich konnte von ihrer Verhaltensweise nichts entnehmen. Was mich anging, hatte ich das Gefühl, im Moment nicht besonders wichtig zu sein; also hielt ich mich still und freute mich darüber, daß alle Leute hier Deutsch sprachen. Die anderen Leute im Raum waren wesentlich aufgeregter als wir drei. Irgendjemand hob ein kleines Glas Wein und sagte: "Es ist unglaublich, euch alle drei bei uns zu sehen. Willy, wir hatten gedacht, daß du im Krieg umgekommen warst, und eine ganze Zeit lang dachten wir, daß du, Frieda, in Transnistrien gestorben warst, und von dir, Littika, wußten wir überhaupt nichts. Und hier seid ihr nun wieder alle zusammen". Alle tranken und aßen; einige Leute kamen zu mir, umarmten mich und gaben mir Verschiedenes zu essen. Ich konnte nicht wirklich essen oder über irgendetwas nachdenken. Ich dachte nur an Baba; was würde sie wollen, daß ich mache? Wie sollte ich mich verhalten? Am Abend verabschiedeten sich alle Gäste. Tante Malli führte mich in ein winziges Zimmer, das mit einem Bett und einem Stuhl ausgestattet war und sagte, daß ich hier schlafen könnte. Es war das erste mal in meinem Leben, daß ich alleine in einem Zimmer schlief. Meinen Eltern sagte sie, daß, da sie in Ruhe mieinander reden mußten, sie ihnen das Zimmer neben dem Meinen zur Verfügung stellte. Ich erhielt einen Schlafanzug und das Licht in meinem Zimmerchen wurde ausgemacht. Ich lag ruhig in meinem Bett, dann hörte ich meine Eltern im anderen Zimmer reden. Leise schlich ich mich an die Zimmertür heran und steckte mein Ohr ans Schlüsselloch. Nun konnte ich sie deutlich hören. Ich verbrachte Stunden in dieser Haltung, bis die ersten Anzeichen des Morgengrauens durch die Fensterläden meines Zimmerchens durchlugten. Meine Eltern redeten ununterbrochen. Sie erzählten einander über die Jahre, die sie voneinander getrennt verbracht hatten. Auf diese Weise erfuhr ich alles, was mit ihnen in dieser Zeit geschehen war. Schließlich hörte ich meinen Vater sagen: "Nun ja, wir haben beide viel 87 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 durchgemacht. Ich glaube, wir haben beide viel Glück gehabt, am Leben geblieben zu sein, und daß wir noch jung und genügend bei Kräften sind, um von Neuem anzufangen. Wir sollten zum Wohl unseres Kindes wieder eine Familie werden". Meinte er etwa mich damit? War ich ein genügend guter Grund dafür, daß wir von neuem ein Familie werden? Wo war meine Baba, sie hätte ich fragen können, was das alles zu bedeuten hatte. Erschöpft schliefen wir alle für ein paar Stunden ein – ich in meinem Zimmerchen und meine Eltern in dem Zimmer nebenan. Dann wachte ich mit großem Hunger auf und begab mich ins Wohnzimmer. Meine Eltern lächelten beide, umarmten und küßten mich unter den Augen der Spazirers. Dann sagten sie feierlich: "Wir haben beschlossen, zu versuchen, wieder als Familie zusammenzuleben. Wir werden uns bemühen müssen, uns wieder aneinander zu gewöhnen". Sie erklärten, daß sie sich auf die Suche nach einer Bleibe für die Familie und nach einem Ort, wo mein Vater eine Werkstatt für Grabsteine in Bukarest (meine Mutter hatte bereits nach einem passenden Ort gesucht). Bis dahin könnten wir uns noch für ein paar Tage bei den Spazierers aufhalten. Nach dem Früstück wirkten meine Eltern glücklich und erfrischt. Sie nahmen von mir Abschied und machten sich auf den Weg. Tante Malli umarmte mich und sagte:"Du bist sehr ruhig, Littika, aber heute solltest du dich freuen. Nun hast du wieder eine Familie, deine Eltern haben den Krieg überlebt und sind jetzt wieder zusammen". Ich verstand, was sie meinte, aber ich fühlte mich verwirrt. Dann rief sie ihren Sohn Freddie, einen netten Jungen meines Alters. Ich war dermaßen wegen meiner Eltern angespannt gewesen, als mein Vater und ich am Abend davor angekommen waren, daß ich ihn kaum wahrgenommen hatte. Er sprach mit mir auf Deutsch und zeigte mir Spielzeuge und Bücher in seinem Zimmer. Es war schön, mit jemandem meines Alters zu spielen. Ich begann, mich wohler zu fühlen, obwohl ich meine Baba sehr vemißte. Ich hätte ihr alles erzählen wollen, wie ich es immer zu tun pflegte. Jeden Tag kamen meine Eltern spät nach Hause zurück und erzählten den Spazirers von den Ereignissen des Tages. Sie fragten mich, wie ich den Tag verbracht hatte, aber kümmerten sich ansonsten nur wenig um mich. Dann, eines Tages, kehrten sie von ihrer täglichen Suche mit guten Nachrichten zurück: "Wir haben einen geeigneten Raum gefunden für eine kleine Werkstatt neben dem jüdischen Friedhof gefunden – am Stadtrand. Wir haben auch die Gelegenheit, ein Zimmer für uns drei auf einem großen Anwesen zu mieten, das ungefähr in vierzig Minuten 88 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Entfernung zu Fuß von der Werkstatt liegt. Wir können morgen dort einziehen". Auf diese Weise nahm unser Willkommensbesuch bei den Spazirers sein Ende und so begann ein neues Kapitel in unserem Leben. Ich hatte dabei das Gefühl, daß dies ein guter Anfang war. 89 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 15 Der erste Schultag Zu früher Morgenstunde kamen wir an dem Buduj-Anwesen an, weit weg von der Stadtmitte. Meine Mutter erklärte mir, daß dies eine adelige rumänische Familie sei, daß wir uns so gut wie möglich benehmen und so weit wie möglich unter uns bleiben sollten. Wir würden nur ein einziges Zimmer zum schlafen haben und wir würden deren Küche benutzen, um einfache Mahlzeiten für uns selbst zuzubereiten. Sie hatten einen großen Bauernhof mit Schweinen und Hühnern, sowie einen großen Obstgarten, mit allerlei Obstbäumen. Dies könnte für uns alle ein Paradies sein, aber ganz besonders für mich. Es war ein angenehmer Sommertag. Frau Buduj, eine kleine Frau mit sehr strengen Gesicht, nahm uns auf und zeigte uns unser Zimmer. Sie sagte, daß sie uns in einem Monat oder zwei ein zweites kleines Zimmer anbieten könnten, so daß ich dann mein eigenes Zimmer hätte. Bis dahin müßten wir zusammen in einem Zimmer schlafen – meine Eltern in einem Doppelbett und ich auf einer kleinen Matratze am Boden. Sobald wir unsere Sachen in dem kleinen Zimmer abgelegt hatten, bat ich meine Eltern um Erlaubnis, nach draußen zu gehen und mich umzublicken. Ich hatte etwas Rumänisch von meinem Vetter Freddie gelernt und hatte das Gefühl, alleine zurechtkommen zu können. Ich hatte auch gemerkt, daß Frau Buduj eine sehr wohlerzogene Dame war und daß sie etwas Deutsch konnte. Frau Buduj war aus Rußland, wo sie einer Adelsfamilie angehörte, nach Rumänien gekommen. Sie und ihr Sohn mußten nach der Sowjetischen Revolution fliehen. Sie fanden in Rumänien Unterschlupf, wo sie Herrn Buduj, Sohn einer rumänischen Adelsfamilie, kennenlernte. Nach dem Krieg wurde die Lage auch für sie schwierig, daher mußten sie eines ihrer Zimmer vermieten, um auf diese Weise an etwas Geld zu kommen. Aber Nahrung gab es auf dem Bauernhof in reichlichen Mengen. Frau Buduj nahm mich unter ihren Schutz und beschloß, mir beizubringen, wie man sich ordentlich benimmt. Ich war sehr lerneifrig. Vor dem Haus stand ein riesengroßer Nußbaum mit einem Tisch rund um den Stamm. Im Sommer pflegten die Budujs dort ihr Mittagsessen zu nehmen. Wenn ihr Sohn und ihre Schwiegertochter zu Besuch da waren, servierte sie ihnen besondere Gerichte unter dem Baum. Ich saß gerne in einer gewissen Entfernung, mich mit mir selbst beschäftigend und die Budujs beobachtend. Ich kam mir vor wie im Kino. Ich sah, wie Frau 90 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Buduj ihren Tisch zu decken pflegte, mit Tellern, Servietten und Tafelsilber. Einmal sagte sie mir, daß jeder wissen sollte, wie man einen Tisch ordentlich deckt, und daß sie es mir beibringen würde, wenn ich es wollte. Ich war fasziniert; bei Baba zu Hause hatten wir nie darauf geachtet, den Tisch in einer solchen Weise zu decken. Ich mußte sehr staunen, als ich einmal Juri ein Stück Wassermelone mit Gabel und Messer essen sah. Ich nahm mir vor, selber zu lernen, auf dieser Weise zu essen. Ich verbrachte meine Tage damit, im Obstgarten herumzustreunen, die Hühner und die Schweine füttern zu lernen und die Budujs zu beobachten. Ich wollte alles von ihnen lernen. Meine Eltern kamen spät in der Nacht nach Hause, nach einem langen Tag harter Arbeit; sie brachten etwas Salami und Brot mit nach Hause und wir aßen in unserem Zimmer, während die glühende Gaslampe den Tisch beleuchtete. Obwohl das Anwesen der Budujs sehr groß war und die Familie reich zu sein schien, hatten sie weder Strom, noch fließendes Wasser in ihrem Haus, doch gab es in ihrem Wohnzimmer einen Telefonapparat, der nie klingelte. Die Toilette war ein abscheuliches Plumpsklo auf dem Hof, daß einen dermaßen unerträglichen Gestank verbreitete, daß ich immer mit einem Taschentuch auf Nase und Mund gedrückt dorthin ging. Ich konnte nicht verstehen, wie so reiche Leute so leben konnten, aber bald gewöhnte ich mich daran. Samstags durften wir die Küche für unser wöchentliches Bad benutzen. Dies bedeutete, einen großen Bottich mit warmen Wasser aufzufüllen, in dem wir dann unser Bad nahmen. Meine Mutter wusch mich in dieser Art kleinen Badewanne und so hatten wir die Gelegenheit, etwas Zeit zusammen zu verbringen. Während sie mir mein wöchentliches Bad gab, unterhielt sich meine Mutter mit mir, sang mir Lieder vor, was mich sehr glücklich machte. Nach dem Bad saubere Kleider anzuziehen, war das herrlichste Gefühl in der Welt. Nachdem wir alle gebadet hatten, pflegten wir in unserem Zimmer zu sitzen; meine Mutter und mein Vater sangen deutsche und russische Lieder und erzählten Geschichten. Nachts stiegen meine Eltern in ihr Bett und ich legte mich auf meine kleine Matratze. Oft konnte ich nicht einschlafen; dabei hörte ich sie zueinander flüstern: "Och, sie ist sicher schon eingeschlafen" und ich tat so, als ob ich schlafe würde. Ich konnte sie hören, wie sie leise kicherten, flüsterten, wie ihr Atem schneller wurde und das Bett dabei knarrte. Ich wußte nicht, was dort vorging, und ich beschloß, daß sie wohl Spaß miteinander hatten, da sie, wenn es zu ende war, sich viele nette Wörter sagten und sich viel küßten. Daraus schloß daß, wasimmer dort vorging, es etwas Gutes sein mußte. Ich schlief dann glücklich ein. 91 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Die Sommertage bei den Badujs verstrichen langsam. Ich spielte mit Elena, der Tochter der Hausdienerin, die etwas älter war als ich; von ihr lernte ich viele Vokabeln und Ausdrücke auf Rumänsich. Meine Eltern begannen, von Schule zu reden. Ich sollte im Herbst auf eine rumänische öffentliche Schule gehen; ich war siebeneinhalb Jahe alt und konnte weder lesen, noch schreiben. Mein Vater beschloß, mich zu unterrichten. Er brachte eine kleine Schiefertafel und etwas Kreide nach Hause und begann, mir Buchstaben auf Rumänisch beizubringen. Er brachte mir zehn Buchstaben bei, indem er sie aufschrieb und sie aussprach; dann sollte ich jeden Buchstaben einzeln abschreiben. Am nächsten Tag beschloß er, meine Kenntnisse der Buchstaben nachzuprüfen; ich kannte die Meisten, konnte aber das "e" vom "f" nicht unterscheiden. Er widerholte mehrmals seine Frage und ärgerte sich immer mehr über mich, so daß ich in immer größerer Verwirrung geriet. Schließlich schrie er mich an, sagte, daß ich dumm sei und ohrfeigte mich. Sein Ehering hinterließ einen Kratzer auf meinem Gesicht und seine Ohrfeige, eine große Narbe in meinem Herzen. Ich mußte lange weinen und konnte nicht mehr aufhören, dann verfiel ich in ein unaufhörliches Schluchzen. Schließlich trat meine Mutter herein und fragte, was passiert sei. Mein Vater sagte: "Ich habe versucht, ihr das Alphabet beizubringen, aber sie ist zu dumm, um zu lernen". Meine Mutter blickte wütend auf und sagte: "Du hast keine Geduld und kannst nicht unterrichten.Laß sie in Ruhe. Sie wird in der Schule lesen und schreiben lernen. Wir werden sie ins erste Schuljahr schicken. Die meisten Kinder werden ein Jahr jünger sein, aber ich bin sicher, daß es auch Kinder ihres Alters geben wird, die wegen des Krieges das erste Schuljahr verpaßt haben. Sie werden alle lesen und schreiben lernen". Als ich ihr zuhörte, wurde mir auf einmal bewußt, daß ich älter war, als die anderen Kinder im ersten Schuljahr, und daß ich so schnell wie möglich lesen lernen sollte; aber alleine konnte ich nichts machen. Eines Tages kehrte meine Mutter mit ein paar neuen Kleidern für mich nach Hause. "Morgen ist dein erster Schultag. Ich war heute auf der Schule und ich glaube, es wird dir gefallen. Morgen früh bring ich dich dorthin". Am nächsten Morgen kämmte sie mir das Haar zu Zöpfen und kleidete mich in ein hübsches blaues Kleid. Oben drüber trug ich einen kurzen Kittel – es war die Schuluniform. Ich nahm meine kleine Schiefertafel und die Kreide mit und wir machten uns zusammen auf den Weg. Erst durchquerten wir das Feld und erreichten die Straße, auf der sich die Werkstatt meiner Eltern befand. Wir winkten meinem Vater zu und gingen eine Stunde lang weiter, bis wir die Schule erreicht hatten. Meine Mutter führte mich in das Klassenzimmer, gab der Lehrerin meinen Namen an und ging weg. 92 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Die Lehrerin, eine große Frau mit dunklem Haar, in einen Haarknoten gewickelt, lächelte uns an und befahl uns, aufrecht zu sitzen. Dann rief sie unsere Namen ab; jeder mußte aufstehen und "anwesend" sagen, wenn sein Name gerufen wurde. Ich konnte das meiste, von dem was sie sagte, verstehen, da meine Rumänischkenntnisse sich sehr verbessert hatten. Sie begann, uns die ersten zwei Buchstaben des Alphabets und einige Grundlagen des Rechnens beizubringen. Ihre Erklärungen kamen mir sehr einfach vor. Alles, was sie unterrichtete, wußte ich schon. Es gab mir ein gutes Gefühl. Dabei merkte ich, daß einige unter den anderen Kindern nicht alles verstanden hatten. Dann kam die Pause und wir begaben uns nach draußen auf den Hof. Der Schulhof war groß; ich ging langsam mit meinem Apfel und meinem Stück Brot in der Hand. Es war niemand da, mit dem ich hätte reden können. Drei Mädchen gingen hinter mir her. Eine von ihnn zeigte mit dem Finger auf mich: "Seht ihr dieses Mädchen? Die ist Jüdin". Dabei spuckte sie auf den Boden. Die beiden anderen lachten und eine von ihnen sagte: "Ich dachte, Juden sehen viel schlimmer aus!" Ich spürte, wie mein Gesicht rot anlief und ich warf meinen Apfel und mein Brot weg. "Wie wissen die, daß ich Jüdin bin? Was wissen die über mich?" Ich beschloß, dermaßen boshafte Mädchen zu ignorieren, aber mir war nun klar, daß ich niemandem erzählen würde, daß ich Jüdin bin, es sei denn, man würde mich dazu zwingen. Am Ende des Tages ging ich mit den anderen Kindern aus dem Schulgebäude heraus. Ich schritt durch das Tor und machte mich auf den Weg nach Hause. Plötzlich sah ich meine Mutter auf mich zukommen. Sie hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht: "Littika, du kennst von selber den Weg nach Hause?!" "Ja", erwiderte ich, "morgen kann ich alleine zur Schule gehen und alleine nach Hause kommen". Sie schien sehr zufrieden zu sein und umarmte und küßte mich. Jeden Morgen ging ich anderthalb Stunden lang zur Schule und anderthalb Stunden auf dem Rückweg. Auf dem Weg nach Hause ging ich zur Werkstatt und hielt mich dort eine Weile auf. Gewöhnlich befanden sich dort viele Leute, die Jiddisch, Deutsch und Rumänisch sprachen. Dies waren Juden, die einen Grabstein für ein jüdische Grab kaufen wollten. Meine Mutter war damit beschäftigt, ihnen verschiedene Sorten von Marmor- und Granitstein zu zeigen. Ich war gerne in der Werkstatt. Nachdem ich schon seit einigen Wochen zur Schule ging, lernte ich neue Freunde kennen. Ich freundete mich ganz besonders mit einem Mädchen namens Marina an. Sie kam aus einem Dorf, daß noch weiter entfernt lag, 93 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 als das Anwesen der Budujs. Morgens traf ich sie auf dem großen Feld und wir gingen gemeinsam den Weg zur Schule. Sie lief gewöhnlich barfuß, dabei trat sie auf Steine und Dorne, als ob es ihr nichts ausmachen würde. Sie war ein schüchternes und ruhiges kleines Mädchen, und ich freute mich, ihr behilflich sein zu können. Wenn ich auf dem Rückweg von der Schule in der Werkstatt halt machte, sah ich oft meinem Vater zu, während er die eingravierten Buchstaben auf den Grabsteinen anmalte. Die Buchstsben waren lateinische und hebräische Buchstaben; er malte sie gewöhnlich in schwarz und gold an. Bald hatte ich gelernt, wie man es macht und genoß es, meinem Vater zu helfen. Eines Tages kündigte die Lehrerin uns in der Schule eine besondere Nachricht an: "Eine sehr wichtige Gruppe von Inspektoren wird unsere Schule am Sonntag besuchen. Obwohl es gewöhnlich ein freier Tag ist, werden wir am kommenden Sonntag Unterricht haben. Aber ihr könnt später kommen und früher gehen. Wir werden nur zwei Stunden Unterricht haben und die Inspektoren werden uns beim lernen zuschauen. Ihr braucht nicht die Schuluniform zu tragen. Ihr könnt eure besten Kleider anziehen". Jeder von uns erhielt einen Zettel für die Eltern, in dem erklärt wurde, wie wichtig dieser Tag sei. Als jener Sonntag kam, zog ich mein neues blaues Kleid an und meinen Mutter steckte mir zwei schöne blaue Schleifen in die Haare. Es war ein herrlicher sonniger Herbsttag und ich war sehr aufgeregt. Marina hatte mir gesgat, daß sie am Sonntag nicht kommen könne, also ging ich alleine. Das Schulgebäude war mit zahlreichen Fahnen ausgeschmückt, viele von ihnen waren rote Fahnen. Unsere Lehrerin war hübsch angekleidet und sie war besonders nett. Sie nahm jeden von uns einzeln an der Tür auf und führte uns zu einem Stuhl, der nicht unserer gewöhlicher Sitzplatz war. Sie setzte mich in die erste Reihe und ich fühlte meine Beine zittern. Hinten im Raum saßen drei fremde Männer und zwei Frauen, die uns beobachteten. Die Stunde begann. Die Lehrerin widerholte Lernstoff, den wir bereits gelernt hatten. Dann rief sie mich plötzlich vor die Tafel. Ich kam zögernden Schrittes und sie sagte: "Melika (so nannten mich die Rumänen, anstelle von Melitta), schreib den folgenden Satz an die Tafel: “Un cuc pe un nuc”". Ich wußte, was der Satz bedeutete (ein Kuckuck auf einem Nußbaum) und ich wußte, wie man ihn schrieb. "Wenn ich nur aufhören könnte, zu zittern", dachte ich mir. Langsam und sorgfältig schrieb ich den Satz zwischen die roten Zeilen auf die Tafel. Als ich fertig war, klatschten die Fremden hinten im Klassenzimmer Beifall. Mein Gesicht loderte und ich kehrte schnell auf 94 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 meinen Platz zurück. Ich dachte, daß die Lehrerin mich sicher mag, wenn sie mich vor der ganzen Klasse und vor den wichtigen Besuchern schreiben läßt. Der Unterricht endete und ich wollte sofort weggehen und nach Hause rennen. Viele der anderen Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt, aber ich konnte selbstständig nach Hause gehen. Ich lief den ganzen Weg bis zu dem große Feld. Die Sonne schien, es waren frühe Nachmittagsstunden des Sonntags. Ich konnte die Bienen summen und die Kühe in der Ferne muhen hören. Dann waren auf einmal vier Jungen da, größer als ich, wie aus dem Nichts gekommen; sie begannen, mir hinterher zu gehen. Ich ging schneller, ohne nach hinten zu blicken. Einer von ihnen kam an mich heran und fragte, wie ich heiße. Ich antwortete flüsternd. Ein anderer fragte mich, wo ich herkomme. Ich sagte: "Von der Schule". Sie brachen in lautes Gelächter aus und auf einmal umzingelten sie mich. Ich versuchte, ihnen auszuweichen und ging weiter, aber sie hielten mich fest und erlaubten mir nicht, mich zu bewegen. "Komm mit uns!" sagte einer von ihnen. "Wir werden Spaß haben". Ich erschrak und sagte: "Nein! Meine Eltern warten auf mich". Dann rissen sie mich zu Boden und begannen, mir den Körper zu betasten. Ich wußte, daß ich mich in wirklicher Gefahr befand und ich mußte irgendwie gegen sie kämpfen. "Ich will ihnen nicht erlauben, mir irgendetwas anzutun", dachte ich und begann, mit all meinen Kräften zu schlagen und treten, einer nach dem anderen. Sie fluchten mich an und drückten mich etwas nach hinten zurück. Dann schrie ich so laut ich nur konnte – so laut und so heftig, daß ich nicht sicher war, daß es aus meinem eigenen Hals herausgekommen war. Dann sagte einer von ihnen plötzlich: "Ich glaube , wir verschwinden besser". Er trat mich und sie liefen alle weg. Ich zupfte mein Kleid und meine Haare zurecht und lief weiter den Weg nach Hause. Bis ich das Anwesen der Budujs erreicht hatte, hatten meine Beine aufgehört zu zittern und mein Atem hatte sich beruhigt. "Ich werde nie jemandem erlauben, mir etwas Böses anzutun. Ich werde zurückschlagen, bis ich sterbe", sagte ich mir und setzte mich zu meinen Eltern auf den Hof. Ich erzählte ihnen alles über den mekwürdigen Schultag, erwähnte aber mit keinem Wort den Vorfall mit den Jungen. Dann ging ich in den Obstgarten und fand dort einen Ast, der in meinen Schulranzen hineinpaßte. Falls so etwas nochmals vorkommen sollte, würde ich sie dermaßn heftig vor die Augen schlagen, daß die Augen ihnen aus den Augenhöhlen herausspringen würden. Am Ende des Schuljahrs erhielt meine Mutter eine Einladung, mich zur Abschlußfeier zu begleiten. Eine große Menge von Kindern und deren Eltern waren in dem großen Saal zusammengepfercht. Die Direktorin stand in der Mitte und rief die Namen von Schülern aus den oberen Klassen aus. Ich verstand nicht so recht, was dort vorging, und meine 95 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Mutter auch nicht. Plötzlich rief die Direktorin meinen Namen aus. Meine Mutter schob mich nach vorne, in Richtung der Direktorin, die mich mit einem Lächeln aufgriff und auf einen Stuhl neben sie setzte. "Dritter Preis im ersten Schuljahr" rief sie laut und übergab mir ein Zertifikat. Ich war völlig überrascht, und meine Mutter auch. Ich war die drittbeste Schülerin in der Klasse. Ich konnte es nicht fassen. Meine Mutter wirkte sehr erfreut und so gingen wir zusammen nach Hause."Ich wußte nicht, daß du eine so gute Schülerin bist", sagte sie. "Laß uns nach Hause gehen und Tata davon erzählen". Von jenem Tag an erwarteten alle immer von mir, eine gute Schülerin zu sein. 96 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 17 Das Leben unter den Kommunisten Wir blieben bis zum Sommerende bei den Budujs; dann zogen wir in ein kleines Haus an der Hauptstraße, die zu der Werkstatt meiner Eltern führte. Von dort aus hatte ich nur eine Stunde bis zur Schule zu gehen, statt eineinhalb Stunden. Marina kam aber immer noch an meinem Haus vorbei und sie wartete jeden Morgen auf mich am Tor zu unserem Hof. Das Haus war klein, mit zwei Zimmern und einem dunklen Raum, den wir als Küche benutzten. Auch hier bestand die Toilette aus einem Plumpsklo draußen auf dem Hof. Der schönste Ort war der Hof mit seinen zahlreichen Bäumen und Büschen. In den zwei Zimmern gab es Strom, aber nicht in der Küche; dort mußten wir eine Gaslampe benutzen. Es gab kein fließendes Wasser, aber auf dem Hof stand ein Brunnen und bald hatte ich gelernt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Im Winter kaufte mein Vater eine große Menge Holz, um den großen Lehmofen im Wohnzimmer anzuheizen. Er brachte mir bei, wie man das Holz in kleine Stücke schneidet und so wurde es meine Aufgabe im Haus, Wasser zu bringen und Holz kleinzuhacken. Ich lernte auch, Gemüse für den Salat zu schneiden und Kartoffeln zu kochen. Bevor meine Eltern nach Hause kamen, um zu essen, machte ich immer ein paar Vorbereitungen, wie meine Mutter es mir befohlen hatte. Wenn ich mal ihren Anweisungen nicht gefolgt war, wurde sie sehr wütend und manchmal schlug sie mich und ohrfeigte mich mit großer Heftigkeit. Ich wußte, daß sie grundsätzlich gut zu mir war, aber in mir dachte ich auch, daß sie mich nicht sehr liebte. Die verabscheuteste meiner Aufgaben war es, lebendigen Fisch zu kaufen, ihn im Netz zappelnd nach Hause zu tragen, und dann zu versuchen, ihn zu töten und zu säubern. Ich haßte es, Fische zu töten; gewöhnlich legte ich den Fisch auf das Brett ab, warf einen Holzhammer auf ihn und lief weg. Wenn ich zurückkehrte und der Fisch bewegungslos lag, war ich erleichtert; wenn er sich noch auf dem Brett bewegte, widerholte ich die Aktion mit dem Hammer und lief wieder weg. Manchmal dauerte diese Prozedur sehr lange und ich hatte es versäumt, die Schuppen des Fisches vor der Rückkehr meiner Mutter entfernt zu haben; dies war ein genügender Grund für sie, mich zu schlagen. Ich sollte so schnell wie möglich den Fisch säubern, die Innereien entfernen und ihn in Scheiben schneiden, damit sie ihn kochen könne. Bis heute verabscheue ich es, Fische zu säubern. 97 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Zu Beginn des darauffolgenden Schuljahres kehrte ich alleine mit Marina in die Schule zurück. Wir hatten die gleiche Lehrerin. Sie war nett zu mir und setzte mich an einen guten Platz. Nun wurden auf einmal viele Kinder freundlich zu mir und während der Pause hatte ich zahlreiche Spielgefährten. Es schien, daß sie vergessen hatten, daß ich jüdisch war. Eines Tages, im zweiten Schuljahr, kam die Lehrerin mit Tränen in den Augen an. Sie sagte: "Heute hat unser König Michaj abgedankt. Öffnet eure Bücher auf der Seite, wo sich sein Foto befindet und reißt diese Seite heraus. Reißt auch die Seite mit dem Bild der Königinmutter heraus. Von nun an sind wir eine Republik". Wir trennten die Seiten schweigend heraus. Die meisten unter uns verstanden nicht genau, was dieser Vorgang zu bedeuten hatte, aber meine Eltern erklärten mir, daß wir nun Teil der kommunistischen Welt seien. Einige Wochen später gab es Wahlen. Hunderte von Menschen erfüllten die Straßen. Die kommunistische Partei war die stärkste und sie wurde zu 90% von der Bevölkerung gewählt. Meine Eltern sagten mir, daß wir nun sehr vorsichtig sein müßten und so tun sollten, als ob wir die Kommunisten mögen. Am Ende des zweiten Schuljahres erhielt ich den ersten Preis als beste Schülerin meiner Klasse. Mein Rumänisch war nun perfekt und ich war auch in Mathematik gut; so begann ich das dritte Schuljahr als Musterschülerin der Klasse. Bald wurde ich in der Klassenrat gewählt und wurde zur jungen Pionierin, mit einem roten Tuch um den Hals. Im dritten Schuljahr begannen wir, Russisch zu lernen. Die wurde mein Lieblingsfach und meine Russischlehrerin mochte mich sehr. Wannimmer sie das Klassenzimmer verlassen mußte, bat sie mich, an ihrer Stelle den Unterricht weiterzuführen. Es war ein wonniges Gefühl. Zu Jahresende wurde ich dazu ausgewählt, unsere Schule bei einem Schreibwettbewerb der ganzen Stadt Bukarest zu represäntieren. Ich erhielt den dritten Preis und die Schule war sehr stolz auf mich. Die Schuldirektorin lud mich zu sich ins Büro ein und übergab mir eine Sonderurkunde. Eines Tages,als ich aus der Schule nach Hause kam, fand ich meine Eltern in großer Aufregung vor. Sie hatten einen Brief von der Schwester meines Vaters und ihrer Familie, den Buchbergs, aus Los Angeles erhalten. Über das Rote Kreuz hatten sie es fertiggebracht, uns zu finden und unsere Adresse zu erhalten. Bald erhielten wir regelmäßig CarePakete mit Kleidern und allerlei Leckerbissen wie Schokolade und Kaffee. Aber meine Eltern sagten mir, daß wir nicht darüber reden dürften, da einige unserer Nachbarn neidisch werden könnten. 98 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Dann, eines Morgens, als mein Vater sich zu besonders frühen Stunde zur Arbeit begeben hatte, klopften vier Männer an unser Tor. Meine Mutter öffnete das Tor und lud sie hinein in das Haus. Sie erklärten, daß sie vom Ermittlungsbüro seien und daß sie das Haus durchsuchen wollten, um nachzuprüfen, ob dort Gold oder Dollars versteckt seien. Ich konnte meiner Mutter ansehen, daß sie ziemlich erschrocken war, aber sie sagte nur: "Bitte, suchen Sie, wo immer Sie wünschen!". Sie wühlten das ganze Haus drunter und drüber, in sämtlichen Schränken, in den Betten, in den verschiedenen Kisten und allem, was sich öffnen lies. In der Küche hatten sie Schwierigkeiten, die Dursuchung durchzuführen, da es dort sehr dunkel war und ein großes Durcheinander herrschte. Schließlich, nach zwei Stunden Durchsuchung erklärten sie, daß sie nichts gefunden hatten und verließen unser Haus. An diesem Tag ging ich nicht zur Schule. Meine Mutter saß lange still und betrachtete die ausgeschütteten Schubladen, die Kleider und Dokumente, die in dem ganzen Häuschen zerstreut lagen. Letztendlich machten wir uns an die Arbeit und räumten alles auf. Als mein Vater zurück nach Hause kam, sagte meine Mutter: "Morgen werde ich mich als Mitglied der kommunistischen Partei anmelden. Das ist der einzige Weg, auf dem ich uns vor solchen Durchsuchungen schützen kann". Als Parteimitglied wurde meine Mutter sehr bald zur Vorsitzenden. Sie las viele von den Propagandaschriften, bereitete Vorträge vor und verbrachte Stunden damit, Schlüsselsätze, auf die sie während der Sitzungen zurückgreifen würde, endlos zu wiederholen. Eine der Anführerinnen, eine Jüdin, wurde ihre engste Freundin und kam mehrmals in der Woche zu uns nach Hause, um die Versammlungen mit ihr gemeinsam vorzubereiten. Ihr Name war Valentina. Ich mochte Valentina nicht, weil sie mich immer bat, Dinge für sie zu machen, wobei sie mich immer auf einer eher unangenehmen Art und Weise ansprach. Meine Mutter mahnte mich, sehr vorsichtig mit Valentina umzugehen, da sie ziemlich gefährlich sein könne. Sie könne uns für das kleinste Vergehen bei der Partei denunzieren. Eines Tages, gegen Ende des Winters, brachte meine Mutter drei frische Salatgurken mit nach Hause. Wir aßen liebend gern Salat und die Gurkenzeit hatte gerade erst begonnen, wobei sie noch sehr teuer waren; aber wir konnten es uns leisten, da das Geschäft meines Vaters gut lief. Als meine Mutter gerade dabei war, die Gurken zu schneiden, sahen wir auf einmal Valentina vor dem Tor stehen. Hastig versteckte meine Mutter die Gurken und die abgeschälten Gurkenschalen unter einen Topf in der 99 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Küche, und bemühte sich, anhand eines Küchentuchs den Geruch zu verwehen. Sie blickte mich streng an und sagte: "Valentina darf nicht erfahren, daß wir Gurken haben. Sie wird mich in der Partei dafür denunzieren, daß ich Geld habe für Gurken". Ich wußte, daß ich den Mund halten sollte. Sobald Valentina in das Haus hineingetreten war, sagte sie: "Oh, ich rieche hier Gurken. Wer kann sich denn heutzutage schon Gurken leisten?" Meine Mutter lachte auf und erwiderte: "Aber Valentina, das bildest du dir nur ein, wer kann sich Gurken leisten?". Sie saßen und unterhielten sich eine Weile. Aber Valentina schnüffelte immer wieder mit der Nase herum und sagte: "Ich bin mir sicher, daß es hier nach Gurken riecht". Sie schaute mich mit untersuchendem Blick an, aber ich ließ mich nicht aus der Fassung bringen. Ich erwiderte einfach ihren Blick, ohne mit der Wimper zu zucken. Schließlich verließ Valentina unser Haus; wir lachten laut auf und schnitten unsere Gurken zu Ende. Nichts schmeckte uns jemals so gut! Eines Tages, als ich im dritten Schuljahr war, erhielten wir einen hocherfreulichen Brief aus Czernowitz: meine Großeltern wollten nach Bukarest kommen. Meine Eltern begaben sich umgehend auf der Suche nach einer Wohnung für sie, in unserer Umgebung. Als sie schließlich ankamen, war ich außer mir vor Freude. Ich blieb bei ihnen und übernachtete mehrere Nächte in deren Wohnung. Aber bald wurde mir bewußt, daß sie beide sehr gealtert waren, in den zwei Jahren seitdem ich Czernowitz verlassen hatte. Keiner von ihnen war arbeitsfähig oder im Stand, Geld zu verdienen; daher waren sie auf meine Eltern angewiesen, die ihnen halfen; dabei konnte ich meiner Großmutter ansehen, daß sie mit dieser Lage nicht zufrieden war. Wir bekamen nette Briefe von unserer Familie in Palästina; mein Onkel Srul sprach meinen Großeltern zu, zu ihm und seiner Familie in den Kibbutz zu kommen. Es war die Zeit des Britischen Mandats in Palästina und die jüdische Immigration war illegal. Viele der Einwanderer, die mit dem Schiff nach Palästina kamen, wurden entweder nach Zypern geschickt, wo sie in ein Lager eingesperrt wurden, oder sie wurden nach Europa zurückgeschickt. Trotz all dem bemühten sich viele Juden um Dokumente, damit sie Rumänien verlassen könnten.Meine Großeltern beschlossen, nach Palästina auszuwandern und meine Großmutter schlug mir vor, mich mitzunehmen, während meine Eltern später nachkommen würden. Nach langen Dikussionen sagte meine Mutter, daß wir nun eine unzertrennliche Familie seien und daß wir nicht nochmals auseinandergehen sollten. Ich freute mich sehr, als ich sie dies sagen 100 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 hörte; ich dachte, daß ich mich vielleicht geirrt hätte und daß meine Mutter mich wirklich liebte. Meine Großeltern landeten letztendlich in Zypern, wo sie ein Jahr lang in einem Aufenthaltslager lebten; erst nach der Gründung des israelischen Staates in 1948 konnten sie sich ihrem Sohn Srul im Kibbutz anschließen. Für uns ging das Leben in Rumänien recht friedlich weiter, von der wöchentlichen Anspannung meiner Mutter vor ihren Vorträgen in der kommunistischen Partei abgesehen. Ich wuchs und entwickelte mich rasch. Auf einmal war ich die größte in der Klasse. Dann fand ich eines Tages Blut in meiner Unterhose. Ich war davon erschrocken, da ich keine Ahnung davon hatte, was es bedeutete. Ich war fest davon überzeugt, daß ich mir weh getan und irgendetwas falsch gemacht hatte. Meine Mutter mußte wohl etwas gemerkt haben; zusammen mit meinem Vater sprach sie mich an und fragte mit einer ängstlichen Stimme: "Blutest du?". Ich war unfähig, zu erwidern, wie vom Blitz erschlagen. Meine Mutter kam auf mich zu und vor den Augen meines Vaters zog sie meinen Rock hoch. Ich wäre am liebsten verschwunden vor lauter Scham. Was hatte ich nur falsch gemacht? Was ging mit mir vor? Sie ließen mich eine Weile alleine und unterhielten sich leise untereinander. Dann befahl mir mein Vater, mit im auf den großen Hof zu gehen, da er etwas mit mir besprechen wolle. Wir setzten uns unter einen Baum und er versuchte mir zu erklären, was dieses Bluten zu bedeuten hatte und daß es sich von nun an jeden Monat wiederholen würde. Ich hörte zu und sagte kein Wort. Ich mußte erst über diesen Bombenschlag hinweg. Ich hatte nie etwas davon gehört und nun war meine Großmutter nicht da. Wer sollte mir nun die Dinge erklären? Keine meiner Schulfreundinnen war so weit entwickelt wie ich. Meine Brüste waren noch klein und noch konnte ich sie in der losen Schuluniform verbergen. Ich wollte gerne von meiner Mutter aufgeklärt werden; aber alles was sie tat, war mir die Stofflappen zu zeigen, die sie benutzte und sie erklärte mir, daß ich sie sofort nach jeder Benutzung in kaltem Wasser waschen solle. Ich schwor mir selbst, daß, falls ich selber einmal Töchter haben würde, ich sie auf diese Lebensphase mit mehr Einfühlung und Liebe vorbereite nwürde. Einige Zeit lang war ich sehr entmutigt und erwägte sogar, mich umzubringen; aber dann wurde mir nach und nach klar, daß dies zum normalen Leben gehörte und ich lernte, es zu akzeptieren. Die Zeit verstrich und meine Eltern begannen, die Ausreise nach Israel ins Auge zu fassen, wobei alles in der größten Verschwiegenheit verrichtet werden mußte. Wir fürchteten uns ganz besonders davor, daß 101 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 die Partei über unsere Pläne erfahren würde und daß Valentina über unser Vorhaben, das Land zu verlassen, berichten würde. Letztens Endes fand sie es heraus, daß meine Eltern dabei waren, sich auf die Abreise vorzubereiten. Sie informierte die Parteivorsitzende davon und währends einer der wöchentlichen Versammlungen wurde meine Mutter gerügt, blamiert und als "unerwünschtes Element" aus der Partei entlassen. Zu diesem Zeipunkt wurde klar, daß wir alles so schnell wie möglich abschließen und ausreisen mußten. Da meine Eltern Geld hatten, zahlten sie den vollen Preis für die Reisetickets und Dienste der Joint-Organisation und erhielten die Reisekarten für das Schiff nach Israel. Innerhalb von drei Tagen verkauften meine Eltern unsere Möbel, schlossen das Geschäft und packten die vierzig Kilo Gepäck, die wir mitnehmen durften; so fuhren wir mit dem Taxi zum Bahnhof. Ich nahm von keinem meiner Freunde Abschied und erhielt auch nicht das Abschlußzeugnis des fünften Schuljahres. 102 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 17 Lange Reise in ein Neues Land Wir erreichten den Bahnhof kurz vor Abenddämmerung. Dort fanden wir andere Familien wie die unsere vor, mit kleinen Koffern und Taschen voller Butterbrote in der Hand. Sie wirkten angespannt und mistrauisch. Meine Mutter sagte immer wieder leise vor sich: "Laßt uns endlich losreisen. Ich hoffe, es ist uns niemand nachgeschlichen, der uns nachher aus dem Zug herausholt" – sie meinte damit die Kommunisten oder ihre Parteikollegen, die irgendeinen Makel an ihr oder an unserer Familie finden würde und uns an einen unbekannten Orte verschicken würden). Mir kamen ihre Sorgen unbegründet vor, aber trotzallem empfand ich es als beklemmend. Wir stiegen alle in den Zug von Bukarest nach Konstanza ein, von wo aus wir dann unsere Schiffsreise nach Palästina aufnehmen solltne. Es war Anfang Juni 1950. Alle Passagiere auf dem Zug schienen Juden zu sein, die alle auf dem Weg nach Palästina waren. Viele Leute waren in den engen Abteilen und auf dem Durchgang des Zuges zusammengepfercht. Wir hatten ein Abteil, das wir mit einem Ehepaar teilten, das etwas älter war als meine Eltern. Die Frau saß still am Fenster, während der Mann hin und her rannte und sich aufgeregt mit den Leuten um ihn herum unterhielt. Er stellte sich selbst und seine Frau uns vor. Er fuhr mir über den Kopf mit einem breiten Lächeln und einem Augenzwinker. Eine weitere Dame saß dösend neben der Abteiltür. Der Zug ging in Bewegung. Meine Eltern setzten sich hin und stießen einen großen erleichterten Seufzer aus. Sie waren sehr müde und wollten sich nun etwas ausruhen. Ich, meinerseits, war viel zu aufgeregt, um still sitzen zu bleiben. Ich spürte, daß wir dabei waren, ein neues und aufregendes Leben zu beginnen und wollte keine Sekunde davon verpassen. Ich stellte mich vor das Fenster auf dem Gang, betrachtete die Wälder an uns vorbeigleiten und lauschte nach den Geräuschen des Zuges. Dies war meine erste Reise mit dem Zug und ich genoss es. Ich atmete die kühle Nachtluft ein und war glücklich. Plötzlich spürte ich jemanden ganz dicht neben mir stehen. Es war unser Abteilnachbar. Er hatte den Arm um mich gelegt und berührte meine Brüste. Ich war außer mir vor Wut, riß mich aus seiner Umarmung frei und kehrte in unser Abteil zurück. Meine Eltern schienen zu schlafen. Während ich in der Mitte des Abteils stand, trat er ebenfalls herein und begann, mir über die verschiedenen Städte und Orte zu erzählen, an denen wir vorbeifuhren. Nun näherte er sich mir wieder und legte mir seine beiden Hände auf die 103 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Brust. Ich war ratlos; ich wollte zwar einen Skandal vermeiden und doch konnte ich es nicht ertragen. Für den Rest der Nacht bemühte ich mich, ihm aus dem Weg zu gehen; er kam jedoch immer wieder und tastete mich immer wieder an, die Leute um uns ganz und gar ignorierend. Schließlich kam die Morgendämmerung und wir erreichten den Hafen. Zu meiner Erleichterung verloren wir unsere Abteilnacharn für den Rest unserer Reise aus den Augen, während die Menschenmenge aus dem Zug heraus strömte. Obwohl das Schiff erst am Abend aus dem Hafen auslaufen sollte, stiegen wir alle schon an Bord. Da meine Eltern den vollen Preis für die Schiffsreise bezahlt hatten, erhielten wir eine hübsche Kabine mit drei Betten und einem Waschbecken. Meine Eltern sagten mir, daß sie in der Kabine bleiben würden, aber daß ich mich frei auf dem Deck bewegen dürfe. Meine Mutter fürchtete immer noch, das jemand kommen könnte und uns von dem Schiff herunternehmen würde. Ich war von all den Vorbereitungen und der Geschäftigkeit auf dem Schiff, die sich über den ganzen Tag hinauszogen, fasziniert und verbrachte den größten Teil des Tages damit, das Ganze zu beobachten. Es war ein Traum, der in Erfüllung ging. Jahrelang hatte ich Abenteuergeschichten über Erforscher in Afrika und über die Entdeckung Amerikas gelesen; ich wollte schon immer eine Schiffsreise unternehmen. Nun war ich maßlos aufgeregt. Ich redete sehr wenig mit anderen Reisegästen auf dem Schiff, wobei jeder seine Erwartungen von dem neuen Land kundgab. Der Eine sagte: "Wir begeben uns in ein dürres Land, in dem es nur Sand, Kamele und Wüsten gibt". Ein Anderer sagte: "Wir werden in einem jüdischen Staat leben, und Sie sollten sich jetzt allmälig wie ein Jude benehmen und am Sabbat nicht rauchen". Ich hörte all diesen Leuten zu, aber in meinem Herzen hatte ich meine eigene Sicht des neuen Landes: ein Land stolzer, hart arbeitender Menschen, die sich bemühten, frei und unabhängig zu sein. Ich sehnte mich sehr danach, selber so wie diese Menschen zu sein. Am Abend war das Schiff endlich bereit, den Hafen zu verlassen. Alle sammelten sich auf dem Deck an und man konnte sich nicht bewegen. Während wir eine gute Kabine erhalten hatten, da wir aus eigener Tasche dafür bezahlt hatten, hatten die meisten der anderen Fahrgäste ihre Reisetickets von der Jüdischen Agentur erhalten und mußten sich daher mit den engen Räumen des unteren Decks zufrieden geben. Als wir tief mitten im Meer waren, umarmte meine Mutter mich und meinen Vater und sagte: "So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kann uns niemand mehr anhalten". Wir stiegen in unsere Kabine und verzehrten etwas von den Nahrungsmitteln, die wir mitgebracht hatten. Plötzlich sagte meine 104 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Mutter ganz ruhig zu meinem Vater: "Weißt du, daß auf dem Zug ein Mann wa, der Littika dauernd an die Brust gefaßt hat. Ich bin so froh, daß wir ihn nicht mehr gesehen haben". Als ich diese Worte hörte, verschluckte ich mich fast. Ich konnte es nicht fassen, daß sie sein Benehmen wargenommen hatte und kein Wort gesagt hatte. Ich verließ die Kabine und hielt mich lange auf dem Deck auf, die Augen auf die dunklen Wellen gerichtet und in den finsteren Horizont blickend. Ich fühlte mich sehr einsam und sehnte mich nach meiner Baba. Ich liebte es, auf der See zu reisen; erst fuhren wir einen ganzen Tag und eine Nacht lang auf dem Schwarzen Meer mit seinen schwarzen Gewässern, dann glitten wir am frühen Morgen nach und nach durch die Bosphorus-Enge in das blaue Marmara-Meer. Dann machte ds Schiff direkt gegenüber von Istanbul Halt. Wir waren alle hingerissen von der Schönheit dieser Stadt: die grünen Abhänge, die Minarette und Moscheen und die vielen roten Hausdächer. Es war atemberaubend; ich setzte mich an einen stillen Ort auf dem Deck und schrieb ein Gedicht in drei Strofen in mein Tagebuch. Meine Sprache war nun Rumänisch, es war die Sprache, in der ich mich nun am wohlsten fühlte und die Sprache, in der ich gebildet war. Schließlich, nach zwei weiteren Tagen und Nächten, hörten wir eines Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, ein lautes Getöse und eine große Aufregung auf dem Deck. Wir näherten uns der Stadt Haifa. Ich stand dort oben, den Sonnenaufgang betrachtend und in Erwartung, die Sandlandschaften und die Kamele, von denen so viel die Rede gewesen war, demnächst zu erblicken. Bald konnten wir Haifa in ihrer vollen Pracht sehen. Es war zwar nicht so atemberaubend wie Istanbul, aber es war nicht weit davon entfernt. Wie konnten die Leute sich in ihren Beschreibungen dermaßen geirrt haben? Die Landung, das Abladen, die Registrierung und die administrativen Angelegenheiten, die abgeschlossen werden mußten, bevor wir das Schiff verließen, dauerten mehrere Stunden. Schließlich standen wir nun wieder auf festem Boden; als wir uns gerade darauf vorbereiteten, uns in eine große Halle zu begeben, kam ein Mann in Uniform auf uns zu und besprühte uns mit DDT. Der Geruch war uns bekannt, da wir DDT bei uns zu Hause benutzten, um Ungeziefer umzubringen. Es bekümmerte uns nicht weiter. Wir lächelten den Mann an und hatten es eilig, unserer israelischen Familie zu begegnen. Sie waren da – Tarzan, der Bruder meiner Mutter, Efrajm, Meir, und Isjue, die Brüder meines Vaters. Meine Baba war nicht mit dabei; Tarzan erklärte mir auf Deutsch, daß sie nicht 105 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 mehr gut reisen konnte, aber daß es ihr und Großvater gut ginge und daß ich sie bald wieder sehen würde. Wir setzten uns alle zusammen an einen Tisch in einem Restaurant und alle sprachen aufgeregt auf Deutsch. In diesem Augenblick wude mir klar, daß ich nie wieder Rumänisch reden würde und daß für mich nun eine neue Zeit begann. 106 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 18 Ein neuer Anfang Der kleine und überfüllte Bus verlies Haifa und fuhr auf einer engen Straße in den Kibbutz, auf dem zwei meiner Onkel lebten, Mischmar Haemek. Wir fuhren durch die grünen Hügel und Felder und an ein paar Häusern vorbei. Plötzlich sah ich braune Zelte in de Mitte eines der Felder. Ich fragte meinen Onkel, was diese Zelte bedeuteten; er erklärte mir, was es war und daß viele Flüchtlinge, so wie wir, nach Israel gekommen waren und daß es nicht genügen Häuser für alle gab, so daß diese Leute in Zelten leben mußten. Er fügte noch hinzu: "Aber ihr kommt mit uns und werdet mit uns im Kibbutz leben". Ich fühlte mich wohl dabei: eine neue Familie, ein neues Land und jetzt auch noch ein Kibbutz – genau die Menschen, die ich so sehr bewunderte. Ich war sehr aufgeregt. Der Bus fuhr in einen Weg hinein, zu dessen beiden Seiten schöne Palmenbäume aufgereiht waren. Mein Herz klopfte vor lauter Vorfreude. Dann machte der Bus endlich halt an einem offenen Platz, der von gepflegten Rasenflächen, Bäumen und Blumensträußen umringt war. Es war Mittagszeit und die Hitze und die Sonne schlugen mir auf den Kopf ein, wie ich es bis dahin noch nie erlebt hatte. Ich sah Leute auf den Kibbutzwegen schreiten. Sie trugen alle kurze Hosen, einen kleinen Sonnenhut und offene Sandalen. Sie sahen alle gebräunt und gesund aus. Auf einmal kam ich mir mit meinem Blümchenkleid und meinen feinen Schuhen fehl am Platz vor. Ich fühlte mich blass und farblos neben diesen Menschen. Ich wollte so gerne so aussehen wie sie. Wir erreichten Manias und Meirs Haus. Sie hatten eine kleine Einzimmerwohnung mit einer kleinen Veranda auf der zweiten Etage eines kleinen Gebäudes. Alles sah sehr adrett und geschickt eingerichtet aus. Auch eine Dusche und eine Toilette hatten sie. Ich dachte zu mir selbst: wie schön, daß sie eine eigene Dusche besitzen in einer dermaßen kleinen Wohnung. Alle waren sehr freundlich und bekundeten uns Flüchtlingen ein großes Interesse; dabei konnte ich mich nur mit meinen Tanten und Onkel unterhalten, da all meine Cousins nur Hebräisch sprachen und ich überhaupt keine Kenntnisse in dieser Sprache besaß. Unser erster Besuch auf dem Kibbutz galt meiner anderen Großmutter, Sarah, der ich noch nie begegnet war. Sie lebte in einer kleinen Einzimmerwohnung in einem kleinen Gebäude, mit Nachbarn ihres Alters. Sie war sehr anders als meine Baba, eine kleingewachsene Frau mit einer Perrücke auf dem Kopf und einem langen schwarzen Kleid. Sie 107 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 war sehr erfreut und aufgeregt, uns zu sehen und hatte allerlei Süßigkeiten für uns vorbereitet. Während wir bei ihr in ihrem Zimmer saßen, trat ein hübsches junges Mädchen hinein. Sie wurde uns als Schiffra vorgestellt; sie kam auf mich zu und sprach mich auf Jidisch an. Es stellte sich heraus, daß sie das Konzentrazionslager in Polen überlebt hatte und von Frojku und Jadja - mein Onkel und meine Tante aus dem Kibbutz Mischmar Haemek – adoptiert worden war. Mir kam sie wie das Idealbild eines Sabra vor – obwohl sie nicht in Israel geboren worden war; es freute mich sehr, daß es wenigstens eine junge Person gab, die sich mit mir unterhalten konnte. Sie sah wunderschön aus mit ihrer gebräunten Haut und ihren großen schönen blauen Augen. Sie trug eine tief auf der Stirn heruntergezogene "Tembel"-Sonnenmütze, kurze Hosen und ein ärmelloses Hemd. Sie setzte sich auf den kühlen Fliesenboden und blickte uns mit einem ernsten Ausdruk an. Ich verfiel sofort ihrem Charm. Gegen Abend wurde ich gebeten, mich zu Jadjas und Frojkes Wohnung zu begeben und dort zu übernachten, während meine Eltern bei Meir und Mania unterkamen. Wir schliefen alle auf Matrazen am Boden und ich trug meine dünnes, besticktes Nachthemd, daß ich aus Rumänien mitgebracht hatte. Auch dies wirkte fehlt am Platz, wo doch alle hier nur kurze Hosen und Baunwollhemden trugen. Ich war noch immer in einem Zustand großer Aufregung und konnte stundenlang nicht einschlafen. Mir war auch sehr heiß, da ich nicht an das Klima gewöhnt war. Gegen Morgen schlief ich schließlich ein, während ein früher Morgenwind sanft durch die Fensterläden hineindrang. Am nächsten Tag nahm Frojke – mit der Zeit stellte sich heraus, daß er mein Lieblingsonkel war; er hatte große Ähnlichkeit mit meinem Vater, nur war er langsamer und sanfter – uns auf eine Besichtigung des Kibbutz. Wir sahen Kühe, Schafe und Hühner und mir schien, daß ich dort für immer leben wollte. Dann führte er uns in den wunderschönen Mischmar-Haemek-Wald. Die Luft dort war heiß und trocken, aber es schwebte dort etwas Zauberhaftes. Das Lauschen des Windes in den Bäumen, das Zwitschern der Vogel, das Geknister der Kiefern, alles wirkte so friedlich und schön. Ich ahnte noch nicht, daß dieser Wald für mich ein Refugium werden sollte und der Ort, in dem mein Vater und ich unsere bedeutsamsten Unterhaltungen im Laufe der nächsten zwei Jahre führen würden. Alles was ich wußte, war, daß ich mich in diesen Wald wie von einem heimlichen Magnet angezogen fühlte; dies umwob diese neue Phase meines Lebens mit nur noch mehr Mysterium und Aufregung. 108 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Nach einigen Tagen der Entspannung auf dem Kibbutz und nachdem wir uns schon etwas an die Hitze, an die Nahrung und an die Menschen gewöhnt hatten, begannen meine Eltern davon zu reden, nach Arbeit und einer Wohnung in der Stadt zu suchen. Ich hätte liebend gern meine Baba wiedergesehen, aber es wurde mir erklärt, daß der Kibbutz zur Zeit wegen einer Maul- und Klauenseuche in Karantäne sei und ich nun für einige Zeit hier bleiben müsse. Meine Eltern mußten abreisen und konnten erst in zwei Wochen zurückkehren. Ich gab mich mit der Lage ab und blieb bei meinem Onkel und meiner Tante. Da sie beide jeden Morgen zur Arbeit gehen mußten, hatten sie einen Plan für mich vorbereitet: ich sollte jeden Morgen mit Manja im Kuhstall arbeiten gehen; dann würden wir zu mittag essen und danach nach Hause gehen, um uns etwas auszuruhen; in den Nachmittagsstunden sollte ein Kibbutzmitglied vorbeikommen, um mir Hebräisch beizubringen; in den Abendstunden könnte ich dann meine Zeit mit der Familie verbringen. Es wurden mir ein paar kurze Hosen, eine einfache Hemdbluse und ein paar Sandalen ausgehändigt. So konnte ich jeden Tag zur Arbeit gehen. Da ich num jeden Tag mit Manja zur Arbeit ging, zog ich in ihre Wohnung und übernachtete dort. Wir standen früh morgens auf und begaben uns in den Kuhstall, ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben. Draußen war es noch dunkel, die Luft war frisch und etwas kühler als während des Tages. In dem Kuhstall gab man mir ein paar schwere Stiefel und einige Erklärungen dazu, wie man den Stall ausmistet. Es arbeiteten dort noch zwei andere Kibbutzmitglieder und ich merkte, daß alle Respekt vor Manja hatten und ihren Anweisungen folgten. Nach ungefähr zwei Stunden, nachdem wir den Stall geputzt, die Kühe gemolken und gefüttert hatten, setzten wir uns alle hin, um zu frühstücken. Tee und Milch nahmen wir aus dem Kühlraum; Brot, Käse und Gemüse für den Salat wurden aus dem gemeinschaftlichen Speisesaal gebracht. Wir saßen auf Kisten und aßen, während alle um mich herum mir einzelne Vokabeln auf Hebräisch beibrachten. Ich war so glücklich, wie ich es nur sein konnte. Weder der Geruch, noch der Dreck in dem Kuhstall störten mich; ich fühlte mich wichtiggenommen und allen anderen gleichgestellt. Gegen Mittag begaben wir uns in die gemeinschaftliche Dusche für Frauen. Während ich unter dem warmen Wasserstrahl der Dusche stand, genoß ich jeden Tropfen. Ich hatte ein zweites Paar Shorts und eine andere Bluse, die Manja mir gegeben hatte, um saubere Kleider nach der Dusche zu haben. Ich hatte soweit keinen Gebrauch für meine Kleider aus Rumänien. Nach der Dusche nahm Manja mich in den gemeinschaftlichen Speisesaal des Kibbutzs, der aus einer kleinen 109 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Holzbaracke bestand; es war dort sehr eng und laut; eine große Menge von Leuten in Arbeitsskleidung saßen dort um den Tisch gedrängt. Jeder hatte einen eigenen Teller und eine Gabel, aber es gab nur ein einziges Messer, das von allen abwechselnd benutzt wurde. Ein Kibbutzmitglied kam mit einem Rollwägelchen durch den engen Gang und legte jedem etwas Essen auf den Teller. Es gab Kartoffeln, einen kleinen Fleischkloß und etwas Tomate. Es schmeckte alles wunderbar. Wir aßen ziemlich schnell und warfen die Essensreste in einen kleinen Metallbehälter, der in der Mitte des Tisches stand. Ich blickte um mich herum und beobachtete die Leute. Jeder schien jeden zu kennen. Manche lächelten einander an, während sie sich unterhielten, andere aßen schweigend – wie eine große Familie. Hier und da kam jemand an uns heran und fragte nach mir. Sie lächelten mich an; nur die älteren Menschen warfen mir ein oder zwei Worte auf Deutsch zu. Mir wurde klar, daß ich so schnell wie möglich die wunderbare hebräische Sprache lernen mußte, aber irgendwie fiel es mir extrem schwer, die neuen Worte zu behalten. Es kamen immer wieder die russischen Worte dazwischen, die mich durcheinander brachten. Nach dem Mittagessen hielten wir einen Mittagsschlaf. Es schien, daß alle etwa eine Stunde schliefen. Nachdem Meir von seiner Arbeit im Zitronen-Hain zurück kehrte, legten wir uns alle hin. Anfangs war ich viel zu aufgeregt, um am frühen Nachmittag schlafen zu können. Nach und nach lernte ich, die Augen zu schließen und für kurze Zeiten einzuschlummern, aber ich hatte nie wirlich Lust zu schlafen. Ich wäre viel lieber nach draußen gegangen, um meinen Blick umherschweifen zu lassen und etwas zu unternehmen. Dann kam der Freitagabend. Man duschte sich am Nachmittag und zog festliche Kleider an, wobei die festlichen Kleider aus einem weißen Hemd und einer blauen Hose bestanden. Auch ich wollte mich hübsch machen und holte meinen roten Rock mit den perlenverzierten Taschen und eine hellgrüne Bluse hervor. Für mein Empfinden waren dies die schönsten Kleider, die ich besaß. An diesem Abend sollte ich zum Freitagabendessen mit Jadja und Frojku begeben. Schifra kam kurz zu uns nach Hause vorbei; sie unterhielt sich sehr aufgeregt mit Jadja, während sie mich betrachetete. Ich wußte nicht, was sie sagten, aber es war deutlich zu erkennen, daß Schifra meine Kleider mit einem Ausdruck des Entsetzens ansah. Schließlich entschied ich mich, Jadja zu fragen, was los war. Sie blickte mich mit einem freundlichen Lächeln an und sagte nur: "Mach dir keine Sorgen, es ist nichts Ernstes. Schifra meint, daß du nicht passend angekleidet bist für den Kibbutz, aber ich bin der Meinung, daß nicht darauf Acht geben solltest". So begaben wir uns in den Speisesaal des Kibbutz. Den ganzen Abend lang schaute ich immer 110 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 wieder auf meine Kleider und auf die der Anderen: Schifra hatte recht gehabt, ich war völlig falsch angezogen. Ich würde diesen Rock und diese Bluse nie wieder anziehen. Der folgende Tag war ein Samstag und ich ging wieder mit Frojku durch den Kibbutz spazieren. Ich begann allmählig, mich auszukennen und mich dort wohl zu fühlen. Am Nachmittag trafen wir uns alle gegen vier Uhr bei Manja zum Tee. Nun lernte ich meine anderen Cousins kennen: Eddi, Jadjas und Frojkus einziges Kind, sowie Tamar und Chanan, die Kinder von Meir und Manja. Eddi war vier Jahre älter als ich, Tamar war sieben Jahre älter und Chanan etwas jünger als ich. Ich konnte erkennen, daß Eddi und Tamar neugierig auf mich waren; sie lächelten mich immer wieder an, während Chanan mich völlig ignorierte. Ich konnte mich mit keinem von ihnen unterhalten. Schifra setzte sich neben Tamar und sprach mit ihr über irgendetwas, dann sagte sie laut: "Was für ein Name ist das, Melitta? Es klingt nicht nach Hebräisch und Hadassa ist kein passender Name für ein junges Mädchen. Ich schlage vor, wir nennen sie Elite". Ich wurde ganz rot und mein Herz klopfte: ich hatte soeben einen neuen Namen erhalten, einen Namen, der diesem Ort angemessen war, einen Namen, der mir dazu verhelfen würde, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Wie aufregend! Am nächsten Tag begegnete ich Tamar in der Zimmerwohnung ihrer Eltern. Sie war hochschwanger und arbeitete nicht regelmäßig. Sie und ihr Mann Gideon waren während des Unabhängigkeitskrieges in der I.D.F. gewesen, die israelische Armee, und waren Kriegsgefangene der jordanischen Armee gewesen. Ich hatte einen immensen Respekt für sie und hoffte, bald im Stand zu sein, mich mit ihr zu unterhalten. Sie zeigte mir einige Kleider, die sie für mich mitgebracht hatte: ein parr Shorthosen und eine hübsche, bestickte weiße Bluse. Später erfuhr ich, daß dies eine jemenitische Bluse war und als die schönste Kleidung galt, die ein junges Mädchen tragen konnte. Manja erklärte mir, daß Tamar für eine gewisse Zeit diese Kleider nicht tragen könnte, so daß ich sie solange behalten konnte, wie ich wollte. Tamar setzte mich dann vor sich auf einen Stuhl, kämmte mein Haar und anstatt der zwei Zöpfe, die ich gewöhnlich trug, steckte sie mir das Haar zurück in einen Pferdeschwanz, in dem mein lockiges Haar nach hinten aufgebauscht war. Die war die Frisur, die sie selber trug und wir hatten beide ähnliches Haar. Ich sagte mir, daß dies ein weiterer Schritt zu meiner neuen Identität als Sabra sei, nach der ich mich so sehr sehnte. 111 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Meine Hebräischkenntnisse machten große Fortschritte und ich wurde in die Wäscherei versetzt, in der Jadja arbeitete. Ich lernte rasch und war sehr bemüht, mich nützlich zu machen; alle mochten mich. Dann lernte ich Uka kennen, eine Freundin von Manja; ich schloß mich ihr an und begann, mit ihr die Schafe zu verpflegen. Nach zwei Wochen kamen meine Eltern zu Besuch. Sie hatten eine Wohnung gefunden und mein Vater sollte demnächst seine Arbeit in einem Bauunternehmen aufnehmen. Sie sahen zufrieden und entspannt aus und blickte mich fassungslos an.: "Du siehst ja wie ein Kibbutznick aus", sagte meine Mutter. Meine Tanten und Onkel besprachen meine Zukunft mit meinen Eltern. Es wurde vorgeschlagen, daß ich im Kibbutz bleibe und dort den Mossad - die Kibbutzschule - besuche. Meine Onkel überzeugten meine Eltern davon, daß es sich um eine hervorragende Schule handele und daß ich glücklich sei, dort lernen zu dürfen. Nach einem langen Tag von Planungen verabschiedeten meine Eltern sich und versprachen, uns in zwei Wochen wieder zu besuchen. Mir war es recht; ich lernte so viele neue Dinge über den Kibbutz und seine Mitglieder und war nicht wirklich daran interessiert, mit meinen Eltern wegzufahren. Manja hatte soeben ihre Zeit im Kuhstall beendet und sollte nun in die Gemeinschaftsküche übergehen. Der neue und schöne Speisesaal war schon fast fertiggebaut und sie begann nun, die neue dazugehörende Küche zu organisieren. Sie fragte mich, ob ich mit ihr arbeiten wolle und die neue Küche putzen und sie für die Eröffnungsfeier vorbereiten wolle. Ich freute mich sehr über das Angebot; es war für mich die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen und den ganzen Tag Hebräisch zu sprechen. Ich war dermaßen eifrig, mich zu beweisen, daß ich täglich viele Stunden arbeitete und von allen für meine Arbeit gepriesen wurde. Zwei Wochen verstrichen und meine Eltern kamen wieder zu Besuch. Diesmal brachten sie einen Brief von der jüdischen Agentur, eine Verpflichtung an den Kibbutz, für die Kosten des Zimmers und die Verpflegung in der Schule aufzukommen. Sie brachten mir ebenfalls neue Kleider, die sie mit dem Geld gekauft hatten, welches sie von der jüdischen Agentur erhalten hatten. Meine Onkel sagten, daß ich nun ein Gespräch mit dem Schuldirektor haben müsse; er sollte entscheiden, in welche Klasse ich kommen solle. Kurz nach dem Mittagessen, als alle sich shlafen legen wollten, beschlossen mein Vater und ich, einen Spaziergang im Wald zu machen. Dies war der Anfang einer Gewohnheit, die wir lange Zeit weiterführten: jedesmal wenn meine Eltern mich zweimal im Monat besuchten, gingen mein Vater und ich am 112 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Samstagmittag im Wald spazieren. Bei diesem ersten Besuch entdeckten wir viele ruhige und schöne Orte im Wald. Wir beschlossen, bei jeden Spaziergang einen neuen Weg einzuschlagen, um die verschiedenen Teile dieses großen Waldes kennenzulernen. Während unserer Spaziergänge erzählte mir mein Vater aus seiner Kindheit und Jugend und über Czernowitz; ich erzählte ihm von den Dingen, die ich im Kibbutz kennenlernte. Dies waren herrliche Momente des Zusammenseins und des gegenseitigen Austauschs. Eines Tages nahm mein Onkel Frojku mich zu dem Schuldirektor. Es war ein großwüchsiger und ernstblickender Mann; er stellte mir zahlreiche Fragen auf Hebräisch. Dann gab er mir eine kleine Prüfung in Mathematik. Schließlich sagte er, daß es zwei Möglichkeiten gäbe: ich könnte entweder in eine Klasse kommen, die zum größten Teil aus Neueinwanderern aus verschiedenen Ländern bestand, die allerdings alle etwas älter waren als ich, oder ich könnte in eine Klasse von jüngeren Kindern gehen, die alle aus dem Kibbutz kamen. Ich blickte meinen Onkel an und sagte: "Ich möchte mit den Kindern aus dem Kibbutz zusammen sein". Die beiden Männer lächelten mir zu und der Direktor sagte: "Gut, dann kommst du in die "Schibolim16"-Gruppe, mit deinem Vetter Chanan". Auf dem Rückweg nach der Begegnung mit dem Direktor wurde mir klar, daß ich eine große Entscheidung treffen mußte: "Von nun an ist Rumänisch für mich abgestorben. Ich werde diese Sprache nie wieder sprechen. Alles, was ich bisher getan habe, ist unwichtig. Ich muß mich wie eine Sabra verhalten, ich möchte Schiffra und Tamar ähneln, so gut wie möglich. Am darauffolgenden Samstag nahm ich mein Tagebuch, daß auf Rumänisch beschrieben war, das letzte Buch, daß ich gelesen hatte – "40 Tage auf dem Musa Dag" –, sowie den roten Rock mit den perlenverzierten Taschen, und begab mich alleine in den Wald. Dort grub ich ein kleines Loch in die Erde, steckte darin all jene Gegenstände und zündete darüber ein kleines Feuer an. Ich saß vor diesem kleinen Lagerfeuer und spürte, wie ich mich von meiner Vergangenheit entfesselte. Danach löschte ich das Feuer mit großer Vorsicht, verschüttete alles mit etwas Erde und kehrte erleichtert und befreit in den Kibbutz zurück. 16 Auf Hebräisch "Weizensamen". In der Kibbutzgesellschaft, in der Kinder über Jahre zusammen in gemeinschaftlichen Räumen aufwuchsen, war es üblich, jeder Gruppe einen eigenen Namen zu geben. Meistens wurden dazu Namen von Agrarpflanzen gewählt, als Ausdruck der Verbundenheit der Kibbutzgesellschaft zur Agrarlandschaft. 113 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Kapitel 19 Ich werde zur Sabra Dann, als meine Eltern an einem Samstag mich wieder besuchten, wurde mir angekündigt, daß ich nun gehen dürfe, um meine Eltern in Haifa zu besuchen und auch meine Großmutter, die in einem anderen Kibbutz lebte, in Ma'abarot. Als der Sabbatbesuch zu ende ging, packte ich meine Sachen ein und stieg mit meinen Eltern zusammen in den Bus nach Haifa. Ich hatte noch zwei Woche frei, bis zu Beginn des Schuljahres; ich wünschte, so in diesen zwei Wochen viel wie möglich von Israel zu sehen. Meine Eltern lebten zur Untermiete in einem Zimmer einer Vierzimmerwohnung, die sie sich mit drei weiteren Familien teilten; in der Mitte der Wohnung gab es einen großen Flur, den alle sich teilten. Den Balkon teilten meine Eltern mit der einen Familie und die Küche teilten sie mit einer aneren. Das Bad und die Toilette wurde von allen vier Familien gemeinsam benutzt, so daß jeder auf jeden Rücksicht nehmen mußte. Die Wohnung befand sich auf der vierten Etage eines großen arabischen Etagenhaus; von unserem Balkon aus konnte man den wunderschönen Karmelberg sehen. In der ersten Nacht setzte ich mich auf den Balkon und betrachetete die Lichter von Haifa. Es war so schön, wie ein belichteter Weihnachtsbaum, und ich konnte nicht schlafen gehen. Am nächsten Morgen kam nun endlich der hochersehnte Moment, als meine Baba uns besuchte. Ich hatte sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen und ich war sehr erfreut festzustellen, daß sie gut und zufrieden aussah. Mein Vater war an diesem Tag früh zur Arbeit gegangen und meine Mutter erklärte mir, daß sie und Baba eine wichtige Aufgabe zu verrichten hatten: nämlich ein paar Diamanten zu suchen, die in zwei Daunenkissen verborgen worden waren, die wir aus Rumänien mitgebracht hatten. Sie hatte versucht, die Steine allein wiederzufinden, aber es schien eine unmögliche Aufgabe zu sein, da sie in kleine weiße Wattebäuschchen eingenäht worden waren; nun mußte jedes Stück Daunen sorgfältig untersucht werden, in der Hoffnung, diese wertvollen kleine Steine wiederzufinden. Wenn ich die nötige Geduld dazu aufbrächte, könnte ich ihnen mithelfen. Wir bereiteten uns ein paar Butterbrote in der Küche vor, während wir sorgfältig darauf achteten, innerhalb der Ecke, die uns zugeordnet war, zu bleiben; danach sperrten wir uns in unser Zimmer ein. Erst öffneten wir 114 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 das eine Kissen; wir saßen auf dem Boden, mit dem Daunen um uns herum zerstreut. Wir betasteten sorgfältig jedes Stück und steckten es in den Kissenbezug zurück. Nach langen Stunden des Suchens fand meine Großmutter den ersten Stein und gegen Abend, nach einem langen und anstrengenden Tag, fand ich den zweiten. Meine Mutter war erschöpft, aber auch zufrieden. Sie erklärte, daß sie mit dem Geld, daß sie für den Verkauf dieser beiden Steine erhalten würden, es ihnen ermöglichen würde, einen Raum zu mieten, in dem sie wieder ihre eigene Marmorwerkstadt aufbauen könnten. Innerhalb weniger Wochen wurde der Plan verwirklicht und meine Eltern begannen, ihre eigene Werkstadt in der Umgebung der Haifabucht zu führen. Ich, meinerseits, wartete sehnsüchtig darauf, in den Kibbutz zurückzukehren; aber erst mußte ich noch meine Baba in ihrem Kibbutz besuchen und nachsehen, wie es meinem Großvater Lejser erging. Sie lebten in einem kleinen Haus neben dem schönen Speisesaal des Kibbutz Ma'abarot. Es war eine sehr zentrale Lage und meine Baba war damit höchst zufrieden. Mein Großvater, wie immer, schlief die meiste Zeit und stand nur dann und wann auf, um etwas zu essen oder ein paar Schritte in dem kleinen Zimmer zu machen. Manhmal saß er auf einem Stuhl vor dem Hauseingang und betrachtete die vorbeigehenden Leute. Mein Onkel Tarzan und seine Frau Zipora waren lieb und rücksichtsvoll und besuchten täglich meine Großeltern auf dem Weg zum Speisesaal. Dabei brachten sie immer irgendeinen Leckerbissen mit; sie hielten sich jedesmal eine Weile dort auf und unterhielten sich mit ihnen auf Deutsch. Es gab noch weitere Kibbutzmitglieder in Ma'abarot, die meine Großeltern aus Czernowitz kannten und öfters bei ihnen vorbeiskamen, um sich mit ihnen zu unterhalten. Ich blickte meine geliebten Großeltern an und dachte: "Endlich haben sie ein gutes Leben und sie können ihre alten Tage genießen". Sie hatten auch drei wohlgeratene Enkelsöhne auf dem Kibbutz, nur konnten sie sich leider nicht mit ihnen verständigen, da meine Großeltern kein Hebräisch konnten. Ich blieb eine ganze Woche bei meiner Baba. Ich erzählte ihr alles über unsere Reise nach Israel und über den anderen Kibbutz. Sie fand an jeder Einzelheit meiner Geschichten Freude. "Ich habe großes Glück, daß ich es noch erleben konnte, wie deine Familie wieder zusammen gekommen ist; dein Vater, deine Mutter – wer könnte es glauben, was wir alles durchgemacht haben. Und nun seid ihre alle glücklich und gesund hier in Palästina. Ich habe nun nur noch einen Wunsch: noch so lange zu leben, daß ich auf deiner Hochzeit tanzen kann". Wir lachten beide über diesen Gedanken und umarmten uns fröhlich. 115 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 An dem letzten Tag, bevor ich meine Großeltern verließ, um in meinen Kibbutz zurückzukehren und das Schuljahr zu beginnen, setzte mich Baba vor sie hin, vor dem Fenster ihres Häuschen. Sie sprach zu mir: "Littika, weißt du, ich sitze hier jeden Tag und sehe mir die hübschen Mädchen an, die hier vorbeigehen. Es gibt hier im Kibbutz einige junge Mädchen, die wirklich sehr schön sind - aber keine, auch nur eine Einzige, die halb so schön ist wie du. Es freut mich sehr zu sehen, daß du zu einem lieblichen jungen Mädchen herangewachsen bist. Ich hoffe, daß du im Leben weiterhin so viel Glück haben wirst". Ich hörte ihr zu und wußte, daß sie es übertrieb und bemüht war, mir gegenüber wohlwollend zu sein und mir eine Freude zu machen, und doch war es ein wonniges Gefühl, zu wissen, wie sehr sie mich schätzte. In Zeiten von Not und Schmerzen (trying moments) erinnerte ich mich immer wieder an ihre Worte und mußte immer wieder dabei lächeln. Nach dem langen Sommer kehrte ich nach Mischmar Haemek zurück. Es war ein neuer Anfang. Nun ergab sich die Gelegenheit für mich, eine Sabra zu werden und zu beweisen, daß ich im Stande war, wie alle anderen Menschen im Kibbutz zu sein. Dieses Mal hatte ich das Gefühl, daß ich dies aus eigenem Willen tat und daß es nur an mir lag, wie gut ich mich integrieren würde. Als ich im "Mossad", die Kibbutzschule, die auf einer Anhöhe lag, ankam, lernte ich Dina, unsere Leiterin, kennen; sie war eine liebe und freundliche Frau, die für unsere Altersstufe zuständig war. Sie zeigte mir mein Zimmer, daß ich mit drei weiteren Jugendlichen teilte, einem Mädchen und zwei Jungen. Sie erklärte mir, daß auf dem Kibbutz Mädchen und Jungen im gleichen Zimmer schlafen, wie in einer Familie. Die Mädchen erhalten die Betten auf der einen Seite des Zimmers, und die Jungen diejenige auf der anderen Seite. Wir sollten uns nicht darüber zieren, ein gemeinsames Zimmer zu teilen und wir sollten uns ebenfalls das Badezimmer teilen. Ich hatte schon vorher davon gehört, bevor ich in der Schule ankam, aber nun war ich sehr besorgt. "Ich geniere mich ja sogar vor anderen Mädchen, wie kann ich da mit Jungen ein Zimmer und das Bad teilen?". Dina blickte mich an und schien meine Gedanken zu verstehen. Sie sagte: "Du wirst dich daran gewöhnen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du deine Periode hast, dann benutze die Dusche der "schamvollen Mädchen"". Dabei wurde mir klar, daß "die Dusche der schamvollen Mädchen" wohl für die Mädchen gedacht war, die ihre Periode hatten, aber auch für solche, die sich einfach zu sehr genierten. Ich verstand, daß es also eine Ausweichmöglichkeit aus dieser Lage gab. 116 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Neben meinem Bett stand ein Schränkchen, in dem ich persönliche Gegenstände unterbringen konnte. Ich legte meine paar Sachen dort ab und ging draußen in der Umgebung des Gebäudes hin und her. Es kamen noch andere Jugendliche mit ihren Sachen an, die in ihre Zimmer eingewiesen wurden. Unter den Kibbutzkindern gab es auch zwei oder drei Stadtkinder, die durch ihr beklemmtes Verhalten auffielen. Ich fühlte mich genauso wie sie, beschloß aber, erst abzuwarten, bis ich all meine Klassenkamaraden gesehen hätte, bevor ich mich mit jemandem anfreundete. Am späten Nachmittag brachte Dina uns alle zusammen in einem Klassenraum, der auf der gleichen Etage wie unsere Zimmer lag. Sie hieß uns alle willkommen und erklärte uns unseren zukünftigen Tagesablauf. Um sechs Uhr morgens würde uns eine laute Klingel wecken. Um 6:30 Uhr sollten wir uns in den Sportsaal begeben und dort Morgensgymnastik machen – von der ich wußte, daß sie von meiner hübschen Kusine Schiffra gegeben wurde. Um sieben würden wir frühstücken und um acht sollten wir uns in unserem Klassenraum befinden, um den Schultag zu beginnen. Bevor wir uns in den Klassenraum setzten, sollten wir unsere Betten machen und die Zimmer aufgeräumt hinterlassen. Im Laufe des Vormittags gäbe es eine Pause, während der wir frisches Obst zu essen erhalten würden, und zu Mittag würde wir alle gemeinsam unser Mittagessen einnehmen. Danach hätten wir Zeit bis 2Uhr nachmittags, um uns auszuruhen; danach müßte jeder sich zu derjenigen Arbeit melden, die ihm zugeteilt worden war. Jedes Quartier und jeder Schüler sollte auf einem anderen Gebiet und Ort arbeiten. Dann erteilte sie jedem seine Aufgabe für das Schuljahr: mein erstes Arbeitstrimester sollte ich in den Maisfeldern verbringen, das Zweite in der Gemeinschaftsküche und im dritten Trimester würde ich mich um die Schafe auf der Kinderfarm kümmern. Ich verstand das Meiste von dem, was sie auf Hebräisch sagte und begann nun, mich umzuschauen, um zu sehen, wer meine zukünftigen Freunde sein sollte. Als Dina mich vorstellte, sagte sie: "Elite ist ein Flüchtling aus Rumänien, aber sie ist nicht in der Immigrantenklasse. Sie wird Teil eurer Gruppe sein und ihr sollt ihr helfen, eine Sabra zu weden". Einige der Jungen bemusterten mich mistrauisch und die Mädchen ignorierten mich. Später kam ich zu der Erkenntnis, daß mein sozialer Status sehr niedrig war. Ich war weder ein Kibbutznik, noch eine Sabra – also eine von "draußen", wie es dort hieß. Wenn es nur möglich gewesen wäre, hätten sie am liebsten jeglichen Kontakt mit mir vermieden. Aber ich machte mir nichts daraus; ich war fest davon überzeugt, daß ich es schaffen würde; wie Baba immer gesagt hatte: "Mach, was du zu tun hast, mit Liebe und Fürsorge, auch wenn es sich schrecklich anfühlt". 117 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Am Nachmittag, nachdem wir unsere Arbeit in unserem jeweiligen Gebiet beendet hatten, waren wir frei bis zum Abendessen. Dies war die Zeit, in der die Kibbutzkinder ihre Eltern besuchten und für mich war es die Zeit, meine Tanten und Onkel, Frojku und Jadja, Meir und Manja, zu besuchen. Sie freuten sich immer, mich zu sehen und ich genoß den "Vier-Uhr-Tee", was mich an unsere Jause in Czernowitz erinnerte. Indem ich Teil der Schulgruppe geworden war, wurde ich automatisch eine Kandidatin, um dem Schomer Hatsaír als Mitglied beizutreten. Einige Wochen nach Schulanfang fand eine große Zeremonie auf dem Sportfeld statt. Große Sprüche mit strohgebundenen Riesenbuchstaben wurden in Feuer geschrieben und wir wurden in einer Reihe davorgestellt. Ein Betreuer des Schomer Hatsair las die Namen der Neuankömmlinge laut vor und so wurden wir zu Mitgliedern. Ich erhielt meine blaue Bluse mit der weißen Kragenschnur und war immens stolz darauf. Zweimal in der Woche hatten wir Schomer-Hatsair-Treffen, die mich manchmal an meine Zeit bei den russischen Pfadfindern erinnerten, weil dort die Rede von der Bedeutung des Sozialismus und des Kommunismus war. Manchmal wurde intensiv über Beziehungen unter uns diskutiert. Während der Feiertage gab es Sonderveranstaltungen bei dem Schomer Hatsair; dies waren für mich besondere Momente. Wir pflegten in unserer Gruppe wie bei den Pfadfindern zu stehen; es wurden große Abzeichen und Parolen hochgehißt; wir hörten uns Reden an und sangen Lieder. Dabei hatte ich jedesmal das Gefühl, endlich meinem Volk zuzugehören – eine Gruppe junger und schöner Israelis, die aufrichtig, fleißig und hochintelligent waren. Ich empfand mich als glückserkoren, Teil dieses neuen Anfangs zu sein, der auch für mich persönlich ein neuer Anfang war. Das erste Jahr in der Mossadschule war hart, aufregend und intensiv. Ich wachte jeden Morgen vor der Klingel auf, so daß ich mich anziehen konnte, noch ehe die Jungen aufstanden. Ich begab mich in die Dusche, wenn gerade wenig Kinder in der Dusche waren und tat so, als ob ich niemanden sehen würde. Ich freundete mich mit dem Mädchen in meinem Zimmer an, das eine besonders schwache Schülerin war und von den Anderen eher unbeliebt war, aber für mich bedeutete sie Zugang zu den Ortsansässigen. Ich freundete mich mit einem weiteren Mädchen an, daß eine Außenseiterin war. Ich freundete mich auch mit einigen der Jungen an, mit denen ich zusammen auf den Maisfeldern arbeitete. Ich war sehr bemüht, alle meine Aufgaben peinlich genau auszuführen. Auf den Feldern war ich die schnellste Arbeiterin im ersten Trimester; im zweiten Trimester putzte ich die Küche auf perfektester Weise und im dritten Trimester war es mir eine Freude, die Schafe früh morgens zu 118 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 melken und am Nachmittag auf die Weide zu führen. Ich ging weiter mit meinem Vater im Wald spazieren, jeden zweiten Samstag, wenn meine Eltern mich besuchten. Mein Hebräisch wurde sehr schnell immer besser und ich begann auch, Englisch zu lernen. Bald wurde ich zu einer hervorragenden Schülerin in Englisch und ging von der niedrigsten Stufe in die höchste Stufe über, so daß ich in der Lage war, anderen Schülern bei den Schulaufgaben zu helfen. Ich spürte, wie mein sozialer Status sich stärkte und bald begannen die Mädchen aus dem Kibbutz, etwas mehr Interesse an mir zu finden. Gegen Ende des Schuljahres hatte ich das Gefühl, es fertiggebracht zu haben, in die Gesellschaft der Kinder aufgenommen worden zu sein; ich freute mich sehr darüber und war stolz auf meine Errungenschaft. Jedesmal wenn ich meine Baba besuchte, während der Ferien, erzählte ich ihr von meinen Freunden und von meiner Arbeit in der Mossadschule. Wir gingren gewöhnlich Hand in Hand im gemeinschaftlichen Speisesaal und ich spürte, daß meine Baba auf mich stolz war und sich freute. Oft sagte sie: "Ich trage nur einen Wunsch in meinem Herzen, nämlich daß ich noch lange genug leben werde, um deine Hochzeit zu erleben". Als die Sommerferien begannen, fuhr ich für einige Zeit zu meinen Eltern und natürlich auch nach Ma'abarot zu meiner Großmutter. Zur Mitte der Sommerferien sollte ich nach Mischmar Haemek zurückkehren, um dort mit meiner Gruppe an einem Sommerlager des Schomer Hatsairs teilzunehmen. Obwohl man mir das Datum und die genaue Zeit, zu der ich mich für die Abreise bereithalten sollte, angegeben hatte, endeckte ich zu meinem großen Entsetzen, daß die Gruppe zwei Stunden früher als geplant losgefahren waren und mich völlig vergessen hatten. Ich war schrecklich enttäuscht und versuchte, mich mit Manja darüber zu beraten, was ich machen sollte, aber sie sagte nur: "Ich glaube nicht, daß du da irgendetwas machen kannst. Sie sind alle heute morgen mit dem Bus losgefahren und sie befinden sich in einem Wald, ein paar Stunden von hier entfernt. Wir können von hier aus keinerlei Kontakt mit ihnen aufnehmen und ich sehe da keine Möglichkeit für dich, irgendetwas zu unternehmen. Bleib einfach hier mit uns und mach dir schöne Ferien". Ich spürte die Tränen in mir aufkommen und war nicht bereit, aufzugeben. So saß ich, traurig und mismutig, vor dem Speisesaal, als eine junge Frau aus dem Kibbutz gerade vorbeikam und neben mir stehenblieb, um mich anzusprechen. Wir hatten zusammen bearbeitet und sie mochte mich gern. Als ich ihr meine Geschichte erzählte, sagte sie: "Weißt du was, du kannst es noch schaffen. Geh, stell dich an die Straße und such nach einer Mitfahrgelegenheit in die Stadt Afula. Dort begibst du dich dann auf den Busbahnhof und nimmst einen Bus nach Kibbutz Beth Alfa. Dort steigst du dann am Tor aus und fragst jemanden, wie du zu dem Schomer119 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Hatsair-Lager im Wald kommst. Es dürfte nicht länger asl eine Stunde zu Fuß sein und dann bist du da. Das Ganze dürfte nicht mehr als drei oder vier Stunden dauern, so daß du sie vor Anbruch der Dunkelheit erreichen wirst". Ich hörte ihr sehr aufmerksam zu und eine neue Hoffnung brannte in meinem Herzen auf. Ich war dreizehn Jahre alt, recht abenteuerlustig und selbstsicher; ich fühlte mich stark und unabhängig und ich würde es schon schaffen. Ich erzählte Manja von meinem Vorhaben. Sie bereitete mir zwei leckere Butterbrote und gab mir etwas Geld für die Busfahrt, und so trat ich meine Reise an. Auf der Straße machten zwei Männer in einem Jeep vor mir halt. Ich stieg ein und war etwas besorgt, aber sie brachten mich bis zum Busbanhof in Afula. Auf dem Busbahnhof befanden sich zahlreiche Leute, die viele verschiedene Sprachen sprachen. Ich fand schließlich den Bus nach Beth Alfa und hatte das Glück, zu Mittagsstunde in dem Bus zu sitzen. Eine Stunde später lief ich an der Straße entlang, die von Beth Alfa in den Wald führte, während ich die Butterbrote von Manja verzehrte. Die Sonne war heiß und die Straße menschenleer, aber ich genoß sowohl die Butterbrote, als auch meine Freiheit und die Unabhängigkeit meiner Taten. Bald erreichte ich den Wald und konnte die Klänge und Stimmen junger Leute warnehmen. Ich lief direkt in ein Lager des Schomer Hatsair hinein, in dem sich Leute aus dem ganzen Land befanden. Ich fragte nach der Gruppe aus Mischmar Haemek und man zeigte mir die Richtung. Langsamen Schrittes trat ich in das Lager hinein; einige meiner Freunde merkten auf einmal, daß ich es war und alle umringten mich. Sie konnten es nicht fassen, daß ich die ganze Reise alleine und auf eigener Faust unternommen hatte und waren zutiefst beeindruckt. Ich wurde zur Heldin des Tages und empfand ein herrliches Gefühl dabei. Würden sie mich von nun an ganz akzeptieren? Ich mußte mir noch sehr in diesem Lager bemühen, ehe ich mich als Sabra fühlen würde. Zwischen den verschiedenen Lagergruppen entstand ein Wettstreit darum, wer den schönsten und den säubersten Platz hatte. Wir mußten die Steine um unseren Zelten weiß waschen, die Wege, die zu den Zelten führten, säubern und alles Mögliche uneternehmen, damit unser Eßplatz sauber und schön aussähre. Ich stellte mich freiwillig zur Verfügung, um für diese Arbeit zuständig zu sein. Noch nie hatte ich so hart gearbeitet, aber scließlich gewann unsere Gruppe den Preis. Alle Kinder riefen mir Hurra zu und lobten mich. Auf dem Bus, auf dem Rückweg zum Kibbutz mit der ganzen Gruppe, hatte ich endlich das Gefühl, ganz dazu zu gehören. Mein zweites Jahr im Kibbutz sollte ein Vergnügen werden. 120 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Epilog Nun bin ich eine pensionierte Professorin für Spracherziehung von der Hebräischen Universität und lebe in Jerusalem, in Israel. Ich hatte eine wunderbare Karriere, als Spezialistin für Fremdsprachenunterricht für Englisch. Ich habe eine wunderbare Familie, einen liebevollen Ehemann, Seev, drei hübsche und erfolgreiche Töchter, alle mit liebevollen und rücksichtsvollen Männern verheiratet; bisher habe ich acht Enkelkinder, vier Jungen und vier Mädchen. Dieses Buch war etwas, das ich mir selbst schuldete, um den Zusammenhang zwischen meiner Kindheit und den neuen Generationen herzustellen, und um das laut auszusprechen, was viele Holokaustüberlebende sagen: "Hitler wollte unser Volk ausrotten und unser beste Rache ist die Tatsache, daß wir es fertiggebracht haben, eine neue Familie in einem neuen Land zu gründen, trotz all dem Leid, daß uns als Kindern aufgebürdet wurde". Nach mehreren Jahren auf der Kibbutzschule kehrte ich zu meinen Eltern zurück, die inzwischen nach Ramat Gan gezogen waren, einer kleinen Stadt am Rande von Tel Aviv. Ich besuchte die Oberschule in Ramat Gan, wurde zur Musterschülerin und erhielt ein Stipendium, das mir mein Studium finanzierte. Ich war sehr gut in Englisch und daher konnte ich jüngeren Kindern Nachhilfeunterricht geben; auf diese Weise konnte ich ab dem Alter von fünfzehn etwas Geld verdienen. Ich verdiente genügend Geld, um meine Schuluniform, meine Schulbücher und all meine persönlichen Sachen zu kaufen, ohne meine Eltern damit zu belasten, die sehr hart arbeiteten, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Ich begann mein Universitätsstudium in Wirtschaftswissenschaften ein Jahr, bevor ich in die israelische Armee einberufen17 wurde. Während meines Wehrdienstes führte ich mein Studium abends weiter und ein Jahr nach dem Ende meine Wehrdienstes erhielt ich mein Diplom. An der Universität lernte ich meinen Mann Seev kennen; wir heirateten 1959, als ich 21 Jahre alt war. Meine Großmutter Sabina, die damals 80 Jahre alt war, kam zu meiner Hochzeit und strahlte vor Wonne. Sie erlitt einen Gehirnschlag, während wir uns auf unserer Hochzeitsreise befanden, und sie starb wenige Monate später. Sie hatte immer meine Hochzeit erleben wollen und so geschah es auch. Nach unserer Hochzeit studierten Seev und ich an der UCLA in den USA. Wir lebten in Los Angeles zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens. Ich erhielt mein Magisterdiplom; dann kam meine älteste Tochter Tali zur 17 In Israel sind junge Mädchen bis heute zu einem zweijährigen Wehrdienst verpflichtet. Junge Männer dagegen müssen drei Jahre lang dienen. 121 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Welt und schließlich erhielt ich meinen Doktortitel in den USA. Ich bin zweisprachig auf Hebräisch und Englisch und fühle mich in beiden Sprachen und Kulturen zu Hause. Ich verstehe bis heute perfekt Deutsch, spreche aber etwas zögernd, da ich heute nur selten Gelegenheit habe, von dieser Sprache Gebrauch zu machen. Rumänsich habe ich völlig vergessen und gab diese Sprache am Tag unserer Ankunft in Israel auf. Meine Eltern, Willy und Frieda, erreichten beide ein hohes Alter: Frieda starb im Alter von 89 Jahren in 2001 und meine Vater starb 2003 im Alter von 95 Jahren. Frieda begab sich bis zu ihrem letzten Tag zur Marmorwerkstatt, die schon seit langem nicht mehr benutzt wurde. Solange meine Eltern noch am Leben waren, hatte ich nie den Mut, dieses Buch anzufangen. Nachdem sie beide gestorben waren, begann ich, ernsthafte Recherchen zu den Ereignissen zu unternehmen, die während meiner Kindheit stattfanden. Meine jüngste Tochter, Orly, half mir mit diesen Nachforschungsarbeiten, während mein Mann Seev mich laufend unterstützte und mir Mut zusprach. Meine Töchter Tali und Karen lasen mein Manuskript mit Akribie und gaben mir den Einblick, der mir zur endgültigen Version verhalf. Dies war sicherlich ein Familienunternhehmen. Schließlich machte ich im Sommer 2006 eine Reise nach Czernowitz und nach Murafa, zusammen mit Seev. Meine gute Freundinn Bella diente mir als Übersetzerin und als Reiseführerin. Wir fuhren spät nachts nach Czernowitz herein.Mein Herz klopfte ganz wild und meine Augen waren feucht, aber ich konnte nichts wiedererkennen. Als wir am nächsten Morgen auf die Straße gingen, sah ich um mich nur Leute, die Ukrainisch sprachen. Niemand sprach Deutsch und niemand kam mir bekannt vor. Dann kam unsere Reiseleiterin mit eine Stadtkarte an. Ich zeigte auf die Straße, auf der ich geboren wurde; ich wußte von meiner alten deutschen Straßenkarte, daß es die Franzensgasse war. Nun heißt diese Straße "der 28. Juni", das Datum, zu dem die Russen beim ersten mal dort einmarschiert waren. Ich konnte mich nicht an die Hausnummer erinnern. Wir gingen zu unserer Straße. Nun begann die Umgebung, mir bekannt vorzukommen, aber ich war immer noch recht verwirrt. Ich erklärte der Reiseleiterin, daß meine Eltern 1935 geheiratet hatten und daß sie in eine neue Wohnung in einem neuen Gebäude eingezogen waren. Sie lächelte und sagte: "Ich werde euch zu eurem Haus führen. In 1935 gab es nur ein einziges Bauhausgebäude und es gibt heute nur ein einziges solches Gebäude auf dieser Straße". Ich stieg aus dem Wagen hinaus und das Gebäude stand vor mir. Ich konnte mich noch aus meiner Kindheit daran 122 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 erinnern. Wir stiegen das Treppenhaus hinauf und ich blieb an genau der Stelle stehen, an der meine Mutter und ich einander begeneten, nachdem sie aus Transnistrien zurückgekehrt war. Dann klopften wir an der Tür und die Dame, die in der Wohnung lebt, ließ uns hinein. Die Möbel waren mir zwar fremd, aber alle Andere war genau so, wie ich mich daran erinnerte, sogar die Lehmöfen waren da, genau wie vor 60 Jahren, obwohl sie nicht mehr zum Heizen benutzt wurden. Von der Wohnung aus gingen wir zum Ringplatz, den gleichen Weg, den ich so oft mit meiner Großmutter gegangen war. Nun erkannte ich viele Gebäude und natürlich auch die Herrengasse. Unsere Reiseleiterin führte uns nach Rosch und ich erinnerte mich an die Begegnung mit meinem Vater dort. Dann begaben wir uns auf den jüdischen Friedhof; unsere Aufregung war besonders groß, als wir auf einigen der Granit-Grabsteine die Signatur meines Vaters erkennen konnten. Dann kamen wir zum hübschen Bahnhof, von dem aus meine Mutter nach Transnistrien genommen wurde. Alles sah so friedlich aus, daß es unmöglich war, sich vorzustellen, wie die Menschenmengen 1941 in die Züge gejagt wurden. Ich wollte herausfinden, ob wir mit dem Zug nach Moghilev fahren könnten, aber es wurde uns gesagt, daß es keine Züge in die Richtung gab. Wir beschlossen, selber nach Murafa zu fahren. Dies war das kleine Dorf, in dem meine Mutter zweieinhalb, sehr schwierige Jahre verbracht hatte. Die Straßen waren schlecht und die Richtungen ungewiss. Schließlich, nachdem wir uns unterwegs bei zahlreichen Bauern erkundigt hatten, erreichten wir Murafa. Bella sprach ein paar Frauen auf der Straße an und fragte nach den ältesten Leuten im Dorf, die uns Auskunft über die Kriegszeit geben könnten. Eine der Frauen führte uns zu den "ältesten" Mann, der in einem winzigen Häuschen mit einem verkommenen Hinterhof lebte. Er und seine Frau, die kaum reden konnten, erklärten uns, daß sie sich an die Juden erinnern konnten, die während des Krieges bei ihnen auf dem Dorf gelebt hatten. "Die mußten hart arbeiten", sagte der alte Mann, "aber die Stärkeren überlebten den Typhus und den Hunger. Sie wurden nicht im Murafa umgebracht, sonrn über den Bug verschleppt". Wir wollten das Krankenhaus besichtigen, in dem Frieda gearbeitet hatte, aber das Krankenhaus existiert heute nicht mehr. Es existierte damals, um dem deutschen Heer zu dienen. Der alte Mann konnte sich an eine junge Frau namens Frieda erinnern, die dort gearbeitet hatte. Als wir die Ukraine besuchten, war der größte Teil diese Buches bereits geschrieben. Es gab nur wenig, daß neu angepaßt werden mußte. Meine 123 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008 Erinnerungen schienen den Tatsachen des Lebens genau zu entsprechen. Dies ist eine wahre Geschichte, aus den Augen eines kleinen Mädchens betrachtet. 124 © E.Olshtain, Der Lehmofen, 2008