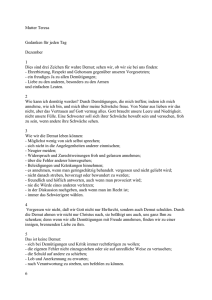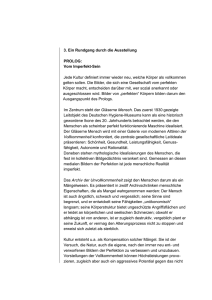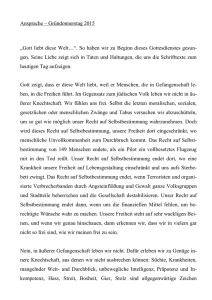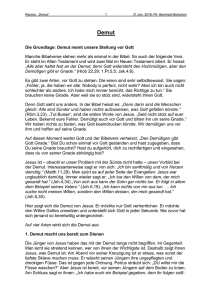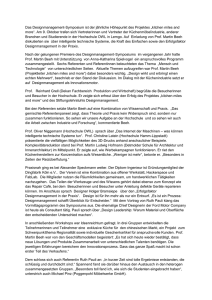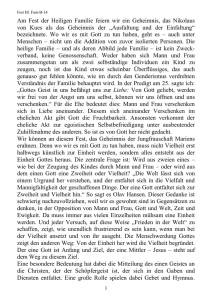Die Würde des Sports ist unantastbar
Werbung

11. Würde Vom Ringen mit der menschlichen Unvollkommenheit Das vorliegende Buch ist in einer Reihe von Studien der Frage nachgegangen, inwieweit man von der Würde eines Kulturbereiches wie des Sports sprechen kann, inwiefern die unantastbar ist und wie allgegenwärtig die Situationen sind, in welchen sie dennoch angetastet und dadurch beschädigt und in ihrer gesellschaftsbereichernden Wirkung beeinträchtigt wird. In diesem abschließenden Kapitel wird der allgemeine gedankliche Hintergrund nachgetragen, von dem aus gehaltvoll von „Würde“ gesprochen werden kann. Von ihm sind auch die vorstehenden sportbezogenen Studien getragen. Schon vorab kann resümierend soviel festgestellt werden: Würde umfasst den gemeinsamen Nenner dessen, was wir uns alle als die Möglichkeiten des Menschen vorstellen und grundsätzlich allen von uns zutrauen. Verletzungen dieser Würde können von innen, von uns selbst durch Selbstunterforderung erfolgen, oder von außen, durch das Einwirken von natürlichen oder von menschlichen Mächten, also durch psychophysische Beschädigungen oder durch soziale Unterdrückung jener Möglichkeiten. Sie können jedoch die Berechtigung des Anspruchs auf Würde nicht beeinträchtigen oder gar aufheben. 1. Prolog: Sechs Worte als Wegweiser für eine Abenteuerreise „Würde“. So einfach! So evident! So allgegenwärtig in jeder Alltags- wie Festrede! Aber dann: Sobald man sich annähert, steckt man fest in der Paradoxie des Augustinus in seiner Rede über die Zeit: Denke ich nicht über sie nach, weiß ich, was sie ist. Denke ich über sie nach, entzieht sie sich. Es lohnt trotzdem den Versuch: eine Annäherung in vielen kleinen Schritten, aus denen sich schließlich doch ein halbwegs erhellendes Gesamtbild ergeben mag. Der Versuch führt auf eine geistige Entdeckungs-, ja Abenteuerreise. Eröffnet wird sie mit sechs „Worten“, die den Rahmen unseres Themas abstecken. (1) Wort 1: Verfassungsgebot. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ So spricht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im ersten Absatz seines ersten Artikels.1 Unantastbar? Als indikativische Aussage ist dieses Wort offensichtlicher Nonsens. Schlimmer: eine Verharmlosung der Allgegenwart des heillosen Gegenteils. Denn jede beliebige Nachrichtensendung ist gespickt mit Berichten über angetastete menschliche Würde. Da Verfassungsgeber zumindest in demokratischen 1 Vgl. GRUNDGESETZ (1963): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Stuttgart. 13. Dieser Text hat seither zahlreiche Verfassungsänderungen erfahren, nicht jedoch in seinem Art. 1,1. 373 Staaten nicht das Geschäft des orwellschen „Wahrheitsministeriums“ betreiben, tut man offenbar gut daran, dieses Wort anders zu lesen: als imperativische Aussage, die das unausgesprochene „soll“ hinter einem Pseudo-Indikativ verbirgt; vielleicht, um die erwünschte unbedingte Geltung nicht durch die Vieldeutigkeit eines solchen Sollens abzuschwächen und zu relativieren; vielleicht auch, um die Verfassung als den Grundlagentext der politischen Gemeinschaft der Deutschen nicht mit einer negativen Formulierung zu eröffnen nach dem Muster: „Niemand darf die Würde des Menschen antasten.“ Jedenfalls beinhaltet dieses erste Wort keine Tatsachenfeststellung. Als solche wäre es offensichtlich unzutreffend. Sie kodifiziert vielmehr eine juristische Norm, eine Forderung, die zugleich eine außerordentliche Herausforderung für das Handeln aller von dieser Norm Gemeinten und Betroffenen beinhaltet. Ähnliches gilt auch für die Formulierung von Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde geboren.“ Sie sind nicht so geboren, was eine biologische Kategorie wäre. Sondern sie haben einen inzwischen durch weltweit erklärte Konvention begründeten und verbürgten Anspruch darauf, was eine moralische bzw. rechtliche Kategorie ist. (2) Wort 2: Verfassungsbeschreibung. „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte“. So spricht der – inzwischen gescheiterte – Entwurf zum Vertrag über eine Verfassung für Europa aus dem Jahr 2004 in seinem Artikel I-22. Die Würde wird auch hier in einer indikativischen Formulierung angesprochen, aber nicht, wie im GG, als scheinbar unbestrittene Tatsache, sondern nur als Feststellung der Werte, auf welche sich die zu gründende Union europäischer Staaten berufen würde, wenn sie denn zustande käme. Was bekanntlich bisher allerdings nicht der Fall ist, weil der Entwurf gescheitert ist an ablehnenden Volksentscheiden in mehreren EU-Staaten. Auffällig gegenüber dem GG ist hier die Nebenordnung der Menschenwürde innerhalb einer diffus anmutenden Mehrzahl von Werten, deren logisches und rechtliches Verhältnis zueinander undeutlich bleibt. Schon dies wäre ein – und zwar in diesem Fall ein guter – Grund gewesen, diesemn Verfassungsentwurf mit Skepsis zu begegnen. (3) Wort 3: Selbstschöpfung. „Keinen bestimmten Platz habe ich dir zugewiesen, auch keine bestimmte äußere Erscheinung und auch nicht irgendeine besondere Gabe habe ich dir verliehen, Adam, damit du den Platz, das Aussehen und alle die Gaben, die du dir selber wünschst, nach deinem eigenen Willen und Entschluss erhalten und besitzen kannst. (…) Weder zu einem Himmlischen noch zu einem Irdischen habe ich dich geschaffen und weder sterblich noch unsterblich gemacht, damit du wie ein Former und Bildner deiner selbst nach eigenem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt dich ausbilden kannst, die du bevorzugst. Du kannst nach unten hin ins Tierische entarten, du kannst aus eigenem Willen wiedergeboren werden nach oben ins Göttliche.“3 So lässt der Renaissance-Philosoph Pico della 2 Vgl. KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION (2004): Vertrag über eine Verfassung für Europa. Paderborn. 10-11 3 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni (1997): Oratio de hominis dignitate. Rede über die Würde des Menschen. Stuttgart. 9 374 Mirandola in seiner berühmten „Oratio de hominis dignitate – Rede über die Würde des Menschen“ den Schöpfergott sein Geschöpf Adam ansprechen, nachdem er das Haus der Welt fertiggestellt hat und sich wünscht, „es sollte jemanden geben, der imstande wäre, die Einrichtung des großen Werkes zu beurteilen, seine Schönheit zu lieben, seine Größe zu bewundern“4. Pico liest also den Bannfluch bei der Vertreibung aus dem Paradies gegen den Strich und wendet ihn ins Positive. Er gründet, ähnlich wie später John Milton in seinem nicht minder berühmten biblischen Epos „Paradise Lost“5, die Würde des Menschen auf die Freiheit, die sein Schöpfer ihm zur Selbstschöpfung verliehen habe, damit aber auch auf die Eigenverantwortung, die er als Mitschöpfer der menschlichen Welt für deren menschenwürdiges Gelingen oder menschenunwürdiges Missraten und Scheitern übernimmt. Pico stellt damit die Stiftungsurkunde für das Bild des modernen Menschen aus. Und er stellt die Würde in deren Mittelpunkt als diejenige Herausforderung, an welcher der Mensch sich bewähren und sich dem damit gewährten Vertrauensvorschuss – eben! – würdig erweisen muss. (4) Wort 4:Unwürdigigkeit des Menschen? „Herr, ich bin unwürdig.“ So steht es auf vielen Mahntafeln am Wegesrand in katholisch geprägten Gegenden zu lesen. Es ist ein Memento und eine Selbstanklage, welche idealtypisch jene Selbstzerknirschung zum Ausdruck bringen, jene für das Christentum charakteristische Selbstherabsetzung des Menschen, an der Friedrich Nietzsche so heftigen Anstoß genommen hat und die Picos froher Botschaft direkt zu widersprechen scheint. Wieso also „unwürdig“? Allemal gerechtfertigt wäre ein solches Memento, wenn es gemeint wäre als Ausdruck von Demut, als Warnung, als Selbstschutz gegen die Anfechtungen von Hochmut und von hybrider Selbstüberschätzung, sowie gegen selbstgefällig wohlfeile Entlastungen von allfälligem eigenem Versagen. Aber tut der Mensch recht daran, sich deshalb als notorisch unwürdig zu bezeichnen? Ohne Wenn und Aber? Berechtigt wäre dies allenfalls dann, wenn er sich mit dieser Selbstbeschreibung Gott gegenüberstellte, sich also am Maßstab des Absolutheitsanspruches göttlicher Vollkommenheit mäße. Aber kann es auch dann und dort berechtigt sein, wenn und wo er sich an dem misst, was billigerweise von Menschen gegenüber Menschen, also am Maßstab des Relativanspruches menschlicher Unvollkommenheit verlangt werden kann? Soll ihm also etwa pauschal abgesprochen werden, dass er sich vor diesen zwischenmenschlichen Anforderungen durchaus als würdig erweisen kann? Und dass er aufgefordert ist, sich gerade darum zu bemühen? (5) Wort 5: Erkämpfte Würde. „Würde und Leiden können nicht leicht nebeneinander bestehen, und doch hat es Shakespeare wie niemand sonst geschafft, sie miteinander zu versöhnen.“6 Diese Summe zieht Harold Bloom in seiner wunderbaren Studie über das Werk William Shakespeares. Auf den ersten Blick mag diese Beobachtung überraschen. Assoziieren wir mit Würde nicht, wie gesehen, vor allem eine Aura von Überlegenheit und Unanfechtbarkeit. So sehr dies aber zutrifft, 4 PICO DELLA MIRANDOLA (1997), a.a.O., 7 MILTON, John (2008b): Paradise Lost. In: DERS. (2008a): Das verlorene Paradies. Werke. Frankfurt am Main. 131-133 6 BLOOM, Harold (2001): Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen. Berlin. 625 5 375 so nachdrücklich ist es auch eingeschränkt. Würde verwirklicht sich nicht in einer harm- und problemlosen Idylle, nicht in einem schlichten Triumphalismus. Ja, sie steht für ein Gelingen. Aber doch nur für ein solches Gelingen, das erst nach schwerer Prüfung einer ernsten Herausforderung abgerungen, ja abgekämpft worden ist. Sie steht für ein erfolgreiches Ringen mit der menschlichen Unvollkommenheit. Diese Doppelgesichtigkeit zeigt sich deutlicher im letzten Eingangs-Wort. (6) Wort 6: Ins Gesicht geschrieben. Die Bilder eines Foto-Reise-Bandes „dokumentieren etwas, dessen Verlust droht: Menschenwürde, das Gefühl des Lebendigseins, ist nicht nur ein unverzichtbarer Rechtstitel, der jedem Individuum zukommt. Würde ist etwas, was ein Mensch ausstrahlt, was ihm ins Gesicht geschrieben steht. Fotografien können einen Teil dieser Ausstrahlung festhalten, diese kaum fassbare Realität, die ebenso Teil eines Menschen ist wie seine leibliche Erscheinung.“ So bewirbt ein Verlag einen Bildband, publiziert unter dem Titel „Unantastbar. Von der Würde des Menschen“7. Er dokumentiert sechs Reisen der Autoren zur Wiege der Zivilisation, die wir, wie es scheint, in einigen verbliebenen kleinen „Inseln“ auch heute noch antreffen und darin gleichsam unsere Vergangenheit besichtigen können: in der Flusslandschaft des Orno in Äthiopien und in das kenianische Rift Valley, in die abgelegenen Berge des Goldenen Dreiecks im Norden Myanmars und Thailands, in die abgeschiedene Wüste Thar im Nordwesten Indiens sowie in das Königreich Bhutan – kurz, wie es in jenem Werbetext weiter heißt: in die „letzten Kulturen, die noch nicht in den Mahlstrom der Uniformierung geraten sind, die zur unvermeidlichen Kehrseite der ökonomischen Globalisierung und Ausbreitung moderner Informationstechnologien gehört“. Hier wird also ein Gegenbild zu Picos Vision entworfen: menschliche Würde, welche aus einer vormodernen, gleichsam natürlichen Unberührtheit gespeist und durch die Errungenschaften der Moderne gefährdet wird. Aus diesem Bild spricht eine romantische Verklärung jenes paradiesischen Urzustandes, bevor Adam und Eva als Stammeltern der Menschheit gegen das göttliche Verbot vom Baum der Erkenntnis gegessen haben.8 Würde aber kann, wie wir noch sehen werden, überhaupt erst entstehen durch gelingende Auseinandersetzung mit der nachparadiesischen menschlichen Unvollkommenheit und Endlichkeit. In der ungetrübten, durch keinerlei Art von Knappheiten und Herausforderungen beeinträchtigten Schlaraffenland-Fülle – und entsprechenden Langeweile! – des raum-, zeit- und ereignislosen Paradieses hingegen hat Würde keinen logischen Platz. Jedenfalls festzuhalten aber bleibt aus diesem Bild die Einsicht, dass Würde nicht festgelegt und beschränkt ist auf einen herrschaftlichen Status. Sie kann gleichermaßen verkörpert sein in jedem von den „Geringsten unter euch“. 7 PFANNMÜLLER, Günter/KLEIN, Wilhelm (2008): Unantastbar. Von der Würde des Menschen. Frankfurt am Main 8 Präformiert ist diese romantische Sicht von Würde als einer paradiesischen, vorbewussten Unschuld bereits im frühen 17. Jahrhundert bei dem schon zitierten John MILTON (2008b), a.a.O.: „Noch war kein Glied mit Heimlichkeit verhüllt, / Noch gab’s nicht falsche, schuldbewusste Scham / Ob Werken der Natur; unwürd’ge Würde, / Der Sünde Brut, wie elend machtest du / Die Menschen durch der Reinheit falschen Schein, / Verscheuchend ihres Lebens höchstes Glück: / Einfältigkeit und fleckenlose Unschuld!“ (185) 376 2. Die Fortschreibung von Picos Stiftungsurkunde (7) Selbstregierung. Pico della Mirandolas Stiftungsurkunde ist fortgeschrieben worden insbesondere mit Kants vernunftphilosophischer Begründung der Verpflichtung – Sartre wird später sagen: mit der Verurteilung – des Menschen zur Freiheit der Selbstregierung. Begabt mit Vernunft, ist es unter seiner Würde, sich anderen Gesetzen zu unterwerfen als denen, die er sich selbst gegeben hat und die die Prüfung durch seine eigene Vernunft bestanden haben. Wie wir in den Zitaten aus Picos „Oratio de hominis dignitate“ und Miltons „Paradise Lost“ gesehen haben, kann die biblische Botschaft sogar mit guten Gründen so gelesen werden, dass diese Freiheit des Menschen nicht auf dessen hybride Selbstermächtigung zurückgeht, sondern einem ausdrücklichen Willen Gottes entspringt. Dann aber verbleibt in der biblischen Schöpfungserzählung ebenso wie in Miltons Nacherzählung ein unausgeräumter Widerspruch: Wie begründet sich eigentlich das göttliche Verbot an den Menschen, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Gerade ein verantwortlicher Umgang mit der Freiheit setzt die Fähigkeit voraus zur Unterscheidung von Gut und Böse, von Richtig und Falsch sowie zur Beurteilung dessen, was in einer jeweiligen Handlungssituation zutrifft. Weder Unterscheidungsfähigkeit noch Urteilskraft aber sind möglich ohne Erkenntnisvermögen.9 Um Kants Formulierung „Und Böses, wenn es wirklich Böses gibt, / Müsst ihr’s nicht kennen, wenn ihr’s meiden sollt?” (MILTON 2008b, a.a.O., 433) Das ist zwar die Rede des Luzifer, des Versuchers und Verführers in „Paradise Lost“, der in Gestalt der Schlange Eva zur Übertretung des göttlichen Verbots überreden will. Aber trotz der bösen Absicht ist das Argument zutreffend (und gerade deshalb wirksam). Denn durch dieses Wissen macht sich der Mensch gerade nicht, wie der Satan die Suggestion noch zu steigern versucht, zu Gott („Was sind die Götter, dass der Mensch wie sie / Nicht werden könnte“, 433), sondern überhaupt erst zum Menschen. Endgültig bekräftigt wird diese Einsicht schließlich durch den Erzengel Michael, als er Adam und Eva aus dem Paradies verweist und ihnen die Erde als ihre neue Lebenswelt vorstellt: „Doch wisse, dass seit deinem Sündenfall / Schon jene wahre Freiheit war verscherzt, / Die stets mit der Vernunft verschwistert nur, / Getrennt von dieser nicht bestehen kann. / Ist die Vernunft getrübt und hört der Mensch / Nicht mehr auf ihren Rat, bemächtigen sich / Ausschweifend leidenschaftliche Begierden / Sogleich der Herrschaft, und ihr Sklave wird / Der bisher freie Mensch. Sobald er selbst / Unwürd’gen Mächten sich im Innern beugt, / Beugt Gott im Äußern auch gerechterweise / Ihn unter grausamer Tyrannen Joch, / Die seine Freiheit scheinbar unverdient / In Fesseln schlagen.“ (577) Unmissverständlich, nicht mehr indirekt als Äußerungen von Gestalten seines Epos, sondern direkt als eigene Meinungsäußerung formuliert Milton dann seine Position in dem flammenden Freiheitsappell „Areopagitica“, seiner „Rede für die Freiheit der Presse an das Parlament von England“ von 1644: „So, wie daher der Zustand des Menschen ist, welche Weisheit kann erwählt, welche Enthaltsamkeit unterlassen werden, ohne Kenntnis des Bösen? (…) Ich kann eine entfliehende, klösterlich eingeschlossene, ungeübte Tugend nicht preisen, die niemals vorspringt und ihren Feind aufsucht, sondern sich von dem Wettlaufe fortschleicht, in welchem, nicht ohne Staub und Hitze, um den unsterblichen Kranz gerungen wird. Ganz gewiss bringen wir nicht Unschuld, wir bringen vielmehr Unreinigkeit in die Welt mit; das, was uns reinigt, ist Prüfung, und Prüfung findet durch das statt, was das Gegenteil ist. Die Tugend also, die nur ein Kind in Betrachtung des Bösen ist und nicht das Äußerste kennt, was das Laster seinen Jüngern verspricht und es zurückweist, ist nur eine blanke, keine reine Tugend (…). Es gibt viele, die es beklagen, dass die Vorsehung Adams Übertretung geduldet habe. Törichte Zungen! Als Gott ihm Vernunft gab, gab er ihm Freiheit zu wählen; denn Vernunft ist nichts als Wahl“ (in: MILTON 2008a, a.a.O., 893, 903). Hiermit sind 9 377 zum Verhältnis von theoretischem Begriff und empirischer Erfahrung abzuwandeln: Freiheit ohne Erkenntnis ist blind; Erkenntnis ohne Freiheit ist leer. Die Erklärung, welche Milton stellvertretend für viele Interpreten für das Erkenntnisverbot mit den Worten des satanischen Gegenspielers und Menschenverführers anbietet, ist eines allmächtigen Gottes nicht würdig: „Nicht essen dürfen sie vom Baum, genannt / Erkenntnisbaum. Verboten ist Erkenntnis? / Verdächtig, seltsam auch. Warum missgönnt / Ihr Herr Erkenntnis? Kann sie Sünde sein? / (…) Ich entflamme sein Gemüt / Mit Drang nach Wissen und nach Übertretung / Des neidischen Verbots, erfunden nur, / Um niedrig ihn zu halten, den Erkenntnis / zur Gottgleichheit erhöbe.“10 Diese Erklärung ist nicht nur gottesunwürdig. Sie ist schlicht gegenstandslos. Denn die unaufhebbare menschliche Unvollkommenheit gilt auch für sein Erkenntnisvermögen. Es vermöchte folglich – selbst bei entsprechender satanisch-hybrider Absicht, die sich bekanntlich immer wieder in der Geschichte der Menschheit Bahn zu brechen versucht hat – der göttlichen Allwissenheit und damit auch seiner Allmacht prinzipiell keine Konkurrenz zu machen. (8) Gegenseitige Anerkennung. Picos Stiftungsurkunde ist ferner fortgeschrieben worden mit Hegels Betonung der gegenseitigen Anerkennung der Würde ihrer Mitglieder als Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, ja der menschlichen Gattung überhaupt. Wenn man diese Beziehung als tatsächlich „allgegenwärtig und abstrakt“11 – als universelle Zuerkennung von Würde unter Absehung von jeder individuellen, sozialen und kulturellen Besonderheit – denkt und praktisch gestaltet, dann eröffnet dies einen revolutionären und bis heute noch nicht annähernd zu Ende gegangenen Weg über die bisherige Dominanz von partikularen familiaren, sozialen und kulturellen Referenzen hinaus. Dieser Weg führt „vom homo hierarchicus zum homo aequalis“12. (9) Herr und Knecht. Aber Freiheit und Würde sind keine gutmenschengerechten Schönwetter-Veranstaltungen. Sie sind, mit Hegels kalt realistischen Worten über die Beziehung zwischen Herr und Knecht, grundsätzlich „eine gefährliche Errungenschaft: Nur wer das eigene Leben aufs Spiel setzt und den Tod der Unterwerfung unter den Willen eines anderen vorzieht, verdient sie. Sie stellt eine Feuerprobe dar, die die Menschen einer Auswahl unterzieht und sie unterteilt, in diejenigen, die fähig sind, zu herrschen, und diejenigen, die nur zu gehorchen imstande sind. Wer hingegen aus Unfähigkeit oder Feigheit das eigene Leben bewahren will und die Freiheit gegen das Überleben eintauscht, verdient es, geknechtet zu werden.“13 Wer Würde mitkonstituiert sieht durch Freiheit, muss sich also darauf einstellen, darum kämpfen zu müssen. Man hat es mit einer verwandten Konstellation dessen zu tun, was Carl von Clausewitz in „Vom Kriege“14 beschreibt: Der Krieg zudem Kernelemente dessen versammelt, was das, das im vorliegenden Text an anderer Stelle als „Gutmenschentum“ kritisiert wird, so bedenklich macht. 10 MILTON (2008b), a.a.O., 195 11 BODEI, Remo (2008a): An den Wurzeln des Verhältnisses von Herrschaft und Knechtschaft. In: VIEWEG, Klaus/WELSCH, Wolfgang (Hrsg.) (2008): Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne. Frankfurt am Main. 240 12 BODEI (2008a), a.a.O., 240 13 BODEI (2008a), a.a.O., 242 14 CLAUSEWITZ, Carl von (1990): Vom Kriege. Augsburg 378 beginnt nicht mit dem Angriff, sondern mit der Verteidigung. Sprich: Würdeverletzende Beherrschung beginnt mit der Bereitschaft zu würdeverletzender Unterwerfung. Eine ähnlich manichäische Sicht der zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich als nüchterner Realismus ausgibt, findet seit jeher Widerhall bei namhaften Denkern wie Thomas Hobbes, Carl Schmitt oder Ernst Jünger und ihre Geistesverwandten, nicht zuletzt übrigens auch in manchen religiösen, etwa alttestamentarischen oder muslimischen Schriften. Auch hat sie über lange Phasen der Menschheitsgeschichte hin das reale Geschehen maßgeblich mit bestimmt. 15 Gleichwohl trägt sie das Zeichen historischer Überlebtheit auf der Stirn. Sie hat zudem niemals in der bekannten Geistesgeschichte das Denken allein bestimmt. Mit wachsender Zivilisierung der gesellschaftlichen Beziehungen und Differenzierung des Denkens ist sie abgelöst worden durch vielschichtigere Wahrnehmungs-, Deutungs- und Gestaltungsmodelle des gesellschaftlichen Lebens. Gänzlich verschwunden jedoch ist diese Sicht nicht. Und sie macht, wie wir sehen werden, nach wie vor einen der Pfeiler dessen aus, was unser Verständnis von Würde bestimmt. (10) Homo generosus. Hinter jenes humanistische und aufklärerische Insistieren auf der allgemeinen Geltung von Eigensinn, Eigenmächtigkeit und Eigenverantwortung menschlichen Handelns also, wie es in These (5) umrissen worden ist, will in modernen zumindest westlichen Gesellschaften – bei allem Respekt vor deren Schwierigkeiten und Grenzen und ohne hybriden Übermut – kein ernsthafter Teilnehmer des öffentlichen Diskurses mehr zurück. Dieses Beharren eröffnet und verteidigt unvergleichliche Handlungsspielräume, stellt aber zugleich auch hohe Anforderungen an jeden einzelnen Menschen. Es wirft allerdings die Frage auf nach der Würde derjenigen Menschen, bei denen die Fähigkeiten zum Bestehen eines solchen Kampfes insuffizient sind: Kinder mit erst heranreifenden und Alte mit schwindenden physischen und geistigen Kräften, Kranke, Behinderte, Antriebsschwache und Unehrgeizige. Hegels Verweis auf die unerbittliche Dualität von Herr und Knecht ist zu einfach und greift hier nicht. Diese Frage beantwortet sich vielmehr grundsätzlich durch das Weitergelten jener gegenseitigen Anerkennung aller durch alle als eines Aktes dessen, was in der Sozialphilosophie als der „homo generosus“16 beschrieben wird. Dessen wohltätige Leistungen wirken zwar nicht umfassend und zuverlässig, weil die Disposition der Menschen dazu stets im Widerstreit mit anderen Dispositionen steht. Aber er bewirkt immerhin, dass wohltätiges Handeln nicht stets nur gleichsam einer strikt dagegenstehenden „natürlichen Natur“ des Menschen abgerungen werden müsste und damit nur Heiligen offenstände. Die „Aktion Mensch“ hat eine Zeit lang um Unterstützung für ihre Ziele zur Förderung von Behinderten mit der Botschaft geworben: „Man ist nicht behindert. Man wird behindert.“ Eine solche Deutung kann sich zwar auf eine allzugroße Vielzahl von entsprechenden empirischen Erfahrungen stützen. Sie fördert gleichwohl eine sträfliche Fehleinschätzung – sträflich deshalb, „Diese Vorstellungen haben in der Geschichte eine enorme Bedeutung gehabt – man findet sie noch bei den Befürwortern der Sklaverei während des amerikanischen Sezessionskrieges zu Zeiten von Lincoln“, so BODEI (2008a), a.a.O., 247; zu einigen weiteren markanten historischen Beispielen vgl. ebd., 248-251. 16 NÖRRETRANDERS, Tor (2004): Homo generosus. Warum wir Schönes lieben und Gutes tun. Reinbek 15 379 weil sie die in der Natur des Menschen auch angelegten, dem homo generosus entgegenstehenden, gleichsam animalischen, zumindest atavistischen Dispositionen unterschätzt. Die Würde aller, also auch der Behinderten, anzuerkennen und durch besondere Unterstützung auch praktisch zu respektieren, hebt den Menschen aus seiner natürlichen Umgebung ab. Sie ist eine besondere, auch ihrerseits anerkennungswürdige und keineswegs selbstverständliche Leistung jener Homo-generosusSeite des Menschen. Statt also Behinderte in ihrem oft heroischen Kampf um eine menschengerechte Lebensführung allein als Opfer ihrer (un-)menschlichen Umwelt darzustellen, wäre es angemessener, diese menschliche Umwelt zu noch größerem Engagement auf diesem Feld durch ausdrückliche Anerkennung des hier jeweils schon Geleisteten zu animieren und zu ermutigen. Humanität erhebt höhere Ansprüche und ist mit höheren moralischen Kosten verbunden, als es sich ein wohlfeiles schlicht-harmonistisches Gutmenschentum vorzustellen bereit ist. Die negativen Konnotationen, die sich mit diesem Begriff des Gutmenschen verbinden, beziehen sich selbstverständlich nicht auf sein – begrüßenswertes! – Beharren auf der Pflicht zur Mitmenschlichkeit. Sie beziehen sich vielmehr aus seine – kritikwürdige! – Unterschätzung ebenjener Fähigkeiten zur Unmenschlichkeit, die in der Natur des Menschen ebenfalls angelegt sind und die nur mit großer permanenter individuell-moralischer und institutionell-rechtlicher Anstrengung beherrscht werden kann. Denn nicht nur irren, sondern auch „unmenschlich“ zu sein ist menschlich! Jedenfalls aber macht, wie wir im weiteren sehen werden, auch diese Seite des Förderungsanspruchs von schwächeren, weniger durchsetzungsfähigen Mitgliedern der menschlichen Gemeinschaft einen zweiten Pfeiler dessen aus, was unser Verständnis von Würde bestimmt. Zusammengenommen mit dem in These (7) entworfenen Szenario wird dies auf das Bild von einem Spagat zwischen zwei sehr unterschiedlichen Facetten des Würde-Begriffes hinauslaufen. (11) Ostasiatische Philosophie: Selbst in der der westlichen Philosophie oft als so fremd dargestellten ostasiatischen Philosophie schließlich findet sich schon sehr früh ein differenziertes Würde-Bild. So z.B. schon bei dem altchinesischen Denker Mengzi („Menzius“), dem zweiten Genius der konfuzianischen Schule nach Konfuzius, der heute wieder eine sehr große Rolle spielt in der Diskussion, was ein moderner Konfuzianismus jenseits seiner Vereinnahmung durch die Politik sein könnte. Mengzi schreibt dem Menschen und nur ihm mit seiner Natur die Verfügung über eine besondere Würde zu: Er beschreibt explizit, „dass im Unterschied zu den politischen Würden, die von Herrschern verliehen werden, diese besonderen Würden weder verliehen noch wieder genommen werden können, da sie in der angeborenen menschlichen Natur bestehen. Mit seinem guten moralischen Vermögen hat der Mensch also etwas Würdiges in sich oder eine Würde in sich selbst, und diese steht höher als die Würden, die ihm von einem Machthaber verliehen oder genommen werden können. Es ist diese Würde dieser menschlichen Natur, die ihn zu moralischem Handeln und Urteilen befähigt.“17 17 ROETZ, Heiner (2009): Zur Lage der Menschenrechte in China. In: INSTITUT FÜR ANGEWANDTE KULTURFORSCHUNG (Hrsg.) (2009): Olympische Spiele 2008. Chinas Herausforderungen. Göttingen. 112 380 3. Spagat zwischen zwei unterschiedlichen Facetten des Würde-Begriffes (12) Januskopf. Nach diesen Ausflügen in die Geistes-, Kultur- und Politikgeschichte wollen wir uns unserem Thema nun durch eine Reihe von phänomenologischen Beobachtungen und Impressionen nähern. Sobald man sich bemüht, aufmerksam und etwas genauer in seinen Bedeutungskreis hineinzuhorchen, zeigen sich unerwartete, eigentümliche Unschärfen und Unstimmigkeiten. Je intensiver man sich darauf einlässt, desto deutlicher schält sich heraus: Würde trägt ein Doppelgesicht. Auf ihrer einen Seite verkörpert Würde eine Aura von Unanfechtbarkeit aufgrund der Suggestion von herausgehobener Erwähltheit. Auf ihrer anderen Seite verkörpert Würde eine Anerkennung der grundsätzlichen menschlichen Imperfektion, die Einsicht, dass erst Fehlbarkeit den Menschen zum Menschen macht; sowie ein – je nachdem: aktiver oder passiver –, jedenfalls aber heroischer Umgang mit der Unvollkommenheit, ein Ringen um die punktuelle Überwindung oder ein stoisches Ertragen dieser Unvollkommenheit. Unser Verständnis von Würde lebt von der Spannung, die zwischen diesen beiden Polen herrscht. (13) Zivilisatorischer Fortschritt? Die Würde des Menschen ist nicht nur das Alpha und Omega der deutschen Verfassung, hier quasi als Wiedergutmachung für die entsetzlichen Verbrechen des vorangegangenen Tausendjährigen Reiches. Sie ist heute – zumindest verbal – ein universell unbestritten positiver Wert. Ihre Verletzung ist durch das Völkerrecht, die Verfassungen der meisten Staaten der Welt und zahlreiche Konventionen geächtet, was allerdings weiterhin nicht gleichbedeutend ist ihrem verlässlichen praktischen Ausschluss. Den zahlreichen geschichtspessimistischen und kulturkritischen Zweiflern kann man – bei aller auch weiterhin begründeten Skepsis – einen vergleichenden Blick auf das gerade erst vergangene Jahrhundert entgegenhalten. Einen Blick zum Beispiel auf die lange Liste derjenigen großen Menschengruppen, denen noch vor historisch extrem kurzer Zeit weithin nicht die volle Würde des Menschen zugebilligt wurde: Frauen, Farbige, Homosexuelle, Behinderte, Nichtehelich-Geborene, Gesetzesbrecher, Kriegsverlierer, Fremde, Andersgläubige, politische Oppositionelle und noch manche andere mehr. Daraus ist zu lernen, dass man sich hüten sollte, Skepsis über das Erreichte und Erreichbare sowie das unablässige Ringen um den Erhalt von kulturellen und sozialen Errungenschaften zu verwechseln oder gar zu ersetzen durch Geschichtspessimismus, Unheils- und Niedergangsprophetien. (14) Gleichursprünglichkeit von Menschheit und Würde. Die Anerkennung einer universal geltenden Würde also ist eine Errungenschaft der jüngsten Moderne. Dies gilt allerdings lediglich im Hinblick auf ihre praktische Durchsetzung, nicht jedoch im Hinblick auf ihre theoretische Geltung. Denn diese lässt sich letztlich zurückführen auf die Selbstentdeckung, ja Selbstschöpfung des Menschen als einer eigenen Gattung innerhalb seiner natürlichen Umwelt.18 Mit diesem Akt der Selbstentdeckung und Selbstschöpfung ist der Mensch aus der Eigendynamik der natürlichen Evolution heraus- und hat den Weg einer nach seinen eigenen Regeln ablau18 Vgl. GÜLDENPFENNIG, Sven (2007): Sport verstehen und verantworten. Sportsinn als Herausforderung für Wissenschaft und Politik. Sankt Augustin. Kap. 9 („Sinn. Plädoyer für eine optimistische Sicht der Dinge“) 381 fenden Geschichte angetreten. Die Faktizität von deren Verlauf ist zwar bis heute maßgeblich mitbestimmt und beschränkt gewesen durch gruppenegoistische, nepotistische, nationalistische und andere partikularistische Verkürzungen und Verweigerungen der Anerkennung einer universalen Menschheitlichkeit. Die Vision einer universal geltenden Würde war jedoch in der Entdeckung von Seinesgleichen im menschlichen Gegenüber von vornherein im Keim angelegt und somit gleichursprünglich mit ihr. Gleichwohl darf nicht übersehen werden: Die Geschichte jener universalen praktischen Durchsetzung dieser Geltung der Würde ist alles andere als eine pure Erfolgsgeschichte. Ihr Weg ist vielmehr – bis auf den heutigen Tag – gepflastert mit Hekatomben von Opfern, bei denen ungezählte unbeschreibliche „Antastungen ihrer Würde“ stattgehabt haben. Ein solches Plädoyer für eine optimistische Sicht der Dinge kommt folglich auch nicht daran vorbei, sich die innere Widersprüchlichkeit des Würde-Begriffs genauer anzusehen, auf die wir unter dem Stichwort Januskopf eben schon hingewiesen haben. (15) Quasi-aristokratische Überlegenheit. Würde entsteht maßgeblich aus der Aura eines Adelig-Herausgehobenen und -Unnahbaren. Ja, sie strahlt etwas Gravitätisch-Majestätisches und einen Hauch von Exzellenz aus. Und doch ist sie nicht zugleich an historische Größe gebunden oder gar an die Fülle der Macht. Sie erhält ihr Profil nicht zuletzt aus dem Gegenbild von Niedrigkeit, Ordinarität, Mediokrität, von Menschlich-Allzumenschlichem und alltäglicher Unbedeutendheit. Würde strahlt eine Art von Unberührbarkeit aus. Aber gerade nicht im Sinne von Aussätzigkeit bzw. von Inferiorität wie bei der indischen Kaste der Unberührbaren. Sondern im Sinne von Exzellenz, Unantastbarkeit und Unbestrittenheit. Diese Assoziationen bilden die eine Seite, den einen Pol jener Janusköpfigkeit. (16) Schutz- und Bannzauber für die Schwachen. Es mutet an wie eine Paradoxie, dass Artikel 1,1 GG das Gegenteil im Blick hat: den Schutz derer, welche zu wenig oder gar nichts aufzubieten haben zu ihrer eigenen Selbstbehauptung und zur Selbsterzeugung des eben gezeichneten Bildes von Würde. Die demonstrative Beschwörung der Unantastbarkeit von Würde meint den Schutz gerade jener, deren Würde faktisch notorisch gefährdet ist, weil sie eben nicht eingehüllt sind in eine Aura der Unverletzlichkeit. Der GG-Artikel, der, wie wir bereits gesehen haben, alles andere als eine empirische Feststellung meint, normiert eine Schutz-Klausel, eine Art von Bann-Zauber, mit denen die allgegenwärtige Gefährdung der Würde der Schwachen abgewendet werden soll. Sie zielt, wie jegliches Recht, darauf ab, die Schwächeren der Gesellschaft gegen das vermeintliche „Recht des Stärkeren“ zu schützen, indem von allen sozialen und individuellen Unterschieden der Gesellschaftsmitglieder abgesehen wird. Denn diese Unterschiede können in der Regel zum Nachteil von – eben – Benachteiligten ausfallen oder ausgelegt werden.19 Diese Schutzfunktion garantiert sogar noch mehr als die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe, auf die sozial- und wohlfahrtsstaatliches Handeln im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, ebenfalls mit dem Ziel des Würde-Schutzes, stets hinauslaufen sollte. Sie meint somit gerade diejenigen, die Jesus in den Seligpreisungen seiner Bergpredigt anspricht. Nur dass sich die – ja alles andere als unmäßigen – Verhei19 Vgl. SPERBER, Katharina (2010): Die Würde der Ärmsten. Karlsruhe rückt Hartz IV zurecht. In: Frankfurter Rundschau (FR) vom 10.2.2010 382 ßungen für sie nicht erst im Reich Gottes erfüllen sollen, sondern bereits im Hier und Jetzt. Jene Schutzfunktion hält ihren Schirm sogar und gerade auch über die, alleingelassen, gänzlich Hilflosen in ihrer höchsten Verletzlichkeit. Diese Assoziationen bilden die andere Seite, den anderen Pol jener Janusköpfigkeit. (17) Gnade, Haltung und Eigenleistung. Würde ist zwar, wie gesagt, nicht gebunden an historische Größe. Sie entsteht auch nicht als Honorierung von Verdienstlichkeit. Denn sie steht zumindest in Konkurrenz, wenn nicht gar im Widerstreit zu persönlicher Leistung. Insofern ist sie eine irdische Verwandte der göttlichen Gnade, auf die Luther alles gesetzt hat für die Rechtfertigung des Menschen. Ein Geschenk. Aber sie besteht trotzdem auch in der Ausstrahlung einer wenn auch unerworbenen, gleichsam angeborenen oder verliehenen Erscheinung von Größe. Und sie zehrt von der Attraktivität von Selbstzweckhaftigkeit und Großzügigkeit, ja Freigebigkeit, die sich geradezu indigniert dagegen verwahrt, sich in die Niederungen eines unkultivierten materiellen Begehrens herabziehen zu lassen. Durchaus diskussionswürdig bleibt dabei allerdings, ob Würde tatsächlich unbedingt berührt, ja kontaminiert wird dadurch, dass sie sich mit Geld und materiellen Interessen einlässt. Und wenn diese Annahme nicht unbedingt gälte, sondern oft nur Ausdruck eines verbreiteten antikapitalistisch-kulturkritischen Ressentiments wäre: Wo verliefe die Scheidelinie? Sie wird zwar von der bürgerlichen Gesellschaft eingefordert, postuliert und gewährleistet, aber nicht geschaffen. Und sie kann durch bestimmte Eigenarten dieser Gesellschaftsform sogar strukturell gefährdet werden. Jedenfalls zeigt Würde einen eher aristokratischen denn bürgerlichen Zug und Habitus. Würde ist also primär Ausdruck einer überlegenen Haltung. Aber sie ist doch auch Ergebnis einer Eigen-Leistung bei ihrer Erarbeitung sowie bei ihrer Verteidigung gegenüber allfälligen widrigen Umständen, gegenüber Versuchungen und Bedrängungen von innen und von außen. Dies zeigt, wie revolutionär der Anspruch auf Universalisierung dieses Vermögens ist, das verfassungsmäßig verbindliche Versprechen auf allgemeinen Zugang zu diesem Vermögen buchstäblich für jedermann, also auch für Kreti und Pleti. Denn jene Haltung und Eigenleistung ersetzen nicht etwa die verfassungsmäßige Würde-Garantie. Sie ergänzen und erleichtern vielmehr deren Verwirklichung, indem sie deren Abwehrbemühungen im Sinne der Schwächeren gleichsam von der anderen Seite der Stärkeren her entgegenkommen und zugleich den Schwächeren Wege aufzeigen, auf welchen sie auch selbst an der Verteidigung ihrer Würde mitwirken können. 4. Die Wurzeln für die Universalisierung des Würde-Anspruchs (18) Revolution. Der Anspruch auf Universalisierung der Würde bedeutet einen revolutionären Umbruch im Denken des Menschen über sich selbst. Er geht zurück auf das christliche Liebes- und Entfeindungs-Gebot, wie es Jesus seiner Bergpredigt verkündet hat. Diese Revolution zieht sich wie ein scharfer Bruch durch die Bibel selbst hindurch – und verbindet zugleich die Botschaften des Alten und des Neuen Testaments zu einer Gesamterzählung. Denn sie wird erst möglich durch ein schneidend scharfes Dementi: Jesus revidiert den zornigen, parteiischen, rächenden 383 Gott des Alten Testaments. Nach einer Interpretation von Jack Miles beglaubigt Gott mit Jesu universalem Liebesgebot seine Kündigung des partikularen, exklusiven und gewaltbewehrt nach innen und außen durchgesetzten Bundes mit Israel – und zwar aus der Not geboren angesichts der übermächtigen Bedrohung durch den römischen Imperialismus, gegen den er die „Kriegskosten“ für die Verteidigung seines auserwählten Volkes nicht mehr zu tragen bereit oder in der Lage sei.20 (19) Paulus als Begründer des Universalismus. Die christliche Liebes- und Friedensbotschaft wäre nach dieser Lesart nicht die Verkündigung eines theologisch autonomen „Neuen Testaments“.21 Gott unterschriebe vielmehr in Gestalt seines Sohnes eine Kapitulationsurkunde. Sie wäre das Eingeständnis und die Folgerung aus einer Niederlage. Er hisste die weiße Fahne und erklärte sich für alle Zukunft zum Nichtkombattanten in res politicis. Die Legitimierung eines universalen Würde-Anspruchs wurde also möglich, nachdem der alttestamentarische Gott seine exklusive Bindung an ein („sein“) Volk gelöst und neutestamentarisch in der Gestalt und Botschaft Jesu auf die Menschheit ausgeweitet hat.22 In ebendiese Vgl. MILES, Jack (2001): Jesus. Der Selbstmord des Gottessohns. München/Wien. 111-148 („Er verabscheut seine kriegerische Vergangenheit“; „Die römische Schoa und die Entwaffnung Gottes“; „Der Preis seines Pazifismus: Johannes wird ermordet“): Demnach „wurzelt der Wandel in etwas Radikalerem als einem verstärkten Engagement für die Barmherzigkeit, Geduld und Gnade von Exodus 34,6-7, in etwas mehr als einer bloßen Dämpfung der über Generationen hinweg gehegten Rachsucht. Nein, Jesus ermahnt seine Zuhörer zu einer vollkommen kontraintuitiven, um jeden Preis durchzuhaltenden Missachtung des elementarsten aller menschlichen Unterschiede, des Unterschieds zwischen Freundschaft und Feindschaft. (…) Israel war alles für Gott. Seit er seinen Fokus von der Menschheit insgesamt (‚Seid fruchtbar und mehret euch’) auf Abraham (‚Ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels’) verengte, hat sich jedes seiner Worte, jede seiner Taten um sein auserwähltes Volk gedreht. Was konnte ihn veranlassen, eine Unterscheidung, auf die er ein so klar umrissenes persönliches Engagement gegründet hatte, gänzlich aufzuheben? Es war, kurz gesagt, eine extreme Notlage. In der größten Krise seines Lebens macht Gott aus der schieren Not eine heroische Tugend.“ (125-126) „Statt unverblümt zu erklären, dass er außerstande sei, seine Feinde zu besiegen, kann er erklären, er habe keine Feinde, er lehne es ab, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. (…) Der Bund musste geändert werden, weil Gott seine Bedingungen nicht einhalten konnte und weil er, als eine neue nationale Katastrophe für Israel drohte, nicht länger so tun wollte, als könne er es. (…) Er hat aus der Not eine Tugend gemacht, gewiss, aber die Tugend ist eine wirkliche Tugend. Sie ist das heroische Ideal der universalen Liebe.“ (130-131) 21 Hier kann hingegen noch einmal auf John Milton’s „Paradise Lost“ verwiesen werden. Es deutet die Menschwerdung Gottes, der herrschenden Tradition der Bibelexegese folgend, gerade doch als freien Entschluss zur Tilgung der aus der Erbsünde entstehenden Schuld der Menschen. Er lastet der biblischen Gesamterzählung damit eine geringere Plausibilität auf als Jack Miles, welcher diesen Schritt als notwendigen Tribut für den Skandal der Aufkündigung des Bundes mit Israel interpretiert; vgl. MILTON (2008b), a.a.O., 137-139 22 Vgl. MILES (2001), a.a.O.: „Auch der bevorstehende Selbstmord-durch-Hinrichtung Jesu hat eine überraschende ethnische und weltpolitische Dimension. (…) Tatsächlich besteht ein unausweichlicher Zusammenhang zwischen dem Selbstmord des Hirten Israels und der Verschmelzung seiner Herde mit den ‚anderen Schafen, die nicht aus diesem Stall sind’ (Joh. 10, 16). (…) Nachdem Gott sich nämlich von der Pflicht befreit hat, einen Teil der Herde vor der Unterdrückung durch einen anderen Teil zu beschützen (er wird für seine Schafe sterben, aber nicht für sie töten), kann er nicht umhin, zu allen Teilen ein und dieselbe Beziehung einzunehmen. Um das Bild aufzugreifen, das er in Galiläa so eindrucksvoll benutzte, muss er werden wie die Sonne, die unterschiedslos über alle scheint.“ (216) „Unter dem neuen Regime gibt es noch immer eine Absonde20 384 Richtung weist auch die Paulus-Deutung des französischen Philosophen Alain Badiou in seinem Buch „Paulus – Die Begründung des Universalismus“: „Und genau deshalb, weil er die griechischen wie die jüdischen Ausschließungsmechanismen beseitigt, ist Paulus für Badiou der Begründer des Universalismus.“23 (20) Mythos des Planeten versus Mythen beschränkter Gruppen. Der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell spricht statt von Universalismus von einem „Mythos des Planeten“ bzw. von der Zukunftsvision einer „planetaren Gesellschaft“: „Wir brauchen Mythen, die den Einzelnen nicht mit seiner beschränkten Gruppe identifizieren, sondern mit dem Planeten.“24 Jener christliche Rückzug von der Front der religiösen Verteidigung partikularer Interessen also bleibt, unabhängig von jenem möglicherweise heroisch-unheroischen historischen Hintergrund, ein wichtiger Schritt, ein Aufbruchssignal, ja eine Zäsur für die weitere Zivilisationsgeschichte der Menschheit. Fortgeschrieben wurde er in den universalistischen Ideen des Humanismus, der Reformation und der Philosophie der Aufklärung, in den Menschenrechts-Dokumenten der Amerikanischen und Französischen Revolution sowie der Vereinten Nationen, gipfelnd in der unübertrefflichen Schlichtheit von Art. 1,1 GG. Aber auch mit diesen Fanfarenstößen zur Feier der Geburt der universell anerkannten Würde des Menschen sind der Konfliktstoff, der in ihr schlummert, und die Sprengkraft, die er in der globalen Gesellschaft entfaltet, natürlich keineswegs aufgehoben. Wenden wir uns daher weiteren schillernden Facetten unseres Problemfeldes zu. 5. Nachbar- und Gegenbegriffe (21) Familienähnlichkeiten. Die eben zitierten Adjektive verweisen darauf, dass der Sinnraum des Wortes „Würde“ noch deutlicher bestimmt werden muss, indem man ihn kontrastiert mit Nachbar- bzw. mit Gegen-Begriffen. Zunächst eine einfache Aufzählung einiger verwandter Begriffe bzw. Assoziationen, welche durch das Wort „Würde“ ausgelöst werden. Deren Familienähnlichkeiten gestalten den Sinnraum von Würde nach innen hin inhaltlich aus und füllen ihn mit Leben: Ehre, Aura, Nimbus, Klugheit, Wahrhaftigkeit, Weisheit, Besonnenheit, Mäßigung, Augenmaß, zwischenmenschlicher und diplomatisch-politischer Verkehr zwischen Instirung, doch das Kriterium dafür ist ethischer und nicht ethnischer Natur“ (221), und diese Absonderung bei der Zuerkennung von Würde ist Gott am Jüngsten Tag vorbehalten, nicht aber den Menschen in ihrer Welt überlassen: „Sie sollen nicht zu unterscheiden versuchen zwischen dem verdienstvollen und dem unwürdigen Armen, zwischen einem verletzten überfallenen Reisenden und einem verletzten Räuber, der nur bekommen hat, was ihm zukommt. Gott kann diese Unterscheidungen machen, und er wird es tun, am Ende der Zeiten. Doch das Volk Gottes soll sie in der Zwischenzeit nicht machen, mag diese auch noch so lang sein.“ (224) „Die Geschichte, die das Evangelium erzählt, eine Geschichte, in der der jüdische Gott von dem fremden Unterdrücker der Juden gekreuzigt wird, vermittelt auf ausgesprochen grelle und dramatische Weise, dass Gott nicht mehr ein Krieger ist, bereit, die Juden aus fremder Unterdrückung zu erretten, sondern ein Erlöser, der sich entschlossen hat, die ganze Menschheit vom Tode zu erretten.“ (249) 23 SPINNLER, Rolf (2008): Ein Sieg über das Siegen. Radikal im Denken, extrem in der Hoffnung: Warum der Apostel Paulus aktueller ist denn je. In: Die Zeit (DZ) vom 17.12.2008 24 CAMPBELL, Joseph (2007): Die Kraft der Mythen. 36 385 tutionen auf Augenhöhe in gegenseitigem Respekt, Verdienst, Begabung, Gerechtigkeit, Gradlinigkeit, Prinzipienfestigkeit, Beharrlichkeit, Unbestechlichkeit, Seelenadel, zivilisierter Stil, Großmut, Erhabenheit, Überlegenheit, Stolz, stilles Heldentum, Furchtlosigkeit, Tapferkeit, Distanz, stoische Unerschütterlichkeit, Gelassenheit, Selbstbeherrschung, die Unbeirrbarkeit eines Trotzdem-und-Alledem beim Stehen zu seiner gerechten Sache, Gefasstheit oder Fassung, Demut, Haltung, Verantwortung, Autorität, Autonomie, Unabhängigkeit, Souveränität. (22) Kontrastpaare. Die Demut als erstrebenswerte Haltung und Eigenleistung wird in ihr Gegenteil verkehrt durch Demütigung, also eine gewaltsam von außen aufgezwungene Entwürdigung, würdeverletzende Schmach. Zur Sinnfamilie gehört ferner die Würdigung, d.h. die angemessene Darstellung und respektvolle Anerkennung einer herausragenden Person oder Leistung: ein Ausdruck von Wertschätzung, also das Gegenteil von Herabwürdigung im Sinne von Geringschätzung und Abschätzigkeit. Zur Sinnfamilie gehört nicht zuletzt auch ein Mindestmaß an Wohlstand als eine Art von Versicherung gegen die Entwürdigung durch Elend, Verelendung, menschenunwürdige soziale Zustände. Diese Familienähnlichkeiten decken sich zwar nicht mit Würde. Aber sie umreißen den Bedeutungshof, den die Würde um sich hat und der ihre Bedeutung wie ihre Außenbezüge und fließenden Außengrenzen markiert. Durch ihre partielle Ähnlichkeit wie durch ihre partielle Unterschiedlichkeit schärfen sie das Profil unseres Kernbegriffes. Sie sollten folglich nicht als Beleg für Wittgensteins „Familienähnlichkeiten“ gelesen werden. Denn dieses tendiert zu der Annahme, die Sprache löse durch den dominoartigen Übergang von einem zum anderen die Grenzen zwischen den Sinnräumen der Begriffe eher auf, als dass sie sie eindeutiger zöge. Würde unterscheidet sich hier vor allem dadurch, dass sie durch bemühtes Handeln nicht primär erworben, sondern nur allenfalls verteidigt werden kann. (23) Gegenbegriffe der selbstverschuldeten Schwäche. Nun also eine einfache Aufzählung einiger entgegenstehender Begriffe, welche den Sinnraum von Würde von außen her eingrenzen: Nichtswürdigkeit = Unbedeutendheit, Unwürdigkeit = bedauernswerte Kläglichkeit, Würdelosigkeit = moralische Fragwürdigkeit, wahllos-vordergründige Konsumsucht in der Spaßgesellschaft, unzivilisierter Stil, Charakterlosigkeit, Käuflichkeit, Opportunismus, Selbst-Entwürdigung durch Verrat an selbstgesetzten Prinzipien wie z.B. beim Doping im Sport, öffentliche Selbstentblößung, Drückebergerei, Unterwürfigkeit, Kotau vor der Macht, Kollaboration mit dem Unterdrücker, Speichelleckerei, Leisetreterei, Wankelmut, Kadavergehorsam, Heuchelei, Feigheit in Verbindung mit Larmoyanz angesichts der allfälligen natürlichen und gesellschaftlichen Gefährdungen der menschlichen Existenz und der menschlichen Schwäche im Umgang damit, ja Resignation vor der vermeintlichen Übermacht eingebildeter eigener Schwäche, Fatalismus, Indifferenz. (24) Gegenbegriffe der eingebildeten Stärke. Scheinbar ganz anders als diese „schwachen“ gebärden sich „starke“ Gegenbegriffe zur Würde: draufgängerisches Heldentum, Leichtsinnigkeit, hybride Selbstüberschätzung, Aufschneiderei, Prahlerei, Maulheldentum, Ruhmsucht, Hochmut, Überheblichkeit, Diskriminierung, Erniedrigung, Unbeherrschtheit, Cholerik, Zorn, Enthemmung, Gier, Neid, Ressentiment, hysterische Schwarzmalerei, Rachsucht, Niedertracht, Intrigantentum, Rücksichts-, Skrupel- und Gnadenlosigkeit, Fanatismus, entfesseltes Berserkertum. 386 (25) Verächtlichkeit: Das Verbindende beider Gruppen von Gegenbegriffen. Die Gegenbegriffe umfassen also alle Formen mangelnden Selbstbewusstseins und Selbstbehauptungswillens, ja der Selbstdemütigung und Selbstaufgabe gegenüber einer tatsächlichen oder eingebildeten Übermacht äußerer Umstände; bzw. umgekehrt alle Formen unbedachten, verantwortungslosen und unkontrollierten oder gar gewaltsamen Abenteurertums – einschließlich einer Haltung, welche sich gegen drohendes oder vermutetes Unrecht reflexartig in den Kampf stürzt und sich damit fälschlich für heroisch hält, statt Kräfteverhältnisse und Umstände kühl abzuwägen, einen aussichtslosen Kampfes durch Aushalten von Unrecht, gewaltlosen Widerstand und diplomatische Geduld zu ersetzen und so eine Vielzahl von sinnlosen Opfern zu vermeiden. Die Vielzahl dieser Gegenbegriffe können trotz ihrer äußerst heterogenen Vielfalt zusammengefasst werden unter einem einzigen pejorativen Sammelnamen: Verächtlichkeit. In seinem grellen Licht wird das Profil der Würde noch viel schärfer, als es durch die Benennung allein ihrer positiv formulierten Eigenschaften möglich wäre: Sie ragt heraus wie ein Fels in der Brandung, als ein ruhender Pol der Überlegenheit und Unerschütterlichkeit innerhalb eines hektischen Gewimmels unterschiedlichster Formen von Würdelosigkeit. Diese sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung vollzieht sich nach der scheinbar paradoxen Logik von Hochmut und Demut, wie sie treffend zusammengefasst ist in Jesu Memento „Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden“, und vice versa. (26) Beschämung. Es gibt in unserem Sinnkontext sogar eine scheinbar paradoxe Form des Verhaltens. Sie stellt sich vorgeblich und demonstrativ auf die Seite dieser Gegenbegriffe, tatsächlich aber in den Dienst der Verteidigung der Würde. Es ist ein bisweilen listiges, im Extremfall verzweifeltes letztes, ein schwejksches Mittel zur Selbstverteidigung des Schwächeren, des potentiellen Opfers gegen seinen Peiniger. Es ist das Mittel der Beschämung. Der Versuch, durch demonstratives Vorzeigen der eigenen Blöße, seiner vermeintlichen Nichtswürdigkeit und des daraus entstehenden eklatanten Machtgefälles den Überlegenen so zu beschämen, dass er auf den gewaltsamen Einsatz seiner überlegenen Macht verzichtet. Zur Veranschaulichung nur ein Beispiel: Das Neue Testament berichtet in der Geschichte von der Hure beim Fest in Simons Haus (Luk. 7, 36-50), wie Jesus öffentlich die unerkannte Tugend der gefallenen Frau feiert und damit die konventionelle Entrüstung zurückweist, mit welcher der Gastgeber sich über die Unmoral dieser Frau erhebt. Jack Miles deutet diese Episode so: „Sie verhält sich schamlos, um jemanden zu beschämen. Sie erniedrigt sich, um einen anderen zu demütigen. Von Vergeltung kann man bei diesen Verhaltensweisen ebenso wenig sprechen wie von schlichter Kapitulation. Was Jesus entdeckt hat – und die Entdeckung soll im Abendland noch eine lange und explosive Geschichte haben –, ist die Macht des Opfers gegenüber dem Viktimisierer.“25 Jesus unterstreicht diese Botschaft der Episode, indem er deren moralische Logik mit mehreren Gleichnissen verdeutlicht. Demnach würde der sozial Unterlegene, wie die Hure in Simons Haus, „indem er die eigene Würde abstreift, auch den Gegner seiner Würde berauben“26. 25 26 MILES (2001), a.a.O., 151 MILES (2001), a.a.O., 153 387 Man kann hierin die Begründung der historischen Tradition des gewaltlosen Widerstands sehen. Jesus sucht zur Erhaltung der Würde der Schwachen einen dritten Weg zwischen selbstzerstörerischer Revolte und würdeloser Kollaboration. Dieses Mittel der gewaltlosen Selbstverteidigung hat sich seither als jeweils letztlich meist erfolgreich erwiesen. Aber es bleibt in gewaltsam zugespitzten Konfliktsituationen gleichwohl kurzfristig stets ein riskantes und deshalb – eben – verzweifeltes letztes Mittel: Wenn man sich, wie in der genannten Episode, „Szenen vorstellen kann, in denen das Opfer nichts Böses tut, keinen Schlag austeilt, keine direkte Beleidigung äußert und dennoch gewinnt, dann kann man sich auch Gegenszenen vorstellen, in denen das Opfer verliert, weil in der Seele des Viktimisierers nicht ein Funken Anstand ist“27. Auch dies ist in zahllosen berühmt-berüchtigten und noch mehr anonymen historischen Beispielen belegt. Denn bekanntlich „bedarf es nicht viel, um einen kleinlichen Tyrannen zu reizen“28. Im Extremfall wird dem Opfer selbst noch diese allerletzte Möglichkeit genommen, einen Rest seiner Würde durch Beschämung seiner Peiniger zu verteidigen, wie die monströsesten Verbrecher der Geschichte es in ihren KZs von 1942 bis 1945 bei der „Endlösung der Judenfrage“ vollbrachten. 6. Teilhabe an der Aura der Heiligkeit (27) Ernst und Heiterkeit des Lebens. Würde hat teil an der Aura der Heiligkeit. Damit ist sie aber nach herrschendem Verständnis zugleich fest eingebunden in den Ernst des Lebens. Sie fordert und erzeugt eine – bisweilen vielleicht sogar erdrückende? – Ernsthaftigkeit, welche kaum Raum zu lassen scheint für die heitere, ja komische, die unterhaltsame Seite, die nicht minder zur Fülle des menschlichen Lebens gehört. Würde strahlt wegen ihrer Geste ernsthafter Überlegenheit etwas Patriarchalisch-Vertrauenerweckendes aus. Aber wegen ihrer humorlosen Ernsthaftigkeit zugleich auch etwas Penetrant-Unerbittliches.29 Dieses Schicksal teilt sie mit dem religiösen Glauben, zumindest in den monotheistischen Religionen. Denn auch 27 MILES (2001), a.a.O., 153-154 MILES (2001), a.a.O., 154 29 Vgl. CAMPBELL (2007), a.a.O.: „Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Mythologie und unserer jüdisch-christlichen Religion ist der, dass der Mythos seine Bilder mit Humor entfaltet. Man merkt, dass das Bild ein Symbol von etwas ist. Man hat eine Distanz dazu. Aber in unseren Religionen ist alles prosaisch und sehr, sehr ernst. Mit Jahwe kann man keine Faxen machen.“ (245) Und mit Allah oder Mohammed noch weniger, wie wir spätestens seit dem vor Jahren in Dänemark losgetretenen „Karikaturen-Streit“ wissen. „Das Neue wie das Alte Testament sind von einem moralischen Ernst, der Liebenswürdigkeit und oft genug sogar Information praktisch ausschließt. Nicht, dass es in der Bibel keinen Humor gäbe, doch ist ihr Humor, wie alles andere in ihr, immer ein Mittel zu einem moralischen Zweck. Nichts wird in der Bibel zu dem bloßen Zweck gesagt, einen zu informieren oder zu belustigen; weder Wissen noch Schönheit, noch sonst ein menschliches Gut wird jemals um seiner selbst willen angestrebt. So kommt es, dass die Bibel nur wenig von jener Art von ästhetischem Genuss bietet, den wir von fiktionalen Werken zu erwarten gelernt haben, während der ausgeprägte ästhetische Effekt, den sie sehr wohl hervorruft, einer von konzentrierter und zwingender moralischer Dringlichkeit ist.“ (MILES 2001, a.a.O., 58) 28 388 das Streben nach Eindeutigkeit von Glaubensbotschaften und die totalisierende Tendenz religiösen Engagements scheinen sich schwer zu vertragen mit der gewollten Mehrdeutigkeit des ironisch-distanzierten Spiels.30 (28) Die Figuren des Clowns, Hofnarren und Kabarettisten. Ist Würde folglich nur als humorlose möglich? Es ist eine diskussions-würdige Frage, ob dies tatsächlich unvermeidlich so sein muss. Die Gestalt des Clowns im Zirkus, entgegen der Banalisierung dieser Figur im alltäglichen Sprachgebrauch, verkörpert auf anrührende Weise die Ambivalenz der Würde des Menschen, wie sie hier beschrieben worden ist. Aber dies gelingt gerade dadurch, dass hinter seinen Clownerien, hinter der lustigen Fassade seines gekonnt notorischen Scheiterns die Melancholie des überspielten Ernstes der menschlichen Existenz spürbar wird. Ähnliches gilt für die Figur des Hofnarren, welche heute ersetzt ist durch die des Kabarettisten. (29) Ekstase: Feier des schöpferischen Ausnahmezustands. Kann sich Würde also nur in dieser Dreiecksbeziehung über den Ernst mit dem unernsten Spiel verbinden? Sind also z.B. solche Ereignisse, in denen die gravitätische Seite der Würde geradezu vorsätzlich und inszeniert aufgegeben wird – in der Ekstase über herausragende Leistungen in Kunst, Artistik oder Sport, im Karneval, in jeder Art von schöpferischen (nicht-destruktiven!) Ausnahmezuständen – reine Gegenbilder, welche mit der Würde unvereinbar sind? Oder sind sie gerade umgekehrt unverzichtbarer Teil der Würde des Menschen? Joseph Campbell gibt auf diese Frage eine euphemistische Antwort, indem er die Rückkehr, die Wiederaufnahme des aus dem Paradies vertriebenen Menschen in den Garten Eden geradezu als Inbegriff der Würde des Menschen beschwört: „Der Unterschied zwischen dem Alltagsleben und dem Leben in diesen Momenten der Ekstase ist der Unterschied dazwischen, außerhalb oder innerhalb des Gartens zu sein.“31 (30) Heiligkeit, Tabu, Unantastbarkeit. Zu einer wohlverstandenen Würde könnte gehören, dass sie in einem freien Spiel der Möglichkeiten immer aufs Neue ihre Grenzen austestet und neu befestigt (eben: diese auch befestigt!). Sie muss teilhaben können an der tabuisierenden Wirkung von Heiligkeit. Genau dies meint ja die Rede von Unantastbarkeit. Dazu aber scheint es an der Zeit zu sein für eine Revision, für eine Liberalisierung, Generalisierung und Harmonisierung der seit jeher herrschenden Vorstellung von Heiligkeit. Bislang wurde sie als ein Monopol religiöser Güter behandelt. Jene Revision müsste sich als Bewegung von zwei Seiten her vollziehen: von der einen Seite her als Aufhebung dieses Monopols, indem das Tabu über heilige Texte, heilige Menschen und heilige Glaubensinhalte enttotalisiert wird, indem wir uns also zum Beispiel heiligen Texten grundsätzlich so undogmatisch-offen nähern wie historischen Quellen oder literarischen Werken32; von „Für Ironie scheint in der Religion oder auch nur in der religiösen Literatur kein Platz zu sein, denn Ironie spielt ja mit doppelten Bedeutungen und der Umkehrung von Bedeutungen“ (MILES 2001, a.a.O., 298) 31 CAMPBELL (2007), a.a.O., 117 32 Ein Beispiel für die Richtung, in die diese Überlegung zielt: Die bereits mehrfach zitierte Studie von MILES (2001), a.a.O., unternimmt den ambitionierten Versuch, die biblische Einheit zwischen Altem und Neuem Testament dadurch plausibel und fruchtbar zu machen, dass er sie primär als literarisches Werk interpretiert. Seine These lautet: Einer literarischen Kritik gelingt es überzeugender als aller historischen Dekonstruktion und aller theologischen Exegetik, die Botschaft des 30 389 der anderen Seite her als Zuerkennung des Tabus von Heiligkeit auch an herausragende profane Kultur- und Moralgüter, die vielen Menschen heilig sind, indem wir uns also zum Beispiel profanen Werken grundsätzlich so ehrfürchtig nähern wie religiösen Heiligtümern. Beiden also sollte ein besonderer Schutz garantiert werden. Aber beide sollten gleichermaßen der kritischen Nachfrage geöffnet werden. 7. Staat als Institution wohlgeordneter Freiheit (31) Ein Sinn-Spagat. Immer wieder ist deutlich geworden: Würde hat eine eigentümlich große Spannweite. Sie umfasst einen Spagat. Sie ist eine Art von Brückenbegriff, welcher die Kluft zwischen zwei weit auseinander stehenden Pfeilern überspannt. Dieser Brückenbegriff überträgt gleichsam seine Bedeutungsherkunft vom „Hof der Exzellenz“ auf jene, die Jesus in seinem Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen als die „Geringsten unter euch“ tituliert hat: „Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 31-46) Er verbindet ein Recht und eine Haltung, einen moralischen und ästhetischen Begriff mit einem rechtlichen. Er beschwört damit ein unaufhebbares Spannungsfeld, ja eine Quadratur des Kreises. Entsprechend mühselig gestaltet sich die allgemeine und nachhaltige Durchsetzung des Verfassungs-Gebots einer Unantastbarkeit der Würde des Menschen in der globalen politischen Wirklichkeit. (32) Würdenträger. Allgemein geläufig im politischen Kontext ist der Begriff des „Würdenträgers“. Er mutet prima vista unproblematisch an. Er geht daher vielen so leicht von der Zunge. Darin verbinden sich jedoch auf äußerst konfliktreiche Weise das Moment der Exzellenz mit dem Moment der Repräsentation eines Amtes zur Führungs- und Herrschaftsrolle innerhalb von einflussreichen Institutionen. Neuen Testaments im Lichts des Alten Testaments als dessen Revision verständlich zu machen. Denn: „Ein literarisches Kunstwerk ähnelt einem Buntglasfenster. Es ist eigentlich nicht dazu da, um hindurchzusehen, sondern um betrachtet zu werden. (…) Warum verhält sich die NeueTestament-Kritik so ganz anders? Statt das Rosenfenster des Textes zu betrachten, bemüht sie sich unablässig, hindurchzusehen. (…) Warum gegenüber einem Werk der Imagination eine so engstirnig instrumentelle Haltung einnehmen?“ (315) Eine solche Perspektive einzunehmen, „würde niemanden hindern, die Schrift weiterhin als eine heilige zu studieren, eine, die für das kirchliche Leben pastoral und theologisch bedeutsam ist“ (323). Im Fokus dieser Perspektive wäre also „weder der Jesus der Geschichte noch der Christus des Glaubens, sondern der Jesus Christus der Literatur“; es wäre vielmehr „die Option, das Rosenfenster zu betrachten, statt durch es hindurchzusehen“ (325). Es ist die Aufforderung, „dass wir uns selbst gestatten, in einer Haltung ernsthaften Spiels an einen Text heranzugehen, der eine solche Haltung belohnt“, weil wir nämlich, „wenn wir uns mit dem Neuen Testament in der Weise befassen, dass wir das in ihm enthaltene Alte Testament mithören uns genau auf das einlassen, was das Neue Testament als literarisches Kunstwerk unverwechselbar kennzeichnet.“ (342) „Der Reiz der Bibel als – gutes oder schlechtes, sakrales oder weltliches – Kunstwerk übersteigt mittlerweile für eine große und wachsende Zahl von Laien ihren Wert als – wahre oder falsche – Geschichtsquelle. Manche, die in der Bibel nur sie selbst, nur ein heiliges Buch sehen und sie sogar mit einer Folge von sakralen Ereignissen gleichsetzen, werden gegen diese Entwicklung wohl immun sein. Die Bibel als Kunstwerk mag in ihren Augen vielleicht in die Bibliothek gehören, doch im Heiligtum hat sie nichts verloren. Ich für meinen Teil glaube, dass die Bibel, als Kunst gelesen, ihren sakralen Charakter behalten kann“ (343). 390 Würde ist abgekoppelt von Macht. Als Würdenträger verkörpert man zwar die Macht einer Institution. Aber die persönliche Würde ist mit der Führung dieses Amtes nur zufällig verbunden, keinesfalls aber dadurch konstituiert. Denn die Inhaber solcher Führungsämter können „würdige“, d.h. fähige und den Anforderungen des Amtes gewachsene Nachfolger finden. Sie können sich in ihrer Amtsführung aber gleichermaßen, z.B. durch Amtsmissbrauch, als ihrer Aufgabe „unwürdig“ erweisen. Und sie können „würdelos“ auftreten, ohne dass damit automatisch zugleich die Würde des Amtes selbst aufgehoben würde. (33) Wessen Würde tragen Würdenträger? Der Würdenträger trägt die „Würde“ einer Institution, welche diese selbst nur geborgt hat: von außen bzw. von oben, sofern sie durch göttlichen Willen legitimiert ist33; von innen bzw. von unten, sofern sie durch den Willen ihrer Mitglieder sowie die Rechtsförmigkeit ihrer Verfahren legitimiert ist. Fehlen beide, ist die Macht der Institution auf bloße Gewalt gebaut und damit illegitim. Staatliche Würdenträger sind mithin Träger der Würde der von ihnen Regierten – oder sie sind keine! Die Verkörperung der so legitimierten Würde einer Institution kann der Würdenträger durch persönliche Würde verstärken bzw. durch Würdelosigkeit schwächen oder gänzlich zerstören durch Staatsverbrechen. (34) Historische Zäsur. Jedenfalls zieht sich durch den Begriff des Würdenträgers eine historische Zäsur: Vormodern ist eine nicht auf allgemeine Wahl und Anerkennung, sondern auf Gewalt sowie auf Legitimation durch dynastische Geburt oder durch göttliche Berufung gestützte Herrschafts-Würde antiker, mittelalterlicher und frühneuzeitlicher oder absolutistischer Kaiser, Könige und Fürsten. Sie konnte hineinreichen bis in metaphysische Dimensionen von Gottesgnadentum oder gar Gottähnlichkeit der Kaiserwürde. Sie manifestierte sich in einer ungemein elaborierten politischen Formenlehre der in Kleidung, Gesten und Zeremonien rituell sichtbar inszenierten Zeichen und Insignien dieser Macht und Würde34 – grandios entzaubert in Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern! Etwas von 33 Schon der frühneuzeitliche Philosoph Baruch de Spinoza stellt die Berechtigung des Anspruchs weltlicher Machtträger auf eine göttliche Berufung und Einsetzung ausdrücklich als unbegründete Anmaßung in Abrede. In seiner erstaunlich differenzierten, geradezu modernen Form einer textkritischen Bibel-Lektüre – unter unausgesprochener Beherzigung von Luthers Leitsatz „Das Wort sie sollen lassen stahn“ und in unmittelbarer Zeitgenossenschaft mit dem hier mehrfach zitierten John Milton – stellt er in seinem Tractatus Theologico-Politicus von 1670 zum Beispiel der Mazedonier-Könige Philipp und Alexander, stellvertretend für zahlreiche Nachfolger bis fast heran an die Gegenwart, fest: Es hätten „früher Könige, die die Herrschaft an sich rissen, ihrer Sicherheit wegen die Meinung zu erwecken gesucht, dass sich ihr Geschlecht von den unsterblichen Göttern herleite (…). Die Mazedonier waren aber zu klug dazu. Menschen, die nicht vollständig ungebildet sind, lassen sich so offenbar nicht täuschen und aus Untertanen zu sich selbst unnützen Sklaven machen. Andere aber ließen sich leichter bereden, die Majestät sei heilig und vertrete die Stelle Gottes auf Erden, sie sei von Gott und nicht durch die Wahl und Zustimmung der Menschen eingesetzt und werde durch die besondere Vorsehung und Hilfe Gottes erhalten und beschirmt.“ (SPINOZA, Baruch de [1994]: Theologisch-politischer Traktat. Hamburg. 252-253) 34 Vgl. z.B. STOLLBERG-RILLINGER, Barbara (2008): Das Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches. München; vgl. dazu VEC, Milos (2008): Dabei sein ist alles. Der Code des Gemeinwesens: Eine Geschichte der politischen Formenlehre. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 12.12.2008 391 diesen vormodernen Legitimationsgrundlagen steckt auch heute noch immer in der Amtswürde religiöser Führer wie der katholischen Päpste, muslimischer Ayatollahs oder des buddhistischen Dalai Lama. Auch noch moderne Würdenträger können in den Voraussetzungen ihrer Amtsführung von der Aura dieser vormodernen Herrschaftslegitimation zehren. Auch in ihrem persönlichen Habitus können sie noch Anklänge an eine entsprechende Ausstrahlung und Autorität entfalten. Z.B. dort, wo es ihnen gelingt, Züge von Max Webers „charismatischer Herrschaft“ mit der Nachhaltigkeit von „good governance“ zu verbinden. Ein legitimer Würdenträger zu sein, verantwortlich Würde zu tragen, fordert sogar, die in diesem Begriff implizierte Erwartung an Exzellenz nicht von sich zu weisen, sondern anzunehmen und in praktisches Führungshandeln umzusetzen. Ausschlaggebend bleibt hier für die Verleihung von Amtswürde gleichwohl stets die Legitimation durch allgemeine und freie Wahl im institutionellen Rahmen eines rechtsstaatlichen und demokratischen politischen Systems. (35) Selbstanerkennung und Selbstbindung. Der ausschlaggebende Rechtfertigungsgrund für die Forderung nach unbedingtem Respekt vor der Würde aller Menschen liegt weder in deren naturgegebener, angeborener Unverletzlichkeit noch in der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Vor allem diese beiden vermeintlichen Rechtfertigungsgründe, die naturrechtliche und die religiöse, bestimmen bisher weitgehend die Diskussion um die Legitimation von universellen Menschenrechtsund Menschenwürde-Ansprüchen. Aber sie halten einer gründlichen logischen, rechtlichen und moralphilosophischen Prüfung nicht stand. Der ausschlaggebende Rechtfertigungsgrund liegt vielmehr in einer Selbstanerkennung und Selbstbindung der Menschen selbst. Das heißt: in der gegenseitigen Anerkennung aller Menschen als Mitglieder der menschlichen Gattung sowie in der Selbstbindung an die sich daraus ergebenden Normen des zwischenmenschlichen Verkehrs. Sind diese beiden Bedingungen sowie die entsprechenden rechtlich-institutionellen Vorkehrungen nicht gegeben, kann auch kein Verweis auf vermeintlich angeborene oder von Gott verliehene Unantastbarkeit die tatsächliche praktische Respektierung der Würde aller Menschen garantieren. (36) Unvollkommenheit und Endlichkeit. Zur Würde des Menschen gehört neben den berechtigten Ansprüchen, die einem nicht bestritten werden dürfen, auch die Erfahrung des Unvollkommenen, der Endlichkeit, der „Kosten“, Verluste und Verzichte, welche man dafür in Kauf nehmen muss. Sie auszuhalten und den Umgang mit ihr gleichwohl konstruktiv und schöpferisch zu gestalten, erfordert und konstituiert eine Haltung der Würde. Sie wird daher vielfach nicht erlangt durch eine problem-, reibungs- und konfliktarme Biographie, sondern erst durch – sei es heroisch-aktive oder stoisch-erduldende – Verarbeitung dessen, was der Publizist Roger Willemsen als einen biographischen „Knacks“ beschreibt35: durch Prüfungen, welche das Leben stellt und die auch und gerade im Falle des Bestehens dauerhafte Spuren hinterlassen, welche die Würde bestärken oder beschädigen können. 35 WILLEMSEN, Roger (2008): Der Knacks. Frankfurt am Main; vgl. dazu KEGEL, Sandra (2008): Lächeln trotz kleiner Kratzer. Über das allmähliche Scheitern der Menschen beim Leben. In: FAZ vom 20.12.2008 392 (37) Der Kulturstaat als Förderer von Win-Win-Situationen. Würde ist somit ein Gegenbild zu Göttlichkeit und entrückter Vollkommenheit. Wenn man so will: der Weg Jesu! Er verkörpert einen „Sieg über das Siegen, über das Gesetz dieser Welt, das da lautet: for winners only.“36 Der Sport, der nach einem verbreiteten Missverständnis als idealtypische Verkörperung des Sieg-Prinzips gilt und in dem folglich Niederlagen als Nullsummenspiel in der Verteilung von Sieg und Niederlage erscheinen, „genießt“ deshalb weithin eine entsprechende kulturkritische Geringschätzung. Tatsächlich aber erweist er sich bei genauerem Hinsehen als ein sprechendes Symbol des genauen Gegenteils: als ein kulturelles Feld zur Schöpfung von Win-Win-Situationen, bei denen im Fall eines gelingenden Spiels alle Beteiligten als Bereicherte vom Platz gehen wie nach einem dramatischen Stück von der Theaterbühne. Aber der Sport ist nur ein Beispielfeld von vielen. Eine aufgeklärte und zivilisierte, kulturstaatlich verfasste Gesellschaft lebt davon, dass sie ihren Bürgerinnen und Bürgern eine große Vielfalt solcher Handlungsfelder eröffnet, innerhalb derer sie ihre Würde entfalten und verteidigen können. Die Bürgerinnen und Bürger vertun und verspielen allerdings die Möglichkeiten, die technischer Fortschritt und Wohlstand ihnen durch Entlastung von zahllosen Mühseligkeiten des Alltags früherer Tage eröffnen, wenn sie sich in einer Schlaraffenland-Mentalität einrichten und annehmen, alles regele sich von nun ab von selbst: das Grundrecht auf Würde gehe auf in dem Grundrecht, „keine Sorgen und keinen Ärger mehr“ haben zu müssen. (38) Freiheit und Sicherheit. Würde hat also maßgeblich zu tun mit der Verfasstheit einer Gesellschaft. Ihre Gewährleistung ist nicht zuletzt angewiesen auf eine gelingende Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Sie braucht die Freiheit, erhobenen Hauptes und mutig schöpferische Risiken einzugehen. Zugleich aber muss sie sich auf (Ver-)Sicherungen stützen können, um dann, wenn das Risiko zuschlägt, die destruktiven Folgen beherrschbar zu halten. Die Freiheits-Seite der Würde braucht den Entfaltungsraum des demokratischen Rechtsstaates; denn Diktaturen sind neben anderen Übeln auch eine „Schule des Opportunismus“37. Die 36 SPINNLER (2008), a.a.O. BOMMARIUS, Christian (2008): Die Schule des Opportunismus. In: Berliner Zeitung (BZ) vom 3.12.2008. Ähnlich wie in Miltons „Areopagitica“ (vgl. Milton 2008, a.a.O.) findet sich auch schon in Spinozas zeitgenössischem frühneuzeitlichem „Tractatus Theologico-Politicus“ (avant la lettre!) eine ähnlich vehement liberale Verteidigung der persönlichen Denk- und Redefreiheit nicht als Gefährdung, sondern geradezu als Garant von Würde und innerem Frieden eines Staates: „Darum also wird eine Regierung als Gewaltherrschaft angesehen, wenn sie sich auf die Geister ausdehnt, und die höchste Majestät scheint den Untertanen ein Unrecht zuzufügen und sich ihr Recht anzumaßen, wenn sie vorschreiben will, was jeder als wahr annehmen und was er als falsch verwerfen soll und ferner welche Ansichten den Sinn jedes einzelnen mit Ehrfurcht gegen Gott erfüllen sollen. Das gehört zum Recht jedes einzelnen, das niemand, auch wenn er wollte, aufgeben kann. (…) Es ist nicht der Zweck des Staates, die Menschen aus vernünftigen Wesen zu Tieren oder Automaten zu machen, sondern vielmehr zu bewirken, dass ihr Geist und ihr Körper ungefährdet seine Kräfte entfalten kann (…). Der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit. (…) Ich gebe allerdings zu, dass diese Freiheit auch zuweilen Missstände im Gefolge haben kann. Aber welche noch so weise Einrichtung hat es jemals gegeben, die nicht irgendeinen Missstand hätte mit sich bringen können? Wer alles durch Gesetze bestimmen will, wird eher zu Lastern reizen als Laster bessern. Was man nicht hindern kann, muss man eben notgedrungen zulassen, 37 393 Sicherheits-Seite der Würde braucht den Schutzraum des sozialen Rechtsstaates. Wird diese Balance zu je einer Seite hin aufgehoben – sei es zur Seite eines liberalistischen oder eines sozialistischen Fundamentalismus – gehört die Würde des individuellen Menschen zu den ersten Opfern. Dagegen kann man sich nur dann nachhaltig wappnen, wenn die Gesellschaft wie ihre Mitglieder so verfasst sind, dass sie die Würde aller von außen garantieren durch Recht und von innen verteidigen durch Selbstachtung. Diese Voraussetzungen eröffnen allen die Möglichkeit, ein menschen-würdiges Leben zu führen. Sind sie gegeben, liegt es letztlich an jedem einzelnen Menschen selbst, sich des Geschenks dieser Möglichkeiten würdig zu erweisen. (39) Rechtsanspruch auf Würde trotz verspielter persönlicher Würde. Vor allem aber gilt – und dies ist nicht nur theoretisch interessant, sondern von größter praktischer Bedeutung: Die in Abschn. 5 aufgeführten Verwandten und Gegenbegriffe zur Würde bilden gar kein echtes, d.h. symmetrisches Gegensatzpaar. Jene außerordentliche Vielfalt von Gegenbegriffen wurde zusammengefasst unter dem Sammelnamen „Verächtlichkeit“. Sie meint die unterschiedlichsten Formen eines Verspielens oder anderer Arten von Beeinträchtigung der persönlichen Würde. Aber selbst in solchen Fällen darf denen, welche in eine solche Lage geraten sind, der Rechtsanspruch auf Respekt vor ihrer Würde nicht abgesprochen oder gar entzogen werden. Dies ist ein Prinzip der Menschlichkeit, welches von vielen Menschen und Staaten noch immer als nur schwer vereinbar mit atavistischen Resten in ihrem Rechtsverständnis empfunden wird. Der verbreitete Vorbehalt gegen die unbedingte Geltung dieses Prinzips drückt sich aus in der Empörung gegen „zu milde“ Gerichtsurteile, welche den Opfern und ihren Vergeltungsbedürfnissen keine hinreichende Genugtuung verschaffen, sowie in unterschiedlichsten Formen von Selbstjustiz, Lynchjustiz, Folter und Todesstrafe. Staaten, in denen die Verhängung der Todesstrafe noch immer nicht verfassungsmäßig ausgeschlossen ist, verkennen die Verheerungen, welche es im prinzipiellen Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen innerhalb ihrer Gesellschaften und der menschlichen Welt insgesamt anrichtet, dass wehrlose (wenn auch nicht schuldlose) Menschen von Staats wegen buchstäblich „kaltblütig“ getötet werden dürfen. wenn auch oft Schaden daraus folgt. (…) Gesetzt aber, diese Freiheit könnte unterdrückt und die Menschen könnten so in Schach gehalten, dass sie nicht zu mucken wagten ohne Erlaubnis der höchsten Gewalten, so wird es doch sicherlich niemals dahin kommen, dass sie auch bloß so denken, wie die höchsten Gewalten es wollen. Die notwendige Folge wäre also, dass die Menschen tagaus, tagein anders redeten, als sie dächten, und damit würden Treu und Glaube, die dem Staate doch so nötig sind, aufgehoben und die verächtlichste Heuchelei und Treulosigkeit großgezogen, die Quelle jeden Betrugs und der Verderb aller guten Sitten. (…) Soll also nicht Kriecherei, sondern Treue geachtet werden und sollen die höchsten Gewalten die Regierung in festen Händen halten und nicht gezwungen sein, sie Aufrührern zu überlassen, so muss die Freiheit des Urteils notwendig gewährt und die Menschen müssen so regiert werden, dass sie, trotz offenbar verschiedener, ja entgegengesetzter Meinungen, doch in Eintracht miteinander leben. Es kann kein Zweifel sein, dass diese Regierungsweise die beste ist und die wenigsten Missstände im Gefolge hat, denn sie steht mit der Natur der Menschen am meisten in Einklang.“ (SPINOZA 1994, a.a.O., 299301, 304-307) Es klingt, als hätte dieser Autor, der hier auch aus schmerzhafter persönlicher Erfahrung spricht, in seiner hellsichtigen Diagnose bis in die Verheerungen vorausgeblickt, welche die Diktaturen des 20. Jahrhunderts in der Würde des Menschen angerichtet haben. 394 8. Würde als Ausdruck von De-Mut (40) Eine Vision vollendeter Menschlichkeit statt der Utopie eines Neuen Menschen. Würde ist Ausdruck einer Vision von vollendeter Menschlichkeit. Sie umfasst den Reichtum aller Momente, wie sie hier beschrieben und positiv gewürdigt worden sind. Vollendete Menschlichkeit aber heißt zugleich auch: Sie ist Inbegriff einer Anerkennung vollständiger Diesseitigkeit und Unvollkommenheit. Sie ist nicht Ausdruck jener Utopien vom „Neuen Menschen“, wie sie durch die gesamte Literatur und Vorstellungswelt utopischer Verheißungen und Heilslehren geistern, einschließlich der christlichen Botschaft, wie sie etwa in der Antwort Jesu an einen Pharisäer namens Nikodemus anklingt: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ (Joh. 3,1-3)38 Nein. Würde trägt nur der alte Adam in seiner Janusköpfigkeit, du und ich, wir alle. Mehr liegt nicht in unserer Macht. Mehr sollten wir uns daher vernünftigerweise nicht einreden lassen. Wer, unzufrieden mit den Unvollkommenheiten unserer Existenz, grundlegend darüber hinaus will, beschwört damit das Schicksal jeglicher Hybris heraus: Er führt den Kosmos der menschlichen Welt nicht vorwärts in ein Gelobtes Land, sondern wirft ihn erst recht zurück ins Chaos. (41) Vestigia terrunt. Die Spuren am Wege entsprechender historischer Versuche schrecken. Die Imperfektion der menschlichen Welt lässt sich grundstürzend nur mit Gewalt überwinden. Also gar nicht. Denn auf Gewalt lässt sich keine nachhaltige Zukunft gründen. Würde, so verstanden, ist ein Vorschuss, den jeder von uns jedem von uns einräumt. Ein zinsloses verlorenes Darlehen, das also grundsätzlich nicht rückforderbar ist, das aber gerade dadurch einen generellen Vertrauensvorschuss signalisiert, auf den unser Zusammenleben angewiesen ist, um menschenwürdig sein zu können. Und dieses zunächst zinslos vergebene verlorene Darlehen erweist in der Praxis seine segensreiche produktive Wirkung. Es geht darum, allen Menschen ohne Ansehen von deren individuellen oder kollektiven Eigenschaften Würde zuzuerkennen, mit allen allgemeinen Attributen des Menschlichen. Es geht nicht darum, sie zu grundstürzend anderen Menschen zu machen. Denn eine wirkliche Lösung der Probleme der Menschen kann – trotz aller anderslautend in seiner Geistesgeschichte tradierten Hoffnungen, Sehnsüchte und Versprechungen – nicht davon erwartet werden, dass er in eine andere Hülle, eben in die eines grundstürzend neuen Menschen schlüpft. (42) Der neue Mensch wäre kein Mensch. „Die Suche des Menschen nach einem Anders- und Neusein seiner selbst, nach Neu- und Wiedergeburt ist freilich uralt und hat die Kulturgeschichte des Menschen immer begleitet“ – aber: „Die säkularreligiösen Hoffnungsbilder eines Neuen Menschen sind entkräftet.“ 39 Sie könnten immer nur der zum Scheitern verurteilte, ja nicht einmal wünschenswerte Versuch sein, die Ambivalenz, Vieldeutigkeit und damit Freiheit des Menschen um ihre „schwachen Seiten“ zu beschneiden, was aber zugleich bedeuten würde, ihm die Herausforderung zum nachhaltigen Streben nach Selbstvervollkommnung und 38 Näheres vgl. in der luziden Studie von KÜENZLEN, Gottfried (1997): Der Neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkularen Religionsgeschichte der Moderne. Frankfurt am Main 39 KÜENZLEN (1997), a.a.O., 9 395 Kulturentwicklung zu nehmen. Der vermeintlich neue Mensch wäre in Wahrheit kein Mensch mehr. Und überlebte doch der Mensch in ihm, fiele der umgehend wieder zurück in die gewohnten Grundmuster sozialen Zusammenlebens, die der Mensch gar nicht ablegen kann.40 Nein. Die Lösung kann allein darin bestehen, dass der Mensch seine eine zwiespältige Grundausstattung, die er biologisch, anthropologisch, psychologisch und soziologisch vorfindet, gründlich reflektiert, versteht, akzeptiert und durch Aufbau, Vereinbarung und Befolgung von Normen, Regeln und Institutionen zu beherrschen, einzuhegen und in ein menschengerechtes Leben zu transformieren versucht, in einen lebenslangen Prozess der Selbstbildung sowie des moralischen wie politischen Strebens. Dies gilt in jedem partikularen Sinnfeld und in jeder situativen Konstellation, indem er dem Eigensinn der Sinn- und Handlungsfelder, in denen er sich in seiner Lebensführung bewegt, genauer nachspürt und deren Handlungsimperative zu verstehen und zu beherzigen strebt. (43) Würde als Bollwerk wider den Fundamentalismus. Unser Thema bewegt sich in einem Mittelbereich: innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Menschlichem und Allzumenschlichem. Der Bedeutungsraum von Würde überschreitet nicht die Grenze zum Göttlich-Übermenschlichen. Er überschreitet auch nicht die Grenze zum Satanisch-Unmenschlichen. Gestalten unserer Vorstellungs- und Erfahrungswelt wie Jesus oder Hitler sind innerhalb dieses Bedeutungsraums nicht zu fassen.41 Sie verlassen ihn nach oben bzw. nach unten, jedenfalls nach draußen. Bei aller Hochschätzung bzw. Geringschätzung: Ein wohlbegründeter Begriff von Würde ragt ebensowenig hinein bis in Sphären der Unfehlbarkeit, wie seine Gegenbegriffe hineinreichen bis in Sphären des Verbrechens und der Barbarei. In diese Sphäre des Verbrechens und der Barbarei gehört nur der Nihilismus einer prinzipiellen Negierung und gewaltsamen Aufhebung der Würde von Menschen, wie sie kennzeichnend sind für alle Arten von fundamentalistischen Neuschöpfungsversuchen der menschlichen Welt. Existenzielle Bedeutung also erhält die Würde nur ex negativo, nämlich erst dann – aber auch immer dann! –, wenn sie in Gefahr steht, mit Gewalt verletzt zu werden. 40 Vgl. HONDRICH, Karl Otto (2001): Der Neue Mensch. Frankfurt am Main Um noch ein letztes Mal auf Miltons „Paradise Lost“ als einem der wichtigsten Werke der Weltliteratur Bezug zu nehmen: Es drängt sich förmlich auf als Lehrstück für eine verbreitet unplausible Art, wie Freiheit, Erkenntnis, Macht und Würde miteinander in Zusammenhang gesetzt werden: Menschliche Freiheit und Erkenntnis sind, obwohl Milton hier wie gezeigt der biblischen Botschaft von ihrer Unvereinbarkeit folgt, direkt aufeinander verwiesen. Macht und Würde hingegen, wie ebenfalls gezeigt, voneinander entkoppelt. Denn Würde kommt auch (oder gerade!) Menschen selbst in extremer Machtlosigkeit zu. In „Paradise Lost“ jedoch wird eine überragende Würde gerade nur der Allmacht Gottes und seines Sohnes zugesprochen. An Satan in seinem Aufruhr gegen seine Unterordnung unter die Vorherrschaft des Gottessohnes gerichtet, heißt es: „Wie fälschlich nennst du Knechtschaft, dem zu dienen / Den Gott und die Natur zum Herrn bestimmt; / Gott und die Natur gebieten es zugleich, / Weil er der Würdigste von allen ist. / Knechtschaft ist’s nur, dem Unverständigen, / Der wider einen Würd’gern sich empört, / Zu dienen, wie jetzt deine Rotte dir.“ (283) Und Gott selbst an seinen Sohn gerichtet: „“Ich fügte diesen schnöden Aufruhr so, / Um darzutun, du bist der Würdigste, / Berechtigt durch Verdienst, gesalbter König / Und Erbe meines Throns zu sein.“ (MILTON 2008b, a.a.O., 311) 41 396 (44) Ringen mit der menschlichen Unvollkommenheit. Innerhalb des Sinnraumes der Würde hingegen erfassen wir ein gelingendes bzw. misslingendes Ringen mit der menschlichen Unvollkommenheit. Dieses Ringen bewegt sich innerhalb des begrenzten Rahmens moralischer und ästhetischer Kategorien. Das Ringen um die Verwirklichung oder Verletzung von Würde dreht sich um Fragen zwischenmenschlicher Wertschätzung und persönlichen Stils, betrifft aber nicht die Sphäre der Verletzung von Strafrechtsnormen und des offenen Rechtsbruchs. Zudem bieten sie weder für fundamentalistische Verheißungen noch Verdammungen irgendeinen begründeten Anlass. (45) Würde als De-Mut. Die Ausgangsbedingung dafür, dass man überhaupt sinn- und gehaltvoll von Würde (bzw. deren Verletzung) sprechen kann, sind mithin die Unvollkommenheit und Endlichkeit des Menschen. Würde umfasst auf der einen Seite Demut vor der Unaufhebbarkeit dieser Schwäche des Menschen. Sie umfasst auf der anderen Seite aber eben auch einen unbeirrbaren Kampf darum, den destruktiven Folgen dieser Schwäche nicht einfach nachzugeben, sondern ihr alle erreichbaren Formen von kulturellen Errungenschaften abzuringen. Der Mensch kann seine Würde gleichermaßen durch hybriden Hochmut verletzen wie durch widerstandslose Resignation. Würde nimmt das Wort De-Mut in seinen beiden Teilen ernst: Sie unternimmt eine unabschließbare riskante Gratwanderung hindurch zwischen Skylla und Charybdis, zwischen Hochmut und Mutlosigkeit. Zwar hat die Demut stets „den unappetitlichen Beigeschmack des Kriechens und der Erniedrigung mitgeschleppt“ und scheint prädestiniert als „eine Tugend der Verlierer“; tatsächlich aber trifft dies nur für die Demütigung als Gegenprinzip der Demut zu, wenn also „Demut von außen aufgezwungen wird“42. (46) Die dritte, die philosophische Erzählung der Menschwerdung. Hier soll jedoch der verbreiteten Abschätzigkeit gegenüber dieser Tugend und auch deren sprachlichem Hintergrund gar nicht weiter nachgegangen werden. Zumal die Demut mit dem Mut etymologisch gar nicht primär, sondern nur sekundär über ihren gemeinsamen Vorfahren, den althochdeutschen „muot“ verbunden ist. Jedenfalls gilt eine solche Haltung gegenüber der Unvollkommenheit und Endlichkeit des Menschen unabhängig davon, ob man der schönen und melancholischen Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies in der biblischen Genesis (und ihrer noch schöneren Nacherzählung in Milton’s „Paradise Lost“) folgen möchte oder der naturwissenschaftlichen Erzählung von der Evolution nach Darwins „Entstehung der Arten“ und „Abstammung des Menschen“. Jenseits dieser Dichotomie zwischen Schöpfungsgeschichte und Evolutionstheorie also – heute bekanntlich wieder hoch umstritten – spricht viel für eine dritte Erzählung der Menschwerdung: die Vorstellung, dass die Menschwerdung überhaupt erst durch Vertreibung aus dem Paradies möglich wurde. Der Mensch hat das Gute für den Aufbau seiner, einer menschlichen Welt in die natürliche Welt implantiert. Diese Erfindung ist erfolgt zur Gewährleistung des Selbstschutzes von und vor Seinesgleichen, damit aber auch zur Selbstherausforderung durch etwas, das nicht verlässlich von Natur aus gegeben ist: Moral. Überhaupt dadurch erst ist das Dual von 42 ZIELKE, Anne (2009): Demut. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) vom 18.1.2009 397 Gut und Böse entstanden und der Mensch in die Lage versetzt bzw. gezwungen worden, wählen zu können und sich entscheiden zu müssen. Durch diese Erfindung hat der Mensch sich selbst aus der ungeschiedenen Harmonie des natürlichen Paradieses vertrieben. Und damit auch die Würde und deren Gegenteil gestiftet. Eine solche dritte Erzählung der Menschwerdung belässt es folglich nicht bei der passiven Rolle des Menschen, welche ihm in der kosmologischen Erzählung der Genesis ebenso wie in der biologischen Erzählung des Darwinismus zugewiesen worden war, sondern spricht ihm in einer Art von philosophischer Erzählung eine aktive Rolle bei der Selbstentdeckung und Selbstschöpfung aus eigenem Wollen zu. Selbstverständlich muss er im Gegenzug auch die volle Verantwortung für „das Böse“, d.h. alle Verletzungen der Humanität selbst übernehmen. Er kann sie also nicht mehr im Sinne der Theodizee abschieben auf einen entsprechenden Willen oder Zorn Gottes und auf das Wirken des Teufels. Dieser Teufel ist dann niemand anders als wir selbst, sofern wir unsere selbstgesetzten Normen, moralischen Imperative und rechtlichen Gesetze verletzen. Liegt es angesichts solcher Überlegungen schließlich nicht nahe, auch die allzu schlichte Vorstellung, die wir uns üblicherweise vom Paradies machen, etwas genauer zu beschreiben zu versuchen? Erscheint es nicht plausibel, es sich als die kosmische Ordnung nach der Schöpfung aus dem Chaos, also als die natürliche Welt mit ihrer ökologischen Gleichgewichtsordnung vor Einführung der anthropozentrischen Moral vorzustellen, was aber keineswegs gleichbedeutend wäre mit einer konflikt- und gewaltfrei harmonischen Idylle? Paradies und Vertreibung aus ihm, göttlich-vollkommene Schöpfung und menschlich-fehlbare Welt stünden sich dann nicht mehr in jener unüberbrückbar scharfen Konfrontation gegenüber, wie sie in den Bildern von Vertreibung und Sündenfall beschworen wird. 9. Die Würde im theologischen und im juristischen Diskurs (47) Selbstverständlich hat die Würde-Thematik, wie bereits angesprochen, auch eine theologische Seite. Ihr soll hier noch ein Stück weiter nachgegangen werden. Ihre Schlüsselbedeutung für den interkonfessionellen Streit um die Rechtfertigungslehre wird prägnant in einem Presse-Disput auf den Punkt gebracht. Ein Leserbrief-Autor widerspricht einer Interview-Äußerung, in welcher der evangelischkatholische Gegensatz folgendermaßen formuliert worden war: „’Die Frage wird gegensätzlich beantwortet, ob das Geschöpf Mensch seinen Wert in dem hat, was es selbst ist und tut – die römisch-katholische Position –, oder darin, dass Gott es für wertvoll hält – die evangelische Position.’ Es sei mir erlaubt festzustellen, dass dieser Satz den Sachverhalt in jeder Hinsicht verfehlt, da er weder die katholische Anthropologie korrekt wiedergibt noch die Intention Martin Luthers trifft. Zum einen ist die Personwürde eines jeden Menschen eine Schöpfungsaussage, die in der Erschaffung des Menschen als Ebenbild Gottes ihren Grund hat. Demgegenüber betrifft das Rechtfertigungsgeschehen den sündig gewordenen, aber unverlierbar von Gott mit Würde immer schon begabten Menschen. Zum anderen ist bekannt, dass die konfessionelle Auseinandersetzung um die Rechtfertigungslehre ihren Ursprung in der Biographie Martin Luthers hat. Auf seine Frage: ‚Wie finde ich einen 398 gnädigen Gott?’ fand er für sich Antwort beim Lesen des Römerbriefs: Du kannst und du brauchst dich nicht selbst durch eigene Anstrengung zu einem Gerechten machen. Gottes Gerechtigkeit ist nicht die, die Er von dir verlangt, sondern die, die Er dir ohne jegliches Zutun von deiner Seite schenkt. Gott allein handelt an dir. Allein der Glaube an die Gerechtmachung, an die Rechtfertigung durch Gott allein, bewirkt Heil und inneren Frieden. Dieses ‚Allein’ war es nun, das zum Kernpunkt der Auseinandersetzung wurde. Dass kein Mensch sich das Heil selbst zu verdienen vermag, dass alle Bemühungen des Menschen getragen ist von der sie ermöglichenden Gnade Gottes, dass insofern alles, wirklich restlos alles Gnade und ungeschuldetes Geschenk Gottes ist, war immer schon, auch zur Zeit Martin Luthers, gut katholische Lehre, wiewohl man zugeben muss, dass das Bewusstsein dafür bisweilen durch eine bestimmte religiöse Praxis verdeckt wurde. Kontrovers war und ist also nicht, dass alles Gnade ist, sondern nur, dass es Gott allein ist, der des Menschen Heil wirkt. Und hier geht es nun in der Tat um die Würde des Menschen (Hervorh. S.G.). Die Frage ist nämlich: Bezieht Gott den Menschen mit ein in den Prozess seiner Rechtfertigung, seines Heil- und Heiligwerdens? Ist der Mensch mitbeteiligt, mitwirkend mit der Gnade Gottes, oder ist er nur passives Objekt des Wirkens Gottes, gleichsam wie ein Stein, den Gott zu sich erhebt ohne alle Eigenbeteiligung? Wenn es so wäre, würde dies tatsächlich der Würde des Menschen widersprechen, die darin besteht, frei zu sein, zustimmen oder ablehnen zu können, nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt in Gottes Gnadenhandeln zu sein, ein Mitwirkender mit der Gnade Gottes, wie es Paulus unübertroffen exakt formuliert hat. ‚Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als alle habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.’ (1 Kor 15,10). Auf diesem ’die Gnade Gottes, aber nicht allein ohne mich, sondern mit mir’ muss eine katholische Rechtfertigungslehre bestehen, wie gesagt, um der Würde des Menschen willen.“43 Zu diesem Disput ist viererlei anzumerken: Zum einen muss man immer aufs Neue staunen über die theologischen Zauberkünste, die auf allen beteiligten Seiten solcher Dispute ein menschliches Wissenkönnen über die Motive und Taten Gottes aus dem Hut zaubern, obwohl die ausschlaggebende Prämisse jeglichen religiösen Glaubens lautet, dass Gott höher ist als alle menschliche Vernunft.44 Zum zweiten ist der Gerechtigkeit halber festzuhalten, dass ja auch die evangelische Theologie letztlich in ihren praktischen Konsequenzen seit jeher auf eine glei43 WINDOLF, Bodo (2009): Es geht um die Würde des Menschen. Leserbrief. In: FAZ vom 13.11.2009 44 So ist z.B. das tatsächlich ewige, weil unabschließbare und folglich bis heute unabgeschlossene Ringen mit den Paradoxien der Theodizee – die Frage, wie ein allmächtiger und gnädiger Gott das Böse auf der Welt zulassen kann – die notwendige Folge einer unlogischen Problembeschreibung: Zuerst wird gegen Gottes Gebot ein menschengemachtes (also nach aller Wahrscheinlichkeit unzutreffendes) Bild von ihm entworfen, um anschließend ratlos vor mit dem Bild nicht vereinbaren empirischen Tatsachen zu stehen. Durch diese unlogische Problembeschreibung wird der Blick verstellt auf die menschliche Verantwortung für die beklagten Einbrüche des Bösen in die menschliche Welt: nämlich darauf, dass diese Einbrüche durchweg zurückzuführen sind auf einen unverantwortlichen Umgang mit den in der inneren Natur des Menschen und in der äußeren Natur seiner Lebensbedingungen angelegten Gefahren sowie in selbsterzeugten entsprechenden Risiken. 399 che Logik hinausläuft. Gleichsam gegen ihren Erzvater Luther, denn dessen apodiktische Postulate sola gratia und sola fide signalisieren ja eigentlich eine Logik der fatalistisch sich ergebenden Untätigkeit für das eigene Heil. Warum also, so darf man fragen, wird der Streit um die Rechtfertigungslehre zwischen den beiden Konfessionen eigentlich so erbittert ausgetragen? Vermutlich aus demselben Grund, aus dem unter den besonders engen Verwandten die Abgrenzungskämpfe immer besonders heftig und unversöhnlich ausfallen. Zum dritten aber, und das ist hier entscheidend, zeigen die Darlegungen des zitierten Theologen einmal mehr, dass man zu solchen – plausiblen! – Schlussfolgerungen wie er über den ontologischen Status und die praktischen moralischen Konsequenzen der menschlichen Würde auch dann gelangen kann, wenn man den theologischen Umweg über die Berufung auf einen vermeintlichen Willen Gottes gänzlich auslässt und entsprechende Klärungen auf direktem Wege durch zwischenmenschliche Verständigung darüber sucht, was die Menschen aus guten, d.h. vernünftigen Gründen einander schulden, wenn es zwischen ihnen menschengerecht zugehen soll. Zum vierten schließlich ist festzuhalten, dass seine Aussagen den Befund der vorliegenden Studie im wesentlich bestätigen und bekräftigen. Dies war aber nur dadurch möglich, dass die christliche Lehre zwar nicht per se und nicht allein die Grundpfeiler „unserer“ abendländischen Kultur und Moral begründet hat, aber doch in wesentlichen Teilen ihrer Botschaft mit diesen eher kompatibel ist als manche andere religiöse Lehre. Und es war möglich durch die gut begründete Auslegungsvariante der christlichen Lehre, welche dieser Theologe gewählt hat. Aus anderen religiösen Botschaften hätte sich möglicherweise ein virulentes Konfliktpotential mit einem menschengerechten Würde-Verständnis ergeben können. (48) In einem kurzen Porträt zur Philosophie des Augustinus deckt zudem Peter Sloterdijk ein weiteres Moment der christlichen Theologie auf, welches verheerend in die Geistes- und Moralgeschichte der folgenden Jahrhunderte hineingewirkt hat: Der schon bei Platon vorformulierte, überzogene göttliche Höchststandard in den Anforderungen an die menschliche Moral hat den Maßstab für die menschliche Moralfähigkeit so überdehnt und überstrapaziert, dass er durch reales menschliches Handeln niemals eingeholt werden kann und folglich unabwendbar stets unterschritten werden muss. Diese Sicht, die noch selbst das bemühteste menschliche Handeln als Ausdruck notorischer Korruption erscheinen lässt, gab die vermeintliche Begründung für Augustins irreführende und entmutigende Lehre von der menschlichen Erbsünde, welche dann in der fatalismusträchtigen Lehre des Augustinermönches Martin Luther von sola gratia und sola fide ihre logische Fortführung gefunden hat: „Die Gnadenlehre dient dazu, die menschliche Verlorenheit unter Gott dogmatisch zu betreuen. Augustinus hat die Schleusen geöffnet, durch die seither primärmasochistische Energien ins europäische Denken einströmten; er hat – mit einer Radikalität, die ihn geradezu in den Rang einer höheren Gewalt erhob – das menschliche Unheilbare zum Hauptmotiv seiner Wirklichkeitsdeutung erhoben (…) Wo schließlich der nur auf menschliche Weise liebende Mensch die Bühne betritt, mithin der Egoist, der immer sich selber und seine Gelüste meinen muss, dort sieht der spätere Au400 gustinus durchwegs das Stigma des Verlustes und die Spur einer Urschuld, die tiefer reicht als jede Tilgungsmöglichkeit und jedes menschenmögliche Gelingen.“45 In diesem bis heute wirkungsmächtigen theologischen Grundmuster ist eine misanthropische Denkhaltung angelegt, der man tunlichst ein menschengerechteres und doch alles andere als blauäugiges „Plädoyer für eine optimistische Sicht der Dinge“46 entgegenhalten sollte. Etwa in dem Sinne, in welchem Peter Sloterdijk nach und trotz seiner skeptischen Würdigung des schlecht begründeten Harmonismus in der leibnizschen Philosophie feststellt: „Für die künftige Geschichte der Menschheit wird es von Belang sein, ein Prinzip des Optimismus (oder zumindest ein Prinzip des Nicht-Pessimismus) mit nachleibnizschen Mitteln zu regenerieren.“47 (49) Ebenso erstaunlich wie problematisch schließlich sind die mit verlässlicher Regelmäßigkeit wiederkehrenden Versuche, rechts- oder moralphilosophische Begründungen dafür zu suchen, den Menschenrechten – und damit auch ihrem entscheidend tragenden Fundament, der Würde des Menschen – die universelle Allgemeingültigkeit abzusprechen. Statt die konstituierenden Elemente dieser Rechte auf den tatsächlich universell begründbaren und anerkennungsfähigen Kern zu konzentrieren und zu reduzieren, lassen solche Versuche in der Regel diesen Kern im Unbestimmten, um dann umso leichter die allfällig in einer pluralen Welt anzutreffenden Bedenken, Einwände und handfesten Widerstände gegen eine solche universelle Geltung gegen sie ins Feld führen zu können. Ein Musterbeispiel für dieses ebenso gängige wie irreführende Verfahren bietet die Erörterung eines Strafrechtlers und Rechtsphilosophen: „Aus Anlass des sechzigsten Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Dezember vorigen Jahres äußerte sich die zuständige Hochkommissarin der Vereinten Nationen erwartungsgemäß euphorisch: Kein anderes Dokument der neueren Geschichte habe einen größeren Einfluss auf die Menschheit ausgeübt. Weitaus zurückhaltender fiel die Stellungnahme des UN-Generalsekretärs aus. Die Erklärung sei ein inspirierendes Dokument, das freilich erst dann richtig geehrt werde, wenn seine Grundsätze überall und gegenüber jedermann geachtet würden. (…) Wer es wagt, die politische Leitfunktion der Menschenrechte anzuzweifeln, kann außerhalb von Nordkorea, Kuba oder Syrien kaum erwarten, als Gesprächspartner ernstgenommen zu werden. Ungeschlichtet ist allerdings der Streit um die überzeugendste Deutung der Menschenrechtsidee“; denn die Berufung auf die Begründungsinstanz menschliche Vernunft stehe vor einem Dilemma: Ihre Schwäche bestehe darin, „dass sie den Kern der Menschenrechtsidee, die Überzeugung, dass alle Menschen Inhaber gewisser fundamentaler Rechte sind, nicht adäquat auf den Begriff zu bringen vermag. Rational ist es demnach nämlich allein, mit jenen Individuen eine Verständigung zu suchen, von denen ich zu wissen glaube, dass sie für die Beförderung oder 45 SLOTERDIJK, Peter (2009): Philosophische Temperamente. Von Platon bis Foucault. München. 38-39 46 Vgl. GÜLDENPFENNIG (2007), a.a.O., Kap. 9 („Sinn. Plädoyer für eine optimistische Sicht der Dinge“) 47 SLOTERDIJK (2009), a.a.O., 63. Gleichsam die philosophische Ausarbeitung dieses Plädoyers findet sich in Sloterdijks im selben Jahr publizierter Variation auf das Thema „Du musst dein Leben ändern“; vgl. Kap. 1 in diesem Band. 401 Behinderung meiner Interessen wichtig sind. Dass dies alle Menschen sind, ist höchst unwahrscheinlich. Durch das Begründungsraster dieses Vernunftbegriffs drohen vielmehr gerade jene Personen zu fallen, die, weil sie gesellschaftlich unwichtig sind und deshalb über kein ernstzunehmendes Drohpotential verfügen, den Menschenrechtsschutz besonders dringlich benötigen“; folglich müsse eine die Universalität der Menschenrechte verpflichtend anerkennende Gesellschaft „in spezifischer Weise disponiert sein. Dazu bedarf es eines höchst voraussetzungsreichen kulturellen Arrangements“; ebendies aber sei nur in einem bestimmten, nämlich dem westlichen Typ von Gesellschaften, nicht aber universal zu erwarten; und es gehöre zur politischen Klugheit, „sich der Entstehungsgeschichte der eigenen Evidenzvorstellungen bewusst zu bleiben und die eigene Perspektive nicht mit der des Weltgeistes zu verwechseln (…). Der Westen muss indes mit der Einsicht leben lernen, dass seine Lesart nur eine mögliche, nicht aber die schlechthin zwingende Deutung des Menschenrechtsgedankens darstellt. Dieser Lesart kann aus Gründen widersprochen werden, die hierzulande zwar nicht überzeugend erscheinen mögen, aber auch keineswegs pauschal als Ausdruck von Irrtum oder Heuchelei abgetan werden dürfen.“48 Jedenfalls könne der Anspruch auf Allgemeingültigkeit allein schon deshalb nicht schlüssig begründet werden, weil bereits die „westlichen“ Vernunftkonzepte, aus denen ja nur die Idee universaler Menschenrechte habe hervorgehen können, von immanenten Selbstwidersprüchen durchsetzt seien. Doch genau diese Argumentation, welche Michael Pawlik hier stellvertretend für eine skeptische Denkschule wiederholt, erweist sich schnell als ein unfruchtbarer, weil realitätsferner bzw. die Erfahrungen der historischen Realität nur selektiv wahrnehmender Sophismus: Denn sobald man die zeitliche Optik der historischen Erfahrung nur weit genug aufzieht, erkennt man, dass es eine solche definitive Entscheidung zwischen „wichtig“ und „unwichtig“ allenfalls kurzfristig, aber auf lange Sicht gar nicht geben kann. Auch situativ ohnmächtige Kräfte und Strebungen haben sich letztlich stets als unbezwingbar erwiesen – sofern sie sich denn auf die generelle Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung berufen konnten und insofern begründet und berechtigt waren. Es ist also gerade der Nachweis für einen Mangel an Vernunft, wenn man sie aus egoistischen Kurzfristinteressen heraus ignorieren zu können meint. Tatsächlich zeigt der historische Verlauf unbestreitbar, dass die Anerkennung von Menschenrechten ein permanentes Fortschreiten ist, welches zugleich einen Rückgriff auf den Urimpuls zur Herausbildung und Heraushebung der menschlichen Gattung aus ihrer natürlichen Mitwelt auf dem unabschließbaren Weg zu dessen schrittweiser Vollendung bedeutet – also bis hin zu deren wirklich ernstgemeinter und nicht nur rhetorisch vorgeschobener universaler Anerkennung und weltweiter praktischer Verwirklichung. Diesen Weg dadurch zu dementieren, dass man die allfälligen Hindernisse, Verzögerungen und vorübergehenden Rückschritte für unüberwindlich erklärt und ge48 PAWLIK, Michael (2009): Wie allgemein sind die Menschenrechte? In: FAZ vom 27.11.2009. Der weitere differenzierte Argumentationsgang des Autors ist gerade aufgrund seiner Aufnahme verbreiteter skeptischer Einwände aufschlussreich. Er kann hier jedoch aus Raumgründen nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Er könnte aufgrund der Insuffizienz der genannten Grundannahme auch nichts ändern an dem hier formulierten kritischen Gesamtbefund. 402 gen ihn in Stellung bringt, ist intellektuell unredlich und praktisch fatal, weil es die Behinderer dieses Weges mit vermeintlich guten Gründen für ein gutes Gewissen und Weitermachen ausstattet. Peter Sloterdijk hat in seinem knappen Platon-Porträt nachgezeichnet, wie virulent sich schon am Beginn der europäischen Philosophie dieser Impuls zur Befreiung des Denkens aus lokalen Fesseln und zur Ausweitung ins Größere mit letztlich unaufhaltsamer Tendenz zur Universalität Geltung verschafft hat: An Platons Programm der Philosophie als politischer Praxis lasse sich ablesen, „dass die Geburt der Philosophie durch die Heraufkunft einer neuen riskanten und machtgeladenen Weltform bedingt war – wir nennen sie heute die der Stadtkulturen und der Imperien. Diese erzwang eine Neudressur des Menschen in Richtung auf Stadt- und Reichstauglichkeit. Insofern darf man behaupten, dass die klassische Philosophie ein logischer und ethischer Initiationsritus für eine Elite junger Männer – in seltenen Fällen auch für Frauen – gewesen ist: Diese sollten es unter der Anleitung eines fortgeschrittenen Meisters dahin bringen, ihre bisherigen bloßen Familien- und Stammesprägungen zu überwinden zugunsten einer weitblickenden und großgesinnten Staats- und Reichsmenschlichkeit. So ist Philosophie gleich an ihrem Anfang unvermeidlich eine Initiation ins Große, Größere, Größte; sie präsentierte sich als Schule der universalen Synthesis; (…) sie lädt ein zum Umzug in den mächtigsten Neubau: in das Haus des Seins; sie will aus ihren Schülern Bewohner einer logischen Akropolis machen; sie weckt in ihnen den Trieb, überall zu Hause zu sein. Für das Ziel dieses Exerzitiums bietet uns die griechische Tradition den Terminus sophrosyne – Besonnenheit – an, die lateinische den Ausdruck humanitas. (…) Es wäre unbedacht, in den Werten der paideia und der humanitas nur unpolitische Charakterideale zu sehen. Dass von dem Weisen alle Menschen als Verwandte erkannt werden – ist diese Doktrin wirklich nur eine humanitaristische Naivität, geboren aus einer übertriebenen Ausweitung des Familienethos? (…) Jeder Aufstieg zu höheren Standorten fordert aber seinen Preis. Wollte sich der Philosoph als Erzieher für einen noch nicht da gewesenen Typus vernunftgeleiteter Menschen empfehlen, so musste er sich das Recht nehmen, neue Maßstäbe für das Erwachsenwerden in der Stadt und im Reich aufzurichten. (…) Als Dozenten des Erwachsenwerdens unter Stadt- und Reichsbedingungen (und im weiteren Verlauf dann unter Kontinental- und schließlich unter Weltbedingungen, S.G.) wurden die philosophischen Erzieher somit zu Hebammen bei der risikoträchtigen Geburt von mächtigeren, in größere Welten versetzten Menschen. Damit in diesen höheren Geburten nicht Monstren ans Licht kämen, war eine Kunst vonnöten, die neue Machtfülle durch eine neue Besonnenheit auszubalancieren.“49 Unnötig zu sagen, dass dieser historische, dieser säkulare Trend zur universalen Durchsetzung der Menschenrechte nicht zugleich eine Nivellierung und Einebnung oder gar gewaltsame Unterdrückung von kulturellen Unterschieden in dieser globalen, von universalen Menschenrechten geordneten Welt nach sich ziehen muss oder auch nur dürfte. Im Gegenteil: Die Menschenrechte umfassen, kodifizieren und regeln allein einige wenige basale Normen, innerhalb von deren Geltung gerade alle mit ihnen verträglichen kulturellen Unterschiede sich erst wirklich frei entfalten können. Genauer muss es heißen: sich frei entfalten können sollen. Denn selbstver49 SLOTERDIJK (2009), a.a.O., 16-20 403 ständlich sind Skepsis und Zweifel über die Realisierbarkeit dieses Projekts angebracht. Seine nachhaltige universelle Realität ist ein extrem unwahrscheinliches Ziel. Aber es ist zugleich extrem realistisch, insofern es in nuce bereits an der Wiege der Geburt der Menschheit gestanden hat und damit in deren Geburtsurkunde verbindlich und unkündbar niedergelegt ist. Wie gesagt: Die pawlikschen Einwände gegen eine universale Geltung der Menschenrechtsidee, hier stellvertretend für verwandte skeptische Einschätzungen erörtert, können durchweg mit belastbaren Gründen ausgeräumt werden. Dies im einzelnen noch weitergehend aufzuzeigen, würde den Rahmen dieser These vollends sprengen. Stattdessen an dieser Stelle nur ein abschließendes Zitat, welches auf die Basis, das tragende Fundament für solche Widerlegungen rekurriert, nämlich auf die Frage der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung. Sie ist, wenn auch nicht erfunden, so doch entdeckt und erstmals explizit und umfassend philosophisch begründet worden von Immanuel Kant, nachdem sie strukturell schon in dem jesuanischen Universalismus der neutestamentlichen Theologie angelegt war: „Kant begreift die Stellung des Menschen in der Welt weder als Kosmopolitie im Sinne der antiken Weisheitslehren noch als Geschöpflichkeit unter Gott im Sinne mittelalterlicher Theologie: Der Kantische Mensch ist von Grund auf Gattungsgenosse und insofern Weltbürger. Die Kantische Welt-Polis freilich ist nicht, wie die antike, das Resultat einer Übertragung städtischer Ordnungsvorstellungen auf das Weltall; sie entspringt vielmehr aus der Anwendung des Freiheits- und Selbstbehauptungsgedankens auf die Gesamtheit vernunftfähiger Wesen, also das Menschengeschlecht in jenem universalen oder globalen Umfang, wie es Europäer nach dem Zeitalter der Entdeckungen und Kolonisierungen zu konzipieren genötigt waren.“50 Mithin bilden die Menschenrechte gleichsam die wichtigsten Zugehörigkeitsdokumente jedes Menschen. Sie sind zugleich eine Art von Geburtsurkunde, Vereinssatzung und Mitgliedsausweis für die von beiden Seiten unkündbare Mitgliedschaft jedes einzelnen Menschen in der Gemeinschaft der menschlichen Gattung. Geburtsurkunde, Vereinssatzung und darauf bezogener Mitgliedsausweis garantieren die formalen Rechte und Ansprüche der Zugehörigkeit, unabhängig von den individuellen Eigenschaften, welche die Mitglieder mitbringen, und unabhängig von den sinngebenden Begründungen, welche sie persönlich oder andere dieser Zugehörigkeit geben mögen. In diesem Sinne also basiert Menschenwürde auf unbestreitbarer Zugehörigkeit zur Menschengattung und auf der hegelschen gegenseitigen Anerkennung – und dies selbst schon im vordemokratischen Stadium als Herr und Knecht, als Angehöriger oder Fremder oder wie auch immer Unterschiedener, aber stets als Mensch. Idealtypisch und zugleich humorvoll ausgemalt ist diese Konstellation in der Stellung der Gestalt des Troubadix in dem berühmten kleinen gallischen Dorf: Im allgemeinen strikt davon ausgeschlossen, das Gemeinschaftsleben mit seinen unerträglichen persönlichen Eigenschaften und Künsten zu überfordern, wird seine Zugehörigkeit und persönliche Integrität dennoch von seiner Gemeinschaft mit Zähnen und Klauen gegen jeden Übergriff verteidigt. (50) Epilog: Die Inauguration eines Weltpräsidenten. Die Welt hat es als starkes Hoffnungszeichen empfunden, dass die Inauguralrede des neuen amerikanischen 50 SLOTERDIJK (2009), a.a.O., 66 404 Präsidenten, ja der gesamte Festakt zu seiner Amtseinführung am 20. Januar 2009 von genau dieser Doppelbotschaft getragen war: Sie stand zuerst unter dem Zeichen der Demut und des Dienens angesichts der in der Krise offensichtlichen Fehlbarkeit von uns Menschen und der begrenzten Macht selbst des mächtigsten Staates der Erde, des Landes der eben nicht unbegrenzten Möglichkeiten. Und sie setzte den Geist seines Wahlkampfslogans „Yes, we can!“, wenn auch hier nicht explizit wiederholt, als zweites Leitwort der Ermutigung dagegen.51 Barack Obama strahlt mit dieser Doppelbotschaft ebenso wie mit seinem persönlichen Habitus genau jene Würde aus, die man in der Regierungszeit seines Amtsvorgängers – ja immer wieder einmal in der amerikanischen Geschichte – so schmerzlich vermisst hatte. Hier sprach ein Weltpräsident, der versprach, die Stärken seines Landes wiederzubeleben, sie aber nicht weiterhin egoistisch und anmaßend zum Hegemonieanspruch über die Welt zu missbrauchen, sondern zur Versöhnung nach innen und außen fruchtbar zu machen: ein „Held des Rückzugs“52, ein Versprechen für die Zukunft, eine jener Führungsgestalten, welche künftig die Weltgesellschaft voraussehbar mehr prägen werden als die „Helden der Attacke“ der Vergangenheit. Um es in einem verzweifelt-optimistischen Refrain aus Wolf Biermanns Kölner „Ausbürgerungs-Konzert“ von 1976 auszudrücken: „Soooo soll es sein, so soll es sein, so wird es sein!“ Damit die Bäume des Optimismus aber auch nicht in den Himmel wachsen und gleich wieder in hybride Erwartungen umschlagen, muss man umgehend die Skepsis seines geistigen Vaters Bertolt Brecht hinterherrufen – das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens aus der „Dreigroschenoper“: „Ja, mach nur einen Plan …“.53 Und der Verlauf des ersten Amtsjahres des neuen Präsidenten erwies sich dann schnell als eine einzige Kette von Ernüchterungen, da die zitierte Botschaft in weiten Teilen der Welt auf Schwerhörigkeit traf. Um aber Biermanns trotzigen Ruf nach einer optimistischen Sicht der Dinge gleichwohl zu bekräftigen, kann es noch mit einem weiteren Künstlerzitat abgerundet werden: Der Komponist Hans Werner Henze, gefragt, woher er seinen Optimismus nehme angesichts der krisenhaften Weltläufe, sagte kürzlich: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zuendegeht mit einer Welt, die so schön ist und so reich an positiven Werten. Die Menschen sind doch ein anbetungswürdiges Geschlecht, voller Stimmungen und Gefühle, von großer Erfindungsgabe, schönheitsbedürftig. Und was sollte einer wie ich sonst auch machen?“54 Gegenüber allem utopischen Fortschrittsoptimismus und gegenüber allem Niedergangspessimismus ist schließlich das Fazit aus Küenzlers gehaltvoller Studie zur Vision des Neuen Menschen festzuhalten: „Es wird aber für den künftigen Weg von Kultur und Gesellschaft wesentlich sein, welche Auffassungen vom Menschen in ihr bestimmend sein werden; ob etwa die Idee einer innerweltlichen Theophanie 51 Vgl. OBAMA, Barack (2009): Eine neue Ära der Verantwortung. Inaugural-Rede 21.1.2009. In: FAZ vom 22.1.2009 52 KLINGST, Martin/ROSS, Jan (2010): Held des Rückzugs. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt – wo steht Barack Obama heute? In: DZ vom 14.1.2010 53 Vgl. dazu die Interpretation von PETERSDORFF, Dirk von (2009): Ja, mach nur einen Plan. In: FAZ vom 3.1.2009 54 HENZE, Hans Werner (2009): Was macht uns so anbetungswürdig? Interview. In: FAZ vom 3.1.2009 405 des Menschen von neuem ihre Faszination ausüben kann, etwa in Form wissenschaftlich-technischer Programme, welche die Möglichkeiten heutiger Gentechnologie für sich reklamieren; oder ob ein Wissen vom Menschen neu kulturprägend sein kann, das von der innerweltlichen Endlichkeit des Menschen weiß, die ihm erst Würde und Wert verleiht. Dieses Wissen hat die Suche nach dem Neuen Menschen immer wieder auch begleitet und ihr Maß und humanen Inhalt gegeben.“55 10. Schlussbemerkung Die gesamte Studie dieses Kapitels bezog ihre Argumentation auf den WürdeAnspruch des einzelnen, des individuellen Menschen. Insoweit folgte sie dem Hauptstrom des gängigen Diskurses zu diesem Thema. Kann man aber darüber hinaus vielleicht nicht nur Menschen, sondern auch einer von ihnen betriebenen Tätigkeit bzw. dem dahinterstehenden Sinnsystem Würde zusprechen? Als der französische Fußball-Nationalspieler Thierry Henry im entscheidenden Relegationsspiel zur Qualifikation für die WM-Endrunde 2010 gegen Irland im November 2009 mit einem absichtlichen, aber vom Schiedsrichter nicht geahndeten Handspiel in der Verlängerung die Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft herbeigeführt hatte, merkte der Theologe und ehemalige Fußball-Profi Peter Steinacker in einem Interview an: „Henry hat die Würde des Fußballs verletzt.“ Spätestens damit war die Frage in den Raum gestellt: Hat eine Sportart eine antastbare Würde? Wenn ja, dann kann man sie durch Aktionen der genannten Art auch tatsächlich verletzen. Und genau einem solchen Denkansatz folgen alle in dem vorliegenden Buch, ja in der gesamten Schriftenreihe zusammengetragenen Studien: Einem kulturellen Sinnfeld wie dem Sport kommt Würde zu. Ihren Gehalt, ihre grundsätzliche Verletzbarkeit sowie ihre tatsächlichen Verletzungen immer genauer zu beschreiben, ist und bleibt eine unabschließbare Aufgabe der Sportwissenschaft. Die kulturelle Sportidee inkorporiert in sich disparate soziale Ideen, vereinigt, transformiert und amalgamiert sie aber zugleich zum sportlichen Eigensinn: Sport kann zugleich als aristokratisch, bürgerlich und proletarisch verstanden werden. Jede der drei Seiten trägt ihm eigene Vorwürfe ein. Er sei in verschwenderischer Weise unnütz; er schließe die nicht Leistungswilligen aus und diskriminiere sie; er sei primitiv körperfixiert. Alle drei Vorwürfe widersprechen sich gegenseitig. Sie können mithin gar nicht gleichzeitig gelten. Das zeigt, dass sie auf Wahrnehmungsbzw. Deutungsfehlern basieren: Der Sportsinn besteht aus allen drei Sinnelementen gemeinsam und synthetisiert sie zu etwas Eigenem. Darin bestärken sich gegenseitig deren positive und neutralisieren deren negative Seiten. Damit begründen sie die Würde des Sports als einem unverzichtbaren Mitträger der Weltkultur. 55 KÜENZLEN (1997), a.a.O., 276 406