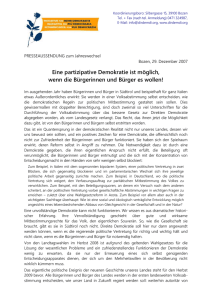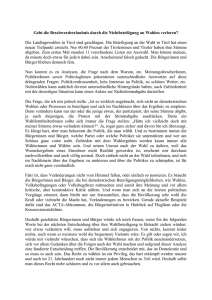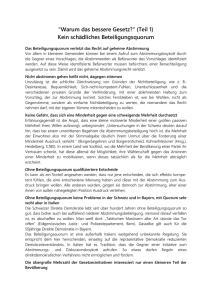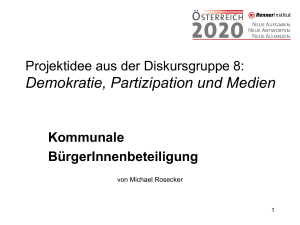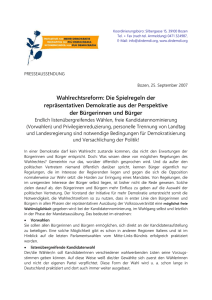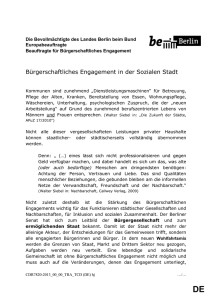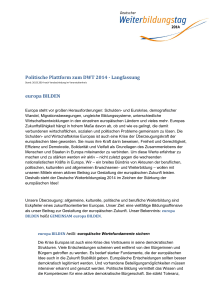Feministische Demokratie - Die Feministische Partei
Werbung

Politische Selbstbestimmung ist das Ziel: Institutionen und Prozesse in einer feministischen Demokratie von Bundessprecherin Dr. Anja Klauk Unsere Demokratie ist von oben gedacht: Entscheidungen werden von Eliten, d.h. von Parteien und Verbänden, vorbereitet und getroffen. Dabei liegt unserer Demokratie die Idee der Repräsentation zugrunde: Das Volk - der eigentliche Souverän - überantwortet qua Grundgesetz gewählten RepräsentantInnen die Entscheidungskompetenz zu politischen Sachfragen. Meine These ist nun: Die Kehrseite der Repräsentation ist die Bevormundung. In immer weniger transparenten Prozessen treffen die gewählten ParlamentarierInnen politische Entscheidungen, während die eigentlichen Diskussionen an der Bevölkerung vorbeilaufen. Öffentliche Meinungsbildung findet fast nur über anonyme Massenmedien oder an wenigen Stammtischen statt und häufig erst dann, wenn "der Zug schon abgefahren" ist. Unterschriftensammlungen, die den politischen Willen jedes einzelnes Bürgers scheinbar dokumentieren, werden nicht selten manipulativ eingesetzt, z.B. durch die hessische CDU zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft im Vorfeld der Landtagswahl 1999. Nicht zuletzt kürzte die Bundesregierung der Bundeszentrale für Politische Bildung die Mittel. Insgesamt läßt sich feststellen, dass sich die BürgerInnen zunehmend aus dem politischen System ausklinken. Vor allem Frauen finden sich in den derzeit gültigen Strukturen nicht wieder. Die hat nicht nur mit der Parteispendenaffäre zu tun, sondern beruht auf einem systematischen Defizit des derzeit gültigen politischen Systems, denn: Das Grundgesetz bevorzugt einseitig Parteien. Den BürgerInnen selbst räumt es keine politische Selbstbestimmung ein, denn es fordert die Entscheidungskompetenz der BürgerInnen in Sachfragen weder aktiv noch verbindlich ein. Was also ist zu tun? Ein längst überfälliges Instrument ist der bundesweite Volksentscheid, für das sich der Verein Mehr Demokratie e.V. seit Jahren einsetzt. Abhängig von seiner konkreten Ausgestaltung könnte der Volksentscheid den geeigneten Rahmen schaffen, innerhalb dessen sich politisches Engagement auch außerhalb von Parteien für jedeN EinzelneN lohnt. Zahlreiche Studien bescheinigen zumindest dem kommunalen BürgerInnenentscheid, dass er zu einem Umdenken in Parteien und der Aktivierung bestimmter Teile der Bevölkerung führen kann. Ob dies auch auf Bundesebene zutreffen wird, bleibt allerdings abzuwarten. In jedem Fall steht fest, daß der bundesweite Volksentscheid den BürgerInnen ein neues Recht auf Mitwirkung einräumt. Wie Untersuchungen auf kommunaler Ebene zeigen, beteiligen sich überproportional akademisch Gebildete, Betroffene, sog. Sozialaktive und - Männer. Wie sich mir in verschiedenen Diskussionen mitteilte, verlangt ein solches Verfahren denen, die den Prozeß vorantreiben wollen, einen Hürdenlauf und ein Höchstmaß an persönlichen Qualifikationen ab: ständige Informiertheit, lokale Bekanntheit, Mut, ausgezeichnete Sachkenntnis der kommunalen politischen Lager und EntscheidungsträgerInnen, Ausdauer, Zeit, Geld und Verantwortungsbereitschaft über den eigenen Tellerrand hinaus. Dies alles sind Qualifikationen einer Elite, die zu jeder Zeit und unabhängig von der jeweiligen politischen Kultur existiert hat. Mit einer politischen Kultur, die auf grundsätzliche politische Partizipation jedes Bürgers und jeder Bürgerin angelegt ist, hat dies jedoch erst einmal wenig zu tun. These: Eine aktive Kultur der Beteiligung und der Auseinandersetzung braucht fördernde Strukturen und Institutionen. Diese müssen stets und zuallererst beim direkten sozialen Umfeld der BürgerInnen ansetzen. Der Grund ist, dass die politische Meinungsbildung in erster Linie vom direkten sozialen Umfeld geprägt wird, denn mit den Menschen, mit denen wir in direktem persönlichen Kontakt stehen, werden am ehesten Argumente und Meinungen ausgetauscht. Damit jedes Thema und jegliche politische Fragestellung besprochen werden kann, müssen die BürgerInnen sie jedoch in ihre eigene Lebenswelt einordnen können. Dies bedarf nicht nur der Öffentlichkeitsarbeit durch Parteien, sondern zusätzlicher Institutionen. Soziales Umfeld für die politische Diskussion schaffen Um zu zeigen, wie diese Institutionen beschaffen sein müssen, werfen wir zunächst einen Blick auf das direkte soziale Umfeld, in dem die politische Meinungsbildung hauptsächlich stattfindet: Familie, FreundInnen, Nachbarn, Bekannte, ArbeitskollegInnen, VereinskameradInnen, in seltenen Fällen Mitglieder einer politischen Partei. Was ist nun das Kennzeichen dieser sozialen Bezugsgruppen? Sie sind meistens von überschaubarer Größe und frei von organisationsspezifischen Machtinteressen, wie sie typisch für Verbände und Parteien sind. Sie sind netzartig strukturiert und setzen auf persönliche Kommunikation mit dem Gegenüber, auf Beziehung und auf Konsens, um die soziale Integration ihrer jeweiligen Mitglieder zu gewährleisten. Ihre Gesprächsthemen orientieren sich in der Regel an lebensweltlichen Kontexten. Eine zentrale feministische Forderung ist nun, dass sich nicht nur die private Kommunikation, sondern politisches Handeln und politische Entscheidungen generell an lebensweltlichen Erfahrungen und Kontexten orientieren sollen, und nicht nur an davon abgehobenen, abstrakten Prinzipien bzw. organisationsspezifischen Machtinteressen. Dies bedeutet umgekehrt: Demokratische Meinungsbildungsprozesse müssen so thematisiert und gestaltet werden, dass BürgerInnen jegliche politische Fragestellung in ihre eigene Lebenswelt einordnen und vor ihren eigenen Erfahrungen mit der Umwelt gewichten können. Was bedeuten diese Forderungen nun? Sie bedeuten, dass politische Institutionen geschaffen werden müssen, die sich die Mechanismen, die im privaten, sozialen Umfeld greifen, zunutze machen. Sie legen nahe, dass politische Meinungsbildungsprozesse inszeniert werden müssen, die auf das persönliche Gespräch zwischen gleich-berechtigten Menschen setzen. Kontextorientierung als demokratisches Grundprinzip Überlegungen und Erkenntnisse aus dem feministischen Umfeld können nun eine Antwort darauf geben, wie diese Meinungsbildungsprozesse ausgestaltet werden müssen: - die Reduktion auf ein definiertes Thema, zum Beispiel im Rahmen eines direktdemokratischen Entscheidungsverfahrens. Diese Begrenzung macht es möglich, sich auf ein Thema zu konzentrieren und gewährleistet Überschaubarkeit: Diese ist nötig, um sich mit dem Thema in Beziehung zu setzen und Argumente vor dem eigenen Erfahrungshintergrund abzuwägen. - Rahmenbedingungen zur authentischen und unabhängigen Artikulation eigener Interessen. Authentisch heißt: von der eigenen Person ausgehend, und nicht an den (unterstellten) Interessen der Umgebung orientiert, zu der eine Abhängigkeit besteht. Diese Forderung ergibt sich aus den Erfahrungen von Institutionen der feministischen Mädchenarbeit und der Frauenpartizipation, die erleben, dass gerade Frauen und Mädchen die authentische Artikulation erst spät erlernen. Daher liegt es nahe, geschlechtsspezifische Gruppen zu bilden, in denen Dritte weder bevormunden noch besondere Vorteile genießen dürfen. Diese Argumentation läßt sich leicht auf andere marginalisierte gesellschaftliche Gruppen übertragen. - vielfältige und ausführliche Diskussionsprozesse unter möglichst vielen Blickwinkeln. Ständiger und freier Zugang zu Informationen sowie ein Höchstmaß an Transparenz auf jeder Stufe der Auseinandersetzung bilden hier unverzichtbare Grundvoraussetzungen. Die seit kurzem praktizierte Veröffentlichung von Gesetzesvorschlägen von Seiten des Deutschen Bundestags im Internet bildet dann nur einen winzigen Baustein. Wie wichtig Transparenz gerade für diejenigen ist, die sonst nicht Ernst genommen werden und kein Gehör finden, läßt sich an zahlreichen Fallbeispielen belegen, z.B. auch an unserer Partei. - die Diskussion in kleinen und hierarchiefreien Gruppen aus LaiInnen, Betroffenen, ExpertInnen und BürgerInnen, z.B. nach dem Modell der Planungszelle von Peter Dienel, als kleinste und überschaubare Einheiten politischer Gemeinschaft. Sie ermöglichen im Idealfall die ergebnisoffene kontroverse Diskussionen ohne organisationsspezifische Eigeninteressen, außerdem die gleichwertige Integration. Aufgrund von Face-to-face-Kommunikation ermöglichen sie persönliche Sichtwechsel und machen den/die andere/n in seiner/ihrer Argumentation erfahrbar - ein Beziehungsaspekt, auf den viele Frauen besonderen Wert legen. Zahlreiche Fallbeispiele belegen zudem eine hohe Zufriedenheit der Beteiligten, ihre starke Identifikation mit dem verhandelten Thema (Beziehungsaspekt!) - und ihre Bereitschaft, sich grundsätzlich mehr politisch zu engagieren. Partizipationsinstrumente dieser Art können die politische Aktivierung der BürgerInnen bewirken und die Bildung von Konsens und Gemeinwohlorientierung fördern - eine Leistung, die unser einseitig auf Parteien fixiertes System immer weniger erbringt. Face-to-face-Kommunikation ermöglicht das persönliche Sich-Einlassen, Identifikation und nicht zuletzt die Integration ihrer Mitglieder - eine Leistung, die eine anonyme Medien-berichterstattung kaum erbringt. - das aktive Inszenieren von Meinungsbildungsprozessen sowie das Einfordern der Entscheidungskompetenz der BürgerInnen. Denn aller Erfahrung nach glauben diejenigen, die vorher nicht beteiligt wurden, nicht so recht daran, dass nun alles anders wird; im schlimmsten Falle gehen sie erst gar nicht hin. Daher sind aus meiner Sicht besondere Institutionen zu fordern, z.B. kommunale Beteiligungsbeauftragte, die je nach der Größe der Kommune mit eigenem Budget und Personal ausgestattet sind. Ihre Aufgabe wäre es, im Vorfeld eines Volks- oder BürgerInnenentscheids eine Mindestanzahl an Diskussionsveranstaltungen bzw. Planungszellen zu organisieren. Die Diskussionsforen müssen wenigstens teilweise geschlechtsspezifisch angeboten werden. Sie sollten die Entscheidungs-kompetenz der BürgerInnen aktiv einfordern, zum Beispiel in Form eines Gutachtens bzw. einer Stellungnahme, das/die die TeilnehmerInnen im Konsens formulieren. Das Gutachten könnte den Vertrauensleuten eines BürgerInnenentscheids zugehen und zusammen mit anderen ausgewertet werden. Wie wichtig das Zugehen auf eine sonst benachteiligte Zielgruppe ist, belegen Institutionen, die sich mit Jugendpartizipation beschäftigen: Jugendliche, vor allem Mädchen, fühlen sich erst dann einbezogen, wenn SozialarbeiterInnen o.ä. zu ihnen hingehen, anstatt sie nur kommen zu lassen ("Geh-Struktur"). - Kontrolle: Gerade, wenn Partizipationsinstrumente für die Beteiligten glaubwürdig sein sollen, müssen sie idealerweise zu jedem Zeitpunkt Mitwirkungsmöglichkeiten am Meinungsbildungsprozess erlauben sowie die Aufklärung über den Stand der Dinge gewährleisten. Vor dem Hintergrund der Parteienkrise ist klar, dass die Sensibilität und das Misstrauen der BürgerInnen gegenüber mehr Demokratie versprechenden Instrumenten sehr hoch sein wird. Dafür sprechen auch die Erfahrungen der Mitfrauen der Feministischen Partei DIE FRAUEN, die hohe Forderungen an die innerparteiliche Demokratie stellen: Zahlreiche Satzungsänderungsanträge zeigen, wie sehr kleine und kleinste Machtungleichgewichte registriert werden. - die Neudefinition der politischen Rolle von Parteien, vielleicht als Moderatoren politischer Prozesse. In einer Beteiligungsdemokratie, in der die BürgerInnen das direktdemokratische Recht auf politische Selbstbestimmung nutzen, kommt ihnen wahrscheinlich eine bedeutende Rolle in der Vermittlung politischer Inhalte zu - eine Rolle, die bisher meistens nur vor Wahlen wahrgenommen wird. - die Politisierung öffentlicher Räume: Diese Forderung macht nicht nur eine geeignete Stadtplanung nötig, sondern die feste Quotierung der Medien mit Sendungen, die sich ausschließlich der Auseinandersetzung im Vorfeld eines Volks- bzw. BürgerInnenentscheids widmen. Insgesamt kann eine Neuausrichtung der Demokratie an den feministischen Prinzipien Integration, Prozeß und Beziehung langfristig dazu führen, dass die unglückselige Polarisierung zwischen Individuum und Gemeinschaft bzw. Gemeinwohl überflüssig wird. Konsens wird im Face-to-FaceDiskurs von politisch selbstbestimmenden Menschen erzeugt. Die direkte Demokratie als BürgerInnenrecht im Grundgesetz zu verankern, bildet dabei meiner Meinung nach eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Die Feministische Partei DIE FRAUEN setzt auf die politische Selbstbestimmung kritischer und konfliktfähiger BürgerInnen. Wir glauben, dass eine tragfähige Gesellschaft an einer entsprechenden demokratischen Entwicklung nicht vorbeikommt. In der Wirtschaft und bei der privaten Altersvorsorge wird bereits auf den selbstverantwortlichen Menschen gesetzt. Warum sollte unsere Demokratie dann nicht auch auf den politisch selbstbestimmten Menschen setzen?