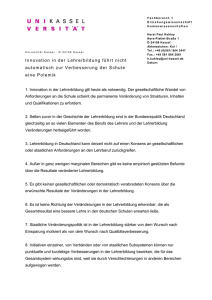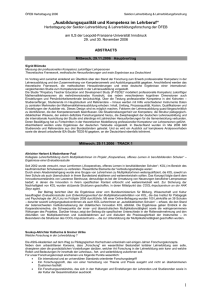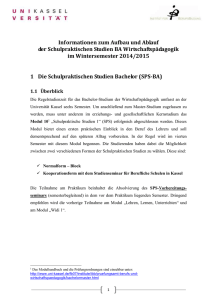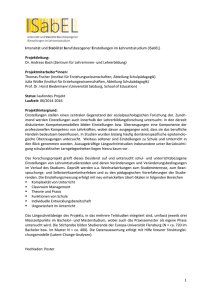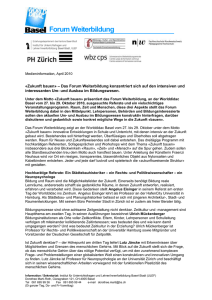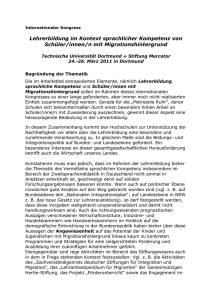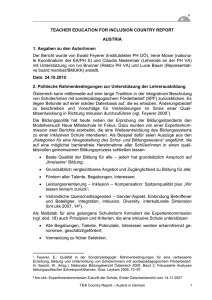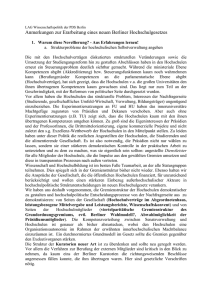Schaffhausen LAB - Institut für Erziehungswissenschaft
Werbung
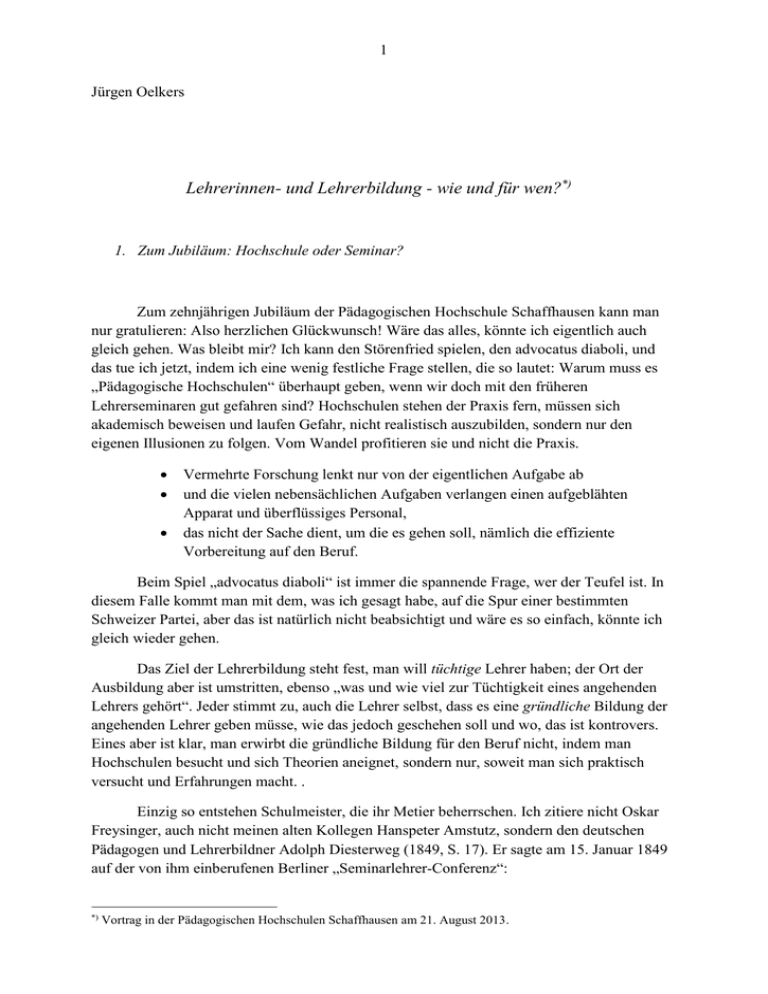
1 Jürgen Oelkers Lehrerinnen- und Lehrerbildung - wie und für wen?*) 1. Zum Jubiläum: Hochschule oder Seminar? Zum zehnjährigen Jubiläum der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen kann man nur gratulieren: Also herzlichen Glückwunsch! Wäre das alles, könnte ich eigentlich auch gleich gehen. Was bleibt mir? Ich kann den Störenfried spielen, den advocatus diaboli, und das tue ich jetzt, indem ich eine wenig festliche Frage stellen, die so lautet: Warum muss es „Pädagogische Hochschulen“ überhaupt geben, wenn wir doch mit den früheren Lehrerseminaren gut gefahren sind? Hochschulen stehen der Praxis fern, müssen sich akademisch beweisen und laufen Gefahr, nicht realistisch auszubilden, sondern nur den eigenen Illusionen zu folgen. Vom Wandel profitieren sie und nicht die Praxis. Vermehrte Forschung lenkt nur von der eigentlichen Aufgabe ab und die vielen nebensächlichen Aufgaben verlangen einen aufgeblähten Apparat und überflüssiges Personal, das nicht der Sache dient, um die es gehen soll, nämlich die effiziente Vorbereitung auf den Beruf. Beim Spiel „advocatus diaboli“ ist immer die spannende Frage, wer der Teufel ist. In diesem Falle kommt man mit dem, was ich gesagt habe, auf die Spur einer bestimmten Schweizer Partei, aber das ist natürlich nicht beabsichtigt und wäre es so einfach, könnte ich gleich wieder gehen. Das Ziel der Lehrerbildung steht fest, man will tüchtige Lehrer haben; der Ort der Ausbildung aber ist umstritten, ebenso „was und wie viel zur Tüchtigkeit eines angehenden Lehrers gehört“. Jeder stimmt zu, auch die Lehrer selbst, dass es eine gründliche Bildung der angehenden Lehrer geben müsse, wie das jedoch geschehen soll und wo, das ist kontrovers. Eines aber ist klar, man erwirbt die gründliche Bildung für den Beruf nicht, indem man Hochschulen besucht und sich Theorien aneignet, sondern nur, soweit man sich praktisch versucht und Erfahrungen macht. . Einzig so entstehen Schulmeister, die ihr Metier beherrschen. Ich zitiere nicht Oskar Freysinger, auch nicht meinen alten Kollegen Hanspeter Amstutz, sondern den deutschen Pädagogen und Lehrerbildner Adolph Diesterweg (1849, S. 17). Er sagte am 15. Januar 1849 auf der von ihm einberufenen Berliner „Seminarlehrer-Conferenz“: *) Vortrag in der Pädagogischen Hochschulen Schaffhausen am 21. August 2013. 2 „Der Unterschied zwischen ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘ muss in den Seminaren ganz schwinden. Er ist nichtig in sich, er ist noch ein Stück von dem Gelehrtenzopfe, welcher allen Lehrern von den Universitäten angebunden wurde. Von theoretischer u n d praktischer Lehrerbildung muss gar nicht mehr gesprochen werden. Aller Unterricht, alle Anweisung soll p r a k t i s c h sein“ (ebd., S. 18). Rein theoretisch gebildete „gelehrte Männer“ haben in der Ausbildung nichts zu suchen, an den Seminaren sollten keine anderen „als durchweg praktische Lehrer“ angestellt werden. „Ein unpraktischer Lehrer hat keine Vorstellung von dem, was praktische Lehrer praktisch nennen“ (ebd.). Und man kann nicht erst die Theorie lernen und sie dann praktisch anwenden. Alle Jahre der Ausbildung müssen praktisch sein, „nicht bloss die unmittelbare Anleitung der Seminaristen zum Lehrgeschäft, sondern aller Unterricht, den sie empfangen“ (ebd.). „Keine Universität leistet das; auf der Universität wird keiner zum praktischen, d.h. zum eigentlichen Lehrer, zu dem, was er leisten soll, gebildet. Beweis: die Gymnasiallehrer“ (ebd., S. 22). Man sieht, wie nah die Glaubenssätze des Diskurses uns immer noch nah sind. Aber Diesterweg geht noch einen Schritt weiter und prognostiziert die Entwertung alles dessen, was an Hochschulen gelernt wird. „Wurde ein nur durch Universitätsstudien gebildeter Literat ein wirklicher Lehrer, er wurde es t r o t z der Universitätslehrer, denn der Lehrer muss als praktischer Lehrer alles umkehren und anders machen, als er es auf der Universität erlebt hat“ (ebd.). Das kann man auch so sagen: Vergessen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben, die Praxis ist anders als die Theorie und kein Studium kann das ändern. Die Lösung des Problems sieht Diesterweg in der Rekrutierung von geeignetem Personal. Das Lehrerseminar „bedarf der lebenserfahrenen, schul- und erziehungsgewandten, praktischdurchgebildeten, dem Volke mit wahrer, nicht anexercirter, sondern tief empfundener Liebe beigethaner Lehrer, ich weiss es mit einem Worte nicht anders zu sagen, der P e s t a l o z z i s c h e n Lehrer“ (ebd., S. 26). Aber als „praxisfern“ und „theorielastig“ sind gerade die Lehrerseminare immer wieder kritisiert worden, Diesterwegs idealen Seminarlehrer hat es nie gegeben und das Strukturproblem, die Vermittlung brauchbaren Wissen für tüchtige Lehrer, ist nie gelöst worden, schon weil der Ernstfall der Ausbildung immer nachfolgt. Es gibt also immer einen Entwertungseffekt, die Kunst ist, ihn so klein wie möglich zu halten. Und schliesslich: wenn Pestalozzi etwas nicht konnte, dann war es professionell zu unterrichten. Er beherrschte seine eigene Methode nicht. Offenbar ist die Grundfrage von „Theorie und Praxis“ der Ausbildung schwieriger zu beantworten als mit dem Hinweis auf grosse Pädagogen und Lehren bei Meistern, die am Ende gar keine sind. Theorie und Praxis sind nicht einfach zwei Seiten, die einander gegenüberstehen und nun irgendwie verbunden werden müssen. Deswegen gibt es auch keine einfache Lösung, wie dies politisch immer behauptet wird. Mein zweiter Punkt ist, dass die 3 Lehrerbildungssysteme auf Kritik reagieren, aber auf eigene Art und Weise. Keine Partei kann das ändern. 2. Lehrerinnen- und Lehrerbildung: Reaktionen auf Kritik Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz ist deutlicher Kritik ausgesetzt, die sich zum Teil mit der Nostalgie der alten seminaristischen Ausbildung erklären lässt, die erst vor knapp einem Jahrzehnt abgeschafft worden ist. Rein als Nostalgie braucht diese Kritik nicht ernst genommen zu werden braucht. Die Lehrerseminare standen vor keinen anderen Problemen und hatten auch nicht aufgrund ihrer Geschichte die besseren Lösungen für sich. Die Ausbildung von Lehrpersonen muss immer das eigentlich Unmögliche schaffen, nämlich auf einen Anwendungsfall vorbereiten, der nicht absehbar ist. Nostalgie verstellt da nur den Blick. Seit Mitte der neunziger Jahre wurden in der Schweiz Pädagogische Hochschulen gegründet, die die alten Seminare ablösten, eine Form, die in Deutschland bereits seit Jahrzehnten verschwunden war. Es gab eigentlich keinen inhaltlichen Grund, die Seminare aufzuheben, der Anlass war ein OECD-Gutachten, in dem darauf verwiesen wurde, dass seminaristische Ausbildungen mit dem europäischen Standard einer Ausbildung auf Tertiärstufe nicht kompatibel seien. Schweizerische Lehrdiplome hätten so keine europäische Anerkennung gefunden. Der Aufbau von inzwischen fünfzehn Pädagogischen Hochschulen erfolgte an den Standorten, an denen die Lehrerinnen- und Lehrerseminare historisch gewachsen waren. Die Ausnahme ist der Kanton Bern, wo erstmalig eine zentrale Lehrerinnen- und Lehreraubildung in der Stadt Bern eingerichtet wurde. Vorher gab es kleine regionale Seminare in Thun, Spiez oder Langenthal, die lange verteidigt wurden, weil sie Teil der Standortpolitik waren. In Zürich wurde aus acht verschiedenen Seminaren des Kantons eine Pädagogische Hochschule gegründet, die die grösste des Landes ist. Aber wäre das der Grund, mich im Folgenden auf sie zu beziehen, würde ich den Zorn meines Publikums provozieren. Ich wohne im Thurgau und kenne die Reflexe. Die Pädagogische Hochschule Zürich habe ich mit aufgebaut, ich kenne sie am besten und weiss also, wovon ich rede. So viel Legitimation muss sein. Die ersten Absolventinnen und Absolventen verliessen die Hochschule im Jahre 2004, so dass inzwischen eine Leistungsbilanz möglich ist. Hauptkritikpunkt der abnehmenden Schulen in Zürich ist die beschränkte Einsatzfähigkeit der neu ausgebildeten Lehrkräfte, die auf der Primarstufe nicht mehr in allen Fächern der Volksschule ausgebildet werden. Dieses Problem ist immer noch virulent, aber durch den Lehrermangel und so durch die Kompromissbereitschaft der einstellenden Schulen reduziert worden. In der Öffentlichkeit vordringlich ist das „Theorie-Praxis-Problem“, also der Nutzen der Ausbildung für den Beruf. 4 Erfahrene Berufspersonen beklagen, politisch durchaus wirksam, die Theorielastigkeit der Ausbildung, obwohl die Studierenden mehr Praxisanteile haben als in der alten seminaristischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Aus dieser Diskussion sind zwei Massnahmen hervorgegangen. Zum einen werden in Zukunft alle Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule Zürich befragt, wie sie nach zwei Jahren praktischer Erfahrung in den Schulen die Vorbereitung durch die Ausbildung einschätzen. Hier geht es darum, das „Theorie-Praxis-Problem“ - bekanntlich ein Dauerverdacht in der Geschichte der Lehrerinnen- und Lehrerbildung - aus der Zone des Polemischen herauszunehmen und mit Daten zu diskutieren. Vorbild sind die Gymnasien des Kantons Zürich, deren Absolventinnen und Absolventen seit längerem befragt werden, ob sie auf das Studium ausreichend vorbereitet waren. Die mittlerweile durchgeführten fünf Befragungen ergeben eine hohe Zufriedenheit mit der Schulbildung, und die spannende Frage ist, ob dasselbe mit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung auch der Fall sein wird. Diese regelmässige Befragung wäre ein Kern der Leistungsüberprüfung, die die alte seminaristische Ausbildung nicht kannte. Man war überzeugt, die Wirkungen zu kennen, also genau zu wissen, wie tüchtige Lehrpersonen ausgebildet werden müssen. Es waren selige Zeiten, „Output“ war ein unbekanntes Wort. Die zweite Massnahme der Pädagogischen Hochschule Zürich dient der Verbesserung des Praxisbezuges, der tatsächlich eine Schwachstelle aller bisherigen Ausbildungskonzepte gewesen ist. Bislang wurden traditionell Praktika angeboten, die wohl vor- und nachbereitet worden sind, ansonsten aber nicht viel mit der übrigen Ausbildung zu tun hatten. Nunmehr hat die Hochschule ein Konzept entwickelt, das über die gesamte Dauer der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerausbildung reicht. Während der sechs Semester werden die Studierenden von Praxislehrkräften begleitet, die die Hochschule selbst ausgebildet hat. Sie arbeiten mit Dozierenden zusammen und sind auf die gleiche Literatur verpflichtet. Die Studierenden bekommen bereits im ersten Semester Praxiskontakt und machen neu ein dreimonatiges Praktikum, das wie ein Ernstfall organisiert ist. Sie können dabei auf die Praxislehrkräfte als Mentoren zurückgreifen und erleben an den Seminaren der Hochschule, wie sich ihre Erfahrungen in der Praxis einbringen lassen. Die relevante wissenschaftliche Literatur steht zur Verfügung, so dass sie ihre Erfahrungen auch objektivieren können. Wichtig an diesem Konzept ist, dass die Studierenden tatsächlich über die gesamte Ausbildungsdauer Ansprechpersonen für das haben, was sie in der Praxis erleben und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Man nennt das in der neueren Literatur „learning from the field“, also nicht „Praxisbezug“ der Theorie, sondern Problemsicht aus dem Erfahrungsfeld. Mit einer solchen Wendung hätte Adolph Diesterweg nie gerechnet, der den Hochschulen und Universitäten nicht zutraute, für kardinale Probleme intelligente neue Lösungen zu finden. Er dachte idealtypisch und brauchte ein Prinzip für alle Fälle, aber genau damit kommt man in einer Berufsausbildung nicht weiter. „Praxisbezug“ kann nicht heissen, Ideale verordnen zu 5 können, sondern Probleme zu erkennen, nach Lösungen zu suchen und Grenzen des eigenen Handlungsraumes zu akzeptieren. Es gibt in jedem Prozess des Wandels immer auch Erfahrungen des Scheiterns, der Unterbrechung oder der Verlagerung von Reformstrategien. Das sind Erfahrungen der Grenzziehung, die am Anfang nicht erwartet werden; Reformen müssen die möglichen Schwierigkeiten kalkulieren, sie dürfen jedoch nicht mit dem eigenen Scheitern rechnen. Aber keine Reform muss gelingen, und jeder Prozess kann in eine Situation geraten, in der der Abbruch droht, etwa weil der Widerstand an der Basis zu gross geworden ist. Dann hilft kein Rückgriff auf „bewährte Konzepte“, welcher Pädagogik auch immer. „Bewährt“ sind immer nur praktische Lösungen. Man muss auch sehr genau zwischen Postulaten der Reform und Zielen unterscheiden. Ziele müssen erreichbar sein, Postulate nicht. Diese Idee geht auf John Dewey zurück, der in Democracy and Education vorschlägt, nur dann von „Erziehungszielen“ zu sprechen, wenn eine Chance der Erreichbarkeit gegeben ist. Das begrenzt die Höhe der Ziele und den Zeitraum, in dem sie verfolgt werden können. Normalerweise werden Erziehungsziele ohne zeitliche Befristung kommuniziert, was sie sehr abstrakt und praxisfern erscheinen lässt. Sie haben dann nur rhetorischen Nutzen. Von „Verantwortung“ für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung kann dann gesprochen werden, wenn nicht nur die Zuständigkeit geklärt ist, sondern auch der Ausbildungserfolg überprüft wird. Das ist durch regelmässige Evaluationen möglich, deren Resultate Konsequenzen haben. Ungeeignete Module müssen ersetzt werden können, was „ungeeignet“ ist und was nicht, muss sich am Ausbildungserfolg bemessen lassen. Daraus würde folgen, nicht nur dass alle Lehrveranstaltungen durch die Studierenden evaluiert werden, sondern auch, dass Transferdaten erhoben werden, also Daten, die erfassen, was bei den Abnehmern ankommt und so tatsächlich Verwendung findet. Erste Erfahrungen mit Abnehmerrückmeldungen liegen vor, sie machen deutlich, dass hier ein mühsamer Kulturwandel abverlangt wird. Studien, die zeigen, wie Studierende tatsächlich lernen, belehren auch darüber, dass die Sprache der Ausbildung im Blick auf die Wirkungen nicht sehr verlässlich ist. Der „reflektierte Praktiker“ ist nur ein Schlagwort, ebenso die „ko-konstruktive Lernumgebung“ oder die „effiziente Ressourcennutzung“, solange sich damit keine konkreten Erfahrungen verbinden. John Goodlads Bahn brechender Studie Teachers of our Nation’s School, die 1990 erschienen ist, war der Durchbruch der internationalen Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Goodlad befragte vor allem die Studierenden und ermittelte ihre Erwartungen. Daraus entstand die so genannte „what works“- Hypothese, die besagt besagt, 6 dass angehende Lehrkräfte das Ausbildungsangebot danach sortieren und bewerten, was ihnen am meisten für den späteren Unterricht verspricht und was persönlich am besten verwendbar erscheint. Daher sind in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Methodenkurse weit mehr gefragt als Vorlesungen, und Praktika erhalten ein höheres Gewicht als das Studium der wissenschaftlichen Literatur. Diese These wird in verschiedenen Studien zum Lernverhalten der Studierenden etwa an Schweizer Pädagogischen Hochschulen bestätigt, auch hier ist die Erwartungshaltung „what works“ (Ruffo 2009). Goodlad hat auch beschrieben, dass das Interesse der Mehrzahl der Studierenden in den Ausbildungsprogrammen für angehende Lehrpersonen nicht primär intellektueller Natur ist. Sie erleben den Übergang von der Ausbildung in den Beruf als Wechsel der Beschäftigung. „That is, they shifted from being students in a college or university to teachers in a school, rather than from students of the contents of their own curriculum to inquirers into teaching, learning, and enculturation“ (Goodlad 1990, S. 214). Und die Überzeugung, was es bedeutet, Lehrer zu sein, erwächst aus der Erfahrung „‘what works‘ with a classroom of children of youths“. „Being ‚able to do it‘ - as, for example, one’s mentor in student teaching did it became more important to these students than questions of why a certain way was successful or an exploration of alternative possibilities” (ebd.). Auch Schweizer Studien legen nahe, dass die „Mentoren“ oder die Praxislehrkäfte die Gruppe darstellen, die den vermutlich grössten Einfluss auf die angehenden Lehrpersonen haben. Ein qualitatives Forschungsprojekt der Universität Zürich zeigt nicht nur den Einfluss der Ausbildungsschulen auf den Aufbau der Kompetenz von Berufsanfängern, sondern auch die mentale und habituelle Prägung durch die Praxislehrkräfte (Stadelmann 2006). Sie zeigen Anfängern „what works,” also sind entscheidende Anlaufstellen für den Anfang der professionellen Kompetenz, von dem die weitere berufliche Entwicklung offenbar wesentlich abhängt. Wirksam sind nicht einfach gute Modelle des Unterrichts, sondern unmittelbare Anleitungen und Rückmeldungen aus direkter Nähe zum Ernstfall. Der Ausdruck „Coaching” ist nicht zufällig der Trainersprache entnommen. Ein Coach spiegelt einen Versuch direkt zum Anforderungsniveau, so jedoch, dass die Rückmeldung als hilfreich für die Entwicklung des Gecoachten wahrgenommen wird. In den Vereinigten Staaten ist bis heute von „Teacher Training“ die Rede, der Ausdruck soll darauf hinweisen, dass professionelle Kompetenz in verlässlichen Übungssituationen aufgebaut wird und nicht einfach die Folge einer wie immer angestrengten Reflexion ist (Shulman 1995). Praxislehrkräfte sind umso mehr zur Kooperation mit der Hochschule bereit, je besser sie auf ihre Aufgaben vorbereitet werden und je überzeugender die Ausbildungsinstitution den Kontakt mit ihnen gestaltet. In der Zürcher Studie gibt es idealtypisch zwei Kategorien von Praxislehrkräften, eine, die empfiehlt, das bisher Gelernte zu vergessen, weil der eigene Unterricht das beste Modell für den Aufbau beruflicher Kompetenz sei, und eine andere, die 7 durch eigene Ausbildung gelernt hat, die Ressourcen der Lehrerbildung zu nutzen und die mit der Pädagogischen Hochschule gemeinsame Standards vertritt. Nur so arbeitet man nicht gegeneinander. Die Studierenden stellen an die Praktika oder die Ausbildungsschulen besonders hohe Erwartungen. Die Zürcher Studie zeigt auch, dass dies nur dann ohne Verlust für die übrige Ausbildung vonstattengeht, wenn die theoretischen und die praktischen Teile der Ausbildung aufeinander abgestimmt sind und in ihnen nicht zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ansonsten ist es angesichts der Erfahrungen, die sie machen, für die Studierenden sehr glaubwürdig, wenn gesagt wird: „Vergessen Sie, was Sie bisher gelernt haben.” Die anschliessende Situation hat dann mit der vorhergehenden wenig zu tun, der Transfer des Gelernten ist schwach, auch weil Wissenstransfer gar kein Thema ist. Transfer in Ausbildungsgängen geschieht nicht von selbst, sondern verlangt Steuerung, also Beobachtung, Nachfrage und Überprüfung sowie auf Seiten der Studierenden das Gefühl, auch tatsächlich voranzukommen (Oser/Oelkers 2001). Es gibt noch eine Bedingung. Im Mittelpunkt der Arbeit der Lehrkräfte stehen die unterrichtsbezogenen Tätigkeiten. Alles, was den Aufwand steigert, ohne den Ertrag zu verbessern, wird in dieser Praxis keine Verwendung finden. Wenn die Ausbildung sozusagen punktgenau verfahren soll, muss sie lernen, sich auf diese Verhältnisse einzustellen. Angehende wie amtierende Lehrkräfte sind vielleicht nicht aufgrund ihrer Philosophie, wohl aber aufgrund der Anforderungen ihrer Praxis Utilitaristen. Sie gehen vom Nutzen für ihren Unterricht aus und erwarten eine Ausbildung, die diesem Test standhält. Und das ist mehr als nur Reflexionswissen. Bereits die Erstsemester, zeigt eine deutsche Studie, nehmen das Lehramtsstudium vom Berufsziel und so von der Praxis her wahr (Cramer/Horn/Schweizer 2009). 3. Aufbau des beruflichen Könnens Wir wissen nicht genau, wie Berufsanfänger es schaffen, nicht unterzugehen. Offenbar schaffen sie es aber, darauf deuten Schweizer Untersuchungen des Weges von der Ausbildung in die Praxis hin (Larcher Klee 2005). Der Weg ist gesteuert durch eigene Navigation, die von der Ausbildung so gut es geht vorbereitet und unterstützt werden muss. Sie muss die passenden Erfahrungen und Wissensformen zur Verfügung stellen, was aber offenbar nicht so ganz leicht ist. Ausbildung ist in gewisser Hinsicht immer Idealisierung, sie zeigt nur an bestimmten Stellen, what works und auch an diesen Stellen kann nicht genau antizipiert werden, was nach der Ausbildung den Alltag ausmacht. Es gibt nicht das, was man „Eins-zuEins-Übertragung“ nennt (Schmid 2006). Der Praxisbezug von Lehrveranstaltungen ist immer eine Generalisierung, die für die Umsetzung persönliche Navigation verlangt. Die Kompetenz von Lehrkräften ist keine abstrakte Grösse, und sie entsteht nicht einfach in der Übernahme von Theorien. Wer etwas über „professionelle Kompetenz“ wissen will, muss sich in das Berufsfeld begeben und beobachten, wie sich die Persönlichkeit der 8 Lehrkräfte in der Auseinandersetzung mit den Aufgaben formt. Man kann daher nicht einfach vom Studium auf die nachfolgende Praxis schliessen, das ist nur die Logik der Studienordnung. Die Ausbildung wirkt immer selektiv, also nie als Ganzes, sondern immer nur in den Teilen, die die Studierenden als relevant erleben (Ruffo 2009). Das bestätigt sich in einer Studie aus Zürich, die gerade abgeschlossen worden ist. Um die Studie zu erklären, muss ich etwas weiter ausholen. Die so genannte „Tertialisierung“ der Lehrerinnen- und Lehrerbildung war vor der Gründung der Pädagogischen Hochschulen politisch umstritten, weil - mit dem klassischen diesterwegschen Argument - befürchtet wurde, dass die Praxisnähe der seminaristischen Ausbildung verloren geht. „Akademisierung“ war in dieser Diskussion eine negative Zuschreibung, die nicht nur von Traditionalisten der alten Ausbildung gewählt wurde. Zehn Jahre später wurde der Verdacht erneuert, dass die Ausbildung der künftigen Lehrpersonen nicht praxisnah genug erfolge und von „Theoretikern“ beherrscht werde. Wortführer der Kritik waren nicht zuletzt ältere Lehrpersonen, die darüber Klage führten, dass Berufsanfänger nicht ausreichend auf das Arbeitsfeld vorbereitet wurden. In dieser Situation beschloss der Zürcher Bildungsrat am 21. Juni 2011, dass die Absolventen der Pädagogischen Hochschule Zürich zwei Jahre nach Abschluss über die Effekte der Ausbildung befragt werden. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist eine solche Absolventenbefragung zum ersten Male durchgeführt worden. Der für die Schulen verantwortliche Bildungsrat wollte auf diese Weise Aufschluss gewinnen, ob die Ausbildung tatsächlich so defizitär ist, wie die Kritiker unterstellen. Befragt wurden Lehrpersonen im Beruf, die nach der Ausbildung auch die zweijährige Berufseingangsphase absolviert haben. Andere im Beruf tätigen Gruppen, wie etwa die Schulleiterinnen und Schulleiter oder die im Kollegium tätigen anderen Personen sind nicht befragt worden. Die Untersuchung betraf noch nicht das neue Studienkonzept, befragt wurden die Absolvent der alten, von aussen häufig kritisierten Ausbildung. Die Ergebnisse geben den Kritikern nicht Recht und erschüttern die traditionellen Sicherheiten im Lager der heutigen Diesterwegs (zum Folgenden: Nido/Trachsler/Swoboda 2012). Die befragten Berufsanfänger geben an, dass ihre beruflichen Kompetenzen während der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich insgesamt in zufriedenstellendem Masse gefördert worden sind. Aus der Sicht der Absolventinnen und Absolventen versagt die Hochschule also nicht. Im Einzelnen lautet die Einschätzung im Blick auf die Ausbildung insgesamt wie folgt: Sie erhielten einen guten Einblick in zentrale theoretische Konzepte und eine gute Fachkompetenz in ihren Fächern. Auch in einigen konkret unterrichtsbezogenen Bereichen attestieren sie der PH Zürich eine gute Kompetenzförderung; so vor allem beim Unterricht planen, vorbereiten und durchführen. 9 Auch in der Reflexion und der Überprüfung der Qualität des Unterrichts fühlen sie sich kompetent gefördert. Daneben zeigen sich einige Bereiche, welche in der Beurteilung deutlich abfallen. Es sind dies die Elternarbeit, die Zusammenarbeit im Team, der Umgang mit Vorgesetzten sowie die Funktion, als Klassenlehrperson tätig zu sein. Das sind keine riesigen Defizite, die einen Aufschrei der Kritik rechtfertigen würden. Die Erfahrung in der Schule und eine gezielte Weiterbildung werden dafür sorgen, auch in diesen Bereichen kompetent zu werden und professionell handeln zu können. Der Praxisbezug der Ausbildung wird durchaus kontrovers wahrgenommen. Einerseits werden die professionellen Kompetenzen der Dozierenden und der Mentoren positiv beurteilt, auf der anderen Seite werden dezidierte Verbesserungsvorschläge gemacht, die insbesondere das Verhältnis von Praktika und Hochschulseminar zum Gegenstand haben. Was im Praktikum erfahren wird, lässt sich nur zufällig im Studium aufgreifen und vertiefen. Auf diese Kritik reagiert das neue, durchgehend praxisorientierte Studienkonzept der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die grösste Überraschung der Befragung ist die Beschreibung des Kompetenzzuwachses während der zweijährigen Berufseingangsphase. „In sämtlichen Kompetenzbereichen ergeben sich signifikante und zum Teil markante Kompetenzzuwächse im Verlauf der zweijährigen Berufseinführungsphase. Besonders gross fallen diese aus bei ‚Sicherheit betreffend Stoff- und Lehrplan’, ‚Elternarbeit’ und ‚Funktion als Klassenlehrperson ausüben können’.“ Vergleichsweise gering fallen die Kompetenzzuwächse bei den theoretischen Konzepten und der eigenen Sozialkompetenz sowie der Reflexion des Unterrichts aus. Theorie- und Unterrichtsreflexion scheinen im Berufsalltag weniger dringlich zu sein oder es steht dafür auch einfach zu wenig Zeit zur Verfügung. Dieses Ergebnis mag die Ausbildner enttäuschen, aber kann nicht eigentlich überraschen, weil die Sprache im Schulzimmer eine andere ist als die Sprache der Ausbildung oder der Prüfung. Das bedeutet aber nicht, dass Lehrpersonen ihren Unterricht nicht reflektieren, nur verwenden sie nicht notwendig die Theoriekonzepte der Ausbildung.1 Die wichtigsten Lernfelder für den Aufbau der professionellen Kompetenz waren der Berufsalltag und so die Ernstfallsituation sowie die Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Der Berufseinstieg gelingt offensichtlich durch den Aufbau oder die Weitergabe von konkretem Know-how vor Ort. Die Novizen stellen in allen 28 abgefragten Bereichen zum Teil beträchtliche Zuwächse ihrer beruflichen Kompetenz fest. Das unterstreicht die Bedeutung der Berufseinstiegsphase und legt eine enge Verbindung von Ausbildung und Berufseinstieg nahe. 1 Noch ein Ergebnis ist auffällig. Die Lehrerinnen schätzen ihre beruflichen Kompetenzen durchgehend höher ein als ihre männlichen Kollegen, insbesondere im Blick auf die konkrete Unterrichtsgestaltung. Wer mit einem höheren Pensum den Berufseinstieg leistet, hat im Blick auf Kompetenzentwicklung gegenüber niederen Pensen Vorteile. 10 Der Berufseinstieg kennt nicht eine bestimmte und dominante Herausforderung. Vielmehr sind die Menge, die Vielschichtigkeit und auch die Widersprüchlichkeit der Aufgaben die Herausforderung, die beim Berufseinstieg täglich zu bewältigen ist. Die Berufsanfänger wissen, dass sie nach Schluss des Studiums einen Rollenwechsel vor sich haben und stellen sich darauf ein. Ein „Praxisschock“, wie er in früheren deutschen Studien beschrieben wurde, gibt es so nicht. Die Studierenden gehen also nicht naiv in die Praxis. Zusammenfassend lässt sich dazu sagen: „Für die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger gilt es, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, die beruflichen Aufgaben und Pflichten zu erkennen und wahrzunehmen, sich der eigenen Position als Lehrerin oder Lehrer bewusst zu werden und Autorität aufzubauen. In besonderem Masse trifft dies auf Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu. Dass die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger gerade hier ihre Kompetenzen unmittelbar nach der Ausbildung vergleichsweise gering einschätzen, erschwert den Rollenwechsel.“ Wie in verschiedenen anderen Studien auch, so lautet auch hier der Befund, dass die wichtigste Unterstützung während der Berufseingangsphase durch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort erfahren wird. Wo eine Fachbegleitung zur Verfügung stand, wird auch dies positiv beurteilt, und zwar sowohl im Blick auf die Beziehung als auch bezogen auf die sachliche Beratung. Auch obligatorische Weiterbildungswochen werden positiv beurteilt, allerdings hat nur etwa die Hälfte der Befragten solche Wochen wahrnehmen können, einfach, weil nicht genügend Zeit zur Verfügung stand. Die Novizen im Beruf erfahren angemessene Unterstützung, aber von Anfang an auch einen massiven Zeitdruck, der ihnen hohe Anstrengungsbereitschaft abverlangt. Die berufliche Selbstwirksamkeit von Berufsanfängern ist über sämtliche abgefragten Aspekte hinweg hoch. Die Arbeitsfreude ist ebenfalls hoch und sie steigt, wenn die Fächer unterrichtet werden können, die auch studiert wurden. Die Berufswahlmotive haben einen klaren Kern: Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer wählen ihren Beruf, weil sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen. Dieses zentrale Motiv wird durch die ersten zwei Jahre im Beruf voll bestätigt. Nur wenige der Befragten haben sich schon ernsthaft Gedanken gemacht, den Beruf oder die Stelle zu wechseln. 90% der Befragten raten einer jungen Person, einen Lehrberuf zu ergreifen. Gefragt wurde auch nach den Belastungserfahrungen. Als mittel bis eher stark belastend eingestuft wurden sowohl unterrichtsbezogene als auch ausserunterrichtliche Aufgaben. Das Kerngeschäft ist also nicht die alleinige Problemzone. Die Belastung steigt mit der Stufe: Lehrpersonen der Sekundarstufe fühlen sich stärker belastet als Lehrpersonen der Primarstufe und die wiederum fühlen sich stärker belastet als Lehrpersonen des Kindergartens. Das Belastungsniveau insgesamt ist aber vergleichsweise niedrig. Eine 11 Besonderheit gibt es im Blick auf die Geschlechtsdifferenz. Männer fühlen sich bei der Zusammenarbeit mit der Schulleitung stärker belastet als Frauen. Diesterweg hat also nicht Recht, was keine politische Stellungnahme ist, obwohl man versucht ist zu sagen, dass Rufe nach der Rückkehr des alten „Schulmeisters“ schon deswegen aus der Welt sind, weil primär Frauen unterrichten. Aber bleibt die Praxis mehr oder weniger so, wie sie in den Anfangsjahren erfahren wird? Oder anders gefragt, wofür bilden die Pädagogische Hochschulen in Zukunft auf? Kommt es wirklich noch auf den Lehrer oder die Lehrerin an? 4. Wandel des Berufsfeldes Heute kündigt sich ein grundlegender Wandel der schulischen Lernkultur an, bei dem das Internet der Treiber ist. Darauf gehe ich abschliessend ein. Dieser Wandel wird Auswirkungen haben auf die Schulorganisation, die Lernzeit, die Lernverantwortung und auch auf die Erfassung der Leistungen. Die heutige Diskussion über Tages- oder Ganztagschulen geht wie selbstverständlich davon aus, dass Unterricht in der Form von Lektionen erteilt und dann für den Tagesbetrieb sinnvoll ergänzt werden muss. Aber das selbstorganisierte Lernen mit dem Laptop und gesteuert durch Aufgabenkulturen gewinnt an Raum und stellt genau diese Prämisse in Frage. Der Lehrplan 21 wird diese Entwicklung beschleunigen. Man kann darin auch das Ende der Schule in ihrer historischen Form sehen. Der amerikanische Journalist und Politikberater Lewis J. Perelman veröffentlichte 1992 eine Streitschrift, die den Titel trug School’s out: Hyperlearning, the New Technology, and the End of Education (Perelman 1992). Vor zwanzig 20 Jahren erregte das Buch in den Vereinigten Staaten grosses Aufsehen, war ein Ereignis in den alten Medien und trug dem Verfasser eine Unmenge an Vorträgen ein. Die Nachfrage und das Interesse an das Ende der Bildung in ihrer gewohnten Form hielten etwa fünf Jahre an, heute ist der Hype vergessen, denn Schulen gibt es immer noch. Das Grundargument bezog sich auf das Missverhältnis von Bildungsausgaben und den Leistungen von öffentlichen Schulen. Zu Beginn der neunziger Jahre betrugen die Gesamtkosten für das amerikanische Bildungssystem über 400 Billionen Dollar pro Jahr, während gleichzeitig die Drop-out-Quote ständig anstieg und die Schulleistungen zurückgingen. Wenigstens war das die öffentliche Wahrnehmung. Perelmans These ging von einer heruntergewirtschafteten Schule aus und formulierte eine radikale Alternative. Ausgangspunkt waren die neuen interaktiven Lernmedien, von denen angenommen wurde, dass sie innerhalb kürzester Zeit den Schulbesuch ersetzen würden. 12 Das Ende der Schule ist schon mehrfach in der Geschichte des Bildungsdiskurses proklamiert worden, zumeist unterstützt mit dem Argument, dass Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis stünden. Bekannt ist etwa das Programm des österreichischen Sozialrevolutionärs Ivan Illich, der 1971 den Slogan Deschooling Society prägte, seinerzeit noch Lichtjahre entfernt von der Internetrevolution. Heute kommen erneut Stimmen auf, die das Ende der gesellschaftlichen Institution Schule vorhersagen und Ideen vertreten, wie sie in der Reformation diskutiert wurden, nämlich dass mit Hilfe des Internet jeder jeden unterrichten könne und somit ein professioneller Stand von Pädagogen oder Priestern überflüssig sei (Gelernter 2012). Das hören staatlich angestellte Lehrkräfte natürlich nicht gerne wie auch schon die Reaktion auf die Thesen von Ivan Illich blankes Entsetzen war. Die Lehrerschaft reagiert auf Kritik leicht mit dem, was der Wiener Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld (1974, S. 125) das „beleidigte Pädagogengemüt“ nannte. Man gibt sein Bestes, aber niemand will es. Doch die Schule ist stärker als viele Kritiker meinen und die Untergangsängste des Personals befürchten. Die Schule als Institution bietet neben dem Unterricht feste Zeiten für Anfang und Ende, einen strukturierten Lerntag, spezialisiertes Personal, verantwortliche Aufsicht und nicht zuletzt die Abwechslung vom Medienalltag. Sehr wahrscheinlich ist das Verschwinden der Schule also nicht. Etwas anderes ist dagegen unübersehbar, nämlich, dass sich die Schule anpasst und den Gewinn für sich auslotet, so wie sie das bisher noch mit jeder Medienrevolution getan hat. Konkret: Die Lernformen und Aufgabenstellungen in der Schule werden sich die Internetrevolution nutzbar machen, ohne dass sie staatliche Schulpflicht verschwindet oder jeder mit eigenen Links lernen kann. Facebook ersetzt die öffentliche Schule nicht, aber beeinflusst die Lernerwartungen und so das Verhalten. Die Standardsituation des Unterrichtens wird sich verändern. Die Stichworte dafür lauten „selbstorganisiertes Lernen“, „Lernen nach eigenem Tempo“ und „Steuerung durch Systeme der Rückmeldung“. Das traditionelle Lehrbuch wird seinen Stellenwert verlieren, die Lehrpersonen werden nicht mehr einfach „ihre“ Klasse unterrichten und sie werden nicht mehr primär Lektion geben, die sie selbst vorbereiteten haben, sondern mit elektronischen Lernplattformen und erneuerbaren Aufgabenkulturen arbeiten, die in der Technologie bereits weit fortgeschritten sind. Der Wandel ist in heutigen Schulen bereits deutlich sichtbar und wird sich in den nächsten Jahren massiv beschleunigen. Die Standardsituation des Unterrichts stammt aus dem 19. Jahrhundert und setzt die Lehrbuchgesellschaft voraus. Lehrbücher sind träge Medien, die sich nur langsam verändern können, weil sie viele Auflagen erleben müssen, um rentabel zu sein. Lernmedien dieser Art können mit der Entwicklung der Wissensgesellschaft sicher nicht Schritt halten. Zudem schränken sie die Lernmöglichkeiten ein und basieren auf der Vermittlung des Durchschnitts. 13 Die Schulen der Zukunft dagegen müssen die Zugänge zum Lernen öffnen, den Habitus des selbstverantwortlichen Lernens ausprägen und die Schülerinnen und Schüler davor bewahren, von Lernleistungen auszugehen, die irgendwann einmal abgeschlossen sind. Das hat etwa Konsequenzen für die Leistungsbeurteilung, das Prüfungswesen und das abschliessende Zertifikat eines Schulbesuchs. Alles das wird sich ändern müssen, wenn die Schule nicht tatsächlich riskieren will, zwischen Laptop-Lernumgebungen allmählich zu verschwinden. Im Kern geht es um einen grundlegenden Wandel der Schulkultur, der sich auch beim Aufbau von Feedback-Systemen oder bei vergleichender Leistungsbewertung zeigen muss. Ein Stichwort dafür ist „Transparenz“, mit dem heutige Schulen immer noch Mühe haben. „Transparenz“ bezieht sich nicht nur auf die Klarheit der Kriterien, etwa bei der Vergabe der Noten, sondern auch auf die Kommunikation mit den Schülern, den Eltern und der lokalen Öffentlichkeit. Die Standards, die jede Schule vertritt, müssen klar und deutlich kommuniziert werden, und das gilt für den Verhaltensbereich ebenso wie für die Leistungserwartungen. Und „Standards“ betreffen nicht nur die Schüler, sondern auch die professionellen Anforderungen der Lehrkräfte (Oelkers/Reusser 2008). Es ist sicher kein Zufall, dass der Qualitätssprung mit der Entwicklung der elektronischen Medien zu tun hat. Und es auch kein Zufall, dass dabei Leistungstests inzwischen eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Tests sind nicht alles, sie haben auch deutliche Grenzen, aber sie werden für die Beurteilung der Leistungen unverzichtbar und werden ihren Platz nicht zuletzt in der Kommunikation mit den Eltern finden. Tests sind allerdings auch nur eine von verschiedenen Massnahmen zur Verbesserung der Qualität von Schule und Unterricht. Die Internetrevolution wird in wenigen Jahren auch die Formen des Lehrens und Lernens in öffentlichen Schulen grundlegend verändern. Lernen mit Smart Boards, elektronischen Plattformen und in LaptopLernumgebungen sind bereits heute in nicht wenigen Schulen Praxis. Die Lehrmittel werden sich in elektronische Aufgabenkulturen verwandeln, die mit Rückmeldesystemen verbunden sind. Die Schülerinnen und Schüler lernen vermehrt nach individuellem Tempo und damit auch unabhängig von einem schulisch vorgegebenen Zeittakt. Die Lernfortschritte werden dokumentiert und transparent gemacht, das gilt ebenso für die von den Schülerinnen und Schülern angefertigten Produkte. So utopisch ist das nicht. Lernplattformen gehen auf eine pädagogische Erfindung zurück. Sie operieren nach dem Muster des historischen „Dalton-Plans“, den die amerikanische Pädagogin Helen Parkhurst 1920 in Abgrenzung zu Maria Montessori veröffentlicht hat. Dahinter steht die Kritik der sogenannten „lock-step-schooling“, die bereits 14 vor dem Ersten Weltkrieg aufkam2 und einen gewissen Einfluss auf die amerikanische Reformpädagogik hatte. Die Kritik greift die historische Normalform des Unterrichts an, also das Lernen in Jahrgängen, in genau gleichen Schritten und mit nur einem Thema pro Lektion für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Dieser Trend hin zum Lernen nach eigenem Tempo und Coaching des Prozesses hat an Privatschulen begonnen und inzwischen auch die öffentlichen Schulen erreicht. Einige Sekundarschulen etwa im Kanton Thurgau haben ihr Programm schon ziemlich weitgehend auf elektronische Plattformen umgestellt, unbemerkt von der Öffentlichkeit und in der Form von Selbstentwicklung. Die Plattformen ermöglichen individuelles Lernen mit Aufgaben oder „Lernjobs,“ und eine fortlaufende Rückmeldung des Lernstandes. Die Lehrkräfte werden zu „Lerncoaches,“ die nicht jeden Tag vor der Klasse stehen und gemäss der Stundentafel Unterricht erteilen. Sie begleiten und bewerten Lernprozesse, ohne für jede Lektion den Unterricht geplant zu haben. Sie betreuen Aufgabenkulturen und bearbeiten den Lernstand. Im Blick auf das Tempo und den Weg ist das Lernen individuell, die Standards aber sind gesetzt ebenso die Art der Leistungsüberprüfung. Von diesem sowohl individualisierten wie standardisierten Lernen profitieren nicht zuletzt die lernschwächeren Schülerinnen und Schüler, die in der festen Leistungshierarchie einer Klasse ihren Rang kaum verbessern können. Mindeststandards sind für sie so eher zu erreichen. Diese Idee steht auch hinter dem Lehrplan 21. Ein weiteres Stichwort ist „open access“: Es gibt inzwischen Schulen, die die Eltern regelmässig und passwortgeschützt über den Lernstand ihrer Kinder informieren. Die Schulen legen Datenbänke an, in denen alle Lehrkräfte die Noten der schriftlichen Leistungen eintragen. Die Eltern erhalten dann regelmässig einen Auszug, der sie über den Stand informiert und den sie unterschreiben müssen. Sie können dann beizeiten überlegen, welche Strategien sie ergreifen, wenn ein Leistungsniveau erreicht ist, das weder sie noch ihre Kinder zufrieden stellt. Auch im Blick auf die oft mangelhafte Kenntnis sowohl der Lernziele als auch der genauen Leistungsanforderungen kann man mit einem offenen Zugang Abhilfe schaffen. Die Schulen müssen nur darstellen und den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern zugänglich machen, was sie in welcher Zeit erreichen wollen und nach welchen Kriterien sie bei der Leistungsbewertung vorgehen. Der Verweis auf den Lehrplan genügt nicht, weil jede Schule im Rahmen der staatlichen Vorgaben letztlich den eigenen Lehrplan verwirklichen Den Ausdruck „lock-step” verwandte schon William J. Shearer, der Superintendent der öffentlichen Schulen von Elizabeth in New Jersey. Er verfasste 1898 ein Buch gegen das Grading of Schools, also die Einteilung der Schülerinnen und Schüler nach Jahrgängen. Shearer war einer der ersten amerikanischen Pädagogen, der für „ungraded schools“ und so für „alterdurchmischtes Lernen“ eintrat. 2 15 muss. Das kann in Gestalt von Monats- oder Jahresplänen geschehen, in die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler Einblick haben. Bezogen auf den Unterricht sind Transparenz und Zielsteuerung längst ein Thema. Mit Eltern und den Jugendlichen werden auf dieser Basis Standortgespräche geführt, die mit Testdaten angereichert werden können. Auch in einer Evaluation von „Stellwerk“ im Kanton Zürich zeigte sich, dass neben dem Test vor allem die Standortgespräche bei den Lehrkräften auf grosse Zustimmung stossen, selbst wenn damit zusätzliche Belastungen verbunden waren (Kammermann/Siegrist/Lempert 2007). Auf diese Weise wird ein professioneller Kontakt mit den Eltern möglich, der sich nicht auf persönliche Beobachtungen beschränkt und auch keine Klagen nötig hat. Die Schulen dürfen nicht einfach nur entgegen nehmen, was kommt, sondern müssen aktiv den Aufbau der Interessen gestalten, nicht bei jedem Schüler gleich, wohl aber als deutlicher Auftrag, Leistungen hervorzubringen. Die Leistungen der Schüler sind stark von ihrem Interesse bestimmt, aber auch davon, dass sie erfahren, in ungeliebten Fächern voranzukommen und dort Erfolg zu haben, wo sie es nicht erwarten, etwa im Französischunterricht. Hier liegt ein wichtiger Testfall für den Schulerfolg und die Probe auf die Anstrengungsbereitschaft. Auch dafür kann viel getan werden kann, dies mit Nutzung neuer Medien und unter aktiver Einbeziehung der Eltern. In manchen Sekundarschulen hat jede einzelne Klasse eine eigene Website, auf der sie ihre Leistungen und Produkte präsentieren kann, in Form von Texten, Bildern, Kommentaren und Disputen. Man liest dann als Vater oder Mutter die besten Aufsätze, kann Musterlösungen mathematischer Aufgaben studieren und erhält Einblick in den Kunstunterricht, indem die Abbildungen der Produkte ins Netz gestellt werden. Blogs geben die reflexive Arbeit wieder, die das Lernen begleitet hat. Und für die Schüler ist es sehr anregend, sichtbar zu sein und gar noch zu den Besten zugehören, vielleicht auch dort, wo es nicht für möglich gehalten wurde. Eltern können auf diese Weise auch Lernfortschritte wahrnehmen, was für sie das Kernkriterium ihrer Beurteilung der Schulqualität ist. Der Weg zur Leistung ist ebenso transparent wie die Leistung selbst. Am Ende stünde aber nicht, wie manche Lehrpersonen befürchten, der „gläserne Schüler“, bzw. die „gläserne Schülerin“, sondern ein Glaubwürdigkeitsgewinn für die öffentliche Schule. Nur so kann man mit dynamischen Bezugsnormen arbeiten, wie sie getestete und fortlaufend weiterentwickelte Aufgabenkulturen darstellen. Berufsschulen spielen hier bereits heute die Vorreiterrolle, weil sie produktorientiert vorgehen und sich an den Betrieben orientieren müssen. Die neuen Technologien des Lernens werden auch die allgemeinbildenden Schulen antreiben, sich auf möglichst intelligente Weise in diese Richtung zu entwickeln. Nur kann sich die Schule als moderne Organisation zeigen, die mit der gesellschaftlichen Entwicklung mithält und vom Auftrag her glaubwürdig bleibt. Nur so ist auch die öffentliche Finanzierung zu rechtfertigen. Niemand hätte Verständnis, wenn die Schulen einfach nur ihren pädagogischen Lieblingsideen folgen würden. Mein Schluss lautet daher so: Entgegen manchen Prognosen löst das Internet die Schulen nicht auf, aber zwingt sie zum Wandel, wenn sie ihren gesellschaftlichen Rang bewahren wollen. Und die Frage für die Ausbildung kann nur lauten, wie sie sich darauf 16 einstellen will. Eine andere Wahl gibt es nicht. Das Lernen hat sich verändert und da können die Institutionen des Lernens nicht abseits stehen, der alte Schulmeister an der Tafel ist geschichtsvergessene Nostalgie. Die Kinder und Jugendlichen werden in Zukunft noch mehr erstaunt sein als heute, dass sie in der Schule anders lernen sollen als im Alltag. Damit sage ich nicht, dass Sport, Handarbeitsunterricht oder Musik im Laptop stattfinden werden. 5. Ein Nachtrag zur Kompetenzorientierung Erlauben Sie mir noch einen Nachtrag: Die öffentliche Schule muss sich strukturell und sichtbar weiter entwickeln, während man heute oft einfach nur semantische Anpassungen erlebt, wie die Karriere des Begriffs „Kompetenz“ zeigt. Heute gibt ein es keinen Lernbereich mehr und kaum noch eine pädagogische Veröffentlichung ohne die Verunzierung durch „Kompetenzstufen“, aber neu ist damit nur die Sprache, nicht das Problem des Unterrichts. Keine didaktische Theorie seit dem 19. Jahrhundert hat Unterrichtserfolg mit dem blossen Nachvollzug von Schulwissen gleichgesetzt; es ging immer um das Verstehen, Durcharbeiten und Anwenden des Stoffes durch die Schüler, also um zunehmendes Können oder um stetig verbesserte Kompetenz. Der Gründer des Pädagogischen Seminars der Universität Leipzig, der Herbartianer Tuiskon Ziller (1884, S. 240),3 hatte dafür auch eine plausible Regel: Der Zögling, wie man die Schüler im 19. Jahrhundert nannte, „darf durch den Unterricht nicht geistig schwächer werden“.4 Wie oft das der Fall war, ist nie untersucht worden, aber das Problem der Nachhaltigkeit des Unterrichts ist nicht neu, und auch Zillers Lösung, dass die Schulübel verschwinden, „wenn nur die Lehrer bessere Methoden zu gebrauchen wüssten“ (ebd., S. 243),5 ist bis heute angesagt. Auch mit den neuen Medien reicht das nicht aus. Jede neue Lehrform kann mit der Gewöhnung an sie ihren Reiz verlieren und die Nachhaltigkeit ist nicht allein dadurch gegeben, dass jeder formal nach eigenem Tempo lernt. Lernqualität setzt viele Wege voraus, nicht nur neue und auch solche, die die Schule nicht bestimmt. Wer das Problem der Schulentwicklung auf neue Methoden des Unterrichts reduziert, und dazu neigt die Ausbildung, in isoliert es und verkennt die Zukunftsaufgaben. Die beiden grossen Entwicklungstrends neben den neuen Technologien sind Ganztagsschulen und Bildungslandschaften. Sie machen deutlich, dass Zillers Lösung keine ist. Sie isoliert das Klassenzimmer, während es darauf ankommt, die Schule zu öffnen und das Geschehen im Klassenzimmer transparent zu machen. Schulen sind Erfahrungsräume und sie stehen nicht für sich, sie müssen sich mit dem Umfeld vernetzen und mehr Zeit gewinnbringender einsetzen, ohne den Unterricht zu vernachlässigen. Und darauf müssen die Hochschulen vorbereiten. 3 Tuiskon Ziller (1817-1882) war Gymnasiallehrer und habilitierte sich als Jurist. 1854 begann er mit Vorlesungen im Pädagogik, 1861 erfolgte die Gründung des Pädagogischen Seminars, das ein Jahr später mit einer Übungsschule verbunden wurde. Zillers Einleitung in die Allgemeine Pädagogik von 1856 ist die Begründungsschrift des Pädagogischen Herbartianismus. 4 Sperrung im Zitat entfällt. 5 Sperrung im Zitat entfällt. 17 Literatur Bernfeld, S.: Antiautoritäre Erziehung und Psychoanalyse. Ausgewählte Schriften Band 1. Hrsg. v. L. v. Werder/R. Wolff. Frankfurt/Berlin/Wien: Ullstein Verlag 1974. Cramer, C./Horn, K.-P./Schweizer, F.: Zur Bedeutsamkeit von Ausbildungskomponenten des Lehramtsstudiums im Urteil von Erstsemestern. Erste Ergebnisse der Studie „Entwicklung Lehramtsstudierender im Kontext institutioneller Rahmenbedingungen (ELKiR). In: Zeitschrift für Pädagogik Jg. 55, H. 5 (2009), S. 761-780. Diesterweg, A.: Zur Lehrer-Bildung. Der in Berlin vom 15. Januar 1849 ab stattfindenden Seminarlehrer-Conferenz überreicht. Essen: Verlag von G.D. Bädeker 1849. Gelernter, D.: Hausfrauen, Polizisten - jeder ist als Lehrer geeignet. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 33 v. 8. Februar 2012, S. N5. Goodlad, J.: Teachers for Our Nation’s Schools. San Francisco/Oxford: Jossey Bass Publishers 1990. Illich, I.: Deschooling Society. New York: Harper&Row 1971. Kammermann, M./Siegrist, M./Sempert, W.: Begleitende und abschliessende Auswertung der Erfahrungen mit dem neu gestalteten Schuljahr an der Sekundarschule des Kantons Zürich. Schlussbericht zur zweiten Erhebung (April-Juni 2007). Vervielf. Ms. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 2007. Larcher Klee, S.: Einstieg in den Lehrberuf. Untersuchungen zur Identitätsentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern in ihrem ersten Berufsjahr. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag 2005. (= Schulpädagogik – Fachdidaktik – Lehrerbildung, Band 9) Nido, M./Trachsler, E./Swoboda, N.: Der anspruchsvolle Weg zum Lehrerinnen- und Lehrerberuf. Befragung von Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern an der Volksschule im Kanton Zürich. Zürich: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob, April 2012. Oelkers, J./Reusser, K.: Expertise: Qualität entwickeln - Standards sichern - mit Differenz umgehen. Unter Mitarbeit von E. Berner/U. Halbheer/St. Stolz. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008. Oser, F./Oelkers, J. (Hrsg.): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme: Von der Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards. Chur/Zürich: Rüegger 2001. Perelman, L.J.: School’s Out: Hyperlearning, the New Technology, and the End of Education. New York: William Marrow 1992. Ruffo, E.: Das Lernen angehender Lehrpersonen. Diss. phil. Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft (Abteilung Allgemeine Pädagogik). Ms. Zürich 2009. Schmid, Chr.: Lernen und Transfer. Kritik der didaktischen Steuerung. Bern: h.e.p.Verlag 2006. Shulman, L.S.: Just in Case: Reflections on Learning from Experience. In: J.A. Colbert/P. Desberg/K. Trimble (Eds.): The Case for Education: Contemporary Approaches for Using Case Methods. Needham Heights, MA: Allyn&Bacon 1995, S. 197-217. Stadelmann, M.: Differenz oder Vermittlung in der Lehrerbildung? Das Verhältnis von Theorie und Praxis im Urteil der Praktikumslehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I. 18 Bern/Stuttgart/Wien: Haupt-Verlag 2006. (= Schulpädagogik - Fachdidaktik - Lehrerbildung, Band 13) Ziller, T.: Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht. 2. verb. Aufl. Hrsg. v. Th. Vogt. Leipzig: Verlag von Veit&Comp. 1884.