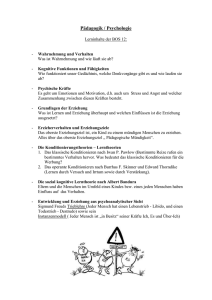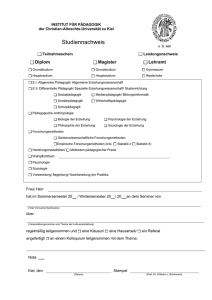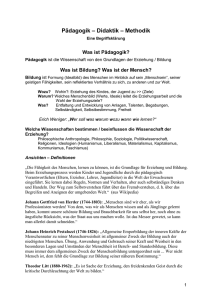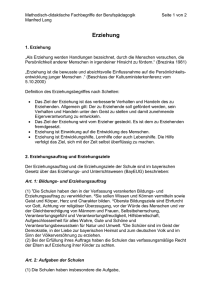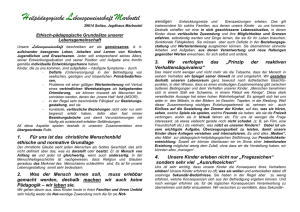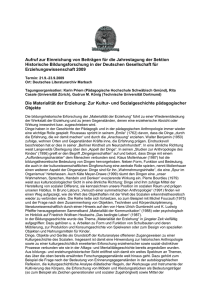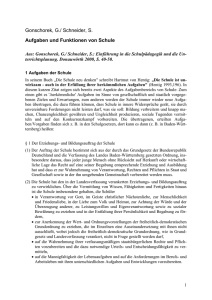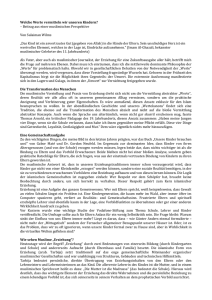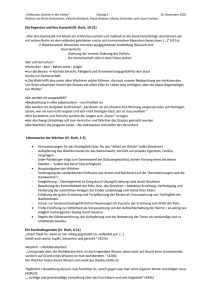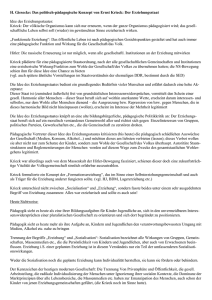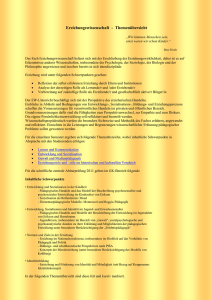Musterkonzept (Word, 48 Seiten, 2.5 MB)
Werbung

Musterkonzept Primokiz Ein Instrument im Programm Primokiz der Jacobs Foundation, um ein umfassendes Konzept für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in einer Stadt oder Gemeinde zu erstellen 2 «In entwickelten Volkswirtschaften stellt die frühkindliche Förderung aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine besonders produktive Investition dar – wie unter anderem anhand des ‚Perry Preschool Projects’ in den USA nachgewiesen wurde. Das heisst nicht, dass man Bildung nur unter dem Gesichtspunkt der materiellen Rendite betrachten soll. Es gibt in einem hohen Masse auch eine nicht geldmässige Bildungsrendite, die genauso wichtig ist.» ERNST FEHR, WIRTSCHAFTSPROFESSOR UNIVERSITÄT ZÜRICH April 2013 Dieses Musterkonzept wurde von Heidi Simoni, Bettina Avogaro und Christine Panchaud vom Marie Meierhofer Institut für das Kind im Auftrag der Jacobs Foundation entwickelt. Es beruht auf dem Modell Primokiz und dient – zusammen mit dem Instrument Situationsanalyse, das ebenfalls im Rahmen des Programms Primokiz der Jacobs Foundation entwickelt wurde – als Arbeitsinstrument für die Städte, die in das Programm Primokiz der Jacobs Foundation aufgenommen wurden. Beide Instrumente stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung auf. www.jacobsfoundation.org/primokiz 3 Wegleitung Der Weg zu einem umfassenden kommunalen Konzept für die frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung beginnt nicht auf einem unbeschriebenen Blatt. Vielmehr kann er an gesetzliche Grundlagen und anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse anknüpfen, da die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung bereits Gegenstand politischer und fachlicher Debatten ist. Das vorliegende Instrument begleitet die Stadt oder Gemeinde auf ihrem Weg zur Erarbeitung eines umfassenden Konzepts frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Es besteht aus einem Musterkonzept und aus Tabellen im Anhang, die der systematischen Erfassung von Informationen dienen. Am Ende des Prozesses verfügt die Stadt oder Gemeinde über eine Grundlage für die Weiterentwicklung des Bereichs der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, da Zielformulierungen sowie strategische Überlegungen zur Zielerreichung und zur Umsetzung der beschlossenen Massnahmen vorliegen werden. Die Konzepterarbeitung baut auf eine kommunale Situationsanalyse zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung auf. Idealerweise wurde diese anhand des Instruments „Situationsanalyse“ der Jacobs Foundation erstellt, da sich das vorliegende Musterkonzept darauf bezieht. Die beiden Instrumente verwenden dieselbe Systematik zur Erfassung von Angeboten und relevanten Akteuren der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und orientieren sich an den gleichen Inhalten wie die Situationsanalyse. Partizipation Wie bereits für die Situationsanalyse, ist es für die Erarbeitung des Konzepts von Vorteil, die Akteure der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu beteiligen. Dieser partizipative Prozess sollte dazu beitragen, die folgenden Wirkungen zu entfalten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Das erarbeitete Konzept wird von den verschiedenen Akteuren mitgetragen, was seine Legitimation stärkt und die spätere Umsetzung unterstützt. Die Kenntnisse und Erfahrungen der verschiedenen Akteure bereichern die Diskussion und das Ergebnis des Erarbeitungsprozesses. Vorbehalte und abweichende Meinungen sowie übereinstimmende Einschätzungen können erfasst werden, was für ein valides Ergebnis wichtig ist. Die Kluft zwischen dem Bestehenden und dem Angestrebten sowie zwischen den Akteuren des Feldes, den Zielgruppen (Eltern und Kinder), den Entscheidungsträgern und der Verwaltung kann vermieden oder zumindest verringert werden. Die Partizipation trägt dazu bei, dass sich die Akteure treffen und besser zu verstehen lernen. Darauf basierend können sie ihre Zusammenarbeit stärken und Netzwerke bilden. Dies gilt insbesondere für Akteure, die es kaum gewohnt sind, bezüglich Konzeptualisierung, Planung oder Umsetzung von Angeboten und Leistungen zusammen zu arbeiten. Die Beteiligung der verschiedenen Akteure trägt dazu bei, dass das Konzept dem Bedarf und den Möglichkeiten der Stadt oder Gemeinde tatsächlich entspricht. Wichtig ist, dass die Projektverantwortlichen in der Stadt oder der Gemeinde entscheiden und planen, wer in die Arbeitsschritte einbezogen werden soll und welche Mittel sich dafür eignen. So können entweder in jede Etappe dieselben Akteure einbezogen werden, was den Zusammenhalt zwischen Erarbeitungsschritten stärkt oder es können, abhängig vom zu bearbeitenden Inhalt, jeweils unterschiedliche Akteure beteiligt werden. Partizipative Vorgehensweisen, wie beispielsweise ein Workshop oder ein Hearing, können überdies für die Bearbeitung von mehreren Arbeitsetappen genutzt werden. Ausserdem muss vorab überlegt und transparent kommuniziert werden, ob ein Gremium nur konsultativ eingesetzt wird oder ob darin auch Entscheidungen getroffen werden sollen. 4 Schritte hin zu einem umfassenden Konzept Die Ausgangslage und die Arbeitsprozesse sind in jeder Stadt oder Gemeinde unterschiedlich. Dennoch lässt sich ein schematisches Vorgehen beschreiben, bei dem jedoch insbesondere die Reihenfolge der Punkte 3 und 4 umgekehrt werden kann: Anstoss Politischer Wille Situationsanalyse Situationsanalyse Identifikation von Entwicklungsmöglichkeiten Definition von Vision, Zielen und Prioritäten Entwicklung von Umsetzungsstrategien Konzeptentwicklung 1. Anstoss Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung wird zum (bildungspolitischen) Thema in einer Stadt oder einer Gemeinde. Auslöser können ganz verschiedener Art sein: z.B. Ereignisse in der Stadt oder Gemeinde, aktuelle wissenschaftliche Befunde, Erkennen eines Handlungsbedarfs oder politische Vorstösse. Die Behörde oder die Verwaltung entscheidet, den Bereich zu bearbeiten und bestimmt die Zuständigkeiten und Ressourcen dafür. 2. Situationsanalyse Eine Übersicht über die bestehende Landschaft der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung wird als Grundlage für die Konzeptentwicklung erstellt. Darin werden verschiedene Aspekte betrachtet: politischer Kontext, bestehende Angebote und Leistungen1, deren Strukturen und Zusammenspiel, Akteure, Prozesse, Qualitätssicherung, Ressourcen etc. Die Jacobs Foundation stellt dafür im Rahmen des Programms Primokiz das Instrument „Situationsanalyse“ zur Verfügung. 3. Identifikation der Entwicklungsmöglichkeiten Auf der Grundlage der Situationsanalyse können die Entwicklungsmöglichkeiten in einer Art Bilanz aufgezeigt werden: Was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung? Wo sind die Stärken, Lücken und Schwerpunkte im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in der Stadt oder Gemeinde? Wo gibt es Überschneidungen? Wo zeigt sich Handlungsbedarf? Welche Möglichkeiten hat die Stadt oder Gemeinde? 1 Zum Unterschied zwischen Angebot und Leistung: Das Angebot Mütterberatung z.B. kann ganz unterschiedliche Leistungen beinhalten, wie Hausbesuche, institutionelle Beratung, Telefonberatung, Elterncafé. 5 4. Wertvorstellungen, Vision, Ziele und Prioritäten Damit aus den identifizierten Entwicklungsmöglichkeiten konkrete Handlungsziele abgeleitet werden können, muss zunächst eine Grundlage über gemeinsame Wertvorstellungen geschaffen werden. Darauf basierend kann anschliessend eine Vision des angestrebten Idealzustands entwickelt und formuliert werden. Die folgenden Fragen sind dabei wegleitend: 1. 2. 3. 4. 5. Welche strategischen Ziele sollen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung und des festgestellten Handlungsbedarfs abgeleitet werden? Welche Ziele sollen zuerst angegangen werden? Welche Ziele können oder müssen zurückgestellt werden? Welche finanziellen und personellen Mittel können zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden? Umsetzungsstrategien Aus den Zielen können die Umsetzungsstrategien entwickelt werden, die in einer Planung der Umsetzung münden. Die Strategie berücksichtigt alle Dimensionen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und legt besonderen Wert auf die Vernetzung der Angebote und ihrer Leistungen. In der Praxis werden diese Prozessschritte oft parallel verlaufen und es werden immer wieder Schlaufen entstehen. Insbesondere stehen Schritte 3 und 4 in einem zirkulären Verhältnis zueinander: Die Identifikation von Entwicklungsmöglichkeiten des Bereichs der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung basiert zum einen auf der Analyse des Ist-Zustands des Bereichs, zum andern orientiert sie sich an den Entwicklungsvisionen und an politisch gesetzten Prioritäten der Stadt oder Gemeinde. Umgekehrt kann die kritische Reflexion des IstZustandes zur Überprüfung, Anpassung und Konsolidierung von Vision und Zielen führen. Gebrauchsanleitung Das vorliegende Instrument umfasst ein Musterkonzept und Tabellen im Anhang, mit denen Informationen aus der Situationsanalyse für die Konzeptentwicklung, der Entwicklungsbedarf sowie Ziele und Prioritäten aufbereitet und dargestellt werden können. Die Struktur des Instrumentes kann von der Stadt oder der Gemeinde verändert und ergänzt werden. Für die Bearbeitung der einzelnen Schritte wurden Leitfragen formuliert. Sie sind als Anregung und Auswahl gedacht und können von der Stadt oder Gemeinde angepasst, ergänzt oder weggelassen werden. Wie gross der Aufwand für die Bearbeitung der einzelnen Konzeptteile ist, hängt stark damit zusammen, wie vertieft sich die Stadt oder Gemeinde auf die jeweiligen Analysen und Reflexionsprozesse einlassen will. Dieses Dokument „Musterkonzept“ enthält drei Typen von Texten: 7. 8. Schwarze Texte können von der Stadt oder Gemeinde als Bausteine in ihrem Konzept verwendet werden. Violette, kursiv gesetzte Texte enthalten Hinweise, Erläuterungen und Anregungen zum Vorgehen. Sie sind nicht Bestandteil des Konzepts und erscheinen nicht im fertigen Konzept der Stadt oder Gemeinde. 9. Rote, kursiv geschriebene Texte enthalten Leitfragen und diesen untergeordnete Teilfragen. Die Beantwortung dieser Fragen ergibt die Kerninhalte des Konzepts. Die Fragen sind also im fertigen Konzept durch Antworten der Stadt oder Gemeinde ersetzt. Die Stadt oder Gemeinde kann entweder direkt mit diesem Dokument „Musterkonzept“ arbeiten oder ein eigenes Konzeptdokument erstellen. Wird mit diesem Dokument gearbeitet, so können die schwarzen Texte – je nach Bedarf - stehen gelassen werden. Die violetten Texte müssen gelöscht und die roten Texte durch Antworten auf die Fragen ersetzt werden. Für ein eigenes Dokument steht eine „Vorlage Musterkonzept“ zur Verfügung, die nur die Struktur mit den Titeln und die schwarzen Texte enthält. 6 Schema zur Erarbeitung eines umfassenden kommunalen Konzeptes der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 7 Musterkonzept einer umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung / Management Summary ........................................................................ 9 1 Warum ein umfassendes Konzept frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung? .............................................................................................................................. 10 1.1 Wozu frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? ..................................................... 10 Neun Argumente für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung .................................. 11 1.2 Wozu ein umfassendes Konzept? .......................................................................................... 12 1.3 Grundlage dieses Konzeptes: Das Modell Primokiz .............................................................. 12 1.4 Wozu eine Konzeptentwicklung in der Stadt oder Gemeinde? ............................................. 13 2 Ausgangslage: Der Ist- Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ................................................................................................................................ 14 2.1 Kontext................................................................................................................................... 14 2.1.1 Relevante demografische Kennzahlen ............................................................................. 14 2.1.2 Sozialpolitischer Kontext ................................................................................................ 14 2.1.3 Rechtsgrundlagen ............................................................................................................ 14 2.1.4 Strukturen ........................................................................................................................ 15 2.2 Angebote und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ............... 15 2.3 Koordination, Kooperation und Vernetzung .......................................................................... 15 2.4 Qualitätssicherung und Evaluation ........................................................................................ 15 3 Entwicklungspotential und -bedarf ........................................................................ 16 3.1 Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ............................................................................................................................... 16 3.1.1 Vorhandene Angebote und ihre Leistungen .................................................................... 16 3.1.2 Zugang zu den Angeboten ............................................................................................... 17 3.1.3 Partizipation der Akteure ................................................................................................. 17 3.2 Entwicklung der Zusammenarbeit und Vernetzung............................................................... 17 3.2.1 Strategische Entscheidungsprozesse................................................................................ 17 3.2.2 Koordination und Organisation ....................................................................................... 18 3.2.3 Vernetzung und Zusammenarbeit .................................................................................... 18 3.3 Entwicklung der Qualitätsentwicklung und Evaluation......................................................... 18 3.3.1 Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses .............................................. 18 3.3.2 Qualitätssicherung von Angeboten und ihren Leistungen ............................................... 19 3.3.3 Professionalisierung und Qualifizierung des Personals ................................................... 19 3.4 Entwicklung der Nachhaltigkeit ............................................................................................ 19 3.4.1 Gesellschaftliche und politische Verankerung ................................................................ 19 3.4.2 Rechtliche Grundlagen .................................................................................................... 20 3.4.3 Personal ........................................................................................................................... 20 3.4.4 Finanzierung .................................................................................................................... 20 4 Vision, Ziele und Prioritäten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ................................................................................................................................ 21 4.1 Werte und Vision ................................................................................................................... 21 8 4.2 Ziele und Prioritäten .............................................................................................................. 23 5 Umsetzungsstrategie ................................................................................................ 25 5.1 5.2 5.3 5.4 6 Strategie zur Veränderung der Angebote und ihrer Leistungen............................................. 26 Strategie zur Verbesserung der Kooperation und Vernetzung ............................................... 27 Strategie zur Qualitätsentwicklung und zur Evaluation ......................................................... 27 Strategie zur Stärkung der rechtlichen Basis ......................................................................... 28 Finanzierung und Personal ..................................................................................... 29 6.1 Personelle Ressourcen ........................................................................................................... 29 6.2 Kosten und Finanzierungsplan ............................................................................................... 30 9 Vorgehensweise und Erarbeitungsprozess ............................................................ 31 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Projektorganisation ................................................................................................................ 31 Partizipative Prozesse zur Erarbeitung des Konzeptes .......................................................... 31 Verwendete Instrumente ........................................................................................................ 31 Beratung und Coaching.......................................................................................................... 31 Abschliessende Reflexion des Konzeptentwicklungsprozesses............................................. 31 Anhang 1 ................................................................................................................................. 32 9.1.1.1 Tabelle 1: Ist-Zustand – Kontext (Kapitel 2.1).......................................................................... 32 9.1.1.2 Tabelle 2: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Angebote und Leistungen (Kapitel 2.2)............................................................................................................................ 34 9.1.1.3 Tabelle 3: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Kooperation, Vernetzung und Partizipation (Kapitel 2.3) .............................................................................................. 35 9.1.1.4 Tabelle 4: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Qualitätssicherung und Evaluation (Kapitel 2.4) ...................................................................................... 36 9.1.1.5 Tabelle 5: Entwicklungsbedarf und -potential bezüglich eines umfassenden und vernetzten Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (Kapitel 3.1) ....................................... 37 9.1.1.6 Tabelle 6 : Entwicklungsbedarf und -potential bezüglich Kooperation, Vernetzung und Partizipation (Kapitel 3.2) ......................................................................................................................... 39 9.1.1.7 Tabelle 7: Entwicklungsbedarf und Entwicklungspotential bezüglich Qualitätsentwicklung und Evaluation (Kapitel 3.3) ............................................................................................................................ 42 9.1.1.8 Tabelle 8: Entwicklungsbedarf und Entwicklungspotential bezüglich Nachhaltigkeit (Kapitel 3.4) 45 9.1.1.9 Tabelle 9: Ziele und Prioritäten - Wertvorstellungen und Vision (Kapitel 4.1) ........................ 46 9.1.1.10 Tabelle 10: Ziele und Prioritäten (Kapitel 4.2)...................................................................... 47 Weitere Anhänge .................................................................................................................... 48 9 Zusammenfassung / Management Summary Von der Stadt oder Gemeinde zu erstellen, gemäss den Stichworten des folgendes Inhaltsverzeichnisses: - - Rekapitulation von Problemlagen, Potenzialen und Zielsetzung der Stadt oder Gemeinde Warum und wie wurde das Konzept entwickelt? Die wichtigsten Inhalte des Konzepts: – Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsschwerpunkte – Zielsetzungen und Prioritäten – Umsetzungsstrategie – Finanzielle und personelle Ressourcen für die Umsetzung Ausblick: Umsetzung des Konzepts Resümee zum Erarbeitungsprozess Das Management Summary soll selbsterklärend sein und alle wichtigen Informationen des Konzepts in knapper Form enthalten. Der Umfang soll 2-3 Seiten nicht übersteigen. Zu beachten ist, dass diese Zusammenfassung denjenigen Teil des Dokumentes darstellt, der am ehesten gelesen wird, z.B. im politischen Prozess. Es ist gut zu überlegen, welche Botschaft diese Zusammenfassung übermitteln soll und welches Ziel mit dieser Botschaft erreicht wird. 10 1 Warum ein umfassendes Konzept frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung? In diesem einleitenden Kapitel wird aufgezeigt, weshalb sich eine Stadt oder Gemeinde im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung engagieren sollte und weshalb ein Konzept dafür notwendig ist. Dieses Kapitel soll Argumente zusammentragen, weshalb es sich für eine Stadt oder Gemeinde lohnt, sich mit diesem Thema zu befassen, es in einem Konzept zu beschreiben und dieses umzusetzen. Rechtliche und fachliche Grundlagen zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind in den Kapiteln 2 und 3 der Situationsanalyse zu finden. Von dort können auch Texte in das städtische oder kommunale Konzept kopiert werden. Die folgenden Texte können im stadteigenen oder gemeindeeigenen Konzept ebenfalls übernommen, weggelassen oder durch eigene Texte ersetzt werden. 1.1 Wozu frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? Die Sicht auf die ersten Lebensjahre eines Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Vor allem die Neurobiologie hat die Erkenntnis hervorgebracht, dass die ersten Jahre eine Zeit grosser Lernfähigkeit des Menschen darstellen. Säuglinge und Kleinkinder haben eine angeborene Neugierde, ja geradezu einen Drang, über aktive sinnliche Wahrnehmung die Welt zu erkunden. Die Umwelt ist in dieser Lebensphase überaus wichtig für die Entwicklung: Frühe Erfahrungen haben für die ganze Lerngeschichte eines Menschen eine besondere Bedeutung. Moderne Konzepte frühkindlicher Bildung bauen auf diesen Erkenntnissen auf. Zahlreiche internationale Forschungsergebnisse belegen heute die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Eine qualitativ hochstehende Förderung der Kinder von 0 bis 4 Jahren führt zu besseren Bildungschancen mit besseren Schulleistungen und weniger Schulabbrüchen, was wiederum das Armutsrisiko durch eine verbesserte Teilhabe an der Arbeitswelt und an der Gesellschaft einschränkt. Die Forschung betont aber auch, dass die aufgezeigten Wirkungen nur unter zwei Bedingungen auftreten: – Die Angebote der frühen Förderung müssen von hoher Qualität sein und – Die Kinder müssen nach dem Schuleintritt weiterhin gefördert werden. 11 Neun Argumente für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung2 1. Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung – von Geburt an. Dieses Bildungsrecht schreibt die UNKinderrechtskonvention, die in der Schweiz 1997 ratifiziert wurde, explizit fest und gilt von Geburt an. 2. Kleine Kinder lernen viel – und das spielend. Den grossen Teil ihres Wissens (Schätzungen gehen von 70 bis 90% aus) erwerben Kinder ausserhalb der Schule, also in der Familie, auf dem Spielplatz, mit Gleichaltrigen, in der Kita etc. Da die Neurobiologie erkannt hat, dass die ersten Jahre eine Zeit grosser Lernfähigkeit des Menschen darstellen, lohnt es sich besonders, dieses Lernen zu fördern. 3. Vorläuferfertigkeiten bestimmen den späteren Schulerfolg. Vorläuferfertigkeiten sind die Fertigkeiten, die Kinder in natürlichen Entwicklungsumwelten spontan erwerben, ohne dass sie geschult werden. Im Gegensatz dazu müssen ihnen schulische Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht werden. Je besser die Vorläuferfertigkeiten des Kleinkindes gefördert werden, desto erfolgreicher ist das Kind später in der Schule. 4. Frühe Förderung erhöht die Chancengerechtigkeit. Beim Eintritt in den Kindergarten sind die Unterschiede in der kognitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen der Kinder riesig. Viele Kinder können diese Unterschiede während der ganzen Schulzeit nicht mehr wettmachen. Deshalb ist es wichtig, schon vor dem Schuleintritt für gerechtere Chancen zu sorgen. 5. Frühe Förderung entlastet die Schulen. Kinder, die mit grossen Entwicklungsrückständen in den Kindergarten eintreten, benötigen besonders viel individuelle Förderung durch die Lehrpersonen und sonderpädagogische Massnahmen. Dies verursacht grossen Aufwand im Schulsystem. 6. Frühe Förderung fördert die Integration. Im Frühbereich können gute Angebote für kleine Kinder und ihre Eltern die Integration in die Schweizer Kultur und in das Schweizer Bildungssystem fördern. 7. Länder mit frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung erzielen bessere Resultate in der PISA-Studie. Die in der PISA-Studie erfolgreichsten Länder zeichnen sich nicht nur durch die Leistungen ihrer 15Jährigen in Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaften aus, sondern verfügen auch über gut ausgebaute Systeme der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und fördern darüber hinaus auch Kinder aus unterprivilegierten,bildungsfernen Schichten besonders gut. 8. Frühe Förderung zahlt sich aus. Für jeden Franken, den die Gesellschaft in die frühkindliche Bildung investiert, erhält sie eine Rendite von mindestens 2 Franken. Umgekehrt ist erwiesen, dass mit weniger gesellschaftlichem Ertrag gerechnet werden kann, je später eine Bildungsmassnahme erfolgt. Zudem sind spätere Massnahmen oft wesentlich teurer. 9. Frühe Förderung ist Armutsbekämpfung. Armut in der Schweiz hängt massgeblich mit dem Bildungsniveau zusammen: Die Armutsstatistik in der Schweiz bestätigt: Je besser ausgebildet eine Person ist, desto geringer ist ihr Risiko, in die Armut abzurutschen. 2 Die Quellenangaben verweisen nur auf deutsch- oder französischsprachige Dokumente und Zusammenfassung von Forscherinnen und Forschern aus der Schweiz. Auf eine Angabe der Originalquellen wird verzichtet. Art. 1, Art. 3 Abs., Art. 28 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html Zusammengefasstes Referat der Neuropsychologin Prof. Claudia Roebers, Universität Bern: www.bildungslandschaften.ch/roebers Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012) Strategie Frühe Förderung. Bildungsdirektion Kanton Zürich. http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/themen/fruehe_foerderung0.html Stamm, M. et al. (2009). Frühkindliche Bildung in der Schweiz: Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Unesco-Kommission Schweiz. Fribourg: Universität Fribourg. http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/forschung/Grundlagenstudie_FBBE_-_Finalversion__edit_13032009_.pdf Das Programm Perry Preschool Project von Prof. James Heckman und andere ähnliche Studien haben Kosten-Nutzenverhältnisse von 1:17 bis 1:2 berechnet. Zusammengefasstes Referat von Prof. Daniel Schunk, Universitäten Zürich und Mainz: www.bildungslandschaften.ch/schunk Caritas Schweiz (2013). Mit Chancengleichheit gegen die Armut: Eine Analyse der Frühen Förderung in den Kantonen. http://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Positionspapiere/Caritas_Armutsmonitoring_2013_DE.pdf 12 1.2 Wozu ein umfassendes Konzept? Ein umfassendes Konzept der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist ein unverzichtbares politisches Steuerungsinstrument, ein wichtiger Beitrag zur politischen Meinungsbildung,ein Instrument der Kommunikation und die Grundlage für eine gezielte und durchdachte Umsetzung. Das Konzept zeigt die Vision auf, die eine Gemeinde oder Stadt in Bezug auf die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder hat, welche strategischen Ziele mit welcher Priorität verwirklicht werden und mit welchen Massnahmen diese Ziele erreicht werden sollen. Damit kann ein Dialog entstehen, aus dem eine Vernetzung der Akteure mit einem gemeinsamen pädagogischen Verständnis zum Wohle aller Kinder der Stadt oder Gemeinde resultiert. Mit dem Konzept können alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt oder Gemeinde transparent über die politischen Zielesetzungen und die Angebote der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung informiert werden. 1.3 Grundlage dieses Konzeptes: Das Modell Primokiz Dieses Kapitel entspricht dem Kapitel 3.1 der Situationsanalyse. Auch hier ist das Ziel aufzuzeigen, dass die Stadt oder Gemeinde nicht beliebig agiert, sondern auf ein wissenschaftliches Modell zurückgreift. Ob das Modell Primokiz hier nach der Situationsanalyse nochmals aufgezeigt wird, hängt von der Situation und dem Vorgehen in der Stadt oder Gemeinde ab. Das vorliegende Konzept basiert auf einer wissenschaftlichen Grundlage, dem „Modell Primokiz“. Dieses Modell, das im Auftrag der Jacobs Foundation vom Marie Meierhofer Institut für das Kind für das Programm Primokiz entwickelt wurde, beschreibt die Merkmale und Inhalte einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. - www.jacobsfoundation.org/modellprimokiz (deutsch) www.jacobsfoundation.org/modelloprimokiz (italienisch) www.jacobsfoundation.org/modeleprimokiz (französisch) Das Modell Primokiz versteht eine Politik der frühen Kindheit als Politik, die jedem Kind möglichst gleiche Chancen eröffnen und alle Kinder in ihrer Entwicklung fördern will und als gemeinsame Aufgabe des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystems. Diese Systeme bilden gemeinsam die tragenden Säulen einer umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Integrationspolitik, Stadt- und Quartierplanung sowie Familienpolitik sind wichtige transversale Felder einer Politik der frühen Kindheit. Das Modell postuliert ferner, dass sich eine Politik der frühen Kindheit über familien- und kinderfreundliche Rahmenbedingungen für alle bis hin zum Schutz des einzelnen Kindes erstrecken soll. Bedürfnisgerechte Leistungen für alle Kinder und Eltern, für bestimmte Gruppen von Kindern und Eltern sowie für individuelle Kinder und Familien lassen sich in diesem Rahmen verorten. Familienpolitische und integrationspolitische Massnahmen bilden den Kitt zwischen den verschiedenen Ebenen. Damit Kinder und Familien nicht durch die Maschen fallen, setzt das Modell Primokiz ferner auf vertikale und horizontale Kohärenz. Gemeint ist damit erstens die Abstimmung von Leistungen und Strukturen für Kinder einer bestimmten Altersgruppe und zweitens die Gestaltung von Übergängen von der Geburt bis zum Schuleintritt. Eine Politik der frühen Kindheit nimmt dabei auch Angebote und Strukturen in den Blick, die sich nicht prioritär um den Frühbereich kümmern, also z.B. die Sozialhilfe und die Schule. 13 1.4 Wozu eine Konzeptentwicklung in der Stadt oder Gemeinde? Die Kapitel 1.1 bis 1.3 sind allgemein gültig, d.h. sie sind nicht von den Gegebenheiten in einer Stadt oder Gemeinde abhängig. In diesem Kapitel 1.4.sollte nun die spezielle Situation in der Stadt oder Gemeinde aufgezeigt werden, also weshalb die Stadt oder Gemeinde gerade jetzt ein Konzept erarbeitet. Damit werden die Beweggründe und Motivationen aufgezeigt. Hier sollte die Problemlage in der Stadt oder Gemeinde beschrieben werden und aufgezeigt werden, mit welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten die Stadt oder Gemeinde konfrontiert ist und mit welchen Herausforderungen sie in naher Zukunft rechnen muss. 14 2 Ausgangslage: Der Ist- Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Die Ausgangslage beschreibt den IST-Zustand in der Stadt oder Gemeinde. Die Informationen dazu wurden in der Situationsanalyse zusammengetragen und sollen hier nochmals zusammenfassend dargestellt oder aus dem Management Summary oder den Resümees der Situationsanalyse kopiert werden. Allenfalls reicht es auch aus, auf die Situationsanalyse zu verweisen. Die Ausgangslage wird wie in der Situationsanalyse entlang der folgenden Perspektiven dargestellt: Perspektive 1: Kontext Perspektive 2: Angebote und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Perspektive 3: Koordination, Kooperation und Vernetzung Perspektive 4: Qualitätssicherung – Evaluation Perspektive 5: Nachhaltige Sicherung der Leistungen Die Ausgangslage soll so beschrieben werden, dass sich die in Kapitel 3 aufzuzeigenden Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsschwerpunkte bezüglich einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung daraus ableiten lassen. 2.1 Kontext Der Kontext beschreibt die Rahmenbedingungen in einer Stadt oder Gemeinde, innerhalb derer die kommunale frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung geplant werden kann. Hier wird gegenüber der Situationsanalyse eine leicht veränderte Struktur vorgeschlagen. Für die Erarbeitung dieser Beschreibung kann die Tabelle 1 im Anhang genutzt werden. Link 2.1.1 Relevante demografische Kennzahlen Hier werden die Erkenntnisse aus der Situationsanalyse zusammengefasst. Es lohnt sich, die wichtigsten Daten dazustellen und die demographischen Besonderheiten der Stadt oder Gemeinde, wie z.B. die Bevölkerungszusammensetzung, aufzuzeigen, sofern sie einen Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung des Bereichs der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung haben. 2.1.2 Sozialpolitischer Kontext Allenfalls kann hier der sozialpolitische Kontext aufgezeigt werden, sofern er nicht bereits im Kapitel „1.4 Wozu eine Konzeptentwicklung in der Stadt oder Gemeinde?“ anhand der Problemlage und den Herausforderungen beschrieben wurde. 2.1.3 Rechtsgrundlagen Die Rechtsgrundlagen wurden bereits in der Situationsanalyse zusammengetragen. Allenfalls müssen hier die kommunalen und kantonalen Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen, die in diesem Bereich neben den 15 nationalen Grundlagen zu berücksichtigen sind, nochmals aufgeführt und kommentiert werden. Der Kommentar beschreibt, wie diese rechtlichen Grundlagen das kommunale Konzept beeinflussen. 2.1.4 Strukturen Hier können wenn nötig die politischen und administrativen Strukturen einer Stadt oder Gemeinde, die über die Gestaltung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu entscheiden haben, nochmals aufgezeigt werden. Die Informationen können der Situationsanalyse entnommen werden, in der die kommunalen und kantonalen Entscheidungsträger bereits identifiziert wurden. 2.2 Angebote und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Hier sollen zusammenfassend die bestehenden Angebote und Leistungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung aus der Situationsanalyse aufgezeigt werden. Zu den Angeboten und Leistungen gehören auch die Nutzungspfade, also die Beschreibung, ob und wie welche Zielgruppen mit welchen Angeboten in Kontakt kommen (Zugänglichkeit), und die Anlaufstellen für die einzelnen Zielgruppen in der Stadt oder Gemeinde. Für diese Beschreibung kann die Tabelle 2 im Anhang genutzt werden. Link 2.3 Koordination, Kooperation und Vernetzung Hier sollen zusammenfassend die bestehenden Kooperationen und Vernetzungen in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung aus der Situationsanalyse aufgezeigt und erläutert werden, wie sie koordiniert sind. Ausserdem können partizipative Ansätze, z.B. bei der Gestaltung und Entwicklung der Angebote und Leistungen aufgezeigt werden. Für diese Beschreibung kann die Tabelle 3 im Anhang genutzt werden. Link 2.4 Qualitätssicherung und Evaluation Hier sollen zusammenfassend die bestehenden Qualitätssicherungsmassnahmen und bereits durchgeführte Evaluationen oder bestehende Evaluationssysteme aufgeführt werden. Für diese Beschreibung kann die Tabelle 4 im Anhang verwendet werden. Link 16 3 Entwicklungspotential und -bedarf In diesem Kapitel wird die Bilanz aus der Situationsanalyse (IST-Zustand) und den Bedürfnissen der Zielgruppen (SOLL-Zustand) aufgezeigt. In der Bilanz wird deutlich, wo aktuell Stärken und Schwerpunkte sowie allfällige Lücken oder Überschneidungen in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung liegen. Daraus kann ein Entwicklungsbedarf abgeleitet werden. Welche Handlungsschwerpunkte später tatsächlich gesetzt werden, hängt von der konkreten Zielsetzung ab, die aufgrund von bereits bestehenden Visionen oder von der Bilanz abgleitet wird. Ausserdem werden die Möglichkeiten der Stadt oder Gemeinde, seien sie finanzieller, politischer oder anderer Art, die Wahl der Umsetzung stark beeinflussen. Dennoch ist es wichtig, das Entwicklungspotential und den Entwicklungsbedarf umfassend aufzuzeigen, damit der Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung weiterentwickelt werden kann und die Lücken im Angebot, resp. nicht befriedigte Bedürfnisse der Zielgruppen nicht vergessen werden. Möglicherweise wird an dieser Stelle des Konzeptentwicklungsprozesses deutlich, dass spezifische Bedürfnisse der Zielgruppen bezüglich spezifischer Leistungen und bezüglich quantitativer Aspekte des Angebots ungenügend bekannt sind. In diesem Fall muss entschieden werden, welche Bedürfnisse wann und wie erhoben werden sollen. Dies kann entweder dazu führen, dass diese Informationen umgehend erhoben werden und die Situationsanalyse entsprechend ergänzt wird, oder dass die als erforderlich erachteten Bedarfserhebungen als Handlungsbedarf Eingang in das vorliegende Konzept der Stadt oder Gemeinde zur Entwicklung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung finden. 3.1 Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung In diesem Kapitel werden die Angebote und Leistungen, der Zugang dazu und die Mitgestaltungsmöglichkeiten erläutert. Alle Fragen sind im Hinblick auf die Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu beantworten. Für diese Beschreibung kann die Tabelle 5 im Anhang genutzt werden. Link 3.1.1 Vorhandene Angebote und ihre Leistungen In den Blick zu nehmen sind hier das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen (die Säulen des Modells Primokiz) und die Querschnittbereiche Familie, Integration, Bau- und Zonenplanung. Welche Zielgruppen gibt es? Was sind deren Bedürfnisse? Wo liegen die Stärken und Schwerpunkte des bestehenden Angebots? Welches sind die wichtigsten Stärken des Angebots? Was sollte konsolidiert und unbedingt bewahrt werden? Wo gibt es Entwicklungspotential? Was sollte ausgebaut werden? Wo gibt es Schwächen und Lücken? Wo gibt es Überschneidungen? - Welches sind die wichtigsten Schwächen oder Lücken des bestehenden Angebots? Welche Angebote fehlen? Gibt es überflüssige Leistungen aufgrund mangelnder Nachfrage oder aufgrund von Überschneidungen? 17 Wie steht es um die vertikale und horizontale Kohärenz der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? Vertikale Kohärenz: Gestaltung und Begleitung der beiden wichtigen Übergänge „rund um die Geburt“ und „Brücke zur Schuleingangsstufe“ Horizontale Kohärenz: Ergänzung der Angebote für dieselbe Altersgruppe 3.1.2 Zugang zu den Angeboten Zu bedenken sind hier die spezifischen Bedürfnisse bezüglich der Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten und ihren Leistungen für die Zielgruppen „alle Kinder und Familien“ und „bestimmte Gruppen von Kindern und Familien“ sowie für „individuelle Kinder und Familien aufgrund einer bestimmten Indikation“. Dabei zu berücksichtigen sind - die Wege und Mittel, mit denen die Zielgruppen informiert werden; - wo die Leistungen angeboten werden; - wie die Leistungen zeitlich angeboten, resp. organisiert sind. Welches sind die Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich des Zugangs der Zielgruppen zu den Angeboten des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereichs? - Welches sind die bedeutsamsten Stärken? Für welche bestehenden Angebote oder Leistungen und für welche Zielgruppen ist der Zugang mangelhaft? 3.1.3 Partizipation der Akteure Welches sind die Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der Beteiligung der verschiedenen Akteure an der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (Zielgruppen: Eltern und andere Betreuungspersonen, Institutionen und Fachpersonen, politische Verantwortungsträger, Verwaltung)? Welche dieser Stärken und Schwächen sind im Hinblick auf die Beteiligung der verschiedenen Akteure an der Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.2 Entwicklung der Zusammenarbeit und Vernetzung Die Stadt oder Gemeinde kann für die Bilanzierung der Zusammenarbeit und Vernetzung auf die Aussagen im Kapitel 2.4 bzw. auf die Aussagen in der Situationsanalyse zurückgreifen. Für diese Beschreibung kann die Tabelle 6 im Anhang genutzt werden. Link 3.2.1 Strategische Entscheidungsprozesse Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich – – der Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse innerhalb der Stadt oder Gemeinde? der Entscheidungsprozesse auf der politischen Ebene und auf der Ebene der Verwaltung? 18 Welche dieser Stärken und Schwächen der Entscheidungswege sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.2.2 Koordination und Organisation Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der Koordination der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung innerhalb der Stadt oder Gemeinde, mit dem Kanton, mit dem Bund, mit den Trägern von Angeboten und den Leistungserbringern? Worin bestehen Stärken und Schwächen der Stadt oder Gemeinde bezüglich ihrer Mittel und Wege, auf das Angebot Einfluss zu nehmen und die Entwicklung zu steuern? Welche dieser Stärken und Schwächen der Organisation und Koordination sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.2.3 Vernetzung und Zusammenarbeit Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken in der Stadt oder Gemeinde bezüglich – – – der Rollen der verschiedenen Akteure im Hinblick auf eine vernetzte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? der vorhandenen Netzwerke sowie bezüglich deren Funktionieren und deren Nutzung? der bestehenden Formen der Zusammenarbeit im Allgemeinen? Welche dieser Stärken und Schwächen der Vernetzung und Zusammenarbeit sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? Wo hapert die Vernetzung zwischen Angeboten? 3.3 Entwicklung der Qualitätsentwicklung und Evaluation Für diese Beschreibung kann die Tabelle 7 im Anhang genutzt werden. Link 3.3.1 Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses? – – Wie steht es um eine gemeinsame Orientierung und geteilte Referenzen? (Gesetze/Verordnungen, wissenschaftliche Grundlagen, verbindliche professionelle Standards, verbindliche – z.B. kantonale Bestimmungen und Vorgaben u.a.) Stärken und Schwächen der vorhandenen Mittel (Abläufe, Erfassung, Beurteilung), um die Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu unterstützen? 19 – Stärken und Schwächen der Definition einer guten Qualität und deren Durchsetzung? Welche dieser Stärken und Schwächen der Qualitätsentwicklung sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.3.2 Qualitätssicherung von Angeboten und ihren Leistungen Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der Mittel und Wege der Stadt oder Gemeinde, um die Qualität von Angeboten und Leistungen zu sichern, die – – sie selber finanziert oder mitfinanziert? von Dritten finanziert werden? Welche dieser Stärken und Schwächen der Qualitätssicherung sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.3.3 Professionalisierung und Qualifizierung des Personals Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich – – – der Abläufe und Möglichkeiten der Weiterbildung des Personals von Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? der Abläufe und Möglichkeiten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken? der Möglichkeiten, ein geteiltes pädagogisches/ fachliches Verständnis zu entwickeln und zu stärken? Welche dieser Stärken und Schwächen der Professionalisierung und Qualifizierung sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.4 Entwicklung der Nachhaltigkeit Dafür kann die Tabelle 8 im Anhang benutzt werden. Link Die nachhaltige Sicherung einer umfassenden Politik der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist abhängig von – – – – der Initiative, der Beteiligung und dem Engagement aller Akteure, entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und politischen Entscheidungen, der Personalpolitik für den Bereich der frühen Kindheit, ausreichenden finanziellen Mitteln und einem mittel- bis langfristigen Finanzierungsplan. 3.4.1 Gesellschaftliche und politische Verankerung Welches sind die besonderen kommunalen Stärken und Schwächen bezüglich – – – des Engagements der verschiedenen Akteure für die Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? der Dynamik auf der politischen Ebene, auf der Verwaltungsebene, auf der institutionellen Ebene? bereits getroffener Entscheidungen in politischer, organisatorischer und/oder fachlicher Hinsicht? 20 Welche dieser Stärken und Schwächen der politischen und gesellschaftlichen Verankerung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind im Hinblick auf deren Weiterentwicklung besonders bedeutsam? 3.4.2 Rechtliche Grundlagen Worauf stützt sich das heutige Engagement der Stadt oder Gemeinde für den Frühbereich? - Politische Entscheide? Aufträge der Verwaltung? Legislaturziele? Anderes? Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich gesetzlicher Grundlagen und Verordnungen? Welche dieser Stärken und Schwächen des rechtlichen Rahmens sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.4.3 Personal Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der personellen Ressourcen der kommunalen Verwaltung sowie der öffentlichen und privaten Leistungserbringer frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (Stellenplan, Qualifikation, Ausbildung und Nachwuchs)? Welche dieser Stärken und Schwächen der personellen Ressourcen sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 3.4.4 Finanzierung Welches sind die besonderen Stärken und Schwächen oder Lücken bezüglich der aktuellen Finanzierung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? Welche dieser Stärken und Schwächen der Finanzierung sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders bedeutsam? 21 4 Vision, Ziele und Prioritäten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Vision und Ziele sind Beschreibungen eines Zustandes in der Zukunft. Die Vision ist eine langfristige Vorstellung, die oft in einem kraftvollen Bild beschrieben wird. Vision Aus der Vision sollten sich die strategischen Ziele ableiten lassen, die die erwünschten Wirkungen für die Zielgruppen beschreiben. Die strategischen Ziele müssen priorisiert werden, damit klar ist, was besonders wichtig ist und zuerst angegangen werden soll. Strategische Wirkungsziele Die konkreten Handlungsziele beschreiben, was zur Erreichung der strategischen Ziele „produziert“ wird. Auch hier wird ein Endzustand beschrieben. Eine gute Zielformulierung ist - Konkrete Handlungsziele spezifisch (keine vagen Aussagen, denn davon müssen Arbeitsschritte ableitbar sein), messbar (die Veränderung nach Zielerreichung sollte spür- und messbar sein) attraktiv (nur ein lohnenswertes und herausforderndes Ziel wird akzeptiert) realistisch (das Ziel muss möglich und erreichbar sein) terminiert (Klarheit, bis wann das Ziel erreicht werden soll). Wichtig ist, dass die Ziele priorisiert werden. Dies kann einerseits eine zeitliche Priorität sein (was wird zuerst angegangen) und andererseits eine inhaltliche Priorität (was am wichtigsten ist und wofür die eingesetzten Ressourcen zu verwenden sind). 4.1 Werte und Vision Vision im Modell Primokiz: - - Eine vernetzte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung hat die Ermöglichung gelingender Entwicklung und die Prävention von Fehlentwicklungen zum Ziel. Die Basis ist ein Konzept, das sich an den Bedürfnissen und Rechten des Kindes orientiert und seinen Lebens- und Entwicklungsraum sowie soziale und kulturelle Gegebenheiten umfassend in den Blick nimmt. Eine kommunale Politik der frühen Kindheit hat zum Ziel, jedem Kind gerechte Chancen zu eröffnen sowie alle Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, sie zu beteiligen und zu schützen. Sie ist eine gemeinsame Aufgabe des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystems. Sie reicht von der universellen Verhältnisprävention für alle Kinder bis zum Kindesschutz im Bedarfsfall. Eine kommunale Politik der frühen Kindheit stellt quantitativ ausreichende, bedarfsgerechte Strukturen und Angebote für eine frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung innerhalb und ausserhalb der Familie mit einer guten Qualität bereit. Um auf der Grundlage der Entwicklungsmöglichkeiten und des Handlungsbedarfs konkrete Handlungsziele herauszuarbeiten, müssen die Wertvorstellungen vereinbart werden. Darauf basierend kann eine Vision des langfristig anzustrebenden Idealzustandes formuliert werden. 22 Eine gemeinsame Vision beinhaltet eine ausgehandelte Übereinkunft über Sinn und Zweck eines politischen Engagements oder Programms, die Prüfung und Festlegung von Zielen, Mitteln und Wegen sowie Vorstellungen über die angestrebten Wirkungen und Ergebnisse. Indem das Modell Primokiz den Analysen zum Entwicklungsbedarf und dem Entwicklungspotential der Stadt oder Gemeinde gegenüber gestellt wird, kann die Vision der Stadt oder Gemeinde diskutiert, bestätigt, erweitert und revidiert werden. Auf diese Weise kann eine aktualisierte und von allen wichtigen Akteuren geteilte Vision entstehen, welche der Weiterentwicklung des Konzepts einer umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung eine Orientierung gibt. Der Weg zu einer konsolidierten Vision Vision der Gemeinde Entwicklungspotential und -bedarf Konsolidierte Vision Vision des Modells Primokiz In dieser Etappe der Konzepterarbeitung sind partizipative Prozesse und der Einsatz entsprechender Methoden wichtig und lohnend. Die Tabelle 9 im Anhang kann dafür genutzt werden. Link Gibt es bereits eine Vision für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? Wie lautet sie? Wo passt diese Vision zum Modell Primokiz, wo nicht? Wie kann das Modell Primokiz die Vision ergänzen und bereichern? Wo muss und wie kann diese Vision aufgrund der Analyse des Entwicklungsbedarfs und der Entwicklungsmöglichkeiten angepasst werden? Wie lautet die konsolidierte Vision der Stadt oder Gemeinde für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? 23 4.2 Ziele und Prioritäten In diesem Kapitel werden unter Berücksichtigung der konsolidierten Vision sowie der festgestellten Bedürfnisse der Zielgruppen und Entwicklungsmöglichkeiten strategische Ziele formuliert. Sie bauen in erster Linie auf dem Entwicklungspotential des Bestehenden auf und berücksichtigen gegebenenfalls bereits früher festgelegte Ziele. Auch in dieser Etappe der Konzepterarbeitung sind partizipative Prozesse und der Einsatz entsprechender Methoden wichtig und lohnend. Die Tabelle 10 im Anhang kann dafür genutzt werden. Link Welche Grundlagen bilden künftig den Rahmen für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung? - Rechtliche Grundlagen und Aufträge? Fachliche Grundlagen wie Rahmenpläne, Orientierungsrahmen, Branchen- und Verbandsrichtlinien? Wissenschaftliche Grundlagen (Studien, Erkenntnisse)? Kantonale Grundlagen (Konzepte, Vorgaben und Rahmenbedingungen)? Anderes? Welches sind die Ziele der Stadt oder Gemeinde im Hinblick auf eine vernetzte und umfassende frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung unter Berücksichtigung des Modells Primokiz? Welche Ziele sollen auf dem Weg hin zu einer vernetzten und umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zuerst angegangen werden? Welche können und welche müssen noch zurückgestellt werden? - Welches sind Ziele und Prioritäten bezüglich der Entwickung der Angebote und ihrer Leistungen? Bezüglich welcher Zielgruppen? Bezüglich der Zugänglichkeit und der Nutzungsmöglichkeiten? 1. Bezüglich der Partizipation der Akteure bei der Entwicklung der Angebote und ihren Leistungen? Beispiele von prioritären Zielen, welche die Angebote und Leistungen betreffen “Jedes Kind, das in der Stadt Zürich aufwächst, kann sich in den ersten vier Lebensjahren in sozialer, emotionaler, kognitiver, motorischer und sprachlicher Hinsicht möglichst gut entwickeln. Die Startchancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien sind erhöht.” (Sozialdepartement, Gesundheits- und Umweltdepartement, Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich und Tages-Anzeiger. So fördert die Stadt ihre jüngsten Einwohner. 2012, S.15). „Eltern – Ressourcen stärken: frühe Förderung unterstützt Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und begünstigt dadurch ein Umfeld, das die kindliche Entwicklung fördert.“(Bericht und Antrag an den Grossen Stadtrat von Luzern vom 31. August 2011. Frühe Förderung: Prävention und Förderung im Vorschulalter; Strategie und Massnahmen, S. 12). 24 Welches sind die Ziele und Prioritäten bezüglich der Kooperation und der Vernetzung? - Bezüglich strategischer Entscheidungsprozesse? Bezüglich der Koordination und der Organisation von Leistungen? Bezüglich der Vernetzung und der Zusammenarbeit der Anbieter? Beispiel von prioritären Zielen, welche die Kooperation und die Vernetzung betreffen „Institutionen – Zusammenarbeit optimieren, vernetzen: frühe Förderung umfasst Angebote, Massnahmen und Strukturen, welche die gesunde, ganzheitliche Entwicklung von Kindern im Vorschulalter gewährleisten und unterstützen. Das soll innerhalb von Familien ebenso wie familienergänzend geschehen.“ (Bericht und Antrag an den Grossen Stadtrat von Luzern vom 31. August 2011. Frühe Förderung: Prävention und Förderung im Vorschulalter; Strategie und Massnahmen, S. 12). Welches sind die Ziele und Prioritäten bezüglich der Qualitätsentwicklunng und der Evaluation? 2. 3. 4. 5. Bezüglich der Rahmenbedingungen für die Qualitätsentwicklung? Bezüglich der Mittel und Wege für eine abgestimmte Qualitätsentwicklung? Bezüglich der Angebotsentwicklung und der Qualitätssicherung? Bezüglich der Professionalisierung und Qualifikation des Personals? Beispiel eines prioritären Ziels, welches die Qualitätsentwicklung betrifft „Die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure fördert den Austausch von interdisziplinärem Wissen und spezifischen Methoden. Langfristig trägt die gezielte Vernetzung und Kooperation zu koordiniertem Handeln und zur Erhöhung der Qualität bei.“ (Fachstelle Kind und Familie Aarau. Leistungsbericht April 2009 bis November 2011, S. 5-6). Welches sind die Ziele und Prioritäten bezüglich der nachhaltigen Sicherung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? – – – – Bezüglich der politischen und gesellschaftlichen Verankerung? Bezüglich der gesetzlichen Grundlagen? Bezüglich personeller Ressourcen? Bezüglich erforderlicher finanzieller Mittel? 25 5 Umsetzungsstrategie Die Umsetzungsstrategie orientiert sich an den formulierten Zielen und festgelegten Prioritäten. Ihre Erarbeitung baut folglich auf Erkenntnissen und Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 auf. Für alle Dimensionen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung werden strategische Prioritäten gesetzt, wobei der Vernetzung der Angebote und ihrer Leistungen besondere Bedeutung zukommt: 1. 2. 3. 4. Leistung und Angebot Kooperation und Vernetzung Qualitätsentwicklung, Evaluation Nachhaltigkeit. Es ist strategisch vernünftig, in einem bestimmten Bereich auf bereits Bestehendem anzusetzen, und ggf. gleichzeitig in einem anderen Bereich ergänzende Angebote oder neue Abläufe zu entwickeln. Für einen dritten Bereich kann es folgerichtig sein, das Bestehende radikal zu verändern und sogar auf vorhandene Angebote oder Abläufe zu verzichten. Die Umsetzungsstrategie bildet die Grundlage für die konkrete Planung und Umsetzung des Konzeptes. Sie verbindet somit die Zielsetzungen mit den operativen Schritten, die zu deren Erreichung erforderlich sind. In der Umsetzungsstrategie werden die erforderlichen Mittel definiert und somit beinhaltet sie: was verändert, entwickelt, besser genutzt, vervollständigt werden soll, wer – welche Akteure und Stellen – die Veränderungen realisieren soll, wie – mit welchen Prozesse und finanziellen Ressourcen – die Umsetzung vollzogen werden soll. Definiert werden ausserdem – passend zu den formulierten Prioritäten – Meilensteine bezüglich der Etappierung der Konzeptumsetzung und der entsprechenden Massnahmen. Berücksichtigt sind in der zeitlichen Planung die nötigen Ressourcen sowie Abläufe und Fristen für deren Bereitstellung. Bedacht wird ferner, wo eine Stärkung oder Anpassung der rechlichen Grundlagen nötig und zweckmässig ist. In der Umsetzungsstrategie sind die verschiedenen aktuellen und möglichen zukünftigen Akteure der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung mitbedacht. In der Etappe der Strategieentwicklung sind partizipative Prozesse und der Einsatz entsprechender Methoden wichtig. Der Einbezug der Zielgruppen und praxisnaher Akteure erlaubt es, die Bedürfnisse und Bedingungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung angemessen zu berücksichtigen. Dies ist nicht nur für diese Etappe, sondern ebenso für die folgende Umsetzungsphase nützlich. Der Weg zur Entwicklung einer Umsetzungsstrategie Strategische Prioritäten bezüglich: - Leistung und Angebot - Kooperation und Vernetzung - Qualitätsentwicklung, Evaluation - Nachhaltigkeit Ansatz beim Bestehenden: - stärken - vervollständigen - verändern - initiieren, erneuern - aufgeben - übertragen, verschieben Erforderliche Mittel in Bezug auf - Rechtliche und politische Basis - Ressourcen - Institutionen/Stellen - Inhaltliche Programme 26 5.1 Strategie zur Veränderung der Angebote und ihrer Leistungen Aufbauend auf den Ergebnissen von Kapitel 3 wird hier definiert, was bezüglich der Angebote und deren Leistungen verändert oder beibehalten werden soll, um die Vision und die Zielsetzungen, wie in Kapitel 4 formuliert, zu realisieren. Für die Angebotsentwicklung in der Stadt oder Gemeinde sind dabei die folgenden Fragen zentral: 1. 2. 3. Wie kann es gelingen, die Bedürfnisse der Gesamtheit der Kinder und Familien und die Bedürfnisse spezfischer Zielgruppen zu berücksichtigen? Welche Prioritäten bezüglich der künftigen Angebotslandschaft frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sind festgelegt? Welche Möglichkeiten hat die Stadt oder Gemeinde in politischer, organisatorischer, finanzieller Hinsicht, um ihre Ziele zu erreichen? Die Angebotslandschaft soll sich künftig bestmöglich an den Kriterien einer vernetzten und umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, wie sie vom Modell Primokiz vorgeschlagen sind, ausrichten. Die strategischen Überlegungen berücksichtigen deshalb insbesondere: 1. 2. 3. 4. 5. 6. die drei hauptsächlichen Säulen der frühkindlichen Bildung, Betreung und Erziehung, also das Gesundheits, Bildungs- und Sozialwesen, die transversalen Felder der Familien- und Integrationspolititk sowie die Raum- und Quartierplanung, die Präventionsebenen und in der Realität vorkommende Kombinationen der genannten Ebenen: universelle Massnahmen für alle Kinder, selektive Massnahmen für bestimmte Gruppen von Kindern, präventive Massnahmen und Inverventionen aufgrund einer bestimmten Indikation für ein individuelles Kind, die horizontale Kohärenz mit einer ausreichenden Vernetzung der Leistungen für eine bestimmte Lebensphase, die vertikale Kohärenz, welche die Kontinuität von Leistungen und die Gestaltung von Übergängen im biografischen Verlauf beinhaltet, eine gute Zugänglichkeit der Angebote und ihrer Leistungen für die gesamte Zielgruppe, insbesondere aber für diejenigen Untergruppen, für die der Zugang erschwert ist. Hier geht es u.a. um die Bekanntheit der Angebote, um ausreichende und eventuell in verschiedene Sprachen übersetzte Informationen dazu sowie um eine passende Organisation der Angebote bezüglich Ort, Öffnungszeiten und Kosten. Wie kann die Passung zwischen Bedürfnissen der Gesamtheit der Kinder und Familien sowie spezifischer Gruppen von Kindern und Familien und der effektiven Nutzung vorhandener Anbote und ihrer Leistungen verbessert werden? In welcher Hinsicht soll das Angebot besser auf welche spezifische(n) Zielgruppen abgestimmt werden? Wie soll das geschehen? Wie kann sicher gestellt werden, dass die Integration der jeweiligen Gruppen unterstützt wird, ohne dass Angebote in unerwünschter Weise zur Segregation beitragen? Wie soll die Partizipation der Akteure, insbesondere der Eltern, Kinder und Familien, an der Entwicklung und Gestaltung der Angebote und ihrer Leistungen aufrecht erhalten oder verbessert werden? Welches sind bezüglich der Angebotsentwicklung die Grenzen und Möglichkeiten der Stadt oder Gemeinde im Hinblick auf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. die Bewilligungs- und Aufsichtsfunktion, Finanzierung, Subventionen, Leistungsvereinbarungen, öffentlich-private Partnerschaften, den gesellschaftspolitischen Kontext, die Finanzlage, die Gesetzgebung und Aufträge, den Zeithorizont? 27 5.2 Strategie zur Verbesserung der Kooperation und Vernetzung Ebenfalls aufbauend auf den Ergebnissen des Kapitels 3 wird hier definiert, welche Akteure zur Umsetzung des Konzepts in welchen Bereichen und zu welchen Zeitpunkten und in welcher Rolle beitragen können. Auch hierbei dienen die Vision und die Zielsetzungen, wie sie in Kapitel 4 formuliert sind, als Orientierung. Die Arbeit im existierenden und/oder zu entwickelnden Netzwerk ist ein integraler Bestandteil der Strategie zur Entwicklung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Berücksichtigt wird deshalb die Vernetzung – zwischen den verschiedenen Anbietern, – zwischen den Anbietern und der Verwaltung, – zwischen bestimmten Themenfeldern der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, – zwischen den Säulen und Präventionsebenen gemäss dem Modell Primokiz (vgl. Kap. 1.3). Im Instrument zur Situationsanalyse wird in Anhang 2 eine Liste von möglichen Akteuren zur Verfügung gestellt. Da eventuell Veränderungen vorgesehen sind, welche die Rolle, den Status, die Verantwortlichkeiten von Akteuren und die Gestaltung der Leistungen betreffen, sind die betreffenden Akteure einzubeziehen. Da für die Erarbeitung der Situationsanalyse und des Konzeptes bereits partizipative Prozesse stattgefunden haben, dürfte sich bereits eine entsprechende Kultur etabliert haben. Es gilt folglich, diese zu pflegen und dabei die Erwartungen seitens der Akteure des Feldes, der Zielgruppen sowie der Stadt- oder Gemeindeverwaltung und der Politik zu berücksichtigen. Aus der erarbeiteten Umsetzungsstrategie wird ersichtlich, wer was zu folgenden Themen beitragen kann: – – – – – – zur Weiterentwicklung einer vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung generell, zur angestrebten Weiterentwicklung der Angebote und ihrer Leistungen, zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, zur Professionalisierung und zur Qualifizierung des Personals, zur Arbeit im Netzwerk, besonders zur multidisziplinären Vernetzung und Kooperation, zur Koordination auf allen angesprochenen Ebenen. Wie können die identifizierten Akteure sich mit ihren aktuellen Rollen sowie ihren Kompetenzen und Ressourcen in den angestrebten Entwicklungsprozess in den folgenden Bereichen einbringen: - in Politik und Verwaltung? in öffentlichen und privaten Institutionen? als private Träger? als Fachpersonal der Angebote im Bereich der frühkindlichen Bildung? als Eltern? als Kinder? 5.3 Strategie zur Qualitätsentwicklung und zur Evaluation Hier wird mit Bezug zum Kapitel 3 definiert, welche Methoden und Wege der Qualitätsentwicklung und sicherung im Hinblick auf eine umfassende und vernetzte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung nötig sind. Wiederum liefern die Vision und die strategischen Ziele die Orientierung dafür. Ferner sind Überlegungen aufgeführt, über welche ihrer Leistungen und Steuerungsprozesse die Stadt oder Gemeinde die Qualitätsentwicklung und -kontrolle beeinflussen kann und will (Bewilligungsverfahren, Aufsicht, Leistungvereinbarungen, weitere Unterstützung für Anbieter von Leistungen, öffentlich-private Partnerschaften, kommunale Angebote und Leistungen für die Zielgruppen). Die Fragen sind sehr detailiert. Es ist zu überlegen, ob Fragen im Rahmen einer Evaluation geklärt werden sollen. In diesem Fall ist die Finanzierung der Evaluation zu planen. 28 Wie und mit welchen Massnahmen sollen die betroffenen Akteure über die Erwartungen der Stadt oder Gemeinde bezüglich Qualitätssicherung auf den verschiedenen Niveaus und hinsichtlich verschiedener Qualitätsdimensionen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung klar und transparent informiert werden? Wie werden die folgenden qualitativen Bestrebungen berücksichtigt: – – – – Die Entwicklung einer geteilten Orientierung (z.B. Leitbild), welche den Kriterien einer umfassenden frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung dem Modell Primokiz entsprechen? Die Qualitätsentwicklung der Angebote und ihrer Leistungen hinsichtlich einer geteilten pädagogischfachlichen Orientierung? Die Qualitätsentwicklung der Angebote und ihrer Leistungen bezüglich bestehender Standards und wissenschaftlich belegter Qualitätskriterien? Die professionelle Qualifikation und entsprechende Weiterbildung des Personals? Welche Werkzeuge, Abläufe und Methoden muss die Stadt oder Gemeinde bereit stellen, um ihren Ansprüchen der Qualitätssicherung auf den verschiedenen Ebenen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht zu werden? Wo steht für die Stadt oder Gemeinde die Kontrolle der Qualität und wo die Unterstützung der Qualitätsentwicklung im Vordergrund? Welche Institutionen oder Stellen sollen mit der Qualitätssicherung zu tun haben? Mit welchen zugeordneten Rollen? (Verwaltungsstellen, Forschungs- oder Fachinstitutionen, Expertengruppen, Steuergruppen, Kommissionen, Träger von Angeboten etc.)? Wie und von wem sollen Qualitätskriterien wofür definiert werden? Welche partizipativen Prozesse sollen die Qualitätsentwicklung gewährleisten? Wie wird die Passung zwischen den Bedürfnissen der Zielgruppen und den Antworten darauf evaluiert und sicher gestellt? Welche Bedürfnisse welcher Zielgruppen sollen in welchen Abständen erhoben werden? Im Hinblick auf welche Fragen sollen die Angebote und ihre Leistungen evaluiert werden? Welche Abläufe sollen im Hinblick auf welche Fragen evaluiert werden? 5.4 Strategie zur Stärkung der rechtlichen Basis Ausgehend von den entsprechenden Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 wird hier dargestellt, ob und wenn ja welche gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden müssen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Bedacht werden dabei der Angebotsausbau, die Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen, die Qualitätssicherung und die Finanzierung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. 29 6 Finanzierung und Personal 6.1 Personelle Ressourcen In diesem Kapitel wird dargestellt, mit welchem personellen Bedarf zur Umsetzung des Konzepts und zur Erreichung der Ziele einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu rechnen ist. Das Vorhandensein ausreichender personeller Ressourcen ist im Bereich der frühen Kindheit in mehrfacher Hinsicht ein sensibler Punkt. Das Personal ist ein erheblicher Kostenfaktor, der den politischen Willen, eine integrale Politik der frühen Kindheit zu entwickeln, bremsen kann. Die mittel- und langfristige Kostenersparnis von Anstrengungen für eine gute Versorgung von jungen Kindern ist zwar wissenschaftlich belegt, insbesondere bei Kindern, die in wenig privilegierten Familienverhältnissen aufwachsen, doch die Investitionen in die frühe Kindheit rechnen sich allerdings erst mit der Zeit. Arbeitspensen, die zu den Aufgaben des Personals passen, und Personal, das über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen verfügt, sind der Schlüssel für eine gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Sie hängt unmittelbar mit einer gelingenden Entwicklung der direkt und/oder indirekt betroffenen Kinder zusammen. Die Sicherstellung der beruflichen Kenntnisse und Kompetenzen des Personals bedingt Investitionen in ihre kontinuierliche Weiterbildung. Welcher personelle Bedarf ist mit der Konzeptumsetzung wann verbunden? In der Verwaltung? Im Feld für die Erbringung der Leistungen für die Gesamtheit der Zielgruppe und für spezifische Zielgruppen? Welche personellen Ressourcen für die Umsetzung des Konzepts und der darin fomulierten Massnahmen sind nötig: 7 8 für die Planung und die Koordination, für die Information, für die Zusammenarbeit und das Netzwerk, für die Steuerung (Bedarfserhebungen und Evaluation der Wirksamkeit umgesetzter Massnahmen), für die Qualitätssicherung, für Weiterbildungen und Supervision? für die Sicherung und Verbesserung der Angebote und ihrer Leistungen einer umfassenden und vernetzten frühkindlichen Bildung Betreuung und Erziehung? Wofür reichen die vorhandenen personellen Ressourcen? Welche zusätzlichen personellen Ressourcen sind wofür nötig? Mit welchen Pensen? Mit welchen Qualifikationen und Kompetenzen? Wann und mit welchem Zeithorizont? 30 6.2 Kosten und Finanzierungsplan Jede Massnahme zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten und jede Massnahme, welche die Abläufe und die Qualitätssicherung betrifft, kann mit Kosten verbunden sein. Im vorliegenden Kapitel wird der Aufwand eingeschätzt und ein entsprechender Finanzierungsplan entwickelt. Die Finanzierung der Konzeptumsetzung ist eine transversale Aufgabe der beteiligten Politikfelder und Verwaltungseinheiten. Deshalb sind hier auch bestehende und anzustrebende Kooperationen und Vereinbarungen zwischen den politischen, öffentlichen und privaten Akteuren der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung dargestellt. Welche finanziellen Mittel zur Umsetzung des Konzeptes sind auf kommunaler Ebene wann zu erwarten? Welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen im zeitlichen Verlauf? Welche Schritte müssen dafür wann unternommen werden? - - Was ist bereits finanziert? Welche finanziellen Mittel sind für welchen Zeitraum und wofür gesprochen oder in Aussicht gestellt? Welche zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten bestehen wofür und mit welchem zeitlichen Horizont? Welche Verfahren müssen wann eingeleitet, welche Anträge bis wann eingereicht, welche legislativen Verfahren beachtet werden, um zusätzliche Fianzierungen zu erhalten oder eine bestehende Finanzierung anzupassen? Welche Unterlagen sind für die Einreichung von Finanzierungsanträgen nötig (Projektauswertungen, Evaluationen)? Welche Finanzierungsmöglichkeiten und -quellen können wann und wie genutzt werden? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Das ordentliche Budget (unbefristet? befristet? erneuerbar?)? Projektfinanzierung (zeitlich befristet)? Externe Unterstützung durch die öffentliche Hand (Kanton, Bund)? Externe private Unterstützung (Stiftungen, etc.)? Öffentlich-private Partnerschaft(en)? Beteiligung der Nutzer/Zielgruppen: wie beeinflusst sie die Angebotsnutzung? Werden bestimmte Zielgruppen ausgeschlossen? Sind abgestufte Beiträge möglich? Wie können und sollen sich das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen an der Finanzierung der Konzeptumsetzung beteiligen? Welche Aufteilung unter den drei Säulen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist sinnvoll und realisierbar? Welche finanziellen Hürden und Chancen bestehen im gesellschaftspolitischen Kontext, in den gesetzlichen Rahmenbedingungen und bezüglich der Planung des Zeithorizonts? 31 9 Vorgehensweise und Erarbeitungsprozess In diesem Kapitel wird beschrieben, wie dieses Konzept entstanden ist und der Prozess der Erarbeitung reflektiert. 7.1 Projektorganisation Wie war das kommunale Projekt der Konzepterarbeitung organisiert? Welche Personen haben in welcher Funktion mitgearbeitet? Projektleitung, Projekt-Gruppe, Projekt-Beirat, Steuergruppe? Welche Aufträge wurden von Externen bearbeitet? 7.2 Partizipative Prozesse zur Erarbeitung des Konzeptes 8. 9. 10. 11. Wann haben die verschiedenen Aktivitäten stattgefunden? Welche partizipativen Prozesse haben zur Erarbeitung des Konzeptes stattgefunden? Welche Settings wurden gewählt (Sitzungen, Workshops, Hearings, Befragungen etc.)? Welche Personen oder Gruppen haben an den Anlässen teilgenommen? 7.3 Verwendete Instrumente Zur Erarbeitung dieses Konzepts wurde das Instrument „Muster-Konzept - Ein Instrument im Programm Primokiz der Jacobs Foundation, um ein umfassendes Konzept der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in einer Stadt oder Gemeinde zu erstellen“ benutzt. Hier können noch weitere Instrumente oder zusätzliche Unterlagen aufgelistet werden. Allenfalls kann auch auf Tabellen im Anhang verwiesen werden. 7.4 Beratung und Coaching – – Inanspruchnahme von Beratung? Wer? Wofür? Wann und in welchem Umfang? Inanspruchnahme von Referenzstädten? Welche? Wofür? Wie? Wann und in welchem Umfang? 7.5 Abschliessende Reflexion des Konzeptentwicklungsprozesses – – – Was lief gut? Was war schwierig/ harzig? Was hat sich bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Was ist bei der Umsetzung des Konzepts zu beachten? 32 Anhang 1 9.1.1.1 Tabelle 1: Ist-Zustand – Kontext (Kapitel 2.1) Schwerpunkte Dimensionen für jeden Schwerpunkt 2.2.1 Demographische Ausgangsdaten Allgemeine demographische Entwicklung und Entwicklung der Anzahl Kinder zwischen 0 und 6 Jahren Welche demografischen Merkmale und Entwicklungen sind für die Weiterentwicklung des Bereichs der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung wichtig? Erwerbstätigkeit der Eltern Demographische Entwicklung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund Wirtschaftliche Lage (mit Auswirkungen auf die gefährdeten Gruppen)? Andere Dimensionen/Einflussgrössen 2.2.2 Bedarf/Bedürfnisse Bereits bekannte Bedürfnisse Was ist für die Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der bisher identifizierten Bedürfnisse und demographischer Entwicklung wichtig? (genau beziffert) bezüglich Dienstleistungen/Angeboten (je nach Art des Angebots, Qualität und Quantität) (Statistische Untersuchungen und andere Daten, Geschäftsberichte, Analysen von Eltern- und Fachpersonen-befragungen, Wartelisten, Umfragen, Petitionen, Forderungen, etc.). Bedürfnisse / Erwartungen der verschiedenen Akteure (Zielgruppen, Anbieter, Verwaltung, Politik etc.) bezüglich Art, Qualität und Quantität von Angeboten und Leistungen? Bereits identifizierte Bedürfnisse / Erwartungen in Bezug auf Koordination, Partizipation, Vernetzung, Qualität, etc. Wesentliche Elemente der aktuellen Situation / wesentliche Ausgangsdaten für die Entwicklung eines Konzepts für die Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit 33 2.2.3 Soziopolitischer Kontext Aktuelle Schlüsselpersonen? Rollen und Verantwortlichkeiten in der Entscheidungsfindung? Was ist für die Weiterentwicklung wichtig in Bezug auf den soziopolitischen Kontext? Verwaltung? Zielgruppen und Anbieter? Themen/Fragen, die politisch, fachlich, zivilgesellschaftlich Gegenstand von Diskussionen sind? Dynamiken , die es zu beachten gilt? Anstehende Entscheidungen, die es zu beachten gilt? Weiteres? 34 9.1.1.2 Tabelle 2: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Angebote und Leistungen (Kapitel 2.2) Was ist für die Weiterentwicklung bezüglich aktueller Angebote und Leistungen wichtig? Aktuelle Angebote und Leistungen (siehe Liste für die Situationsanalyse) In welchen Punkten/Aspekten sind diese Angebote und Leistungen entscheidend für die Weiterentwicklung/die Zukunft? Zugang und Zielgruppen (siehe Daten der Situationsanalyse) In welchen Punkten/Aspekten sind diese Zugänge und Zielgruppen entscheidend für die Weiterentwicklung/die Zukunft? 35 9.1.1.3 Tabelle 3: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Kooperation, Vernetzung und Partizipation (Kapitel 2.3) Was ist für die Weiterentwicklung wichtig bezüglich Kooperation und Vernetzung? Aktuelle Prozesse für Kooperation, Vernetzung und Partizipation (siehe Antworten in der Situationsanalyse) In welchen Punkten/Aspekten sind diese Prozesse für Kooperation, Vernetzung und Partizipation entscheidend für die Weiterentwicklung/die Zukunft? 36 9.1.1.4 Tabelle 4: Ist-Zustand der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung – Qualitätssicherung und Evaluation (Kapitel 2.4) Was ist für die Weiterentwicklung wichtig bezüglich Qualitätssicherung und Evaluation? Aktuelle Prozesse für Qualitätssicherung und Evaluation (siehe Antworten in der Situationsanalyse) In welchen Punkten/Aspekten sind diese Prozesse für Qualitätssicherung und Evaluation entscheidend für die Weiterentwicklung/die Zukunft? 37 9.1.1.5 Tabelle 5: Entwicklungsbedarf und -potential bezüglich eines umfassenden und vernetzten Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (Kapitel 3.1) Dimensionen des Modells Primokiz Leitfragen für die Reflexion 3.1.1 Aspekt: Verfügbare Leistungen und Angebote Horizontale und vertikale Kohärenz Vernetzung zwischen den Präventionsebenen Integration der wichtigsten Leistungen/Angebote Zielgruppen und Bedarfsermittlung Ist die horizontale Kohärenz für eine bestimmte Altersgruppe gewährleistet? Sind die Verbindungen/Schnittstellen ausreichend? Ist die vertikale Kohärenz gewährleistet, um die Entwicklung des Kindes während der gesamten Kindheit zu unterstützen? Ist die Komplementarität zwischen den Angeboten gewährleistet? Sind die Querschnittsbereiche (Familienpolitik, Stadtplanung, Wohnungswesen; Integration) ausreichend mit der FBBE vernetzt, um die vertikale und horizontale Kohärenz zu gewährleisten? Ist die Verbindung zwischen den Angeboten der Präventionsebenen gewährleistet? Sind die wichtigsten Angebote/Leistungen eindeutig identifiziert? Sind sie ausreichend in eine Entwicklungsstrategie für FBBE integriert? Sind die Zielgruppen klar definiert? Werden die Zielgruppen hinreichend erreicht? Sind die Angebote für alle drei Präventionsebenen ausreichend? Sind die Bedürfnisse der Bevölkerung hinreichend bekannt? (Wie) werden diese bezüglich Quantität und Qualität erfasst? Stärken: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse/Abläufe etc. die aufrechterhalten, beobachtet werden müssen oder auf die man sich für die Entwicklung im frühkindlichen Bereich beziehen kann Problematisches: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse, Abläufe etc. Lücken, Überschneidungen, unpassende, schlecht ausgerichtete Angebote, etc. Zusammenfassung der wichtigsten (Kritik-) Punkte / dringlichster Handlungsbedarf für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 38 3.1.2 Aspekt: Zugänglichkeit der Angebote/Leistungen Mittel und Wege der Information Zugänglichkeit/Erreichbarkeit (Standort, Organisation) Sind die Mittel und Wege der kommunalen Information und der Kommunikation mit den verschiedenen Zielgruppen ausreichend? Sind sie einfach zu nutzen? Sind sie für alle Zielgruppen zugänglich? Sind die Eltern mit der Art der Informationsvermittlung zufrieden? Erreichen die aktuellen Angebote ihre Zielgruppen ausreichend? Ist der Zugang zu den Angeboten den Bedürfnissen der Familien angepasst? Werden die Leistungen an den richtigen Orten erbracht (aufsuchend, institutionsbasiert, im öffentlichen Raum, verschiedene Angebote der FBBE unter demselben Dach)? Ermöglichen Basisangebote Zugang spezifischeren Angeboten? etc.? Was bewährt sich / was weniger um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen? (Direkte Kontaktaufnahme, Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen, etc.) 3.1.3 Aspekt: Partizipation Chancen, Kanäle und Prozesse, um seine Meinung zu äußern Zum Beispiel gibt es eine Bezugsperson / -stelle / ein klares Vorgehen? Wird es angewendet? Mit welcher Wirkung? Sind die Möglichkeiten, die Meinung über die Leistungen /Angebote zu äussern für die Zielgruppen ausreichend? Sind die Möglichkeiten, sich zu den Leistungen/ Angebote zu äussern für die Institutionen und Fachpersonen der FBBE ausreichend? Sind die Möglichkeiten, um sich zu den Leistungen/Angeboten zu äussern für die zuständigen/verantwortlichen politischen Stellen ausreichend? 39 9.1.1.6 Tabelle 6 : Entwicklungsbedarf und -potential bezüglich Kooperation, Vernetzung und Partizipation (Kapitel 3.2) Dimensionen des Modells Primokiz Leitfragen für die Reflexion 3.2 1 Aspekt: Prozess der strategischen Entscheidungen Horizontale und vertikale Kohärenz Beschlussfassung Beratung der verschiedenen Akteure Sind die Verantwortlichkeiten auf politischer Ebene innerhalb der Stadt oder Gemeinde eindeutig für jedes Thema festgelegt? Und für alle politisch Beteiligten an Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit? Sind die Zuständigkeiten innerhalb der Stadt oder Gemeindeverwaltung eindeutig für jedes Thema im Zusammenhang mit Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit festgelegt? Sind die zuständigen Instanzen/Entscheidungsträger bezüglich Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit auf politischer Ebene eindeutig für jedes Thema festgelegt? Sind die zuständigen Instanzen/Entscheidungsträger und Punkte bezüglich Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit innerhalb der Stadt oder Gemeindeverwaltung eindeutig für jedes Thema festgelegt? Sind die wichtigsten Akteure der FBBE ausreichend beraten? (wissenschaftlichen Kenntnisse, Besonderheiten und Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen) Stärken: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse/Abläufe etc. die aufrechterhalten, beobachtet werden müssen oder auf die man sich für die Entwicklung im frühkindlichen Bereich beziehen kann Problematisches: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse, Abläufe etc. Lücken, Überschneidungen, unpassende, schlecht ausgerichtete Angebote, etc. Zusammenfassung der wichtigsten (Kritik-) Punkte / dringlichster Handlungsbedarf für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 40 3.2.2 Koordination und Organisation Koordination mit dem Bund Koordination mit dem Kanton Regionale und überregionale Koordination Koordination innerhalb der Stadt oder Gemeinde Ist die Koordination zwischen den Aktivitäten / Programmen und denn verschiedenen Instanzen des Bundes ausreichend/angemessen? Nutzt die Stadt oder Gemeinde die Unterstützung (auch finanziell) durch den Bund? Ist die Koordination zwischen den Aktivitäten / Programmen und den verschiedenen Instanzen des Kantons angemessen? Ist die Einhaltung der Standards und Vorgehensweisen durch die Stadt oder Gemeinde gewährleistet? Nutzt die Stadt oder Gemeinde die Unterstützung (auch finanziell) durch den Kanton? Ist die Koordination auf regionaler Ebene zweckmässig organisiert? Sind die Mittel der Stadt oder Gemeinde für die Steuerung der Angebote / Leistungen der FBBE angemessen? (Aufsicht / Finanzierung/ Leistungsvereinbarungen etc.) Sind die Ansprechpersonen und Gefässe der kommunalen Verwaltung (Steuergruppe, Fachbeirat etc.) die den Fachstellen der FBBE zur Verfügung stehen angemessen? Funktioniert die Koordination / Zusammenarbeit auf politischer Ebene zwischen dem Bildungs-, Gesundheits-, Sozialwesen sowie den Bereichen Familie und Integration? Funktioniert die Koordination / Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Verwaltung zwischen dem Bildungs-, Gesundheits-, Sozialwesen sowie den Bereichen Familie und Integration? Ist die Koordination zwischen privaten und öffentlichen Stellen ausreichend und sichergestellt? 41 Für die Koordination der FBBE zuständige Stelle der Stadt oder Gemeinde Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten dieser Stelle in Bezug auf die fachliche Arbeit: qualitative und quantitative Weiterentwicklung der FBBE? Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten dieser Stelle in Bezug auf Koordination und Steuerung der Leistungen der Anbieter der FBBE? Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten dieser Stelle in Bezug auf Vernetzung der Akteure der FBBE? Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten dieser Stelle in Bezug auf Information der Zielgruppen und der Öffentlichkeit? 3.2.3 Vernetzung und Zusammenarbeit Rollen und Vernetzung der Akteure (öffentliche und private) Funktionalität und Nutzung der vorhandenen Netzwerke Mittel und Wege für die Zusammenarbeit Sind die Rollen von öffentlichen und privaten Akteuren definiert? Welche sind nicht ausreichend definiert? Ist die Vernetzung der Schüsselakteure ausreichend? Sind die Netzwerke zwischen den Angeboten ausreichend? Funktionieren sie gut genug, um die Zusammenarbeit für eine integrierte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sicher zu stellen? Sind die existierenden Mittel und Wege die Vernetzung zu fördern (z.B. Arbeitsgruppen, Foren, etc.) ausreichend und wirksam? Werden sie genutzt? Vom wem? Wozu? Ist die tägliche Zusammenarbeit ausreichend und definiert? Ist die Zusammenarbeit in speziellen Situationen ausreichend und definiert? 42 9.1.1.7 Tabelle 7: Entwicklungsbedarf und Entwicklungspotential bezüglich Qualitätsentwicklung und Evaluation (Kapitel 3.3) Dimensionen des Modells Primokiz Leitfragen für die Reflexion 3.3.1 Aspekt: Rahmenbedingungen der Qualitätsentwicklung Gemeinsame politische Rahmenbedingungen und Definition von Qualität Legitimierung und Anerkennung Rahmenbedingungen und Vernetzung Qualitätsmasse entsprechend dem Modell Primokiz - Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern; - Beteiligung der 3 Säulen - Beteiligung der übergreifenden Bereiche (Integration, Familie, Wohnen) - Berücksichtigung der Präventionsebenen - Vernetzungsarbeit; - Partizipation; - Evaluation und Qualitätskontrolle Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen, wissenschaftliche Forschung, professionelle Standards, kantonale Konzepte oder Programme, Qualitäts-Standards? Sind die bestehenden Rahmenbedingungen den Institutionen der FBBE ausreichend bekannt? Sind sie den Mitarbeitenden bekannt? Werden sie von ihnen anerkannt? Werden sie angewandt? Sind die bestehenden Rahmenbedingungen den an die FBBE angrenzenden Bereichen ausreichend bekannt? Werden sie angewandt? Betreffen diese Rahmenbedingungen auch die Vernetzungs- und Koordinierungsarbeit: - zwischen den Akteuren der FBBE? - zwischen den Akteuren der FBBE und den angrenzenden Bereichen? Ist die Partizipation der Akteure in die Erarbeitung der Rahmenbedingungen ausreichend gewährleistet Stärken: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse/Abläufe etc. die aufrechterhalten, beobachtet werden müssen oder auf die man sich für die Entwicklung im frühkindlichen Bereich beziehen kann Problematisches: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse, Abläufe etc. Lücken, Überschneidungen, unpassende, schlecht ausgerichtete Angebote, etc. Zusammenfassung der wichtigsten (Kritik-) Punkte / dringlichster Handlungsbedarf für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 43 3.3.2 Aspekt: Entwicklung eines integrierten Ansatzes für Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit Mittel (Verfahren, Instrumente, Massnahmen etc.) um die Entwicklung und Qualität zu überprüfen / unterstützen Verantwortlichkeiten und Beteiligung der Akteure an der Entwicklung von Qualitätsstandards Mittel um die Qualität nach dem Modell von Primokiz zu beurteilen: - Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder? - Partizipation der 3 Säulen der übergreifenden Bereiche? - Massnahmen auf den 3 Ebenen der Prävention ? - Vernetzungsarbeit? - Partizipation? Mittel zur Beurteilung / Entwicklung der Effektivität der Leistungen/Angebote und ihren Interaktionen? Mittel zur Beurteilung / Entwicklung der Fachlichkeit der Mitarbeitenden? Mittel um anerkannte wissenschaftliche Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen? Mittel um eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Verständnis von dem, was Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit bedeutet, zu entwickeln? Sind die Verantwortlichkeiten für die Qualitätssicherung klar definiert? Ist die Zuordnung sinnvoll? Sind die Verfahren der Partizipation der Akteure in die Qualitätsentwicklung der FBBE angemessen? 3.3.3 Aspekt: Entwicklung von Angeboten für Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit Mittel und Methoden, um die Qualität der Leistungen/Angebote zu gewährleisten Sind die Mittel/Methoden der Stadt oder Gemeinde angemessen, um die Qualität der Leistungen/Angebote zu gewährleisten, die direkt von der Stadt oder Gemeinde unterhalten werden? Sind die Mittel/Methoden der Stadt oder Gemeinde ausreichend, um die Qualität der Leistungen/Angebote zu gewährleisten, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden? 44 3.3.4 Aspekt : Professionalisierung und Qualifizierung des Personals Kontinuierliche Schulung des Personals Interdisziplinäre Kooperationen Gemeinsame pädagogische Ansätze Sind die Mittel/Methoden ausreichend, um eine ausreichende Ausbildung des Personals der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu gewährleisten? - Art der Unterstützung? Sind die Möglichkeiten für die Stärkung interdisziplinärer Kooperationen angemessen? Sind sie ausreichend aufeinander abgestimmt: - zwischen den drei Säulen? - mit den Querschnittbereichen? - zwischen den Ebenen der Prävention? Sind die Personen / Instanzen, die für die Organisation interdisziplinärer Kooperationen zuständig sind, klar benannt? Sind die Möglichkeiten zur Entwicklung und Konsolidierung von gemeinsamen pädagogischen Ansätzen ausreichend? 45 9.1.1.8 Tabelle 8: Entwicklungsbedarf und Entwicklungspotential bezüglich Nachhaltigkeit (Kapitel 3.4) Dimensionen des Modells Primokiz Leitfragen für die Reflexion 3.4.1 Gesellschaftspolitische Verankerung Grundlagen der Stadt oder Gemeinde für ihr Engagement für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung Legislaturziele politische Entscheide Aufträge der Verwaltung Koalitionen 3.4.2 Rechtsgrundlagen Rechtsgrundlage für das Engagement der Stadt oder Gemeinde Kommunale Gesetze, Verordnungen Beschlüsse von Exekutive u./od. Legislative Andere: 3.4.3 Finanzierung Finanzierung Finanzielle Beteiligung der Stadt oder Gemeinde? Höhe und Art? Nützlichkeit für die kommunalen Zielsetzungen bezüglich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? Sonstige öffentliche Mittel (Kanton / Bund)? Höhe und Art? Nützlichkeit für die kommunalen Zielsetzungen bezüglich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? Private Finanzierungen? Höhe und Art? Nützlichkeit für die kommunalen Zielsetzungen bezüglich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung? 3.4.4 Personal Personal Innerhalb der Verwaltung für Planung und Koordination der frühkindlichen Bildung Betreuung und Erziehung (Pensum, Qualifikation, Pflichtenheft/Aufgaben etc..)? Für die Leistungserbringung innerhalb der Angebote der FBBE? (Pensum, Qualifikation, Pflichtenheft/ Aufgaben etc..)? Stärken: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse/Abläufe etc. die aufrechterhalten, beobachtet werden müssen oder auf die man sich für die Entwicklung im frühkindlichen Bereich beziehen kann Problematisches: wichtige Angebote /Leistungen, Prozesse, Abläufe etc. Lücken, Überschneidungen, unpassende, schlecht ausgerichtete Angebote, etc. Zusammenfassung der wichtigsten (Kritik-) Punkte / dringlichster Handlungsbedarf für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 46 9.1.1.9 Tabelle 9: Ziele und Prioritäten - Wertvorstellungen und Vision (Kapitel 4.1) Referenzdokument (Jahr) Politische Entscheide Aufträge der Verwaltung Legislaturziele Anderes In den Dokumenten zum Ausdruck gebrachte Sichtweise in Bezug auf: 1. Angebote/Leistungen 2. Zusammenarbeit, Vernetzung und Partizipation 3. Qualität, Evaluation und Partizipation 4. Nachhaltigkeit Mögliche Anpassungen in Bezug auf: 47 9.1.1.10 Tabelle 10: Ziele und Prioritäten (Kapitel 4.2) Dimensionen eines integrativen Ansatzes einer integrierten und vernetzten Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit Aktuelle Schwerpunkte Wie sie zurzeit in den Referenzdokumenten dargestellt sind : - rechtliche Grundlagen - fachliche Grundlagen - wissenschaftliche Grundlagen - kantonale Grundlagen - etc. 1. Dienstleistungen 1.1 Verfügbare Angebote/Leistungen 1. 2. etc. 1.2 Zielgruppen und Rückmeldungen zu den Be1. dürfnissen 2. etc. 1.3 Teilnahme an der Gründung und Organisation 1. von Angeboten/ Leistungen 2. etc. 2. Zusammenarbeit, Vernetzung und Partizipation 2.1 strategischen Entscheidungen 2.2 Strategisch-organisatorische Ebene 2.3 Vernetzung und Zusammenarbeit 3. Qualität, Evaluation und Partizipation 3.1 Kriterien und Vorschriften für die Qualitätsentwicklung 3.2 Mittel und Verfahren für eine kohärente Entwicklung 3.3 Entwicklung von Dienstleistungen und Qualitätskontrolle 4. Nachhaltigkeit 4.1 Soziale und politische Verankerung 4.2 Rechtsgrundlage 4.3 Finanzierung 4.4 Personalressourcen Überarbeitete / angepasste / konsolidierte Ziele In Bezug auf: 10. Vision 11. Bedürfnisse der Bevölkerung 12. Handlungsbedarf Prioritäten Ziele die zuerst angegangen werden sollen Ziele die noch zurückgestellt werden können Ziele die noch zurückgestellt werden müssen 48 Weitere Anhänge In weiteren Anhängen können zum Beispiel wichtige Ergebnisse aus Sitzungen, Workshops, Hearings, Befragungen oder ausführliche Antworten auf bearbeitete Fragestellungen. dokumentiert werden. Marie Meierhofer Institut für das Kind Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich Tel. 044 205 52 20 [email protected] www.mmi.ch Seefeldquai 17, Postfach, 8034 Zürich Tel. 044 388 61 10 [email protected] www.jacobsfoundation.org/primokiz