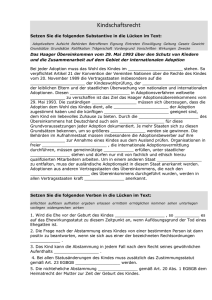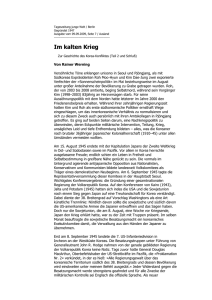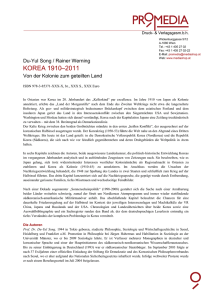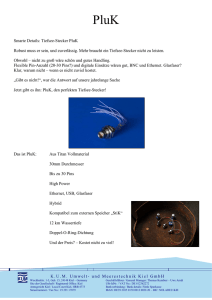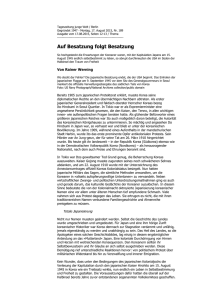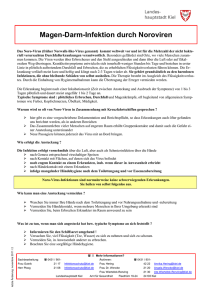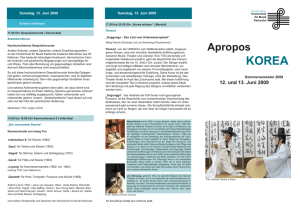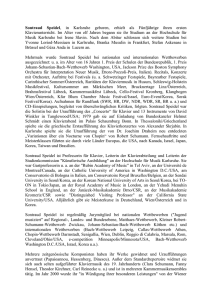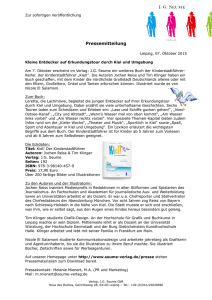Adoption kor
Werbung

Adoption kor http://en.wikipedia.org International adoption of South Korean children The International adoption of South Korean children is a recent historical process triggered initially by casualties of the Korean War after 1953. The initiative was taken by religious organizations in the United States, Australia, and many European nations, and eventually developed into various apparatus that sustained adoption as a socially integrated system. Historical context International adoption of South Korean children started after the Korean War which lasted from 1950 to 1953. When the war was over, many children were left orphaned. In addition a large number of mixed race ‘G.I babies’ (offspring of U.S. and other western soldiers and Korean women) were filling up the country’s orphanages (Jang, 1998). Touched by the fate of the orphans, Western religious groups as well as other associations started the process of placing children in homes in the USA and Europe (Jang, 1998). Adoption from South Korea began in 1955 when Harry Holt, a born again Christian from Eugene, Oregon, went to Korea and adopted eight war orphans (Rotschild, The Progressive, 1988). His work has been followed by the Holt International Children's Services. The first Korean babies sent to Europe went to Sweden via the Social Welfare Society in the mid 1960s. By the end of that decade, the Holt International Children's Services began sending Korean orphans to Norway, Denmark, Belgium, the Netherlands, France, Switzerland and Germany (Hong, Korea Times, 1999). For the next decade, most of the children adopted from Korea were fathered by American soldiers who served in the Korean war. But Amerasians presently account for fewer than 1% of adoptees. Foreign adoptions serve many purposes for the government (Rothschild, The Progressive, 1988). Social context Korean traditional society places significant weight on paternal family ties, bloodlines, and pureness of ‘race’. Children of mixed race or those without fathers are not easily accepted in Korean society (Jang, 1998). Many families would go through excessive and expensive procedures such as surrogacy or in vitro fertilization to ensure that their offspring are at least related than to accept a child of a complete stranger into their family. Indeed, it was the case until recently that Korean citizenship was directly tied to family bloodline. Children not a part of a Korean family (i.e., orphans) were not legal citizens of Korea. Another reason is the stigma of adoption. Ninety-five percent of families who do adopt choose babies less than a month old so that they can pass them off as their natural born offspring, overlooking older adoptable children (Yun, Korea Times, 1997). In addition, most Western countries started to face a shortage of healthy, domestic babies available for adoption in this period, as a result of social welfare programs, legalized abortions and use of contraception. Many Western couples became open to the idea of adopting children from abroad. This was the start of a popular trend which is still present today, as the demand for foreign babies from infertile, upper- and middle class couples in the West is rising (Jang, 1998). The procedure of international adoption is today a growing and often favoured method for couples to build their families and new countries are constantly opening up for international adoption, both as sending and receiving countries. Economic impact Korean adoptees bring in hard currency, which is roughly $15 to $20 million a year. They relieve the government of the costs of caring for the children, which would otherwise be a drain on the budget. And they help with population control. Also, they solve a difficult social problem: What to do with orphans and abandoned children? In 1986, South Korea had 18,700 orphaned or abandoned children. Almost half were sent abroad for adoption, 70% of these to the United States, the rest to Canada, Australia, and eight European nations (Rotschild, The Progressive, 1988). At the time of writing (1988) the amount of $15-20m was significant compared to the spending on social welfare. Some skeptics claim that Korean adoption agencies have established a system to guarantee a steady supply of healthy children. Supporters of this system claim that adoption agencies are only caring for infants who would otherwise go homeless or be institutionalized. While their motives can not be easily determined, their methods are efficient and well-established. Korean adoption agencies support pregnant-women's homes; three of the four agencies run their own. One of the agencies has its own maternity hospital and does its own delivery. All four provide and subsidize child care. All pay foster mothers about $80 a month to care for the infants, and the agencies provide all food, clothing and other supplies free of charge. They also support orphanages, or operate them themselves. Along with advice from 'counselors' at the agencies, this system not only makes the process of giving up a child easier, it encourages it. When the time for departure arrives, the babies are flown to their foreign families. Payments are routine to maternity hospitals, midwives, obstetricians and officials at each of the four agencies acknowledged. The agencies will cover the costs of delivery and the medical care for any woman who gives up her baby for adoption. The agencies also use their influence with hospitals, and with the police, to acquire abandoned children (Rothschild, The Progressive, 1988). Upbringing, identity, and nationalism The adoption abroad of Korean children has been criticized both in and out of Korea. A number of adoptees grow up feeling out of place or alienated from the Western society they are placed in. Despite the fact that many are well adjusted and go on to live happy and successful lives, in Sweden, Korean and other international adoptees are highly overrepresented when it comes to suicide, suicide attempts, mental illness, substance abuse, social maladjustment, crime and other social and personal issues (Hjern et al. 2002). Statistik nach Empfängerländern bis 2001 gerundet: 1. USA 99.000, 2. Frk 11.000, 3. Schweden 8.600, 4. Dänemark 8.400, 5. Norwegen 5.800 …. 12. Dt 2300 http://www.taz.de 29.09.2004 Adoptiert bleibt man ein Leben lang Sie haben einen deutschen Pass und oft auch einen deutschen Namen. Schätzungsweise 30.000 Adoptivkinder kamen in den letzten 30 Jahren aus dem Ausland in eine neue Familie. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte begleitet sie auch dann noch, wenn sie längst keine Kinder mehr sind VON KRISTINE DÖLL Oktober 1978, Flughafen Frankfurt. Vor 36 Stunden war eine Maschine mit über 30 Kindern und zahlreichen Betreuern von terre des hommes in Seoul an Bord gegangen. Einige Kinder landen in Deutschland, empfangen von Menschen, die ihre Eltern werden wollen. Es ist nicht die einzige Maschine, die in diesen Siebziger- und Achtzigerjahren verlassene Kinder aus Korea, Vietnam, aus Afrika und Südamerika nach Europa bringt. Kirsten (Name geändert) ist eine von ihnen. Sie ist eine Deutsche, die in Korea geboren ist. Sie ist mit zehn Monaten nach Deutschland gekommen - damals noch unter dem Namen In-Souk. Heute ist sie 25 Jahre alt und eines der schätzungsweise 30.000 verlassenen Kinder, die seit den Siebzigerjahren aus dem Ausland in deutsche Adoptivfamilien vermittelt wurden. Sie sagt: "Ich hatte nie das Gefühl, schlechter zu sein als andere Kinder." Ihre Mutter arbeitete zu Hause. Schon früh begannen die Eltern, ihr Korea näher zu bringen. Die koreanische Freundin der Mutter, die koreanischen Kollegen ihres Vaters, das koreanische Essen, alles unterstützte Kirsten auf ihrem Weg. Als sie 16 war, fuhren ihre Eltern mit ihr nach Seoul, um ihr das Land zu zeigen, in dem sie geboren wurde. Der Umstand, dass sie Einzelkind ist, kommt ihr zugute. Rückblickend erzählt Kirsten, dass es für sie, ihre Familie und ihre Freunde nie eine Rolle spielte, dass sie ein ausländisches Adoptivkind war. Zweifel, wo sie hingehört, hatte sie nie. Für sie kommen die Probleme nicht von innen, sondern von außen: Unverständnis für die Adoption, rassistische Anfeindungen und vor allem Unwissenheit. Menschen, die nicht wissen, dass es offizielle Vermittlungsstellen gibt, denken, sie sei gekauft. Und immer wieder sei da diese Verwunderung, wenn sie akzentfrei deutsch spricht, sagt Kirsten. Fremd für ihre Umwelt "Ich musste nicht damit kämpfen, weggegeben und adoptiert worden zu sein, ich musste darum kämpfen, als koreanische Deutsche anerkannt zu werden." Wie Kirsten erzählen viele Adoptivkinder, die aus dem Ausland kommen, dass sie immer wieder von ihrer Umwelt an ihr Anderssein, Fremdsein erinnert werden - obwohl ihnen selbst oft erst der Blick in den Spiegel versichert, dass sie anders aussehen als andere. Oft werden diese und andere Probleme der Kinder aus dem Ausland unterschätzt. Dies lässt sich an den Entwicklungen bei der Adoptionsvermittlung erkennen. Deren Intention hat sich in den letzten vierzig Jahren stark gewandelt: "Während sich die Adoptionsbewerber anfangs zumeist aus politisch aufgeschlossenen, sozial engagierten und oftmals religiös oder humanistisch motivierten Kreisen rekrutierten, begann sich Mitte der 1980er-Jahre dieses Profil merklich zu wandeln", erklärt Dr. Bernd Wacker, Adoptionsexperte des Kinderhilfwerks terre des hommes: "Immer mehr unfreiwillig kinderlose Bewerber wurden bei den Jugendämtern vorstellig." Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2003 offiziell 5.330 Kinder unter 18 Jahren adoptiert. 1995 lag die Zahl noch bei 7.969 Kindern. Demgegenüber ist die Zahl der Auslandsadoptionen mit jährlich über 1.700 relativ stabil geblieben - nicht mitgezählt die Kinder, die an den Landesjugendämtern oder den staatlich anerkannten Fachstellen vorbeivermittelt werden, nach Schätzungen von terre des hommes immerhin 30 Prozent. Schließlich ist eine Auslandsadoption für viele die letzte Möglichkeit, zu einem "eigenen" Kind zu kommen. Aufgrund dieser Entwicklung sind seit den Achtzigerjahren zahlreiche neue Adoptionsvermittlungsstellen entstanden. "Mittlerweile treten sich diese Vermittlungen gegenseitig auf die Füße," sagt Maria Holz, Mitarbeiterin des Adoptionsreferats von terre des hommes. Der entstandene weltweite Kindermarkt folge nicht mehr dem Leitspruch "Eltern für Kinder", so Holz. Stattdessen würden mittlerweile häufig eher "Kinder für Eltern" gesucht, das Wohl des Kindes habe nicht mehr Priorität. Noch problematischer sei allerdings, dass es den zahlreichen Vermittlungsstellen an der nötigen Erfahrung fehle, um Bewerber und Kinder fachgerecht zu betreuen. Bei terre des hommes, das 1995 seine Arbeit als Vermittlungsstelle beendet hat, stehen seither Projekte im Vordergrund, die dabei helfen sollen, die Zahl der Adoptierten im Ausland zu minimieren, und Adoptivkinder und ihre Familien betreuen. Die Einrichtung der so genannten "Motherland Tours" beispielsweise bietet seit 1990 den Kindern die Möglichkeit, in ihr Heimatland zu reisen. Im Jahr 2000 fährt Kirsten gemeinsam mit anderen Adoptivkindern auf einer solchen "Tour" ein zweites Mal nach Seoul. Die damals 20-Jährige will sehen, woher sie stammt. Kirsten erfährt: Ihre Geburt war kompliziert. Nach dem Kaiserschnitt fiel die Mutter ins Koma. Als sie aufwachte, wollte sie ihr Kind holen, doch es war schon weg. Ohne ihr Wissen war Kirsten vom Vater und einer Tante zur Adoption freigegeben worden. Der Vater, ein Fischer, hätte eine Familie mit vier Töchtern nicht mehr finanzieren können. Und Kirsten begreift: Sie war nicht schlechter als ein anderes Kind, sie war nur eins zu viel. Da ist noch dieses Land Heute ist Kirsten Krankenschwester. Sie hat ihre Eltern, gute Freunde und einen festen Freund. "Jeder Mensch hat im Leben etwas, womit er klarkommen muss. Bei mir ist es eben, dass ich adoptiert bin. Die Adoption ist Teil meines Lebens, aber nicht der Mittelpunkt", sagt sie. Ganz anders erlebt Martin (Name geändert) sein Leben als Adoptivkind. "Ich konnte nichts mit mir anfangen. Ich habe mich gehasst, und ich habe meine Adoptiveltern gehasst." Martin ist 27 und wurde mit acht Monaten aus Kenia adoptiert. Als er ankam, habe er drei Monate lang nur geschrien, sagt er. Später schien er sich ganz normal zu entwickeln. Doch in der Pubertät traten Probleme auf. Lange Zeit war Martin der Überzeugung, ein schlechtes Kind und ein minderwertiger Mensch zu sein, weil seine leibliche Mutter ihn weggegeben hat. Zu diesem Gefühl der Nutzlosigkeit kommt die Orientierungslosigkeit: Trotz deutscher Eltern und deutscher Sozialisation ist er eben doch ganz anders als andere Kinder. Er ist schwarz, seine Eltern sind weiß. Doch da ist noch dieses Land in Afrika. Ein Land, von dem er nichts kennt als die Umrisse auf der Landkarte. Kenia, sein Herkunftsland. Bisher hat er alles, was mit Kenia zusammenhing, von sich weggeschoben. Auch seine Eltern beschäftigen sich nicht übermäßig mit dem Land, aus dem ihr Sohn kommt. Jahrelang war ihm das auch ganz recht. Als seine Schulkameraden mit zerrissenen Hosen und gefärbten Haaren herumliefen und Punkrock hörten, habe auch er das versucht, erzählt er. Aber irgendwie habe nichts gestimmt, er blieb eben anders als die anderen. Statt diese Erkenntnis zu nutzen, wollte er noch weniger über sich und seine Herkunft wissen, so sagt Martin heute. Er glaubte, wenn er sich nicht mit seiner Adoption beschäftige, dann interessiere es auch keinen anderen mehr. Er bricht den Kontakt zu seinen Eltern ab. Auch sie erinnern ihn daran, dass er ein Adoptivkind ist. Er ist 21, als er eine Reportage über Kenia sieht - nicht über Safaris, wilde Löwen oder die Schönheit der Landschaft, sondern das Leben in den Slums von Nairobi. Das ist der Wendepunkt. Er beginnt zu begreifen, dass er dort niemals die Möglichkeit gehabt hätte, die er in Deutschland hat. "Der Hass auf mich selbst und meine Eltern hatte mich gelähmt." "Adoptiert zu sein bedeutet, zwei Elternpaare zu haben. Adoptivkinder müssen zwei ganz unterschiedliche Identitäten miteinander vereinen. Sie stehen zwischen zwei Welten", sagt der Psychologe Jürgen Stapelmann. Adoptivkinder müssten nicht nur biologische und psychosoziale Beziehungen verbinden, sondern darüber hinaus auch ihre ethnokulturelle Herkunft und Zugehörigkeit integrieren. Ihrer Lebensgeschichte fehle es an Kontinuität. "Die Adoption ist ein lebenslanges Thema. Die Kränkung der Weggabe bleibt. Adoptivkind bleibt man auch dann noch, wenn mal längst kein Kind mehr ist", so Stapelmann weiter. Adoleszenz, Heirat, Schwangerschaft, Geburt und Tod - immer wieder spielen Herkunft und Identität eine wichtige Rolle. "Die Adoptivfamilien haben den Wunsch, eine ganz normale Familie zu sein. Die Tatsache der doppelten Elternschaft darf aber nicht außer Acht gelassen werden," sagt Maria Holz von terre des hommes. Je weniger die Adoptivfamilie die Sonderstellung ihres Kindes akzeptiert und sich mit der Herkunft beschäftigt, desto größer können die Probleme werden, die auf das Kind zukommen, wenn es erwachsen werden will - wobei Holz relativiert: "Auch leibliche Kinder können auf der Suche nach ihrer Identität scheitern." Endlich kehrt Ruhe ein Martin fährt 2002 nach Afrika. Als er in Nairobi aus dem Flugzeug steigt, erfüllt ihn ein Gefühl, was er bisher nicht kannte. Irgendwie ist er angekommen. Obwohl er - als Findelkind - seine leiblichen Eltern nicht kennen lernen kann, kehrt plötzlich Ruhe ein: In Kenia fühlt er sich wohl. Nach der Reise beginnt er eine Therapie. Er beginnt zu begreifen, dass er sein Leben selbst in der Hand hat und er deswegen auch Verantwortung dafür übernehmen muss. "Die Adoption wird immer ein unausweichlicher Teil meines Lebens sein. Sie wird auch weiterhin mein Leben in gewissen Situationen bestimmen, aber ich beginne meine Identität zu formen. Ich bin eben Deutscher mit einem afrikanischen Einschlag." Martin selbst würde nie ein Kind adoptieren. Er glaubt, dass Eltern dafür viel Kraft und Überzeugung haben müssen. "Meine Eltern", sagt er, "hatten diese Kraft nicht, und ich werde sie auch nicht haben." http://www.spiegel.de 21.02.2009 ADOPTION: Das siebte Kind Kein Land der Welt hat so viele Babys exportiert wie Südkorea: zur Adoption für Eltern im Westen, die diese Kinder aus dem Elend holen und sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Nun schämt sich Korea dieser Geschichte, wirbt um die Exilierten – und hofft, sie kehren zurück. Von Sandra Schulz Er ist um fünf Uhr morgens aufgewacht. Er weiß, was er fragen will. Er will wissen: Warum ich? Warum war ich es, das siebte Kind, das abgegeben wurde? Er glaubt zu wissen, was seine Mutter will. Sie will ihn um Vergebung bitten an diesem Tag, 24 Jahre nachdem sie ihn verließ. Seither haben sie sich nicht gesehen. Er kennt die koreanische Vokabel für Mutter, aber ob er sie so nennen wird? Natürlich würde es ihr gefallen, doch selbst wenn, es wäre nicht das Gleiche wie Mama. Mama ist seine amerikanische Mutter. Kiel Hamm ist sein Name, man spricht das Amerikanisch aus, geboren ist er am 3. Juli 1984 in Sungnam, Südkorea, aufgewachsen in einem Vorort von Seattle, USA. "Guten Tag", "danke", "Vater", "Mutter" und "Freut mich, Sie kennenzulernen" kann er auf Koreanisch sagen. Mehr nicht. Melanie Seggewiß spricht Platt, sie hat ihr Leben lang, fast ihr ganzes Leben lang, in Rhede, Kreis Borken, westliches Münsterland, gewohnt. Sie ist Mitglied im Kegel- und auch im Motorradclub, dort sogar im Vorstand. "Auch mein Mann", sagt Melanie, "kommt aus dem Kaff, wo ich herkomme." Sie verbessert sich: "Oder wo ich hingebracht wurde." 35 Jahre ist sie jetzt alt. Ihre Vergangenheit in Korea umfasst nicht mehr als einen Zentimeter, so dick ist die Akte K-8761, die ihre Eltern ihr mit 18 überreichten, zur Volljährigkeit. "First Trip Home" lautet der offizielle Name dieser Reise nach Seoul, zu der sie aufgebrochen sind, Melanie und Kiel und 40 andere Adoptierte. 42 von 160 000 Kindern, die Korea seit 1953 in die Fremde geschickt hat, so viele wie kein anderes Land. Koreas Geschichte als "Baby-exportierende Nation", wie sich die Koreaner schuldbewusst nennen, begann nach dem Korea-Krieg mit der Vermittlung von Waisen und amerikanisch-koreanischen Säuglingen, Soldatenkindern. Doch der Kindertransfer in 15 westliche Gastländer hörte auch nicht auf, als Südkorea längst selbst zur reichen Industrienation geworden war. Vietnam hatte seine Zeit in den Siebzigern; Indien, Kolumbien und natürlich Korea führten in den Achtzigern die Liste der Herkunftsländer an. In den Neunzigern war es Rumänien, später China, Russland, auch Guatemala und die Ukraine, neuerdings kommen Adoptierte oft aus Afrika, vor allem aus Äthiopien. Über 800 000 Kinder wurden in den vergangenen 60 Jahren um die Welt geschickt, mussten sich zurechtfinden in einer fremden Kultur. Wollten früher viele westliche Familien Waisenkindern ein neues Zuhause schenken, so möchten heute viele kinderlose Paare vor allem sich selbst eine Familie schenken. Das Land, das in den letzten 20 Jahren die meisten Adoptierten aufnahm, waren die USA. Korea hat angefangen, sich seiner ehemaligen Staatsangehörigen zu erinnern. Eine koreanische Stiftung, in Kooperation mit dem koreanischen Außenministerium, zahlt Melanie, Kiel und den anderen ihren Flug, lädt sie ein ins Luxushotel nach Seoul. Man wolle, so steht es in der Broschüre der Overseas Koreans Foundation, die Adoptierten darin unterstützen, ihre Herkunftsfamilie wiederzufinden, "als beispielhafte Bürger und Führungspersönlichkeiten im Adoptionsland heranzuwachsen und Stolz zu empfinden, Koreaner zu sein". "Wir sind die, die keiner wollte", solche Sätze hört man im Flugzeug, auf dem "First Trip Home". Am ersten Tag sitzen sie in einem Ballsaal in Seoul, werden begrüßt vom Generalsekretär ihrer Betreuungsorganisation Goal, "Global Overseas Adoptees' Link". Es sind schwarzhaarige junge Leute mit asiatischem Gesicht, doch sie heißen Anne-Mette, Mia, Randy oder Klaus, leben in Dänemark, Deutschland, Australien oder in den USA. Sie sprechen Englisch, das ist ihre gemeinsame Sprache. Die Jüngste ist 19, der Älteste 56 Jahre alt, sie sind selbst Mütter oder Väter, sind verlobt oder verheiratet, aber hier in Korea sind sie vor allem eines: Kinder, Adoptivkinder. Melanie Seggewiß aus Rhede kennt die Summe, die ihre neuen Eltern für sie bezahlten, Betreuungskosten und Flug, 2413 Mark. Den Namen ihrer biologischen Mutter kennt sie nicht. Jeden Tag trägt sie ihre Akte bei sich in Seoul, jedes Detail sei wichtig, um etwas herauszufinden: "Und wenn es nur der Name der Kran-enschwester ist, die mir ein Zäpfchen gab." Am zweiten Tag der Reise steht sie in einem Kinderheim der Vermittlungsagentur, mit der Terre des Hommes auch bei ihrer Adoption zusammengearbeitet hat. Sie nimmt einen Jungen auf den Arm, schaut auf die frischgekämmten Kinder und denkt, das sind die, die in 20 Jahren zurückkommen werden und suchen. "Mein Leben beginnt mit dem Tag, an dem ich im Krankenhaus abgegeben wurde", sagt Melanie. Da wurden zum ersten Mal ihre Daten erfasst. Es war der 15. Juli 1975, Melanie, zwei Jahre alt, hatte Tuberkulose. Vielleicht konnte die Mutter die Behandlung nicht bezahlen. Vielleicht, glaubt Melanie, wäre sie sonst bei der Mutter gestorben. Es tut gut, das zu glauben. Nein, eine Entscheidung "aus Selbstsucht" sei es gewiss nicht gewesen, und doch spricht Melanie von "dieser Tat" und "dieser Last", mit der die Mutter nun lebe. Im "Pre-Flight Child Report", maschinegeschrieben, steht oben das Flugdatum: 4. Dezember 1975, Zielort: Deutschland. Ein Kinderleben auf einem knittrigen Stück Papier, untergliedert in "Essgewohnheiten: Sie isst dreimal am Tag Reis mit Beilagen und Suppe, hat gute Verdauung, Schlafgewohnheiten: Schläft mit gedämpftem Licht und niemals allein, Sprache: Drückt ihre Gedanken in simplen Sätzen aus, Fähigkeiten: Sie tut so, als könnte sie sich selbst anziehen, doch Erwachsene helfen ihr dabei, Persönlichkeit: Sie ist aktiv und fröhlich, attackiert keine anderen Kinder, weint leicht, spielt gern mit dem Puppenhaus". "Chinese, Chinese! Eierkopf mit Käse!", riefen die Kinder in Rhede, doch denen drohte Melanies deutsche Schwester mit Prügel. Irgendwie, sagt Melanie, sei sie auch stolz gewesen, dass sie "ein bisschen was Besonderes" war. Der Preis des Besonderen waren die Kämpfe, die sie mit sich selbst austrug. Nie, sagt Melanie, konnte sie sich richtig für eine Sache entscheiden. Zum Beispiel ihre Frisur: eine Seite lang, eine Seite kurz. Und im Innern nicht koreanisch, nicht deutsch. "Man war immer fifty-fifty." Sie will nichts verlieren. Sie hebt alles auf: Zigarettenschachteln aus Jugoslawien, den löchrigen Pullover, der sie an einen Urlaub erinnert. Ein bisschen unheimlich ist ihr das selbst. Einmal hat sie riesige Müllsäcke vollgestopft mit alten Sachen, nur um die Hälfte wieder herauszuholen. Sogar zum Arzt ist sie deswegen gegangen. Sie weiß noch, als Kind hat sie oft gefragt, ob sie wirklich nicht wieder wegmüsse. "Mehr, als diese Reise zu machen, kann ich nicht tun", sagt Melanie. "Vielleicht räume ich ja Sonntag auf." Sonntag, wenn sie wieder in Deutschland ist. Die, die es wagen, auf so eine Reise zu gehen, sind wohl die Stärkeren, vielleicht auch die Glücklicheren. Doch wer weiß das schon? "Adoptierte sind Meister im Verbergen", sagt Dae Won Wenger, der Goal-Generalsekretär. "Überangepasst" seien viele an ihre westliche, weiße Umgebung, stets bemüht, es anderen recht zu machen. Wenn ich mich nicht anpasse, so die tiefe Angst, werde ich zurückgeschickt. Zu ihm kommen sie, abends meist, die Reisenden, ihm erzählen sie von Depressionen, Schlafstörungen, Drogenproblemen. Er ist ja auch so ein "verpflanztes Wesen", wie Wenger sagt, er kam selbst im Alter von fünf Jahren aus Korea nach Basel, Schweizerdeutsch spricht er perfekt. Er versteht die Wut, die manche packt, wenn die Adoptionsagentur keine Informationen preisgibt. Er versteht das Gefühl von Betrug, wenn sie die Akten sehen, und auch, dass die Phantasie, mit der sie das Dunkel am Anfang füllten, anders ist als die Wirklichkeit. Er kennt nicht nur die Studie aus Schweden, fünfmal häufiger, heißt es da, komme Suizid bei international Adoptierten vor als bei gebürtigen Schweden. Er kannte selbst fünf Adoptierte, die sich umgebracht haben. Es gibt Sätze, die besonders weh tun, sagt Melanie. Sätze, die nur anderen gelten, niemals ihr selbst: "Dir fallen die Haare aus wie Opa. Du hast die Pranken von Papa." In der Schule sollten sie einmal einen Stammbaum malen, es ging um das Thema Gene. Melanie zeichnete den ihrer deutschen Familie, aber es war ein komisches Gefühl. "Ich hatte niemanden, der mir ähnlich sieht." Erst als ihre Tochter geboren war, verschwand das Gefühl. Es war so schön, wenn jemand zu ihr sagte: "Die hat deine Augen." Wenn sie kein Kind bekommen hätte, sagt Melanie, adoptiert hätte sie keines. Denn sie hätte nicht verhindern können, "dass da eine kleine Lücke ist. Da kann noch so viel Liebe nichts dagegensetzen". Es war kurz vor der Geburt ihrer Tochter, als sich der damalige koreanische Präsident Kim Dae Jung offiziell bei den Adoptierten entschuldigte: "Wenn ich euch anschaue, bin ich stolz auf so kultivierte Erwachsene, doch ich bin auch überwältigt von dem Gefühl enormen Bedauerns über all den Schmerz, dem ihr ausgesetzt wart ... Der Grund für die Adoption waren vorrangig ökonomische Schwierigkeiten. Wir sind euren Adoptiveltern dankbar, aber wir sind ebenso erfüllt von Scham." Korea, das ewige Opfer, seit Jahrzehnten geteilt, immer wieder von Großmächten bedrängt, unterdrückt, will auf seine Wunden schauen. Koreanische Filme, Theaterstücke, Popsongs, sie alle machen internationale Adoption zum Thema. Die Regierung führte einen "Adoptionstag" im Mai ein, um das eigene Volk zu ermutigen, koreanische Kinder bei sich aufzunehmen. Solche Kampagnen sind nötig in einem konfuzianisch geprägten Land, wo Blutsbande und Ahnenlinien alles sind und die Menschen davor zurückschrecken, ein fremdes Kind als ihres anzusehen. 2007 lag die Zahl der Inlandsadoptionen erstmals über der der ins Ausland vermittelten. Bis 2012 will die Regierung dafür sorgen, dass Auslandsadoptionen eingestellt werden. Sie kennt den Vorwurf, Korea solle lieber sein Sozialsystem ausbauen, seine ledigen Mütter unterstützen. Und schön ist es auch nicht, wenn man sich von Nordkorea vorhalten lassen muss, der kapitalistische Süden verkaufe sogar seine Kinder. Es ist elf Uhr morgens, Kiel Hamm sitzt am dritten Tag der Reise im Warteraum der Adoptionsagentur, seine Hand zittert. Immer wieder schaltet er das Tonbandgerät ein und aus, er will den Moment für die Ewigkeit bannen, wenn er seine Mutter zum ersten Mal trifft. Das Ticket nach Korea war gekauft, als plötzlich der Anruf kam: Seine Mutter sei gefunden, er habe sechs Geschwister. Kurz darauf las ihm die Adoptionsagentur einen Brief vor, er begann mit den Worten: "Mein liebster Sohn". Und schon am Flughafen von Seoul gab es diese unheimliche Begegnung, eine ältere koreanische Frau starrte ihm sekundenlang ins Gesicht, als versuchte sie, ihn wiederzuerkennen, und Kiel dachte: Vielleicht ist das meine Mutter. Er will sie nicht anklagen. Er will ihr danken. Danke, mein Leben wäre nicht so gelaufen, wenn du nicht diese Entscheidung getroffen hättest. Aber er ahnt, Dank ist nicht das, was seine Mutter hören möchte. Wenn er an die ersehnte, erwartete, eingeforderte Verzeihung denkt, spürt er einen kleinen Widerwillen. Er ist in einer guten Familie aufgewachsen. Er möchte ihr versichern, dass alles in Ordnung ist. So, wie es ist. Meist, hat er von anderen gehört, wolle die koreanische Familie viel Zeit mit dem fremd gewordenen Kind verbringen. "Aber", sagt Kiel, "wir Adoptierten möchten nicht in diese Beziehung hineinspringen." Wer weiß, ob sie überhaupt in Kontakt bleiben, hinterher. Zumindest will er nicht bei seiner Mutter übernachten. Das hat er entschieden. Seltsam, dass er derjenige ist, der entscheidet. Man habe ihm gesagt, bei diesem Trip gehe es allein um ihn. Kiel mag es nicht, wenn alles von ihm abhängt. "Wenn du adoptiert wirst, liegt dein Leben in den Händen anderer." Einen "naiven Optimismus" habe er, sagt Kiel, gerade wegen seiner Adoption. Er glaubt jetzt, dass am Ende immer alles gut wird. Es ist dann eine kleine Frau mit halblangen, lockigen Haaren und einem zarten, feinen Gesicht, die auf ihn zugeht, langsam, mit ausgestreckter Hand, und ihn umarmt, lange. Sie hat die gleichen hohen Wangenknochen wie er. Seine Mutter überreicht ihm die Geschenke: ein Lesezeichen, das er benutzen soll beim Koreanischlernen, einen Schlüsselanhänger mit dem Foto seiner koreanischen Familie und einen goldenen Ring. Kiel hatte ihnen aus Amerika eine Flasche Wein und geräucherten Lachs mitgebracht. "Ich schäme mich ein bisschen dafür", sagt er. Hätte er doch etwas ausgesucht, das mehr Bedeutung hat. Sie haben Kiels Leben wie ein Puzzle zusammengefügt. Kiel hat seiner Mutter ein paar Fotos gezeigt, eine Handvoll Kindheit, mit 10 auf dem BMX-Rad, mit 13 beim Golfspielen, in schwarzer Robe an der Universität, und als seine Mutter die Bilder sah, sagte sie: "Du hast dasselbe Lächeln wie dein Bruder." Sie ist mit ihm in die Nähe ihres alten Hauses gefahren, das Haus selbst gibt es nicht mehr, auch nicht das Entbindungsheim, in dem er geboren wurde. Wenigstens den kleinen Park konnte sie ihm zeigen; ein Weinberg war hier früher, durch den sie jeden Morgen lief, hochschwanger, mit Kiel in ihrem Bauch. Noch am Tag seiner Geburt hatte sie gekellnert, sie verdiente das Geld für die Familie, Kiels Vater, arbeitslos, verschwand mal für Tage, mal für Wochen, irgendwann ganz. Niemand von ihrer Familie war dabei, als sie das Kind zur Welt brachte, das sie auf den Namen Chil Sung taufte. Denn Chil heißt sieben, und die Sieben, sagt man in Korea, bringe Glück. Kiels Mutter wusste, sie würde das Baby nicht behalten. Aus Chil machten die Adoptiveltern Kiel, das klang so ähnlich, ähnlicher zumindest als Andrew, diesen Namen mochten sie auch. Als Schreibweise wählten sie nicht "Kyle", schließlich stammen ihre Vorfahren aus Deutschland, und so wurde das neue Kind aus Korea in eine fremde Familienlinie aufgenommen, trug fortan denselben Namen wie zwei deutsche Städte, Kiel Hamm, und malt heute, an diesem Wintertag in Seoul, sorgfältig und noch ein wenig steif das Schriftzeichen für seinen alten koreanischen Namen auf ein Blatt Papier, zeigt es stolz seiner Mutter. Im Fernsehstudio, zwischen falschen Säulen und künstlichen Rosen, sitzen die, die niemanden gefunden haben. Auf roten Sesseln die, die reden dürfen. Am Rand die anderen, die hoffen, dass sie zwischendurch ins Bild kommen und irgendwo in Korea vor dem Fernseher plötzlich jemand aufspringt. Melanie sitzt in der zweiten Reihe, ein lila Schild auf der Brust mit ihrem koreanischen Namen: Kim Suh Sook. "Ich vermisse diese Person" heißt die Show, produziert nicht nur für Adoptierte, viele Familien wurden nach dem Korea-Krieg auseinandergerissen. Die Quoten sind gut. Vorgestern hat Melanie Seggewiß Haare abgegeben für eine DNS-Probe. Vielleicht, dachte sie, sucht meine Mutter eines Tages in dieser Gen-Datenbank nach mir. Jetzt, sagt sie, bleibt ihr nur noch der Fernsehauftritt , als letzter Versuch. Nacheinander treten sie nun ans Mikrofon, sie erzählen von Narben, hier auf der linken Wange, von Problemen mit dem Bein, eine Amerikanerin hat ihre alten koreanischen Kinderschuhe mitgebracht. Sie erzählen alles, was sie wissen, Fragmente sind es nur. "Mein Vater spielte Karten, meine Mutter servierte Getränke, sie haben mich weggeschickt ... Ich erinnere mich kaum an meine Mutter.""Oh!", raunt das Publikum, ältere Damen in bonbonfarbenen Blazern. "Mein Vater wurde Alkoholiker." "Ohh!" "Meine Mutter starb." "Ohhh! Ohhh!" "Ich bin glücklich und gesund." "Ahhh!" "Ich studiere Jura." "Wow!" "Bitte meldet euch!" Applaus. Zweimal werden kleine Filmchen eingespielt, "Hallo, mein Name ist Melanie Seggewiß", mit trauriger Klaviermusik unterlegt, dazu Babybilder in Schwarzweiß. Es gibt Zuschaueranrufe, ehemalige Nachbarn hätten sich gemeldet für eine Amerikanerin. Für Melanie bleibt am Ende nur ein kurzer Kameraschwenk. Abends, vor der Akrobatik-Show, als sie alle vor dem Theater warten, schaut Melanie zu Kiel hinüber, zu dritt stehen sie da, Mutter, Schwester, Kiel, ein wenig abseits der lärmenden Grüppchen von Adoptierten, sie bilden einen kleinen Kreis, sie sind eine Familie, die zusammen ausgeht. "Ich könnte gerade schon wieder heulen", sagt Melanie. Im Theater waren sie zum ersten Mal allein, Kiel und seine Mutter, ohne Dolmetscher, denn es gibt ja diese seltsame Übereinstimmung in ihrem Leben. Er war in Japan, sie auch, er hat Japanisch gelernt, sie auch, beide arbeiteten sie in einem japanischen Restaurant. Ein wenig können sie sich in der Sprache der ehemaligen Besatzer Koreas unterhalten, doch es sind nur Sätze wie "Bist du hungrig?". Heute Abend aber, es ist ihr letzter gemeinsamer, wollen sie andere Sätze sagen. Sie sitzen in einem Hotelzimmer im 14. Stock, das Licht ist gedämpft. Die Mutter fasst Kiel am Arm, er legt seine Hand auf ihre, und dann erzählt sie von ihrer Reise im vergangenen Sommer, ein Geburtstagsgeschenk seiner Geschwister, eine Reise nach Amerika: Grand Canyon, Los Angeles. Ein paar Monate war das, bevor sie von Kiel hörte. Pause. Die Dolmetscherin übersetzt, macht sich Notizen. Sie habe, fährt die Mutter fort, ihn so vermisst. Sie wusste doch, dass er irgendwo dort ist, in Amerika. "Wann", fragt sie, Tränen laufen über ihr Gesicht, "in welchen Momenten hast du mich vermisst?" "Das ist schwierig zu erklären", sagt Kiel. "Ich habe immer schon davon geträumt, nach meinen leiblichen Eltern zu suchen, und dann habe ich von diesem Trip gehört." Pause, Übersetzung, die Mutter redet. Die Dolmetscherin wiederholt: "Sie hat dich so sehr vermisst, ihr ganzes Leben lang. Sie hat dich nie vergessen. In welchen Momenten hast du sie vermisst?" Kiel: "Ich wusste nicht einmal, ob meine Mutter noch lebt. Ich wusste überhaupt nichts, nichts von ihr, nichts von der Familie." Die Mutter weint. Kiel weint. Sie sitzen nebeneinander auf dem Sofa. Dolmetscherin: "Sie hat sich immer schuldig gefühlt." Kiel: "Ich hatte ein gutes Leben, sie soll sich nicht schuldig fühlen. Auch wenn wir uns nur zwei Tage gesehen haben, sie sind jetzt Teil meines Lebens." Dolmetscherin: "Du meinst, du wurdest zweimal adoptiert?" Kiel: "Nein, nein." Ein Missverständnis, die Mutter streichelt Kiels Hand. Kiel hat seine amerikanische Familie noch nicht angerufen, seitdem er seine koreanische getroffen hat. Der Zeitunterschied, sagt er. Das sagt er jeden Tag. Bis er zugibt, dass er keine Worte hat für das, was ihm widerfahren ist, und jedes falsche Wort wäre wie ein kleiner Verrat. "Wie geht es euch?", ruft die Repräsentantin von der Overseas Koreans Foundation am Tag vor der Abreise in den Saal, fordernd. "Gut", antwortet der Chor der Adoptierten, höflich, doch ein wenig lustlos. "Wie geht es euch?", fragt sie noch einmal, lauter, unerbittlich. "Gut", antwortet der Chor zum zweiten Mal, doch die Frau ist noch nicht zufrieden. "Und ihr kommt wieder, einverstanden?" "Ja", antwortet der Chor zum dritten Mal, brav. 1999 hat die südkoreanische Regierung die Adoptierten als Auslandskoreaner anerkannt, sie dürfen nun zwei Jahre in Korea arbeiten. Die abgeschobenen Kinder von damals sind heute Humankapital – in einem Land mit überalterter Bevölkerung und niedriger Geburtenrate. Etwa 500 Adoptierte haben sich schon im Land ihrer Vorfahren niedergelassen. Doch diese 42 werden morgen erst mal nach Hause fahren. Eine Deutsche hat sich fünf Paar Schuhe gekauft, weil es daheim kaum welche gibt für ihre kleinen Füße. Ein Amerikaner hat mit seiner koreanischen Familie zuckenden Oktopus gegessen und Hund. Kiel Hamm hat ein Getränk entdeckt, das so heißt wie er selbst, und eine Flasche Chilsung Cider eingepackt. Melanie hat in der Karaoke-Bar gesungen, sie hat für ihre Tochter eine koreanische Tracht besorgt, und heute, beim Abschiedsdinner, hat sie es zu den anderen gesagt, auf der Bühne, ins Mikrofon: "Ich gehöre zu euch." Es war ihr erster 100-Prozent-Satz. "Adoptiert zu sein ist ein lebenslanges Thema", sagt Generalsekretär Wenger, der Schweizkoreaner. Mit den Rettungsphantasien mancher Paare, Hauptsache, das Baby ist raus aus dem Elend, kann er nichts anfangen. Wie sehr muss zudem die Last der Dankbarkeit ein "gerettetes" Kind drücken. Es ist doch ohnehin alles schwierig genug. Adoptiveltern, die alles richtig machen wollen, das fremde Kind wie ihr eigenes behandeln und dessen Herkunft verleugnen. Adoptivkinder, die alles richtig machen wollen, sich ihren leiblichen Eltern als ganz koreanisch präsentieren und nur Missverständnisse produzieren. Koreanische Eltern, die alles richtig machen wollen, ihre wiedergefundenen Kinder mit Geschenken überschütten und nur eine Frage provozieren: Wollen die sich freikaufen von ihrer Schuld? Eines, sagt Wenger, sollten die Adoptierten nie tun: bei den leiblichen Eltern wieder einziehen. Zu groß ist die Gefahr des Scheiterns, und dann sind es dieses Mal vielleicht die Kinder, die ihre Mutter verlassen. Am Flughafen haben Kiel und seine Mutter ein Foto gemacht, das trägt sie jetzt immer bei sich, gespeichert auf dem Display ihres Handys, und Kiel trägt ihren Ring an einem roten Band um den Hals. Er nennt sie jetzt "Omma", Mama. Davor hatte er stets von "sie" gesprochen. Könnten Sie "sie" fragen, hatte er die Übersetzerin gebeten. Deswegen war es auch keinem aufgefallen, dass er immer noch nicht genau weiß, wie der Vorname seiner Mutter lautet. Aber er kennt jetzt die koreanischen Wörter für "Bruder" und "Schwester". Zweieinhalb Tage und einen Abend haben sie miteinander verbracht, und Kiel hat eine Antwort gefunden auf seine Frage. "Es waren einfach zu viele, einfach zu viele Kinder zum Aufziehen. Ich war der Wendepunkt." Ja, er habe das alles schon vor dem Treffen gewusst, das mit der Armut, mit seinen sechs Geschwistern. Ja, die Fakten hätten sich nicht verändert. "Aber das ist die Antwort, die ich akzeptiere", sagt Kiel. Er weint. Zum Abschied hat ihm seine Mutter einen neuen Brief mitgegeben. Kiel will ihn nicht übersetzen lassen. Er wird warten, bis er ihn selbst lesen kann, auf Koreanisch. * Links: 1994; rechts: mit ihren Adoptivgeschwistern, 1976. * In Korea, um 1985. * Foto aus der Adoptionsakte, 1975. http://www.csmonitor.com Single moms: In South Korea, adoption remains priority, but attitudes are shifting In South Korea, societal pressure still leads most unwed mothers to give up their children for adoption. But more are keeping their kids, sparking a debate about how to offer support. By Ben Hancock, November 25, 2009 Seoul, South Korea — When Kim Ji-hye rides the bus with her 7-month-old daughter, she often draws stares and overt expressions of concern for the child. That's because Kim is only 18 – and looks it. Being a young unwed mother in South Korea means defying a set of values instilled in this society over the course of centuries. Kim, who asked that her real name not be used, became pregnant in her senior year in high school. Instead of having the abortion her parents demanded, she and the child's father ran away. Still, she says, "I wondered if it was going to be like everyone was saying, that after I gave birth I would have to live on the street like a bum." The reality has not been so bleak, thanks in large part to Aeranwon, a private center that offers preand postnatal support and educational services. But Kim's future is uncertain. She lives with her daughter's father, but has been cut off from her family and does not qualify for state support because she is still a minor. Slow to change attitudes Her plight is familiar to Korea's unwed mothers, who are slowly becoming more visible and demanding more rights. In 2007, there were nearly 8,000 births out of wedlock. About 2,300 of those children were put up for international or domestic adoption, while nearly 2,500 stayed with their mother – a sharp rise from the 472 who stayed with their mother in 1991, which saw a similar number of out-of-wedlock births. Yet cases like Kim's are also at the heart of a debate over how best to offer support. Advocacy groups say the government should give more financial aid to allow unwed mothers to keep their children, thrive, and drive social change. But officials and adoption groups say the priority should be finding homes for kids. One area of disagreement is just how much attitudes have changed. Kwon Hee-jung, of the Korean Unwed Mothers Support Network, says the 1968 movie "Love Me Once Again" indicated attitudes at the time. It depicts an affair between an unmarried woman and a wealthy married man, and ends with her giving up her illegitimate son to the father's family. "Everyone cried but understood," Ms. Kwon says, "They said, 'It has to be like that. How can a woman raise a child alone?' " In recent decades, greater individualism has shifted Korea's Confucian value system, she says, leading to a slow change in the way unwed mothers are viewed and how they view themselves. Still, Kwon acknowledges that a stigma remains. An opinion study early this year by the state-funded Korean Women's Development Institute revealed mixed feelings. The majority of Koreans felt unwed mothers showed poor judgment. Most were also against childbirth outside wedlock, but even more were opposed to abortion. "Right now it's changing slowly," says Kwon. "[T]he social welfare structure is not friendly. There are a lot of women who want to raise their children, but because ... discrimination is so extreme, they end up giving their child away." Low domestic adoption rates Adoptee Stephen Morrison, who founded a group promoting domestic adoption in Korea, paints a different picture. "More often than not," he says, "it's the mothers themselves who cannot live with the shame." According to a government survey in 2005, about 38 percent of women who sent their child for adoption said they would not have done so under better financial circumstances. The government is seeking to expand the number of state-run, single-parent support centers to 16 nationwide from the current six. But it has gotten flak for its perceived emphasis on domestic adoption. Adoptive parents receive about $86 per month. Unwed mothers can receive only half that, depending on income level and only if they are not already on state welfare. Paik Soo-hyeon, an official at the Welfare Ministry, says the government is trying to provide incentives for people to raise those children that unwed mothers cannot support. Korea has one of the world's lowest birthrates, and domestic adoption has long been shunned here due to a strong emphasis on bloodlines and stigmas surrounding infertility. South Korea has sent more than 162,000 children overseas since 1953, when the Korean War ended. Even after 1991, when it was clearly a developed democracy, the number of kids adopted domestically did not surpass those put up for international adoption until 2007 – 1,388 and 1,264 children, respectively. Social pressures on mothers Unwed-mothers advocacy groups allege that adoption agencies sometimes pressure women into giving up their children by citing social stigma, and perpetuate it in the process. Jane Jeong Trenka, a Korean-American adoptee who has pushed for a clear record of Korea's adoption history, says women are often coerced in counseling offered by adoption agencies. Kim, the mother, says she experienced such pressure. Adoption agencies and advocates vehemently deny such accusations. Susan Soon-keum Cox, spokeswoman for Holt, the world's largest international adoption agency, says it's key that birth mothers understand "that they have options." Mr. Morrison says he has "never heard of a case" of coercion. Mr. Paik, the Welfare Ministry official, stresses that social change cannot be made through policy alone: "Asking which direction change should come from is like debating the question of the chicken or the egg. Both society and the government need to move together." Han Sang-soo, head of the Aeranwon unwed mothers shelter, says that attitudes will only really begin to shift when people see unwed mothers can be successful. Kim is working toward her high school diploma equivalent and hopes to become a nurse. "They don't need to worry. I have a good life," she says. http://www.mufilms.org/films/first-person-plural/historical/skadoptions3.php 2000 Deann Borshay Liem A HISTORY OF ADOPTIONS FROM SOUTH KOREA In 1955 Harry Holt, an Oregon farmer, was so moved by the plight of orphans from the Korean War that he and his wife, Bertha, adopted 8 children from South Korea. The arrival of these children to their new home in Oregon received national press coverage, sparking interest among Americans from all over the country who also wanted to adopt Korean children. In partial response, Harry and Bertha Holt created what has become the largest agency in the U.S. specializing in Korean children - Holt International Children's Services which has placed some 60,000 Korean children into American homes. During the same period, the South Korean government began formalizing overseas adoption through a special agency under the Ministry of Social Affairs. For the first decade, the majority of children sent overseas were mixed-race children of American (and other United Nations) military fathers and Korean women. (Biracial children in Korea were called "dust of the streets," a term that illustrates the pervasive negative attitudes in South Korea toward these children.) Soon the practice of placing Korean babies for adoption became institutionalized and over the course of several decades following the Korean War, South Korea became the largest supplier of children to developed countries in the world. An estimated 200,000 South Korean children have been sent overseas for adoption (about 150,000 to the U.S. and the remaining 50,000 to Canada, Europe, and Australia.) In Europe, Korean children have been adopted by families in such countries as Switzerland, Sweden, Norway, Denmark, France, Germany, and Luxembourg. Prior to the Korean War, adoption was not a common practice in Korea. Cultural values emphasized bloodline and if adoptions did take place, they were done within the same family to preserve the family line. However, during the late 1950s and 1960s, with foreign adoptions becoming the primary social policy for orphaned and abandoned children, many distraught parents from poverty-stricken families who could not feed or educate their children abandoned them with hopes of getting them to a Western country. Most of the children adopted during this period were older. Later, in the 1970s and 1980s, industrialization and urbanization brought changing social mores, including increased divorce rates and teen pregnancies. Unlike the period immediately following the Korean War when most adopted children were orphans or had been abandoned, the majority of the children sent for adoption during the 70s and 80s were infants from out-of-wedlock pregnancies. Arrangements for these adoptions typically began in obstetrical clinics where unwed, pregnant, young women (usually poor and working class) were provided pre- and post-natal care. While women were generally not paid for giving up their babies, they were often housed in unwed mothers' homes until the baby's birth and their medical expenses were covered by the adoption agencies. (There are four main adoption agencies in South Korea, all closely regulated by the government: Holt Children's Services, Eastern Child Welfare Society, Social Welfare Society, and Korea Social Service. The Ministry of Health and Social Welfare establishes annual quotas for the number of children that will be released for adoption by each agency. The total quota for 1999 was approximately 2,000. (Source: U.S. Department of State). Meanwhile, in the U.S., legalized abortion, access to reliable birth control methods, greater social acceptance of single parenthood, and other socio-economic factors in the 1970s and 1980s dramatically altered the domestic adoption landscape. The availability of "normal" infants (nondisabled and White) began to decline significantly and the demand from prospective adoptive couples far exceeded the supply of available babies. At the same time, controversies over the adoption of Black children by White parents began to increase. The National Association of Black Social Workers issued a formal position (in the 1970s) opposed to transracial adoption, raising concerns about whether such placements compromised the child's racial and cultural identity and claiming that such adoptions amounted to cultural genocide (see Transracial Adoption Overview). These controversies increasingly led childless couples to look abroad. By this time, legal and administrative arrangements of international adoptions from South Korea had become extremely efficient, reliable, and reportedly free from corruption. These factors, combined with the changes in the domestic adoption market, soon made children from South Korea the most popular alternative to healthy, White American infants. The year 1988 was a turning point in South Korea's adoption history. The Seoul International Olympics attracted the attention of journalists worldwide about many aspects of Korean culture, and much of this attention focused on Korea's primary export: its babies. Journalists like Bryant Gumbel of NBC commented that Korea's primary export commodity was its babies, and articles like "Babies for Export" (The New York Times) and "Babies for Sale: South Koreans Make Them, Americans Buy Them" (The Progressive), embarrassed the South Korean government. North Korea also criticized South Korea's adoption program, pointing out that selling its children to Western countries was the ultimate form of capitalism. As a result, the South Korean government delayed the scheduled departure of adopted children before and during the Olympics. And the number of Korean children adopted by American families began to decrease, from over 6,200 in 1986 to just over 1,700 in 1993. Following the Olympics, the government set up a long-term mandate to cease international adoption by 1996. However, finding limited success with in-country adoptions, the government began to reconsider its policy and decided in 1994 to continue international adoptions for biracial and disabled children. With the recent economic collapse in 1997, policies have changed once again and foreign adoptions of healthy Korean children are again on the rise. While international adoptions have long been associated with wars and destruction, in the case of South Korea, the largest number of children were sent overseas after the country had long recovered from war - the 1980s. The peak was in 1985 when South Korea sent 8,837 children overseas in a single year. Critics of the South Korean adoption program point out that because of the government's reliance on international adoptions, South Korea's social welfare programs for families and orphaned or abandoned children remained under-developed. Lack of support for poor and single-parent families, lack of access to programs like free or affordable childcare, a growing preoccupation with population control, and the continuing dependence on international aid organizations that supported orphanages in South Korea, all contributed to the growth of international adoptions well beyond the crisis of the Korean War period. In addition, cultural attitudes and a pervasive stigma toward orphans, adoption, widows, and single and unwed mothers had a deep impact on relinquishing decisions by birth parents. http//:www.nytimes.com October 8, 2009 Unwed Korean Mothers Start to Assert Their Rights By CHOE SANG-HUN SEOUL -- In 2005, when she found she was pregnant by her former boyfriend, Choi Hyong-sook considered abortion. But when she saw the little blip of her baby's heartbeat on the ultrasound images, she couldn't go through with it. Eight months into her pregnancy, she confided in her elder brother. His reaction would sound familiar to unwed mothers in South Korea. He grabbed Ms. Choi by the hair and tried to drag her to an abortion clinic. Later, he pressed her to give the child up for adoption. ''My brother said, 'How can you be so selfish? You can't do this to our parents,''' said Ms. Choi, 37, a hairdresser in Seoul. ''But when the adoption agency took my baby away, I felt as if I had thrown him into the trash. It felt as if the earth had stopped turning. I persuaded them to let me reclaim my baby after five days.'' Now, Ms. Choi and other women in her situation are working to set up the country's first unwed mothers association to defend their right to raise their own children. It's a small -- only 40 women are involved so far -- but bold first step in a society that ostracizes unmarried mothers. For example, when Koreans want to signal something outrageous, they compare it to ''an unmarried woman seeking an excuse to give birth.'' These women are striking at one of the great ironies of South Korea. The government and social commentators fret over the country's birth rate -- one of the world's lowest with a total fertility rate of 1.19 live births per woman. They deplore its international reputation as a ''baby exporter'' for foreign adoptions. Yet, each year, social pressure drives thousands of unmarried mothers to choose between abortion, which is illegal but rampant, and adoption, which is considered socially shameful but is encouraged by the government. The few women who decide to raise their child risk a life of poverty and disgrace. Nearly 90 percent of the 1,250 South Korean children adopted abroad last year, most of them by American couples, were born to unmarried women. In their campaign, Ms. Choi and the other women have attracted unusual allies. Korean-born adoptees and their foreign families have been returning here in recent years to speak out for the women, who face the same difficulties in today's South Korea as the adoptees' own mothers did decades ago. One such supporter -- Richard Boas, an ophthalmologist from Connecticut who adopted a Korean girl - was helping other Americans adopt foreign children when he visited a social service agency in South Korea in 2006 and began rethinking his ''rescue and savior mentality.'' There, he encountered a roomful of pregnant women, all unmarried and around 20 years old. ''They had already agreed to give their child at delivery to the agency for adoption,'' he said. ''I looked around and asked myself why these mothers were all giving up their kids.'' He founded the Korean Unwed Mothers Support Network, whose work includes lobbying against social bias and for better welfare protection. ''What we see in South Korea today is discrimination against natural mothers and favoring of adoption at the government level,'' said Jane Jeong Trenka, 37, a Korean-born adoptee who grew up in Minnesota. ''Culture is not an excuse to abuse human rights.'' Ms. Trenka -- the author of ''Fugitive Visions: An Adoptee's Return to Korea'' -- now leads Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea, one of two groups organized by Korean adoptees who have returned to their homeland, calling themselves, ''walking, breathing examples of the failure of South Korea to provide a welfare system that gives its children the basic necessities for life with their families.'' They advocate revising adoption laws to enhance the rights of adoptees, such as granting greater access to information about natural parents and banning agencies from taking babies away directly after birth so a mother has more time to consider her decision. http://www.taipeitimes.com Group struggles to end stigma on unwed mothers As South Korea tries to raise its birthrate and curb the number of foreign adoptions, single moms are still ostracized by society By Choe Sang-hun, NY TIMES NEWS SERVICE, SEOUL, Oct 10, 2009 “We don’t see a campaign for unmarried mothers to raise our own children ... Once you become an unwed mom, you’re branded as immoral and a failure. People treat you as if you had committed a crime. You fall to the bottom rung of society.” — Lee Mee-kyong, a 33-year-old unwed mother Four years ago, when she found that she was pregnant by her former boyfriend, Choi Hyong-sook considered abortion. But after she saw the little blip of her baby’s heartbeat on ultrasound images, she could not go through with it. As her pregnancy advanced, she confided in her elder brother. His reaction would sound familiar to unwed mothers in South Korea. She said he tried to drag her to an abortion clinic. Later, she said, he pressed her to give the child up for adoption. “My brother said: ‘How can you be so selfish? You can’t do this to our parents,’” said Choi, 37, a hairdresser in Seoul. “But when the adoption agency took my baby away, I felt as if I had thrown him into the trash. It felt as if the earth had stopped turning. I persuaded them to let me reclaim my baby after five days.” Now, Choi and other women in her situation are trying to set up the country’s first unwed mothers association to defend their right to raise their own children. It is a small but unusual first step in a society that ostracizes unmarried mothers to such an extent that South Koreans often describe things as outrageous by comparing them to “an unmarried woman seeking an excuse to give birth.” The fledgling group of women — only 40 are involved so far — is striking at one of the great ironies of South Korea. The government and commentators fret over the country’s birthrate, one of the world’s lowest, and deplore South Korea’s international reputation as a baby exporter for foreign adoptions. Yet each year, social pressure drives thousands of unmarried women to choose between abortion, which is illegal but rampant, and adoption, which is considered socially shameful but is encouraged by the government. The few women who decide to raise a child alone risk a life of poverty and disgrace. Nearly 90 percent of the 1,250 children adopted abroad last year, most of them by US couples, were born to unmarried women, the Ministry for Health, Welfare and Family Affairs said. In their campaign, Choi and the other women have attracted unusual allies. South Korean-born adoptees and their foreign families have been returning here in recent years to speak out for the women, who face the same difficulties in today’s South Korea as the adoptees’ birth mothers did decades ago. One such supporter, Richard Boas, a Connecticut ophthalmologist who adopted a South Korean girl in 1988, said he was helping other Americans adopt foreign children when he visited a social service agency in South Korea in 2006 and began rethinking his “rescue and savior mentality.” There, he encountered a roomful of pregnant women, all unmarried and around 20 years old. “I looked around and asked myself why these mothers were all giving up their kids,” Boas said. He started the Korean Unwed Mothers Support Network, which lobbies for better welfare services from the state. “What we see in South Korea today is discrimination against natural mothers and favoring of adoption at the government level,” said Jane Jeong Trenka, 37, a South Korean-born adoptee who grew up in Minnesota and now leads Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea, one of two groups organized by adoptees who have returned to their homeland to advocate for the rights of adoptees and unwed mothers. “Culture is not an excuse to abuse human rights,” she said. In 2007, 7,774 babies were born out of wedlock in South Korea, 1.6 percent of all births. (In the US, nearly 40 percent of babies born in 2007 had unmarried mothers, National Center for Health Statistics data shows.) Nearly 96 percent of unwed pregnant women in South Korea choose abortion, the Ministry for Health, Welfare and Family Affairs said. Of unmarried women who give birth, about 70 percent are believed to give up their babies for adoption, a government-financed survey found. In the US, the figure is 1 percent, the Health and Human Services Department reports. For years, the South Korean government has worked to reduce overseas adoptions, which peaked at 8,837 in 1985. To increase adoptions at home, it provides subsidies and extra health care benefits for families that adopt, and it designated May 11 as Adoption Day. It also spends billions of dollars a year to try to reverse the declining birthrate, subsidizing fertility treatments for married couples, for example. “But we don’t see a campaign for unmarried mothers to raise our own children,” said Lee Mee-kyong, a 33-year-old unwed mother. “Once you become an unwed mom, you’re branded as immoral and a failure. People treat you as if you had committed a crime. You fall to the bottom rung of society.” The government pays a monthly allowance of US$85 per child to those who adopt children. It offers half that for single mothers of dependent children. The government is trying to increase payments to help unwed mothers and to add more facilities to provide care for unmarried pregnant women, said Baek Su-hyun, a Health Ministry official. But the social stigma discourages women from coming forward. “My former boyfriend’s sister screamed at me over the phone demanding that I get an abortion. His mother and sister said it was up to them to decide what to do with my baby because it was their family’s seed,” said Chang Ji-young, 27, who gave birth to a boy last month. Families whose unmarried daughters become pregnant sometimes move to conceal the pregnancy. Unwed mothers often lie about their marital status for fear they will be evicted by landlords and their children ostracized at school. Only about a quarter of South Koreans are willing to have a close relationship with an unwed mother as a coworker or neighbor, a recent survey by the governmentfinanced Korean Women’s Development Institute found. Choi said her family changed its telephone number to avoid contact with her. When her father was hospitalized and she went to see him with her baby, she said, her sister blocked them from entering his room. When she wrote to him, she said, her father burned the letters. Last year, about three years after the birth, he finally accepted Choi back into his home. “That day, I saw him in the bathroom, crying over one of my letters,” she said. “I realized how hard it must have been for him as well.” http://www.asian-nation.org September 13, 2007 More Domestic Than International Adoptions in Korea When it comes to the issue of international Asian adoption (usually associated with White American families adopt an Asian child), one of the Asian countries most associated with “sending” large numbers of children to the U.S. is South Korea — close to 50,000 children since 1989 (according to U.S. State Department figures). But the tide seems to be changing — domestic adoption in South Korea have now overtaken international adoptions (thanks to the Transracial Korean Adoptee Nexus for covering it first): About 60 percent of all adoptions were made domestically in the first half of this year, making it the first time for them to surpass overseas adoptions. . . . A ministry spokesman said the “increase” is largely attributed to a new law prioritizing domestic adoption to overseas adoption — rather than changing attitudes towards adoption — as well as tax incentives and campaigns to encourage domestic adoptions. . . . In 2005, Korea was rated the fourth biggest source for overseas adoptions, behind China, Russia and Guatemala _ 2,101 Korean children were adopted by foreign couples in 2005. The government has been making efforts to shake off the country’s reputation as a “baby-exporting” nation but any fruitful results have yet to be observed. As the article notes, I’m not sure what effect this growing trend of domestic adoption will have on the overall numbers of international adoptions (we’ll have to wait for the numbers to come in later), but it is interesting that the government seems interested in trying to change their reputation as a “babyexporting” country. However, perhaps even more interesting is the government official’s statement that the rise in domestic adoptions has more to do with new laws and incentives, rather than changing social attitudes. So as such, it remains to be seen just how much of South Korea’s “baby-exporting” reputation will ultimately change. http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,609300,00.html Adoption: Das siebte Kind Von Sandra Schulz, 21. Februar 2009, DER SPIEGEL 9/2009 Kein Land der Welt hat so viele Babys exportiert wie Südkorea: zur Adoption für Eltern im Westen, die diese Kinder aus dem Elend holen und sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Nun schämt sich Korea dieser Geschichte, wirbt um die Exilierten - und hofft, sie kehren zurück. Er ist um fünf Uhr morgens aufgewacht. Er weiß, was er fragen will. Er will wissen: Warum ich? Warum war ich es, das siebte Kind, das abgegeben wurde? Er glaubt zu wissen, was seine Mutter will. Sie will ihn um Vergebung bitten an diesem Tag, 24 Jahre nachdem sie ihn verließ. Seither haben sie sich nicht gesehen. Er kennt die koreanische Vokabel für Mutter, aber ob er sie so nennen wird? Natürlich würde es ihr gefallen, doch selbst wenn, es wäre nicht das Gleiche wie Mama. Mama ist seine amerikanische Mutter. Kiel Hamm ist sein Name, man spricht das Amerikanisch aus, geboren ist er am 3. Juli 1984 in Sungnam, Südkorea, aufgewachsen in einem Vorort von Seattle, USA. "Guten Tag", "danke", "Vater", "Mutter" und "Freut mich, Sie kennenzulernen" kann er auf Koreanisch sagen. Mehr nicht. Melanie Seggewiß spricht Platt, sie hat ihr Leben lang, fast ihr ganzes Leben lang, in Rhede, Kreis Borken, westliches Münsterland, gewohnt. Sie ist Mitglied im Kegel- und auch im Motorradclub, dort sogar im Vorstand. "Auch mein Mann", sagt Melanie, "kommt aus dem Kaff, wo ich herkomme." Sie verbessert sich: "Oder wo ich hingebracht wurde." 35 Jahre ist sie jetzt alt. Ihre Vergangenheit in Korea umfasst nicht mehr als einen Zentimeter, so dick ist die Akte K-8761, die ihre Eltern ihr mit 18 überreichten, zur Volljährigkeit. "First Trip Home" lautet der offizielle Name dieser Reise nach Seoul, zu der sie aufgebrochen sind, Melanie und Kiel und 40 andere Adoptierte. 42 von 160.000 Kindern, die Korea seit 1953 in die Fremde geschickt hat, so viele wie kein anderes Land. Koreas Geschichte als "Baby-exportierende Nation", wie sich die Koreaner schuldbewusst nennen, begann nach dem Korea-Krieg mit der Vermittlung von Waisen und amerikanisch-koreanischen Säuglingen, Soldatenkindern. Doch der Kindertransfer in 15 westliche Gastländer hörte auch nicht auf, als Südkorea längst selbst zur reichen Industrienation geworden war. Vietnam hatte seine Zeit in den Siebzigern; Indien, Kolumbien und natürlich Korea führten in den Achtzigern die Liste der Herkunftsländer an. In den Neunzigern war es Rumänien, später China, Russland, auch Guatemala und die Ukraine, neuerdings kommen Adoptierte oft aus Afrika, vor allem aus Äthiopien. Über 800 000 Kinder wurden in den vergangenen 60 Jahren um die Welt geschickt, mussten sich zurechtfinden in einer fremden Kultur. Wollten früher viele westliche Familien Waisenkindern ein neues Zuhause schenken, so möchten heute viele kinderlose Paare vor allem sich selbst eine Familie schenken. Das Land, das in den letzten 20 Jahren die meisten Adoptierten aufnahm, waren die USA. Korea hat angefangen, sich seiner ehemaligen Staatsangehörigen zu erinnern. Eine koreanische Stiftung, in Kooperation mit dem koreanischen Außenministerium, zahlt Melanie, Kiel und den anderen ihren Flug, lädt sie ein ins Luxushotel nach Seoul. Man wolle, so steht es in der Broschüre der Overseas Koreans Foundation, die Adoptierten darin unterstützen, ihre Herkunftsfamilie wiederzufinden, "als beispielhafte Bürger und Führungspersönlichkeiten im Adoptionsland heranzuwachsen und Stolz zu empfinden, Koreaner zu sein". "Wir sind die, die keiner wollte", solche Sätze hört man im Flugzeug, auf dem "First Trip Home". Am ersten Tag sitzen sie in einem Ballsaal in Seoul, werden begrüßt vom Generalsekretär ihrer Betreuungsorganisation Goal, "Global Overseas Adoptees' Link". Es sind schwarzhaarige junge Leute mit asiatischem Gesicht, doch sie heißen Anne-Mette, Mia, Randy oder Klaus, leben in Dänemark, Deutschland, Australien oder in den USA. Sie sprechen Englisch, das ist ihre gemeinsame Sprache. Die Jüngste ist 19, der Älteste 56 Jahre alt, sie sind selbst Mütter oder Väter, sind verlobt oder verheiratet, aber hier in Korea sind sie vor allem eines: Kinder, Adoptivkinder. Melanie Seggewiß aus Rhede kennt die Summe, die ihre neuen Eltern für sie bezahlten, Betreuungskosten und Flug, 2413 Mark. Den Namen ihrer biologischen Mutter kennt sie nicht. Jeden Tag trägt sie ihre Akte bei sich in Seoul, jedes Detail sei wichtig, um etwas herauszufinden: "Und wenn es nur der Name der Krankenschwester ist, die mir ein Zäpfchen gab." Am zweiten Tag der Reise steht sie in einem Kinderheim der Vermittlungsagentur, mit der Terre des Hommes auch bei ihrer Adoption zusammengearbeitet hat. Sie nimmt einen Jungen auf den Arm, schaut auf die frischgekämmten Kinder und denkt, das sind die, die in 20 Jahren zurückkommen werden und suchen. "Mein Leben beginnt mit dem Tag, an dem ich im Krankenhaus abgegeben wurde", sagt Melanie. Da wurden zum ersten Mal ihre Daten erfasst. Es war der 15. Juli 1975, Melanie, zwei Jahre alt, hatte Tuberkulose. Vielleicht konnte die Mutter die Behandlung nicht bezahlen. Vielleicht, glaubt Melanie, wäre sie sonst bei der Mutter gestorben. Es tut gut, das zu glauben. Nein, eine Entscheidung "aus Selbstsucht" sei es gewiss nicht gewesen, und doch spricht Melanie von "dieser Tat" und "dieser Last", mit der die Mutter nun lebe. Im "Pre-Flight Child Report", maschinegeschrieben, steht oben das Flugdatum: 4. Dezember 1975, Zielort: Deutschland. Ein Kinderleben auf einem knittrigen Stück Papier, untergliedert in "Essgewohnheiten: Sie isst dreimal am Tag Reis mit Beilagen und Suppe, hat gute Verdauung, Schlafgewohnheiten: Schläft mit gedämpftem Licht und niemals allein, Sprache: Drückt ihre Gedanken in simplen Sätzen aus, Fähigkeiten: Sie tut so, als könnte sie sich selbst anziehen, doch Erwachsene helfen ihr dabei, Persönlichkeit: Sie ist aktiv und fröhlich, attackiert keine anderen Kinder, weint leicht, spielt gern mit dem Puppenhaus". "Chinese, Chinese! Eierkopf mit Käse!", riefen die Kinder in Rhede, doch denen drohte Melanies deutsche Schwester mit Prügel. Irgendwie, sagt Melanie, sei sie auch stolz gewesen, dass sie "ein bisschen was Besonderes" war. Der Preis des Besonderen waren die Kämpfe, die sie mit sich selbst austrug. Nie, sagt Melanie, konnte sie sich richtig für eine Sache entscheiden. Zum Beispiel ihre Frisur: eine Seite lang, eine Seite kurz. Und im Innern nicht koreanisch, nicht deutsch. "Man war immer fifty-fifty." Sie will nichts verlieren. Sie hebt alles auf: Zigarettenschachteln aus Jugoslawien, den löchrigen Pullover, der sie an einen Urlaub erinnert. Ein bisschen unheimlich ist ihr das selbst. Einmal hat sie riesige Müllsäcke vollgestopft mit alten Sachen, nur um die Hälfte wieder herauszuholen. Sogar zum Arzt ist sie deswegen gegangen. Sie weiß noch, als Kind hat sie oft gefragt, ob sie wirklich nicht wieder wegmüsse. "Mehr, als diese Reise zu machen, kann ich nicht tun", sagt Melanie. "Vielleicht räume ich ja Sonntag auf." Sonntag, wenn sie wieder in Deutschland ist. Die, die es wagen, auf so eine Reise zu gehen, sind wohl die Stärkeren, vielleicht auch die Glücklicheren. Doch wer weiß das schon? "Adoptierte sind Meister im Verbergen", sagt Dae Won Wenger, der Goal-Generalsekretär. "Überangepasst" seien viele an ihre westliche, weiße Umgebung, stets bemüht, es anderen recht zu machen. Wenn ich mich nicht anpasse, so die tiefe Angst, werde ich zurückgeschickt. Zu ihm kommen sie, abends meist, die Reisenden, ihm erzählen sie von Depressionen, Schlafstörungen, Drogenproblemen. Er ist ja auch so ein "verpflanztes Wesen", wie Wenger sagt, er kam selbst im Alter von fünf Jahren aus Korea nach Basel, Schweizerdeutsch spricht er perfekt. Er versteht die Wut, die manche packt, wenn die Adoptionsagentur keine Informationen preisgibt. Er versteht das Gefühl von Betrug, wenn sie die Akten sehen, und auch, dass die Phantasie, mit der sie das Dunkel am Anfang füllten, anders ist als die Wirklichkeit. Er kennt nicht nur die Studie aus Schweden, fünfmal häufiger, heißt es da, komme Suizid bei international Adoptierten vor als bei gebürtigen Schweden. Er kannte selbst fünf Adoptierte, die sich umgebracht haben. Es gibt Sätze, die besonders weh tun, sagt Melanie. Sätze, die nur anderen gelten, niemals ihr selbst: "Dir fallen die Haare aus wie Opa. Du hast die Pranken von Papa." In der Schule sollten sie einmal einen Stammbaum malen, es ging um das Thema Gene. Melanie zeichnete den ihrer deutschen Familie, aber es war ein komisches Gefühl. "Ich hatte niemanden, der mir ähnlich sieht." Erst als ihre Tochter geboren war, verschwand das Gefühl. Es war so schön, wenn jemand zu ihr sagte: "Die hat deine Augen." Wenn sie kein Kind bekommen hätte, sagt Melanie, adoptiert hätte sie keines. Denn sie hätte nicht verhindern können, "dass da eine kleine Lücke ist. Da kann noch so viel Liebe nichts dagegensetzen". Es war kurz vor der Geburt ihrer Tochter, als sich der damalige koreanische Präsident Kim Dae Jung offiziell bei den Adoptierten entschuldigte: "Wenn ich euch anschaue, bin ich stolz auf so kultivierte Erwachsene, doch ich bin auch überwältigt von dem Gefühl enormen Bedauerns über all den Schmerz, dem ihr ausgesetzt wart ... Der Grund für die Adoption waren vorrangig ökonomische Schwierigkeiten. Wir sind euren Adoptiveltern dankbar, aber wir sind ebenso erfüllt von Scham." Korea will auf seine Wunden schauen Korea, das ewige Opfer, seit Jahrzehnten geteilt, immer wieder von Großmächten bedrängt, unterdrückt, will auf seine Wunden schauen. Koreanische Filme, Theaterstücke, Popsongs, sie alle machen internationale Adoption zum Thema. Die Regierung führte einen "Adoptionstag" im Mai ein, um das eigene Volk zu ermutigen, koreanische Kinder bei sich aufzunehmen. Solche Kampagnen sind nötig in einem konfuzianisch geprägten Land, wo Blutsbande und Ahnenlinien alles sind und die Menschen davor zurückschrecken, ein fremdes Kind als ihres anzusehen. 2007 lag die Zahl der Inlandsadoptionen erstmals über der der ins Ausland vermittelten. Bis 2012 will die Regierung dafür sorgen, dass Auslandsadoptionen eingestellt werden. Sie kennt den Vorwurf, Korea solle lieber sein Sozialsystem ausbauen, seine ledigen Mütter unterstützen. Und schön ist es auch nicht, wenn man sich von Nordkorea vorhalten lassen muss, der kapitalistische Süden verkaufe sogar seine Kinder. Es ist elf Uhr morgens, Kiel Hamm sitzt am dritten Tag der Reise im Warteraum der Adoptionsagentur, seine Hand zittert. Immer wieder schaltet er das Tonbandgerät ein und aus, er will den Moment für die Ewigkeit bannen, wenn er seine Mutter zum ersten Mal trifft. Das Ticket nach Korea war gekauft, als plötzlich der Anruf kam: Seine Mutter sei gefunden, er habe sechs Geschwister. Kurz darauf las ihm die Adoptionsagentur einen Brief vor, er begann mit den Worten: "Mein liebster Sohn". Und schon am Flughafen von Seoul gab es diese unheimliche Begegnung, eine ältere koreanische Frau starrte ihm sekundenlang ins Gesicht, als versuchte sie, ihn wiederzuerkennen, und Kiel dachte: Vielleicht ist das meine Mutter. Er will sie nicht anklagen. Er will ihr danken. Danke, mein Leben wäre nicht so gelaufen, wenn du nicht diese Entscheidung getroffen hättest. Aber er ahnt, Dank ist nicht das, was seine Mutter hören möchte. Wenn er an die ersehnte, erwartete, eingeforderte Verzeihung denkt, spürt er einen kleinen Widerwillen. Er ist in einer guten Familie aufgewachsen. Er möchte ihr versichern, dass alles in Ordnung ist. So, wie es ist. Meist, hat er von anderen gehört, wolle die koreanische Familie viel Zeit mit dem fremd gewordenen Kind verbringen. "Aber", sagt Kiel, "wir Adoptierten möchten nicht in diese Beziehung hineinspringen." Wer weiß, ob sie überhaupt in Kontakt bleiben, hinterher. Zumindest will er nicht bei seiner Mutter übernachten. Das hat er entschieden. Seltsam, dass er derjenige ist, der entscheidet. Man habe ihm gesagt, bei diesem Trip gehe es allein um ihn. Kiel mag es nicht, wenn alles von ihm abhängt. "Wenn du adoptiert wirst, liegt dein Leben in den Händen anderer." Einen "naiven Optimismus" habe er, sagt Kiel, gerade wegen seiner Adoption. Er glaubt jetzt, dass am Ende immer alles gut wird. Es ist dann eine kleine Frau mit halblangen, lockigen Haaren und einem zarten, feinen Gesicht, die auf ihn zugeht, langsam, mit ausgestreckter Hand, und ihn umarmt, lange. Sie hat die gleichen hohen Wangenknochen wie er. Seine Mutter überreicht ihm die Geschenke: ein Lesezeichen, das er benutzen soll beim Koreanischlernen, einen Schlüsselanhänger mit dem Foto seiner koreanischen Familie und einen goldenen Ring. Kiel hatte ihnen aus Amerika eine Flasche Wein und geräucherten Lachs mitgebracht. "Ich schäme mich ein bisschen dafür", sagt er. Hätte er doch etwas ausgesucht, das mehr Bedeutung hat. Sie haben Kiels Leben wie ein Puzzle zusammengefügt. Kiel hat seiner Mutter ein paar Fotos gezeigt, eine Handvoll Kindheit, mit 10 auf dem BMX-Rad, mit 13 beim Golfspielen, in schwarzer Robe an der Universität, und als seine Mutter die Bilder sah, sagte sie: "Du hast dasselbe Lächeln wie dein Bruder." Sie ist mit ihm in die Nähe ihres alten Hauses gefahren, das Haus selbst gibt es nicht mehr, auch nicht das Entbindungsheim, in dem er geboren wurde. Wenigstens den kleinen Park konnte sie ihm zeigen; ein Weinberg war hier früher, durch den sie jeden Morgen lief, hochschwanger, mit Kiel in ihrem Bauch. Noch am Tag seiner Geburt hatte sie gekellnert, sie verdiente das Geld für die Familie, Kiels Vater, arbeitslos, verschwand mal für Tage, mal für Wochen, irgendwann ganz. Niemand von ihrer Familie war dabei, als sie das Kind zur Welt brachte, das sie auf den Namen Chil Sung taufte. Denn Chil heißt sieben, und die Sieben, sagt man in Korea, bringe Glück. Kiels Mutter wusste, sie würde das Baby nicht behalten. Aus Chil machten die Adoptiveltern Kiel, das klang so ähnlich, ähnlicher zumindest als Andrew, diesen Namen mochten sie auch. Als Schreibweise wählten sie nicht "Kyle", schließlich stammen ihre Vorfahren aus Deutschland, und so wurde das neue Kind aus Korea in eine fremde Familienlinie aufgenommen, trug fortan denselben Namen wie zwei deutsche Städte, Kiel Hamm, und malt heute, an diesem Wintertag in Seoul, sorgfältig und noch ein wenig steif das Schriftzeichen für seinen alten koreanischen Namen auf ein Blatt Papier, zeigt es stolz seiner Mutter. Jedes falsche Wort wäre wie ein kleiner Verrat Im Fernsehstudio, zwischen falschen Säulen und künstlichen Rosen, sitzen die, die niemanden gefunden haben. Auf roten Sesseln die, die reden dürfen. Am Rand die anderen, die hoffen, dass sie zwischendurch ins Bild kommen und irgendwo in Korea vor dem Fernseher plötzlich jemand aufspringt. Melanie sitzt in der zweiten Reihe, ein lila Schild auf der Brust mit ihrem koreanischen Namen: Kim Suh Sook. "Ich vermisse diese Person" heißt die Show, produziert nicht nur für Adoptierte, viele Familien wurden nach dem Korea-Krieg auseinandergerissen. Die Quoten sind gut. Vorgestern hat Melanie Seggewiß Haare abgegeben für eine DNS-Probe. Vielleicht, dachte sie, sucht meine Mutter eines Tages in dieser Gen-Datenbank nach mir. Jetzt, sagt sie, bleibt ihr nur noch der Fernsehauftritt , als letzter Versuch. Nacheinander treten sie nun ans Mikrofon, sie erzählen von Narben, hier auf der linken Wange, von Problemen mit dem Bein, eine Amerikanerin hat ihre alten koreanischen Kinderschuhe mitgebracht. Sie erzählen alles, was sie wissen, Fragmente sind es nur. "Mein Vater spielte Karten, meine Mutter servierte Getränke, sie haben mich weggeschickt ... Ich erinnere mich kaum an meine Mutter.""Oh!", raunt das Publikum, ältere Damen in bonbonfarbenen Blazern. "Mein Vater wurde Alkoholiker." "Ohh!" "Meine Mutter starb." "Ohhh! Ohhh!" "Ich bin glücklich und gesund." "Ahhh!" "Ich studiere Jura." "Wow!" "Bitte meldet euch!" Applaus. Zweimal werden kleine Filmchen eingespielt, "Hallo, mein Name ist Melanie Seggewiß", mit trauriger Klaviermusik unterlegt, dazu Babybilder in Schwarzweiß. Es gibt Zuschaueranrufe, ehemalige Nachbarn hätten sich gemeldet für eine Amerikanerin. Für Melanie bleibt am Ende nur ein kurzer Kameraschwenk. Abends, vor der Akrobatik-Show, als sie alle vor dem Theater warten, schaut Melanie zu Kiel hinüber, zu dritt stehen sie da, Mutter, Schwester, Kiel, ein wenig abseits der lärmenden Grüppchen von Adoptierten, sie bilden einen kleinen Kreis, sie sind eine Familie, die zusammen ausgeht. "Ich könnte gerade schon wieder heulen", sagt Melanie. Im Theater waren sie zum ersten Mal allein, Kiel und seine Mutter, ohne Dolmetscher, denn es gibt ja diese seltsame Übereinstimmung in ihrem Leben. Er war in Japan, sie auch, er hat Japanisch gelernt, sie auch, beide arbeiteten sie in einem japanischen Restaurant. Ein wenig können sie sich in der Sprache der ehemaligen Besatzer Koreas unterhalten, doch es sind nur Sätze wie "Bist du hungrig?". Heute Abend aber, es ist ihr letzter gemeinsamer, wollen sie andere Sätze sagen. Sie sitzen in einem Hotelzimmer im 14. Stock, das Licht ist gedämpft. Die Mutter fasst Kiel am Arm, er legt seine Hand auf ihre, und dann erzählt sie von ihrer Reise im vergangenen Sommer, ein Geburtstagsgeschenk seiner Geschwister, eine Reise nach Amerika: Grand Canyon, Los Angeles. Ein paar Monate war das, bevor sie von Kiel hörte. Pause. Die Dolmetscherin übersetzt, macht sich Notizen. Sie habe, fährt die Mutter fort, ihn so vermisst. Sie wusste doch, dass er irgendwo dort ist, in Amerika. "Wann", fragt sie, Tränen laufen über ihr Gesicht, "in welchen Momenten hast du mich vermisst?" "Das ist schwierig zu erklären", sagt Kiel. "Ich habe immer schon davon geträumt, nach meinen leiblichen Eltern zu suchen, und dann habe ich von diesem Trip gehört." Pause, Übersetzung, die Mutter redet. Die Dolmetscherin wiederholt: "Sie hat dich so sehr vermisst, ihr ganzes Leben lang. Sie hat dich nie vergessen. In welchen Momenten hast du sie vermisst?" Kiel: "Ich wusste nicht einmal, ob meine Mutter noch lebt. Ich wusste überhaupt nichts, nichts von ihr, nichts von der Familie." Die Mutter weint. Kiel weint. Sie sitzen nebeneinander auf dem Sofa. Dolmetscherin: "Sie hat sich immer schuldig gefühlt." Kiel: "Ich hatte ein gutes Leben, sie soll sich nicht schuldig fühlen. Auch wenn wir uns nur zwei Tage gesehen haben, sie sind jetzt Teil meines Lebens." Dolmetscherin: "Du meinst, du wurdest zweimal adoptiert?" Kiel: "Nein, nein." Ein Missverständnis, die Mutter streichelt Kiels Hand. Kiel hat seine amerikanische Familie noch nicht angerufen, seitdem er seine koreanische getroffen hat. Der Zeitunterschied, sagt er. Das sagt er jeden Tag. Bis er zugibt, dass er keine Worte hat für das, was ihm widerfahren ist, und jedes falsche Wort wäre wie ein kleiner Verrat. "Wie geht es euch?", ruft die Repräsentantin von der Overseas Koreans Foundation am Tag vor der Abreise in den Saal, fordernd. "Gut", antwortet der Chor der Adoptierten, höflich, doch ein wenig lustlos. "Wie geht es euch?", fragt sie noch einmal, lauter, unerbittlich. "Gut", antwortet der Chor zum zweiten Mal, doch die Frau ist noch nicht zufrieden. "Und ihr kommt wieder, einverstanden?" "Ja", antwortet der Chor zum dritten Mal, brav. Die abgeschobenen Kinder von damals sind heute Humankapital 1999 hat die südkoreanische Regierung die Adoptierten als Auslandskoreaner anerkannt, sie dürfen nun zwei Jahre in Korea arbeiten. Die abgeschobenen Kinder von damals sind heute Humankapital in einem Land mit überalterter Bevölkerung und niedriger Geburtenrate. Etwa 500 Adoptierte haben sich schon im Land ihrer Vorfahren niedergelassen. Doch diese 42 werden morgen erst mal nach Hause fahren. Eine Deutsche hat sich fünf Paar Schuhe gekauft, weil es daheim kaum welche gibt für ihre kleinen Füße. Ein Amerikaner hat mit seiner koreanischen Familie zuckenden Oktopus gegessen und Hund. Kiel Hamm hat ein Getränk entdeckt, das so heißt wie er selbst, und eine Flasche Chilsung Cider eingepackt. Melanie hat in der Karaoke-Bar gesungen, sie hat für ihre Tochter eine koreanische Tracht besorgt, und heute, beim Abschiedsdinner, hat sie es zu den anderen gesagt, auf der Bühne, ins Mikrofon: "Ich gehöre zu euch." Es war ihr erster 100-Prozent-Satz. "Adoptiert zu sein ist ein lebenslanges Thema", sagt Generalsekretär Wenger, der Schweizkoreaner. Mit den Rettungsphantasien mancher Paare, Hauptsache, das Baby ist raus aus dem Elend, kann er nichts anfangen. Wie sehr muss zudem die Last der Dankbarkeit ein "gerettetes" Kind drücken. Es ist doch ohnehin alles schwierig genug. Adoptiveltern, die alles richtig machen wollen, das fremde Kind wie ihr eigenes behandeln und dessen Herkunft verleugnen. Adoptivkinder, die alles richtig machen wollen, sich ihren leiblichen Eltern als ganz koreanisch präsentieren und nur Missverständnisse produzieren. Koreanische Eltern, die alles richtig machen wollen, ihre wiedergefundenen Kinder mit Geschenken überschütten und nur eine Frage provozieren: Wollen die sich freikaufen von ihrer Schuld? Eines, sagt Wenger, sollten die Adoptierten nie tun: bei den leiblichen Eltern wieder einziehen. Zu groß ist die Gefahr des Scheiterns, und dann sind es dieses Mal vielleicht die Kinder, die ihre Mutter verlassen. Am Flughafen haben Kiel und seine Mutter ein Foto gemacht, das trägt sie jetzt immer bei sich, gespeichert auf dem Display ihres Handys, und Kiel trägt ihren Ring an einem roten Band um den Hals. Er nennt sie jetzt "Omma", Mama. Davor hatte er stets von "sie" gesprochen. Könnten Sie "sie" fragen, hatte er die Übersetzerin gebeten. Deswegen war es auch keinem aufgefallen, dass er immer noch nicht genau weiß, wie der Vorname seiner Mutter lautet. Aber er kennt jetzt die koreanischen Wörter für "Bruder" und "Schwester". Zweieinhalb Tage und einen Abend haben sie miteinander verbracht, und Kiel hat eine Antwort gefunden auf seine Frage. "Es waren einfach zu viele, einfach zu viele Kinder zum Aufziehen. Ich war der Wendepunkt." Ja, er habe das alles schon vor dem Treffen gewusst, das mit der Armut, mit seinen sechs Geschwistern. Ja, die Fakten hätten sich nicht verändert. "Aber das ist die Antwort, die ich akzeptiere", sagt Kiel. Er weint. Zum Abschied hat ihm seine Mutter einen neuen Brief mitgegeben. Kiel will ihn nicht übersetzen lassen. Er wird warten, bis er ihn selbst lesen kann, auf Koreanisch.