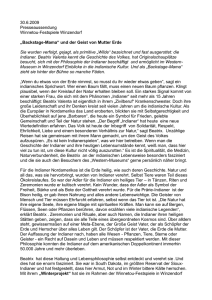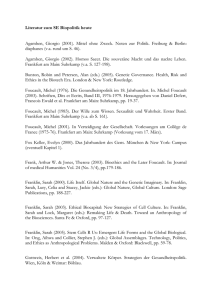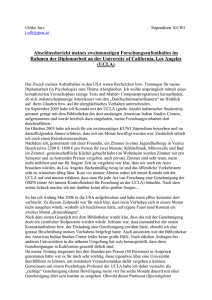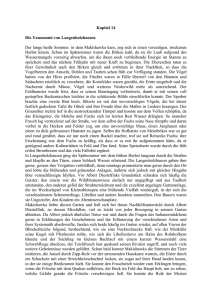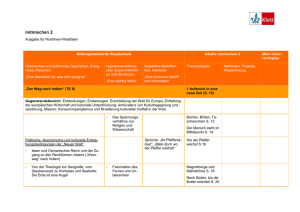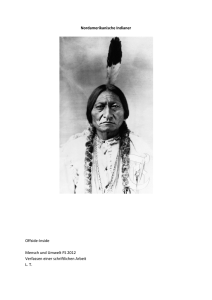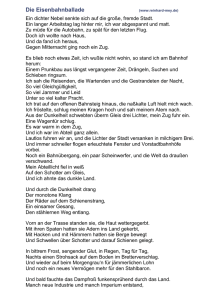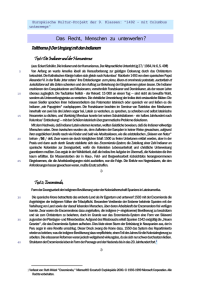Freund und Feind
Werbung
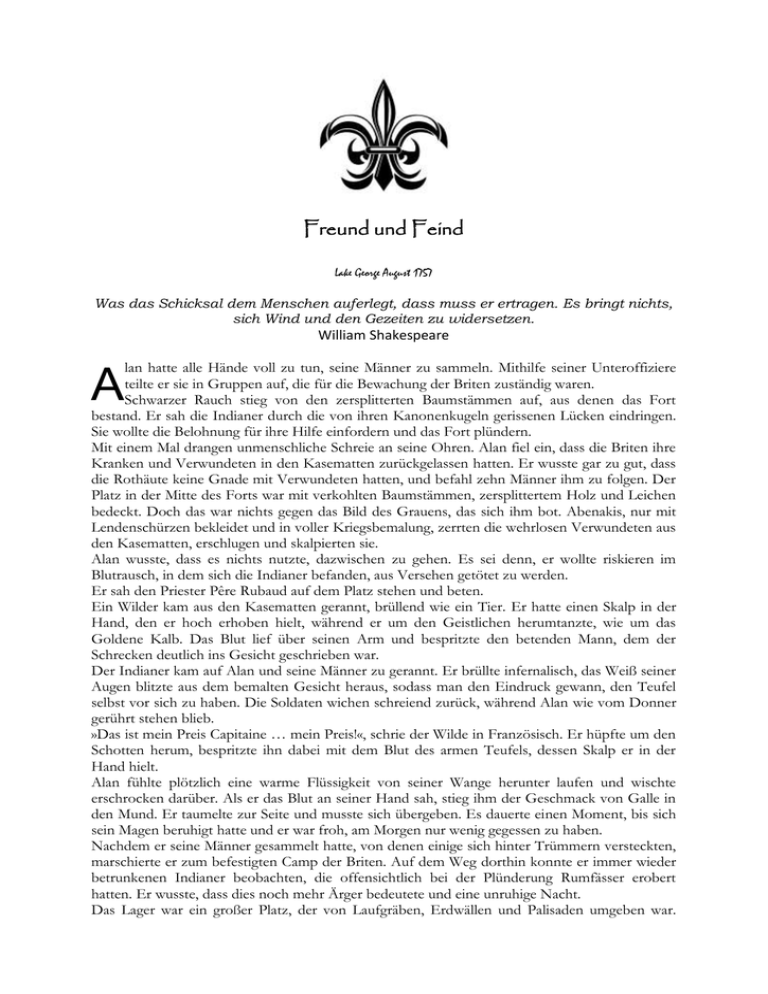
Freund und Feind Lake George August 1757 Was das Schicksal dem Menschen auferlegt, dass muss er ertragen. Es bringt nichts, sich Wind und den Gezeiten zu widersetzen. William Shakespeare A lan hatte alle Hände voll zu tun, seine Männer zu sammeln. Mithilfe seiner Unteroffiziere teilte er sie in Gruppen auf, die für die Bewachung der Briten zuständig waren. Schwarzer Rauch stieg von den zersplitterten Baumstämmen auf, aus denen das Fort bestand. Er sah die Indianer durch die von ihren Kanonenkugeln gerissenen Lücken eindringen. Sie wollte die Belohnung für ihre Hilfe einfordern und das Fort plündern. Mit einem Mal drangen unmenschliche Schreie an seine Ohren. Alan fiel ein, dass die Briten ihre Kranken und Verwundeten in den Kasematten zurückgelassen hatten. Er wusste gar zu gut, dass die Rothäute keine Gnade mit Verwundeten hatten, und befahl zehn Männer ihm zu folgen. Der Platz in der Mitte des Forts war mit verkohlten Baumstämmen, zersplittertem Holz und Leichen bedeckt. Doch das war nichts gegen das Bild des Grauens, das sich ihm bot. Abenakis, nur mit Lendenschürzen bekleidet und in voller Kriegsbemalung, zerrten die wehrlosen Verwundeten aus den Kasematten, erschlugen und skalpierten sie. Alan wusste, dass es nichts nutzte, dazwischen zu gehen. Es sei denn, er wollte riskieren im Blutrausch, in dem sich die Indianer befanden, aus Versehen getötet zu werden. Er sah den Priester Pêre Rubaud auf dem Platz stehen und beten. Ein Wilder kam aus den Kasematten gerannt, brüllend wie ein Tier. Er hatte einen Skalp in der Hand, den er hoch erhoben hielt, während er um den Geistlichen herumtanzte, wie um das Goldene Kalb. Das Blut lief über seinen Arm und bespritzte den betenden Mann, dem der Schrecken deutlich ins Gesicht geschrieben war. Der Indianer kam auf Alan und seine Männer zu gerannt. Er brüllte infernalisch, das Weiß seiner Augen blitzte aus dem bemalten Gesicht heraus, sodass man den Eindruck gewann, den Teufel selbst vor sich zu haben. Die Soldaten wichen schreiend zurück, während Alan wie vom Donner gerührt stehen blieb. »Das ist mein Preis Capitaine … mein Preis!«, schrie der Wilde in Französisch. Er hüpfte um den Schotten herum, bespritzte ihn dabei mit dem Blut des armen Teufels, dessen Skalp er in der Hand hielt. Alan fühlte plötzlich eine warme Flüssigkeit von seiner Wange herunter laufen und wischte erschrocken darüber. Als er das Blut an seiner Hand sah, stieg ihm der Geschmack von Galle in den Mund. Er taumelte zur Seite und musste sich übergeben. Es dauerte einen Moment, bis sich sein Magen beruhigt hatte und er war froh, am Morgen nur wenig gegessen zu haben. Nachdem er seine Männer gesammelt hatte, von denen einige sich hinter Trümmern versteckten, marschierte er zum befestigten Camp der Briten. Auf dem Weg dorthin konnte er immer wieder betrunkenen Indianer beobachten, die offensichtlich bei der Plünderung Rumfässer erobert hatten. Er wusste, dass dies noch mehr Ärger bedeutete und eine unruhige Nacht. Das Lager war ein großer Platz, der von Laufgräben, Erdwällen und Palisaden umgeben war. Alan postierte seine Männer an Stellen, die leicht zu überwinden waren und an den Eingängen. Sie hatten Befehl auf jeden zu schießen, der sich unbefugt Zutritt verschaffte. Er wusste gar zu gut, wie schwierig das war. Die Indianer waren zu zahlreich und die Soldaten hatten große Angst vor den Wilden. Er selbst betrat das Lager und musste feststellen, dass es eigentlich schon zu spät und vielen Indianern bereits gelungen war, durch die Wachen zu kommen. Alan war nicht der einzige französische Offizier, der anwesend war. Er entdeckte Bougainville im Gespräch mit einem jungen Leutnant des 35. Regimentes, während er stumm die englischen Soldaten musterte. Er sah nicht nur rote Uniformen, sondern auch die blauen der amerikanischen Regimenter. Zwischen den Zelten hockten auch hunderte Zivilisten. Die üblichen Frauen, die den Tross einer Armee folgten mit ihren Kindern. Ihnen allen war die Angst und Ungewissheit in die Gesichter geschrieben und Alan hatte ehrlich Mitleid mit ihnen. Er wusste gar zu gut, dass das Glück des Siegers sehr schnell in eine Niederlage umschlagen konnte. Dann würde er selbst in einem solchen Lager sitzen. Auch Milizen und mit den Briten verbündete Indianer waren hier. Sie hockten ergeben am Boden, musterten ihn misstrauisch, nicht ahnend, dass der französische Offizier vor ihnen gar zu gut verstand, was sie sprachen. In der Nähe der Palisade erforderte ein Streit seine Aufmerksamkeit. Eine Gruppe von Rothäuten stritt sich mit ein paar Milizmännern um das Gepäck der Leute, das sie aus den Zelten geholt hatten. Sie saßen neben einer Gruppe zu den Briten gehörenden Indianern. Einer von ihnen, ein großer kräftiger Mann, der seine Haare nur in einer mit bunten Bändern geschmückten Skalplocke trug, stand auf. Er hatte die Hand am Dolch, den er trug und der Alan merkwürdiger Weiße an seinen eigenen Highlanddolch erinnerte. Er ahnte mehr als das er wirklich etwas verstand, um was es bei dem Streit ging. Doch er wusste, dass die Sache in einem Zweikampf ausarten konnte oder in einem Handgemenge. Alan zog die Pistole, die er am Gürtel trug, und entsicherte sie, als er auf die Gruppe zuging. „Was geht hier vor!“, rief er noch aus einiger Entfernung einem der bemalten Indianer zu, der ihn erschrocken ansah. Jedoch weiter dem Mann, der vor ihm hockte, die Tasche aus der Hand zu zerren versuchte. Der Fremde mit der Skalplocke warf ihm einen kurzen Blick zu, wandte sich aber sofort wieder ab und setzte sich ergeben. Alan stutzte einen Moment und musterte ihn aufmerksam. Der Mann war mit einem bunten Hemd bekleidet, wie die meisten Indianer der Grenzgebiete. Auf seinem Unterarm entdeckte er Tätowierungen, rhombische Muster, die wie ein Armband aussahen. Doch was ihn stutzen ließ, war der blonde Flaum auf der sonnenverbrannten Haut. Er konnte das Gesicht des Mannes nicht genau sehen, da er zu Boden sah. Doch seine Haare waren nicht von jenem glänzenden Blauschwarz wie üblich bei den Wilden, sonder eher braun. Seine Augenbrauen, zweifarbig gemischt aus Braun und blond. Sein Schädel war kahl geschoren, bis auf die mit Fellstreifen und bunten Lederbändern verziert Skalplocke und auch hier konnte er Tätowierungen ausmachen. Eine Art Stern, der auf der der rechten Schläfe prangte und feine Linien, die sich über seinen ganzen Schädel fortsetzten. Er trug schweren Silberschmuck in beiden Ohren. Hinter ihm hockte eine Frau, eine Squaw, die Alan aufmerksam ansah. Ihr Gesicht erinnerte ihn fatal an Andrea, mit den hohen Wangenknochen und den schräg stehenden Augen. Alan fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Auch der bemalte Krieger wurde nun auf die Frau aufmerksam und ließ plötzlich das Gepäck des Siedlers fallen. Er machte einen Satz auf die Squaw zu, packte sie und zerrte sie grob zum Stehen. Sie schrie entsetzt auf und Alan konnte nun sehen, dass sie schwanger war. Etwas was ihn noch mehr an seine Frau erinnerte, vor allen Dingen, weil sie genauso klein war. Auch der Mann mit der Skalplocke sprang auf. Doch bevor es zu einem Handgemenge kam, war Alan mit seiner entsicherten und geladenen Pistole dazwischen gegangen. Er hatte die Frau gepackt, hinter sich gezogen und hielt dem verdutzten Krieger die Mündung seiner Pistole an die Stirn. »Sie ist meine Beute!«, schrie er dem Indianer an, der vor ihm zurückwich. »Hast du verstanden sie ist mein!«, fügte er noch lauter hinzu, ›mein‹ extrem betonend, da er sich nicht sicher war, ob der Krieger ihn verstanden hatte. Der sah ihn eingeschüchtert an und wich zurück. Auch die anderen Rothäute musterten den französischen Offizier ängstlich und entfernten sich murrend, anderswo Beute suchend. Im ganzen Lager wurde es mittlerweile unruhig. Er war froh, dass die Situation so glimpflich abgegangen war, und holte tief Luft. Noch immer hatte er die Squaw am Handgelenk gepackt und plötzlich tönte es in seinem Rücken unverwechselbar in Gälisch. »Se an bean agam! Sie ist meine Frau!« Erschrocken fuhr Alan herum. Er fand sich, seine noch immer geladene und entsicherte Waffe auf die Brust des Mannes gerichtet, der ihm so seltsam vorgekommen war. Das Gesicht, in das er nun sah, war alles andere als Indianisch. Er starrte verdutzt in ein paar strahlend blaue Augen, die Charles MacDonald gehörten, dem Sergeanten, der ihm und Annie 1752 zur Flucht verholfen hatte. Der Mann, den er glaubte, getötet zu haben. Alan hatte das Gefühl, als würde ihm das Herz stehen bleiben. »Tearlach Dòmhnallach, Charles MacDonald!“, entfuhr es ihm fassungslos. »Willst du mich jetzt hier erschießen und ein Massaker auslösen Ailean Breac?«, sprach der ihn weiterhin Gälisch an. Da Alan nicht sofort reagierte, sprangen plötzlich mehrere der Milizmänner und Indianer auf und machten Anstalten ihn zu entwaffnen. Doch Charles MacDonald hob die rechte Hand und stoppte sie. »Ruhig Leute, der Offizier ist aus demselben Stall wie ich, ein Landsmann von mir, ein Highlander!«, erklärte er ruhig auf Scots und die Männer zogen sich zurück. Alan senkte die Pistole und sicherte sie, um sie in den Gürtel zu stecken. Sein Gegenüber warf den langen Dolch, den er in der Hand hatte mit Schwung in den Boden vor ihren Füßen. Er setzte sich in der Art der Indianer hin, während sich seine Frau hinter ihn zurückzog. Alan machte es genauso und starrte auf die hölzernen Griffe der beiden Highlanddolche, die kunstvoll geschnitzt waren. Seiner mit dem Kormoran und MacDonalds mit einer Distel, umgeben von einem keltischen Flechtmuster. Die uralte Tradition ihrer Heimat in der fernen Wildnis Amerikas! »Capitaine! Eine steile Karriere Ailean Breac!«, stellte der Mann fest. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte Alan sich beleidigt. Es lag so etwas wie Spott und Zynismus in dem Gesichtsausdruck des Mannes. »Besser, als das was du darstellst, ein Wilder unter Wilden!«, erwiderte er scharf und stellte verwundert fest, das MacDonald grinste. »Du bist noch immer dieselbe Mimose, stolz und eingebildet, ganz wie es sich für einen Franzmann gehört! Aber ich bin ehrlich erstaunt, dass du schon Capitaine bist! Ich habe es nur zum Leutnant geschafft, bis ich die Nase voll hatte, Soldat zu sein!«, kam es nun deutlich ernster von ihm. Nun lächelte Alan zynisch. »Warum bist du dann hier in einem britischen Fort?«, fragte er, denn er konnte sich MacDonalds Benehmen nicht wirklich erklären, ganz zu schweigen von seinem Aussehen. »Das ist eine lange Geschichte Ailean Breac, eine bitterböse noch dazu!«, erwiderte der Mann mit finsterer Miene. Doch noch, bevor er etwas darauf erwidern konnte, wurde es wieder laut, um sie herum und er sprang auf. Noch immer streiften Indianer durch das Lager und zerrten wahllos, Kleidung und was sie sonst für wertvoll hielten aus den Zelten der Besiegten. Die sahen wehrlos zu, aus Angst ein Massaker auszulösen. Zwar hatten die Briten noch ihre Waffen, aber die meisten keine Munition dazu. Mehrere Offiziere, selbst de Lèvis kamen nun und versuchten die Rothäute davon abzuhalten. Alan rief seinen Unteroffizieren, unter ihnen Sergeant Collet und Caporal Francoeur zu, für Ordnung zu sorgen. Dann setzte er sich wieder auf den Boden, von wo MacDonald ihn erstaunt beobachtet hatte. »Du hast deine Männer im Griff Alan!« »Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, MacDonald! Doch ich kann meine Hand nicht für die Wilden ins Feuer legen. Wenn sie noch mehr Brandy finden, wird es gefährlich!« Der Schotte sah sein Gegenüber noch einmal genau an. Er stellte fest, dass der Mann sogar einen Ring in der Nase trug, genauso wie die Indianer die hinter ihm standen. »Du bist also ein Wilder geworden Tearlach«, meinte er dann ruhig. »Besser ein Wilder, als ein Schlächter!«, kam es von diesem und er senkte den Blick. Alan wusste, auf was der Mann anspielte, auf ihre Rolle in Culloden, wo sie sich als Feinde gegenübergestanden hatten. Die Erinnerung an diesen Apriltag vor zwölf Jahren ließ sie beide verstummen. Es schien wie ein eiskalter Windhauch, der über sie fuhr. »Erzähl mir, warum du hier als Wilder vor mir sitzt, mit kahl geschorenem Kopf und Ringen in Ohren und Nase?«, forderte er sein Gegenüber schließlich auf. MacDonald warf einen Blick auf die Milizmänner um ihn herum und starrte zu einem Kanadier, der nicht weit von ihnen stand. »Vor zwei Jahren kam ich mit meiner Frau in die Kolonien nach Albany. Ich habe mir für das Geld, das mir mein Vater vererbt hat, ein Stück Land an einem Nebenlauf des Mohawk River gekauft. Ich hatte ein Blockhaus gebaut, die erste Ernte reifte und meine Frau erwartete ein Kind. Alles schien perfekt zu sein, bis ich an einem Juniabend von der Jagd zurückkam und mein Haus nur noch eine rauchende Ruine war. Ich fand meine Frau ermordet, skalpiert und verstümmelt dazwischen.« MacDonald schwieg einen Moment und Alan merkte, das er mit den Gefühlen zu kämpfen hatte. Die junge Squaw, die er als seine Frau bezeichnet hatte, legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. Sie sagte etwas in einer Sprache, die der Schotte nicht verstand. »Es waren Abenaki auf dem Kriegspfad gewesen, zusammen mit kanadischen Milizen. Ich heftete mich an ihre Fersen und habe sie schließlich eingeholt. Es kam zu einem Gefecht und ich bin mit einer Gruppe Mohawk aneinandergeraten, die den Männern ebenfalls gefolgt waren. Dabei habe einen ihrer Krieger getötet. Ich war damals noch nicht lange in den Wäldern und für mich waren alle Wilden gleich, so wie wir es für sie sind. Es war Chepies Mann, den ich getötet hatte«, er wies mit dem Kopf zu der Frau, die Alan so an seine eigene erinnerte. »Ihr Bruder hat mich halb totgeschlagen bei dem Handgemenge, doch mir war sowieso alles egal. Ich wollte nur, dass die Männer bezahlen, die das meiner Frau angetan hatten. Doch Nakaya, Chepies Bruder, ließ mich am Leben und sie brachten mich in das Dorf der Mohawk am Unadilla River, wenn dir das etwas sagt. Ich überlebte, aber nur um dann auf Verlangen von Chepies Bruder geopfert zu werden. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass es ziemlichen Streit zwischen den Kriegern gab wegen mir. Sie wollten es nicht mit den Engländern verderben, indem sie einen englischen Gefangenen martern und töten. Doch Nakaya forderte mein Leben, er wollte mein Herz essen, wie er so schön sagte. Glaube mir Alan, sie tun das wirklich, aber ich brauche dir da wohl nichts zu erzählen.« MacDonald machte eine Pause. Er folgte Alans Blick, der einen Abenaki anvisierte, der sich ihnen näherte. »Verschwinde hier!«, schrie dieser den Mann in Französisch an und stand auf, zog seine Pistole und richtet sie auf den Wilden, der sich daraufhin zurückzog. Zögernd setzte er sich wieder und sah MacDonald abwartend an, dessen Frau ihren Kopf an seine Schulter schmiegte, eine Hand auf ihrem Bauch. Ein Bild, das Alan an seinen Abschied von Andrea in Brest erinnerte und zugleich fatal an Marianne Douville. Die Nächte mit ihr, seine Sünde … Er senkte den Blick, um die Gedanken abzuschütteln. Er fühlte sich so unendlich schuldig. »Wie bist du davon gekommen Charles? Meines Wissens nach, sind die Wilden bei einer solchen Sache durch nichts davon abzubringen, ihr Opfer zu martern«, fragte er schließlich, um sich selbst auf andere Gedanken zu bringen. »Sie hatten auch schon angefangen damit, mich mit dem Messer zu kitzeln und mich auf kleiner Flamme zu garen. Bis Chepie gekommen ist und mich unter ihre Decke genommen hat«, erklärte MacDonald ruhig und gelassen. »Unter Ihre Decke?«, wiederholte Alan fragend und betrachtet sich erneut die Squaw. »Wenn eine der Frauen dem Opfer ihre Decke umlegt, ist es damit begnadigt, man wird von dem Stamm adoptiert. Glaube mir Alan, einerseits war ich froh nicht so sterben zu müssen. Aber andererseits wollte ich auch nicht bei den Mohawk bleiben und Chepies Mann ersetzen! Es hat eine Weile gedauert, bis ich mein Glück begriff. Dass ich jetzt hier als Scout für die Briten bin, ist eine andere Geschichte. Ich bin ein Mohawk Krieger und der Sachem hat beschlossen den Engländern zu helfen, damit sie in diesem Krieg nicht wie die Weiber alles verlieren! Hier kämpfe ich für meinen Clan und die Feinde sind nicht meine Brüder, nicht mein eigener Clan, nicht meine Freunde«, erzählte er ruhig. Er warf erneut einen Blick auf den Kanadier, der sich abwandte. »Außerdem gibt mir das die Gelegenheit meine Rechnung mit den verfluchten Franzosen und Abenaki zu begleichen, die meine Frau ermordet haben«, fügte er noch hinzu. Alan holte tief Luft und schüttelte den Kopf. »Rache ist nicht unbedingt ein guter Ratgeber MacDonald«, sagte er schließlich. »Das sagt der Richtige!«, erwiderte der Mann und sie schwiegen betreten. »Was ist aus Annie geworden Alan? Hast du das arme Mädchen mit nach Frankreich geschleift und dort verdorben?«, kam es plötzlich und Alan hatte das Gefühl, eine schallende Ohrfeige bekommen zu haben. Als sich ihre Blicke trafen, schien ein Gefühl maßloser Eifersucht ihn zu überwältigen. Er hatte nicht vergessen, dass Charles MacDonald seine Frau damals geliebt hatte. Doch sie hatte sich für ihn entschieden. Er packte plötzlich seinen Dolch und sprang auf, während MacDonald sitzen blieb. Er hob abwehrend die Hände in die Luft, um ihm zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Doch die Männer um sie herum schienen bereit zu sein einzugreifen. »Vergib mir Alan, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich will nur wissen, was aus dem Mädchen geworden ist, das bereit war, alles für dich zu tun. Genauso wie du für sie«, sagte er schließlich leise und sah zu ihm auf. Alan holte geräuschvoll Luft und setzte sich zögernd wieder. Er stieß seinen Dolch in die Erde neben dem mit der geschnitzten Distel im Griff und drehte vorsichtig seinen Sporran am Gürtel nach vorn. Er zog den Brief Andreas heraus, den er wie einen Talisman, stets bei sich trug, seit er ihn vergangenen Herbst erhalten hatte. Er reichte ihn MacDonald, der ihn zögernd auseinander faltete. »Sie ist meine Frau Charles und die Mutter meiner Kinder geworden«, sagte er leise. Der Mann sah auf den Brief, überflog ihn kurz. Seine indianische Frau fuhr mit den Fingern vorsichtig über die winzigen Fußabdrücke und lächelte Alan freundlich an. MacDonald faltete ihn sorgsam zusammen und gab ihn zurück. »Ich freue mich für dich«, sagte er kurz und in seltsamen Tonfall. »Ich hoffe, dass dieser unglückliche Krieg bald vorüber ist und ich zurück kann zu ihnen«, sagte Alan und holte tief Luft. Er versuchte vergeblich all die Erinnerungen und Sehnsüchte abzuschütteln, und als er zu Charles MacDonalds Frau sah, erwachte ganz unmissverständlich sein schlechtes Gewissen. ›Man brauchte so etwas wie menschliche Wärme bei all dem Schrecken um einen herum‹, dachte er. Es schien wie eine Entschuldigung zu sein, für den Ehebruch, den er begangen hatte. Erneute Unruhe im Camp ließ Alan aufschrecken. Er erhob sich, steckte sein Messer wieder in die Scheide, die er am Gürtel trug und den Brief zurück in den Sporran. Auch MacDonald stand auf und sah sich um. Die mit den Franzosen verbündeten Indianer wurden immer dreister. Viele waren betrunken und die Auseinandersetzungen wurden zunehmend gewalttätiger. »Ich muss gehen und für Ordnung sorgen!«, sagte Alan kurz und straffte sich, während er den Sporran wieder an seinen Platz schob. Er sah den Mann an, der in seiner Kindheit einmal sein Freund gewesen war, etwas was nur wenige wussten. Er zweifelte sogar, dass sich Charles selber daran erinnerte. An den schmutzigen, pockennarbigen, dürren Jungen, der ihn einmal grässlich verdroschen hatte. Und der dann zu seinem treusten Freund geworden war für ein paar kurze Sommer in Duror. Das war schon ewig her. Der Mann vor ihm war ein Indianer, ein Wilder geworden und er war erneut sein Feind. »Pass auf dich auf Alan. Ich hoffe wir begegnen uns nicht noch einmal als Feinde!«, kam es nun von MacDonald, als ob er seine Gedanken gelesen hätte. Er nickte stumm und reichte dem Mann die Hand, die er kräftig drückte. Dann forderte die Unruhe im Lager der Briten erneut seine Aufmerksamkeit und er ging schnell zu seinen Unteroffizieren, um ihnen weitere Befehle zu geben. Alan hatte bis zum späten Abend zu tun, weitere Übergriffe zu verhindern. Er fiel todmüde auf sein Lager, und der Schlaf übermannte ihn sofort. Doch als er am Morgen des 10. August von Pierre Delboro geweckt wurde, war er mehr als beunruhigt. Die Truppen, die die Briten nach Fort Edward eskortieren sollten, waren noch nicht bereit. Doch Teile von Colonel Monros Männern schon auf dem Weg und die Indianer ihnen auf den Fersen, bereit erneut ihre Bezahlung einzufordern. Im befestigten Lager hatten sich grauenvolle Szenen abgespielt. Die Indianer hatten die Verwundeten vor den Augen der Wachen und der Briten abgeschlachtet und plünderten ungeniert. Zerrten Schwarze und Indianer heraus, um sie als Gefangene zu verschleppen. Alan konnte nicht verstehen, was die Briten bewogen hatte aufzubrechen, ohne auf die Eskorte zu warten. Diese Gedanken beschäftigten den Schotten, als er seine Männer antreten und Munition und Waffen überprüfen ließ. Er selbst steckte sich eine Pistole in den Gürtel und hing sich eine Patronentasche um, anstatt mit der Hellebarde loszuziehen. Als er mit seiner Kompanie den Weg erreicht hatte, der vom befestigten Lager in den Wald nach Fort Edward führte, bot sich ihm ein chaotisches Bild. Die Rothäute waren überall zwischen den Briten, bewaffnet bis an die Zähne, mit Tomahawks, Kriegskeulen und Feuerwaffen. Viele waren betrunken und entsprechend aggressiv. Er sah einige Offiziere der Briten, die gelinde gesagt halb nackt waren. Mehrere Indianer traten, an die zögernd marschierenden Soldaten, und vor allen an die Marketenderinnen heran. Sie forderten ungeniert Rum, den diese wohl entgegen der Order vom Vorabend bei sich hatten. Die Leute gaben den Wilden, was sie hatten, wohl um sie loszuwerden. Doch sie schütteten nur Öl ins Feuer damit. Alan schüttelte entnervt den Kopf und versuchte seine Männer zwischen die Indianer und die marschierenden Truppen zu bringen. Er sah wie ein grell bemalter Abenaki einem Leutnant des 35. Regimentes die Patronentasche und das Gewehr aus der Hand riss. Der Mann setzte sich dagegen energisch zur Wehr und rief ihn schließlich um Hilfe an. »Gebt es ihm um Gottes Willen, oder wollt Ihr erschlagen werden dafür!«, erwiderte er dem verdutzten Briten in Englisch, der seiner Empfehlung folgte. Doch der Indianer schien nicht damit, zufrieden zu sein. Er zerrte dem entsetzten Mann an der Kleidung herum. Nötigte ihn sich bis auf die Hose auszuziehen, um ihn dann einen derben Stoß mit der Kriegskeule zu versetzen und von dannen zu ziehen. »Das ist ein Verstoß gegen die Artikel der Kapitulation Captain!«, demonstrierte der Leutnant lautstark, sich nun nicht mehr Mühe gebend Französisch zu sprechen. »Ich nehme es zur Kenntnis, Lieutenant, aber ich habe keine Kontrolle über diese Wilden!«, erwiderte Alan trocken und sah sich nach dem Tross um, der den Regulären folgte. Es waren zumeist Zivilisten, unter ihnen einige Indianer und Kolonialmiliz. Plötzlich ertönte ein schriller Kriegsschrei, der ihn zu einem Eisblock erstarren ließ. Aus dem Dickicht, das den Weg umgab, stürmten auf einmal noch mehr Indianer, grell bemalt, die Keulen und Tomahawks schwingend. Erste Schüsse fielen und das Angstgeschrei der Frauen und Kinder schrillte in seinen Ohren. Schießpulverdampf hüllte sie ein. Der Geruch stach Alan in die Nase und ließ seine Augen tränen. Er riss eine eigene Waffe aus dem Gürtel, während Sergeant Collet die Befehle an seine Männer gab. Sie stellten sich in zwei Reihen auf, die vorderste kniete bereits. Doch als sich der Dunst legte, erkannte er, dass er hier mit einer Salve nichts ausrichten konnte. Die Indianer waren überall zwischen den Briten und den Zivilisten, die verzweifelt versuchten, sich zur Wehr zu setzen. Doch die meisten hatten keine Munition, nicht einmal Bajonette. Wenn er schießen ließ, traf er alle und nicht nur die angreifenden Wilden. Hier half nur ein Kampf von Mann zu Mann oder gezielte Schüsse. Doch er wollte seine Männer nicht in ein Handgemenge verwickeln und mit Musketen konnte man nicht wirklich treffen. »Wer genau ein Ziel erfassen kann, schießt, ansonsten nur im Notfall!«, befahl er. Vereinzelt wagten seine Männer, zu feuern. Es waren besonders die, die er zu guten Schützen ausgebildet hatte, wie Laducoeur, Meilleur und Jolycoeur. Die anderen sahen mit entsetzten Augen, was sich da vor ihnen abspielte, bereit ihre Bajonette zu gebrauchen. »Hierher Leute, kommt hierher hinter meine Soldaten!«, rief Alan laut einigen der Männer, Frauen und Kindern zu, die versuchten zu fliehen. Er selber erschoss einen Indianer, der eine der Frauen bei den Haaren gepackt hatte und sie mit dem Tomahawk erschlagen wollte. Entsetzt sah er nun, wie einer der Krieger einer Frau im Tross, das Kind, das sie auf dem Arm trug entriss. Die Frau kreischte vor Entsetzen und was dann noch folgte, ließ ihn erschauern. Alan fühlte sich wie gelähmt, als er plötzlich inmitten dieser grausamen Szenen Charles MacDonald entdeckte. Er versuchte verzweifelt seine Frau zu schützen. »Sergeant Collet, versucht so viel Leute wie möglich zurück ins Fort zu bringen!«, befahl er, steckte sich seine erneut geladene Pistole in den Gürtel und zog seinen Säbel. »Ich habe hier eine persönliche Sache zu erledigen. Ich komme nach, sobald ich kann.« Alan wollte sich in Bewegung setzen, bemerkte aber noch rechtzeitig, das Louis Chauvet ebenfalls Anstalten machte ihm zu folgen. »Ich gehe allein Francoeur!«, entfuhr es ihm zornig und der junge Mann wich entsetzt zurück. »Nimm meine Muskete!«, sagte Louis schließlich und reichte sie ihm. Alan nickt nur stumm und hängte sie sich um. Er rannte zur Straße und in die Richtung, in der er MacDonald zuletzt gesehen hatte. Unterwegs hieb er mit seinem Säbel verzweifelt auf einen Wilden ein, der versuchte, eine Frau wegzuzerren. Dann sah er MacDonald, der im Nahkampf mit einem Krieger, dessen Gesicht pechschwarz bemalt war. Alan riss die Muskete von der Schulter und legte auf den Indianer an. Doch er riskierte Charles zu treffen, der sich verzweifelt mit dem Dolch gegen den, mit dem Tomahawk auf ihn einschlagenden Wilden wehrte. Doch dann entdeckte er MacDonalds Frau. Ein Hüne von einem Krieger packte sie an den Haaren und zerrte sie weg. Er legte auf diesen Mann an und schoss. Für einen Moment machte der Schießpulverdampf, der bei der Explosion des Pulvers auf der Pfanne entstand ihn blind. Und als er wieder richtig sehen konnte, war er erschrocken. Die Frau und auch der Indianer waren verschwunden. Entschlossen rannte er in die Richtung, in der er sie zuletzt gesehen hatte, und nahm dabei einen Schatten wahr, der sich ihm näherte. Als er sich nach links drehte, erkannte er zu spät den Indianer. Es war eben jenen, auf den er geschossen hatte, der blutüberströmt, mit seiner Kampfkeule ausholte. Alan konnte nicht mehr ausweichen und fühlte einen heftigen Schlag, der ihn hinter dem Ohr und am Hals traf, und ihn zu Boden stürzen ließ. Der Schmerz war schier unerträglich. Er schrie, bekam kaum noch Luft und schließlich umgab ihn Dunkelheit. Das Nächste, was er mitbekam, war das ihn jemand an den Haaren packte, seinen Kopf nach oben riss. Während ein Fuß in seinem Rücken ihn auf den Boden festnagelte. Er wusste, was das bedeutete, denn er hatte es schon Dutzende Male gesehen. Der Indianer wollte ihn skalpieren! Das war nicht der Tod, auf den er wartete, nein nicht das. Er wollte am Leben bleiben, er musste am Leben bleiben! Etwas in ihm schrie laut Nein und er schrie es wirklich. Verzweifelt wehrte er sich, versuchte den Mann in seinem Rücken abzuwehren und schrie ihn in Französisch an. Doch der riss weiter an seinen Haaren und packte plötzlich das Lederband, des Medizinbeutels, den er noch immer um seinen Hals trug. Er strangulierte Alan fast damit. Auf einmal versetzte der Wilde ihm einen Schlag mit der Kriegskeule, der ein gleißendes Licht aufblitzen ließ, als er seine Schläfe traf. Dunkelheit umgab ihn erneut. Als er wieder zu sich kam, braucht er eine Weile, um sich zu erinnern, was passiert war und wo er war. Schemenhaft nahm er Bewegungen wahr. Er sah durch das Gras, in dem er lag, Leute rennen, hörte das Geschrei, die Kriegsrufe der Indianer, das Stöhnen der Verwundeten. Sein Schädel und sein Genick schmerzten und er taste benommen nach seiner Stirn, von der das Blut lief. Dann umgriff er die Muskete, die noch immer neben ihm lag und versuchte mehrere Male schwankend, wie betrunken auf die Beine zu kommen. Schließlich stand er, gestützt auf seine Waffe und begriff, was um ihn herum geschah. Suchend sah er sich nach MacDonald und seiner Frau um. Er bemerkte die beiden keine fünf Meter von ihm entfernt, den Mann erneut im Handgemenge mit einem Wilden. Alan lud die Muskete, mit gewohnt schnellen Bewegungen und versuchte den Indianer aufs Korn zu nehmen. Doch erneut war es zu riskant. Aber noch, bevor er die Muskete wieder sichern konnte, erhielt er erneut einen Schlag, der ihn von hinten auf den Oberarm traf. Er taumelte nach vorn und der Schuss löste sich. Zum Glück schlug er über MacDonalds Kopf in einem Baum ein, wovon der Mann jedoch nichts mitbekam. Alan drehte sich in Richtung des Schlages und blickte in die vor Zorn entstellte Fratze eines bemalten Kriegers. Eben jenes Mannes, auf der er geschossen, der ihn angegriffen und zu skalpieren versucht hatte. Der holte erneut zum Schlag aus und Alan griff blitzschnell nach seinem Säbel, der im Gras lag. Er bohrte ihn in den Bauch seines Angreifers, der wie ein gefällter Baum umkippte. Im Fallen traf die Kriegskeule erneut seine Schulter und betäubte seinen linken Arm so, dass er nichts mehr halten konnte. Er sank ebenfalls in Gras, neben den Mann, der sich nicht mehr rührte. Alan stöhnte vor Schmerzen und ihm wurde so übel, das er sich mehrmals übergab, bevor er sich wieder auf seine Muskete gestützt umsehen konnte. Das Blut lief ihm warm über seine Wange und alles um ihn herum schwankte. Noch immer kämpfte MacDonald mit einem Krieger, der langsam die überhand gewann, während sich die Squaw hinter einem niedrigen Busch zu verbergen suchte. Alan gelang es die Übelkeit abzuschütteln und hängte sich die Muskete wieder um. Da sein linker Arm noch immer völlig taub war und ihm den Dienst versagte, nahm seinen Säbel und rannte auf die beiden Kämpfenden zu. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, bohrte er seine Waffe dem Indianer von hinten in den Leib, wobei sie alle drei zu Fall kamen. Nach Atem ringend und halb ohnmächtig vor Schmerzen rappelte Alan sich auf und sah verstört in das ebenfalls blutverschmierte Gesicht Charles MacDonalds. „Danke …!“, brachte der keuchend heraus und schob den leblosen Körper des Indianers von sich weg. Chepie, seine Frau kam zu ihnen gekrochen und klammerte sich schluchzend an ihn. Es war, als ob sie weit weg von allem waren. Das Töten und Kämpfen um sie herum erschien wie ein ferner Schatten. Sie sahen sich nur schweigend an.