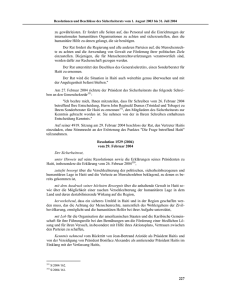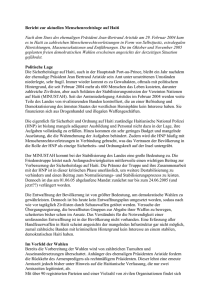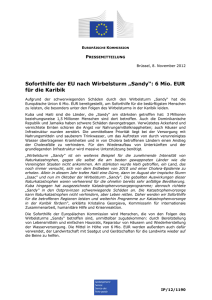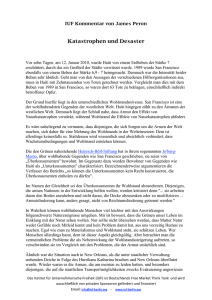Tagebuch unseres Schulbesuches
Werbung

„Haiti macht Schule“ – Haiti-Tagebuch von Thomas Roth, Präsident Hope for Haitis Kids und Michel Lochmatter, HSG-Absolvent und freiwilliger Helfer, Januar – Februar 2015 Einleitung: Anfangs Februar 2015 hielt sich unser Präsident Thomas Roth aus Thun zum dritten Mal für gut eine Woche in Haiti auf, um unsere nach dem grossen Erdbeben von 2010 in mehreren Etappen aufgebaute Schule „Maison d’Espoir Arc-en-Ciel du Haut-Valais“ zu besuchen. Begleitet wurde er vom Vereinskassier Klemens Kaufmann aus Niederglatt ZH, für den es den ersten Haitibesuch war. Bereits seit Mitte Januar weilte mit dem 25jährigen Michel Lochmatter aus St. Niklaus VS ein freiwilliger Mitarbeiter vor Ort und half während sechs Wochen tatkräftig in der Schule mit. Die nachfolgenden Tagebucheinträge und Fotos geben ungefilterte Impressionen aus den Blickwinkeln von Michel, der erstmals in einem Entwicklungsland war, und Thomas, der vor seinen Besuchen in Haiti mehrere Jahre lang in Südkalifornien im Obdachlosenbereich arbeitete und bereits in jungen Jahren längere Entwicklungseinsätze in Zentralamerika hatte. Michel, 21.01.2015 An meinem ersten Schultag in Haiti geht es morgens um acht vom Hotel zur Schule „Arc-en-ciel du Haut-Valais“. Schuldirektor Rivelino, Fahrer Jean-Marc und ich rattern mit dem dreirädrigen Töff durch eine slumartige Siedlung den steinigen Hang hinauf. Ein penetranter Geruch hängt in der Luft. Der Schweiss rinnt. Am Ende der Siedlung bläst uns der Wind giftige Gase des ständig brennenden Abfallberges ins Gesicht. Weiter oben erscheint als einziges Gebäude aus der Ferne die Schule mit 250 Primarschülern. Mir ist es, als ob ich ein Licht am Ende des Tunnels erblicke, welches für all die Kinder scheint. Ein Frühstück und ein nahrhaftes Mittagessen erleichtern den Kindern den täglichen Kampf ums Überleben. Niemand motzt in der Schulkantine, alle danken Gott. „Ohne die Schule gäbe es für die meisten Kinder nichts. Keine Bildung, kein Essen - nichts“, so Rivelino, welcher nach dem katastrophalen Erdbeben vor fünf Jahren selber zwei Waisenkinder bei sich zuhause aufgenommen hat und seither für sie sorgt. Jeden Abend verlasse ich das harte Leben da draussen und kehre in das strengbewachte Hotel am tropischen Traumstrand zurück. Es hat Elektrizität und sogar fliessendes Wasser sowie praktisch jeden Überfluss, den ich aus der Heimat kenne. Dabei frage ich mich, womit ich dies verdient habe. Weshalb haben wir in der Schweiz das Privileg, ein anderes Leben zu führen? Michel, 28.01.2015 „Schritt für Schritt“ lautet in Haiti das Lebensmotto. So trifft man etwa überall angefangene Kleinsthäuser an, wo die wenigen Armierungseisen zwischen den ersten Ziegelreihen schräg in den Himmel ragen und vielfach seit Jahren oder gar Jahrzehnten dahinrosten. Hat man wieder etwas Geld zur Seite gelegt, werden die Mauern um wenige Ziegelreihen erhöht. Eine langwierige Geschichte. Wer aber auf diese Art bauen kann, der kann sich zu den Glücklichen zählen. Denn er hat einen gutbezahlten Job. Arbeit gibt es hier nämlich kaum. Schätzungen zufolge sind 41% arbeitslos. Jeder Dritte Haitianer leidet Hunger. 75% der Bevölkerung leben in Armut. Diese Zahlen aus dem Jahre 2012 entnehme ich einem Lehrmittel, welches die Fünftklässler gerade im Geographieunterricht behandeln. Unter diesen Umständen ist es kaum verwunderlich, dass ich hier tagsüber viele Kinder auf den Strassen antreffe. Denn oft fehlt den Eltern nicht nur das Geld zum Bauen, sondern auch das Geld für die Schule. In Haiti sind die wenigsten Schulen gratis wie die unsere. Als Folge davon sind 45% der Haitianer Analphabeten. Schritt für Schritt entstand auch die Schule „Arc-en-ciel du Haut-Valais“. Der Schuldirektor Rivelino versuchte vor sieben Jahren auf dem Grundstück eines Unbekannten mit jungen Leuten schattenspendende Bäume zu pflanzen, damit Schüler wenigstens einen Ort zum lernen hätten. Mangels Wasser scheiterte das Vorhaben. Heute steht auf demselben Grundstück eine grosse, sehr beliebte Schule, was er sich damals nie erträumt hätte. Wasser hat es allerdings heute noch keines. Der 28-jährige Wasserfahrer Jean-Marc, welcher damals beim Pflanzen der Bäume dabei war, meint aber: „Wir sollen für das danken, was heute ist. Weil morgen ist es vielleicht nicht mehr.“ Unglaublich, welche Hoffnung und Dankbarkeit viele Menschen wie Jean-Marc in diesem arg gebeutelten Land ausstrahlen und existentielle Probleme Schritt für Schritt meistern. Thomas 1.2.2015 Ankunft mit der französischen Airline Air Caribes in Port-au-Prince nach einem Direktflug aus Paris. Obwohl in der haitianischen Hauptstadt kaum mehr als fünf Flugzeuge pro Tag landen, müssen wir über dem offenen Meer eine halbe Stunde lang Schlaufen drehen, die meinen durch die engen Sitze und den extrem holprigen Flug drangsalierten Magen noch mehr zusetzen. Die ersten beiden Male flog ich von Miami her und habe den Anflug als problemlos und das Check-out als absolut reibungslos in Erinnerung. Das letzte Mal hatte ich sogar vergessen, die Einfuhrerklärung auszufüllen, weshalb mich der Immigrationsbeamte kurz tief in die Augen schaute, dann nochmals einen Blick auf das Formular tat, um es dann kurzerhand und ohne weitere Fragen abzustempeln. Dieses Mal wurden wir jedoch zuerst einmal auf das Ende der Landebahn beordert, wo wir nach langem Warten in einen unklimatisierten Bus umsteigen musste, der sich nach einer endlos scheinenden Warterei endlich Richtung Terminal bewegte (die US-Maschine war gerade vor uns gelandet und blockierte das einzige Dock, welches ich beim letzten Mal benutzen durfte). Die wahre Qual fing dann erst im Terminal an: wir hatten uns keineswegs beeilt, da ich wieder mit einer problemlosen Abfertigung rechnete und davon ausging, dass wir nach Immigration und Zoll sowieso auf unser Gepäck warten musste. Zwei Stunden später waren wir eines besseren belehrt: auch in Haiti können Flughafenabfertigungen unendlich lange sein, zumal vor uns noch die endlos lange Schlange der Fluggäste aus den USA abgefertigt werden musste. Wie unsere „französische“ Schlange bestand sie zur Hälfte aus Exilhaitianer/innen und Mitarbeiter/innen von internationalen Hilfswerken. Im Flugzeug hatte ich gegenüber Klemens noch optimistisch davon gesprochen, dass vielleicht ein Teil der klar als Touristen erkennbaren Mitfliegenden auch in Haiti aussteigen würden und dadurch die darniederliegende Tourismusindustrie wieder etwas Aufschwung erhalten könnte. Doch wie zu befürchten flogen diese ausnahmslos nach der Zwischenlandung in Port-auPrince in die Dominikanische Republik weiter, d.h. auf die andere, touristisch und ökonomisch so ungleich reichere Hälfte der Insel Hispaniola. Mit gut drei Stunden Verspätung traten wir endlich aus dem Terminal hinaus und wurden von Rivelino, Danaika und dem mir ebenfalls schon vom letzten Mal bekannten Fahrer Junior begrüsst. Auch Michel hatte sich die Zeit in der Hitze und im Staub der Hauptstadt irgendwie um die Ohren geschlagen. Ohne grössere Umwege ging es dann auf direkten Weg – Klemens zog die Fahrt auf der Ladefläche dem Eingequetschtsein zu dritt im Führerstand unseres alten Nissan Pick-ups vor – in knapp zwei Stunden der Küste hoch nach Montrouis, wo wir kurz vor dem Einnachten eintrafen. Beim Einchecken im Hotel Indigo, in dem Michel bereits einquartiert war, trafen uns kurz noch die letzten Sonnenstrahlen hinter der sonst ausnahmsweise durchgehenden Wolkendecke und badeten uns und die malerische Umgebung direkt am Strand in ein fast unwirkliches Licht. Obwohl das Check-in im Hotel nur wenige Minuten dauerte, war die Sonne aber schon hinter der geheimnisvollen Insel Gonaves verschwunden, welche in der Bucht von Port-au-Prince den Horizont bildet. Auf der Hinfahrt bestaunten wir die zwischenzeitlich „noch besser als im Wallis“ (Michel) ausgebaute Küstenstrasse sowie die kleinen Märkte, welche an diesem ruhigen Sonntagnachmittag noch im Betrieb waren. In Cabaret – der Namen ist Programm – überholten wir noch einen ersten Karnevalsumzug, der – noch in Zivil d.h. für die Männer im nackten Oberkörper – schon einmal für die wenige Tage später beginnende Fastnacht Schwung zu holen schien. Thomas, 2.2.2015 In Haiti beginnt ein Tag unmittelbar mit dem Tagesanbruch, d.h. selbst im Winter kurz vor sechs Uhr morgens. Als privilegierte Weisse heisst dies für uns etwas Sport, da wir wissen, dass in der Hitze des Tages – selbst im kühlsten Monat des Jahres wird es tagsüber weit über 30 Grad heiss – solches kaum mehr möglich ist. Im Gegensatz zu meinen früheren Besuchen muss ich jedoch auf mein beliebtes Morgenjogging verzichten und damit auf die vielen ungefilterten Eindrücke, die ich dadurch jeweils erhielt. Weder meine lädierte Achillessehne noch Michels vom vielen Fussballspielen defekten Knies erlaubten solche Aktivitäten. Wir begnügten uns deshalb mit einem täglichen Schwumm dem langen Hotelstrand entlang, bis uns die aufgehende Sonne zur Arbeit rief. Der Tagesablauf der Schule ist klar geregelt: Wer das kleine Frühstück (meist der allgegenwärtige Maisbohnenbrei) erhalten will, muss schon um halb acht dort eintreffen, bevor um acht Uhr der Morgenappell mit anschliessender Nationalhymne und Fahnenaufzug ansteht. Danach begeben sich die Kinder klassenweise und in Einerkolonnen in ihre Schulzimmer, wo die ersten zwei Stunden Unterricht anstehen. Dabei gilt zwei Stunden Stillsitzen auch für die ganz Kleinen, was für diese aber kein Problem zu sein scheint. Heute wird diese Routine aber durch den Besuch von uns in jeder der 7 Klassen unterbrochen, wo wir mit je einem anderen Willkommenslied begrüsst werden. Auch wir haben etwas mitgebracht: für die Kleinen gibt es ein Stück dunkler Schokolade – die helle würde selbst um diese Jahreszeit sofort schmelzen – für die Grösseren wie schon letztes Jahr ein Basler Leckerli. Da auch dunkle Schokolade in den Fingern schnell schmilzt, muss ich die Kinder fast schon energisch auffordern, diese möglichst umgehend zu essen, da ich ihnen mein Schicksal ersparen – durch das Aufbrechen der vielen Tafeln Schokolade wurde meine weisse Hose zum getüpfelten Schwarz-weiss-Anzug – bzw. die Schulbücher und ihren schönen Schuluniformen schützen will. Beim Basler Leckerli dagegen habe ich durchaus Verständnis, wenn sie dieses für später aufbewahren oder gar nach Hause mitnehmen willen. Schliesslich gibt es für Kinder wie Erwachsene in Haiti eigentlich nie Süsses. Dies schützt zwar ihre Zähne, die mit wenigen Ausnahmen wunderschön weiss aus ihren Gesichtern blenden, zeigt aber auch das Paradox der zu Zeiten der französischen Fremdherrschaft „reichsten und schönsten Kolonie der Welt“ (angeblich Napoleons Worte), welches seinen seinerzeitigen Reichtum vor allem aus dem Zuckerrohr erwarb. Nach verschiedenen Besprechungen über die Zukunft der Schule bzw. deren anstehenden Herausforderungen – dazu später – entscheiden wir uns am Nachmittag für einen Ausflug nach Piatre, dem kleinen Bergdorf, aus dem ein grosser Teil unserer Kinder stammt. So weit wie möglich fahren wir dazu mit dem Auto den Berg hoch, bevor es klar wird, dass die Strasse nicht mehr fahrbar ist. Ab hier schaffen es nur noch einige leistungsstarke Motorräder den Berg hoch, obwohl die Strasse vor rund 10 Jahren von einer amerikanischen Hilfsorganisation (US-Aid) mit dem Ziel der Fahrtüchtigkeit für 4Rad-Fahrzeuge gebaut wurde. Allerdings gibt es solche kaum auf Haiti, da diese bereits im Ankauf, aber insbesondere im Unterhalt und beim Benzinverbrauch für die lokalen Verhältnisse nicht geeignet sind. So gehen wir zu Fuss weiter mit dem Ziel der grossen Wasserquelle, welche sich weit oben am Berghang befindet. Unsere anschliessende Bergtour hat jedoch mehr als eine touristische Zielsetzung: wir wollen herausfinden, warum seit drei Monaten kein Wasser mehr die grosse Wasserleitung herunterfliesst, welche die Landwirtschaftskooperative versorgen sollte, welche rund einen Kilometer südlich von uns liegt. Bei unserem Kurzbesuch bei derselben erfuhren wir vorher, dass es offensichtlich politische Gründe gibt, welche das Wasser zu versiegen brachte. War vor einem Jahr die Kooperative noch eine grüne Oase auf dem kargen Plateau, wo unsere Schule liegt, gab es dieses Mal auch dort nur noch Ziegen und einige wenige, fast vertrocknete Peperoni-Pflanzen zu bestaunen. Bald zeigt sich, dass unsere Mission recht schwierig war. Die Anrainer, mit denen wir dank Rivelino offene Gespräche führen konnten, wussten nicht genau, warum ihnen das Wasser abgeschnitten wurde. Offensichtlich sei es für andere Zwecke abgezweigt worden, was sich jedoch als falsch herausstellt, da es zwei grosse Quellen gibt, die eigentlich genügend sauberes Trinkwasser für alle Anwohner/innen gäben und selbst für eine vernünftige Landwirtschaft in der steilen Hanglage genügen würden. Erst auf dem Rückweg wird der Grund klar, der zeigt, wie instabil die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in diesem Land sind: die oberen Anrainer haben die Wasserleitung bewusst unterbrochen und das Wasser über ihr Land fliessen lassen, wo es schnell versickert, weil sie es unfair fanden, dass sie der Landwirtschaftskooperative, welche für den Unterhalt der Wasserleitung aufkam, eine Wassergebühr entrichten musste, welche aber nicht von einem grossen Anrainer bezahlt wurde, welcher am unteren Teil des Hanges wohnte. Das tönt ja noch verständlich, wobei es bald klar wurde, dass der Neid gegen diesen Anrainer wohl andere, irrationale Gründe hat: dieser ist nämlich ein uns bekannter weisshaariger Amerikaner namens Sam (der einzige Weisse weit und breit), der dort ein Waisenheim betreut, dessen Kinder mehrheitlich auch in unsere Schule geht. Dank seinen Beziehungen – und auch wegen seinen finanziellen Problemen – gelang es ihm, die Kooperative zu überzeugen, ihm das Wasser unentgeltlich zu geben, was den anderen Anrainern dann sauer aufstiess. Und seither haben weder er, seine 25 Kinder noch die Kooperative Wasser……. Für uns bedeutet dies, dass wir wohl auch in Zukunft uns nicht auf das Wasser verlassen können, welches eigentlich in genügender Menge rund 2 Kilometer weiter oben dem Berg entspringt, sondern – falls wir dazu überhaupt die Mittel finden – uns auf das Bohren einer eigenen Quelle konzentrieren müssten. Seit rund zwei Jahren wissen wir, dass es am Rande – knapp ausserhalb – unseres Grundstückes durchaus Grundwasser hat, wobei wir trotz „Probebohrungen“ (diese geschahen von Hand mit zwei Haitianern, die nur mit einem Seil gegenseitig gesichert mit Schaufel und Pickel bohrten, bis sie in rund 20 Metern Tiefe auf wasserhaltige Böden stiessen) noch nicht sicher sind, ob sich die Errichtung einer Pumpstation mit Pipeline überhaupt lohnen würde. Realistischerweise ist davon auszugehen, dass die eigene Quelle im besten Fall wohl nur unsere eigenen Trinkwasserbedürfnisse abdecken könnte, jedoch kaum für die gewünschte Bewässerung unseres Grundstückes für den Anbau von Bäumen und eines Schulgartens. So werden die wenigen schon früher gepflanzten Bäume durch unsere Mitarbeitenden weiterhin liebevoll von Hand begossen, damit sie die rund 5monatige Trockenperiode überstehen. Michel, 4.2.2015 „Oui, j’ai bien dormi — grace à dieu“, höre ich hier in Haiti oft als Antwort auf die Frage, ob die Nacht gut war. Auch kann Gott dafür gedankt werden, dass mithilfe der Stiftung „Oberwallis für Kinder unserer Welt“ 250 Kinder zwei Mahlzeiten am Tag kriegen und so gut schlafen können. Denn zuhause herrsche oft eine Misere, erzählt mir Monsieur Serge. Der Lehrer und Journalist führt aus, dass hier Leute langsam vor Hunger dahin sterben und kommt zum Schluss: „Es sei, als ob die Leute existieren, aber sie leben nicht.“ Es hat natürlich auch jene Haitianer wie etwa unsere Lehrer, die sich und ihrer Familie genug zu essen kaufen und davon leben können, anstatt nur zu existieren. Darüberhinaus gibt es die vermögenden Mulatten und Bourgeoisen, welche die schönsten Villen, Privatstrände und Motorboote besitzen. So betrachten wir auf einem Fischerboot-Trip entlang der bekannten Côte des Arcadins unter anderem das prächtige Anwesen des einst populären Kompa-Musikers und heutigen Staatschefs Michel Martelly. Hat er es mit Staatsgeldern bezahlt? Aus irgendeinem Grund hat der haitianische Staat nämlich kein Geld für die Schulfinanzierung. Bei einem Besuch einer staatlichen Schule erfahren wir vom Direktor, dass die Lehrer der Sekundarstufe seit acht Jahren keinen Lohn mehr bekommen. Doch es sei besser zu unterrichten, als nichts zu machen. Mit Mühe kratzen sie etwas Geld für die Spesen zusammen. Die meisten Schulen im Land sind dementsprechend privat finanzierte Schulen, welche aus Projekten von NGOs hervorgegangen sind. Nicht alle privaten Schulen bieten Mahlzeiten an. So kommen mittags oft zwei hungernde Brüder zu unserer Schule, um auf eine Portion Reis oder Mais zu spekulieren. An ihrer Schule gibt es kein Essen. Zuhause meist auch nicht. An einem Montag kurz vor Mittag treffe ich beide vor der Schulküche an. Der Jüngere schweigt wie immer. Er ist ausgehungert und merklich deprimiert. Die wenigen Worte des Vierjährigen schockieren mich. Seit Samstag habe er nichts mehr gegessen, weshalb er das Brot unserer zu Hilfe eilenden Chefköchin Astrid aufgrund der Entkräftung nur langsam isst. Auch wenn die Beiden im Gegensatz zu unseren Schulkindern im Verborgenen essen müssen, damit es sich in der Umgebung nicht herumspricht, können sie Gott für die rettenden Rationen danken. Eine andere Köchin erklärt mir folgendes, wobei sie gleichzeitig auf den vierjährigen Jungen schielt: „Für jeden Menschen, dem man hilft, werde Gott einem irgendwann danken, indem er es vielfach zurückgibt.“ Artikel 4 vom 11.02.2015 An einem Freitag fahren wir nach Port-au-Prince mit dem Ziel, den Bildungsminister zu treffen. Thomas und Klemens, welche aus der Schweiz für eine Woche nach Haiti gereist sind, sowie die Schulvertreter Rivelino und Danaika begeben sich zusammen mit mir aufs Gelände des Bildungsministeriums. Aus dem Treffen mit dem Minister wird wie erwartet nichts. Dafür nimmt uns der Zweitoberste in seinem Container-Büro in Empfang. In der Hoffnung, dass die Präsenz von uns drei Weissen – wie dies leider oft der Fall ist in Haiti – etwas bewirkt, bitten wir den „Directeur Général“ um die Aufnahme unserer Primarschule in das staatliche Schulfinanzierungsprogramm PSUGO. Vergebens. „Je ne peux rien faire pour vous“, hören wir mehrmals von ihm. Dabei heisst PSUGO ausgeschrieben und übersetzt so viel wie „Programm für einen umfassenden kostenlosen und obligatorischen Schulbesuch“. In Montrouis, unserem Standort, sind nur zwei Schulen in diesem Programm. Die Gelder, welche sie bis anhin gemäss Behördenangaben kriegten, würden unserer Schule nicht einmal für einen Monat Schulbetrieb genügen. Mir wird spätestens jetzt klar, dass es für die 250 verarmten Kinder nur einen Weg zu Bildung und Nahrung gibt: Eine Spende auf das Konto der Stiftung „Oberwallis für Kinder unserer Welt“ mit der IBAN CH26 8049 6000 0021 3682 0. Nach einer erfolglosen Bettelaktion beim Ministerium und einer Nacht in der „capitale de la misère“, so wird die Hauptstadt von Einheimischen genannt, geht’s in den Süden nach Jacmel, wo sogar ein paar Touristen anzutreffen sind. Denn hier laufen gerade die Vorbereitungen für den Karneval, welcher jenem von Rio de Janeiro nachempfunden sein soll, auf Hochtouren. Da Thomas und Klemens nach einer Woche in Haiti am Sonntagnachmittag bereits abfliegen, verpassen wir die Karnevalseröffnung um wenige Stunden und fahren zurück nach Port-auPrince durch das Quartier „Cité Soleil“ mit den übelsten Slums weiter zum Flughafen. Für die beiden Schweizer winkt die schöne heile Welt. Für die Kinder der Schule „Arc-en-Ciel du Haut-Valais“ heisst es am Montag und Dienstag zuhause bleiben. Für manche bedeutet dies zwei weitere Tage wenig oder gar kein Essen. Kommunale sowie nationale Probleme führten nämlich zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Staatsgewalt. Zwei an der Strasse wohnende Kleinkinder starben aufgrund des Tränengases. Gut, konnten wenigstens unsere gefährdetsten Kinder oben am Hang in der sicheren Schule Unterschlupf finden.