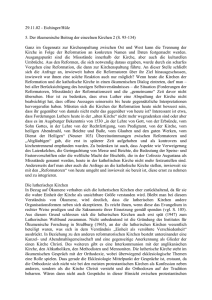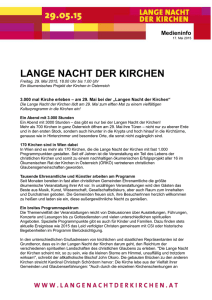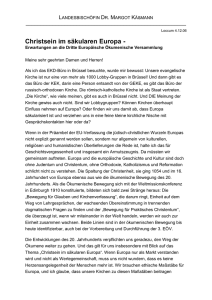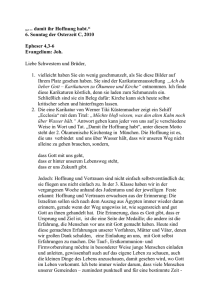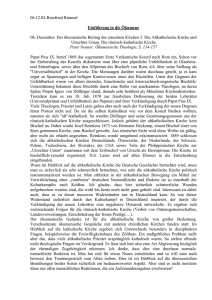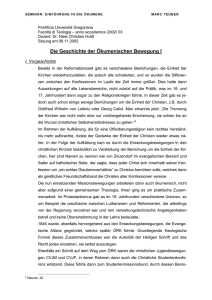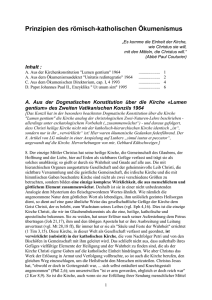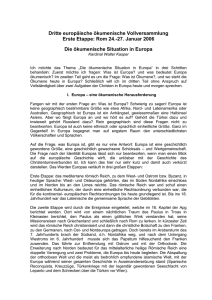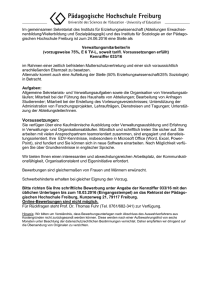Ansprache von Prof. Dr. Friederike Nüssel
Werbung
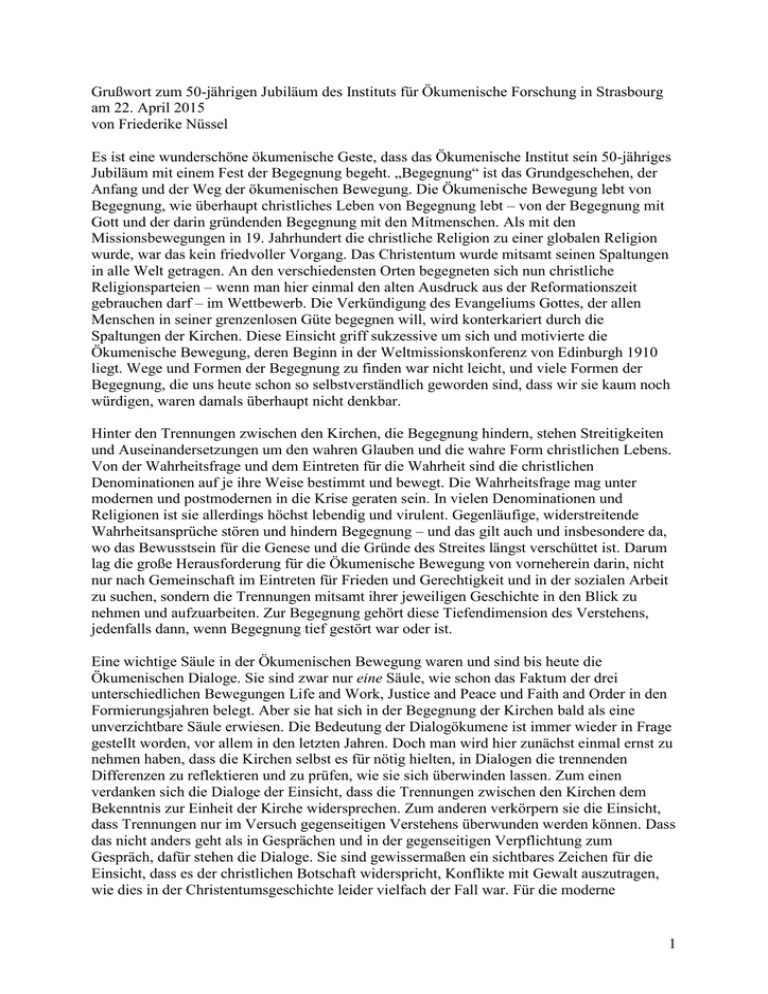
Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum des Instituts für Ökumenische Forschung in Strasbourg am 22. April 2015 von Friederike Nüssel Es ist eine wunderschöne ökumenische Geste, dass das Ökumenische Institut sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Fest der Begegnung begeht. „Begegnung“ ist das Grundgeschehen, der Anfang und der Weg der ökumenischen Bewegung. Die Ökumenische Bewegung lebt von Begegnung, wie überhaupt christliches Leben von Begegnung lebt – von der Begegnung mit Gott und der darin gründenden Begegnung mit den Mitmenschen. Als mit den Missionsbewegungen in 19. Jahrhundert die christliche Religion zu einer globalen Religion wurde, war das kein friedvoller Vorgang. Das Christentum wurde mitsamt seinen Spaltungen in alle Welt getragen. An den verschiedensten Orten begegneten sich nun christliche Religionsparteien – wenn man hier einmal den alten Ausdruck aus der Reformationszeit gebrauchen darf – im Wettbewerb. Die Verkündigung des Evangeliums Gottes, der allen Menschen in seiner grenzenlosen Güte begegnen will, wird konterkariert durch die Spaltungen der Kirchen. Diese Einsicht griff sukzessive um sich und motivierte die Ökumenische Bewegung, deren Beginn in der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910 liegt. Wege und Formen der Begegnung zu finden war nicht leicht, und viele Formen der Begegnung, die uns heute schon so selbstverständlich geworden sind, dass wir sie kaum noch würdigen, waren damals überhaupt nicht denkbar. Hinter den Trennungen zwischen den Kirchen, die Begegnung hindern, stehen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen um den wahren Glauben und die wahre Form christlichen Lebens. Von der Wahrheitsfrage und dem Eintreten für die Wahrheit sind die christlichen Denominationen auf je ihre Weise bestimmt und bewegt. Die Wahrheitsfrage mag unter modernen und postmodernen in die Krise geraten sein. In vielen Denominationen und Religionen ist sie allerdings höchst lebendig und virulent. Gegenläufige, widerstreitende Wahrheitsansprüche stören und hindern Begegnung – und das gilt auch und insbesondere da, wo das Bewusstsein für die Genese und die Gründe des Streites längst verschüttet ist. Darum lag die große Herausforderung für die Ökumenische Bewegung von vorneherein darin, nicht nur nach Gemeinschaft im Eintreten für Frieden und Gerechtigkeit und in der sozialen Arbeit zu suchen, sondern die Trennungen mitsamt ihrer jeweiligen Geschichte in den Blick zu nehmen und aufzuarbeiten. Zur Begegnung gehört diese Tiefendimension des Verstehens, jedenfalls dann, wenn Begegnung tief gestört war oder ist. Eine wichtige Säule in der Ökumenischen Bewegung waren und sind bis heute die Ökumenischen Dialoge. Sie sind zwar nur eine Säule, wie schon das Faktum der drei unterschiedlichen Bewegungen Life and Work, Justice and Peace und Faith and Order in den Formierungsjahren belegt. Aber sie hat sich in der Begegnung der Kirchen bald als eine unverzichtbare Säule erwiesen. Die Bedeutung der Dialogökumene ist immer wieder in Frage gestellt worden, vor allem in den letzten Jahren. Doch man wird hier zunächst einmal ernst zu nehmen haben, dass die Kirchen selbst es für nötig hielten, in Dialogen die trennenden Differenzen zu reflektieren und zu prüfen, wie sie sich überwinden lassen. Zum einen verdanken sich die Dialoge der Einsicht, dass die Trennungen zwischen den Kirchen dem Bekenntnis zur Einheit der Kirche widersprechen. Zum anderen verkörpern sie die Einsicht, dass Trennungen nur im Versuch gegenseitigen Verstehens überwunden werden können. Dass das nicht anders geht als in Gesprächen und in der gegenseitigen Verpflichtung zum Gespräch, dafür stehen die Dialoge. Sie sind gewissermaßen ein sichtbares Zeichen für die Einsicht, dass es der christlichen Botschaft widerspricht, Konflikte mit Gewalt auszutragen, wie dies in der Christentumsgeschichte leider vielfach der Fall war. Für die moderne 1 Entwicklung des Christentums ist das Faktum der Dialogökumene darum in seiner Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Das Institut für Ökumenische Forschung in Strasbourg hat an der Entwicklung der Dialogökumene einen elementaren Anteil. Seit seiner Gründung begleitet es einerseits die multilaterale Ökumene in der Faith and Order Bewegung und in den Verständigungsbemühungen zwischen den Kirchen reformatorischer Prägung, wie sie sich in der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa formiert haben. Zum anderen begleitet das Institut zahlreiche bilaterale Dialoge auf Weltebene zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Römisch-Katholischen Kirche, der Anglikanischen Kirchengemeinschaft, den Orthodoxen Kirchen, den Reformierten Kirchen, den Pfingstkirchen, den Mennoniten. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass das Institut dies als Forschungseinrichtung tut. Der Name „Institut für Ökumenische Forschung“ zeigt das an. Um die Kirchen bei ihren Dialogen unterstützen zu können, bedarf es der gründlichen Erforschung der Gegenstände, die in den Dialogen reflektiert werden, und das sind in der Regel die Lehrdifferenzen, die sich wiederum in der Gestaltung der kirchlichen Praxis und Frömmigkeit niederschlagen. Um die Lehrunterschiede bearbeiten zu können, muss man zunächst einmal die eigene Lehre verstehen und dem Dialogpartner verständlich machen können. Als Einrichtung des Lutherischen Weltbundes ist es darum Aufgabe des Instituts, sich in besonderer Weise um die Auslegung der lutherischen Lehre zu bemühen. Das geht nicht ohne wissenschaftliche Lutherforschung, der sich das Institut mit seinem Collegium widmet, in dem seit seiner Entstehung stets namhafte Lutherforscher vertreten sind. Aber die Lutherforschung ist nur ein Forschungsbereich. Daneben betreibt das Institut konfessionskundliche Forschung, die für das Verstehen der Dialogpartner unerlässlich ist. Diese Forschung umfasst zum einen die geschichtliche Entwicklung der Kirchen und Denominationen, zum anderen die Lehrentwicklung im engeren Sinne. Und schließlich besteht ein dritter großer Bereich der Forschungsarbeit des Instituts in der ökumenischen Methodik. Das Institut hat entscheidenden Anteil nicht nur an der Entwicklung der Methode des differenzierten Konsenses, sondern auch an ihrer Präzisierung als differenzierenden Konsens. Die ökumenische Methodik lässt sich dabei nicht trennen von der Frage nach der ökumenischen Zielvorstellung. Und auch hier hat das Institut wesentlich zur Profilierung der lutherischen Ökumene beigetragen, indem es zum einen die ökumenischen Zielvorstellung der Einheit in versöhnter Verschiedenheit entwickelt hat, und in dem es zum anderen das ökumenische Potential des reformatorischen Kirchenverständnisses für die Bildung von Kirchengemeinschaft systematisch in den Dialogen erschließt. Man könnte viele Beispiele nennen für die unermüdliche Forschungsarbeit der Direktoren und Professorinnen und Professoren am Institut. Diese bestehen zum einen in vielen wissenschaftlichen Monographien und zahllosen Artikeln, in denen die ökumenische Forschung vorangebracht worden ist – und dies ist gewissermaßen die sichtbare Seite der Arbeit des Instituts. Daneben gibt es zum anderen aber noch eine unsichtbare Seite. Das Collegium des Instituts begleitet nicht nur viele Dialoge, sondern leistet in diesen Dialogen eine elementare Arbeit in Gestalt von Referaten und Textentwürfen. Diese Arbeit wird nur für die sichtbar, die an den Dialogen teilnehmen. Die Dialogdokumente sind Gemeinschaftswerk und lassen nicht mehr erkennen, wer hier was geschrieben und beigetragen hat. Das ist gut und sinnvoll so. Aber das Jubiläum heute darf man doch zum Anlass nehmen, einmal auf diese unsichtbare und selbstlose Arbeit des Instituts hinzuweisen. Ohne die Textentwürfe, die von den Mitarbeitern in den Dialogen erarbeitet werden, wären viele Dialoge nicht so erfolgreich oder gar nicht möglich gewesen. Ich möchte Ihnen dafür zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung geben. 2 Das eine Beispiel bildet das Dialogdokument der internationalen lutherisch-katholischen Kommission für die Einheit zum Reformationsgedenken im Jahr 2017. Es trägt den Titel „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ und wurde 2013 zuerst publiziert. Inzwischen gibt es bereits eine dritte Auflage. Man kann sagen, dass die Kommission in der Erarbeitung des Dokuments selber einen Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft zurückgelegt hat – und zwar gar nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch im Ringen um die Form des Dokuments. Die Gruppe sollte und wollte einen Text schreiben, der den Kirchen in ihren ganz unterschiedlichen Kontexten eine Hilfestellung gibt, der Bedeutung der Reformation gemeinsam zu gedenken. Nach mehreren Etappen der Arbeit waren es die Leiter des Instituts für Ökumenische Forschung in Strasbourg und des Adam-Möhler-Instituts in Paderborn, die der Kommission einen Vorschlag unterbreiteten, der sich schließlich als tragfähig erwies. Wer das Dokument liest und die Arbeit der Institute ein wenig kennt, kann sehen, wie hier die Forschungsleistung der Institute Früchte getragen hat. Das gilt zum einen für die Methode, die hier eingeschlagen wird. Wie kann man der Reformation gemeinsam in einer fruchtbaren Weise gedenken? Diese schwierige Frage, die momentan viele Kirchen und Gremien mit Blick auf 2017 beschäftigt, findet in dem Dokument eine einfache und zugleich höchst produktive Antwort. Sie lautet: „Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen.“ (16) Wie geht das? Nun, indem der Reformation im Lichte der jüngeren evangelischen und katholischen Lutherforschung und im Lichte der Dialoge gedacht wird, die Katholiken und Lutheraner nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geführt haben. So wird es möglich, keine andere Geschichte der Reformation zu erzählen, aber die Geschichte anders zu erzählen. Das geschieht in drei elementaren Schritten. Im ersten Schritt gibt die Studie Einblick in die neuere Lutherforschung und zeigt, wie es im Lichte der Erneuerung der katholischen Theologie Katholiken möglich geworden ist, „Martin Luthers Reformanliegen zu würdigen und sie mit größerer Offenheit zu betrachten, als dies früher möglich schien“ (28). Im nächsten Schritt wird sodann eine historische Skizze der lutherischen Reformation und der katholischen Antwort geboten. Hier gelingt es, die Geschichte der Reformation und der katholischen Antwort in Grundzügen ganz einfach zu erzählen. Man muss nicht theologisch gebildet sein, um diese beiden Kapitel zu verstehen. Und doch basieren sie auf dem ganzen Umfang und Gewicht der Lutherforschung und den neuen Perspektiven, die sie erschlossen hat. Wir wissen alle, dass man eine Geschichte erst dann einfach erzählen kann, wenn man sie wirklich durchdrungen hat und versteht, wenn man also weiß, was wirklich wichtig war und welche Deutungen anhand der Quellenlage vertretbar sind. Und so verdankt diese schöne einfache Darstellung ihre Souveränität der Forschungsleistung derer, die hier gedraftet haben. Doch damit nicht genug. Im dritten Schritt werden die Dialoge einbezogen, in denen es möglich wurde, die wesentlichen Themen und Anliegen lutherischer Theologie gemeinsam zu erschließen. Diese Darstellung basiert auf der genauen Kenntnis und aktiven Beteiligung in den Dialogen. Sie zeigt in knappen Zügen, was erreicht ist und wie es weiter gehen kann. Es wird auf diese Weise sichtbar, dass die evangelisch-katholische Dialogökumene faktisch selbst eine Form des Reformationsgedenkens ist. Und es wird damit auch deutlich, dass das Ziel ökumenischer Verständigung nicht jenseits der Dialoge liegt, sondern sich in den Dialogen zu realisieren beginnt. Am Ende werden anknüpfend an die Geschichte, die nun anders erzählt wurde, fünf ökumenische Imperative formuliert. Einer der Imperative lautet: „Lutheraner und Katholiken müssen gemeinsam die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit neu entdecken“. Das wäre eine gesetzlich anmutende Forderung, stünde der Imperativ nicht am Ende dieser Studie, die den Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft 3 beschreibt. Der Text nimmt darin die Herausforderung an zu zeigen, wie durch die erneute Beschäftigung mit der Tradition die alten konfessionellen Gegensätze, insbesondere in der Rechtfertigungslehre, überwunden werden konnten. Der Imperativ ist nicht gnadenlos, weil er an einen Weg anschließt und an eine Spur, die schon gelegt ist. Ein weiteres Beispiel für die immense Hintergrundarbeit des Instituts für Ökumenische Forschung bieten der Dialog mit den Mennoniten und die Versöhnung, die auf der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart möglich geworden ist. Auch hier hat namentlich der Direktor des Instituts Theodor Dieter mit seiner Forschung maßgeblich dazu beigetragen, die Geschichte der Beziehungen zwischen Lutheranern und Täufern bzw. Mennoniten von lutherischer Seite zu erschließen. Das Institut hat sich überdies wesentlich dafür eingesetzt, dass es nicht einfach bei der Versöhnungsgeste in Stuttgart bleibt. Inzwischen gibt es einen Trialog zwischen Mennoniten, Lutheranern und Katholiken, in dem gemeinsam das Verständnis der Taufe reflektiert wird unter Berücksichtigung aller dafür wesentlichen Aspekte wie insbesondere des Verständnisses von Sünde, Gnade, Heiligung und Erneuerung. Der Trialog stellt ein Novum dar, indem zum einen drei Konfessionen beteiligt sind und Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Dreier-Konstellation noch einmal anders hervortreten als im bilateralen Gespräch. Zum anderen ist das Ziel des Trialogs nicht die Überwindung einer kirchentrennenden Frage. Vielmehr geht es darum, genau zu verstehen, wie die Differenzen im Taufverständnis motiviert sind, zu eruieren, wo wechselseitig Fehlvorstellungen von der jeweils anderen Tauftheologie und Taufpraxis vorliegen, und diese zu überwinden. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung für die ganze Frage nach der Anerkennung der Taufe, die nicht nur da virulent ist, wo die Anerkennung noch nicht oder nicht in jedem Fall gegeben ist, sondern auch da, wo sie praktiziert wird. Ich habe Ihnen hier nur zwei Beispiele genannt für die wichtige und zum Teil unsichtbare Arbeit des Instituts in den Dialogen und den sie umgebenden ökumenischen Prozessen. Diese Arbeit können die Ökumenischen Institute an den Universitäten im Rahmen ihres universitären Auftrages und ihrer Lehr- und Prüfungsverpflichtung nicht erbringen. In seiner institutionellen Formation war es dem Institut in Strasbourg bisher vergönnt, Forschung zu betreiben, ohne permanent auf die Sichtbarkeit dieser Forschung in Publikationen und Drittmitteleinwerbungen achten zu müssen, wie das universitäre Einrichtungen immer stärker tun müssen. Der Forschung tut dieser Druck nicht immer gut. Denn nicht immer lassen sich Ergebnisse schnell erzielen, und die Gefahr, dass die Selbstdarstellung gegenüber dem hartnäckigen Verfolgen des Forschungszieles in den Vordergrund tritt, ist immer gegeben. Selbstdarstellung kann aber kein Ziel sein. Für theologische Forschung gilt das allzumal – wenn wir die Rechtfertigungslehre auch in diesem Kontext ernst nehmen. In diesem Sinne wünsche ich der Ökumenischen Forschung und der Ökumenischen Bewegung, dass das Institut weiterhin diesen seinen wichtigen Dienst tun und die ökumenischen Begegnungen und Dialoge zwischen den Kirchen mit Grundlagenforschung begleiten kann. Es wird oft gesagt, dass die Dialoge stagnieren – weil wir nach einer Phase, in der viele Klärungen möglich waren, nun an die Themen gestoßen sind, in denen die Differenzen noch tief sind und sich die Überwindung der Trennungen nicht schnell erwarten lässt. Aber die Konstellationen ändern sich, nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung pfingstlicher und charismatischer Kirchen und Strömungen und die immer neuen Spannungen zwischen den Konfessionen und Religionen. Um Gerechtigkeit und Frieden im ökumenischen Miteinander der Kirchen zu befördern, sind die Dialoge unverzichtbar, und es wäre durchaus wichtig, ihre Rolle für ein ziviles ökumenisches Miteinander der Kirchen noch deutlicher herauszustellen. Damit verbunden ist es wichtig, dass es Einrichtungen gibt, die diesen Prozessen wissenschaftlich fundiert zuarbeiten – wie dies das Institut für Ökumenische Forschung in Strasbourg tut. 4