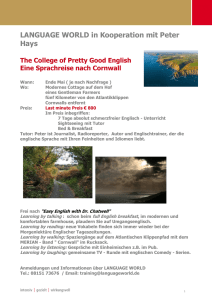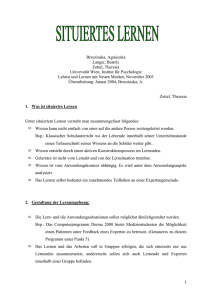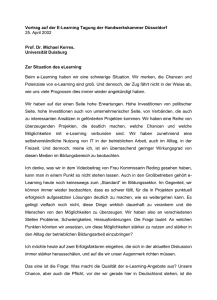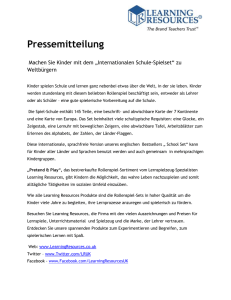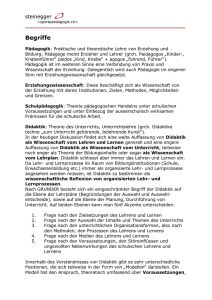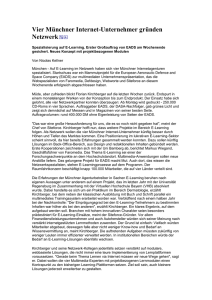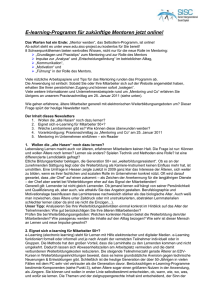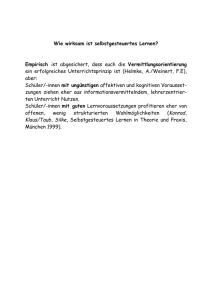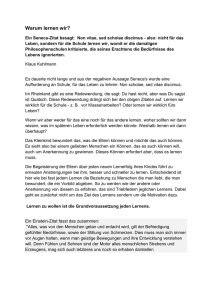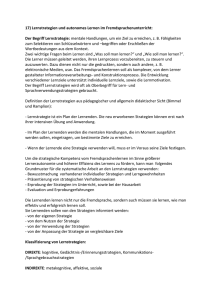M_NM_Universitaet_Leipzig_Didaktik
Werbung
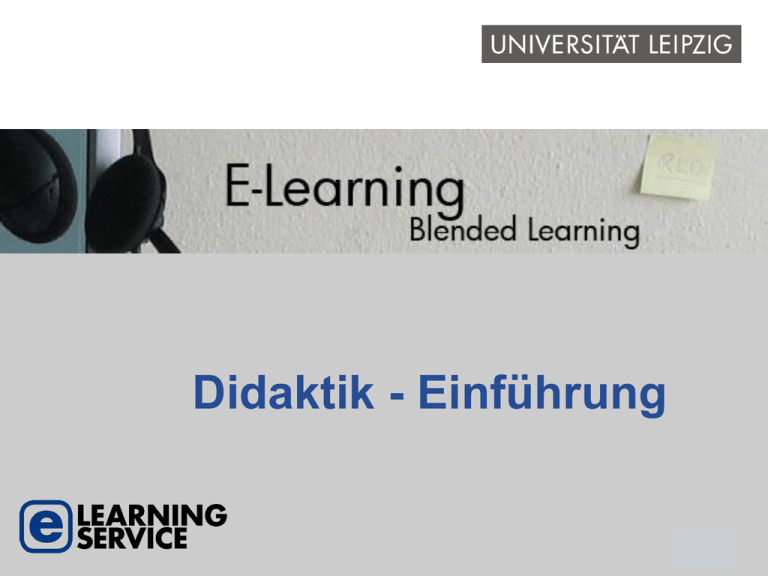
Didaktik - Einführung Gibt es eine E-LearningDidaktik oder E-Didaktik? Rolf Arnold: „Es gibt keine ELearning-Didaktik. Die Fragen, die sich bei der Nutzung neuer Medien in Lehr-Lernprozessen stellen, sind die Alten. Zwar kann man – wie vielfach beobachtbar – fragen, ob und inwieweit die Netzbasiertheit das Lehr-Lernarrangement das Lernverhalten der unterschiedlichsten Lerntypen in genuiner Weise prägt, anregt, verändert etc., doch bewegt man sich dabei in dem breiten Bereich der Lehr-Lernforschung, der wenig oder kaum einen signifikanten Bezug zu den Charakteristika eines virtuellen Lernens aufzeigt.“(Arnold (Vivian, 10 Jahre) Inhalt Kapitel 1 2006, 12 f.) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 2 Überblick zur E-Didiaktik Einführung Theoretische Grundlagen/ Didaktische Modelle Didaktik Lernen/Lehren und Technik Lernen mit Digitalen Medien Erweitung des Lernens durch E-Learning Möglichkeiten des Einsatzes von E- und Blended Learining in Anlehnung: http://www.crashkurs-elearning.ch/IN Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 3 Inhalte 1 Einführung 1.1 Was ist E-Didaktik? – Definitionen 1.2 Begriffe des E-Learning 2 Theoretische Grundlagen und Didaktische Modelle 2.1 Lernen und Didaktisches Design 2.2 Dimensionen des Lernens 2.3 Lerntheorien 3 Lernen mit digitalen Medien 3.1 Lernkonzepte im E-Learning 3.2 Voraussetzungen für erfolgreiches E-Learning 4 Vom Lernen zum Lehren 4.1 Lernen und Technik 4.2 Lernen und Lehren mit Informationstechnologien 5 Erweiterung des Lernens durch E-Learning 5.1 Möglichkeiten des Einsatzes von E- und Blended Learning 5.2 E-Learning im Studienalltag Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 4 Inhalte im Überblick Theoretische Grundlagen Didaktik/E-Didaktik? Möglichkeiten Theoretische Grundlagen/ Didaktische Modelle Einführung Rahmenbedingungen Lernen und Technik Lernen/ Lehren und Technologien Lerntheorien Paradigmen des Lernens Didaktisches Design Didaktik Lernkonzepte Digitale Medien Lernen/Lehren mit Informationstechnologien Dimensionen des Lernens Vorraussetzungen für erfolgreiches E-Learning Erweitung des Lernens durch E-Learning Möglichkeiten des Einsatzes von E- und Blended Learning Testfragen Links/Literatur Material online in Anlehnung: http://www.crashkurs-elearning.ch/IN Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 5 1 Einführung E-Learning und Didaktik Die klassischen Lernorte und Lernumgebungen finden sich bei Studierenden nicht mehr nur in realer sondern meist auch in semivirtueller oder virtueller Form als Ergänzung orts- und zeitunabhängig wieder. In unterschiedlicher Weise können hier innovative und das Potenzial steigernde Eigenschaften der Neuen Medien genutzt werden. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Foto: © S. Hofschlaeger/PIXELIO Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 6 Allgemeine Rahmenbedingungen • „Google-Generation“/“Digital Natives“ • v. a. Studierende aufgeschlossen gegenüber Neuen Medien • breite Nutzung v. a. von Homepage (Skripts) Organisation/Content Kosten/Ökonomie Didaktik Blended-Learning Szenarien Kultur Technik „Kinder an die Rechner. (…) Zuhause gehört der PC zum Mobiliar, im Klassenzimmer ist er Mangelware: Deutschlands Schulen sind zu schlecht mit Bildschirmtechnik ausgestattet.“ (Warnecke in:Tagesspiegel Nr. 19/223, B2, 2006) (in Anlehnung an Henning/Hoyer in Reusser 2006, 97) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Vor dem Hintergrund allgemeiner Rahmenbedingungen der Kosten, Organisation, Technik und Kultur, welche sich gegenseitig bedingen, findet E-Learning statt. Die Schaffung einer ELearning-Lernkultur ist von diesen Faktoren beeinflusst. Günstig erscheint, wenn die sich bedingenden Faktoren in gleicher Weise Beachtung bei der Planung und Umsetzung finden. Kapitel 4 Kapitel 5 7 Erweiterung der Möglichkeiten Die Umsetzung von E- und Blended Learning ermöglicht nicht nur LehrLerninhalte multimedial, verlinkt und interaktiv darzulegen, sondern erhöht zudem den Grad der Anschaulichkeit und wirkt motivierend auf den Lern-prozess, erhöhend auf Behaltens-effekte, unterstützend auf das kreative Weiterdenken, den Verstehensprozess wie auch beim Aufbau mentaler Modelle (MultimediaDidaktik). Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 8 1.1 Was ist E-Didaktik? – Definitionen Was ist gemeint, wenn von E-Didaktik oder Multimedia gesprochen wird? Welche Begriffe sollte man wissen? Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Didaktik Didaktik wird verstanden als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. In einem Prozessablauf werden einzelne Schritte des Planens, Leitens und der Evaluierung von Unterricht nach Grundsätzen aus der Didaktik unterschieden. Foto: © UL/Sylvia Dorn Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 9 E-Didaktik Wird oftmals auch als Mediendidaktik bezeichnet. Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit dem Einsatz von Medien zum Erreichen pädagogisch reflektierter Ziele; in ihren Bereich gehören vor allem die Unterrichtsmedien. (Dieter Baacke: Medienpädagogik in: Die Vermessung des Feldes. 1997, 4) Mediendidaktik als Bereich der Didaktik beschäftigt sich damit, wie Medien als Hilfsmittel für einen erfolgreichen Unterricht eingesetzt werden können bzw. allgemein damit, welche Rolle Medien bei der Gestaltung von Lehr-/ Lern-Prozessen spielen. (in: Astrid Blumstengel: Entwicklung hypermedialer Lernsysteme,1998) Vgl.: http://beat.doebe.li/bibliothek/w01503.html Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 10 Theoretische Fundierung der E-Didaktik Entwicklung von Theorien: • Sozialer Konstruktivismus (Vygotski, 1978) • Mindful Learning (Langer, 1997) • Communities of Practice (Wenger, 1998) • E-Moderation (G. Salmon, 2000) • E-tivities (G.Salmon, 2002) Wichtige und grundlegende Schriften: Vygotski, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, Langer, E. J. (1997) Mindful Learning. Perseus Books, Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity.Cambridge, Salmon, G. (2000). EModerating. London, Salmon, G. (2002). Etivities. London. Vgl.: J. Pauschenwein, 3.11.05, zml.fh-joanneum.at 16 Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 11 Klassische Didaktik Vorherrschende Lernsituation: Zumeist wird in der Vermittlung Faktenwissen, gewonnen aus fachwissenschaftlichen Erkenntnissen, dem Lernenden zur Verfügung gestellt. Foto: © Carola Langer/PIXELIO Das Lernen findet in den Fachdisziplinen durch einen hohen Grad der Spezialisierung statt, dabei werden v. a. die Strukturprinzipien der abgegrenzten Fachwissenschaften beachtet. (in Anlehnung an Mayer/Treichel 2004, 3) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 12 Vermittlungsformen: Die Vermittlungsformen sind dabei v. a. autoritär geprägt und kommen überwiegend in der Umsetzung durch Frontalunterricht in den Präsenzphasen zum Ausdruck. Es werden sprachlich orientierte, lehrerzentrierte Vermittlungsformen bevorzugt. Im Vordergrund steht die Förderung kognitiven Lernens, die in der Lehre durch die Orientierung auf Wissenswiedergabe gefördert wird. (in Anlehnung an Mayer/Treichel 2004, 3) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 13 Multimediadidaktik „Neue Medien“ hat es immer wieder gegeben: auch Film, Funk oder Fernsehen waren einmal neue Medien. Zurzeit meint man damit „Digitale Medien“ und fasst unter diesem Terminus eine Anzahl medialer Produkte und Dienstleistungen aus dem Informations- und Kulturtechnologie-Bereich zusammen, die mittlerweile als traditionelle mediale Produkte empfunden aber häufig die Dienstleistungen noch immer als neuartig empfunden werden. Inhalt Kapitel 1 Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 14 Zuordnungen innerhalb Multimedia Bereiche: Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO • Erfassung, Speicherung, Bearbeitung, Darstellung und Versand von Mediendaten durch Digitaltechnik, • Möglichkeiten der Integration verschiedener Medientypen (Video-/Audiosequenzen, Texte usw.) durch Digitaltechnik, • Interaktive Nutzbarkeit von Medien durch Digitaltechnik, • Verlinkung (Verknüpfung) von Medienobjekten durch Digitaltechnik, (lokal oder über das Internet). Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 15 1.2 Begriff des E-Learnings Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Definitionsansatz: E-Learning (Electronic Learning) kann als Lernen und Lehren mit Neuen Medien bezeichnet werden. Angrenzende Begriffe sind E-Teaching, Blended Learning, Lernen mit Informations- und Kommunikationstechnologien und mit darauf respektiv aufbauenden Lernsystemen, Lernen mit dem Internet oder auch computergestützte, internetbasierte Lehr- und Lernformen. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 16 Hintergründe: Ansätze zu E-Teaching/E-Learning gibt es bereits seit den 1960er Jahren. Mit zunehmenden Neuerungen und Veränderungen in der elektronischen Datenverarbeitung sind in vielen Bereichen auch Ergänzungen und Erweiterungen durch E-Learning erfolgreich implementiert und eingesetzt worden. Während in den ersten Jahren vor allem die Entwicklung im IT-Bereich im Vordergrund standen und Einzelne sogar den alleinigen Einsatz von ELearning als Lehr- und Lernform planten, entstanden durch zunehmende Kritik an fehlender Pädagogik und Didaktik vor allem seit der Jahrtausendwende 2000 neue Tendenzen im E-Learning. Diese brachten vor allem neue Konzeptansätze mit sich, wie beispielsweise das sogenannte Hypride Lernen/Blended Learning. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 17 E-Learning noch immer ein Novum? Autoren, wie gehen davon aus, dass „bis heute […] neue Formen des Lernens mit digitalen Medien in der betrieblichen Bildungsarbeit ebenso wie in der Erwachsenenbildung im Verhältnis zu konventionellen Formen des Lernens ein randständiges Phänomen geblieben“ sind. (Kerres & de Witt & Stratmann 2003) Doch gerade hier entwickelt sich ein großes Forschungsfeld, denn der Bedarf steigt mit zunehmender Nachfrage durch eine mit digitalen Medien aufgewachsene Generation „Neuer Lernenden“. Viele E-Learning-Protagonisten sehen in E- und Blended-Learning eine sinnvolle Ergänzung zu den bewährten tradierten Lernformen. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 18 E-Learning in der Didaktik: Sesink (2002) beschreibt E-Learning als Lehr- und Lernform mit einer großen Vielfalt „… von Praktiken der informationstechnischen Unterstützung von Lehr-Lern-Prozessen […], wobei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden: Vom • gelegentlichen Einsatz informations- und kommunikations-technischer Elemente • in einem ansonsten traditionell organisierten und strukturierten Lehr- und Lern-Umfeld, bis hin zur • vollständigen Übertragung von Lehrfunktionen auf das informationstechnische Medium“. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 19 Verortung/Zuordnung von E-Learning Die Computerunterstützung von Lehre und Lernen kann grundsätzlich auf drei Gebieten erfolgen (Wetter 2004, 7 f.) • Organisation, • Kommunikation, • Inhaltserstellung. Damit lassen sich folgende Lehr-/Lernszenarien unterstützen: • multimediale Ergänzung von Präsenzveranstaltungen, • Kombination von Präsenzveranstaltungen und computergestützten Lehreinheiten • (Lehrsoftware) innerhalb eines Kurses, • computergestützte Kurse. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 20 Blended Learning Ist eine Form des E-Learning, was in Deutschland auch als „Hyprides Lernen“ bezeichnet wird und sich durch die Kritik an der fehlenden Didaktik vor allem in Bezug auf ungenügende voraus Selbstlernmotivation und die IT-Lastigkeit des E-Learnings entwickelt hat. „Blended Learning“ wird häufig auch Mixed Learning bezeichnet, und steht für eine Mischung aus Präsenzlernen gestützt durch Online-Phasen. Definitionen: „Blended Learning bedeutet wörtlich ‚gemischtes Lernen‘ und bezeichnet die Verbindung von Online- und Präsenzelementen in Lernangeboten.„ (Maier-Häfele/Häfele 2005/313) „Blended Learning bezeichnet Lehr-/Lernkonzepte, die eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von 'traditionellem Klassenzimmerlernen' und virtuellem bzw. Online Lernen auf der Basis neuer Informations- und Kommunikationsmedien anstreben.“ (Reusser 2002) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 21 Fazit! Zitat: Dozierender aus dem Bereich BWL "Die Frage ... lautet nicht mehr: „Was sage ich den Studierenden?“ sondern: „Was lasse ich die Studierenden tun, damit sie möglichst viel und nachhaltig lernen?“" Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Kapitel 4 Kapitel 5 22 2 Theoretische Grundlagen und Didaktische Modelle 2.1 Lernen und Didaktisches Design Was heißt eigentlich Lernen. Wie kann gelernt werden, welche Ausmaße kann das Lernen einnehmen? 1987 wurde von Flechsig der Begriff „Didaktisches Design“ eingeführt. Dieser umfasst die Planung, Gestaltung und Umsetzung von Lernangeboten bis hin zu Qualitätssicherung und Evaluation. Im engeren Sinn ist damit häufig nur die Gestaltung der Benutzeroberfläche gemeint. Der Begriff steht in Konkurrenz zu dem aus dem Amerikanischen entlehnten 'Instruktionsdesign'. Quelle: Global Learning - Glossar Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 23 2.2 Dimensionen des Lernens Bei der Beschreibung des „Didaktischen Designs“ geht es v. a. um die Beschreibung wie der Kenntniserwerb gestaltet ist. Der Kenntniserwerb bzw. die Verstehens- und Aneignungsprozesse sind im Wesentlichen von vier Dimensionen des Lernens abhängig. „Lernen ist – auf jedem Intensitätsniveau – ein aktiver Prozess, der Aufmerksamkeit und geistige Grundvoraussetzungen, Lernbereitschaft und ein Mindestmaß an Lust sowie eine soziale Umwelt einfordert, oder anders formuliert: Lernen hat kognitive, motivationale, emotionale und soziale Dimensionen, die zwar nicht immer in gleicher Ausprägung und Stärke, aber doch eine unabdingbare Rolle spielen.“ (Reimann 2005, 70) Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 24 Überblick: Vielfalt des Lernens (vgl. Reimann 2005, 72) . Verschiedene Qualitätsstufen Verschiedene Facetten a) Kognitive Dimension b) Motivationale Dimension c) Emotionale Dimension a) Soziale Dimension • Gedächtnis • Motive/Motivation • Interaktion • Problemlösen • Selbstbestimmung • Bezug zu Motivation/Kognition • Lerntransfer • Motiviertes Handeln • Metakognition • Selbststeuerung • Flow-Erleben • Emotionale Intelligenz • Neugier • Kooperation • Kollaberation • Kontext • Situiertheit • Interesse Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 25 a) Kognitive Dimension Die kognitive Dimension ist mit folgenden Konzepten zu umschreiben: • • • • • Gedächtnis Problemlösen Lerntransfer Metakognition Selbststeuerung „Ohne Gedächtnis ist kein Lernen möglich, weil man von Lernen nur sprechen kann, wenn neue Erfahrungen und das resultierende Wissen über die Lernsituation hinaus Veränderungen in der Person auslösen.“ (Reimann 2005, 70) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 26 b) Motivationale Dimension Die motivationale Dimension unterstützt folgenden Konzepte: • Selbstbestimmung, • Neugier (steht im Wechselverhältnis zu Wissen), • Interesse. „Motivation ist gleichsam der Motor des Lernens, der Bedürfnisse, aber auch Interesse seitens der Lernenden und eine Lernumwelt mit Aufforderungs- und Unterstützungscharakter braucht. Neugier ermöglicht intrinsisch motiviertes Lernen auch ohne äußere Anreize und Belohnungsstrukturen; Neugier fördert die Entwicklung von Interessen, und diese wiederum stabilisieren ein langfristig motiviertes Lernen.“ (Reimann 2005, 71) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 27 c) Emotionale Dimension Die emotionale Dimension steht eng in Beziehung mit der Motivation und bedingen sich meistens sogar. Konzepte sind dabei insbesondere: • Flow-Erleben und • Emotionale Intelligenz. Einfluss auf das Lernen vor allem hinsichtlich der Motivation nehmen z. B. Lust, Zufriedenheit und spielerische Leichtigkeit, womit Höchstleistungen verknüpft sein können; aber auch Ärger, Wut oder Angst können damit verbunden werden, die jedoch das Lernen und somit auch Lernleistungen negativ beeinflussen. (vgl. Reimann 2005, 71) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 28 d) Soziale Dimension Die soziale Dimension steht eng in Beziehung mit den drei anderen voran genannten Dimensionen des Lernens und ist gekennzeichnet durch die Bewusstmachung der sozialen Komponente. Sozial meint hier, dass der Lernende als Mensch und soziales Wesen gegenüber seinem Umfeld in eine Interaktion tritt, was beim Lernen beachtet werden muss. Konzepte sind dabei insbesondere: • Interaktion • Kooperation • Kollaboration • Kontext • Situiertheit „Die soziale Dimension des Lernens schließlich öffnet einem die Augen für die Bedeutung der sozialen Interaktion des Lernenden mit anderen Lernenden, mit Lehrenden, mit sozialen Artefakten und mit der soziokulturellen Umwelt.“ (vgl. Reimann 2005, 72) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 29 2.3 Lerntheorien Einerseits können von den Paradigmen des Lernens Lerntheorien abgeleitet werden. Andererseits sind tradierte Lerntheorie damit zu verknüpfen. E- und Blended Learning zur Unterstützung der Lehre und des Lernens besitzt in der praktischen Umsetzung verschiedene Kennzeichen: • konstruktivistisch (aufeinander aufbauend) orientierte Lernumgebungen • mediengestützte und -orientierte Lehr- sowie Lernstrategien • selbstgesteuertes Lernen, • informelles und lebensbegleitendes Lernen, • kooperatives Lernen mit neuen Medien. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 30 Drei Paradigmen des Lernens In der Lerntheorie und -forschung werden drei große (Lern-) Theoriesysteme unterschieden:. Kognitivismus Behaviorismus Konstruktivismus Diese „nehmen in hohem Maße Einfluss darauf, wie gelernt und gelehrt wird, welche normativen Vorstellungen mit dem Prozess des Lernend (und Lehrens) verbunden sind und mit welchem Forschungsverständnis und Methodenarsenal man versucht, dem Phänomen des Lernens näher zu kommen.“ (Reimann 2005, 148) Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 31 Behaviorismus Fundiert auf dem Reiz-Reaktions-Modell, was besagt, das auf einen äußeren Reiz (Stimulus, Input) nach bestimmten Gesetzen eine Reaktion (Response, Output) folgt. Kennzeichen sind: • Black-Box-Denken, da keine mentalen Prozesse relevant sind (zwischen Input und Output) • Gehirn wird als Organ angesehen, dass auf Reize/Reizsituationen mit vorgegebenen (angeborenen/erlernten) Verhaltensweisen reagiert • Nachfolgende Konsequenzen im Sinne neuer Reizsituationen sind von Bedeutung, da sie das Verhalten „formen“ • Die wichtigsten behavioristischen Ansätze zum Lernen sind: - das klassische Konditionieren (Pawlow, 1928), - das operative Konditionieren (Skinner, 1938), - das Lernen am Modell (Bandura, 1970) - Übergang zum Kognitivismus. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 32 Die Bedeutung von Lernparadigmen für Blended Learning – Lernen aus Sicht des Behaviorismus Lernparadigmen bilden wichtigen Hintergrund, der die Haltung zum Lernen und Lehren deutlich macht. Sie sind der Boden, auf dem didaktische Modelle entstehen. Behavioristische Auffassung von Lernen • Akt der Verhaltensänderung • durch einen geeigneten Input (Reiz) wird die „richtige“ Reaktion oder Verhaltensweise erzeugt, • durch ein geeignetes Feedback kann dieser Prozess unterstützt werden, • Lernen gilt als Sonderform des Verhaltens, • Lernen wird als Trainingsvorgang verstanden. Rolle des Lehrenden und Lernenden • Autoritäre Rolle des Lehrenden, entscheidet was zu Lernen ist, • Der Lehrende hat die Aufgabe, Reizsituationen und Konsequenzen so zu gestalten, dass die angestrebten Lernziele erreicht werden, • Der Fokus liegt auf dem Lernergebnis. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 33 Behavioristische Ansätze und Lernen mit digitalen Medien Im Bereich der digitalen Medien werden behavioristische Ansätze vor allem beim Üben und „(Ein-)pauken“ eingesetzt. Vor allem im Bereich der Sprachen und Naturwissenschaften kommen z. B. beim Vokabel- oder Mathematiktraining diese Ansätze zum Tragen. Hier wird insbesondere Lernen durch Wiederholen praktiziert, vorgegebene Übungen werden solang wiederholt, bis sie richtig gelöst werden. Oftmals werden entsprechende Lernsoftware nach diesem Prinzip aufgebaut: Lernstoff, Übung, Verfestigung/Wiederholdung, Training Ebenfalls wird das Prinzip der Nachahmung eingesetzt, indem Experten als Modelle (auch Animationen oder Anleitungen) fungieren. Diese können zudem nachvollziehbare Erklärungen geben oder Misserfolge z. B. bei Übungen rückmelden. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 34 Kognitivismus Der Kognitivismus hat als Theorieansatz seinen Ursprung mit der „kognitiven Wende“ (Mitte 20. Jhd.) im technischen und mathematischen Bereich. Basierend auf dem Informationsverarbeitungsmodell findet wie folgt die Informationsverarbeitung statt: Input (Reiz) Informationsverarbeitung Informationsspeicherung Output (Leistung) Grundmodell der Informationsverarbeitung (in Anlehnung an Edelmann, 2000) Psychische Prozesse (wie z. B. das Lernen) werden unter der Perspektive der Informationsverarbeitung betrachtet. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 35 Kognitivismus und digitale Medien Lehrender = Sender, Lernender = Empfänger Übertragung von Informationen erfolgt über Codierung und geeignete Medien.Besonders eignet sich hier das Tutormodell. Das Lernen mit digitalen Medien kann hier besonders auf der Grundlage kognitivistischer Ansätze z. B. über Planspiele erfolgen. Zu Grunde liegt das Instruktionsdesign, es umfasst die Gestaltung der Lernumgebung, wo der Lernende ein System wiederfindet. Die Unterrichtsplanung erfolgt nach Bedarfsbestimmung, die wie folgt aussehen kann: Entwicklung der Unterrichtseinheiten Durchführung Evaluation (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 36 Konstruktivismus Ausgehend vom theoretischen Konzept des Konstruktivismus ist Lernen ein eigenaktiver, autopoietischer und selbstreferentieller Vorgang mit Rückkoppelungen zur Lernumgebung bzw. Umwelt. Hier verändert sich die Perspektive der Vermittlung hin zur Aneignung, woraus folgende zentrale Postulate für Lehr-und Lernprozesse abgeleitet werden können. Lernangebote müssen demnach: • anschlussfähig sein, da Lernen ein höchst individueller Prozess ist; • sich von vorhandenem Wissen unterscheiden, wofür Differenzierungen der Wahrnehmung notwendig sind und • die Ziele, Inhalte und Methoden müssen für den Lernenden transparent, nützlich und logisch erscheinen. Dabei erscheinen die Rollen des Lehrenden und Lernenden bidirektional, d. h. auf gleicher Stufe treten sie in ein (Kommunikations-) Verhältnis, der Lehrende übernimmt keine Kontrollfunktion mehr. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 37 Konstruktivistische Ansätze und digitale Medien Im Bereich der digitalen Medien sind es vor allem jene Bereiche des Lernens, wo wenig Anleitung und Kontrolle und höhere Selbstlernaktivitäten und -prozesse stattfinden. Hier ist ein hohes Maß an Handlungsspielraum zur Exploration sowie zu eigenständigen Prozessen der Wissenskonstruktion gegeben. So werden hier die digitalen Medien auch als Werkzeuge individueller Wissenskonstruktion gesehen. Neue Kommunikationstechnologien, wie etwa Plattformen und Tools stehen hier für kooperatives und kollaboratives Lernen und eignen sich daher gut für die Umsetzung konstruktivistischer Lernansätze. Darüber hinaus werden insbesondere komplexe Lernumgebungen mit dem Konstruktivismus in Verbindung gebracht. (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 38 Lehren und Lernen aus Sicht verschiedener Lernparadigma (Reimann 2005, 165 ) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 39 3 Lernen mit digitalen Medien Unter Berücksichtigung der theoretischen Ansätze aus der Didaktik und Pädagogik zum Lernen gibt es folgende Schwerpunkte a)Potentiale digitaler Medien b)Lernen mit IT c)Lernen mit neuen Kommunikationstechnologien Foto: © R. B./PIXELIO Inhalt Foto: © Ernst Rose/PIXELIO Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 40 a) Potentiale digitaler Medien (vgl. Reimann 2005, 74-80) • Medienbegriff Allgemeine Funktion der Medien ist die Verbreitung von Informationen bzw. Mittler von Auskünfte oder Angaben zu sein. Medien mit ihrer zweiseitigen Ausrichtung innerhalb von Kommunikationsprozessen sind sowohl „Mittler“ wie auch „Vermittelnde“, was ihrer ursprünglichen Bedeutung gleich kommt. • Funktionen von Medien Aus Sicht der Kommunikationstheorie gibt es drei Grundfunktionen von Kommunikation: - propositionale Funktion: Medien als Vermittler/Informant über Inhalte - interaktive Funktion: Medien als Ausdrucksmittel für Kommunikation sowie für zwischenmenschliche Beziehungen oder sozialer Vereinbarungen - personale Funktion: Medien als Ausdrucksmittel für persönliche/ individuelle Gedanken Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 41 • Aspekte eines Mediums Weidemann (2001) geht von fünf Aspekten eines Mediums aus (psychologischer Ansatz): - Hardware: Materialität eines Mittlers (z. B. Player/Beamer) - Software: übermittelte Programme (z. B. Film) - Symbolsystem: d. h. der Code (z. B. Sprache/Bilder) - Sinnesmodalität: d. h. was den jeweiligen Code anspricht (z. B. Auge/Ohr) - Botschaft: d. h. das im Symbolsystem vermittelte (z. B. Bildaussage) • Definitionsansatz digitale Medien Kennzeichen der digitalen Medien sind: Multimedialität, Interaktivität, Simulation, Kommunikation, Kooperation über Distanz; auch gebräuchlich mit dem Synonym: Multimedia; im Bereich des ELearning wird mit digitalen Medien gesprochen, wenn mit digitaler Technologie multicodierte und multimediale Inhalte dargestellt werden. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 42 Lernpotentiale Distribuation – Repräsentation – Exploration • • • Disritbutionsfunktion: Informationen können schnell orts- und zeitunabhängig mittels digitaler Medien- und Kommunikationstechnologien zur Verfügung gestellt werden. Dies stärkt zudem Selbstkompetenzen des Lernenden, der nun die Informationen über den Seminarraum und die Bibliothek hinaus abrufen kann. Repräsentationsfunktion. Durch die spezifische Eigenschaften digitaler Medien vor allem in der Vielfalt der Darstellungsformen (Text/Bild/Animation sowie Audio/Video) wird der Grad der Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Lehrinhalte erhöht. Explorationsfunktion: Durch Erweiterungen von Multimedia und technischen Werkzeugen nimmt der Realitätscharakter zu. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 43 Kommunikation – Kollaboration • „Internet und andere Netze dienen nicht nur der Verteilung von Informationen; sie sind auch die Grundlage für verschiedene Formen der synchronen und asynchronen Interaktion zwischen Menschen via E-Mail, Foren, Chat und Videokonferenzen; hier geht es um die Kommunikationsfunktion der digitalen Medien. “ • Kommunikation wird ermöglicht und ergänzt durch kollaborative Prozesse. Denn Kommunikation befähigt nicht nur den Informationsaustausch, sondern unterstützt auch unabhängig von verschiedenen Orten das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben, Problemstellungen, was mit der Kollaborationsfunktion gleich zusetzten ist. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 44 Interaktion – Interaktivität Die Interaktion ist in verschiedene Richtung interpretierbar (Reimann 2005, 79): • Interaktion des Nutzers mit der Hardware des Computers • Interaktion des Nutzers mit der Benutzerschnittstelle des Computers • Interaktion des Benutzers mit Inhalten bzw. Lernobjekten in einem Lernprogramm • symbolische Interaktion des Nutzers mit anderen Nutzern (beim Blended Learning z. B. mit dem Lehrenden und anderen Lernenden) • soziale Interaktion, die Interaktion mit dem Computer und/oder der Benutzerschittstelle Merke: „Interaktivität bedeutet (…) die ‚Manipulation und den lernenden Umgang mit den Lernobjekten im virtuellen Raum‘“ (Reimann zitiert Schulmeister: Reimann 2006, 79) 45 3.1 Lernkonzepte im E-Learning Virtuelle Lehre Sie umfasst virtuelle Lehrveranstaltungen, OnlineAus- und Weiterbildung. Die Lehr- und Lernumgebung, Kommunikation und Kooperation ist ausschließlich netzbasiert, so dass hier der größtmögliche Anteil des zeit- und ortsunabhängigen Lernens gegeben ist. Dies jedoch erfordert ein hohes Maß an Motivation des Lernenden zum Selbststudium, was wiederum einen hohen Aufwand für ein ansprechendes didaktisches Design erfordert! Ein hoher Anteil an Kommunikationsmitteln, wie z. B. gut gestaltete Foren sowie Qualitäts- und Selbsteinschätzungsinstrumente z. B. Selbststests tragen zum Erfolg virtueller Lehre bei. (weiterführende Literatur: Arnold 2006, 18) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 46 Integratives Konzept Das integrative Konzept meint, dass zu klassischen Lernangeboten interaktive (online-)Angebote zum Lernen bereit gestellt werden. Anteilig am Häufigsten wird das integrative Konzept beim Blended Learning integriert und umgesetzt. Foto: © Markus Hein/PIXELIO Nach Dittler (2002) ist ein Beispiel des integrativen Konzeptes das Anreicherungskonzept, das integrative Lernangebote, dynamische (z. B. Video, animierte Gifs) und statische (z. B. Grafiken, Bilddatenbanken), Arbeiten mit OnlineRessourcen beinhaltet. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Foto: © SMA/PIXELIO Kapitel 4 Kapitel 5 47 Beim integrativen Konzept sind folgene Aspekte vordergründig: 1. Interaktionen zwischen Lernenden, ihre Aktivitäten, ihre Interaktion mit dem Tutor, Moderator, Lehrer 2. Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis (Lernende und Lehrer 3. technisch einfache Realisierungen (möglich z. B. mit gängigen Systemen und Programmen wie PowerPoint, E-Mail-Programme) 4. Freeware und Opensource in der Bildung (wie z. B. Hot Potatoes, WIKI, Foren). (Dittler 2002) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 48 3.2 Voraussetzungen für erfolgreiches E-Learning Paradigmenwechsel in der Didaktik Die Verwaltung von virtuellen Lernumgebungen sowie die Orientierung und Unterstützung von Aktivitäten initiieren Zusammenarbeit und stärken die Motivation zur Autonomie sowie regen zur Reflexion und Moderation an. Nach Jutta Pauschenwein (2005) stehen folgende Schwerpunkte für ein neues Lernen bzw. für die Erweiterung des tradierten Lernens: Im Zentrum stehen beim E-Learning erstens, die Interaktionen zwischen Lernenden und ihre Aktivitäten, zweitens die Aktivitäten und die Aktionen mit dem Tutor sowie drittens wird durch den E-Content der Lernprozess allgemein unterstützt. (http://www.interaktiv-einfach.ch/edidaktik/konzepte.htm, Stand 12/07) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 49 4 Vom Lernen zum Lehren (vgl. Reimann 2005, 144) Lernen Lehren Lernen Wissen Wissen als Bindeglied Strukturgenetische Wissensauffassung Personales und öffentliches Wissen Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • informelles und institutionalisiertes Lernen • Lernumgebungen, Didaktik und Design Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • Verschiedene Gestaltungsebenen • Die Konzeption auf der Strukturebene • Die Betreuung auf der Prozessebene Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 50 Wissen als Bindeglied Strukturgenetische Personales und Wissensauffassung* öffentliches Wissen Relevante Fragen nach: • Wie werden Lehr- und Lernaktivitäten mit ihren unterschiedlichen Formen, Qualitäten und Ausrichtungen in Übereinstimmung gebracht? • Wie lernt man erfolgreich und was generiert man als Wissen? *Die Strukturgenetische Wissensauffassung geht davon aus, dass sich Wissen und damit auch Erkennen oder Verstehen aus einem aktiven und fortlaufenden Prozess der Auseinandersetzung mit der gegenständlichen und sozialen Umwelt des Lernenden ergibt (Reimann 2005, 142) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 51 Strukturgenetische Perspektive (Reimann 2005, 118 f.) Aus strukturgenetischer Perspektive besteht alles Wissen einer Person aus reaktivierten Systemen von kognitiven Strukturen unterschiedlicher Art. Innerhalb der strukturgenetischen Perspektive treten verschiedene Wissensformen in einen Dialog durch Sprache, Bilder und andere Formen der Darstellung/Kommunikation und generieren Wissen. Verschiedene Wissensformen: - personales Wissen: ursprüngliches, intuitives und begriffliches Wissen - öffentliches Wissen: kollektives oder auch konventionelles, formalisiertes Wissen - kontextuelle/soziale Bezüge: sozial geteiltes Wissen/Kollaboriertes Wissen Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 52 Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • informelles und institutionalisiertes Lernen • Lernumgebungen, Didaktik und Design • Informelles Lernen: bezeichnet alle Lernaktivitäten außerhalb von Bildungseinrichtungen oder systematisch organisierter Bildungsveranstaltungen, welche durch Lehrer/Dozierende oder andere Lehrpersonen gesteuert werden. Informelles Lernen kann individuell oder in Gruppen, bewusst (jedoch häufig auch unbewusst) stattfinden. • Institutionalisiertes Lernen: darunter sind planmäßig angeleitete und organisiert angelegte Lernprozesse zu verstehen . Foto: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 53 Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • Verschiedene Gestaltungsebenen • Die Konzeption auf der Strukturebene • Die Betreuung auf der Prozessebene • Faktoren einer Lernumgebung: unter Lernumgebung ist das Arrangement von Lehrmethoden, Lehrmaterialien und Medien zu verstehen. Bestandteil von Lernumgebungen ist aber auch der kulturelle Kontext (Subkultur, Organisationskultur, regionale und nationale Kultur). • Konzeption auf der Strukturebene: die Didaktik als „Wissenschaft vom Unterricht“ beschäftigt sich mit der Gestaltung der Lernumgebung. • Betreuung auf Prozessebene: Durch die theoretischen Kenntnisse didaktischen Handels können gemäß der Lernprozesse Informationen/Wissensinhalte entsprechend der Lernenden/Lernumgebung gestaltet und vermittelt werden. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 54 4.1 Lernen und Technik Übersicht Dimensionen von Mulitmedia aus mediendidaktischer Sicht mono- multi- Medium monomedial: -Buch -Videoanlage -PC und Bildschirm multimedial: -PC+CD-ROM-Player -PC+Videorecorder Codierung monocodal: -nur Text -Nur Bilder -Nur Zahlen multicodal: -Text mit Bildern/Animationen o. Audio… -Grafik mit Beschriftung/Animation o. Audio Sinnesmodalität monomodal: -nur visuell (Text, Bilder) -nur auditiv (Rede, Musik) multimodal: -audiovisuell (Video/CBTProgramm mit Ton) (vgl. Naumann/Hartmann/Ehrke 2000) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 55 Perspektive: Technik • Voraussetzung: Computer als Integrationsplattform • zusätzliches wichtiges Kriterium: Interaktivität und Benutzerinteraktion, d. h. die Nutzer sind nicht nur ausschließlich Empfänger, sondern können auch als Akteure durch Verwendung entsprechender Rückkanäle Inhalte verändern bzw. Handlungen auslösen. · Mischung verschiedener Medien (Text, Grafik, Ton etc.) · Gleichzeitige Benutzung dieser Medien · Digitale Speicherungsform · Verschiedene Medienformen z.B. statische und dynamische Fotos: © S.Hofschlaeger/PIXELIO (vgl. Naumann/Hartmann/Ehrke 2000) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 56 Praxis: Erweiterung/Nutzung vorhandener Potenziale durch neuen Technikeinsatz Geräte Einsatz – elektronische – Online-Ankündigung und -Einschreibung/ Tafel, Tablets, Software, Web/Internet/LCMS (LerncontentManagement-System) – weitere Peripheriegeräte zum Computer/ Notebook, digitale Aufnahmegeräte) – Texte über Internet (z. B. HTML- oder PDF-Datei) Inhalt Informationsplattform/Materialarchiv – Einsatz und Aufbereitung von Bild/Audio/ Video/Animation, Lernsequenzen/-szenarien (CBT/WBS) – interaktiver Austausch z. B. via E-Mail/ Chat/Internet-Forum/virtuellen Konferenzen u. Teletutoring – Download-Skripte u. -Foliensätze, Recordings, interaktive Skripte und Foliensätze, Recordings, interaktive Skripte, Online-Übungen und -Tests Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 57 Perspektive: Nutzer Multimediale Angebote lassen sich aus Nutzersicht in folgende spezifische Dimensionen gliedern: • multicodal, d. h., sie beziehen sich auf unterschiedliche Symbolsysteme bzw. Codierungen wie z.B. Sprache und Bilder, • multimodal, d. h. sie sprechen unterschiedliche Sinneskanäle an • interaktiv, d. h., die NutzerInnen können selbst aktiv werden. (vgl. Naumann/Hartmann/Ehrke 2000) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 58 4.2 Lernen mit neuen Informationstechnologien Möglichkeiten der Unterstützung von Präsenzphasen durch E-Learning: • Aufbau sozialer Kontakte • Absprachen/Administrative Verständigung • Klären von Missverständnissen (Lösungsvarianten oder Fehler) • Bewertung von Ergebnissen, Diskussion, Erfahrungsaustausch Imperative für das virtuelle Lernen (Schulmeister, 2001, S. 227–231) • Eignung des Gegenstandes (Möglichkeiten der Darstellungsformen) • didaktische Anpassung (z. B. Animation von Algorithmen in Informatik) • neue Wissensdarstellung und konstruktivistische Lernplattformen • selbstgesteuertes Lernen: erfordert hohen Grad an Interaktivität • authentische (komplexe) Beispiele (z. B. Prozessabläufe mit Animationen) • studentenzentriert und anspruchsvolle Prüfungsformen • Interaktion und Kommunikation mit Menschen (Lerngemeinschaften) (vgl. Schubert/Schwidrowski: http://www.die.informatik.uni-siegen.de/) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 59 Merke: eine didaktische Vereinfachung (Reduktion) darf nie zu unwissenschaftlichen (falschen)Vorstellungen führen! Lernziele als didaktische Landkarte und Rückkoppelung von Problemen: • Überforderung der Lernenden mit der Selbstorganisation des Lernens - geschätzte Bearbeitungszeit angeben - störungsfreier Lernplatz vs. Lernen am Arbeitsplatz - Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung • Problemorientierung - Vorwissen reicht nicht aus, um ein Problem zu lösen - Motivation zur Aneignung neuen Wissens - Vorgehensweise: Lösungshypothese entwickeln, überprüfen sowie Ergebnis und Erkenntnis formulieren (vgl. Schubert/Schwidrowski: http://www.die.informatik.uni-siegen.de/) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 60 E-Konzepte (Dittler 2007) Virtuelle Lehre Damit sind gemeint: virtuelle Lehrveranstaltungen, Online Aus- und Weiterbildungen. Kommunikation/Kooperation werden netzbasiert abgewickelt. Integratives Konzept Beinhaltet: interaktive Lernangebote + Chat, Foren, Lernplattformen. Dokumente und gemeinsam erarbeitete Projekte können auf einem Server abgelegt werden. Anreicherungskonzept Beinhaltet: interaktive Lernangebote, dynamische (z. B. Video, animierte Gifs) und statische (z. B. Grafiken, Bilddatenbanken), Arbeiten mit Online-Ressourcen (http://www.interaktiv-einfach.ch/edidaktik/konzepte.htm, Stand 12/07) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 61 Aufwand Bei der virtuellen Lehre ist der Aufwand für die Umsetzung sehr hoch und nimmt ab beim integrativen Konzept. Kleine Teams, Einzelpersonen können Lernangebote mit einem kleinen Aufwand auf der Basis des Anreicherungskonzeptes realisieren. Interaktivität: Virtuelle Lernumgebungen ermöglichen unter günstigen Bedingungen (z. B. E-Moderation) den höchsten Grad an Interaktivität. Merke: Je höher die Ansprüche an eine virtuelle Lernumgebung sind, desto höher sind die Anforderungen an einen Betrieb, eine Institution, ein Team und an Kooperationen von Wissenschaftlern und Informationstechnologen. (vgl. Dittler 2002) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 62 E-Learning innerhalb der Lernkultur Nach Arnold (2006) wird E-Learning integriert in einem pluralen Konzept, wo es darum geht, didaktische Formen so zu bündeln, dass die jeweilige Leistunsfähigkeit (Qualität/Wertigkeit) angemessen zur Anwendung kommt. Verschiedene Lehrund Lernformen ergänzen und befördern sich dabei. (Arnold 2006, 18) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 63 5 Erweiterung des Lernens durch E-Learning Lernen im 20. Jahrhundert (im Zentrum steht der Tutor, die Tutorin Lernen im 21. Jahrhundert (LernerInnen- und teamorientiert) lecture support of self-directed learning individual learning group oriented learning listening, following co-operation transmission of information extension of abilities tutor as provider of information tutor as companion static content dynamic content homogeneity of learning resources diversity exams and tests application and increased performanc Quelle: Chute A., Thompson M. and Hancock B. (1999) The McGraw-Hill handbook of distance learning. New York/J. Pauschenwein, 3.11.05, zml.fh-joanneum.at 15 Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 64 Neue Rollen des Lehrenden • Verwaltung von virtuellen Lernumgebungen • Orientierung und Unterstützung • Aktivitäten initiieren • Zusammenarbeit stärken • Motivation zur Autonomie • Reflexion anregen • Moderatoren Fotos: © S.Hofschlaeger/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Neue Aktivitäten • Lernende müssen Erfahrung im Umgang mit Technologien sammeln. (Motivation!) • Abstimmung hinsichtlich technischer Voraussetzung in Institution und zu Hause • Detaillierte Festlegung der Informationsabfrage • Moderatoren sind verantwortlich für Dokumentation und der Datenverwaltung/-freigabe Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 65 Lassen sich aus der Erweiterung des Lernens auch neue Lernwege beschreiben? Schubert und Schwidrowski unterscheiden dabei: – arbeitsplatzorientiertes Lernen: Aneignung von Wissen zur Lösung einer konkreten Arbeitsaufgabe; Nutzen des Lernens messbar an der Arbeitsaufgabe – Geschäftsprozess setzt sich aus Tasks (Arbeitsaufgaben) zusammen – Wissensmanagementplattformen: dokumentiertes Wissen, Wissensaustausch zwischen Mitarbeitern – Problem: relevanten Experten zur Lernkooperation in der Hochschule und anderen Institutionen finden – Rollen: Wissensarbeiter o. Lehrender/Lernender und Experte Lösungsansatz Fotos: © S.Hofschlaeger/PIXELIO (vgl. Schubert/Schwidrowski: http://www.die.informatik.uni-siegen.de/) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 66 Neue Lernwege im Überblick nach S. Schubert & K. Schwidrowski: 1. Identifikation der aktuellen Prozessschritte des Lernenden: Für welche Task (Aufgabe) braucht Wissensarbeiter/Lernender Unterstützung durch Experten? 2. Identifikation relevanter Experten, Werkzeuge und Dokumente nach folgenden Kriterien: Task des Lernenden; Kompetenz, Verfügbarkeit des Experten; soziale, organisatorische Distanz; 3. Priorisieren der Liste möglicher Experten unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien und individueller Präferenzen durch Gewichtung der Kriterien; 4. Information über Kooperation in vorhandene Wissensbasis integrieren Verschlagwortung der Dokumente, Verfeinerung der Auswahlkriterien. (vgl. Schubert/Schwidrowski: http://www.die.informatik.uni-siegen.de/) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 67 5.1 Möglichkeiten des Einsatzes von Blended-Learning (S. Schubert & K. Schwidrowski) Gründe für eine sinnvolle Kombination von E-Learning-Angeboten und Präsenzphasen: • Lerninhalt ist in Präsenzphasen besser zu vermitteln, z. B. handlungsorientierte Aufgabe, Gruppenarbeit, Rollenspiele, Reflektieren von Gelernten; • Lernende sind motivierter in Präsenzveranstaltungen, da Abwechslung zum selbstlernzentrierten Online-Lernen; • Einführungsveranstaltung: Aufbau von Verbindlichkeit, da soziale Kontakte zu anderen Lernenden und Lehrenden geknüpft werden Klärung von organisatorischen Fragen Vertraut machen mit dem technischen Systemen (Lernplattform, Kooperationswerkzeugen) Zusammenfinden zu Lerngruppen Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 68 Gründe für Ergänzung von Präsenzangeboten mit E-Learning-Phasen • Dokumentation der Lernprozesse durch Einsatz technischer Medien (z. B. Foren); • Organisation der Veranstaltung, schwarzes Brett (Strukturierung und Transparenz der Veranstaltung); • E-Learning zur Vorbereitung von Präsenzphasen: Wissensaneignung, z. B. für vergleichbares Anfangsniveau aller Teilnehmer, Instruktion der Teilnehmer; • E-Learning zur Nachbereitung von Präsenzphasen: Übungen zur Steuerung des individuellen Lernprozesses, Qualitätssicherung durch Befragung und Tests mit automatisierter Auswertung. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 69 „E-Learning ist keine Ikone. Es ist eine Methode, die wir zum Lernen und Lehren benutzen sollten.“ (zitiert nach: Dozierenden aus d. Techn. Chemie/anonymisiert) 5.2 E-Learning im Studienalltag • Erweiterung der Lernumgebung • schnellere und kurze Kommunikationswege mit hoher Breitenwirkung, z. B. durch Foren • vielfältigere Möglichkeiten der Anwendung verschiedener didaktischer Szenarien (kooperatives Lernen) • Stärkung der Möglichkeiten des Selbststudiums • Mediengestützte und -orientierte Lehrsowie Lernstrategien • Informelles und lebensbegleitendes Lernen Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 70 Literatur/Links - Arnold, P.: Qualitätsentwicklung im E-Learning Ansätze, Herausforderungen und Perspektiven. In: Behrmann, D. & Schwarz, B.: Integrative Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung. Bertelsmann: Bielefeld 2006. - Baacke, D.: Medienpädagogik in: Die Vermessung des Feldes. 1997. - Blumstengel, A. : Entwicklung hypermedialer Lernsysteme, 1998. - Chute A., Thompson M. and Hancock B.: The McGraw-Hill handbook of distance learning. New York/J. 1999. - Dittler U. (Hrsg), E-Learning, Erfolgsfaktoren und Einsatzkonzepte des Lernens mit interaktiven Medien, Oldenbourg Verlag 2002. -Kerres & de Witt & Stratmann: 2003. - Langer, E. J.: Mindful Learning. Perseus Books. Cambridge 1997. - Naumann/Hartmann/Ehrke in: http://www.projekt-alf.de/elearning/ 03Multimedia.php. 2000. Foto: © D. Meinert/PIXELIO Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 71 - Naumann/Hartmann/Ehrke: Multimedia - Didaktik – Eine kleine Einführung. 2000. - Pauschenwein, J. in: http://www.zml.fh-joanneum.at (03.11.05) - Reimann, G.: Blended Leraning in der Lehrerbildung. Grundlagen für die Konzeption innovativer Lernumgebungen. Lengerich 2006. - Reusser, K.: E-Learning als Katalysator und Werkzeug didaktischer Innovation“ in: Lehren und Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien II. 2003. - SALMON, G. : EModerating. London: Kogan Page Limited. 2000. - SALMON, G. : Etivities. London: Kogan Page Limited. 2002. - Schubert S. und Schwidrowski K.: http://www.die.informatik.uni-siegen.de/lehre/MIidB/2_ Organisation 12/07 - Schulmeister, R.: eLearning: Einsichten und Aussichten. München 2006. - Sesnik, W. in: http://weiterbildung.bildung.hessen.de/laku/laku_material/sesink_september_ 2002.pdf 2002. - Vygotski, L. S.: Mind in Society. Cambridge: Cambridge University Press. 1978. -Wenger, E.: Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 1998. - Warnecke, T. in: Tagesspiegel Nr. 19/223, B2, 2006 - Wetter, G. in: http://www.e-learning.uni-mainz.de/Dateien/E-Learning-Hinweise-2004.pdf. Mainz 2004. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 72 Links/Websites: - Global Learning – Glossar - http://beat.doebe.li/bibliothek/w01503.html - http://www.crashkurs-elearning.ch/IN - http://www.interaktiv-einfach.ch/edidaktik/konzepte.htm, Stand 12/07 Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 73 Testfragen (Antworten erscheinen beim nächsten Klick, vergleichen sie bitte!) a) Auf welchen Theorien fundiert die E-Didaktik? Antwort: Sozialer Konstruktivismus (Vygotski, 1978) Mindful Learning (Langer, 1997) Communities of Practice (Wenger, 1998) E-Moderation (G. Salmon, 2000) E-tivities (G.Salmon, 2002) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 74 b) Ist folgende Aussage wahr oder falsch? E-Learning, Blended Learning und Multimedia stehen begrifflich eng und oftmals mit Überschneidungen in den Inhalten beieinander. So werden sie in ihrer praktischen Anwendung auch als angrenzende Begriffe verwandet. Antwort: richtig Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 75 c) Kreuzen Sie die falsche(n) Antwort(en) an: Merkmale der kognitiven Dimension in der Lerntheorie können sein… a) Gedächtnis b) Problemlösen c) Lernvorlagen d) Lerntransfer e) Metakognition f) Selbststeuerung Antwort: c) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 76 c) Kreuzen Sie die richtige(n) Antwort(en) an: Merkmale der motivationalen Dimension in der Lerntheorie können sein… a) Selbstbestimmung b) Desinteresse c) Pessimismus d) Interesse e) Neugier Antwort: a), d) und e) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 77 c) Kreuzen Sie die falsche(n) Antwort(en) an: Merkmale der emotionalen Dimension in der Lerntheorie können sein… a) Flow-Erlebnis b) Problemlösen c) Emotionale Intelligenz d) Lerntransfer e) Selbststeuerung Antwort: b), d) und e) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 78 c) Kreuzen Sie die falsche(n) Antwort(en) an: Merkmale der sozialen Dimension in der Lerntheorie können sein… a) Interaktion b) Kooperation c) Einzelarbeit d) Kontext e) Situiertheit f) Kollaboration Antwort: c) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 79 d) Welche fünf Kennzeichen zeichnen das E- und Blended Learning zur Unterstützung der Lehre und des Lernens aus? Antwort: •konstruktivistisch (aufeinander aufbauend) orientierte Lernumgebungen • mediengestützte und -orientierte Lehr- sowie Lernstrategien • selbstgesteuertes Lernen, • informelles und lebensbegleitendes Lernen, • kooperatives Lernen mit neuen Medien. Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 80 e) Wie werden die drei Paradigmen des Lernens beschrieben? ? Antwort: 1.Behaviorismus 2.Kognitivismus 3.Konstruktivismus Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 81 f) Ergänzen Sie folgendes Schema: Basierend auf dem Informationsverarbeitungsmodell findet wie folgt die Informationsverarbeitung statt: (Grundmodell der Informationsverarbeitung (in Anlehnung an Edelmann, 2000) Input (Reiz) Informationsspreicherung Antwort: Basierend auf dem Informationsverarbeitungsmodell findet wie folgt die Informationsverarbeitung statt: Input (Reiz) Informationsverarbeitung Informationsspeicherung Output (Leistung) (vgl. Reimann 2005, 146-174) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 82 g) Füllen Sie im folgenden Text die Lücken mit den entsprechenden Begriffen: 1. Bei der ………………….. können Informationen schnell orts- und zeitunabhängig mittels digitaler Medien- und Kommunikationstechnologien zur Verfügung gestellt werden. Dies stärkt zudem Selbstkompetenzen des Lernenden, der nun die Informationen über den Seminarraum und die Bibliothek hinaus abrufen kann. 2. Bei der ………………….. nimmt durch Erweiterungen von Multimedia und technischen Werkzeugen nimmt der Realitätscharakter zu. 3. Bei der …………………… werden durch die spezifische Eigenschaften digitaler Medien vor allem in der Vielfalt der Darstellungsformen (Text/Bild/Animation sowie Audio/Video) der Grad der Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Lehrinhalte erhöht. Antwort: 1. Distributionsfunktion 2. Behaviorismus 3. Repräsentationsfunktion Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 83 h) Ergänzen Sie folgendes Schema: Lernen ………… (1.) Lernen Wissen Wissen als Bindeglied Strukturgenetische …………… und Wissensauffassung ………… (2.) Wissen Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • informelles und institutionalisiertes Lernen • ………………………………………………(3.) Lehren als Gestalten von Lernumgebungen • …………………………………………..(4.) • Die Konzeption auf der Strukturebene • Die Betreuung auf der Prozessebene Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Antwort: 1. Lehren 2. Personales und öffentliches 3. Lernumgebun g, Didaktik und Design 4. Verschiedene Gestaltungseb enen Kapitel 4 Kapitel 5 84 i) Frage: Füllen Sie die leeren Felder aus oder ergänzen Sie die fehldenden Begriffe in der Übersicht zu den Dimensionen von Multimedia aus mediendidaktischer Sicht! mono- ……….(1.) Medium monomedial: -………….. -………….. -………….. (2.) multimedial: -PC+CD-ROM-Player -PC+Videorecorder …………(3.) monocodal: -nur Text -Nur Bilder -Nur Zahlen multicodal: -Text mit Bildern/Animationen o. Audio… -Grafik mit Beschriftung/ Animation o. Audio monomodal: -nur visuell (Text, Bilder) -nur auditiv (Rede, Musik) ……………(4.): -audiovisuell (Video/CBTProgramm mit Ton) Sinnesmodalität Antwort: 1. multi2. Buch, Videoanlage, PC und Bildschirm 3. Codierung 4. multimodal (vgl. Naumann/Hartmann/Ehrke 2000) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 85 j) Frage: Welche E-Konzepte werden wie folgt nach nach Dittler (2007) beschrieben? 1. Beinhaltet: interaktive Lernangebote, dynamische (z. B. Video, animierte Gifs) und statische (z. B. Grafiken, Bilddatenbanken), Arbeiten mit OnlineRessourcen. 2. Damit sind gemeint: virtuelle Lehrveranstaltungen, Online Aus- und Weiterbildungen. Kommunikation/Kooperation werden netzbasiert abgewickelt. 3. Beinhaltet: interaktive Lernangebote + Chat, Foren, Lernplattformen. Dokumente und gemeinsam erarbeitete Projekte können auf einem Server abgelegt werden. Antwort: 1. Anreicherungskonzept 2. Virtuelle Lehre 3. Integratives Konzept (http://www.interaktiv-einfach.ch/edidaktik/konzepte.htm, Stand 12/07) Inhalt Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 86 Konzeption und Gestaltung der Folien © E-Learning-Service, Universität Leipzig Alle Fotos, welche nicht verzeichnet wurden, sind durch den E-Learning Service der Universität Leipzig angefertigt wurden. Nutzung der Folien nur für Studienzwecke zulässig! 87