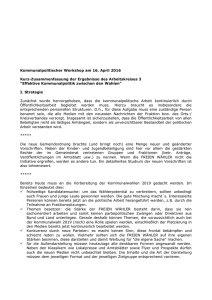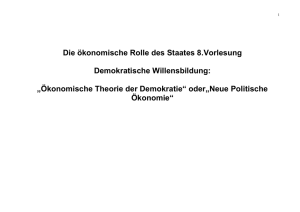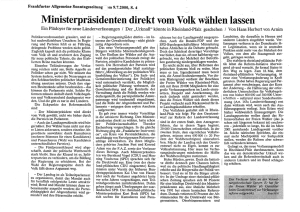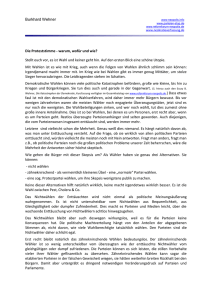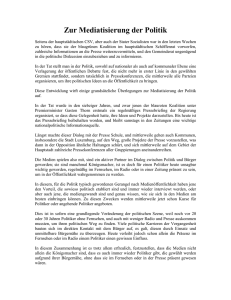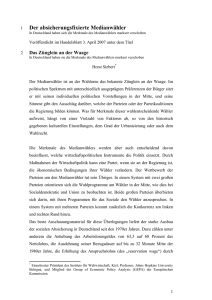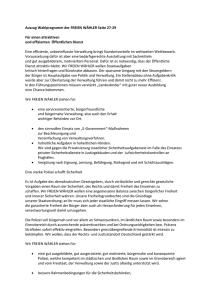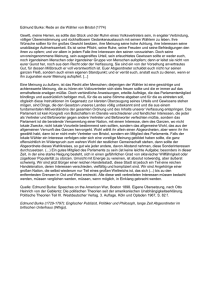1 Die Vorlesungsstrategie
Werbung
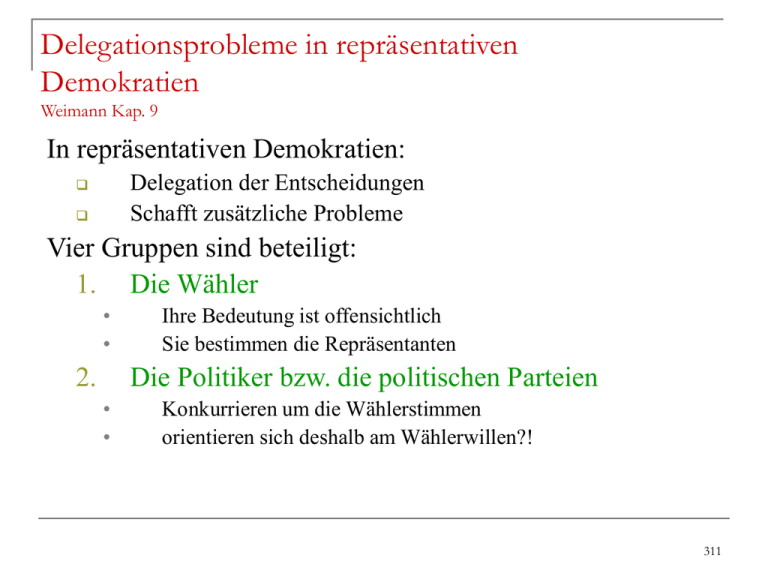
Delegationsprobleme in repräsentativen
Demokratien
Weimann Kap. 9
In repräsentativen Demokratien:
Delegation der Entscheidungen
Schafft zusätzliche Probleme
Vier Gruppen sind beteiligt:
1. Die Wähler
•
•
2.
Ihre Bedeutung ist offensichtlich
Sie bestimmen die Repräsentanten
Die Politiker bzw. die politischen Parteien
•
•
Konkurrieren um die Wählerstimmen
orientieren sich deshalb am Wählerwillen?!
311
3.
Die Interessenverbände
•
•
4.
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, NGO‘s aller
Art
Hohes Interesse an Interessenwahrnehmung (im
Unterschied zu Wählern)
Die Bürokratie
•
•
•
•
Wichtiger Teil der Exekutive
Politiker müssen zwangsläufig einen Teil der
Entscheidungen an Bürokraten delegieren!
Minister kommen und gehen, Bürokraten bleiben!
Bürokratie gehorcht eigenen Gesetzen!
312
Die Wähler: Das Wahlparadoxon
Die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen liegt bei über 70%
Warum gehen so viele Menschen wählen?
Ist es rational zu wählen?
Ein einfaches Modell
Walter ist unser repräsentativer Wähler
Er entscheidet sich zwischen zwei Kandidaten {1, 2} und bevorzugt
Kandidat 1.
B – ist der Vorteil den Walter hat, wenn 1 gewählt wird
d – ist der direkte Nutzen aus dem Wahlakt (staatsbürgerliche
Pflichterfüllung)
c – sind die Kosten der Wahlbeteiligung
313
n1 , n2 = Wählerstimmen für Kandidat 1, 2
Vier Fälle:
a)
n1 – n2 > 1 Kandidat 1 gewinnt auch wenn Walter nicht zur
Wahl geht
b)
n1 – n2 = 0 Walter entscheidet die Wahl zugunsten seines
Kandidaten
c)
n1 – n2 = 1 Walter kann ein Patt erreichen
d)
n1 – n2 < -1 Kandidat 2 gewinnt auch wenn Walter für 1
stimmt
Sei q1 die Wahrscheinlichkeit für Ausgang a), und p die W‘keit für die Ausgänge b)
und c). Dann ist der Erwartungsnutzen Walters:
314
Der erwartete Nutzen aus der Wahlbeteiligung:
(bei Patt entscheidet das Los)
E[U(W)] = q1B + pB + p ½ B + d – c
Erwartungsnutzen, wenn Walter nicht zur Wahl geht:
E[U(E)] = q1B + p ½ B
Walter geht wählen, wenn die Differenz:
pB + d –c > 0 ist!
Achtung: p ist praktisch = 0!
1960:
Kennedy 49,72%, Nixon 49,55% = 114.673 Stimmen Differenz!
315
Resultat:
1.
Wählen, um einen Kandidaten auszuwählen, macht
keinen Sinn.
Die W‘keit, entscheidend zu sein, ist zu klein
Impliziert, dass es auch keinen Sinn macht, sich über
Kandidaten zu informieren!
2.
Zur Wahl geht nur, für den d > c gilt
Es muss wenig kosten zu wählen und es muss hinreichend
viel „Spaß“ machen!
Macht es mehr Spaß bei den Gewinnern zu sein?
These der Schweigespirale
316
Folgerungen
Aus der Sicht des einzelnen Wählers:
Wahl dient nicht der Auswahl eines Kandidaten
Wenn deshalb niemand wählen geht:
kann ein Wähler entscheiden
für diesen ist es dann rational zur Wahl zu gehen!
Wahlbeteiligung = 0 deshalb kein Gleichgewicht
Aber:
Gleichgewicht bei sehr geringen Beteiligungsraten!
317
Folgerungen
Wahlbeteiligung ist ein Akt der Bereitstellung eines
öffentlichen Gutes
Demokratie
demokratisch gewählte Regierung
wir bekommen alle die gleiche!
Kann man 70 – 80% Beteiligung mit dem üblichen
Kooperationsverhalten erklären?
Wohl kaum
d spielt eine wichtige Rolle
318
Direkter Nutzen der Wahlbeteiligung
Für d > 0 gibt es verschiedene Interpretationen:
Staatsbürgerliche Pflicht
Implizite Sanktionen der Wahlenthaltung
„es gehört sich nicht“
Wahl als Ausdruck der einen Präferenz
Eine Art Konsumakt
gewählt wird auch dann, wenn der eigene Kandidat keine Chance
hat!
Es geht darum kundzutun, welche Vorliebe man hat.
319
Wahl als Ausdruck der politischen Präferenz:
Legt die Zerlegung des Wahlaktes in zwei Stufen nahe:
1. Welche Präferenz habe ich
2. Soll ich dieser auch Ausdruck verleihen (wählen
gehen)
•
Für beides muss die Nutzen-Kosten Kalkulation
getrennt durchgeführt werden
Kosten-Nutzen des Wahlganges (2. Stufe):
•
Kosten: Nur die Opportunitätskosten der Zeit
•
Nutzen d muss nur gering sein, um die Wahlbeteiligung
zu einem rationalen Akt werden zu lassen
320
Kosten und Nutzen der Präferenzbildung
Frage:
Welche Kosten entstehen, wenn ein Wähler versucht, die für ihn beste
Partei zu finden und
welchen Vorteil hat er von einer fundierten Entscheidung?
Antwort:
Die Kosten sind extrem hoch
Informationsaufwand sehr groß
Die Erträge sind praktisch = 0
Ein Irrtum verursacht keine Kosten
Wahlentscheidung unbedeutend für den Ausgang!
Analogie zum Restaurantbesuch:
Macht es Sinn, die Karte extrem aufwendig zu studieren, wenn klar ist, dass es
sowieso nur Erbsensuppe gibt?
321
Rationale Wähler sind schlecht informiert
Information lohnt sich nicht
Entscheidung wird dadurch nicht „besser“
Hat weit reichende Konsequenzen:
Wählerstimmenmarkt:
Parteien treten in Konkurrenz um die Wählerstimmen
Erfolg hat die Partei, die ein Programm anbietet, das den Präferenzen der
Wähler entspricht
Analogie zum Gütermarkt:
Nur der Anbieter hat Erfolg, der sein Produkt den Bedürfnissen der
Wähler anpasst.
Analogie trägt aber nicht
Parteien wissen, dass Wähler die wahre Qualität ihre Produkts nicht
kennen!
322
Die Funktion von Ideologien
Ideologien sind die Kurzfassungen der Weltanschauungen
Bestehen aus Schlagwörtern und „Glaubenssätzen“, wie
„Erneuerbare Energien sind gut für die Umwelt“
„Arbeitszeitverkürzungen führen zu mehr Beschäftigung“
„Mehr Markt, weniger Staat“
„Arbeit muss sich wieder lohnen“
Die „Gläubigen“ hinterfragen diese Sätze nicht mehr
Ideologien sind leicht konsumierbar
Deshalb eignen sie sich in der politischen Auseinandersetzung
Sachliche Argumente sind viel zu schwierig
Ideologien lösen das Informationsproblem der Wähler!
323
Die Funktion des Parteienstandorts
Gemeint ist die Position im Links-Rechts Schema
Dient ebenso wie Ideologien der Orientierung der Wähler
Erlaubt es den Wählern, die Distanz, in der sie sich zu
einer Partei befinden, einfacher abzuschätzen.
Wettbewerb der Parteien findet vor allem in diesem Raum
statt.
Zur Frage der Mehrdimensionalität später mehr
324
Die Funktion der Medien
Ideologien und Parteistandorte müssen den Wählern bekannt gemacht
werden
Diese Aufgabe erledigen die (Massen-) Medien.
Aber:
Der rationale Wähler ist schlecht informiert
D.h. er hat keinen Anreiz, Informationen über das öffentliche Gut
„Politikermeinung“ einzuholen
Er hat auch keinen Anreiz Informationen über andere, aus seiner Sicht
öffentliche Güter nachzufragen
Der letzte Stand der Diskussion um die nächste Rentenreform?!
Arbeitsmarktreformen der Zukunft?!
325
Private Medien
Bieten die Information an, die auch nachgefragt wird
Das sind nicht „politische Informationen“
Politiker passen sich den Bedingungen des Medienmarktes an
Produzieren die Information, die eine Chance hat, veröffentlicht
zu werden
Darin besteht die eigentlich wichtige Medienfunktion:
Nicht in der direkten Beeinflussung der Wähler
Außerdem wirken sie als Agenda Setter!
Sie bestimmen die Themen der Diskussion
These:
Rationale Politiker und rationale Journalisten investieren nicht in
Kompetenz
326
Parteienverhalten
Parteienverhalten stark abhängig von den institutionellen
Bedingungen:
Verhältniswahlrecht?
Zwei Parteien System?
„Arbeitspferd“ der public choice Theorie:
Medianwählermodell
Eingeschränkt in seiner Anwendbarkeit:
Eindimensionalität des Entscheidungsraums
Wähler und Politiker müssen den gleichen Entscheidungsraum
unterstellen
Verhältniswahlrecht nicht abbildbar etc.
Dennoch: Tendenz zur Mitte wird häufig beobachtet
327
Gleichgewichte für mehr als zwei Parteien:
3 Parteien ist der Ausnahmefall, denn bei drei Parteien
existiert kein Gleichgewicht
Beachte dass es in Deutschland lange Zeit ein stabiles Drei Parteien
System gab
Bei 4 Parteien: Je zwei auf ¼ und ¾
Bei 5 Parteien: Wie bei 4 plus eine Partei auf ½
Allen Modellen gemeinsam:
Verhaltensannahme für die Politiker:
Stimmenmaximierer
Rational und eigennützig
Interessiert an Macht und Amt
328
Interessengruppen
Zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Interessengruppen
Erfolg heißt: Partikulare Interessen durchsetzen, ggf. auf Kosten
der Allgemeinheit.
Steinkohlelobby, Landwirtschaft
Greepeace, Anti Atom Bewegung
Gewerkschaften
Aber genauso gibt es viele Gruppen, die sehr wenig Erfolg
haben
Wovon hängt es ab, Interessengruppen erfolgreich sind oder
nicht?
329
Informationspolitik und Drohpotential
Informationspolitik bedeutet, die öffentliche Meinung zu
mobilisieren
es geht auch darum, die Politiker zu informieren, aber das
Interesse der Politiker an dieser Information hängt stark von
der öffentlichen Aufmerksamkeit ab.
Nachfrageverhalten der Medien:
Produziere Nachrichten, die gefragt werden, die gut visualisierbar sind,
Unterhaltungswert besitzen
Beispiel: Bauerndemo, Greenpeace Aktionen
Themen, die die Medien auf die Agenda setzen, müssen von
der Politik aufgegriffen werden.
330
Drohpotential
Was geschieht, wenn sich die Interessengruppe nicht durchsetzt?
Die Konsequenzen daraus sind zu einem erheblichen Teil endogen, d.h.
können von der Interessengruppe gestaltet werden.
Beispiele:
Durchschnittsalter im Steinkohlebergbau
Mengensubventionen in der Landwirtschaft an Stelle von direkten
Einkommenszuschüssen.
331
Bürokratie
Zwischen dem, was Politiker beschließen und dem, was
tatsächlich geschieht, kann es beträchtliche Unterschiede
geben: Dazwischen liegt die Bürokratie.
Bürokraten haben Spielräume
Diese können genutzt werden zu
Maximierung des eigenen Budgets (Niskanen Modell)
Minimierung des Arbeitsleides
Gegenmittel:
entstehen durch asymmetrische Information
Privilegien für loyales Verhalten (Lebensstellung, Ministerialzulage
etc.)
Abbau dieser Privilegien: Gefahr der „Südamerikanisierung“
332