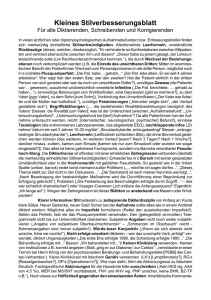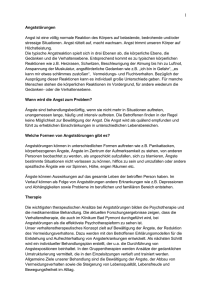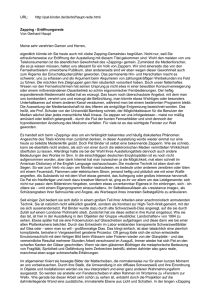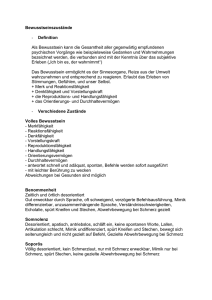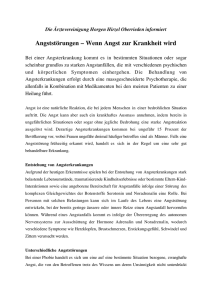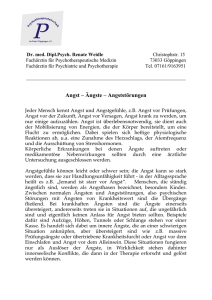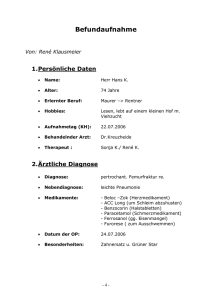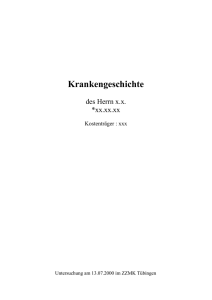Angst lass nach - Caritas Akademie
Werbung

Angst lass nach Möglichkeiten der Angsterkennung in der Palliativbetreuung 4. Interprofessioneller Basislehrgang Palliativ Care 2011/2012 DGKS Irmgard Kothgasser Dr.med.univ. Thomas Lausch DGKS Anna-Maria Palko DGKP Gernot Plank Dr.in med.univ. Stefanie Schatz-Krienzer Projektbetreuung: OA Dr.in Julijana Verebes I INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 1 1. Angst 3 1.1 Definition der Angst in der Psychologie: 3 1.2 Stufen der Angst 4 1.2.1 Sorge, Vorsorge, Unsicherheit: 4 1.2.2 Angst als Zustand (state anxiety): 4 1.2.3 Angst als Eigenschaft (trait anxiety): 4 1.2.4 Reale Angst: 5 1.2.5 Unreale Angst: 5 1.2.6 Panik: 5 1.3 Symptome der Angst 6 1.4 Psychophysiologie der Angst 6 1.5 Die Angststörungen: 8 1.5.1 Die Panikstörung 8 1.5.2 Die generalisierte Angststörung: 9 1.5.3 Die Phobien: 10 2. Ängste in der Palliativ Care 11 2.1 Angst vor Tod und Sterben: 12 2.2 Verletzungsangst 13 2.3 Spirale der Angst (Angst/Schmerzen) 13 2.4 Angst vor dem Verlust der Selbständigkeit und der Selbstbestimmungsfähigkeit 15 2.5 Angst vor dem Verlust sozialer Beziehungen 15 2.6 Angst um die wirtschaftliche Existenz 16 3. Häufigkeit der Angst 17 4. Abwehrmechanismen gegen Ängste 20 4.1 Verdrängung 21 4.2 Verleugnung 21 4.3 Vermeidung 21 4.4 Verschiebung 21 4.5 Projektion 22 II 4.6 Rationalisierung 22 4.7 Regression 22 4.8 Das Eisbergmodell 23 5. Instrumente zur Erfassung der Angst 25 5.1 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 25 5.2 Beck Angst Inventar (BAI) 27 5.3 Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD 7) 28 5.4 Diagnostisches Interview: 28 5.4.1 Das standardisierte, strukturierte Interview 29 5.4.2 Das halb standardisierte oder semistrukturierte Interview 29 5.4.3 Ein offenes, unstrukturiertes/nicht standardisiertes Interview 30 5.4.4 Das qualitative Interview 30 6. Arbeitsprozess/ Methodik/Fallpräsentationen 31 6.1 Arbeitsprozess 31 6.2 Methodik: 33 6.3.1 Fall 1 vom 07.03.2012: 34 6.3.2 Fall 2 vom 15.03.2012: 36 6.4 Fallberichte (Anna Maria Palko) 38 6.4.1 Fall 3 vom 30.01.2012: 38 6.4.2 Fall 4 vom 15.2.2012: 39 6.5 Fallberichte (Thomas Lausch) 41 6.5.1 Fall 5 vom 22.12. 2011: 41 6.5.2 Fall 6 vom 10.05.2012: 43 6.6 Fallberichte (Irmgard Kothgasser) 46 6.6.1 Fall 7 vom 20.03.2012/ 27.03.2012: 46 6.6.2 Fall 8 vom 28.01.2012: 48 6.7 Fallberichte (Gernot Plank) 50 6.7.1 Fall 9 vom 29.03. 2012: 50 6.7.2 Fall 10 vom 29.03. 2012: 53 7.1 Angst darf nicht bagatellisiert oder „ausgeredet“ werden 56 7.2 Angst muss angenommen werden 56 III 7.3 Über Angst kann (muss) gesprochen werden 57 7.4 Diffuse Angst soll so konkret wie möglich werden 57 7.5 Körperliche Begleiterscheinungen der Angst sollten ausagiert werden 58 7.6 Für unvermeidbar ängstigende Situationen sollte ein entspannendes Gleichgewicht geschaffen werden 58 8. Therapie der Angststörungen 59 8.1 Nicht-pharmakologische Therapien: 60 8.1.1 Pädagogische Aufklärung 60 8.1.2 Verhaltenstherapie 60 8.1.3 Kognitive Therapie 61 8.1.4 Tiefenpsychologisch (analytisch) orientierte Psychotherapie 61 8.1.5 Entspannungstherapie 62 8.2 Pharmakologische Therapie: 62 8.2.1 Benzodiazepine 64 8.2.2 Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 64 8.2.3 Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI): 65 8.2.4 Serotonin-(5-HT2)-Antagonist und Wiederaufnahmehemmer (SARI) 66 8.2.5 Noradrenerg, spezifisch serotonerges Antidepressivum (NaSSA) 67 8.2.6 Partieller 5-HT1A-Agonist 67 8.2.7 Selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI) 67 8.2.8 Glutamat-Modulator (GM) 67 8.2.9 Trizyklische Antidepressiva (TZA) 68 8.2.10 Antipsychotika 68 8.2.11 Antikonvulsiva 68 8.2.12 Anthistaminika 69 8.2.13 Opipramol 69 8.2.14 Phytopharmaka 69 8.2.15 Beta-Blocker 69 8.2.16 Agomelatin 69 8.3.1 Therapieresistenz 70 9. Pflegerische Maßnahmen zur Angstlinderung 72 IV 9.1 Aromapflege: 72 9.1.1 Beruhigende Öle 72 9.1.2 Anregende Öle 73 9.1.3 Anwendung: 73 9.1.4 Kontraindikationen: 74 9.2 Basale Stimulation und Ganzheitlichkeit 74 9.2.1 Berührung und Berührungsqualitäten 75 9.2.2 Ziel der Berührungen: 76 9.3 ASE -Atemstimulierende Einreibung 76 9.3.1 Ziel der ASE: 77 9.4 Beruhigende Ganzkörperwaschung(GKW) 77 9.5 Beruhigende Teilwäsche der Füße und der Beine: 78 10. Schlusswort 79 Anhang 81 Interviewprotokolle (Stefanie Schatz – Krienzer): 81 Interview 1 vom 07.03.2012 : 81 Interview 2 vom 15.03.2012 82 Interviewprotokolle (Anna Maria Palko): 84 Interview 3 vom 30.01.2012: 84 Interview 4 vom 15.02.2012: 85 Interviewprotokolle (Thomas Lausch): 88 Interview 5 vom 22.12. 2011: 88 Interview 6 vom 10.05.2012: 89 Interviewprotokolle (Irmgard Kothgasser): 92 Interview 7 vom 20.03.2012 92 2. Gespräch vom 27.03.2012 93 Interview 9 vom 29.03. 2012: 96 Interview 10 vom 29.03.2012: 98 HADS-D-Fragebogen: 100 HADS-D Auswertungshilfe: 101 HADS-D Auswertung/Interpretation: 102 V SKID Strukturiertes klinisches Interview für DSM – IV 102 DIPS Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen 102 Durchführung der Atemstimulierenden Einreibung (ASE): 103 Durchführung der Beruhigenden Ganzkörperwaschung (GKW): 104 Literaturverzeichnis 105 Bilderverzeichnis 108 1 “Es gibt kein Leben ohne Angst vor dem anderen, schon weil es ohne diese Angst, die unsere Tiefe ist, kein Leben gibt. Erst aus dem Nicht–Sein, das wir ahnen, begreifen wir für Augenblicke, dass wir leben. Man freut sich seiner Muskeln, man freut sich, dass man gehen kann, man freut sich des Lichtes, das sich unserem dunklen Auge spiegelt, man freut sich seiner Haut und seiner Nerven, die uns so vieles spüren lassen, man freut sich und weiß mit jedem Atemzug, dass alles, was ist, eine Gnade ist. Ohne dieses spielende Wachsein, das nur aus der Angst möglich ist, wären wir verloren. Wir wären nie gewesen.“ (Max Frisch)1 EINLEITUNG (Dr.med.univ.Thomas Lausch) Patienten mit schweren bzw. chronischen Krankheiten werden häufig von Ängsten geplagt. Zum Beispiel Angst vor einem Fortschreiten der Erkrankung, vor Kontrollverlust, vor quälenden Symptomen, vor dem Verlust sozialer Beziehungen, Angst sterben zu müssen sowie Existenzängste stellen Patienten vor unlösbare Probleme. Nimmt die Angst derart überhand, dass sie längere Zeit anhält, ein unangemessenes Ausmaß annimmt und Patienten sich in ihr „gefangen“ oder von ihr „überflutet“ fühlen, so bekommt das Symptom Angst einen Krankheitswert und wird behandlungsbedürftig.2 Patienten entwickeln Abwehrmechanismen und bauen Barrieren auf, sodass die Verbalisierung dieser Ängste durch Betreuende und Pflegende eine schwierige Gradwanderung darstellt und sich somit oft einer symptomatischen Behandlung entzieht. Sämtliche Professionen im Palliativ Care Bereich wissen, dass ihre Klienten bzw. ihre Patienten von vielen Ängsten geplagt werden, trotzdem werden im täglichen Umgang mit ihnen Ängste zu selten thematisiert und verbalisiert. Ein Grund hierfür könnte ein zu geringes Symptomverständnis sein. Vegetative Begleiterscheinungen wie Schlafstörungen, Herzrasen, Beklemmungsgefühle werden falsch interpretiert oder sogar übersehen. Psychische Problemsituationen werden bei einer auf den Körper fokussierten Medizin nicht beachtet und nicht behandelt. “Es fällt uns nicht schwer, 1 2 Specht-Tomann, Monika: Zeit des Abschieds. Sterbe- und Trauerbegleitung, Ostfildern 2010, S.90. Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1059. 2 ihnen die beste ärztliche Pflege und Betreuung zu verschaffen, aber nur zu oft vernachlässigen wir ihre viel schmerzhafteren emotionalen und seelischen Beschwerden.“3 Die Angst des Behandelnden vor den Ängsten der Patienten und die dadurch entstehende Hilflosigkeit sowie die Ohnmacht, gewisse Situationen nicht beherrschen zu können, führt dazu, dass sie bewusst nicht angesprochen werden. „Der Umgang mit der Angst erfordert eine hohe kommunikative, allgemein gesprochen, menschliche Kompetenz der Betreuer.“4 Behandelnde müssen sich vorerst ihren eigenen Ängsten stellen und diese verarbeiten können, um Patienten mit Ängsten helfen zu können. Ziel unserer Arbeit sollte es sein, das Symptom Angst in unserem Arbeitsumfeld zu thematisieren und mit Hilfe von Kurzinterviews zu versuchen, Ängste zu erkennen bzw. zu verbalisieren, ohne die Integrität des Patienten zu verletzten. Kommunikationsbarrieren sowie eigene Hemmungen bzw. Defizite gilt es vorab aufzuarbeiten, um professionell arbeiten zu können. Mit unserer Arbeit wollen wir Kollegen im Bereich der Palliativ Care eine Hilfestellung im Umgang mit dem Symptom „Angst“ geben. 3 Kübler-Ross, Elisabeth: Verstehen was Sterbende sagen wollen, Einführung in ihre symbolische Sprache, München 1981, S. 10. 4 Speidel, Hubert: Angst in der Palliativmedizin, in Georg Thieme: Zeitschrift für Palliativmedizin, Jahrgang 2007, Heft 8, S. 33. 3 1. ANGST (DGKP Gernot Plank) „Angst ist ein vitales Grundgefühl des Menschen. Sie gehört zur menschlichen Existenz und wird als physikalische Grundfunktion bezeichnet. Gefühle der Angst treten in Situationen auf, in welchen die Sicherheit und Integrität einer Person bedroht sind, in welchen ihr eine adäquate Reaktion nicht möglich scheint, in denen sie sich hilflos und orientierungslos fühlt und in denen sie die Kontrolle und Steuerung des eigenen Ichs zu verlieren droht. Angst beengt den Menschen, erregt und lähmt seinen Willen und ist mit körperlichen Begleiterscheinungen verbunden. Sie tritt dort auf, wo der Mensch im Verlauf seiner Entwicklung einer Situation nicht oder noch nicht gewachsen ist. Angst zeigt physisch Gefahren und psychisch Bedrohungen auf und ist somit ein sinnvolles Warnsignal für das Individuum“.5 Das Wort „Angst“ kommt von der indogermanischen Wurzel „angh“ welches „Enge“ bedeutet, im Lateinischen verwandt mit dem Wort „angustus“ (Enge, Beengen) sowie mit dem Wort „angor“. Dies ist ebenfalls eine Bezeichnung für Angst und wird auch als Verb für „würgen“ verwendet. Angst schnürt uns die Kehle zu, Angst beengt unseren Brustkorb, Angst wird somit mit Atemnot in Verbindung gebracht. Wir spüren, dass, wenn eine Angstsituation vorbei ist, wir wieder aufatmen und durchatmen können.6 1.1 Definition der Angst in der Psychologie: Angst wird bezeichnet als ein mit Beengung, Erregung und Verzweiflung verknüpftes Lebensgefühl, dessen besonderes Kennzeichen die Aushebung der willensmäßigen und verstandesmäßigen Steuerung der Persönlichkeit ist.7 Webster (1976) bezeichnet Angst als qualvolle innere Unruhe aufgrund eines drohenden oder 5 Bühlmann, Josi: Angst, in Käppelli Silvia: Pflegekonzepte. Phänomene im Erleben von Krankheit und Umfeld, Bern 2004, S. 81. 6 Vgl. Kast, Verena: Vom Sinn der Angst, Wie Ängste sich festsetzen und wie sie sich verwandeln lassen, Freiburg 2001, S. 9. 7 Vgl. Häcker, Hartmut; Stapf, Karl Heinz: Dorsch Psychologisches Wörterbuch, Bern 1994, S. 34. 4 befürchteten Unheils. Für Eidelsberg ist sie ein Unbehagen, das man empfindet, wenn der betreffende Gegenstand unbekannt ist, sowie die Vorahnung, dass man von einer inneren oder äußeren Macht überwältigt werden wird.8 1.2 Stufen der Angst In der psychologischen Literatur werden folgende Stufen der Angst unterschieden: 1.2.1 Sorge, Vorsorge, Unsicherheit: Hier ist der Mensch besorgt, macht sich Sorgen, was oft zu einem Aufgeregtsein und einer übertriebenen Wahrnehmung der eigenen Körperempfindungen führt.9 1.2.2 Angst als Zustand (state anxiety): Nach Spielberger stellt diese Art der Angst einen emotionalen Zustand dar, welcher durch Anspannung, Nervosität, innere Unruhe und Furcht vor zukünftigen Ereignissen gekennzeichnet ist. Dieser Zustand wird bewusst erlebt, das Individuum kann daher seine Erfahrungen mitteilen. Die Zustandsangst ist eine vorübergehende Emotion auf eine reale Bedrohung.10 1.2.3 Angst als Eigenschaft (trait anxiety): Dies ist nach Spielberger das erworbene Verhaltensmuster, objektiv ungefährliche Situationen als Bedrohung wahrzunehmen und mit einer überschießenden Angstreaktion zu begegnen.11 Es ist somit eine Angstreaktion auf eine unreale Bedrohung. 8 Vgl. Levitt, Eugene: Die Psychologie der Angst, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1987, S. 16. 9 Vgl. Schwarzer, Ralf: Stress, Angst und Hilflosigkeit. Stuttgart/Berlin/Köln 1981, S. 80. 10 Vgl. Schwarzer, Ralf: Stress, Angst und Hilflosigkeit. Stuttgart/Berlin/Köln 1981, S. 81. 11 Vgl. Häcker, Hartmut; Stapf, Karl Heinz: Dorsch Psychologisches Wörterbuch, Bern 1994, S. 15. 5 1.2.4 Reale Angst: Diese Angst wird durch eine greifbare, äußere Bedrohung hervorgerufen und wird auch als rationale Angst bezeichnet. Diese Angst signalisiert Gefahren und stellt die notwendige Energie für eine Abwehr- / Fluchtreaktion zur Verfügung.13 1.2.5 Unreale Angst: Die unreale oder irrationale Angst ist eine pathologische Angstform. Ängste entstehen in unserer Vorstellung ohne greifbare äußere Bedrohung. Die unreale Angst manifestiert sich in Form von Angststörungen wie der generalisierten Angststörung oder auf bestimmte Auslöser in Form von Phobien, z.B. Platzangst, oder Agoraphobie.13 1.2.6 Panik: Panik wird durch ein Übermaß an Angst ausgelöst und als destruktives Erlebnis bezeichnet, welches extrem zerstörerische Reaktionen hervorruft und kein gezieltes Handeln mehr zulässt.14 Panikattacken äußern sich in erster Linie durch ein psychosomatisches Erleben mit Schweißausbrüchen, Zittern, Herzschmerzen und Schwindel. Angst als Ursache dieser Situation wird häufig nicht zugegeben.15 Man kann wie bereits erwähnt zwischen einer physiologischen Angst, welche als natürliches und festgelegtes Gefühl bei Mensch und Tier vorhanden ist, und einer krankhaften Angst, welche auch in Verbindung mit anderen psychiatrischen Erkrankungen stehen kann, unterscheiden. Die krankhafte Angst kann sich im Rahmen einer Angststörung, einer Psychose oder Depressionen sowie bei verschiedenen medizinischen Krankheiten, z.B. Hyperthyreose, manifestieren.16 12 Vgl. Flöttmann, Holger Bertrand: Angst/Ursprung und Überwindung, Stuttgart, 1993, S. 15. 13 Vgl. Häcker, Hartmut; Stapf, Karl Heinz: Dorsch Psychologisches Wörterbuch, Bern 1994, S. 15. 14 Vgl. Erni, Margrit: Zwischen Angst und Sicherheit, Düsseldorf 1989, S. 21. 15 Vgl. Kast, Verena: Vom Sinn der Angst, Wie Ängste sich festsetzen und wie sie sich verwandeln lassen, Freiburg 2001, S. 101. 16 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie. 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 151. 6 1.3 Symptome der Angst Die körperlichen Symptome der Angst sind normale physiologische Reaktionen, die bei (einer realen oder phantasierten) Gefahr die körperliche oder seelische Unversehrtheit, im Extremfall also das Überleben, sichern sollen. Sie sollen ein Lebewesen auf eine Kampf- oder Fluchtsituation (fight or flight) vorbereiten: - Durch Ausschüttung von Stresshormonen, wie Adrenalin und Cortisol, und Aktivierung des Sympathikus kommt es zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. - Pupillen weiten sich; Seh- und Hörnerven werden empfindlicher. - Erhöhte Muskelanspannung, erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit. - Erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck. - Flachere und schnellere Atmung. - Energiebereitstellung in Muskeln. - Körperliche Reaktionen wie zum Beispiel Schwitzen, Zittern und Schwindelgefühl. - Blasen-, Darm- und Magentätigkeit werden während des Zustands der Angst gehemmt. - Übelkeit und Atemnot treten in manchen Fällen ebenfalls auf. - Absonderung von Molekülen im Schweiß, die andere Menschen Angst riechen lassen und bei diesen unterbewusst Alarmbereitschaft auslösen. Die körperlichen Ausdrucksformen der Angst sind die gleichen, unabhängig davon, ob es sich um eine reale Bedrohung oder um eine Panikattacke handelt. Patienten mit einer Angststörung zeigen gleiche körperliche Reaktionen auf irrationale Ängste.17 1.4 Psychophysiologie der Angst Die Psychophysiologie befasst sich mit den Beziehungen zwischen psychischen Vorgängen und den zugrundeliegenden körperlichen Funktionen. Sie beschreibt, wie 17 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Angst (09.03.2012) 7 Emotionen, Bewusstseinsänderungen und Verhaltensweisen mit Hirntätigkeit, Kreislauf, Atmung, Motorik und Hormonausschüttung zusammenhängen. Für die Entstehung und Weiterverarbeitung von Ängsten werden im Gehirn verschiedene Regionen beansprucht. Dem Corpus amygdaloidem (Amygdala), oder Mandelkern, wird die Hauptrolle in der Angstentstehung zugeschrieben. Der Mandelkern ist ein Komplex im Bereich des Schläfenlappens, ein evolutionsgeschichtlich alter Teil des Großhirns, der dem limbischen System zugeordnet wird. Das Limbische System ist eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und Entstehung von Triebverhalten dient. Die Amygdala gleicht jede Situation, in der wir uns befinden mit vorgespeicherten, alten Informationen ab. So werden traumatische Erlebnisse im Mandelkern gespeichert, eine „Angstkonditionierung“ findet statt. Tritt eine ähnliche Situation auf, schlägt die Amygdala „Alarm“ und das vegetative Nervensystem wird erregt, so wird der Körper auf Kampf bzw. Flucht vorbereitet. Diese im Unterbewusstsein verlaufende Reaktion verläuft um vieles schneller als die vom Großhirn bewusst gesteuerte Reaktion, erst im Nachhinein kann durch rationelles Denken oft eine Entschärfung der Situation mit Abnahme der Hormonausschüttung und somit Abnahme der körperlichen Reaktion erzielt werden.18 Abb. 1: Amygdala im Saggitalschnitt19 Abb.2: Amygdala im MR – Bild 18 Vgl. www.angst-und-panik.de/angst.../die-amygdala/index.html (09.03.2012) 19 Abb. 1 aus http://www.psycheducation.org/emotion/amygdala.htm (09.03.2012) 20 Abb. 2 aus http://www.astropage.eu/index_news.php?id=587 (09.03.2012) 20 8 Nach bisherigem Wissensstand spielen bei Ängsten vor allem drei Neurotransmittersysteme eine wichtige Rolle: · Das GABA-erge System · Das Noradrenerge System · Das Serotonerge System Die medikamentöse Therapie der Angststörungen greift in diese Neurotransmittersysteme ein. 1.5 Die Angststörungen: Von einer Angststörung spricht man, wenn häufige, langandauernde und unrealistische Angst zu deutlichem Leiden bzw. zu deutlicher Beeinträchtigung in der normalen Lebensführung einer Person führt.21 Hauptmerkmal ist eine psychische als auch eine körperliche Manifestation von Angstsymptomen sowie einem Vermeidungsverhalten. Angststörungen zählen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen. Folgende Hauptkategorien können unterschieden werden: Panikstörung, Generalisierte Angststörung, Soziale Phobie sowie spezifische Phobien. Bei der Panikstörung und Generalisierten Angststörung ist meist die Angst dominierend- bei den Phobien ist meist das Vermeidungsverhalten vorrangig.22 1.5.1 Die Panikstörung Synonyme sind episodisch paroxysmale Angst oder Herzphobie: Leitmerkmale sind Panikattacken mit intensiver Angst und Unbehagen, welche rasch und unerwartet auftreten und meist eine Dauer zwischen 1 und 60 Minuten haben. Die Symptome sind von psychischer und körperlicher Natur. 21 22 Vgl. http://www.i-med.ac.at/medpsy/patienten/angst.html (09.03.2012) Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie. 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 151. 9 Psychische Symptome wie Angst zu sterben, Angst die Kontrolle zu verlieren, Ohnmachtsgefühle, Angst verrückt zu werden sowie das Gefühl, sich in einem Albtraum zu befinden, zeichnen eine Panikattacke aus. Zu den körperlichen Symptomen zählen Schwindel, Erstickungsgefühle, Atemnot, Brustschmerzen, Durchfall, Harndrang, Parästhesien („Kribbeln“), weiche Knie, Tachykardie, abdominelle Beschwerden, Zittern, starker Schweiß, Hitzewallungen oder Kälteschauer. Panikattacken werden nicht durch Situationen realer Bedrohung ausgelöst. Patienten mit einer Panikstörung neigen zu Alkohol- und Medikamentenabusus, die im Sinne einer Selbstmedikation zur Behandlung der Panikstörung eingesetzt werden. Zur Diagnose einer Panikstörung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Mehrere schwere Panikattacken innerhalb eines Monats. Die Attacke ist nicht auf bekannte oder vorhersehbare Situationen begrenzt. Es müssen weitgehend angstfreie Zeiträume bestehen. Im Zusammenhang mit einer Depression sollte die Panikstörung nicht als Hauptdiagnose stehen. Panikstörungen treten meist im Alter zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf. Sie zeigen einen chronischen, jahrzehntelangen Verlauf mit häufiger Entwicklung von depressiven Episoden bzw. Auftreten einer Missbrauchssymptomatik. Eine soziale Isolation sowie Minderung der Arbeitsfähigkeit findet sich jedoch nur in 10% aller Fälle.23 1.5.2 Die generalisierte Angststörung: Synonym Angstneurose: Bei der generalisierten Angststörung verselbständigt sich die Angst und verliert ihre Relation. Sie zeichnet sich durch ausgeprägte Angstzustände aus, die mehrere Wochen andauern und an den meisten Tagen bestehen. Der Patient erlebt eine generalisierte und anhaltende Angst, die nicht (wie bei den phobischen Störungen) auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt ist, sondern vielmehr frei flottiert. 23 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie. 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 153 -163. 10 Inhalt der Angst ist in den meisten Fällen eine unbegründete Sorge und Befürchtungen vor zukünftigen Unglücken oder Erkrankungen. Der Betroffene ist kaum oder nicht in der Lage die alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. Er hat Angstzustände, die kaum Kraft für einen normalen Lebenswandel lassen. Die Krankheit beginnt meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, oft im Zusammenhang mit belastenden Lebensumständen. Der Verlauf ist unterschiedlich, neigt aber zu Schwankungen und Chronifizierung. Neben den psychischen Symptomen mit Nervosität und Schlafstörungen werden vegetative Übererregbarkeit, Schwindel, Zittern und Herzrasen beobachtet. Zu den Diagnosekriterien einer generalisierten Angststörung gehören: monatelange Befürchtungen, Ängste und Sorgen; Schlafstörungen, körperliche Unruhe, die Unfähigkeit sich zu entspannen sowie vielfältige körperliche Symptome wie Herzrasen, Schwitzen, Magenbeschwerden, Übelkeit, Schwindel und Erstickungsgefühl. Eine Depression sowie eine organische Ursache der Symptome muss ausgeschlossen werden. Die generalisierte Angststörung ist neben den spezifischen Phobien eine der häufigsten Angststörungen.24 1.5.3 Die Phobien: Eine weitere Art der Angststörung sind die Phobien. Diese spielen im Bereich der Palliativ Care kaum eine Rolle und werden somit hier nicht behandelt. 24 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried;Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie. 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 156 -164. 11 2. ÄNGSTE IN DER PALLIATIV CARE (DGKS Anna-Maria Palko) Angst gilt ganz allgemein als die emotionale Reaktion auf die Vorwegnahme persönlich bedeutsamer Verluste. Die Angst setzt also dann ein, wenn etwas, was uns persönlich als sehr wertvoll erscheint, was für uns einen großen Wert darstellt, in Gefahr ist.25 Im Falle einer tödlichen Erkrankung ist unser Leben in Gefahr sowie der Verlust von sämtlichen Beziehungen denkbar. Angst ist somit eine natürliche, verständliche Reaktion. Das Spektrum der Angstauslöser im palliativen Setting ist vielfältig, aber auch sehr differenziert und individuell. Die Ängste bei Tumorkranken sind oft unabhängig vom Ausmaß der Krankheit und der Behandlung, tendenziell nehmen sie aber im Verlauf der Krankheit in Abhängigkeit der Symptomausprägung zu. Es sind vor allem Verlustängste, die aus dem Kranksein selbst resultieren, die Angst vor dem Verlust körperlicher Integrität, Verlust der wirtschaftlichen Existenz, der sozialen Geborgenheit, schließlich die Angst vor dem Verlust des Daseins selbst. Die Ängste der Patienten können in uns als Therapeuten und Pflegepersonen ebenfalls Ängste und Hilflosigkeit auslösen, da wir unsere eigene Zerbrechlichkeit erkennen können. .“Es ist dringend erforderlich, dass jeder, der Sterbende und ihre Familien betreut, jederzeit seine eigenen Sorgen und Ängste begreift, um die Projektion seiner eigenen Ängste zu vermeiden.“26 25 Vgl.: Kast, Verena: Vom Sinn der Angst, Wie Ängste sich festsetzen und wie sie sich verwandeln lassen, Freiburg 2011, S. 31. 26 Kübler-Ross, Elisabeth: Verstehen was Sterbende sagen wollen, Einführung in ihre symbolische Sprache, München 1981, S. 26. 12 „Die Menschen fürchten den Tod so, wie Kinder das Dunkel fürchten“ (Francis Bacon)27 2.1 Angst vor Tod und Sterben: Laut Elisabeth Kübler Ross hat der Mensch schon seit jeher Angst vor dem Tod. Sie erklärt dies damit, dass wir im Unterbewusstsein davon überzeugt sind, dass wir selbst unmöglich vom Tode betroffen sein können. Die Vorstellung eines natürlichen Todes ist für uns unbegreiflich. Wir schieben den Tod immer irgendeiner bösen Einwirkung von außen, einer furchtbaren Untat zu, die nach Vergeltung und Strafe schreit.28 Die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben beginnt bei vielen Kranken bereits mit der Diagnosestellung. Die Krankheit bedroht das Leben, das Bewusstsein verändert sich, Lebenspläne geraten ins Wanken, es kommt zu Einbrüchen der Identität und sozialen Beziehungen. Die Angst steigt mit der Krankheitsdauer, besonders wenn Rezidive oder Metastasen auftreten, Therapiekonzepte nicht greifen und die Krankheit absehbar zum Tod führen wird. Sterbenskranke erleben sich schwach und hinfällig. Der Bewegungs- und Gestaltungsrahmen wird enger. Die Angst vor dem Verlust von Kontrolle und Autonomie, verbunden mit den körperlichen Veränderungen durch Krankheit und Behandlung, stellt eine enorme psychische Belastung dar. Die Auseinandersetzung mit dem Sterben ist schmerzhaft. Ohnmacht, Zorn, Verzweiflung, Wut und Trauer wechseln sich mit Resignation, Verleugnung und manchmal Annahme der Situation ab. Die Hoffnung, das Lebensende doch noch hinauszuschieben, verändert sich und baut sich immer wieder neu auf. Wie werde ich sterben? Werde ich große Schmerzen erleiden? Muss ich ersticken? Werde ich alles bewusst erleben? Wie viel Zeit bleibt mir noch? Diese verzweifelten und quälenden Fragen stehen oft im Mittelpunkt nicht enden wollender Gedankenkreisläufe.29 27 Gesine Baur, Eva; Schmid-Bode, Wilhelm: Wie der Tod keine Angst macht, Hamburg 2005, S.20. 28 Kübler-Ross, Elisabeth: Interviews mit Sterbenden, München 2001, S. 12f. 29 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1063f. 13 2.2 Verletzungsangst Mit der Krankheitsdauer steigt auch die Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen, die mit Schmerz assoziiert werden. Dies bezieht sich auf eingreifende Operationen die das Körperbild verändern, Entstellungen oder Funktionsverluste zur Folge haben, aber auch therapie- und krankheitsbedingte Veränderungen wie Haarausfall, Fisteln und Narben. Auch „Zeichnung“ durch die Krankheit wie Aszites oder Kachexie zählen zur Verletzungsangst des Patienten sowie Einbrüche und Verletzungen der Intimsphäre und Integrität. Durch häufige, medizinische Interventionen entwickeln sich manchmal so starke Aversionen gegen Spritzen oder Infusionen, dass bereits das Legen eines Venenzuganges zur großen psychischen Belastung werden kann. Sehr konkrete Verletzungsangst zeigt sich z.B. bei Patienten mit Knochenmetastasen: Bei jeder Lagerung kann es zu einer Spontanfraktur kommen, jeder versehentliche Stoß gegen die Bettkante kann Schmerzen verursachen. 2.3 Spirale der Angst (Angst/Schmerzen) Ängste und körperliche Symptome wie Schmerzen sind häufig vergesellschaftet, und oft bedingen sich die Beschwerden gegenseitig oder können sich wechselseitig verstärken. Eine Spirale der Angst entsteht häufig durch chronische oder instabile Schmerzsyndrome, Übelkeit und Erbrechen, Atemnot sowie zunehmende körperliche Schwäche oder Schlafstörungen. In schlaflosen Nächten werden Schmerzen durch Angst und Hilflosigkeit stärker wahrgenommen. Schmerz, und vor allem chronischer Schmerz ist bei einer onkologischen Grunderkrankung ein unbarmherziger Mahner, dass die Erkrankung fortschreitet und macht den Menschen auf Dauer hilflos. Umgekehrt können ständige Ängste und Sorgen der Schwerkranken über eine ungewisse Zukunft, Angst vor dem Tod, Sorge um die Familie, Verlust der Familienrolle, finanzielle Verluste, Verlust der sozialen Stellung, Einschränkung der Autonomie und das Gefühl der Hilflosigkeit, sich durch körperliche Beschwerden wie Schmerzen bemerkbar machen. Aus dieser Perspektive verbinden sich Schmerz und Angst zu einem psychophysiologischen Stressor. 14 Abb. 3: Psychische und psychosoziale Auswirkung des Schmerzerlebens (Hoffmann und Marqulies 1994)30 Aber auch die Institution Krankenhaus kann durch die Starrheit der Regeln und durch Undurchschaubarkeit der Organisation Ängste verstärken. Der Patient braucht wahrheitsgetreue, ausgewogene Informationen (soweit der Patient dies nicht selbst ablehnt) über Erkrankung und Behandlungssituation unter angemessenen zeitlichen und örtlichen Rahmenbedingungen, damit Angst- und Panikattacken vermieden werden. Schmerzen sind jene Symptome, die Patienten am meisten fürchten. Deshalb ist es wichtig, dass Informationen über die Unheilbarkeit der Erkrankung mit der Information verknüpft werden, dass es auf dem Gebiet der Symptombehandlung vor allem auch der Schmerztherapie sehr gute Möglichkeiten gibt, das Leid der Patienten zu lindern und man alles tun wird, um dem Patienten eine gute Lebensqualität zu ermöglichen.31 30 Abb. 3 aus Bernatzky, Günther; Likar, Rudolf: Schmerzbehandlung in der Palliativmedizin, 2., Aufl., Wien 2006, S. 204. 31 Vgl. Bernatzky, Günther; Likar, Rudolf: Schmerzbehandlung in der Palliativmedizin, 2. Aufl., Wien 2006, S. 204. 15 2.4 Angst vor dem Verlust der Selbständigkeit und der Selbstbestimmungsfähigkeit Besonders Schwerkranke sehen ihre Lebensgestaltung und Planung bedroht, Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, gesteckte Ziele werden unerreichbar. Der Verlust der Autonomie kann aber bereits durch längere Bettlägerigkeit oder körperliche Schwäche erlebt werden. Der Patient braucht selbst für kleine Handgriffe Hilfe. Das Gefühl, ausgeliefert und abhängig von anderen und auf Pflege angewiesen zu sein, lässt Patienten mitunter ungeduldig und zornig werden. Die Selbstachtung leidet, wenn körperliche Funktionen nicht mehr kontrolliert werden können. Ist die Krankheit mit kognitiven Einschränkungen verbunden, ist die Angst vor dem Kontrollverlust besonders groß.32 „Die tiefste Angst ist im Kern die Angst vor dem endgültigen Beziehungsverlust in einer Welt, die sich am Ende nicht mehr als jene Behausung erweist, als die wir sie ein Leben lang wahrgenommen haben. Der Tod erscheint dann als der radikalste und unwiderrufbarste Beziehungsverlust.“ (M Volkenandt) 33 2.5 Angst vor dem Verlust sozialer Beziehungen Bei lang andauender Krankheit können soziale Beziehungen unberechenbar werden. Freunde und manchmal auch Angehörige beginnen, sich zu distanzieren, andere, mit denen kein regelmäßiger Kontakt bestand, tauchen plötzlich wieder auf. Der Rückzug von Besuchern hat mit ihren eigenen Ängsten und ihrer Hilfslosigkeit im Umgang mit Schwerkranken zu tun. Patienten wiederum haben häufig Angst, für andere eine Belastung zu sein. Für beide Seiten ist es schwer, diese belastende Situation zu ertragen. Durch körperliche Schwäche und andere belastende Symptome, wie Schmerzen oder Atemnot, ist der Patient in seinem Handlungs- und Bewegungsradius stark eingeschränkt. Die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen oder Familienfeiern ist manchmal nicht möglich, manchmal auch aus Angst, man 32 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1063f. 33 Geisler, Linus: Kommunikation in der Palliativmedizin, in H. Hoefert: Kommunikation als Erfolgsfaktor im Krankenhaus, Heidelberg 2008, S. 131. 16 wäre eine Belastung für die Anwesenden. Dies führt häufig zu Rückzug in die eigenen vier Wände. 2.6 Angst um die wirtschaftliche Existenz Schwer- und chronisch Kranke geraten schneller in finanzielle Not. Die soziale Sicherung wird auch in unserem Land auf Grund der wirtschaftspolitischen Situation immer brüchiger. Die finanziellen Einbußen führen zu Zweifeln an der Gerechtigkeit unseres sozialen Systems. Es gibt Situationen, in denen Menschen durch plötzliches, schweres Kranksein aus ihren beruflichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen gerissen werden. Bei schnell fortschreitender Erkrankung werden sie direkt aus dem Arbeitsleben herausgeworfen, und nicht nur die eigenen finanziellen Belange sondern auch die finanzielle Zukunft der Angehörigen, ist ungelöst. Das frühe Ausscheiden aus der Arbeitswelt mindert den Selbstwert und kann massive Ängste auslösen.34 34 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1063f. 17 „Bedenkt man das menschliche Dasein, so ist es viel erklärungsbedürftiger, dass der Mensch meist keine Angst hat, als das er manchmal Angst hat“ (Schneider, 1967)35 3. HÄUFIGKEIT DER ANGST (DGKS Anna-Maria Palko) Epidemiologische Studien zeigen, dass zwischen 20 und 25 % der Bevölkerung psychisch so belastet sind, dass psychiatrische bzw. psychotherapeutische Behandlung notwendig wären. Davon ausgehend wird angenommen, dass ein Fünftel bis ein Viertel aller palliativ-medizinisch betreuten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens die Geschichte seelischer Belastungen mitbringen, bzw. klinisch relevante Ängstlichkeit zeigen. Eine große Verbundstudie in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat gezeigt, dass ca. 50% der Patienten, die mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind, diese ohne psychopathologische Reaktion verarbeiten. Bei der anderen Hälfte führt die Erkrankung aufgrund der psychischen Belastungsgeschichte zu ausgeprägter Anpassungsstörung. Im Vordergrund der Symptomatik stehen Angst und Depression.36 Untersuchungen der deutschen Krebsgesellschaft über die Häufigkeit von psychischen Störungen bei onkologischen und palliativmedizinisch betreuten Patienten im Rahmen einer interdisziplinärer Arbeitsgemeinschaft, Psychoonkologie und Palliativmedizin der deutschen Krebsgesellschaft, dem Universitäts-CancerCenter Hamburg und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, unter der Leitung von Mehnert/Oechsle, im Jahre 2009/2010, ergibt aber auch, dass Ängste und Depressionen im terminalen Stadium stark zunehmen. 37 35 http:// www.linus-geisler.de/ap/ap14_angst.htm (04.01.2012) 36 Vgl. Speidel, Hubert: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Vortrag auf dem 6. Kongress, 22. September 2006, [email protected]. 37 Vgl. http://www.uke.de/kliniken/hno/downloads/klinik.-hno/12-Menhert_oechsle.pdf (25.01.2012) 18 Epidemiologie psychischer Störungen bei Onkologischen und Palliativmedizinisch betreuten Patienten38 Insgesamt gibt es aber wenige Studien, die Depressive Störungen Angststörungen Posttraumatische 0-58% 9-77% bei terminal Kranken 1- 49% 50-80% bei terminal Kranken 0-35% Belastungsstörung Kognitive Störungen Keine Studien bei terminal Kranken (Delir, Demenz) Bis 85% bei terminal Kranken ausschließlich die Angstsymptomatik bei Palliativpatienten bzw. Tumorpatienten beschreiben. In einer Studie von Stark und Kiely 2002 gaben in einer speziell auf Angst ausgerichteten Untersuchung anhand eines HADS–Fragebogens 48% der Patienten Angstgefühle an. In einem diagnostischen Interview erfüllten 18% der Patienten Kriterien einer Angst-erkrankung.39 In einer weiteren, großen Studie mit 900 Patienten mit Malignomen konnte eine Gruppe um Carrol 1993 anhand einer Auswertung von HADS–Fragebögen eine psychische Komorbidität von 23% erkennen, wobei insgesamt 17,7% der Patienten höhere Werte für Angst zeigten. Außerdem konnte die Gruppe einen deutlichen Zusammenhang von Depression und Angst erkennen.40 Lt. Rolf Stecker weist jeder dritte Patient mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung sowie jeder fünfte Patient in der terminalen Phase der Erkrankung relevante depressive Störungen auf. Fast jeder zwölfte Betroffene in einer fortgeschrittenen, und jeder achte Erkrankte in der terminalen Phase, zeigt Symptome einer psychiatrisch relevanten Angststörung. Noch ausgeprägter ist das Ausmaß der relevanten Anpassungsstörungen. Hier schildert jeder dritte Patient solche Symptome. Auch die Angehörigen Erkrankter reagieren mit psychiatrisch relevanten 38 Vgl.http://www.uke.de/kliniken/hno/downloads/klinik.-hno/12-Menhert_oechsle.pdf (25.01.2012) 39 Vgl. Stark, D.; Kiely, M., u.a: Anxiety disorders in cancer patients: their nature, association and relation to quality of life, Journal of Oncologie 2002, 3137-3148, in Silvia Lehenbauer: Angst und Depression bei Tumorpatienten, Dissertation, Berlin 2008, S. 14. 40 Vgl. Carrol, BT.; Kathol, RG., u.a: Screening for depression and anxiety in cancer patients using Hospital Anxiety and Depression Scale, Gen Hosp Psychiatry 1993, 15(2), S. 69-74, in Silvia Lehenbauer: Angst und Depression bei Tumorpatienten, Dissertation, Berlin 2008, S. 14f. 19 Symptommustern. Die Notwendigkeit psychosozialer Betreuung durch ausgebildete Psychotherapeuten scheint deshalb evident.41 41 Vgl. Rolf, Stecker: Psychoonkologische Palliativtherapie im Akutkrankenhaus, PsychotherapieWissenschaft, Jahrgang 1, Heft 3/ 2011, S.161. 20 4. ABWEHRMECHANISMEN GEGEN ÄNGSTE (Dr.med.univ.Thomas Lausch) Der Begriff Abwehrmechanismus stammt aus der Psychoanalyse, geprägt von Sigmund Freud bzw. seiner Tochter Anna Freud. Man bezeichnet damit Verhaltensweisen, mit denen sich Menschen vor seelischen Konflikten schützen, wenn es nicht möglich ist, einer bedrohlichen Situation durch Flucht oder Angriff zu begegnen. Abwehrmechanismen werden in der Regel unbewusst eingesetzt und haben eine entscheidende Funktion bei der Bewältigung von Belastungen. Sie fungieren als lebenswichtige Schutzfunktionen, um das psychische Gleichgewicht nicht zu gefährden.42 Abwehrmechanismen können jedoch erheblich die Kommunikation beeinträchtigen, so wird der Behandelnde vielmehr mit einer ganzen Skala von Abwehrphänomenen konfrontiert als durch das offene Angsteingeständnis. Abwehrmechanismen sollten von Behandelnden erkannt und respektiert werden, sie sollten nicht gewaltsam aufgebrochen werden, um z.B. Aufklärungspflichten nachzukommen. Es sollte eine vorsichtige Annäherung an bedrohliche Situationen durch den Behandelnden erfolgen.43 Kranke können durch Abwehrmechanismen eine gewisse Kontrolle ihrer Ängste erreichen, jedoch bleibt ein gewisser unkontrollierbarer Teil, die sogenannte „frei flottierende Angst“, übrig. Die Aufgabe des Arztes sollte es sein, die AngstAbwehrmechanismen sowie die frei flottierende Angst zu erkennen und ein entsprechendes Behandlungsschema gemeinsam mit den Patienten zu finden. Dominieren Abwehrmechanismen das tägliche Leben, können Probleme im Sinne von psychischen Störungen oder anders gesagt Neurosen auftreten. 44 Beispiele für Angst-Abwehrmechanismen sind: 42 Vgl. http://www.teachsam.de/psy/psy_per/abwehrmech/abwehr_1htm (30.12.2011) 43 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1065. 44 Vgl. Geisler, Linus: Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch, Frankfurt a.M.1992. 21 4.1 Verdrängung Nach mehrmaligen, sorgfältigen Aufklärungsgesprächen stellen Patienten oder Angehörige Fragen, die deutlich machen, dass das unmittelbar vorher Gesagte und auch Verstandene einfach nicht angekommen ist. Angstauslösende Erlebnisse werden schlagartig ins Unterbewusste verdrängt. Bsp.: Dem Patienten wurde im Rahmen einer Befundbesprechung erklärt, er habe metastatische Absiedlungen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Pat klagt im Anschluss daran über Rückenschmerzen, die er vom „vielen Liegen“ habe.45 4.2 Verleugnung Als Verleugnung bezeichnet man ein vorübergehendes Ausblenden des Ausmaßes der Bedrohung. Verleugnung ist im Gegensatz zur Verdrängung ein bewusster Abwehrmechanismus. Man handelt so als ob es das Realitätsprinzip nicht gäbe. Bsp.: Patient ist über seine Krankheit mit Behandlung und Prognose aufgeklärt, hält aber trotzdem an seinem Lebensstil und an seiner Lebensplanung (Fernreise,…) fest.46 4.3 Vermeidung Bewusstes Vermeiden von angstauslösenden Situationen: „Ich möchte über meine Krankheit nicht reden und vermeide Gedanken daran, so komme ich am besten darüber hinweg.“47 4.4 Verschiebung Phantasien und Impulse werden von einer Person auf andere übertragen, sodass die ursprünglich gemeinte Person unberührt bleibt. Angst versteckt sich hinter Aggressionen gegen Drittpersonen ohne Herstellung ursprünglich vorhandener Zusammenhänge. 45 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1065. 46 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1065. 47 Geisler, Linus: Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch, Frankfurt a.M.1992. 22 Bsp.: Die Angst vor einem Kontrollbesuch im Krankenhaus äußert sich durch Schimpfen und Nörgeln über die schlechte Koordination und den unfreundlichen Patientenumgang im Krankenhaus.48 4.5 Projektion Eigene nicht akzeptierte Eigenschaften, die eigene Angst, wird in andere Personen „hineininterpretiert“ – wird auf andere Personen projiziert. Bsp.: “Meine Frau macht sich über meinen Zustand große Sorgen. Ich bitte Sie, ihr beizustehen, denn ihre Angst belastet mich mehr als alles andere.“49 4.6 Rationalisierung Rational logische Handlungsmotive werden im Nachhinein als alleinige Beweggründe für Handlungen vorgeschoben. Die eigentlichen Gefühle werden dabei ignoriert oder unterbewerten. Bsp.: Die Krankheit macht mir keine Angst, aber diese vielen Medikamente möchte ich nicht einnehmen, denn sie schädigen meine Leber.50 4.7 Regression Unter Regression versteht man den unbewussten Rückzug auf eine frühere Entwicklungs- bzw. Verhaltensstufe, somit tritt die Schutzbedürftigkeit in den Vordergrund. Patienten lassen sich vollkommen umsorgen und geben Alltagstätigkeiten, die sie selbst verrichten könnten, in die Hände ihrer Betreuenden. Patienten geben sogar ihre eigene Autonomie und Selbstbestimmung auf, um leichter leben/überleben zu können.51 48 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus (30.12.2011) 49 Geisler, Linus: Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch, Frankfurt a.M.1992. 50 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus (30.12.2011) 51 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1066. 23 4.8 Das Eisbergmodell Das Eisbergmodell geht auf Sigmund Freud zurück und ist Teil der allgemeinen Theorie der Persönlichkeit. Das menschliche Bewusstsein wird mit einem im Meer treibenden Eisberg verglichen, wobei der Teil, der aus dem Meer herausragt, dem Bewussten entspricht, der weitaus größere Anteil, ca. 80-90%, dem Unterbewussten. Die im Unterbewussten liegenden Ängste, Konflikte, Triebe und Instinkte sind so in Schichten unter Wasser angeordnet, dass sie verschieden weit von der Wasseroberfläche entfernt liegen. Das Unterbewusste, das von Sigmund Freud als „ES“ bezeichnet wird, ist die Instanz der Triebe, Wünsche und Bedürfnisse. Das „ES“ steht im ständigen Kampf mit dem „ÜBER-ICH“, der Instanz für Wert- und Normvorstellungen. Als dritte Instanz beschreibt er das „ICH“, das er als das Bewusstsein als Realitätsprinzip beschreibt, dass ständig die Schiedsrichterrolle im Kampf zwischen „ES“ und „ÜBER-ICH“ einnimmt. Die bereits beschriebenen Abwehrmechanismen werden vom „ICH“ dazu eingesetzt, unbewusste Ängste, Triebe, verdrängte Konflikte sowie Instinkte aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Werden belastende Lebensereignisse und Ängste mit Hilfe der Abwehrmechanismen ins Unterbewusstsein abgedrängt, so sind sie nicht unwirksam gemacht worden und können uns in unserer Dynamik, in unserem Verhalten, beeinflussen. Ein Versagen der Abwehrmechanismen könnte eine Krise des „ICH“ verursachen, da es den Ausgleich zwischen dem „ES“ und dem „ÜBER– ICH“ nicht mehr schafft. Generalisierte Angststörungen, Panikstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen könnten entstehen.52 52 Vgl. http://www.teachsam.de/psy/psy_per/psy_pers_freud/psy_pers_freud_5.htm (30.12.2011) 24 Abb. 4. Das Eisbergmodell nach Ruch/Zimbardo53 Wie häufig Verleugnen als eine der häufigsten Abwehrhaltung vorkommt, wurde z.B. in einer Studie von Weismann und Worden (1976/1977) nachgewiesen. Bei 120 Patienten mit frisch diagnostizierten Krebsleiden, die sorgfältig über Befund und Diagnose aufgeklärt wurden, behauptete wenige Tage später jeder 10. Patient, seine Diagnose nicht zu kennen. Für den Behandelnden ist es wichtig, dass Abwehrmechanismen in den verschiedensten Formen bei Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen fast regelrecht auftreten und dass sie nicht zwanghaft durchbrochen werden sollen, sie stellen nämlich eine unverzichtbare Hilfe zur Bewältigung der Realität dar.54 53 Abb.4. aus Ruch, Philip; Zimbardo, Floyd: Lehrbuch der Psychologie, Berlin/Heidelberg 1974, S. 366. siehe http://www.teachsam.de/psy/psy_per/abwehrmech/abwehr_1htm (30.12.2011) 54 Vgl. Geisler, Linus: Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch, Frankfurt a.M.1992. 25 5. INSTRUMENTE ZUR ERFASSUNG DER ANGST (Dr.med.univ.Thomas Lausch) Als klinische Instrumente zur Erfassung der Angst stehen verschiedene Fragebögen, meist Selbstbeurteilungsbögen, zur Verfügung, wobei die meisten dieser Tests im Bereich der psychiatrisch/psychotherapeutischen Praxis ihre Anwendung finden. Die „Hospital Anxiety and Depression Scale“ wurde hingegen speziell für somatisch erkrankte Patienten entwickelt und stellt mittlerweile den Goldstandart in der Angst– und Depressionserkennung im Bereich der Medizin dar. Als weitere Testverfahren werden das Beck–Angst Inventar (BAI) sowie der GAD 7 als Modul des Gesundheitsfragebogens PHQ –D beschrieben. Als wichtigstes Instrument zur Erfassung von Ängsten gilt jedoch das persönliche Gespräch, die Kommunikation mit Patienten in Form von ärztlichen bzw. pflegerischen Anamnesegesprächen sowie auf wissenschaftlicher Basis in Form von Interviews. Diese Gespräche sind zwar schwer validier- und evaluierbar, sind zugleich das einfachste aber auch schwierigste Instrument zur Erfassung von Angst, aber sollten sie gelingen, sind sie immer „Gespräche gegen die Angst“ und haben somit neben dem diagnostischen auch einen therapeutischen Effekt.55 5.1 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) „Hospital Anxiety and Depression Scale“ (HADS) ist ein kurzer Selbstbeurteilungsbogen zur Erfassung von Angst und Depression in somatisch-medizinischen Einrichtungen. Erstmals wurde die Skala von Zigmond und Snaith 1983 veröffentlicht. Bisher wurde diese Scale in mehr als 3000 veröffentlichten Studien lt. PubMed-Recherche nicht nur in Europa sondern weltweit eingesetzt und hat sich zu einem Standartverfahren für Screening und orientierende Quantifizierung von Störungen aus dem Angst- und Depressionsspektrum entwickelt. 1991 wurde erstmals eine deutsche Version der HADS von Hermann Scholz und Kreuzer entwickelt, die sogenannte HADS–D. Hermann hat in einem Reviewartikel 1997 55 Vgl. Geisler, Linus: Kommunikation in der Palliativmedizin, in H. Hoefert: Kommunikation als Erfolgsfaktor im Krankenhaus, Heidelberg 2008, S. 138. 26 erstmals die Ergebnisse von über 200 Studien zum Einsatz des HADS in verschiedenen klinischen Anwendungsbereichen vorgelegt und hat die Eignung dieser Skala im kardiologischen sowie im allgemein routinemäßigen Einsatz bei Patienten mit internistischen Erkrankungen bestätigt.56 Mittlerweile hat die Skala neben dem primären Einsatzgebiet der somatischen Medizin bei Bevölkerungsstudien sowie bei Angehörigen von Patienten Einsatz gefunden. In vielen vergleichenden Studien wird die HADS als sogenannter Goldstandard eingesetzt und laut zahlreichen Expertengruppen bei onkologischen sowie bei Patienten mit Schmerzsyndromen als Mittel der Wahl zur Angst- und Depressionsdiagnose empfohlen.57 Alle künftigen Angaben beziehen sich auf die deutsche Version, die HADS–D. • Anwendungsbereich: Screening und Verlaufsbeurteilung psychischer Störungen bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren, insbesondere im Bereich der somatischen Medizin. Erfahrungen liegen auch von Patienten–, Angehörigen- und Bevölkerungsstichproben vor. • Erfasste Merkmale: Angst und Depression bei Menschen mit körperlichen Beschwerden bzw. Erkrankungen • Art des Verfahrens: Selbstbeurteilungsverfahren (Fragebogen) • Bearbeitungszeit: 2-6 Minuten • Auswertungszeit: < 1 Minute • Kurzbeschreibung: Die HADS-D ist ein kurzes, rasch zu bearbeitendes, gut akzeptiertes Selbstbeurteilungsverfahren mit je sieben alternierend dargebotenen Angst– und Depressionsitems. Itemauswahl und Itemformulierung berücksichtigen die spezifischen Anforderungen eines durch körperliche Krankheit bestimmten Settings. Erfasst wird die Ausprägung ängstlicher und 56 Hermann-Lingen, Christoph: International Experience with the Hospital Anxiety and Depression Scale: a Review of Validation Data and clinical results Journal of Psychosomatic Research 42, S. 17-41. 57 Vgl. Hermann-Lingen, Christoph; Buss, Ulrich, u.a: HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale Deutsche Version, Göttingen 2011, S. 7ff. 27 depressiver Symptomatik der vergangenen Woche. 58 Die 14 Items der HADSD enthalten vierstufige, itemspezifische Antwortmöglichkeiten. Es ergeben sich 2 Subskalen – eine Angstskala HADS-D/A und eine Depressionsskala HADS–D/D, durch Addition ein möglicher Wertebereich von 0-21, wobei maximal ein fehlendes Item pro Subskala toleriert werden kann, ohne signifikante Verfälschung des Summenwertes zu erzielen (Schätzung durch Addition des Mittelwertes der sechs vorhandenen Items derselben Subskala). Die erfragten Symptome der Angstskala entsprechen zum Teil Kriterien einer generalisierten Angststörung. Zudem werden Nervosität sowie allgemeine Befürchtungen und Sorgen und Aspekte motorischer Spannung bzw. Entspannungsdefizite thematisiert. Das Item A7 berücksichtigt die Prävalenz von Paniksymptomen.59 Im Anhang finden sie den vollständigen HADS–D–Fragebogen sowie eine Auswertungshilfe. 5.2 Beck Angst Inventar (BAI) Das Beck-Angst-Inventar (BAI), in der deutschen Bearbeitung von J. Margraf und A. Ehlers, ist seit 1995 in Verwendung. Das BAI ist ein Selbstbeurteilungsverfahren mit 21 deskriptiven Fragen zu Angstsymptomen, die auf einer vierstufigen Skala hinsichtlich der Schwere des Auftretens in den letzten 7 Tagen zu bewerten sind. Das BAI kann zur Diagnostik und Differentialdiagnostik von Angststörungen sowie zur Beurteilung von Therapieindikation, Therapieverlauf und Qualitätssicherung eingesetzt werden. Durch den kombinierten Einsatz des Beck-Angst-Inventars und des Beck Depression Inventars kann zwischen Angststörungen und Depression differenziert werden.60 58 Vgl. Hermann-Lingen, Christoph; Buss, Ulrich, u.a: HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale Deutsche Version, Göttingen 2011, S. 11. 59 Hermann-Lingen, Christoph; Buss, Ulrich, u.a: HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale Deutsche Version, Göttingen 2011, S. 19f. 60 Vgl. dr-elze.de/beck-angst-inventar-bai.html (25.01.2012) 28 5.3 Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD 7) Der GAD-7 wurde konzipiert, um Patienten mit einer möglichen generalisierten Angststörung zu identifizieren sowie die Symptomschwere der generellen Ängstlichkeit zu erfassen. Er wird hauptsächlich im psychologisch/psychiatrischen Bereich eingesetzt. Der GAD-7 hat eine hohe Treffsicherheit, nicht nur für die generalisierte Angststörung sondern auch für andere Angststörungen wie die soziale Phobie, die Posttraumatische Belastungsstörung und die Panikstörung. Die Items des GAD-7 beschreiben die wichtigsten diagnostischen Kriterien für die Generalisierte Angststörung. - Kriterium A (Angst und Sorge in Bezug auf eine Reihe von Ereignissen oder Tätigkeiten), - Kriterium B (Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren) und - Kriterium C (Angst und Sorgen werden von mindestens drei zusätzlichen Symptomen begleitet wie, Ruhelosigkeit, leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, Muskelverspannungen und Schlafprobleme). Im GAD-7 wird erfragt, wie oft innerhalb der letzten zwei Wochen unter den sieben Kernsymptomen der Generalisierten Angststörung gelitten wurde. Antwortmöglichkeiten sind „überhaupt nicht“, „an einigen Tagen“, „an mehr als der Hälfte der Tage“ und „fast jeden Tag“, denen entsprechend die Zahlenwerte 0 bis 3 zugeordnet sind. Entsprechend des Skalensummenwertes kann eine minimale bzw. milde oder mittelgradige von einer schweren Angstsymptomatik unterschieden werden 61. 5.4 Diagnostisches Interview: Unter „Interview“ verstehen wir in der Alltagssprache ein im Journalismus gebräuchliches Verfahren. In der Forschung versteht man unter Interview eine mündliche Befragung, die sich durch ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung auszeichnet. Man kann die Methode des Interviews auf verschiedene Arten charakterisieren. Die gebräuchlichste Unterscheidung ist die nach dem Grad der Standardisierung. Man unterscheidet standardisierte 61 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/GAD-7 (26.01.2012) 29 (strukturierte), halb standardisierte (semistrukturierte) und nicht standardisierte (unstrukturierte, offene) Interviews. 5.4.1 Das standardisierte, strukturierte Interview Dies ist eine mündliche Befragung anhand eines ausgearbeiteten und standardisierten Fragebogens mit fix vorgegebenen Fragen hinsichtlich ihrer Formulierung und ihrer Reihenfolge. Die Struktur des Gesprächs ist asymmetrisch und die Rollen der Gesprächsteilnehmer sind festgesetzt. So nimmt der Interviewer eine aktive und der Interviewpartner eher eine passive Rolle im Gespräch ein. Ein standardisiertes Interview ist ein gutes Instrument zur quantitativen Datenerhebung mit dem Vorteil, dass eine späterer Vergleich gut möglich ist. 62 In der Psychologie/Psychiatrie stehen verschiedene standardisierte Interviews zur Diagnose von psychischen Krankheiten zur Verfügung. Es sind sämtliche Schritte der Fragestellung und auch Auswertung genau festgelegt. Eine klinische Erfahrung des Untersuchers ist für die Durchführung solcher Interviews nicht zwingend erforderlich und die Objektivierbarkeit ist gewährleistet. Beispiele solch standardisierter Interviews stellen der SKID oder das DIPS dar.63 Diese Interwieformen werden im Anhang kurz dargestellt. 5.4.2 Das halb standardisierte oder semistrukturierte Interview Das halb standardisierte oder semistrukturierte Interview beschreibt eine mündliche Befragung anhand eines Interviewleitfadens, der eine Hilfestellung für den Interviewer darstellt. Die Reihenfolge und Formulierung der Fragen sind frei und somit an die Interviewsituation anpassbar. Auch Zwischen- und Verständnisfragen sind möglich. Das semistrukturierte Interview wird in vielen qualitativen Forschungsarbeiten eingesetzt. Der Interviewleitfaden soll daran erinnern, über welche Themen man sprechen möchte und sollte ein paar Formulierungen für Fragen bieten. Der 62Mayer, Hanna: Pflegeforschung kennenlernen, Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung, Wien 2007, S. 114f. 63 Keller, Andrea: Die Klassifikation psychischer Störungen nach DSM-IV mit Hilfe eines strukturierten diagnostischen Interviews (F-DIPS) –Inaugural-Dissertation im Fach Psychologie zur Erlangung der Doktorwürde, Dresden 2000, S. 48f. 30 Leitfaden sollte nicht starr befolgt werden sondern eine flexible Anpassung an den Gesprächsverlauf möglich machen.64 5.4.3 Ein offenes, unstrukturiertes/nicht standardisiertes Interview Dies wird prinzipiell ohne Fragebogen oder Interviewleitfaden durchgeführt. In der Regel wird über ein vom Interviewer vorgegebenes Thema frei gesprochen. Es gilt als Idealform des qualitativen Interviews. 5.4.4 Das qualitative Interview Das qualitative Interview beschreibt eine Interviewform, in der der Betroffene selbst zur Sprache kommen kann und seine subjektive Deutung von Ereignissen und Erlebnissen vermitteln kann. Prinzipiell kann man zwei verschiedene Formen des qualitativen Interviews abgrenzen, das auf Erzählung abzielende oder narrative Interview vom Leitfadeninterview. · Das narrative Interview ist gekennzeichnet durch ein offenes Vorgehen, wobei der Aspekt des Erzählens im Vordergrund steht. Ein Interviewleitfaden im klassischen Sinn kommt nicht zur Anwendung. Es ist die offenste Form eines Interviews und ist aus der Biografieforschung entstanden, maßgeblich durch den deutschen Soziologen Fritz Schulze. · Das Leitfadeninterview ist ebenfalls ein nicht standardisiertes Interview oder nur halb standardisiertes Interview, dessen Gesprächsgrundlage eine Liste mit offenen Fragen darstellt, die zuvor vorbereitet wurden. Der Leitfaden wird flexibel, abhängig der jeweiligen Gesprächssituation, eingesetzt.65 64 Mayer, Hanna: Pflegeforschung kennenlernen, Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung, Wien 2007, S. 114f. 65 Mayer, Hanna: Pflegeforschung kennenlernen, Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung, Wien 2007, S. 115ff. 31 6. ARBEITSPROZESS/ METHODIK/FALLPRÄSENTATIONEN (Projektteam) 6.1 Arbeitsprozess Der Beginn unserer Arbeit mit der Themenfindung gestaltete sich als sehr einfach. Jeder in unserer Projektgruppe war schnell von der Themenauswahl „Angst im Bereich der Palliativ Care“ überzeugt, und konnte bereits aus seiner eigenen Erfahrung mit Ängsten von Patienten sowie Ängsten von Angehörigen in der Palliativbetreuung berichten. Primär galt es zu klären, wollen wir die Ängste der Patienten, der Angehörigen oder unsere eigenen Ängste als Pflegende und Therapeuten im Umgang mit Palliativpatienten zum Thema unserer Arbeit machen. Wir entschieden uns einstimmig über die Ängste, der von uns betreuten Patienten zu berichten, und die Patienten selbst im Rahmen unserer Anamnesegespräche über ihre Ängste zu befragen. Welches Umfeld, welche Form, welche stilistischen Vorgaben wir für unsere Befragungen wählen sollten, war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Im Rahmen unserer Literaturrecherche stießen wir auf eine Dissertation von Silvia Lehenbauer–Dehm aus dem Jahr 2008: „ Angst und Depression bei Tumorpatienten. Ergebnisse einer vergleichenden Studie über die Entwicklung eines Kurzinterviews zur schnellen Diagnose einer Depression bei Tumorerkrankungen“66, in der Tumorpatienten mithilfe eines von der Autorin kreierten Kurzinterviews bezüglich Depression befragt wurden. Die interviewten Patienten erhielten weiters einen HADS-Fragebogen zum Ausfüllen, somit konnte die Autorin die Ergebnisse ihrer Kurzinterviews mit dem mehrfach validierten HADS –Fragebogen vergleichen. In Anlehnung an ihre Arbeit wollten wir ein standardisiertes Interview bzgl. Angst bei Palliativpatienten erschaffen, diesbezüglich erhielt jedes Teammitglied die Aufgabe 5 Fragen betreffend Angstsymptomatik und Angsterkennung zu formulieren. Wir wollten mithilfe der gesammelten Fragen jeweils 5 Patienten pro Teammitglied mit 66 Vgl. www.diss.fu-berlin.de/.../Dissertation_SilviaLehenbauerDehm.pdf.(18-04.2012) 32 einem strukturierten Interview befragen und die Ergebnisse mit der Hospital Anxiety and Depression Scale vergleichen. Als weiteren Schritt galt es eine grobe Gliederung für unsere spätere schriftliche Arbeit zu finden, sowie eine Arbeitsaufteilung bezüglich der weiteren Literaturrecherche zu treffen. Gernot Plank beschäftigte sich mit verschiedenen Definitionen der Angst, Angstentstehung sowie den Symptomen der Angst. Anna Maria Palko bearbeitete die Themen Ängste im palliativen Setting sowie die Häufigkeit der Angst. Thomas Lausch schrieb die Einleitung sowie über Abwehrmechanismen und Instrumente zur Erfassung der Angst. Stefanie Schatz-Krienzer sammelte Informationen zu pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Therapie der Angst, sowie über Grundregeln zum Umgang mit Angstpatienten. Last but not least beschäftigte sich Irmgard Kothgasser mit pflegerischen Maßnahmen zur Angstlinderung. Wir mussten erkennen, dass unser primäres Ziel jeweils 5 Patienten pro Teammitglied mit 2 verschiedenen Fragesystemen zu interviewen / zu befragen, um dann die Ergebnisse zu vergleichen, den Zeitrahmen unserer Arbeit sprengen würde. Außerdem erkannten wir, dass ein strukturiertes Interview, mit vorgegeben Fragen nicht die richtige Möglichkeit einer Interviewführung bei solch einem sensiblen Thema darstellt. Wir beschlossen somit, die Patienten mittels eines semistrukturierten Interviews zu befragen. Es schien als beste Möglichkeit mit den Patienten über solch ein sensibles Thema, wie Ängste in der Palliativsituation, zu sprechen. Wichtig war uns auch der richtige Zeitpunkt, die richtige Stimmung für ein derartiges Gespräch zu finden. Trotzdem war ein Interviewleitfaden als Hilfestellung sehr wichtig, da wir ja eine bestimmte Thematik bearbeiten wollten. Aus den bereits formulierten Fragestellungen kreierten wir einen Interviewleitfaden, der angemessen der jeweiligen Interviewsituation angewendet werden sollte. Die Interviews fanden in unterschiedlichen beruflichen und örtlichen Settings statt, wodurch es möglich war verschiedene Patientengruppen zu erreichen und diese, sowohl im Rahmen einer pflegerischen als auch ärztlichen Anamnese zu befragen. Wir bereiteten mögliche Fragestellungen im Vorfeld auf, damit man bei dieser schwerwiegenden Thematik den Gesprächspartner sozusagen sensibel „durch das Gespräch lenken konnte“. Trotzdem war es uns allen auch wichtig, unserem 33 Gegenüber genügend Zeit zur nonverbalen Kommunikation, zum gemeinsamen Schweigen und Traurig zu geben, weshalb wir keine Zeitvorgabe anberaumten. Da zwei Teammitglieder aktuell nicht in ihrer Stammarbeitsstätte beschäftigt sind und somit in ihrem beruflichen Umfeld kaum die Möglichkeit haben, derartige Interviews zu führen, wurden die zu bearbeitenden Fälle von drei auf zwei reduziert. 6.2 Methodik: Durchführung von insgesamt 10 semistrukturierten Interviews (2 pro Teammitglied) anhand eines Interviewleitfadens/ folgende Punkte sollten im Interview behandelt werden: · Körperliche Symptome: Schmerzen, Atemnot, Übelkeit,… · Vegetative Symptome: Schlafstörungen, Schwitzen, innere Unruhe, Beklemmungsgefühle, Reizbarkeit, Nervosität · Belastende Gedanken, ständiges Grübeln, Albträume · Ängste Weitere Vorgaben: Dokumentation der Interviews in Form von Interviewprotokollen (→ siehe Anhang), Beschreibung und Bearbeitung der Fälle in Form von Fallberichten mit Bezugnahme auf die Biografie des Patienten, Beschreibung der allgemeinen, aktuellen Krankheitssituation des Patienten, Beschreibung des äußeren Umfeldes, Beschreibung des Gesprächsverlaufs, Versuch einer Interpretation des Interviews sowie Beschreibung der eigenen Gefühle sowie Ängste während des Gesprächs. Jeder der hier vorgestellten Patienten gab vorab sein Einverständnis, anonym in unserer Arbeit beschrieben zu werden. Zu Beginn der folgenden Fallberichte möchten wir uns einzeln sowie unsere berufliche Organisation kurz vorstellen, um das Umfeld unserer Fallberichte besser verstehen zu können. 34 6.3 Fallberichte (Stefanie Schatz-Krienzer) Mein Name ist Stefanie Schatz-Krienzer und ich befinde mich im sechsten Ausbildungsjahr zur Fachärztin für Innere Medizin. Seit 2006 arbeite ich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz Eggenberg, wobei mein Schwerpunkt in der Gastroenterologie angesiedelt ist. 2009 wurde in unserem Krankenhaus ein Palliativkonsiliarteam gegründet, bei welchem ich mich von Beginn an einbrachte. Seit Februar 2012 arbeite ich für ein Jahr im LKH West auf der Internen Abteilung, um meine Kenntnisse in der Gastroenterologie zu vertiefen (Zusatzfach). Unter anderem werden in der Internen Abteilung auch die Patienten der pulmonologischen Tagesklinik mitbetreut, weshalb ich hier vermehrt Kontakt zu onkologischen Patienten habe und versuche mein bis jetzt erworbenes palliativmedizinisches Wissen in meine Arbeit einfließen zu lassen. In diesem Rahmen fanden auch die von mir geführten Interviews statt. 6.3.1 Fall 1 vom 07.03.2012: Ich lerne Frau K. im Rahmen eines stat. Aufenthaltes in der Internen Abteilung des LKH West kennen, wo sie am 06.03.2012 aufgrund einer 3-Etagen-Beinvenenthrombose stationär aufgenommen wird. Frau K. bekam im Dezember letzten Jahres die Diagnose Lungenkrebs gestellt. Im Jänner 2012 bekam sie den ersten palliativen Chemotherapiezyklus. Aus der Krankenakte geht hervor, dass auch bereits Metastasen in der Lunge, in den Knochen und in der Niere bekannt sind. Kurz vor meinem Interview lerne ich die ältere Tochter der Patientin kennen. Sie teilt mir mit, dass ihr gesagt wurde, ihre Mutter hätte nur noch ein Jahr zu leben, aber das wisse die Mutter nicht und ich solle bitte ja nichts sagen. Über die Erkrankung wisse sie Bescheid, über die Absiedelungen jedoch nicht. Frau K. ist 68 Jahre alt, verwitwet, ihr Mann ist bereits 1994 an Magenkrebs verstorben. Sie hat 2 Töchter (42 und 35 Jahre), sowie 5 Enkelkinder. Bis Februar 2012 hat die Patientin noch selbstständig im eigenen Haus in Thal gewohnt, seither wohnt sie bei ihrer jüngeren Tochter und den drei Enkelkindern in Attendorf, da sie 35 vermehrt Hilfe im Alltag benötigt. Durch die zunehmende Atemnot wird ihre Mobilität von Tag zu Tag eingeschränkter. Frau K. wird jetzt auch durch das mobile Palliativteam Graz betreut, welches bereits eine Heimsauerstofftherapie für sie organisiert hat. Das Interview fand im Krankenzimmer, einem Vierbettzimmer statt, da die Patientin noch absolute Bettruhe hatte. Ich holte mir einen Stuhl und stellte ihn ganz nahe ans Bett von Frau K., um so wenigstens eine kleine Privatsphäre für unser Gespräch zu schaffen. Zunächst wollte mir Frau K. den Eindruck vermitteln, dass alles in Ordnung sei, und es ihr alles in allem ganz gut gehe. Auf nonverbaler Ebene war für mich aber bereits zu Beginn des Gesprächs die Verzweiflung und Angst der Patientin zu spüren, auch wenn sie versuchte ihr Gegenüber durch die teilweise saloppe Ausdrucksweise vom Gegenteil zu überzeugen. Erst auf Nachfragen, wie es denn mit dem Schlafen gehe, ist die von der Patientin der Außenwelt gegenüber aufgebaute Fassade zum Einsturz gekommen und sie konnte erstmals über ihre Ängste sprechen. Auch ein weiterer Abwehrmechanismus wurde von Frau K. angewandt, nämlich Zeichen der Vermeidung. Als ich sie fragte, ob die Atemnot auch mit einem Angstgefühl verbunden sei, bekam ich zur Antwort: „ich kenne das schon, bei uns hatten alle Krebs“, womit Frau K. versuchte das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Durch das kurze Gespräch mit der Tochter und das anschließende Interview mit der Patientin, gewann ich den Eindruck, dass in dieser Familie aus Angst wenig über die momentane Situation gesprochen wird. Im Gespräch habe ich versucht, die Patientin zu motivieren, offener mit Ihren Töchtern über Ihr Ängste und Sorgen zu sprechen und somit die Basis für tiefergehende Gespräche zu schaffen, weil dies dann auch für die Töchter die Situation erleichtern könnte. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Frau K. durch ihr Familie und das mobile Palliativteam sehr gut versorgt ist und somit meinerseits keine weiteren Vorkehrungen die Infrastruktur betreffend getroffen werden mussten. Ich empfand das Gespräch als sehr belastend, da ich merkte, wie schnell ich an meine persönlichen Grenzen kam und das Gefühl hatte, nicht das Richtige sagen zu können, da mir alles in dieser Situation unzureichend erschien. Mit dieser Problematik werde ich durch meine Tätigkeit in einem Akutkrankenhaus öfters 36 konfrontiert, da ich meinen Patienten nur beschränkt Angebote für eine gemeinsame Zukunftsbewältigung machen kann, und mir somit oft die richtigen Worte fehlen. Weiters lag in diesem Fall, wie so oft, die Situation vor, dass die Angehörigen mehr über die Erkrankung wissen als der oder die Betroffene selbst. Dies löst in mir immer eine innere Zerissenheit aus, da ich wie schon oben erwähnt meist nur ein kurzer Wegbegleiter der Patienten bin und sich in der kurzen Zeit oft nicht die Möglichkeit ergibt, mit dem Patienten alles offen anzusprechen. 6.3.2 Fall 2 vom 15.03.2012: Bei Frau H. (70 Jahre) wurde im Dezember 2011 ein Adenokarzinom der Lunge diagnostiziert. Sie litt damals unter massiver Atemnot, weil es zu einem tumorbedingten Verschluss des linken Oberlappenbronchus kam. Bei der Bronchoskopie wurde der Verschluss mittels Stent geöffnet und es kam auch zur Erstdiagnose des Tumors. Frau H. hatte jedoch bereits eine längere Leidensgeschichte hinter sich. 1999 wurde ein Brustkrebs diagnostiziert, Frau H. wurde operiert und anschließend bestrahlt. Bei den nachfolgenden, regelmäßigen Kontrollen wurde 2002 ein Tumor der linken Niere diagnostiziert und operativ entfernt. (NCC) Frau H. lebt gemeinsam mit ihrem Mann in einem Einfamilienhaus in Graz. Sie hat 4 erwachsene Kinder und 5 Enkelkinder, zu denen sie einen guten Kontakt pflegt. Bis jetzt benötigt bzw. möchte die Patientin zu Hause keine Hilfe. Zum Zeitpunkt des Interviews befindet sie sich gerade stat. in der pulmonologischen Abteilung im LKH Graz West aufgrund einer Lungenentzündung, weshalb der dritte Zyklus der palliativen Chemotherapie verschoben werden musste. Ich lernte Frau H. im November 2011 im Rahmen eines stationären Aufenthaltes im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz Eggenberg kennen. Ich betreute sie wegen der zunehmenden Dyspnoe auf meiner Station, und stellte sie anschließend aufgrund des ausgeprägten CT-Thorax Befundes an der Pulmonologie LKH Graz West vor. Ich erinnere mich noch an ein längeres Gespräch kurz vor der Transferierung der Patientin. Vor mir saß eine mental starke Frau, die zwar aufgrund der Atemnot körperlich sehr geschwächt war, mir aber lächelnd mit Tränen in den Augen versicherte, dass es diesmal sicher etwas Gutartiges sei, dass könne doch gar nicht sein, dass sie schon wieder Krebs habe…. 37 Seit Februar 2012 bin ich für ein Jahr im Zusatzfach im LKH West und unsere Wege kreuzen sich in der pulmonologischen Abteilung. Die positive Grundeinstellung von Frau H. ist nach wie vor zu spüren. Bei dem neuerlichen Kontakt überwog aber eine Ausstrahlung der inneren Ruhe, trotz der traurigen Gewissheit, dass sie dieses Mal den Kampf gegen den Krebs endgültig verloren hat. Am schwersten scheint Frau H. die Aufgabe ihrer Stellung in der Familie zu fallen, weil sie bisher immer die Starke war, an die sich alle anlehnen konnten. Sie versucht nach wie vor alles Schlimme von ihren Lieben fernzuhalten und gibt vor, noch immer an eine Heilung zu glauben. Trotz der starken Nebenwirkungen lässt sie die Chemotherapie über sich ergehen, obwohl sie innerlich schon ihr Schicksal angenommen hat. Sie meint, dass Angst nicht das richtige Wort für ihren Gefühlszustand sei und möchte dafür beschreibend eher das Wort Sorge verwenden. Da sie aber auch unter Schlafstörungen aufgrund ihres ständigen Grübelns leidet, glaube ich, dass Angst durchaus das richtige Wort ist, ihre jetzige Situation zu beschreiben. Für mich war das Gespräch sehr berührend, da die Stärke der Patientin trotz der körperlichen Schwäche so intensiv zu spüren war. Frau H. benutzt als Abwehrmechanismus die Projektion, weil sie ihren Mann und ihre Kinder als die eigentlichen Leidtragenden sieht. Es war schwierig für mich, der Patientin Hilfe in irgendeiner Form anzubieten, da sie mir immer wieder versicherte, nichts zu brauchen und mich nicht sehr nahe an sich heranließ. 38 6.4 Fallberichte (Anna Maria Palko) Ich bin seit vielen Jahren im Pflegeberuf tätig und sammelte Pflege- und Betreuungserfahrungen mit Schwerstbehinderten sowie im Langzeitbereich und in der mobilen Hauskrankenpflege. Seit eineinhalb Jahren bin ich als Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester im Mobilen Palliativteam Deutschlandsberg beschäftigt. Unser Einzugsgebiet umfasst die Bezirke Deutschlandsberg, Voitsberg und Leibnitz. Eingebunden in ein Team aus Ärzten, Kollegen aus der Pflege, einer Sozialarbeiterin und Hospizmitarbeitern sind wir für eine optimale, umfassendganzheitliche Versorgung von Schwerkranken und Palliativpatienten im häuslichen Bereich verantwortlich. Diese Aufgabe führt mich manchmal an die Grenze meiner psychischen und körperlichen Belastbarkeit. Trotz alledem bin ich an dieser Aufgabe gewachsen und viele Dinge im Leben bekommen dadurch eine andere Wertschätzung und anderes wiederum verliert an Bedeutung. Selten zuvor habe ich mehr über „das Leben“ aber auch über “Lebensfreude“ erfahren als in meiner jetzigen Arbeit. 6.4.1 Fall 3 vom 30.01.2012: Frau M. ist 43 Jahre alt, seit 20 Jahren verheiratet, Mutter von 2 Kindern, 7 und 15 Jahre alt. Sie ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. In diesem Beruf, der ihr immer sehr viel Freude machte, arbeitete sie seit 20 Jahren, davon seit 15 Jahren in der mobilen Hauskrankenpflege. Frau M. wohnt mit ihrem Gatten, den gemeinsamen Kindern und der Schwiegermutter im gemeinsam erbauten dHaus. Sie pflegt mit ihrer Mutter und den fünf Geschwistern, die alle in der Nähe wohnen, engen Kontakt. Vor zwei Jahren wurde Frau M. erstmals mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Es war ein Zufallsbefund im Rahmen einer Gesundenuntersuchung. Nach insgesamt sechs Chemotherapiezyklen und mehreren Strahlentherapien, in denen Frau M. immer an einen guten Ausgang ihrer Erkrankung glaubte, traten Knochenmetastasen und Metastasen in der Leber auf. Eine palliative Chemotherapie wurde eingeleitet. Ein großes Problem beim Erstkontakt war ihre Übelkeit und rezidivierende Obstipation. Vorausgegangene Schmerzen waren zu diesem Zeitpunkt durch eine 39 optimierte Schmerztherapie gut im Griff. Am Anfang des Gesprächs waren die Ängste der Patientin nicht erkennbar, erst durch genaueres Hinterfragen der Schlafprobleme konnte die Patientin über ihre Ängste sprechen. Das Thema „Sterben“ mit dieser jungen Patientin zu besprechen, war für mich sehr schwer auszuhalten. Es ist unvorstellbar, welche Gedanken durch den Kopf der Betroffenen gehen, und ich spürte, dass es eigentlich kaum möglich ist, diese Gedanken und Gefühle in Sprache zu fassen. Als ihre 7-jährige Tochter während des Gesprächs ins Zimmer kam und Frau M. liebevoll auf ihre Wünsche einging, kämpften wir beide mit den Tränen. Dabei erinnerte ich mich an einen Spruch unbekannter Herkunft, der lautet „Wo alle Worte zu wenig sind, ist jedes Wort zu viel.“ Und so war dieses Gespräch von längeren Pausen geprägt. Ich hatte das Gefühl in diesen Pausen wurde mehr gesagt, als man mit Worten sagen kann. Unser Gespräch gab Frau M. die Möglichkeit, über ihre Sorgen mit anderen zu sprechen und Klarheit für ihre momentane Situation und für die kommende Zeit zu finden und dies auch zu reflektieren. Durch diese Hilfestellung im Gespräch konnte ich Frau M. mit einem guten Gefühl verlassen. Beim nächsten Hausbesuch berichtete Frau M. vom Gespräch mit ihrer Familie und wie schwer es war, darüber zu reden. “Wir alle haben sehr viel geweint.” Und doch war es für alle Beteiligten eine Befreiung, die Ängste, Sorgen und Unsicherheiten offen aussprechen zu können. Frau. M. berichtete vom Gefühl des „Getragenseins“ und wirkte viel ruhiger. 6.4.2 Fall 4 vom 15.2.2012: Frau W., 57 Jahre alt, seit 35 Jahren verheiratet, 3 Söhne, 27, 30, und 32 Jahre alt. Frau W. ist gelernte Verkäuferin und arbeitet seit 20 Jahren in einem Strickwarengeschäft. Zusammen mit ihrem Mann wohnt sie im gemeinsam erbauten Haus. Die Söhne sind bereits ausgezogen und leben mit ihren Partnern in Lebensgemeinschaften. Frau W. lebt in engem Kontakt mit ihren Kindern und Schwiegerkindern, ihren Geschwistern und nahen Verwandten. Frau W. ist stets bemüht alle Sorgen von ihrer Familie fernzuhalten. Bei Problemen und Schwierigkeiten innerhalb der Familie, versuchte sie immer allein eine Lösung zu finden, um ihre Familie und vor allem ihre Kinder nicht zu belasten. 40 Frau W. wurde vor 4 Jahren mit der Diagnose Leiomyosarkom des Uterus mit Lungenmetastasen konfrontiert. Ein Jahr verheimlichte sie die Diagnose vor Ihrer Familie. Erst als die Krankheit weit fortgeschritten war und Symptome wie Schmerzen und Atemnot einen ersten Krankenhausaufenthalt forderten, sprach sie mit ihrem Mann darüber, noch später wussten ihre Kinder Bescheid. Als bei laufender Chemotherapie Metastasen in der Lunge und in der Brust auftraten, kam die Patientin in unsere Betreuung. Ihr Hauptproblem war die Atemnot und der Druck in der Brust. Frau W. ist selbständig gehfähig und bekommt derzeit eine palliative Chemotherapie und wird mit einer PCA versorgt. Frau W. begegnete mir in diesem Gespräch mit großer Offenheit und Ehrlichkeit. Ich spürte, dass ihr die Zukunft große Sorgen bereitet und ängstigt. Mit ihren Mann kann sie offen über die Krankheit und deren möglichen Folgen sprechen. Diese Gespräche sind aber für beide ein große Belastung und Frau W. versucht, möglichst wenig daran zu denken und wenig darüber zu reden. Ihre Kinder aber will sie in diese Zukunftssorgen nicht einbinden. Bei meinen vorangegangenen Hausbesuchen kam ich wieder mit den Kindern ins Gespräch und ich spürte, wie belastend diese Ungewissheit für die Kinder ist. Im Innersten spürt auch Frau W., dass sie ihren Kindern die Konsequenzen ihrer Krankheit nicht ersparen kann und dass das Aufrechterhalten einer Zukunftshoffnung, die nicht realistisch ist, viel Kraft kostet. Ein offenes und ehrliches Gespräch über die Zukunft ihrer Mutter wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte Frau W. bei den nächsten Hausbesuchen in dieser Hinsicht unterstützen und bestärken, weil ich merke, dass ein Gespräch mit ihren Kindern für die ganze Familie eine Entlastung wäre. 41 6.5 Fallberichte (Thomas Lausch) Ich heiße Thomas Lausch, habe seit 1 ½ Jahren eine Facharztausbildungsstelle für Anästhesiologie und Intensivmedizin im LKH–Deutschlandsberg. Unsere Abteilung gewährleistet die ärztliche Betreuung des Mobilen Palliativteams Deutschlandsberg. Seit März 2011 gehöre ich nunmehr als einer von 4 Ärzten diesem Team an. Das Team arbeitet als Palliativkonsilliardienst für das LKH-Deutschlandsberg sowie als Mobile Palliativteam im häuslichen Bereich und in Heimen. Das Einsatzgebiet umfasst die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg. Ziel des Teams ist es eine adäquate Betreuung von Schwerkranken bzw. Palliativpatienten im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Neben der Symptomkontrolle (Schmerztherapie, Behandlung von gastrointestinalen sowie respiratorischen Beschwerden etc.) legt das Team besonderes Augenmerk auf Aufklärung und Beratung von Patienten sowie Angehörigen, Organisation von Pflegehilfsmitteln sowie Pflegebetreuungen, um ein würdiges Leben sowie Sterben zuhause zu ermöglichen. Die Arbeit in diesem Team stellt für mich eine große Herausforderung aber auch eine große Bereicherung in meinem Arbeitsleben dar. Aktuell bin ich seit Jänner 2012 der Anästhesie des LKH Graz zugeordnet und absolviere für ein Jahr meine Ausbildung im Bereich der speziellen Anästhesie, somit musste ich meine Tätigkeit im Mobilen Palliativteam vorübergehend pausieren. Im Mai 2012 absolvierte ich ein Praktikum auf der Palliativstation im Krankenhaus der Elisabethinen Graz. 6.5.1 Fall 5 vom 22.12. 2011: Frau L. ist 20 Jahre alt, ledig und lebt zusammen mit ihren beiden Geschwistern, 9 und 18 Jahre, bei ihrer Mutter und deren Lebensgefährtin in einer Wohnung. Mit harmlosen Unterbauchschmerzen vor ca. 9 Monaten begann ihre Leidensgeschichte, die zu wiederholten Krankenhausaufenthalten mit zwei großen Bauchoperationen führte, bis endgültig die Diagnose Granulosazelltumor des Ovars feststand. Nach weiteren Untersuchungen musste festgestellt werden, dass sich der Tumor bereits in ihrem gesamten Bauchraum ausgebreitet hat und dass er mehrere Tochtergeschwülste gebildet hat. Eine Chemotherapie sowie eine Strahlentherapie wurden 42 eingeleitet. Erstmals wurden die Patientin sowie ihre Angehörigen mit der palliativen Zielsetzung der Therapie konfrontiert. Auch im privaten Umfeld kam es für die Patientin zu Veränderungen. Die bereits längerfristige Beziehung zu ihrem Freund zerbrach aufgrund der äußeren Umstände und die Patientin zog aus der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Freund zu ihrer Mutter. „Er konnte meine schwere Erkrankung nicht ertragen, so war es besser, dass wir uns trennten“, war ihr kurzer Erklärungsversuch, warum ihre Beziehung in Brüche ging. Bei ihrer Mutter fühle sie sich sehr wohl, sie seien gemeinsam ein gutes Team. Zum Zeitpunkt meines Interviews war die Patientin seit 3 Wochen in unserer Betreuung. Die Anbindung an unser Team erfolgte durch ihre Hausärztin, die Unterstützung in der Betreuung der Patientin bei uns suchte. Als Symptome wurden von der Hausärztin zunehmende Unterbauchschmerzen, Obstipationsneigung unter bereits laufender Opioidtherapie sowie ausgeprägte Schwäche mit beginnender Immobilität beschrieben. Nach mehrmaligen Aufklärungsgesprächen durch die Hausärztin konnte die primär ablehnende Haltung unserer Organisation gegenüber überwunden werden, und wir konnten die Patientin in ihrem häuslichen Umfeld besuchen. Die Ursache der anfänglichen Ablehnung begründete sich im Namen unserer Organisation, Palliativ wurde mit Sterben assoziiert, und ans Sterben wollte in dieser Situation keiner ihrer Angehörigen denken. Unsererseits wurde eine Therapieanpassung mit Umstellung der Opiattherapie auf ein transdermales System, Einleitung einer Akutmedikation, forcierter Obstipationsprophylaxe sowie Einleitung einer Glucocorticoidtherapie durchgeführt. Bei zunehmender Immobilität konnte mit Hilfe unserer Sozialarbeiterin ein Rollstuhl binnen weniger Tage organisiert werden. Dies war mein dritter Besuch bei der Patientin. Die Frage, ob ich ihren Fall im Rahmen eines Palliativkurses wiedergeben darf, wurde von der Patientin bejaht. Die ersten beiden Besuche waren dominiert von körperlicher Symptomkontrolle, mit Adaptierung der Schmerztherapie, forcierte Stuhlsorge mittels Klysmen sowie langen Aufklärungsgesprächen. Mich berührte ihre Leidensgeschichte sehr, dies ist auch der Grund, warum ich ihren Fall präsentieren möchte. 43 Wir führten das Interview im Beisein ihrer Mutter. Ich fand diesen Umstand anfangs als angenehm, merkte jedoch gleich, dass die Anwesenheit der Mutter das Interview sehr beeinflusste. Ich hatte das Gefühl, dass Frau L. ihre Antworten so wählte, um ihre Mutter zu schonen. Aus einer normalen Anamnese, die auf körperliche Symptomkontrolle ausgerichtet war, entwickelte sich rasch ein sehr emotionales Gespräch, was vor allem die Mutter zu Tränen rührte. Mit der Frage nach Schlafstörungen konnte ich das Gespräch von der rein körperlichen Ebene auf die psychisch, emotionale Ebene lenken, was die Patientin dazu bewegte, mir von Albträumen, in der sie in ihrer Hilflosigkeit alleine gelassen worden war, zu berichten. Die ständige Sorge, nicht mehr gesund werden zu können sowie die beschriebene vegetative Symptomatik gaben doch deutliche Hinweise, dass die Patientin von starken Ängsten geplagt wurde. Die Patientin erkannte mittlerweile das Ausmaß ihrer Erkrankung und wusste zu diesem Zeitpunkt, dass eine Heilung nahezu unmöglich war. Die Situation war stabil, weil die Patientin durch ihre Mutter einen starken Rückhalt erhielt. Frau L. ließ sich völlig von ihrer Mutter umsorgen und zog sich auf eine frühere Entwicklungs- und Verhaltensstufe zurück, dieser Abwehrmechanismus wird als Regression bezeichnet. Die Mutter, die verständlicherweise mit der Erkrankung ihrer Tochter völlig überfordert war, konnte zumindest nach außen hin Stärke vermitteln und dadurch ihrer Tochter sehr viel Kraft geben. Die Frage, ob sie Angst hat, wurde von der Patientin verneint, sie befürchtete vermutlich, dadurch ihrer Mutter noch mehr Sorgen zu bereiten. In folgenden Gesprächen mit meinen Kollegen erklärte die Patientin, sie habe Angst, ihre Mutter alleine zurücklassen zu müssen. Für mich war dieses Interview belastend, da ich ihre Ängste sehr gut nachvollziehen konnte und dies in mir eine Hilflosigkeit auslöste. Durch meine eigene Angst, weitere emotionale Ausbrüche auszulösen, vermied ich, ihre Sorgen noch genauer zu hinterfragen. 6.5.2 Fall 6 vom 10.05.2012: Frau M. ist 67 Jahre alt, geschieden, hat 4 Töchter und lebt in einer kleinen Wohnung in Graz. Ich lernte Frau M. im Rahmen meines Praktikums auf der Palliativstation im Krankenhaus der Elisabethinen kennen. Frau M. leidet an einem Mammacarcinom welches 2007 erstdiagnostiziert wurde. Eine operative Entfernung der rechten Brust sowie die Entfernung der regionalen 44 Lymphknoten und der Achsellymphknoten wurden durchgeführt. In weiterer Folge musste sich Frau M. mehreren Strahlentherapien sowie Chemotherapien unterziehen. Ende 2008 wurde ihr versichert, dass sie den Krebs besiegt habe. Es kam leider anders. Es wurde im Juni 2011 bei einer Kontrolluntersuchung ein Rezidiv entdeckt und neuerliche Chemotherapien wurden eingeleitet. Die letzte Chemotherapie Anfang April 2012 wurde abgesetzt, da Frau M. Fieber hatte und ihr Allgemeinzustand zusehends schlechter wurde. Frau M. wurde von der chirurgischen Abteilung der Elisabethinen auf die Palliativstation zur Therapie ihrer wiederkehrenden Übelkeit sowie zur Therapie der rezidivierenden Kopfschmerzattacken transferiert. Frau M. ist eine äußerst nette, zurückhaltende Person, ist immer freundlich, bedankt sich mehrmals, wenn man sie nach ihrem Befinden fragt und sie wird kaum irgendwelche Beschwerden zugeben. Eine Krankenschwester bezeichnete sie einmal vor der Visite als „auffällig unauffällig“. Bezüglich ihrer Übelkeit sowie der rezidivierenden Kopfschmerzen wurde eine Bedarfsmedikation angeordnet. Man erklärte Frau M., dass man ihre Symptome gut mit Medikamenten lindern könne, sie müsse nur danach verlangen. Sie meldete sich jedoch nie und erklärte bei jeder Visite, es ginge ihr den Umständen entsprechend gut. Frau M. lag in einem Einzelzimmer und ich ging eigentlich zu ihr, um mit ihr über einen geplanten Umzug in ein Doppelzimmer zu sprechen. Es entstand jedoch aufgrund der Tatsache, dass Frau M. ihr Mittagessen wegen der vorherrschenden Übelkeit nicht zu sich nehmen konnte, ein aufschlussreiches Gespräch. Frau M. gab zu, dass sich ihre Übelkeit nicht wie bei der Visite geschildert, verbessert hatte. Sie erklärte, dass diese eigentlich immer bestehe, sie wolle jedoch niemandem zur Last fallen. Ihre größte Angst bestand darin, von jemandem abhängig zu sein. Ihr ist es wichtig, ihr Leben selbständig und unabhängig zu gestalten. Ihr Gatte verließ sie mit 4 kleinen Kindern, so musste sie selbst stark sein und musste alleine für alle sorgen. „Ich hab mein ganzes Leben gearbeitet, es war nicht immer leicht, aber ich habe es geschafft. Nun sind meine Töchter erwachsen, sie haben alle eine eigene Familie“, sagte sie während eines anderen Gespräches stolz. Aufgrund ihrer bestehenden Erkrankung wurde ihr klar, dass ihre Kräfte mehr 45 und mehr schwinden und dass sie nun hilfsbedürftig wurde. Sie befürchtet, dass sie ihre Autonomie sowie ihre Selbstbestimmung verlieren könnte. Frau M. erkannte ihre Situation sehr gut. Sie erkannte, dass ihre Krankheit nicht mehr heilbar ist, und bemerkte im Interview, dass ihr keiner mehr helfen könne. Dieser Umstand zeigte mir wieder meine eigene Hilflosigkeit, ich konnte ihre Gedanken gut nachvollziehen und musste erkennen, dass ich ihre beiden Wünsche, die Heilung ihrer Krankheit sowie die Wahrung ihrer Unabhängigkeit, nicht erfüllen konnte. In mir entwickelte sich ebenfalls eine Angst, einmal meine Autonomie aufgeben zu müssen. Im Interview schilderte Frau M. sehr genau und ausführlich ihre Ängste. Da sie ihre bestehende Übelkeit nicht verbergen konnte, ist die von der Patientin der Außenwelt gegenüber aufgebaute Fassade zum Einsturz gekommen und sie konnte dann ungezwungen über ihre Symptome, Gedanken und Sorgen sprechen. Als Konsequenz dieses Interviews wurde die Bedarfsmedikation durch eine regelmäßige Medikamentengabe ersetzt. Wir kontaktierten die Sozialarbeiterin, um mit der Patientin gemeinsam die Möglichkeiten der Betreuung zuhause zu besprechen. 46 6.6 Fallberichte (Irmgard Kothgasser) Ich bin über 11 ½ Jahre im Bezirkspensionistenheim Gleisdorf als DGKS tätig. In dieser Zeit absolvierte ich Fortbildungen in der Validation, der Basalen Stimulation und der Kinästhetik. Unser Haus bietet derzeit 140 Bewohner und Bewohnerinnen einen Pflegeplatz. Neben der Langzeitbetreuung gibt es auch die Möglichkeit eine Tagesbetreuung oder einen Kurzzeitpflegeplatz in Anspruch zu nehmen. Ab Pflegestufe vier werden Senioren und Seniorinnen in unserm Haus betreut. Unsere Bewohner weisen meistens ein multimorbides Krankheitsbild auf. Die häufigsten Diagnosen in unserem Haus sind dementielle Erkrankungen, Parkinson, Schlaganfälle, COPD und Diabetes. 6.6.1 Fall 7 vom 20.03.2012/ 27.03.2012: Herr X. ist 86 Jahre alt, Baupolier im Ruhestand, verwitwet und hat eine Lebenspartnerin. Seine einzige Tochter ist vor mehreren Jahren an einer Krankheit verstorben. Er hat noch 2 Enkelkinder und Urenkelkinder. Herr X. ist seit über 3 Jahren in unserem Pflegeheim. Herr X. hat bis zu seinem Heimeinzug in seinem selbst erbauten Haus gewohnt, das er dann schweren Herzens verkaufen musste. Seine Frau ist ein paar Jahre zuvor in unserem Haus gestorben und er hat sich bis zu ihrem Tod rührend um sie gekümmert. Kurz vor seinem Heimeinzug hat er ein neues Auto gekauft, mit dem er regelmäßig am Wochenende mit seiner Lebenspartnerin Ausflüge unternahm und das er nach seinem Sturz vor 2 Monaten aufgrund der daraus resultierenden körperlichen Einschränkungen verkaufen musste. Seit diesem Vorfall besteht außerdem ein höherer Pflegebedarf und er wurde auf die Pflegestufe 5 eingestuft. Herr X. ist seitdem auf einen Krankenfahrstuhl angewiesen. Als Herr X. erfahren hat, dass er einen Rollstuhl benötigt, hat er lange gebraucht, diesen zu akzeptieren. Die Besuche seiner Verwandten und der Lebenspartnerin sind in letzter Zeit weniger geworden. Der Bewohner ist ein sehr geselliger Mensch, der gerne singt, aber Schwierigkeiten hat, sich an andere Mitmenschen anzupassen. Er war laut eigener 47 Aussage „immer ein Angeber“ und trotz der Verluste der letzten Jahre schien es, als ob er seine Lebensfreude nicht verloren hätte. Er ist immer sehr fröhlich, aber diese Fröhlichkeit wirkt oft gespielt und übertrieben. Herr X. hat ein Einzelzimmer, sodass wir das Gespräch, ohne gestört zu werden, durchführen konnten. In diesem Gespräch, das ich vorher Herrn X. angekündigt hatte, erzählte er mir wieder einmal von seinem Leben. Ich kenne die Geschichte bereits, da er sie bei jeder Gelegenheit erzählt. Mir fiel auf, wie sehr er die Zeit vermisst, als er noch im Berufsleben war und sich „gebraucht“ fühlte. Es scheint, als ob er immer wieder darauf hinweisen will, dass er viel geleistet hat in seinem Leben und er dieses Gefühl des „Gebrauchtseins“ benötigt. Ich hatte das Gefühl, dass es doch sehr schwer für mich war, dieses Gespräch zu lenken, da Herr X. immer wieder vom eigentlichen Thema abwich und am liebsten von früher erzählen wollte. Ich hatte immer wieder Mühe, dieses Gespräch auf die jetzige Situationen zu fokussieren. Daher habe ich das Gespräch nach 45 Minuten beendet, da ich das Gefühl hatte, dass er mir nicht gerne über seine Ängste erzählen oder sie mir offenbaren wollte. Umso überraschter war ich, als ich ein paar Tage später sein Zimmer betrat und er von sich aus über seine Ängste zu sprechen begann. Beim zweiten Gespräch hatte ich ein ganz anderes Gefühl. Ich spürte, dass Herr X. sich dieses Mal mir gegenüber öffnen konnte und sehr ehrlich antwortete. Mich beeindruckte, dass er anscheinend lange über unser erstes Gespräch nachgedacht hatte und sich Gedanken über seine Ängste machte und sich diesen stellte. Ich fühlte mich aber andererseits, da ich doch unvorbereitet war, vor der Offenbarung seiner Ängste hilflos. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Ich denke aber, das Wichtigste ist, dass er sich seinen Ängsten bewusst wurde und mit mir bereits darüber reden kann. Ich unterstütze Herrn X mit dem, was ich schon immer gemacht habe. Ich versuche ihm die Teilnahme an jeder Veranstaltung im Haus zu ermöglichen und führe immer wieder kurze Gespräche, da er sehr wenig Ansprache von den Mitbewohnern und Angehörigen bekommt und in mir eine gute Zuhörerin gefunden hat. Außerdem habe ich veranlasst, dass er wöchentliche Therapietermine bei unseren Therapeutinnen bekommt. In diesen Einheiten wird er massiert und seine Schultern mobilisiert. Diese 48 Maßnahme lindert seine Schulterschmerzen und die Mobilisation fördert die Beweglichkeit der oberen Extremitäten. 6.6.2 Fall 8 vom 28.01.2012: Frau A. ist 85 Jahre und seit 4 Monaten in unserem Haus in einem Zweibettzimmer untergebracht. Ihre Zimmerkollegin ist bettlägerig und durch einen Schlaganfall gelähmt. Frau A. weist ein multimorbides Krankheitsbild (Mischdemenz, Osteoporose, Fingergelenkspolyathrose, art. Hypertonie,…) auf. Sie ist vor 2 Wochen gestürzt, hat sich dabei den Daumen gebrochen und benötigt jetzt vermehrte pflegerische Hilfe und Unterstützung. Frau A. ist verwitwet, hat 5 Kinder und Enkel sowie Urenkelkinder. Sie ist ein Familienmensch und hat ihre Schwiegermutter bis zu ihrem Tod zu Hause gepflegt. Immer wieder hat sie auf ihre Enkelkinder aufgepasst und alles für ihre Kinder getan. Vor ihrem Heimeinzug hat Frau A. alleine zu Hause gelebt. Ich war überrascht, wie Frau A. unter den neuen Umständen litt. Sie wirkte auf mich immer sehr aufgeschlossen, war sehr offen für andere und machte den Eindruck, als würde es ihr im Heim sehr gut gefallen. Durch das Weinen während der Morgenpflege, wurde ich darauf aufmerksam, dass Frau A. unter dem Heimeinzug doch sehr gelitten hatte. Da Frau A. immer zu Hause betreut und alt werden wollte, war sie sehr enttäuscht und verletzt, dass sie in ein Pflegeheim ziehen musste, obwohl sie 5 Kinder groß gezogen hatte. Als ich sie fragte, was sie noch belaste, erzählte sie von ihrer Mitbewohnerin, die bettlägerig ist und vollständig auf fremde Hilfe angewiesen ist. Das gibt wieder den Hinweis darauf, dass sie sich vor dem Verlust ihrer Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit fürchtet. Sie hat Angst, zu stürzen und als Folge davon körperliche Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. Um die Gefahr eines neuerlichen Sturzes zu vermeiden, beschloss ich in Absprache mit dem Team, dass wir das Licht im WC in der Nacht brennen lassen, da Frau A. durch ihre Demenz nicht mit der Rufglocke zurechtkommt. Frau A. fühlte sich von da an in der Nacht wieder sicherer. Durch Fingerübungen, die wir regelmäßig durchführten, konnte sie ihren Daumen von Tag zu Tag mehr belasten. Das freute Frau A. natürlich sehr. Da sich Frau A. im Doppelzimmer unwohl fühlte, konnten wir 49 Frau A. nach 1 ½ Monaten ein Einzelzimmer vermitteln, das für ihr eigenes Wohlbefinden sehr wichtig war. Als ich sie vor kurzem fragte, wie es ihr jetzt gehe, lachte sie mich an und sagte: ,,Durch das Einzelzimmer fühle ich mich schon viel wohler, mein Zuhause wird es zwar nicht ersetzen, aber damit muss ich leben.“ 50 6.7 Fallberichte (Gernot Plank) Mein Name ist Gernot Plank, bin am 02.11.1970 geboren, wohnhaft in Mariahof, verheiratet, habe 2 Kinder (Anja, 15 Jahre und Miriam, 5 Jahre). Berufspraxis: 10 Jahre als Pflegehelfer, ab 2008 Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKH Stolzalpe - Abschluss Februar 2010. Seit April 2010 beschäftigt im Mobilen Palliativteam Knittelfeld-Judenburg-Murau. Zusatzausbildungen: Basisseminar Basale Stimulation; Aufbauseminar Basale Stimulation; Grundkurs und Aufbaukurs Kinaesthetics; Wahrnehmungsbehandlung nach erworbener Hirnschädigung. Im Mobilen Palliativteam Knittelfeld-Judenburg-Murau werden Patienten, deren Lebenserwartung durch eine nicht heilbare, weit fortgeschrittene Erkrankung begrenzt ist, in ihrer vertrauten Umgebung begleitet. Unser Leitgedanke ist die Annahme und Begleitung von Patienten in der letzten Lebensphase. Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen von betroffenen Menschen. Unser Team besteht aus speziell ausgebildeten Ärzten, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, einer Sozialarbeiterin, einer Sekretärin, den Mitarbeitern des Hospizvereines Steiermark und dem Palliativkonsiliardienst. 6.7.1 Fall 9 vom 29.03. 2012: Dauer des Gespräches ca. 60 Minuten. Diagnose: Hypernephrom; Z.n Nephrektomie; Z.n Lungenrezidiv (2 OPs- die letzte April 2011); Solitäre Knochenmetastasen und eine neuerliche Lungenmetastase; größenprogrediente Metastase im Bereich des Sternums. Herr M. ist 78 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Gattin in einer Eigentumswohnung. Aus dieser Ehe entstanden 4 Töchter (53J, 52J, 40J, eine Tochter ist als Kind an Rotlauf verstorben). Die drei Töchter leben aber nicht mehr bei ihren Eltern. Geboren wurde Herr M. in Graz, dort besuchte er auch die Volksschule und die Hauptschule. Sein erlernter Beruf ist Gärtner. Später (1952) rückte er zur neu 51 gegründeten B-Gendarmerie ein. Herr M. schildert, dass dies am Anfang nicht leicht war, da viele Personen an den Krieg erinnert wurden und die Bevölkerung der BGendarmerie anfangs nicht immer wohl gesinnt gegenübertraten. 1955 erfolgte eine Übernahme ins Bundesheer. Bis 1977 arbeitete er beim Bundesheer im Verwaltungsdienst, machte die Matura nach sowie die Verwaltungsdienstprüfung und brachte es bis zum Rang eines Offizieres (Oberst der Miliz). In dieser Zeit erfolgte die Eheschließung mit seiner Gattin. 1977 wechselte Herr M. in den Gemeindedienst, absolvierte die Gemeindeverwaltungsprüfung in Semriach, sowie die Amtsleiterprüfung. Diese Tätigkeit übte er bis zu seiner Pensionierung 1994 aus. Beim Pensionsantritt hatte er den Titel eines Oberamtsrates erreicht. Seine Hobbys sind Fischen, Lesen und die Gartenarbeit. Hr. M. erzählt, dass er sehr viel freie Zeit in seinem Schrebergarten in Graz verbringt. Zum Zeitpunkt des Interviews ist Herr M. seit ca. 1 ½ Monaten in unserer Betreuung. Ich war bis jetzt bei 4 Hausbesuchen bei der Familie. Herr M ist noch mobil, versorgt sich und seine Gattin selbst, wobei er auch seine Gattin unterstützt, da bei ihr eine hochgradige Sehstörung besteht. Herr M hat in 8 Monaten ca. 18kg abgenommen, immer wieder Übelkeit mit Erbrechen, immer wieder Schmerzen im Bereich der Schulter bei bekannter Arthrose. Außerdem beschreibt er immer wieder Phasen mit ausgeprägter Müdigkeit. Bei meiner Ankunft nimmt mich Herr M. an der Tür in Empfang, begleitet mich zum kleinen Küchentisch und bietet mir den stirnseitigen Sitzplatz an. Gegenüber nimmt seine Gattin Platz. Herr M. setzt sich rechts neben mich und fragt, ob ich etwas trinken möchte. Gerne nehme ich dieses Angebot an. Meiner Bitte, mit ihm ein Interview führen zu dürfen, willigt er gerne ein. Die Gattin war gerade beim Kochen – es liegt ein für mich angenehmer Geruch in der Luft. Herr M. sitzt während des ganzen Interviews mit erhobene, geraden Oberkmörper neben mir (meiner Empfindung nach nahezu militärisch überkorrekt). Die Hände ruhen während des gesamten Interviews auf den beiden Knien und weichen nicht von diesen. Ich bat Herrn M., bevor ich das Interview begann, mir etwas über seine Biographie zu erzählen. Besonderen Wert legte Herr M. darauf, seine Biographie mit genauen Jahreszahlen, allen Ausbildungen und Urkunden zu belegen. 52 Durch die ausführliche biographische Erzählung von Herrn M. hat sich gleich zu Beginn ein emotionales Gespräch entwickelt. Ich befand mich plötzlich in einer Gesprächsrolle, in der es nicht notwendig war, vertiefend oder nachfragend zu agieren. Herr M. begann aus seinem Leben zu erzählen und ich erlebte völlig neue Perspektiven und entdeckte, dass wir beide gleiche Hobbys haben, wie z.B. die Aquaristik oder Griechische Landschildkröten. Obwohl es Herrn M. am Tag des Interviews sichtlich nicht sehr gut ging, bedingt durch den Verdacht auf Magen-Darmblutung und der ständigen Übelkeit, war er bemüht, unser Interview möglichst korrekt durchzuführen. Aufgrund seiner Biographie habe ich nun besser verstanden, welche Copingstrategien er bis jetzt angewandt hat. So hat er erwähnt, dass er sich trotz Übelkeit zwingt, immer wieder kleine Portionen zu essen, um nicht noch weiter an Körpergewicht zu verlieren. Er schläft derzeit gut, hat eine Schlafmedikation zu Hause, möchte diese jedoch nicht nehmen. Seine Schmerzen sind zum Zeitpunkt unseres Gespräches gut eingestellt. Herr M. betont während des Interviews immer wieder, wie froh er ist, dass die Chemotherapeutika nun abgesetzt wurden. Manchmal stellt er sich die Frage, wie lange wird es noch dauern. Es reicht, da immer wieder etwas Neues dazukommt. Angst hat Herr M. weniger vor dem Tod, aber z.B. wieder medikamentenbedingte Halluzinationen zu haben oder zukünftig die Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist zu verlieren. Für mich war das Interview belastend, da seine Schilderungen über die Folgen einer Behandlung mit Chemotherapeutika auf seinen Körper in mir Hilflosigkeit auslöste. Ich hatte versucht, die Ängste anzusprechen, hatte jedoch den Eindruck, dass Herr M. nur ungern über seine Ängste spricht. Er wechselte nach kurzer Zeit das Thema und erzählte über seine Erfahrungen am Friedhof in Graz. Man könnte diese Äußerung auch als Symbolsprache oder als eine Form eines Abwehrmechanismus deuten. Ich sehe es als meine Intervention, dass Ich Herrn M. einen Raum geben konnte, in dem er sich selbst, seinem Leben und seinen Erinnerungen begegnen kann. Ich dachte an die Aussagen des russischen Mediziners, Psychologen und Philosophen Vladimir Iljine. Er wies um die Jahrhundertwende erstmals auf die große Bedeutung 53 von Erinnerungsarbeit in Zusammenhang mit der Kommunikation von Schwerkranken und sterbenden Menschen hin. 6.7.2 Fall 10 vom 29.03. 2012: Dauer des Gespräches ca.60 Minuten. Diagnose: Magenkarzinom, Z.n. OP; Lebermetastasen; V.a. Peritonalkarzinose. Frau G. ist in Mölbling/Kärnten aufgewachsen. Sie schildert selbst, dass sie bettelarm war. Sie hat 9 Geschwister. Ihr Vater hat immer gearbeitet (war Straßenarbeiter und Holzarbeiter) und sie erinnert sich, dass immer zu wenig zum Essen da war. In Ihrer Verzweiflung stahlen sie von den Bauern (Äpfel und Gemüse). Trotz mehrmaligen Bitten der Mutter war keiner der Bauern bereit, der 11-köpfigen Familie mit Lebensmitteln zu helfen. Später verlor ihr Vater die Arbeit und er und seine Gattin haben bei einer Bauernfamilie in der Landwirtschaft gearbeitet. Sie erinnert sich, dass sie als Kinder immer nur eine gewässerte Milch bekommen haben, die richtige Milch wurde verkauft. Sie erzählt, wenn man bei einem Bauern schuftet und man sieht, es ist ein reicher Überfluss an Lebensmitteln da, man selbst bekommt aber nichts, das ist bitter. Jedes ältere Kind hat von den Eltern weggehen müssen. Sie selbst lebt in Zeltweg und hat 2 Kinder (2 Buben) alleinerziehend großgezogen. Sie erzählt, dass sie nie gejammert hat und um die Kinder immer gekämpft hat. Sie arbeitete 12 Jahre als Dienstmagd bei Bauern und 24 Jahre in der Firma Napiag in Zeltweg. Heute kocht Fr. G. sehr gerne und löst gerne Rätsel in den Zeitungen. Frau G. ist seit 2 Monaten in unserer Betreuung. Sie lebt in Ihrer kleinen Wohnung alleine und versorgt sich selbst und möchte Ihren Söhnen nicht zur Last fallen. Für sie ist es wichtig, dass sie möglichst lange selbständig bleiben kann. Über ihre Erkrankung ist sie aufgeklärt, hat in 1 ½ Jahren 20 kg an Körpergewicht verloren und während der Chemotherapie starke Durchfälle gehabt. Mit Ihren Kindern versteht sie sich sehr gut. Sie hat derzeit keine Schwellungen und die Schmerzen (hauptsächlich Druckgefühl über der Leber) sind gut medikamentös eingestellt. Beim Interview öffnete Frau G. mir die Türe und bat mich in ihre Küche. Die Küche ist sehr klein und hat gerade Platz für einen Tisch und 4 Sessel. Die Interviewsituation 54 und den Raum empfand ich als sehr angenehm. Auf meine Frage, ob ich ein Interview führen dürfte, antwortete Frau G. mit: „Ja, sehr gerne.“ Bevor ich das Interview begann, bat ich Frau G. mir einiges aus ihrer Biographie zu erzählen. Frau G. sitzt bequem vis a vis von mir. Die Hände liegen mit der offenen Handfläche nach oben auf dem Tisch, sie lächelt mich an. Im Laufe des Interviews schildert Frau G., dass Appetit und Essen für sie sehr wichtig seien, denn aufgrund Ihrer Biographie war in ihrer Kindheit nie genug zu Essen da. Essen ist für Frau G. Leben. Die Übelkeit ist zurzeit meines Interviews kein Thema, sie hat einmal in 14 Tagen erbrochen. Mit Medikamenten geht sie sehr sparsam um, sie nimmt nur das Notwendigste. Die Patientin schläft sehr gut, ca. 7-8 Stunden täglich. Beunruhigende Gedanken kennt Frau G. nicht, ebenso wenig stören sie körperliche Beschwerden wie Atemnot oder Schwitzen. Sehr wichtig für sie ist aber die Erhaltung Ihrer Eigenständigkeit. Sie betont immer wieder, dass sie ihren Söhnen nicht zur Last fallen möchte, und sollte es zu Hause nicht mehr gehen, wird sie ins Pflegeheim gehen. Ängste konnte sie gut ansprechen, wobei sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung gelernt hat, dass man vor nichts Angst haben muss. Als Frau G. aus Ihrem Leben zu erzählte, war ich berührt, welche Tiefe und Intensität ihre biographische Erzählung angenommen hatte. Man spürte, dass Frau G. sehr viele belastende Situationen in ihrem Leben erfahren hatte. Diese drängen zusehends in Ihre Gegenwart. Umso wichtiger war meine Aufgabe, hinzuhören und ihre Lebensgeschichte ernst zu nehmen. Ihre Lebensbilanz war subjektiv geprägt von vielen negativen Erinnerungen. Aber Frau G. hat sich trotz vieler Rückschläge nie unterkriegen lassen, den Lebensmut und ihren Humor nicht verloren und hat immer gekämpft. Eine Situation blieb mir sehr stark in Erinnerung: Ich stand schon und wollte mich gerade für das Interview bedanken und mich verabschieden. Da sagte Frau G. zu mir: „Hungern tut weh.“ Es erfolgte eine lange Schweigephase und sie hielt meine Hand. Dann erzählte sie mir, dass sie als Kind mit Ihrem Vater mitging zum Wildern, da sie wieder einmal nichts zu essen hatten. Ihr Vater wurde ein paar Tage später verhaftet und musste ins Gefängnis. Da sie wegen der Kälte sehr viel an Kleidung anhatten, glaubten alle, ihr Bruder war beim Wildern mit. Es folgte wieder eine lange Gesprächspause. „Der Vater hat das nur gemacht, damit wir nicht verhungern“. Wir 55 sahen uns in die Augen. Frau G. wollte aber verbergen, dass sie weinte. Ich empfinde für Frau G. tiefsten Respekt und Ehrfurcht aufgrund ihrer Biographie. Für mich war auch die Gesprächssituation eine andere. Es ist leider in unserem Palliativen Arbeitsbereich selten in einem Gespräch Platz für Fröhlichkeit und Lachen. Bei Frau G. ist es mir leicht gefallen, Ängste zu verbalisieren. Sie spricht offen über Ängste. Man hat den Eindruck, dass jegliche Ängste keine große Rolle in Ihrem Leben spielen. Unabgeschlossene Situationen drängen im Angesicht des nahen Endes in die Gegenwart. Es gibt bewegende Momente geprägt von Trauer und Glück, und es entstand für mich als Begleiter ein Bild, als fährt jemand eine reiche Ernte vergangener zurückliegender Jahre ein. Es war im Falle von Frau G. eine reiche Lebensernte. Ich glaube, dass es mir Dank der Offenheit von Frau G. gut gelungen ist, gemeinsam mit ihr zu erleben (gleichsam wie in einem Film): WER BIN ICH? Wer werde ich sein? 56 7. Grundlagen beim Umgang mit der Angst (Dr.in med.univ. Stefanie Schatz-Krienzer) Das persönliche Erleben, die individuellen Vorerfahrungen, die Persönlichkeitsstrukturen, das soziale Beziehungsgefüge und das Umgehen und die Bewältigung der Angst sind individuell verschieden. Es kann keine für alle gültigen Patentrezepte geben.67 7.1 Angst darf nicht bagatellisiert oder „ausgeredet“ werden Das Erleben von Angst bei anderen macht hilflos und betroffen und löst den Impuls aus, zu trösten und zu lindern. Leicht fallen gut gemeinte Sätze wie: „Es wird schon wieder, du brauchst doch keine Angst zu haben.“ Auf einen Patienten jedoch kann dies so wirken, dass man seine Angst nicht ernst nimmt und nichts davon hören mag. Dies kann ihn zutiefst verletzen und zu seinem Rückzug führen. Es ist wichtig, genau zuzuhören, herauszuhören, worauf sich die Angst bezieht, und die Bereitschaft zum Gespräch zu signalisieren. 7.2 Angst muss angenommen werden Da die meisten Ängste schwer kranker Patienten berechtigt und begründet sind, muss Raum dafür gegeben werden, sich mit der Angst auseinanderzusetzen. Für viele Kranke ist dies ein langer und mitunter schmerzlicher Prozess. Doch erst dieser Prozess macht Sätze wie die folgenden möglich: „Es hat mich bereichert, dass ich die Angst vor der Krankheit zuließ und sie sich dann umwandelte in Gelassenheit.“ Ziel muss sein, mit der Angst leben zu lernen, sich nicht von ihr überwältigen zu lassen. Erst wenn die Angst akzeptiert ist, kann man beginnen herauszufinden, wer oder was gegen die Angst hilft. 67 Vgl. Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a.: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1071. 57 „Die schlimmsten Sorgen sind die unausgesprochenen. Es ist schon viel gewonnen, wenn man seine Angst in Worte fasst.“ (Lewis Richmond)68 7.3 Über Angst kann (muss) gesprochen werden Sprechen über Angst reduziert die Angst. Nicht ausgesprochene, nicht ausgelebte Angst brodelt im Untergrund, führt zu nächtlichem Grübeln und zu sozialem Rückzug, zu Isolation und kann Beschwerden verstärken. Häufig wird das Thema Angst gemieden, weil die Sorge besteht, dass sie noch schlimmer wird, zu einem unkontrollierbaren Strudel. Das Gegenteil ist der Fall, eine große emotionale Erleichterung tritt ein, wenn es möglich wird, für tiefste innere Befürchtungen Worte zu finden. Gelingt es, schwere Gedanken auszusprechen und darüber zu sprechen, verlieren diese an Bedrohlichkeit. Patienten fühlen sich nicht mehr in ihrer Angst gefangen, sondern erleben in (ehrlichen) Gesprächen menschliche Nähe und Verbundenheit. Durch die Bestätigung, dass es natürlich und sinnvoll ist,, Angst zu empfinden, wird die eigene Empfindung bekräftigt. Über das Sprechen wird es möglich, sich zu distanzieren, neue Perspektiven zu entdecken und neue Einsichten zu gewinnen. Hier ist noch anzumerken, dass es auch Gespräche über Angst geben kann, die abgebrochen werden müssen, weil sie zu langen Gesprächen oder gar rationalen Diskussionen werden, in denen immer wieder nur um Angst „gekreist“ wird, sie jedoch nicht konkret und greifbar wird. Solche Gespräche erbringen keine neuen Einsichten oder Erkenntnisse, weil die emotionale Ebene nicht berührt wird. 7.4 Diffuse Angst soll so konkret wie möglich werden Viele Kranke (und nicht nur sie) leiden unter diffusen Ängsten, die sie oft selbst nicht genau definieren oder konkretisieren können. Diffuses Unbehagen kostet Kraft und belastet mehr als Klarheit. Gezieltes Nachfragen kann helfen, die Angst in Worte zu fassen. Die Angst soll genau betrachtet werden, es kann enorm erleichternd sein, Befürchtungen und schwere Gedanken zu Ende zu denken. So kann überprüft werden, wie (realistisch) die Dinge eingeschätzt werden und ob darauf Einfluss genommen werden kann. Daraus lassen sich Bewältigungsmöglichkeiten entwickeln. Es kann gemeinsam überlegt werden, ob es sinnvoll ist, noch einmal mit dem Arzt 68 Vgl. http://www.psp-tao.de/zitate/thema/Angst/22/10 (18.04.12) 58 alles durchzusprechen, um konkrete Informationen zu bekommen. Durch Konkretisierung wird der Umgang mit der Angst besser handhabbar.69 7.5 Körperliche Begleiterscheinungen der Angst sollten ausagiert werden Angst ist immer mit körperlichen Symptomen verbunden. Um die Muskelverspannungen und die körperliche Unruhe abzubauen, ist körperliche Betätigung wichtig. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass durch Bewegung Adrenalin abgebaut wird. Schwer körperlich Kranken fehlt dafür die Kraft, umso bedeutsamer sind für sie Physiotherapie, Massagen und Atemübungen, sowie die Ermutigung, sich selbst so oft und so gut es geht zu bewegen, im Zimmer oder auf dem Flur umherzuwandern. Das Gefühl der Enge (Angst) soll durch Bewegung umgewandelt werden. Hilfreich sind Übungen zur Muskelentspannung, z.B. die Progressive Muskelrelaxation nach Jakobson. 7.6 Für unvermeidbar ängstigende Situationen sollte ein entspannendes Gleichgewicht geschaffen werden Es gibt viele diagnostische und therapeutische Maßnahmen, die den Kranken Angst und Anspannung bereiten und für die je nach individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten, Erleichterung gefunden werden soll. Methoden und Techniken zur mentalen Entspannung oder geleiteter Imagination mit der Verankerung von beruhigenden Bildern oder Tagtraumreisen bewähren sich. Mit der Kraft der Vorstellung kann es gelingen, sich in einer Angst verursachenden Situation etwas Beruhigendes vorzustellen.70 69 Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a.: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1071f. 70 Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhard Aulbert, u.a.: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011, S. 1072. 59 8. THERAPIE DER ANGSTSTÖRUNGEN (Dr.in med.univ. Stefanie Schatz-Krienzer) Es stehen sowohl nicht pharmakologische als auch pharmakologische Behandlungsmethoden für die Behandlung von Angststörungen zur Verfügung. Bei der Behandlung einer spezifischen Phobie haben sich vor allem nicht pharmakologische Behandlungsmethoden bewährt. Prinzipiell ist es wichtig, dem Patienten den sog. Angstkreis zu erklären (siehe Abb. 5). Dieser besteht aus den Teilen Wahrnehmung, Gedanken, Angst, körperliche Veränderungen, körperliche Symptome und kann an jeder Stelle in Gang gesetzt werden.71 Abb. 5. Der Angstkreis nach Wittchen 72 71 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 172f. 72 Abb 5 aus Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 172. 60 8.1 Nicht-pharmakologische Therapien: 8.1.1 Pädagogische Aufklärung Die pädagogische Aufklärung ist bei der Behandlung von Angststörungen besonders wichtig. Der Arzt sollte dem Patienten bereits frühzeitig die Störung erklären und Wege vorschlagen, wie der Patient die Symptome bewältigen kann. Es ist z.B. für den Patienten hilfreich zu wissen, dass seine Symptome bekannten Mustern entsprechen, dass viele andere Menschen an den gleichen Symptomen leiden und dass es dafür erfolgreiche Behandlungsmethoden gibt. Neben dieser gezielten Information stehen auch spezifische psychotherapeutische Verfahren zur Verfügung. 8.1.2 Verhaltenstherapie Ihr Ziel ist es, Verhaltensmuster im Rahmen einer strukturierten, aufgabenorientierten und normalerweise kurzzeitigen Therapie zu ändern. Die Therapie gestaltet sich je nach Entwicklungsstufe unterschiedlich. Solange nur das Stadium der klassischen Konditionierung vorliegt, wird eine Habituierung, d.h. letztlich auf eine spontane Rückbildung, gesetzt. Therapeutisch ist deshalb das Fortschreiten zur nächsten Stufe der Phobophobie (Vermeideverhalten) zu verhindern. Dies geschieht durch Reattribuierungstechniken, d.h. der Patient lernt Auslösemechanismen kennen und seine zunächst gefürchteten und bedrohlichen vegetativen Erregungszustände als „gesunde“ Reaktion auf zunächst begründete Angst zu verstehen. Ist es zum Stadium des Vermeideverhaltens (Phobophobie) gekommen, dann gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Kernstück ist in jedem Falle eine „Reaktionsexposition“, d.h. der Patient wird therapeutisch dahin geführt, dass er gezielt versucht, die bislang gefürchteten und deshalb vermiedenen vegetativen Erregungszustände (=Reaktionen) herbeizuführen und sich ihnen zu exponieren. Man nennt das auch „paradoxe Intervention“. Er lernt dabei Auslösemechanismen kennen, darunter auch vor allem kognitive Auslöser und schließlich ebenfalls die vegetativen Zustände als Konsequenz und nicht Ursache des Problems zu reattribuieren. Durch weitere therapeutische Interventionen mit Methoden der „kognitiven Therapie“ lernt der Patient dann, die kognitiven Auslöser von Panik und Vermeidungsverhalten zu kontrollieren. Damit wird der Circulus vitiosus unterbrochen, in dem eine Situation wie „Dunkelheit“ zur Erwartung von Angst führt, was wiederum Angst auslöst, mit der 61 Folge von vegetativen Begleitreaktionen, was wiederum die Erwartungsangst steigert und das Vermeideverhalten verstärkt, mit noch mehr Angst beim nächsten Mal. Ein wichtiger Punkt bei diesem Verfahren ist auch der Einsatz eines Entspannungsverfahren, wie z.B. der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson, das eine Dekonditionierung der angstauslösenden Reiz-Reaktions-Koppelung erst ermöglicht. 8.1.3 Kognitive Therapie Sie liegt der Überlegung zugrunde, dass das Leiden des Patienten hauptsächlich auf fehlangepasste, übergeneralisierte und stabile kognitive Muster oder Denkprozesse zurückgeführt werden kann, die zu situationsinadäquaten Bewertungen führen.73 Der Therapeut, der eine kognitive Therapie durchführt, hilft dem Patienten, seine unangepasste Sicht zu korrigieren und eine angemessene Einstellung bezüglich der Situation aufzubauen. 8.1.4 Tiefenpsychologisch (analytisch) orientierte Psychotherapie Sie untersucht die Grundzüge des menschlichen Verhaltens, um den Patienten Einsicht in seine Probleme zu ermöglichen und dadurch sein Verhalten zu verändern. Bei der Panikstörung, die früher von tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapeuten als Herzphobie bezeichnet wurde, wird eine charakteristische, neurotische Konfliktsituation mit einem unbewussten ambivalenten Trennungskonflikt angenommen, der einerseits mit aggressiven Todeswünschen und andererseits mit einer Liebeserwartung konstelliert ist. Im Verständnis dieser Störung wird davon ausgegangen, dass der Patient in der angstvollen Erwartung und Vorwegnahme der Trennung lebt, die er sich gleichzeitig wünscht und fürchtet. Die Auflösung dieses Konfliktes und das Verständnis der damit verbundenen spezifischen Abwehrmechanismen anhand des mit dem Patienten erarbeiteten lebensgeschichtlichen Hintergrundes, auch unter Einbeziehung der „Hier-und-Jetzt-Situation“ ist das Ziel der über einen längeren Zeitraum angelegten tiefenpsychologischen (analytischen) Psychotherapie.74 73 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 173f. 74 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 173f. 62 8.1.5 Entspannungstherapie Als Beispiel kann hier die progressive Muskelentspannung nach Jacobson genannt werden. Bei dieser Methode werden Muskelgruppen verschiedener Körperbereiche nach einem vorgegebenen Schema zuerst angespannt und dann wieder entspannt. Durch tägliche Übungen kann bei einem Großteil der Patienten ein insgesamt niedriges Erregungsniveau erreicht werden, wodurch die Angstschwelle für angstauslösende Stimuli heraufgesetzt wird. Diese Methoden werden heute in Kombination mit anderen psychotherapeutischen Verfahren eingesetzt. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit des autogenen Trainings bzw. Biofeedbacks. Bei der letztgenannten Methode werden den Patienten physiologische Vorgänge durch visuelle oder akustische Signale rückgemeldet und dadurch die Möglichkeit aufgezeigt, auf seine biologischen Reaktionen Einfluss zu nehmen. Idealerweise sollten mehrere Therapiemöglichkeiten kombiniert werden: • Verhaltenstherapie (Angsttagebuch) • Gedankliche Übungen (kognitive Therapie) • Praktische Übungen (progressive Muskelentspannung, Biofeedback, systemische Desensibilisierung) • Kombination mit Medikamenten75 8.2 Pharmakologische Therapie: Die medikamentöse Therapie zielt auf die Normalisierung gestörter Funktionen im Gehirn, die auf eine Verschiebung der Botenstoffe (Neurotransmitter) zurückzuführen ist, ab. Ein wichtiger Botenstoff ist z.B. das Serotonin. Psychopharmaka regulieren die Biochemie außer Kontrolle geratener chemischer Vorgänge im zentralen Nervensystem. Sie führen nicht zu Persönlichkeitsveränderungen und nicht generell zur Abhängigkeit. 76 75 Vgl. Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 172f. 76 Vgl. http://www.angst.hexal.de/angst/behandlung/medikamente.php (02.02.2012) 63 Nur die Gruppe der Benzodiazepine führt bei längerer Anwendung zur Abhängigkeit, was im der palliativen Krankheitssituation, letztendlich keine zentrale Rolle spielt.77 Angstzustände können zu massiven Beeinträchtigungen und zu einer Verschlechterung der Lebensqualität führen. Die möglichen Nebenwirkungen einer medikamentösen Behandlung sind im Vergleich dazu, oft das deutlich kleinere Übel. Manche Verhaltenstherapeuten behaupten, dass man alle Angststörungen verhaltenstherapeutisch behandeln kann und dafür keine Medikamente braucht. Wahr ist, dass besonders bei noch gut kompensierten Angststörungen, eine Aufklärung bereits die Hälfte der Symptome beseitigt, und eine Verhaltenstherapie oft schnell erfolgreich sein kann. Medikamente und Psychotherapie schließen einander nicht aus, Medikamente machen eine Psychotherapie oft erst möglich. 78 Eine Reihe von Substanzen und Substanzklassen können zur Therapie generalisierter Angststörungen (GAD) eingesetzt werden. Zum Teil sind die therapeutischen Erfolge evidenzgesichert, zum Teil finden sich Substanzen in Verwendung, die sich in der klinischen Praxis bewährt haben, für die jedoch noch keine spezifische Indikation vorliegt. Die pharmakologische Therapie von Angsterkrankungen gliedert sich in drei Phasen: Zu Beginn wird eine Akuttherapie verordnet, nach Stabilisierung eine Erhaltungstherapie, und schließlich wird mit einer prophylaktischen Therapie ein Rückfall verhindert. Generell sollte bei selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin Wiederaufnahmehemmern (SNRI) am Anfang eine reduzierte Standarddosis verordnet, d.h. einschleichend dosiert, werden. Ebenso kann Komedikation mit Benzodiazepinen zu Beginn der Akuttherapie sinnvoll sein. In Analogie zur Therapie depressiver Erkrankungen können Dosierungsschritte bzw. Dosierungsumstellungen von Antidepressiva auch bei Angsterkrankungen vorgenommen werden. Zur Beurteilung von Therapieeffekten bei Angststörungen ist 77 Vgl. http://www.angst.hexal.de/angst/behandlung/medikamente.php (02.02.2012) 78 http://www.neuro24.de/psychopharmaka.htm (02.02.2012) 64 eher ein längerer Zeitraum zu veranschlagen als bei depressiven Störungen, bevor Änderungen/Umstellungen vorgenommen werden.79 8.2.1 Benzodiazepine Sie nehmen einen zentralen Stellenwert in der Psychopharmakotherapie von Angsterkrankungen, vor allem in der Akutbehandlung, ein. Die anxiolytische Wirkung dieser Substanzgruppen, insbesondere auf somatische, angstassoziierte Symptome, ist durch mehrere kontrollierte Studien belegt. Trotz guter Wirksamkeit treten häufig Nebenwirkungen wie Sedierung, Benommenheit, verzögerte Reaktionsfähigkeit, Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten etc. auf. Inwieweit diese Nebenwirkungen im palliativen Setting erwünscht sind, wird immer wieder diskutiert, und ethische Fragen werden in weiterer Folge aufgeworfen. Die Erfahrungen mit einem mehrmonatigen Einsatz von Benzodiazepinen zeigen, dass ein maximaler Therapieeffekt nach sechs Wochen beobachtet wird, darüber hinaus aber kaum mehr Zuwachs an positiver Wirksamkeit erreicht wird. 8.2.2 Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) Die Wirksamkeit der meisten SSRI wurde bei Panikstörung, generalisierter Angststörung, Sozialphobie, posttraumatische Belastungsstörung (PTSD), sowie Zwangsstörung in einer Reihe von doppelblind placebokontrollierten Studien belegt. Zu Beginn der Behandlung können jedoch bei manchen Patienten Nebenwirkungen wie Unruhe, Zunahme der Angstsymptome und Schlafstörungen auftreten, die durch eine reduzierte Anfangsdosierung oder durch Zugabe von Benzodiazepinen gemildert bzw. verhindert werden können. Angesichts der guten Wirksamkeit, des günstigen Nebenwirkungsprofils und der Sicherheit sind mehrere SSRI als First-lineTherapeutika für die Behandlung unterschiedlicher Angststörungen anzusehen.80 • Citalopram hat sich als gutes First-line-Therapeutikum bei verschiedenen Indikationen der Angsterkrankungen etabliert. Die empfohlene Anfangsdosis 79 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 7. 80 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 10. 65 beträgt 5 bis 10mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 20 bis 60mg täglich.81 • Escitalopram ist das S-Enantiomer von Citalopram und stellt die pharmakologische Weiterentwicklung von Citalopram dar. Es senkt bei generalisierter Angststörung das Rückfallrisiko. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 5 bis 10mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 10 bis 20mg täglich. • Fluoxetin hat sich in kontrollierten Studien, insbesondere auch bei Zwangsstörungen, als effektiv erwiesen, ist aber nicht für die GAD bzw. Panikstörung zugelassen. • Fluvoxamin entfaltet eine günstige Wirkung bei Zwangs- und Panikstörungen. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 50mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 100 bis 300mg täglich. • Paroxetin hat sich in einer Reihe von Studien als gut wirksame Substanz bei sozialer Phobie, Panikstörung, Zwangsstörung, posttraumatischer Belastungsstörung und generalisierter Angststörung - auch über längeren Zeitraum hin erwiesen. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 10 bis 20mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 20 bis 60mg täglich. • Sertralin weist insbesondere günstige Effekte bei posttraumatischer Belastungsstörung, bei Zwangsstörung, der sozialen Phobie und Panikstörung auf. Die empfohlene Anfangsdosis bei PTSD beträgt 25 bis 50mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 50 bis 200mg täglich. 8.2.3 Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI): SNRI können in den ersten Tagen nach Einnahme zu Übelkeit, Unruhe und Schlafstörungen führen, die nach weiterer Einnahme meist zurücktreten. 81 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 10. 66 • Venlafaxin ER ist bei der Indikation generalisierte Angststörung eine gut wirksame Substanz. Die Wirksamkeit konnte sowohl in Kurz-als auch in Langzeitstudien belegt werden. Die empfohlene Anfangsdosis für die retardierte Form von Venlafaxin beträgt 75mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 75 bis 225mg täglich. • Duloxetin zeigt aufgrund seines dualen Wirkmechanismus günstige Effekte bei der Angstsymptomatik. Die Wirksamkeit konnte sowohl in Kurz-als auch in Langzeitstudien belegt werden. Die empfohlene Standarddosierung beträgt für Patienten mit generalisierter Angststörung 30mg einmal täglich, unabhängig von den Mahlzeiten. Bei Patienten mit unzureichendem Ansprechen sollte die Dosis auf 60mg erhöht werden, was der üblichen Erhaltungsdosis bei den meisten Patienten entspricht. • Milnacipran zeigte in einer offenen Studie eine gute Wirksamkeit bei generalisierter Angststörung. Da Milnacipran keinen First-pass-Effekt in der Leber aufweist, kann es bei Patienten mit Leberschädigung ohne Dosisanpassung verabreicht werden. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 25 bis 50mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 100mg täglich.82 8.2.4 Serotonin-(5-HT2)-Antagonist und Wiederaufnahmehemmer (SARI) • Trazodon zeigte in einer doppelblinden, plazebokontrollierten, randomisierten Studie gute Wirksamkeit und Verträglichkeit bei GAD. Die Wirksamkeit beruht auf einem ausgeprägten 5-HT2-Rezeptor-Antagonismus kombiniert mit einer schwächeren Serotonin-Wiederaufnahmehemmung. Die Blockade der 5 HT2Rezeptoren führt einerseits zu einer Verstärkung der antidepressiven Wirkung von Serortonin über 5-HT1A-Rezeptoren und verhindert anderseits Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen und Agitation, welche durch eine serotonerge Stimulation der 5-HT2-Rezeptoren 82 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 10f. 67 hervorgerufen werden. Zu Beginn der Behandlung empfiehlt sich eine niedrige Initialdosis: mindestens drei Tage 50mg, danach drei Tage 100mg und die darauffolgenden drei Tage 150mg. Die Tagesdosis nach Einstellung beträgt 150-300mg/Tag, stationär bis 600mg. 8.2.5 Noradrenerg, spezifisch serotonerges Antidepressivum (NaSSA) • Mirtazapin entfaltet seine duale Wirkung über einen rezeptorspezifischen Mechanismus und nicht über eine Wiederaufnahmehemmung. Therapeutisch günstig ist auch die Verbesserung der klinischen Schlafparameter. In Österreich ist das Präparat aber nicht erhältlich. 8.2.6 Partieller 5-HT1A-Agonist • Buspiron hat sich bei generalisierter Angststörung in mehreren kontrollierten Studien als wirksam erwiesen. Jedoch wird ein maximaler Therapieerfolg erst nach drei bis vier Wochen erzielt. Im Vergleich zu Benzodiazepinen zeigt Buspiron keine Abhängigkeitsentwicklung und behindert nicht die Gedächtnisleistung. Die empfohlene Anfangsdosierung beträgt 5 bis 10mg täglich, die empfohlene Tagesdosis nach Einstellung 30 bis 60mg täglich.83 8.2.7 Selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI) • Reboxetin ist auch für die Behandlung von Panikstörungen zugelassen. Die antriebssteigernde Wirkung könnte auch für diese Indikation ein wichtiger Zusatzeffekt sein. 8.2.8 Glutamat-Modulator (GM) • Tianeptin beeinflusst sowohl mit einer Depression einhergehende Angstsymptomatik als auch spezifische Angststörungen günstig. Die signifikante Verbesserung von Angst bei Depression wurde in klinischen 83 Vgl.CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 11. 68 Studien mehrfach nachgewiesen- und zwar im gleichen Ausmaß wie bei SSRI und Amitriptylin. 8.2.9 Trizyklische Antidepressiva (TZA) Die Effektivität der TZA wurde bei mehreren Formen der Angststörung gezeigt, insbesondere für Clomipramin. Die anxiolytische Wirksamkeitslatenz beträgt wie bei SSRI zwei bis vier, in manchen Fällen bis zu sechs Wochen. Die empfohlenen Anfangsdosen sind für Clomipramin 25 bis 50mg täglich, die empfohlenen Tagesdosen nach Einstellung liegen bei 75 bis 225mg täglich. Die Langzeitwirkung der TZA ist gut. Allerdings treten unter Therapie mit trizyklischen Antidepressiva in der klinisch notwendigen Dosierung häufig Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Obstipation, orthostatische Hypotension, Tachykardie, Sedierung, psychomotorische Störungen, Gewichtszunahme etc. auf. Wegen dieser zum Teil erheblichen Nebenwirkungen und mangelnder Sicherheit (z.B. Kardiotoxizität, Glaukom, Prostatahypertrophie) sollten TZA als Medikamente der dritten Wahl angesehen werden.84 8.2.10 Antipsychotika Niedrig dosierte typische Neuroleptika (Antipsychotika der 1. Generation) im Sinne der „Neuroleptikaanxiolyse“ kamen bei Angststörungen, insbesondere bei generalisierter Angststörung, ebenfalls zur Anwendung. Sie erwiesen sich als zum Teil effektiv, jedoch ist ihre Anwendung bei längerfristiger Einnahme wegen der Entwicklung einer möglicherweise auftretenden tardiven Dyskinesie, nicht empfehlenswert. Antipsychotika der neuen Generation z.B. Quetiapin zeigen eine gute Wirksamkeit bei GAD. Ein anxiolytischer Effekt wird vermutlich über eine 5-HT2Blockade vermittelt. 8.2.11 Antikonvulsiva • Pregabalin zeigte in mehreren großen placebokontrollierten Studien eine rasche Wirksamkeit und gute Verträglichkeit bei der Indikation GAD. Der 84 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 11. 69 anxiolytische Effekt von Pregabalin zeigte sich in der Verminderung sowohl der psychischen als auch der somatischen Symptome der Angst. Auch Schlafstörungen werden positiv beeinflusst. Pregabalin wird auch für die Behandlung von peripheren und zentralen neuropathischen Schmerzen eingesetzt. 8.2.12 Anthistaminika • Hydroxyzin erwies sich in zwei kontrollierten Studien in der Behandlung der GAD als wirksam. Limitierend kann jedoch die unter dieser Substanz anfänglich auftretende Sedierung sein. 8.2.13 Opipramol Es liegen günstige Resultate aus einer doppelblinden und plazebokontrollierten Studie bei der GAD vor.85 8.2.14 Phytopharmaka Beispiele hierfür wären Johanniskraut oder Baldrianpräparate. Es gibt für diese Präparate aber keinen gesicherten Wirksamkeitsnachweis. 8.2.15 Beta-Blocker Nicht kardioselektive Betablocker (z.B. Propranolol) können in bestimmten Situationen als Komedikation bei GAD gegeben werden. Sie helfen mit Angst einhergehende körperliche Symptome kurzfristig zu kontrollieren. Aufgrund des immer wieder diskutierten möglichen depressiogenen Effektes der Beta-Blocker wird von dieser Medikation abgeraten. 8.2.16 Agomelatin Dies ist das erste Antidepressivum, das antagonistisch auf 5-HT2C-Rezeptoren, die u.a. mit Angst und Depression in Verbindung gebracht werden, und zugleich agonistisch auf MT1- und MT2-Rezeptoren wirkt. Weiters kann Agomelatin die 85 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 12. 70 zirkadiane Rhythmik wiederherstellen. In einer Vergleichsstudie zeigte Agomelatin bei depressiven Patienten nach sechs Wochen eine stärkere Wirkung auf die Angstsymptome als Sertralin.86 Abb.6: Stufenschema der medikamentösen Behandlung von Angsterkrankungen87 8.3.1 Therapieresistenz Sie kann auch pharmakologische Ursachen haben, wie eine schlechte Compliance wegen nicht tolerierter Nebenwirkung, eine Abschwächung der Wirkung durch Interaktionen, die Einnahme einer falschen Dosis bzw. Therapiebeginn mit einer zu hohen Dosis, sowie zu kurze Behandlungsdauer oder falsche Einnahmefrequenz. Aber auch die Psychotherapie führt nicht immer zu einem adäquaten Erfolg. In diesem Fall muss die Wahl der Therapiemethode überdacht werden. Als Hauptursache für das Versagen der Psychotherapie gelten unklare Zielsetzungen, eine schlechte Therapeutenbeziehung bzw. falsche Behandlungstechniken. Im 86 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 12. 87 Abb.6 aus CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- StatementState of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 7. 71 Zusammenhang mit einem zögerlichen Therapieansprechen ist auch an die Symptome aufrechterhaltende psychosoziale Belastung zu denken.88 Ist eine Therapieresistenz evident, gilt es, sowohl psychotherapeutische als auch pharmakologische Strategien zu überdenken. Möglicherweise kann ein Wechsel der Medikation oder die Kombination mit einem anderen Pharmakon den gewünschten Erfolg bringen. Komorbide Störungen sowie andere körperliche Erkrankungen müssen in jedem Fall suffizient therapiert sein. 89 88 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 15. 89 Vgl. CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 12. 72 „Menschen dabei behilflich zu sein, nicht von Ängsten zerstört zu werden, ist das größte Geschenk überhaupt.“ (Thich Nhat Hanh) 90 9. PFLEGERISCHE MAßNAHMEN ZUR ANGSTLINDERUNG (DGKS Irmgard Kothgasser) In diesem Kapitel geht es um Möglichkeiten, die Angst mit pflegerischen Maßnahmen in der Palliativ Care zu lindern. Die hier beschriebenen Maßnahmen wirken auf der nonverbalen Kommunikationsebene und haben sich in der Pflege etabliert. Im Folgenden wird näher auf folgende pflegerischen Maßnahmen eingegangen: • Die Aromapflege • Die Basale Stimulation • Berührungen • Die atemstimulierende Einreibung [ASE] • Die beruhigende Ganzkörperwaschung [GKW] Es sollte vom Pflegepersonal gemeinsam mit dem Patienten entschieden werden, welche Maßnahmen individuell anzuwenden sind 9.1 Aromapflege: Die Aromapflege wirkt auf Körper, Seele und Geist. Es ist eine gute Unterstützung der Symptomlinderung und steigert das Wohlbefinden im palliativen Bereich.91 Man unterscheidet in der Aromapflege zwischen beruhigenden und anregenden Ölen. 9.1.1 Beruhigende Öle · Lavendelöl: Wirkt beruhigend auf das Nervensystem, löst Spannungen. Lavendel hilft auch bei Einschlaf- und Schlafstörungen. Bei depressiven Menschen aktiviert es und bewirkt eine Linderung der Melancholie und der Angstzustände. 90 Thich Nhat, Hanh: Das Glück einen Baum zu umarmen, 4. Aufl., München 1997, S. 102. 91 Vgl. Kutzner, Marion: Basale Stimulation, Berlin 2011, S. 254. 73 · Melissenöl: Melissenöl hat einen belebenden zitronenartigen Duft, der auch beruhigt und kräftigend wirkt. Der Duft wirkt bei einer Anwendung in Duftlampen auch gegen Schlafstörungen und Unruhe. 92 9.1.2 Anregende Öle • Limette: Limette als Öl hat einen herben, süßlichen, erfrischenden Duft. Er befreit Patienten, die sehr viel grübeln. Der Duft wirkt sehr erfrischend, aufmunternd und hat eine stimmungsaufhellende und appetitanregende Wirkung. • Bergamotte: Dieses Öl hat einen leicht süßlichen, zitronigen Duft und hilft bei Menschen, die seelisch angespannt und unter nervösen Anspannungen, Ängsten und Depressionen leiden. Man bekommt mehr Lebensfreude und ist optimistischer. Die Anwendung empfiehlt sich abends und kann auch als Badezusatz eingesetzt werden. 93 9.1.3 Anwendung: Die ätherischen Öle können in Duftschalen, Kalt- oder Warmverneblern verwendet werden. Auch bei Bädern, Inhalationen, Massagen, Wickeln und Auflagen können Öle eingesetzt werden.94 Abb. 7: Aromaöle95 92 Vgl. Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 255. 93 Vgl. Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 256. 94 Vgl. Perrar, Klaus Maria; Sirsch, Erika; Kutschke, Andreas: Gerontopsychiatrie für Pflegeberufe, Stuttgart 2007, S. 220. 95 Abb. 7 aus: Kursana Residenz: Wohlriechende Öle als Unterstützung in der Pflege, Wien-Tivoli 2012. 74 Bei der Anwendung einer Aromapflege sollte man beachten, dass die Düfte nicht nur positive sondern auch negative Gedanken auslösen können. Daher ist es sehr wichtig, vor der Anwendung den Patienten zu fragen, ob er den Duft mag und ob er ihn ausprobieren möchte. Dem Patienten steht natürlich frei, einen eigenen, individuellen Duft zu nehmen.96 Wichtig ist, dass vor jedem Gebrauch eine allergische Reaktion ausgeschlossen wird. Beim Umgang mit ätherischen Ölen sind folgende Grundregeln zu beachten: · Niemals unverdünnte Öle bei Patienten verwenden! Für die Verdünnung eines Öles kann man Mandel- oder Jojobaöl verwenden. Dazu nimmt man 100 ml Mandel- oder Jojobaöl mit 10-15 Tropfen ätherischem Öl. 97 · Als Badezusatz reichen 2-3 Tropfen aus. · Es sollen nicht mehr als drei Öle zusammengemischt werden, da sonst zu viele Informationen vermischt werden. · Bei Berührung der Schleimhäute, soll mit einem neutralen Öl ausgespült werden! 9.1.4 Kontraindikationen: · Bei Lungenerkrankungen (z.B. COPD) sollten Aromaöle nur sehr verdünnt angewendet werden. · Bei Kindern wirken die ätherischen Öle doppelt so stark, daher die Menge des Öles halbieren. · Bei Epilepsie sollten einige Öle wie zum Beispiel Fenchel, Salbei, Rosmarin und Ysop vermieden werden. · Bei Schwangerschaft sollte auf Aromapflege verzichtet werden.98 9.2 Basale Stimulation und Ganzheitlichkeit Basale Stimulation bedeutet in der Pflege, sich mit dem ganzen Menschen, dem Körper, dem Geist und der Seele auseinander zu setzen. Pflegende sollen sich nicht 96 Vgl. Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 257. 97 Vgl. Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 257. 98 Vgl. Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 257. 75 nur auf die Diagnose beziehen, sondern sich auch ein eigenes Bild über den Patienten machen. Dieses soll die Biographie des Menschen, dessen Ängste, Sorgen und Erfahrungen berücksichtigen. Auch Angehörige und Freunde können Pflegenden eine wichtige Unterstützung sein. Sie können über den Patienten Auskunft geben, wenn die Patienten selbst nicht mehr in der Lage sind, sich zu äußern. Basale Stimulation erfordert auch eine gute Zusammenarbeit mit den Ärzten, den Therapeuten, den Seelsorgern und allen anderen Berufsgruppen, die im Umfeld des Patienten sind. Mit diesem Hintergrund kann eine ganzheitliche Begleitung gelingen. Basale Stimulation ist eine wichtige Grundlage in der Pflege und erleichtert die verbale und nonverbale Kommunikation. Angebote in der basalen Stimulation müssen so gemacht werden, dass diese von den Patienten verstanden werden können.99 Eine zentrale Rolle in der basalen Stimulation spielen Berührungen. 9.2.1 Berührung und Berührungsqualitäten Die größte Erfahrung, die ein Mensch in seinem Leben macht, sind Berührungen. Das Wichtigste in der Pflege sind unsere Hände. Der ganze Körper bietet eine Vielzahl an Berührungs- und Bewegungsmöglichkeiten. Begegnung, Kommunikation und Interaktion bedeutet Berührung. Sie können den Patienten beeinflussen, ablenken und lenken. Berührungen sollen und dürfen nicht verwirren. Die oberflächlichen Berührungen werden als sehr unangenehm und unverbindlich empfunden und sollten daher vermieden werden. Bei Berührungen ist es wichtig, mit deutlichem Druck zu beginnen und so auch wieder zu enden. Eine so genannte Initialberührung kann zum Beispiel eine deutliche Berührung mit der ganzen Handfläche am Oberkörper sein. Es teilt dem Patienten mit, dass die Berührung beginnt und wann sie später wieder endet. Diese Initialberührungen können bei jeder Begegnung angewandt werden. Patienten können sich an der Berührung orientieren und spüren dadurch ihren Körper wieder besser. 99 Vgl. Kutzner, Marion: Basale Stimulation, Berlin 2011, S. 249. 76 9.2.2 Ziel der Berührungen: Man unterscheidet zwischen Berührungen, die dem Patienten über sich selbst Informationen geben und solche, die eine Kommunikation zwischen Pflegenden und Pflegekraft ermöglichen. Um dem Patienten Informationen über sich selbst zu vermitteln, werden verschiedene Materialen verwendet. Die Materialen können die Distanz zwischen Pflegepersonen und Pflegenden vermindern und helfen den Pflegenden, sich selbst mehr wahrzunehmen. Der Körperkontakt soll mit bloßen Händen stattfinden und fördert eine kommunikative Basis. Alle Berührungen sollen den Beginn und das Ende einer Pflegetätigkeit deutlich zeigen.100 9.3 ASE -Atemstimulierende Einreibung Die Atmung bringt Informationen über die Befindlichkeit einer Person. Eine Atemsveränderung signalisiert somatische, psychische oder geistige Aktivitäten oder Einschränkungen. Menschen, die zum Beispiel eine starke Unruhe aufweisen bzw. deren Körperwahrnehmung sehr mangelhaft ist, haben sehr oft eine hochfrequente, oberflächliche Atmung. Abb. 8: Atemstimulierende Einreibung101 100 Vgl. Kutzner, Marion: Basale Stimulation, Berlin 2011, S. 250. 101 Abb. 8 aus: Nydahl, Peter; Bartoszek, Gabriele: Basale Stimulation, Wiesbaden 1998. 77 9.3.1 Ziel der ASE: Das Ziel der ASE ist dem Patienten zu einer ruhigen, gleichmäßigen und tiefen Atmung zu verhelfen. Es soll die Körperwahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit unterstützen und die Bereitschaft des Patienten erhöhen, sich wieder für die äußeren Geschehen zu interessieren. Menschen, die mittels ASE gefördert werden, haben anfangs meist eine oberflächliche, rasche und teilweise eine unregelmäßige Atmung.102 Die Zielgruppe für ASE sind Patienten, die: · Schmerzen haben · sich in einem depressiven Zustand befinden, · unter Einschlafstörung leiden, · Wahrnehmungsverluste des Körpers haben (z.B. Patienten mit Morbus Alzheimer oder andere demente Menschen), · vor schweren operativen oder diagnostischen Eingriffen stehen, · eine maligne Diagnosemitteilung erhalten haben, · beatmet werden zur Unterstützung des Abtrainierens von Beatmungsgeräten.103 Laut Literatur gibt es keine Kontraindikationen bei ASE. Jedoch ist eine ASE bei Bestrahlungsfeldern auf dem Rücken, sowie bei Frakturen im Thoraxbereich oder bei der Wirbelsäule kontraindiziert.104 9.4 Beruhigende Ganzkörperwaschung(GKW) Eine beruhigende Ganzkörperwaschung vermindert Unruhezustände. Sie lenkt auch von Schmerzen ab und reduziert Ängste bzw. baut diese ab. Die GKW hat auch eine große Bedeutung in der Begleitung und Pflege der Sterbenden.105 102 Vgl. Bienstein, Christel; Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation in der Pflege: Die Grundlagen, Bern 2010, S. 174-175. 103 Vgl. Perrar, Klaus Maria; Sirsch, Erika; Kutschke, Andreas: Gerontopsychiatrie für Pflegeberufe, Stuttgart 2007, S. 219. 104 Vgl. Bienstein, Christel; Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation in der Pflege: Die Grundlagen, Bern 2010, S. 219. 105 Vgl. Kutzner, Marion: Basale Stimulation, Berlin 2011, S. 252. 78 Abb. 9: Basale Ganzkörperwaschung106 9.5 Beruhigende Teilwäsche der Füße und der Beine: Ein warmes Fußbad wirkt besonders beruhigend. Das Bein muss genau in Richtung der Körperbehaarung gewaschen werden. Viele Patienten wirken schon während der Waschung ruhiger oder schlafen sogar ein. Man kann anschließend warme Socken anziehen. Das vermittelt ein besonderes Wohlbefinden. 106 Abb. 9 aus: Nydahl, Peter; Bartoszek, Gabriele: Basale Stimulation, Wiesbaden 1998. 107 Vgl. Bienstein, Christel; Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation in der Pflege: Die Grundlagen, Bern 2010, S. 150 79 „Hast Du Angst vor dem Tod?“ fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt soviel ich konnte. Und Liebe tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.“ (Antoine de Saint-Exupéry – Der kleine Prinz) 10. SCHLUSSWORT (Projektteam) So wie es kein Leben ohne Angst gibt, so gibt es für Menschen in einer palliativen Lebenssituation selten Tage ohne Angst und Unsicherheit. Wir haben uns das Thema ausgesucht, da wir alle schon auf schwierige Situationen beim Umgang mit Patienten gestoßen sind, bei denen wir oft nicht genau wussten, wie wir mit der Angst der Patienten umgehen sollten. Oft hatten wir das Gefühl, dass die richtigen Worte fehlten, oder dass wir aus Überforderung einfach nicht weiter nachfragten, weil wir nicht wussten, wie wir reagieren sollten. Das Ziel der Projektarbeit war es, sich mehr mit diesem schwierigen und feinfühligen Thema auseinanderzusetzen und somit unsere Patienten besser begleiten zu können, aber auch für uns selbst eine Hilfestellung beim Umgang mit dem Symptom „Angst“ in der Palliativ Care zu haben. Wir alle haben ausführlich recherchiert und viele Bücher und Artikel über das Thema gelesen, bevor wir mit dem praktischen Teil begonnen haben. Der zentrale Teil unseres Projektes waren die Patienteninterviews. Wir versuchten, die Angst gemeinsam mit unserer Patienten in einem Gespräch in einem Interview sichtbar zu machen. Während unserer Arbeit konnten wir erkennen, wie wichtig es für unsere Patienten ist, über dieses Thema in einem geschützten Rahmen sprechen zu können. Die Gefühle anzusprechen, war in manchen Fällen schon ein Beginn, „den Knoten“ zu lösen. Nach anfänglichem Zögern und auftretenden Verdrängungsmustern begannen schmerzhafte seelische und 80 emotionale Beschwerden zu fließen und lösten sich manchmal sogar auf. Jedoch haben wir bei den Patientengesprächen gemerkt wie schwer es ist, das Thema Angst vorm Sterben direkt anzusprechen, denn alle Menschen haben Angst vorm Sterben. Elisabeth Kübler Ross meinte, dass wir im Unterbewusstsein davon überzeugt sind, dass wir selbst unmöglich vom Tod betroffen sein können.107 Unsere eigenen Ängste, die Angst vor dem Sterben und der eigenen Zerbrechlichkeit wurde uns immer wieder sehr deutlich vor Augen geführt. Was haben wir aus unserer Arbeit gelernt? Wir haben gelernt, sensibler in unserer Gesprächsführung zu werden. Viele von uns haben erstmals direkt die Ängste der Patienten hinterfragt. Wir haben gelernt, dass Ängste verbalisiert werden sollen und wir merkten, dass Patienten uns sehr dankbar waren, ihre Ängste einmal aussprechen zu dürfen. Einigen unserer Patienten konnten wir dadurch sogar helfen, ihre Ängste besser verarbeiten zu können. Durch die Interviews lernten wir unsere Patienten mit ihrem Lebensumfeld besser kennen und konnten sie dadurch besser begleiten. Wir haben gelernt, dass nahezu alle Patienten Abwehrmechanismen benützen, sie sind eine unverzichtbare Hilfe zur Realitätsbewältigung. Durch dieses Wissen konnten wir manch ungewöhnliches Verhalten unserer Patienten erst richtig deuten. Doch was am wichtigsten ist, wir lernten unsere eigenen Ängste kennen, unsere eigenen Schwächen und unsere eigene Hilflosigkeit. Durch die empfundene Empathie hat sich die therapeutische und menschliche Beziehung vertieft. Wir müssen noch lernen, die Ängste unserer Patienten besser zu verstehen und somit besser zu behandeln. Eine fortwährende Selbsterfahrung, Reflexion und Supervision bezüglich des Symptoms Angst könnte uns helfen. 107 Kübler-Ross, Elisabeth: Interviews mit Sterbenden, München 2001, S. 12. 81 ANHANG Interviewprotokolle (Stefanie Schatz – Krienzer): Interview 1 vom 07.03.2012 : Wie geht es Ihnen jetzt im Moment Frau K.? Pat: Es geht eigentlich soweit ganz gut. Ich habe heute bis jetzt kaum Sauerstoff gebraucht, das heißt, dass mit der Luft ist im Moment so echt gut auszuhalten…..nur dass ich nicht aufstehen darf, das bedrückt mich und macht mich ganz unrund…. Das heißt, Sie haben in letzter Zeit zu Hause vermehrt unter Atemnot gelitten? Pat: Wie soll ich sagen…es gibt gute und es gibt schlechte Tage…Das mobile Palliativteam war bei mir und die haben organisiert, dass ich zu Hause Sauerstoff bekommen werde. Bis jetzt ist er zwar noch nicht da, aber ich hoffe, bis ich wieder nach Hause entlassen werde, werde ich ihn haben. War die Atemnot denn häufig auch mit einem Angstgefühl verbunden? Pat: Ich kenne das schon, bei uns hatten alle Krebs: mein Vater, mein Großvater und meine Schwester. Alle hatten sie Lungenkrebs und dabei hat meine Schwester nicht einmal geraucht- ich hab zwar geraucht, aber wie Sie sehen kann es jeden erwischen. Wie schlafen Sie denn? Pat: Sehr schlecht. Können Sie schwer einschlafen oder ist eher das Durchschlafen das Problem? Pat: (Pat. beginnt zu weinen) Ich kann kaum einschlafen, weil mir so viele Dinge und beunruhigende Gedanken durch den Kopf gehen…ich habe Angst vorm Sterben und Angst davor, wie es weitergehen wird….wenn ich dann einschlafe ist es nur für ein, zwei Stunden und sobald ich aufwache sind die Gedanken wieder da. Haben Sie schon einmal mit Ihrer Familie darüber gesprochen? 82 Pat: Nein, bisher noch nicht. Ich will meine Töchter nicht auch noch damit belasten, ich falle Ihnen ohnehin schon schwer zu Last. Ich habe das Gefühl, dass sie mit meiner Erkrankung und mit all dem, was kommen wird, nicht fertig werden, deshalb sprechen wir nicht darüber. Ich glaube, dass gerade ein offenes Gespräch für beide Seiten sehr wichtig wäre. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Euch gegenseitig zu schützen versucht und dass es für alle eine große Erleichterung wäre, über Eure Sorgen offen zu sprechen. Pat: Vielleicht sollte ich das wirklich einmal versuchen…. Interview 2 vom 15.03.2012 Wie geht es Ihnen jetzt im Moment Frau H.? Pat: Im Moment ist es wieder etwas schlechter, da ich wieder ins Krankenhaus musste wegen einer Lungenentzündung. Daher muss der nächste Chemotherapiezyklus verschoben werden… ich wünschte, ich hätte ihn schon vorbei… Die Nebenwirkungen sind jetzt nämlich mit jedem Zyklus stärker geworden. Ich leide dann immer sehr unter Übelkeit und einem ausgeprägten Schwächegefühl. Es ist so, als würde meine ganze Energie aus meinem Körper herausgezogen werden. Im Moment sorgen sich halt auch meine Kinder sehr, weil die Mutti schon wieder im Krankenhaus ist. Wie geht es ihnen mit der Luft? Pat: Ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Jetzt durch die Lungenentzündung ist es natürlich etwas schlechter, vor allem die Sättigung ist schlecht. Deshalb muss ich hier im Krankenhaus auch öfter den Sauerstoff nehmen, zu Hause hab ich ihn aber so gut wie nie gebraucht. Wie schlafen Sie denn? Pat: Nicht so gut. Ich muss viel grübeln, wenn ich wach in der Dunkelheit liege. Ich mach mir viele Gedanken über meine Familie…meinen Mann und meine Kinder. Die ganze Situation ist so schwierig für sie. Außerdem macht es mich traurig zu wissen, dass ich meine Enkelkinder nicht groß werden sehen kann. Tagsüber muss ich stark 83 sein und darf meiner Familie nicht zeigen, dass ich traurig bin, weil sie das dann noch trauriger macht. Und wie denken Sie darüber? Haben Sie Angst vor der Zukunft? Pat: Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich hab mich mit meinem Schicksal einfach abgefunden. Wissen Sie, der Tod ist jetzt schon seit vielen Jahren mein Wegbegleiter, zweimal bin ich ihm von der Schaufel gesprungen, aber natürlich setz´ ich mich schon seit Jahren mit der Thematik auseinander. Jetzt bin ich bereit zu gehen… Ich bin dankbar, dass ich noch ein paar schöne Jahre hatte… Was mir aber schon Sorgen bereitet, ist, dass ich vielleicht in Zukunft nicht mehr alle Dinge selber machen kann und dann von jemandem abhängig sein werde. Die Aufgabe meiner Selbstständigkeit ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Sprechen Sie in der Familie offen über dieses Thema? Pat: Nein, bisher noch nicht. Ich hab es mir schon oft vorgenommen, aber irgendwie hat es dann doch nie gepasst. Für mich ist es leichter, meinem Mann und meinen Kindern die Hoffnung zu lassen… ich sage ihnen, dass ich weiter kämpfen werde und dass alles gut werden wird. Ich spüre, dass sie große Angst haben. Ich war schon immer die Starke in der Familie. 84 Interviewprotokolle (Anna Maria Palko): Interview 3 vom 30.01.2012: Wir sitzen hier in ihrer Küche und sie haben sich etwas zu essen gerichtet, wie entwickelt sich ihr Appetit? Pat: Seit ich Medikamente gegen meine Übelkeit nehme, hat sich auch mein Appetit sehr gesteigert. Jetzt esse ich wieder drei Mal täglich normale Portionen. Meine Übelkeit ist weg und erbrochen habe ich seit Tagen nicht mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt meine Verdauung wieder gut funktioniert. Bei unserem letzten Telefonat waren sie mit ihrer Schlafqualität zufrieden, wie geht es ihnen heute damit? Pat: Hier habe ich Probleme. Es gelingt mir zwar recht rasch einzuschlafen, aber nach zwei bis drei Stunden werde ich munter und es dauert Stunden, bis ich wieder weiterschlafen kann. Haben sie vielleicht Schmerzen, Atemnot, schwitzen sie stark oder leiden sie in der Nacht unter anderen körperlichen Beschwerden? Pat: Ja, manchmal habe ich Schmerzen, aber dagegen helfen meine Akutmedikamente gegen Schmerzen, die ich schon vorsichtshalber neben mir liegen habe, sehr gut. Trotzdem kann ich nicht weiterschlafen. Es gehen mir zu viele Gedanken durch den Kopf. Möchten sie mir diese Gedanken beschreiben? Was glauben sie, wie es weitergehen wird? Patientin senkt den Kopf und gibt keine Antwort. Langes Schweigen folgt. Haben sie Angst vor dem Sterben? 85 Pat: Nein, es kommt, wie es kommen muss. Ich hoffe nur, dass es, wenn es soweit ist, schnell geht und dass ich nicht leiden muss. Was die Schmerzen und andere körperliche Symptome betrifft, so gibt es sehr gute Medikamente, die das Leiden in der letzten Lebensphase sehr gut lindern. Haben sie mit Ihrer Familie auch schon über diese Zeit gesprochen? Pat: Nein, davor hab ich Angst, das tut so weh. Ich hab ja noch so kleine Kinder. Mein Mann hat in den letzten Monaten ja schon den größten Teil der Betreuung übernommen, und er macht das gut, da habe ich keine Sorgen. Aber es wird für alle nicht leicht werden. Das kann ich gut verstehen. Vielleicht ist gemeinsam durchlebter Schmerz und Angst leichter zu tragen. Und wenn man weiß, dass der andere das auch weiß, dann kann man kommende Gespräche befreiter führen. Pat: Diese Anregung werde ich gerne aufgreifen und in einem günstigen Augenblick mit meinem Mann sprechen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für dieses Gespräch. Interview 4 vom 15.02.2012: Wie geht es Ihnen heute? Pat: Ich bin sehr zufrieden, meine Müdigkeit ist zwar unverändert, aber ich bin im Haus mobil und wenn die Sonne scheint, schaffe ich es noch auf die Terrasse. Die Krankheit schraubt die Ansprüche im Leben nach unten. Wie geht es Ihnen mit den Schmerzen? Pat: Hier habe ich keine Probleme. Manchmal verspüre ich einen leichten Druck im Brustkorb. Wenn dieser über NRS. 3 ansteigt, drücke ich die Bolus-Funktion bei der PCA. Meine letzte Bolusgabe war gestern vor der Morgenpflege, seitdem bin ich wieder beschwerdefrei. Wie geht es Ihnen mit der Atmung? 86 Pat: In Ruhe geht es gut, nur bei körperlicher Belastung- wie Treppensteigen- gerate ich in Luftnot. Wenn ich mich dann hinsetze, geht es gleich wieder besser. Haben Sie schon einmal versucht, auch bei Atemnot einen Bolus zu drücken? Pat: Ja, und der hilft auch sehr gut, nur möchte ich mit dieser Möglichkeit sparsam umgehen. Hinsetzen hilft ja auch. Schwitzen Sie häufig oder haben Sie Herzrasen? Am Anfang meiner Erkrankung waren Schweißausbrüche vor allem nachts ein Problem, aber seit vielen Wochen bin ich beschwerdefrei. Herzrasen hatte ich nie. Wie geht es Ihnen in der Nacht? Haben Sie Ein- oder Durchschlafprobleme? Pat: Seit ich Medikamente einnehme, kann ich gut ein- und durchschlafen, nur selten muss ich nachts auf die Toilette, danach liege ich manchmal etwas länger wach und denke so vor mich hin. Aber das ist kein Problem für mich. Welche Gedanken gehen Ihnen dabei durch den Kopf? Pat: Wie es weitergehen wird und was noch alles auf mich zukommt. Wie lange ich noch leben darf. Ich weiß, niemand kann mir darauf eine Antwort geben. Ich versuche aus diesen Grübelkreisläufen auszubrechen, indem ich dann den Fernseher einschalte oder Musik höre. Meist schlafe ich dabei ein, das funktioniert gut. Besprechen sie diese Zukunftssorgen auch mit Ihrer Familie? Pat: Ja, mit meinen Mann habe ich schon gesprochen. Ich merke aber, dass es uns beide sehr belastet und uns sehr traurig macht. Eigentlich ist ja schon alles besprochen, und ich will nicht immer daran denken müssen. Unsere Kinder sind in diese Gespräche nicht eingebunden. Ich kann das nicht, ich möchte sie schonen. Sie haben beruflich und zum Teil auch privat viel zu tun. Mein jüngster Sohn wird im Frühjahr heiraten, darauf freue ich mich schon sehr. Deshalb möchte ich sie auf keinen Fall belasten. Später vielleicht, wenn es nicht mehr anders geht, aber jetzt ist es noch zu früh. Haben Sie Angst vor dem Sterben? 87 Pat: Vor dem Tod selbst habe ich keine Angst. Und noch habe ich ja eine gute Lebensqualität, nur selten Schmerzen oder Atemnot. Vor ein paar Monaten ist es mir um vieles schlechter gegangen. Und ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit und bleibe noch länger beschwerdefrei. Was nach dem Tod kommt, das weiß ja keiner. Ich hoffe schon, dass es weitergeht, und das tröstet mich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen. 88 Interviewprotokolle (Thomas Lausch): Interview 5 vom 22.12. 2011: Wie geht es ihnen heute? Pat: Es geht mir recht gut. Die Schmerzen sind nun nach Erhöhung der Schmerzpflaster deutlich geringer als bisher. Wie hoch würden sie die Schmerzen jetzt einschätzen? Pat: Aktuell habe ich Schmerzen im Bereich der linken Leiste und im linken Oberschenkel. Ich würde die Schmerzhöhe mit 1-2 angeben. Schmerzspitzen gestern bis 4 – nach Einnahme der Hydal akut kam es zu einer deutlichen Verbesserung. Kann die Schmerzen jetzt gut kontrollieren. Wie ist der Appetit und wie das Stuhlverhalten? Pat: Appetit ist gut – könnte rund um die Uhr essen. Stuhl habe ich jetzt regelmäßig alle 2 Tage, der Stuhl ist zwar hart, aber es geht. Wie geht’s mit den Kräften? Pat: Ich bin jetzt wieder deutlich mobiler, war gestern mit meiner Mutter einkaufen und Kaffee trinken. Ich konnte endlich wieder einmal am normalen Leben teilnehmen. Wir haben den Rollstuhl zwar mitgenommen, aber ich brauchte ihn nicht. Haben sie Schlafprobleme? Pat: Ja, ich brauche mindestens eine Stunde, bis ich einschlafen kann und komme dann mehrmals in der Nacht auf. Ich wecke meist meine Mutter auf, wir gehen dann raus Rauchen und ein bisschen tratschen. Letztens hatte ich einen Albtraum und hab meine Mutter wieder aufgeweckt. Können sie sich an den Albtraum erinnern? Pat: Ja, ich lag in meinem Zimmer und viele Menschen liefen an meiner Zimmertür vorbei. Ich brauchte Hilfe und keiner konnte mir helfen. Ich bin dann aufgewacht, war 89 schweißgebadet und weckte meine Mutter, sie konnte mir schließlich gut helfen, indem sie mich beruhigen konnte. Ich habe jetzt öfters richtige Schweißausbrüche, vielleicht als Nebenwirkung der vielen Medikamente. Wie oft haben sie diese Schweißausbrüche und haben sie dabei beunruhigende Gedanken? Pat: Oft mehrmals am Tag habe ich diese Schweißausbrüche, ich muss doch öfters grübeln, wie es so weitergehen soll. Was denken sie sich dabei? Pat: Ich mach` mir Sorgen, dass ich nicht mehr gesund werde. Aber ich werde kämpfen bis zum Umfallen. Haben sie Angst? Pat: Nein, ich hab` ja meine Mutter, somit brauche ich keine Angst haben. Danke für das Gespräch. Interview 6 vom 10.05.2012: Frau M. stochert lustlos in ihrem Essen herum und zwingt sich einzelne Bissen des Mittagessens herunterzuwürgen. Schmeckt ihnen das Essen nicht? Pat: Das Essen ist gut, ich habe keinen Appetit, außerdem ist mir so schlecht. Meine Töchter schimpfen immer mit mir, wenn ich nichts esse, so zwinge ich mich, ein paar Bissen zu essen. Hat sich ihre Übelkeit nicht verbessert? Sie haben bei der Visite nichts davon angegeben. Pat: Die Übelkeit ist nicht besser geworden, aber ich kann ganz gut damit umgehen. Soll ich ihnen etwas gegen die Übelkeit bringen? Pat: Wenn es ihnen keine Umstände macht. 90 Ich verlasse das Zimmer und bringe Frau M ihre Bedarfsmedikation. Wieso melden sie sich nicht, wenn es ihnen schlecht geht? Pat: Ihr seid alle so freundlich zu mir, ich will euch nicht immer mit meinen Kleinigkeiten belästigen, außerdem habt ihr noch viel schlechtere Patienten zu versorgen. Wir sind aber dafür da, sie sollen sich sogar melden, nur dann können wir Ihnen gut helfen. Pat: Mir kann sowieso keiner mehr helfen. Wieso? Pat: Ja schauen sie mich mal an, bin ja nur mehr ein Häufchen Elend (und zeigt auf ihre dünnen Beine). Die ganzen Therapien haben nichts geholfen und ich werde immer schwächer und schwächer. Ich merke, es wird nicht mehr besser. Wir können aber ihre Symptome lindern. Pat: Das könnt ihr vielleicht, aber wirklich helfen könnt ihr mir nicht (blickt zu Boden). Wovor haben sie Angst? Pat: Ich habe Angst, abhängig zu sein. (Macht eine längere Pause) Mein Mann hat mich mit 4 kleinen Kindern verlassen und ist zu einer Jüngeren gegangen. Ich habe meine Kinder allein aufgezogen und habe immer alles selber geregelt. Ich war mein ganzes Leben nie von jemandem abhängig, und jetzt soll ich mir bei jeder Kleinigkeit helfen lassen. Meine Töchter haben mittlerweile selber eine Familie, ich will nicht, dass sie sich auch noch um mich kümmern müssen. Ich merke aber, dass ich immer schwächer werde und dass ich immer mehr Hilfe benötige, ich will aber keinem zur Last fallen. Haben sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie es zuhause weitergehen soll? Pat: Ich möchte in kein Pflegeheim, ich will in meiner Wohnung bleiben, wie das gehen soll, weiß ich nicht. 91 Wir können mit der Sozialarbeiterin besprechen, welche Möglichkeiten der Betreuung zuhause es gibt. Haben sie Angst vor dem Sterben? Pat: Nein, ich hatte vor längerer Zeit schon mal den Gedanken aus dem Fenster zu springen. Das kann ich meinen Kindern nicht antun, dafür hab ich sie zu sehr lieb. Hatten sie diese Gedanken in letzter Zeit auch? Pat: Nein. Danke für dieses Gespräch. Pat: Es tut mal gut, so offen reden zu dürfen. 92 Interviewprotokolle (Irmgard Kothgasser): Interview 7 vom 20.03.2012 Herr X., wie geht es Ihnen? Pat: Sehr gut, so gut wie jetzt habe ich es noch nie im Leben gehabt. Alle sind sehr nett zu mir. Wie gefällt ihnen ihr Zimmer? Sie haben es sehr nett eingerichtet mit einigen Erinnerungsstücken. Pat: Mir gefällt mein Zimmer so gut, ich möchte am liebsten hier bleiben. (Tränen in den Augen). Ich habe mein Haus ganz alleine aufgebaut,…[dieser Text ist gekürzt. Hr. X schilderte hier ausführlich sein Haus und die anstrengende Bauzeit]. Haben sie Angst vor dem neuem Heim, dass dieses Jahr fertig wird? Pat: Angst nicht, aber ich möchte eigentlich nicht weg von hier. Früher war ich ein Baupolier [Hier ist der Text wieder gekürzt. Hr.X. erzählte von seiner Berufszeit und welche Bauwerke er als Polier betreute.] Warum möchten sie hier nicht weg? Pat: Ich habe doch hier alles. Haben sie sonst vor etwas Angst? Pat: Ich hatte noch nie in meinem Leben Angst, Ich war immer ein lustiger Mensch, ich habe viel geschaffen. Haben sie Angst vor dem Sterben? Pat: Ich habe keine Angst davor. (Tränen in den Augen) Dann bin ich wieder mit meiner Familie zusammen! Danke für ihr Gespräch 93 2. Gespräch vom 27.03.2012 Guten Morgen, haben sie gut geschlafen? Pat: Ja, sehr gut. Wie geht es ihnen Herr X.? Pat etwas nachdenklich: Eigentlich nicht gut, ich war immer ein starker Mann, der viel geleistet hat. Und jetzt brauche ich sogar Hilfe beim Waschen. Haben sie Angst vor dem Schwächerwerden des Körpers? Pat: Ja, sehr sogar. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass ich nicht einmal einen kleinen Schritt gehen kann. Ich kann, wenn ich im Bett bin, nichts vom Tisch holen. Das ist sehr schlimm. Und wie geht es ihnen jetzt, da sie einen Krankenfahrstuhl haben? Pat: Ich bin froh, dass ich den habe, so komme ich doch aus dem Zimmer. Aber um mein Auto tut es mir leid. Mit diesem konnte ich immer zum Friedhof fahren oder zu meiner Freundin oder auch einkaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Ich vermisse das. (Nach einer kurzen Pause und etwas nachdenklich) Das ist schon schlimm. Was wäre für sie schlimm oder würde ihnen Angst machen? Pat: Wenn ich nicht mehr aus dem Zimmer könnte und bei allen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen könnte. Danke, dass sie mir so ehrlich antworteten. 94 Interview 8 vom 28.1.2012: Das Interview führte ich während der Morgenpflege durch, als Frau A. zu weinen begann. Was ist los, hab ich Ihnen wehgetan? Pat: Nein, es ist so schlimm, so hilflos zu sein. Was ist für sie am schlimmsten? Pat: Ich kann gar nichts mehr alleine machen, brauche Hilfe beim Anziehen, beim Waschen. Habe seit dem Sturz Angst wieder zu stürzen. Ich kann sie verstehen, sie können uns jederzeit per Rufglocke zu Hilfe rufen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, um Ihnen die Angst vor einem weiteren Sturz zu nehmen? Pat: Es geht mir so schon viel besser. Danke. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Pat: Naja, was soll ich sagen: Es sind alle sehr nett. Eigentlich ist es auch sehr schön, aber daheim ist es eben nicht. (Tränen waren in ihren Augen. Ich saß neben Frau A. und hielt ihr die Hand) Waren Sie schon mal daheim, seit Sie hier sind? Pat: Nein, meine Kinder kommen zwar schon häufig, aber eigentlich dachte ich, dass ich nur für eine kurze Zeit hier bleiben muss, bis mein Sohn wieder vom Krankenhaus nach Hause kommt. Aber als er wieder vom Spital daheim war, sprach keiner mehr vom nach Hause gehen. Sind Sie darüber traurig? Pat: Sie meinen es halt gut mit mir. Sie kommen mich sehr oft besuchen. Belastet Sie noch etwas oder macht Ihnen etwas Angst? Pat: Ich habe nichts gegen meine Mitbewohnerin, aber ich kann mit ihr nichts reden. Und dann muss ich ihr immer bei allen pflegerischen Tätigkeiten zuschauen. Wenn 95 sie eine frische Einlage braucht, stinkt es und auch das Reinigen ihrer Ausscheidungen muss ich mitriechen - das ist nicht sehr angenehm. Wenn ich kann, gehe ich aus dem Zimmer. Ich kenne hier doch einige Leute. Als ich ans Ende meines Gesprächs kam, fragte ich Frau A., ob ich es für meine Projektarbeit verwenden dürfte, sie lachte mich an und meinte: „Wenn Ihnen das hilft, gerne.” 96 Interviewprotokolle (Gernot Plank): Interview 9 vom 29.03. 2012: Hr. M., wie geht es Ihnen mit dem Appetit? Pat: Scheußlich (blickt zum Boden). Es schmeckt alles grauslich. Die Gattin ist nicht erfreut (nimmt Blickkontakt mit seiner Gattin auf, welche rechts von ihm sitzt); (nimmt Blickkontakt mit mir auf) sogar normales Leitungswasser hat einen metallischen Geschmack. Ich habe immer wieder Blutungen im Mund. Der Hausarzt war gestern da und hat einen Verdacht auf eine Magen- und Darmblutung geäußert. Sutent wurde vor 14 Tagen auf meinen eigenen Wunsch abgesetzt. Haben Sie zurzeit Übelkeit und oder Erbrechen? Pat: Ja, ich habe fallweise immer wieder Erbrechen, ich kann im TV bei keiner Kochsendung zusehen. Die Übelkeit ist bei Obst etwas geringer, das geht. Nüsse schmecken sehr gut, aber ich kann diese jetzt nicht essen wegen der offenen Stellen im Mund.“ Was unternehmen sie dagegen? Pat: Ich nehme 3 Tropfen Dronabinol und Zofran, das hilft recht gut. Weiters nehme ich die Paspertintropfen. Wie würden sie Ihre Schmerzsituation beschreiben? Pat: Seit ich mit Sutent aufgehört habe, besser. (Macht eine lange Gesprächspause und wir schauen uns beide an) Ich meine, es ist auszuhalten, wesentlich besser als vorher. Haben Sie Schlafprobleme? Pat: Ich schlafe sehr gut. Habe ein Medikament verschrieben bekommen. (Macht eine Pause und denkt über den Namen des Medikamentes nach, da es ihm nicht einfällt, steht er auf und geht in sein Zimmer, um die Medikamentenliste zu holen. Kommt nach ca. einer Minute zurück, setzt sich wieder zu mir und seiner Gattin.) Das Medikament heißt Halcion, ich möchte es aber nicht nehmen. 97 Warum? Pat: Ich möchte nur wenige Medikamente nehmen. Gibt es beunruhigende Gedanken? Pat: Im Prinzip nicht. Ich bemühe mich, nicht viel nachzudenken, ich habe keine Angst vor dem Kommenden. Manchmal stelle ich mir die Frage, wie lange dauert es noch? Es reicht! Immer wieder kommt etwas Neues dazu, alles wird weniger, ich muss essen, das hält mich am Leben. Es geht so weit, dass ich mich täglich zwinge, etwas zu essen, um nicht noch mehr abzunehmen. Auch meine Muskeln werden weniger. Bemerken Sie an sich selbst andere körperliche Beschwerden wie Schwitzen oder Atemnot? Pat: Eigentlich nicht. Ich schwitze beim Hals manchmal in der Nacht, es ist aber kein Dauerzustand. Unter Sutent war es mir immer wieder kalt. Jetzt ist es wieder besser. Dieses Medikament hat einiges ruiniert- Gott sei Dank gibt es jetzt eine Pause vom Medikament. Was glauben Sie, wie könnte es weitergehen? Pat: (Schaut seine Fingernägel an) Sie sind so brüchig, damit muss man leben. Es wurde mir gesagt, dass ich zeitlebens eine Therapie benötige.“ Haben sie Angst? Pat: Ich habe im LKH nach einer OP einmal begonnen zu halluzinieren. Dies macht mir heute noch Angst. Oder dass ich meine geistige Kraft verliere. Wie helfen sie sich selber? Pat: Ich nehme Medikamente nur widerwillig und sparsam ein. Früher hatte ich Angst vor Versagen und Prüfungen. Mit dem Tod möchte ich mich nicht befassen. Ich bin nicht sehr gläubig - begleite die Gattin zwar in die Kirche. Eine Bibelstunde finde ich eher belustigend. Ich erinnere mich an einen Friedhofsbesuch in Graz, bei dem ich von Zeugen Jehovas angesprochen wurde - mit den Worten: „ein lieber Gruß von einem Verstorbenen“ wollten sie ein Gespräch beginnen. Ich habe gesagt, sie mögen bitte verschwinden. 98 Danke für das offene Interview. Interview 10 vom 29.03.2012: Sie haben mir erzählt, dass sie sehr gerne kochen. Wie geht es Ihnen mit dem Appetit? Pat: Ich fühle mich immer so schlapp- hätte aber große Lust auf Kärntner Kasnudelndies ist meine Lieblingsspeise. Das Teigmachen ist aber so schwer. Oder ein guter Salat mit einer Sulze schmeckt sehr lecker. Ich esse immer mehrere kleine Portionen (lächelt). Haben sie Übelkeit oder Erbrechen? Pat: Vor vierzehn Tagen einmal. Das war noch nie da. Ist auch egal, wenn der Koffer (meint das Erbrochene) heroben ist (lacht wieder).Ich trinke statt Kaffee jetzt halt Ovomaltine oder einen ganz schwachen Kaffee. Wie würden sie Ihre Schmerzsituation beschreiben? Pat: Wie soll ich es sagen. Es drückt einmal da, einmal dort, aber direkt Schmerzen oder Weh habe ich nicht. Außer der Bauch wird immer größer- durch das Wasser. Nehmen sie eine Bedarfsmedikation von uns? Pat: Bedarfsmedikation (Zwinkert mich an)? Was ist das? Was ich nehmen muss, nehme ich. Haben sie Schlafprobleme? Pat: Das dürfen sie nicht fragen (lacht herzlich). Ich schlafe so gut (lacht wieder). Ich denke mir oft, wenn ich so einschlafen könnte. Ich schlafe 7-8 Stunden durch. Gibt es für sie beunruhigende Gedanken? 99 Pat: (Deutet nein und lacht) Schaun`s, wie soll ich sagen, ich weiß, dass es bergab geht. Aber jeder Mensch muss gehen und ich konnte das nie, dass ich mich da so hineinsteigere. Jeder Mensch muss gehen. Bemerken Sie an sich andere körperlichen Beschwerden wie Schwitzen oder Atemnot? Pat: Aber wie (lacht herzhaft), in der Früh ist der Bauch dünner. Schwitzen nein. Atemnot ja. Ich muss bei jeder Stiege stehen bleiben. Laut Krankenhaus sind die Lunge und das Herz gesund. Was glauben sie, wie könnte es weitergehen? Pat: Wenn ich nicht mehr aufstehen oder mich waschen kann, gehe ich ins Heim. Ich habe mit meinen Söhnen noch nie gesprochen, wer schaut, keine Ahnung. Wie soll ich sagen, das klingt, wie wenn ich betteln soll (schaut auf mich). Kein Kind ist verpflichtet. Ich möchte niemandem zur Last fallen. So ist es! Ich fahre mit dem Taxi einkaufen und der Fahrer trägt es herauf. Einmal in der Woche hilft mir jemand im Haushalt. Das Bücken geht nicht mehr so gut. Manches Mal denke ich mir, die Leute beklagen sich, wenn es nicht so geht und möchten alles selber machen. Ich werde alle Kleider verschenken – sie passen mir eh nicht mehr. Wenn der Kasten auch leer ist, das ist mir egal. Haben sie Angst? Pat: Angst vor dem Sterben? Nein (blickt mir tief in die Augen und macht eine längere Pause). Warum soll ich Angst haben? Ich habe ja nichts verbrochen. Habe auch kein Geld, über das ich mir Sorgen machen müsste. Angst vor Leid- ja. Angst vor Schmerzen oder dass ich nichts mehr weiß. Ich habe mein Leben gelebt. Heuer werde ich 84. Ich dachte immer, dass ich nicht so alt werde. Ich war bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meiner Schwester beim Sterben dabei. Danke für das Interview. 100 HADS-D-Fragebogen: 101 HADS-D Auswertungshilfe: 102 HADS-D Auswertung/Interpretation: Werte ≥ 11 je Subskala sind als sicher auffällig und solche ≤ 7 als unauffällig anzusehen. Werte von 8-10 gelten als grenzwertig, sie lassen jedoch psychische Auffälligkeiten vermuten. Der auffällige Bereich kann in schwer (Werte 11-14) und sehr schwer (Werte 15 -21) unterteilt werden. Die Testergebnisse sind wie bei allen Fragebogeninstrumenten mit Zurückhaltung zu interpretieren und im individuellen Einsatz nicht als diagnoseweisend sondern als Orientierungsmarken zu verstehen. Alternativ zu festen Grenzwerten (fixer Cut off–Bereich) stellen Normtabellen und Perzentilenwerte geschlechtsbezogen sowie krankheitsspezifisch eine Orientierungshilfe dar.108 SKID Strukturiertes klinisches Interview für DSM – IV (Wittchen et al, 1997) Es dient zur Erstellung von Differentialdiagnosen psychischer Störungen laut des Diagnosesystems DSM-IV (Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen, 4. Revision). Es enthält im Prinzip alle Fragen, die zur Diagnose der entsprechenden psychiatrischen Erkrankung führen. Sogenannte Trennpunktfragen ermöglichen das Überspringen ganzer Fragebereiche, die aufgrund einer Vorfrage als irrelevant erscheinen. Wissenschaftliche Auswertung auch computerunterstützt möglich.109 DIPS Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen (Margraf et al., 1991,1994) Das DIPS ist ein strukturiertes Interviewverfahren, welches eine Einordnung psychischer Störungen sowie das Erfassen von für psychotherapeutische Behandlung relevanten Informationen ermöglicht. Das DIPS konzentriert sich auf Störungen, die im DSM IV klassifiziert sind. In der DSM IV werden Störungen in fünf 108 Vgl. Hermann-Lingen, Christoph; Buss, Ulrich, u.a: HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale Deutsche Version, Göttingen 2011, S. 21f. 109 Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 15. 103 verschiedenen Achsen klassifiziert, z.B.: Achse I (Klinische Störungen und andere klinisch relevante Probleme), Achse II (Persönlichkeitsstörungen und Geistige Behinderung). Das DIPS nimmt auf alle Achsen Bezug, so werden betreffend der Achse I Fragen zu folgenden Themenbereichen gestellt: Angststörungen, affektive Störungen, Substanzmissbrauch und -abhängigkeit, Somatoforme Störungen und Essstörungen. Im Frageteil zu den Störungen ist die Abfolge der Fragen an den Störungsbildern orientiert, sodass jede Störung mit all ihren Symptomen vollständig erfragt wird bzw., falls keine positiven Anzeichen für die Störung vorliegen, wird mit Hilfe der Sprungregel der Rest des Störungskapitels hin zur nächsten Störung übersprungen. Am Ende jedes Abschnittes schätzt der Untersucher die jeweilige Störung auf einer fünfstufigen Skala ein. Nach Beendigung des Interviews erfolgt die Kodierung der Diagnosekriterien Der Schweregrad der jeweiligen Diagnose wird auf einer Skala von 0 – 8 eingeschätzt. Der Interviewer soll die Sicherheit, mit der er die Diagnose stellt, auf einer Skala von 0 – 100 beurteilen. Durchführung der Atemstimulierenden Einreibung (ASE): Die ASE soll ca. 5-10 Minuten dauern. Wichtig ist, dass man für diese Maßnahme Zeit hat und nicht gestört wird. Der Patient benötigt eine Sitzgelegenheit, wobei der Rücken frei zugängig sein soll. Dem Patienten sollen die Möglichkeiten gegeben werden, den Oberkörper an einer Rückenlehne oder der Bettkante anzulehnen und die Arme leicht abstützen zu können. Einen Polster oder ein Kissen kann man zusätzlich als Polsterung anbieten. Eine zweite Pflegeperson hat sich zur Stütze nicht bewährt, da sich die Beteiligten schwerer auf die ASE konzentrieren können, da der Patient dazu neigt, sich mit der stützenden Pflegekraft zu unterhalten. Man kann grundsätzlich eine ASE genauso in 135° Bauchlage oder einer Seitenlage durchführen.110 Die Hände sollen fühlen und denken können und daher äußerst bewusst eingesetzt werden. Die ASE soll ohne Handschuhe durchführt werden. Es soll möglichst eine unparfümierte W/O-Lotion (Wasser in Öl) verwendet werden. Man verteilt die Lotion gleichmäßig in seiner Handfläche und trägt sie am Rücken vom 111 Vgl.:http//dk.akis.at/klin.interviews.html (06.02.2012) 110 Vgl. Buchholz, Thomas; Schürenberg, Stefan: Basale Stimulation in der Pflege alter Menschen: Anregungen zur Lebensbegleitung, Bern 2009, S. 147. 104 Nacken bis zum Steiß auf. Besonders der seitliche Bereich des Brustkorbes soll nicht vergessen werden. Die Hände sollen nie gleichmäßig vom Körper genommen werden sondern werden gleichzeitig mit kreisenden Bewegungen vom Rücken in Richtung Steiß geführt. Rechts und links der Wirbelsäure wird ein stärkerer Druck mit dem Daumen, dem Zeigefinger und den Handflächen ausgeübt als auf den Rippenbögen. Der Dornfortsatz der Wirbel wird dabei ausgelassen. Die Hände werden mit einem Druck nach außen zum Brustkorb geführt. Nun kehrt man kreisförmig wieder zur Wirbelsäule zurück, ohne dass man einen stärkeren Druck ausübt. Die Kreise bewegen sich langsam in Richtung Steiß. Die Ausatmung erfolgt, wenn der Druck links und rechts der Wirbelsäule durchgeführt wird, die Einatmung erfolgt beim Schließen des Kreises ohne Druck der Hände. Durchführung der Beruhigenden Ganzkörperwaschung (GKW): Die Wassertemperatur soll zwischen 37-40°C liegen. Man benötigt keine Badezusätze. Der Patient soll entspannt liegen. Er wird nicht aktiv miteinbezogen. Mit den Händen beginnt der Wasserkontakt. Begonnen wird das Waschen vom Thorax aus. Das Gesicht ist für alle Menschen ein sensibler Bereich. Eine Initialberührung im Gesicht kann zu Entspannung führen, aber auch das Gegenteil bewirken. Deshalb sollte man sich dieser Körperregionen sinnvollerweise nur langsam annähern. Die Hände des Pflegenden sollen sich dem Körper des Patienten anpassen. Eine Hand hält ständig Körperkontakt, während die andere zu dem Körperteil wechselt, der als Nächster gewaschen wird. Die andere Hand folgt ihr. Der Patient soll sich auf die Waschung einlassen können. Die einzelnen Körperteile sollen abwechselnd mit ruhigem und klarem Druck gewaschen werden. Zum Schluss erfolgt die Gesichtswäsche von der Stirn bis zum Kinn. Der Patient soll die Augen dabei geschlossen haben. Diese Bewegung übermittelt außerordentlich viel Ruhe und ist den meisten Menschen von Kindheit vertraut. Die beruhigende Bewegung wirkt tröstend und leitet den Schlaf ein. Abgetrocknet wird ebenfalls in der Haarwuchsrichtung.111 111 Vgl. Bienstein, Christel; Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation in der Pflege: Die Grundlagen, Bern 2010, S. 148f. 105 LITERATURVERZEICHNIS - Bernatzky, Günther; Likar, Rudolf: Schmerzbehandlung in der Palliativmedizin, 2. Auf., Wien 2006. - Bienstein, Christel; Fröhlich, Andreas: Basale Stimulation in der Pflege: Die Grundlagen, Bern 2010. - Buchholz, Thomas; Schürenberg, Stefan: Basale Stimulation in der Pflege alter Menschen: Anregungen zur Lebensbegleitung, Bern 2000. - Bühlmann, Josi: Angst, in Käppelli Silvia: Pflegekonzepte. Phänomene im Erleben von Krankheit und Umfeld, Bern 2004. - Carrol, BT; Kathol, RG, u.a: Screening for depression and anxiety in cancer patients using Hospital Anxiety and Depression Scale, Gen Hosp Psychiatry 1993 15 (2) S. 69-74, in Lehenbauer Silvia: Angst und Depression bei Tumorpatienten, Dissertation, Berlin 2008. - CliniCum, neuropsy. Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, KonsensusStatement- State of the art 2009, Sonderausgabe, September 2009. - dr-elze.de/beck-angst-inventar-bai.html (25.01.2012) - Erni, Margrit: Zwischen Angst und Sicherheit. Düsseldorf 1989. - Flöttmann, Holger Bertrand: Angst/Ursprung und Überwindung. Stuttgart 1993. - Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie. 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002. - Geisler, Linus: Kommunikation in der Palliativmedizin, in H. Hoefert: Kommunikation als Erfolgsfaktor im Krankenhaus, Heidelberg 2008. - Geisler, Linus: Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch, Frankfurt a.M. 1992. - Gesine Baur, Eva; Schmid-Bode, Wilhelm: Wie der Tod keine Angst macht, Hamburg 2005. - Häcker, Hartmut; Stapf, Karl Heinz: Dorsch Psychologisches Wörterbuch, Bern 1994. 106 - Hermann-Lingen, Christoph: International Experience with the Hospital Anxiety and Depression Scale: a Review of Validation Data and clinical results Journal of Psychosomatic Research, 42. - Hermann-Lingen, Christoph; Buss, Ulrich, u.a: HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale Deutsche Version, Göttingen 2011. - Hill, Susanne: Aromatherapie, Berlin 2011, S. 255. - http://dk.akis.at/klin.interviews.html (06.02.2012) - http:// www.linus-geisler.de/ap/ap14_angst.htm (04.01.2012) - http://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus (30.12.2011) - http://de.wikipedia.org/wiki/Angst (09.03.2012) - http://de.wikipedia.org/wiki/GAD-7 (26.01.2012) - http://www.angst.hexal.de/angst/behandlung/medikamente.php (02.02.2012) - http://www.i-med.ac.at/medpsy/patienten/angst.html (09.03.2012) - http://www.neuro24.de/psychopharmaka.htm (03.02.2012) - http://www.teachsam.de/psy/psy_per/abwehrmech/abwehr_1htm (30.12.2011) - http://www.teachsam.de/psy/psy_per/psy_pers_freud/psy_pers_freud_5.htm (30.12.2011) - http://www.uke.de/kliniken/hno/downloads/klinik.-hno/12-Menhert_oechsle.pdf (25.01.2012) - Kast, Verena: Vom Sinn der Angst, Wie Ängste sich festsetzen und wie sie sich verwandeln lassen, Freiburg 2001. - Keller, Andrea: Die Klassifikation psychischer Störungen nach DSM-IV mit Hilfe eines strukturierten diagnostischen Interviews (F-DIPS), InauguralDissertation im Fach Psychologie zur Erlangung der Doktorwürde, Dresden 2000. - Kübler-Ross, Elisabeth: Interviews mit Sterbenden, München 2001. - Kübler-Ross, Elisabeth: Verstehen was Sterbende sagen wollen, Einführung in ihre symbolische Sprache, München 1981. - Kutzner, Marion: Basale Stimulation, Berlin 2011. - Levitt, Eugene: Die Psychologie der Angst, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1987. 107 - Marx, Rudolf: Angststörungen - eine Einführung, in Wolfgang Beiglböck: Handbuch der klinisch-psychologischen Behandlung, Wien 2006. - Mayer, Hanna: Pflegeforschung kennenlernen, Elemente und Basiswissen für die Grundausbildung, Wien 2007. - Perrar, Klaus Maria; Sirsch, Erika; Kutschke, Andreas: Gerontopsychiatrie für Pflegeberufe, Stuttgart 2007. - Ratsak, Gerda: Angst und Angstbewältigung, in Eberhart Aulbert, u.a: Lehrbuch der Palliativmedizin, Stuttgart 2011. - Rolf, Stecker: Psychoonkologische Palliativtherapie im Akutkrankenhaus, Psychotherapie-Wissenschaft, Jahrgang 1, Heft 3, 2011. - Schwarzer, Ralf: Stress, Angst und Hilflosigkeit. Stuttgart/Berlin/Köln 1981. - Specht-Tomann, Monika: Zeit des Abschieds. Sterbe- und Trauerbegleitung, Ostfildern 2010. - Speidel, Hubert: Angst in der Palliativmedizin, in Georg Thieme: Zeitschrift für Palliativmedizin, Jahrgang 2007, Heft 8. - Speidel, Hubert: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Vortrag auf dem 6. Kongress am 22. September 2006, [email protected]. - Stark, D; Kiely, M, u.a: Anxiety disorders in cancer patients: their nature, association and relation to quality of life, Journal of Oncologie 2002, 3137 -3148, in Silvia Lehenbauer: Angst und Depression bei Tumorpatienten, Dissertation, Berlin 2008. - Thich Nhat, Hanh: Das Glück einen Baum zu umarmen, 4. Aufl., München 1997. - www.angst-und-panik.de/angst.../die-amygdala/index.html - www.diss.fu-berlin.de/.../Dissertation_SilviaLehenbauerDehm.pdf. (18.04.2012) 108 BILDERVERZEICHNIS - Titelbild: Gerd Weber: Angst, 1985, siehe: http://www.webbs-online.de/seiten/ oelmalerei.html (05.06.2012) - Abb.1: http://www.psycheducation.org/emotion/amygdala.htm (09.03.2012) - Abb. 2: http://www.astropage.eu/index_news.php?id=587 (09.03.2012) - Abb.3: Bernatzky, Günther; Likar, Rudolf: Schmerzbehandlung in derPalliativmedizin, 2. Aufl., Wien 2006, S. 204. - Abb.4: Ruch, Philip; Zimbardo, Floyd: Lehrbuch der Psychologie. Berlin/ Heidelberg 1974, S. 366. - Abb. 5 : Gastpar, Markus; Kasper, Siegfried; Linden, Michael: Psychiatrie und Psychotherapie, 2., vollständig überarbeitete Aufl., Wien 2002, S. 172. - Abb.6: CliniCum, neuropsy, Angsstörungen, Medikamentöse Therapie, Konsensus- Statement- State of the art 2009, Sonderausgabe September 2009, S. 7. - Abb. 7: Kursana Residenz, Wien-Tivoli: Wohlriechende Öle als Unterstützung in der Pflege, 2012. - Abb. 8: Nydahl, Peter; Bartoszek, Gabriele: Basale Stimulation, Wiesbaden 1998. - Abb. 9: Nydahl, Peter; Bartoszek, Gabriele: Basale Stimulation, Wiesbaden 1998.