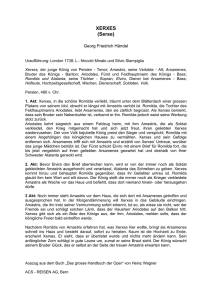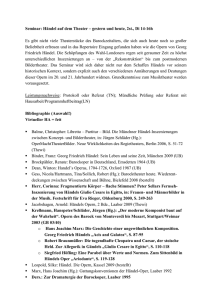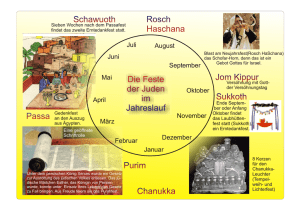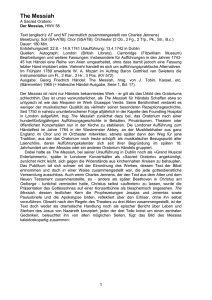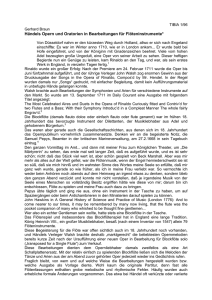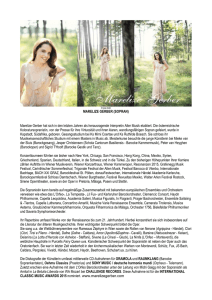XERXES - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Werbung

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden XERXES Georg Friedrich Händel Georg Friedrich Händel Xerxes Oper in drei Akten nach einem Libretto von Niccolò Minato und Silvio Stampiglia. Deutsche Übersetzung von Eberhard Schmidt Koproduktion der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, des Staatsschauspiels Dresden und der Hochschule für Bildende Künste Dresden im Rahmen der Feierlichkeiten des 250-jährigen Bestehens der HfBK Dresden Musikalische Leitung Franz Brochhagen Inszenierung Jasmin Solfaghari Bühne/Kostüme Maira Bieler1 und Romina Kaap1 Regieassistenz Studienleitung Choreinstudierung Chorassistenz Choreographische Mitarbeit Inspizienz Susanne Hardt Alexandre Balzamo Elena Beer Sunyoung Jin Katja Erfurth Tobias Mäthger, Michael Käppler Bühnenbildassistenz Ariane Stamatescu1 Kostümassistenz Mara Scheibinger1 Musikalische Assistenz Alexandre Balzamo, Andrea Barizza, Beatrice Carraro, Wolfgang Drescher, Ioanna Ismyridi, Yosuke Osada Mentor: Prof. Franz Brochhagen Theatermaler Friederike Brück, Frederike Deharde, Laura Heider, Anika Hilbert, Kathrin Kobinger, Theresa Thomann, alle Studiengang Theatermalerei der HfBK, Mentoren: Prof. Michael Münch, Tom Böhm Theaterplastik Ruth Adams, Alina Illgen, Hanna Kriegleder, Kathrin Müller, Martin Rudelt, Liesbeth-Marie Rülke alle Studiengang Theaterplastik der HfBK, Mentor: Prof. Ulrich Eißner Maske Julika Leiendecker, Sarah Poser, Carolina Schorr, Annika Titzmann, Lydia Zänisch alle Studiengang Maskenbild der HfBK, Mentorin: Kerstin Scholz Herstellung der Kostüme Janina Fischer, Sebastian Helminger, Anne-Sophie Lohmann, Anna Lutz, Mareike Müller, Gunda Noseleit, Nora Scheve, Olga Schulz alle Studiengang Kostümgestaltung der HfBK Mentorin: Prof. Gabriele Schoß-Jansen Kostümatelier MEDINA/Beate Ficker Herstellung der Dekoration Werkstätten der Sächsischen Staatsoper Dresden/ Staatsschauspiel Dresden 2 Gesamtleitung Technik Produktionsleitung Theatermeister Beleuchtungsmeister/Licht Beleuchtung Ton Requisite Pyrotechnik Konstruktion Bodo Garske2 Magnus Freudling2 Jens Kelm2 Rolf Pazek 2 Carola Dregely2 Uwe Lahmann2, Ulrich Berg2 Heike Jordan2, Heike Böhme2, Ramon Stage2 Ramon Stage2 Daniel Wolski2 Aufführungsrechte Bärenreiter-Verlag, Kassel Besetzung Xerxes, König von Persien Romilda, Tochter des Ariodates Atalanta, Tochter des Ariodates Amastris, Braut des Xerxes Arsamenes, Bruder des Xerxes Ariodates, Feldhauptmann des Xerxes Elviro, Diener des Arsamenes Patricia Osei-Kofi, Eva Schuster a. G.3 Maria König, Natalia Rubis4 Marie Hänsel, Teresa Suschke Leandra Johne, Monika Zens Eszter Forgò, Sungwhan Sa Pawel Kolodziej4, Felix Schwandtke Philipp Schreyer, Carl Thiemt Doppelbesetzung in alphabetischer Reihenfolge Bitte beachten Sie die Tagesaushänge im Theaterfoyer. Continuo Alexandre Balzamo/Yosuke Osada Cembalo Tabea Brode Theorbe/Barockgitarre Sophia Dimitrow/Lisa Rößeler Violoncello 3 4 Erasmus-Studierende 2 Staatsschauspiel Dresden 1 HfBK Dresden Pause nach ca. 90 Minuten 3 Hochschule für Musik und Theater Leipzig Chor der Studienrichtung Gesang Hochschulsinfonieorchester Handlung 1. Akt Der Perserkönig Xerxes hat seine Verlobte und Königstochter Amastris verlassen und bereitet sich auf seinen Feldzug gegen die Griechen vor. Bevor diese Aktion durchgeführt wird, sucht Xerxes Ruhe in der Natur und findet sie bei einer Platane (im alten Orient ein heiliger Baum). Die Stimme von Romilda, Tochter seines Feldherrn Ariodates, erweckt seine Aufmerksamkeit und Leidenschaft, ohne dass er auch nur ahnt, dass sie die Geliebte seines Bruders Arsamenes ist. Dieser ist mit seinem Diener Elviro angereist und bereits auf der Suche nach Romilda, streitet jedoch dem Bruder gegenüber ab, sie auch nur zu kennen. Arsamenes Lüge fliegt auf, Xerxes verjagt seinen Bruder und macht der Schönen selbst einen Heiratsantrag. Romilda bleibt aber den Avancen des Königs gegenüber standhaft. Atalanta taucht auf. Sie ist Romildas unliebsame Schwester, die ihr Arsamenes gezielt ausspannen möchte. Unterdessen hat sich Xerxesʼ eigentliche Verlobte Amastris als Soldat getarnt, um Xerxes nah zu sein. Soldatenchor. Dem verdienstvollen Feldherren Ariodates verspricht Xerxes einen Mann „aus dem Stamm wie Xerxes“ als Gatten seiner Tochter Romilda. Ariodates fühlt sich geehrt. Arsamenes möchte den Kontakt zu Romilda nicht verlieren und gibt Elviro den Auftrag, einen Brief an sie zu überbringen. Atalanta entschließt sich dazu, mit ihren Verführungskünsten ab jetzt in die Vollen zu gehen. 2. Akt Elviro verkauft vermeintlich Blumen, in der Hoffnung, so unerkannt Romilda den Brief zuzustecken. Gegenüber Amastris (Soldat) verplappert er sich und berichtet von Xerxesʼ Heiratsplänen mit Romilda und ihrer Verbindung zu Arsamenes. Atalanta schafft es, Elviro das Briefchen abzuluchsen, im vorgetäuschten Versprechen, es an ihre Schwester weiterzugeben. Nun beginnt Atalantas Intrige: vor Xerxes behauptet sie, der Brief sei an sie selbst. Xerxes spielt das Spiel mit und konfrontiert Romilda mit der vermeintlichen Untreue von Arsamenes. Romilda hält dennoch treu zu ihrem Geliebten. Zweiter Soldatenchor. Unterdessen hat der König eine Brücke über die Meerenge bauen lassen, die Asien mit Europa verbindet (Hellespont) und begutachtet das Ereignis mit seiner Truppe. Dort trifft er auf seinen Bruder Arsamenes. Xerxes gibt sich zahm, da er ja annimmt, sein Bruder liebe Atalanta. Dieser Irrtum klärt sich auf. Elviro hat seinen Herrn verloren, versteht die Welt nicht mehr und entdeckt seine Liebe für den Weingott Bacchus. Xerxes will nun rasch Romilda heiraten, das vereitelt Amastris, die sie vor dem König warnt. Romilda rettet den vermeintlichen Soldaten vor Xerxesʼ Strafe und sieht die Liebe als treibende Kraft in ihrem Leben. 4 3. Akt Arsamenes und Romilda konfrontieren Atalanta mit ihrer Lüge und versöhnen sich. Feldherr Ariodates geht davon aus, dass Xerxes Arsamenes für Romilda ausgesucht hat, da ein König nur eine Frau aus königlichem Geschlecht heiraten kann, und ist mit der Hochzeit einverstanden. Xerxes will nun die Heirat mit Romilda endgültig erzwingen. Sie gesteht dem König einen Kuss mit Arsamenes, woraufhin Xerxes seinen Bruder töten lassen will. Nun ist Romilda bereit eher Xerxes zu heiraten, als den Tod ihres Geliebten in Kauf zu nehmen. Amastris quält sich in ihrer Abhängigkeit von Xerxes. Sie will um ihre Liebe kämpfen und verfasst ein Schreiben an den König. Priesterchor. Ariodates vermählt Romilda und Arsamenes ohne das Wissen des Königs. Xerxes erhält einen Brief, den er von Ariodates vorlesen lässt, da er annimmt, er sei von Romilda. Es stellt sich jedoch Amastris als Verfasserin heraus. Xerxes ist zutiefst verstört. Amastris gibt sich zu erkennen und droht, Xerxes und sich selbst zu töten. Der König bereut, Amastris erzwingt Xerxesʼ Zuneigung, Romilda und Arsamenes sind glücklich, Elviro versteht die Welt nicht mehr und Atalanta will sich einen neuen Mann suchen – woanders. Zusammenfassung: Jasmin Solfaghari 5 Georg Friedrich Händel – Bilder seiner Zeit Abb. 1: Georg Friedrich Händel Georg Friedrich Händel (geb. 1685 in Halle, gest. 1759 in London) wurde als Sohn eines bedeutenden Hofchirurgen geboren. Seine frühere Zuneigung zur Musik soll anfänglich von seinem Vater nicht gebilligt worden sein, der für ihn wohl eine juristische Laufbahn vorgesehen hatte. Dies habe sich nach einem schicksalhaften Besuch beim Herzog von Sachsen-Weißenfels geändert. Nachdem er Händels Orgelspiel bewunderte, konnte der Herzog die Bedenken des Vaters teilweise zerstreuen. Händels erste musikalische Ausbildung fand in Halle statt. Sein Lehrer Friedrich Wilhelm Zachow bereitete ihn hauptsächlich auf eine kirchenmusikalische Laufbahn vor. Die Oper lernte Händel zuerst von dem vier Jahre älteren Georg Philipp Telemann kennen, der im nahen Leipzig sein Jurastudium absolvierte und ab 1703 in Hamburg, wo er eine wechselhafte Bekanntschaft mit Johann Mattheson machte (Mattheson behauptet einerseits Händel die Tür zur Oper geöffnet zu haben und erzählt andererseits, dass er Händel beinah im Duell erschlagen hätte). 1706 reiste Händel vier Jahre durch Italien, wo er an den wichtigen Höfen Station machte und in Rom u. a. dem großen italienischen Meister Arcangelo Corelli begegnete. 1710 reiste Händel nach London, wo er sich vor allem dem Ausbau der Opera seria (dramma per musica) und später der Komposition von Oratorien widmete. Während Händel für seine großen Orchesterwerke (etwa Music for the Royal Fireworks oder Water Music) und vor allem für sein Oratorium The Messiah im allgemeinen Bewusstsein präsent ist, rückt langsam aber stetig seine große Leidenschaft wieder in den Fokus des gegenwärtigen musikalischen Repertoires – seine Opern. 6 Abb. 2: London: The South East Prospect of Westminster Bridge (Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, 1747) London war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Metropolen der Welt. Die englische Marine dominierte weite Strecken der Weltmeere, und die dadurch gesicherten Handelsrouten erlaubten einen regen Handel mit seinen Handelspartnern und Kolonien, was zu immer größerem Reichtum des Inselvolkes beitrug. Im Zuge dieses Wohlstandes entstand eine florierende Kulturlandschaft: Schon im ausgehenden 17. Jahrhundert erscheinen John Lockes A Treatise on Human Understanding und Second Treatise on Civil Gouvernment (beides 1690), die als Vorreiter der Aufklärung angesehen werden, 1719 erscheint Daniel Defoes Robinson Crusoe, der als erster realistischer Roman der Weltliteratur gilt, 1728 wird John Gays und Johann Christoph Pepuschs ballad opera The Beggars Opera uraufgeführt, und 1739 wird der Grundstein zur neuen Westminster Bridge nach Plänen von Charles Labelye gelegt. In dieses lebendige und inspirierende Umfeld tauchte der damals 25-jährige Händel im Jahre 1710 ein. Schon im Februar 1711 feierte er mit Rinaldo im Queen’s Theatre (später King’s Theatre) seine erste erfolgreiche Londoner Opernerstaufführung. 7 Abb. 3: The King‘s Theatre (William Capon, 1783) Ursprünglich im Jahre 1705 als Queen’s Theatre eröffnet, wurde das Theater am Haymarket in London im Jahre 1714 bei der Thronbesteigung Georg I. in The King’s Theatre umbenannt. Hier begann Händels Karriere als Opernkomponist in London mit der Uraufführung seiner Oper Rinaldo. Zwischen 1719 und 1728 agierte Händel im King’s Theatre als musikalischer Direktor der Royal Academy of Music (auch als erste Opernakademie bekannt) und gründete nach deren Auflösung eine zweite, die für weitere fünf Jahre das King’s Theatre mietete. 1733 entstand ein zweites konkurrierendes Opernunternehmen, die Adelsoper, die zuerst im Lincoln Fields Inn Theatre spielte (mit dem berühmten Sänger-Kastraten Farinelli als Aushängeschild) und ab 1734 das King‘s Theatre übernahm. Händel zog daraufhin mit seiner nun dritten Opernakademie in das Covent Garden Theatre um. Nach Zusammenbruch der beiden Opernunternehmen kehrte Händel erst 1738 mit den Uraufführungen seiner Opern Faramondo und Xerxes in das King’s Theatre zurück. 8 Abb. 4: Kurpark Burtscheid (F. J. Jansen, 1796) Nach einem Zusammenbruch im April des Jahres 1737, der als „Paraletick Disorder“ diagnostiziert wurde, musste sich Händel für sechs Wochen einem Kuraufenthalt in Burtscheid bei Aachen unterziehen. Die genauen Ursachen für diesen Zusammenbruch sind in der medizinischen Forschung nicht restlos geklärt, die Symptome sollen allerdings ähnlich wie ein Schlaganfall gewesen sein. Unmittelbar nach seiner Genesung begann er die Arbeit an den Opern Faramondo und Xerxes. 9 Abb. 5: Die Auspeitschung des Meeres (Darstellung um 1909) Xerxes I., König von Persien (519–465 v. Chr.), regierte das persische Reich von 486–465 v. Chr. Einer von Herodot überlieferten Anekdote zur Folge habe Xerxes tatsächlich das Meer auspeitschen lassen, nachdem ein Sturm eine von ihm erbaute Brücke über die Dardanellen zerstört hat. Herodot berichtet auch über eine Platane, die vom König verehrt wurde, was später als Beispiel für königlichen Frevel angeführt worden ist. Zudem berichtet Herodot von Xerxes‘ Zuneigung zur Frau seines Bruders. Ansonsten dürften die Hofintrigen der Oper Xerxes frei erfunden sein. 10 Abb. 6: Autograph der Ouvertüre zu „Xerxes“ (Quelle: SLUB Dresden) Händel komponierte die Oper Xerxes zwischen dem 26. Dezember 1737 und dem 6. Februar 1738. Xerxes gehört somit zu seinen letzten Opern und zeugt von der kompositorischen Reife des damals schon in ganz Europa berühmten Komponisten. Das Libretto basiert auf Vorlagen von Nicolò Minato und Silvio Stampiglia. Eine musikalische Vorlage Giovanni Battista Bononcinis diente Händel als Orientierung (Bononcini setzte Stampiglias Libretto 1694 in Musik). Nicht nur die überraschende erste Arie des Xerxes („Ombra mai fù“) gilt als dramatische Erneuerung in der Opernkomposition, sondern auch der weitgehende Verzicht auf Da-capo-Formen bei den Arien (die Wiederaufnahme des ersten Teils nach einem kontrastierenden zweiten Teil) und der schnelle Wechsel zwischen kurzen Rezitativen und Arien bzw. Ariosi. Somit gewinnt der Verlauf der Oper an „Tempo“, und es entstehen plastische Übergänge zwischen dem Instrumentalen, dem Rezitativischen und den zum Teil auch handlungstragenden Arien. Seine empfindsame Handhabung der Affekte und tonkünstlerisch vielschichtige Charakterisierungen ebnen den Weg zu den Opern Glucks und Mozarts. 11 Abb. 7: Gaetano Majorano, genannt „Caffarelli“ (1710–1783) Gaetano Majorano war einer der berühmtesten Kastraten des 18. Jahrhunderts. In Bitonto 1710 geboren, besuchte er mit zehn Jahren das Konservatorium in Neapel. Im Rom des Jahres 1726 begann seine brillante Karriere als Opernsänger; Händel engagierte ihn für die Aufführungen von Xerxes und Faramondo im Jahre 1738. Der Überlieferung nach soll es zu heftigen Streitigkeiten zwischen dem großen italienischen Star-Sänger und dem „deutschen“ Komponisten gekommen sein, unter anderem weil Caffarelli mit der Eingangsarie von Xerxes nicht einverstanden war. Nach Meinung Caffarellis wäre sein erster Auftritt viel zu früh im Drama platziert und würde wegen seiner schlichten Gesangsführung seine sängerischen Künste nicht genügend zur Geltung bringen. Die ersten Aufführungen der Oper Xerxes dürfte mit ihrem bescheidenen Erfolg Caffarelli zuerst recht gegeben haben – die Arie „Ombra mai fu“ avancierte aber im Laufe der Musikgeschichte zu einer der berühmtesten Arien aller Zeiten. Bilder zusammengestellt von John Leigh 12 Im Schatten der Platane – Ein Interview mit der Regisseurin Jasmin Solfaghari zu Händels Oper „Xerxes“ Der folgende Beitrag ist ein Ausschnitt aus einem Werkstattgespräch, das im Rahmen der Ringvorlesung „Händels Oper Xerxes“ an der Hochschule für Musik im Januar 2014 stattfand. Die Gesprächspartnerin Jasmin Solfaghari wird mit den Initialen JS, der Moderator John Leigh mit JL abgekürzt. JL: Wie läuft eigentlich eine Opernproduktion ab? Wer bringt z. B. den Vorschlag für eine Produktion in die Diskussion ein, was sind dann die Arbeitsschritte? Wie verläuft die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Institutionen (Regie, musikalische Leitung, Bühnenbild/Kostüme …)? JS: Größtenteils wird man als freier Regisseur direkt angefragt, ob man dieses oder jenes Stück machen möchte. Wenn der Auftraggeber selbst noch schwankt, kann man Vorschläge machen. Das ist natürlich als festangestellter Regisseur an einem Theater, z. B. als Oberspielleiter anders. Wir Regisseure schlagen meist das Ausstattungsteam vor, das Haus meist den Dirigenten und dann beginnt die Stückanalyse und die gemeinsame Konzeptionsfindung. Das findet normalerweise mindestens ein Jahr vor dem Premierentermin statt. Es folgen gemeinsame Meetings, das Sinnieren jedes Einzelnen, bis man alle Ideen in ein Konzept zusammenfügt. Circa ein halbes Jahr vor Probenbeginn gibt es eine Bauprobe, bei der man das Bühnenbild aus Versatzstücken schon einmal in der Originalproportion auf der Bühne nach Vorbild des Bühnenbildmodells aufbaut, das spart im Ernstfall viel Geld. Anschließend gehen die Kostümentwürfe in die Werkstätten. Das alles zusammen (dazu mit Maske und Licht) sehen wir erst bei der Klavierhauptprobe, meist wenige Tage vor der Premiere. Nicht gerade viel Zeit für so viele Parameter einer Aufführung, und nicht selten für eine Überraschung gut! JL: Wie würden Sie Ihre Regieästhetik charakterisieren? JS: Das lässt sich über einen selbst schwer beantworten. Vielleicht eines: mir ist nicht daran gelegen, jedem Stück dieselbe optische Ästhetik zu verpassen. Jede Musik, Epoche, Struktur des Werks braucht nach meiner Meinung eine individuelle Findung. Von daher versuche ich den Besonderheiten des Stücks nachzugehen und dem Publikum eine Umsetzung dessen anzubieten. Aus diesem Grund habe ich auch immer mit verschiedenen Ausstattern zusammen gearbeitet. JL: Wie sehen Sie im Allgemeinen und speziell bei der Oper Xerxes die Beziehung zwischen Text, Bild, Musik und Dramaturgie in einer Opernproduktion? Gibt es bei Ihnen eine besondere Gewichtung, oder für Ihre Regieästhetik besondere Verhältnisse? JS: Den Ausstatterinnen Romina Kaap und Maira Bieler und mir gefiel die Auseinandersetzung mit persischen Miniaturen mit ihren Details und die mögliche Übertragung auf einzelne Bildelemente an unserem Abend. Das Stück fokussiert ja sehr die zwischen13 menschliche Komponente. Ein Herrscher, der gegen die Griechen gewinnen will, aber zugleich oder am besten vorher noch Romildas Herz erobern möchte. Die Verwicklungen, Lügen und Verwechslungen sind teils komisch, teils poetisch angelegt, außerdem tritt Militär auf. Wir brauchten bei der Bildfindung einen Grundraum, der die Massivität einer Festung und zugleich „luftige“ Elemente ausstrahlt, die das Spielerische im Stück räumlich ermöglichen. Muster und Farben haben auch eine große Wichtigkeit für uns, um eine persische Atmosphäre zaubern zu können. JL: Wie viel von einer Charakterdarstellung steht bei Ihnen vor dem Probenanfang fest? Ändert sich diese Vorstellung nach der Probenarbeit mit den Sängern/Schauspielern? Gibt es hier Unterschiede bei einer Hochschulproduktion – vielleicht etwas wie ein „pädagogischer Auftrag“? JS: Durch das Stück sind ja viele Charakterzüge der Rollen vorgezeichnet und die Musik bekräftigt sie ebenfalls oder zeigt eine eigene Haltung dazu. Diese Voraussetzungen vermischen sich mit meiner eigenen Interpretation des Werks. Nach dem Vorsingen weiß man, wer die Rollen auch in der Doppelbesetzung verkörpern wird und das habe ich bei der Konzeption der Figuren auch immer ein wenig im Kopf. Wenn die szenischen Proben beginnen, steht der spannende Prozess an, diese Vorstellungen in Realität zu verwandeln. Dabei gibt es meist viele Überraschungen, weil man sich bei der Arbeit näher kennenlernt. Natürlich ist man als Regisseur zwar gefordert seinen Überzeugungen zu folgen, aber den Sänger mit seinen Möglichkeiten und Fragen auch ernst zu nehmen. In unserem Fall Xerxes kenne ich zahlreiche Studierende bereits aus meinem Jahr des dramatischen Unterrichts, was die Sache enorm erleichtert. Natürlich muss es an einer Hochschule einen pädagogischen Auftrag geben, allerdings weniger aus interpretatorischer, sondern mehr aus handwerklicher Sicht. Bei solch einer Produktion gilt es für die jungen Sänger das szenische Handwerk zu erlernen und/oder zu verfeinern, Nerven werden anders belastet als bei einem Szenenabend im kleinen Raum und die Kombination aus Regie, Kostüm, Maske, Orchester, Licht, Dirigat, Publikum und einer abendfüllenden Rolle fordert den jungen Sängern viel ab. Da ist viel Unterstützung gefragt. Meine Vorgehensweise bei den Proben ist allerdings in der Hochschule sowie an den Theatern draußen die gleiche. JL: In einer von der Romantik beherrschten Opernwelt (mit Ausnahme der Opern Mozarts) ist die Aufführung einer barocken Oper immer noch etwas besonderes. Stellt die Barockoper im Allgemeinen und die von Händel insbesondere andere Herausforderungen an die Regie als neuere Opern? JS: Das ist sicher richtig. Gerade wurde ja wieder einmal sehr erfolgreich zum Beispiel bei den Händelfestspielen in Karlsruhe mit barocker Gestik gearbeitet, wie andernorts auch. Mir persönlich fehlt – bei allem Charme dieser Aufführungen – die heutige Erkennbarkeit der Charaktere. Bei einer realistischeren Spielweise ist der junge Sänger darstellerisch etwas „näher dran“ und nicht sehr in den Bewegungsmustern eingeengt. In unserer Aufführung 14 gibt es keine Verlegung in eine bestimmte Zeit, so dass wir eine eigene Theaterrealität schaffen, in der wir die Konflikte darstellen. JL: Xerxes finde ich für eine Opera seria (Dramma per musica) etwas besonderes. Nicht nur Elviros und zu einem gewissen Grad auch Atalantas Rollen sind eher im komischen Bereich angesiedelt, sondern es wurde auch in der Vergangenheit vieles vom dramatischen Ablauf insgesamt in einer Grauzone zwischen Komödie und ernstem Drama inszeniert. Wie „ernst“ und wie „komisch“ ist für Sie Händels Oper Xerxes? JS: Die Oper Xerxes ist immer da ernst, wo es um ehrliche Gefühle geht. Bei unserem Hauptdarsteller wird aus Ernst manchmal Komik, wenn er cholerische Anfälle bekommt, absurde Forderungen stellt, despotisch ohne Rücksicht auf Verluste agiert. Er ist seinen Emotionen komplett ausgeliefert und hat sich nicht wirklich immer im Griff. Insofern verstehe ich das Bild der Grauzone sehr gut. Seine Unberechenbarkeit macht ihn auch gefährlich. Die komischen Figuren Elviro und Atalanta sind klar gezeichnet. Elviro ist mental einfach gestrickt, der gute Mensch und macht uns deshalb Freude. Atalanta intrigiert und strotzt vor Selbstbewusstsein und wirkt dadurch überzogen. Beide können dennoch viele charakterliche Farben entwickeln. Die Vielfalt der Begegnungen, die auch jederzeit kippen können (der als Soldat getarnte Amastris) lassen immer Tragik und Komik fast gleichermaßen zu und sind auszuloten. JL: Von unserem Standpunkt aus gesehen bietet Xerxes eine Verflechtung kultureller Momente: Die Oper spielt in Persien etwa im Jahr 500 vor Christus, und handelt von der historischen Person Xerxes I., König von Persien. Die Handlung wird mit ihrer typischen „Komödie der Irrungen“ aber der europäischen barocken Opernpraxis angepasst. Diese Anpassung an die damals gängige Praxis erfolgt aber so, dass bei der Figur des Königs wenig Heldenhaftes übrigbleibt (im Sinne einer Helden-Saga). Schließlich geht es in Xerxes auch um die ewige Frage von Mann und Frau, Macht und Liebe. Wie gehen Sie als Regisseurin mit diesen unterschiedlichen Kontexten um? Inwieweit bleibt Xerxes für Sie historisch und inwieweit gibt es dort für Sie auch Momente der Aktualisierung? JS: Zunächst einmal – ob historischer Held oder nicht – ist Xerxes zwar ein mächtiger Herrscher, wir erleben ihn jedoch als ganz normalen Mann, der die schöne Romilda einfach haben will, ungeachtet der Tatsache, dass er mit der Königstochter Amastris bereits verbunden ist. Romilda ist die Geliebte seines Bruders Arsamenes, was Xerxes vor Beginn der Oper noch nicht weiß. Es handelt sich hier oft um ein psychologisches Kammerspiel, deshalb steht bei mir die historische Figur tatsächlich nicht wirklich im Vordergrund. Xerxesʼ sprunghafte Emotionen müssen wir fassen und widerspiegeln. Die Tatsache, dass Männer mit Geld und Einfluss gewohnt sind, schöne Frauen leichter zu bekommen als andere, ist ein internationales und epochenübergreifendes Phänomen, ob man das gut findet oder nicht. Romilda ist im Stück – Gott sei Dank – eine Frau mit Rückgrat, die ihre konträre Meinung dem Herrscher gegenüber frei äußert – auch wenn sie sich im 3. Akt fast zur Hochzeit mit 15 ihm bereit erklärt, um Arsamenesʼ Leben zu retten. Das macht das Ganze für mich natürlich spannend. Für mich ist Persien als Spielort dennoch sehr wichtig, da mich persönlich durch meine ersten sechs Lebensjahre mit dem Iran sehr viel verbindet. Ich empfinde an der Figur Xerxes als sehr „persisch“, wie er sich gegenüber Romilda öffnet und zu seinen Emotionen steht. Und natürlich lernt der Held in unserem Stück, dass seine Zeit, sich als solcher künstlich aufzuführen, vielleicht auch ein Stück weit vorbei ist. JL: Es wird viel gesprochen und geschrieben über den Charakter von Xerxes und Romilda. Wie sehen Sie eigentlich den Charakter Arsemenes? Mir scheint seine Rolle besonders spannend zu sein, denn, erdrückt von seiner Stelle als zweiter Mann im Staat und allen Umständen, die hieraus resultieren, agiert er zwischen den Höhen der Liebe zu Romilda und den Abgründen des Exils. JS: Schauen Sie, die Frage ist ja auch: Was findet Romilda an Arsamenes? Die Gefahr, dass Arsamenes als männliche Figur und eigentlich Kontrahent zu sehr in die Passivität abrutscht, ist groß. Vielleicht ist er einfach der Diplomat, der sich im Unterschied zu seinem Bruder nicht wie ein verwöhnter Königssohn aufführt? Vielleicht ist Romildas Wahl deshalb eindeutig auf ihn gefallen? Ist er ihr nach dem Erlebnis mit der Leidenschaft von Xerxes fremder geworden? Wir machen uns auf den Weg, um das alles herauszufinden. JL: Ich bedanke mich für das Gespräch. Jasmin Solfaghari ist Regisseurin für die Produktion von Händels „Xerxes“ an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Im Studienjahr 2012/13 hatte sie einen Lehrauftrag für Dramatischen Unterricht in der Opernklasse der Hochschule. Zu ihren zahlreichen und vielfältigen Opernproduktionen (die von Claudio Monteverdi bis Hans Werner Henze reichen) zählen eine Inszenierung von Händels „Xerxes“ (Volkstheater Rostock, 1992) und seine „Alcina“ (Hochschule für Musik und Theater Leipzig, 2006). 16 Was ist „Historisch informierte Aufführungspraxis“? Franz Brochhagen Seit Beginn des Wintersemesters 2013/14 erarbeiten Studierende der Dirigier- und Korrepetitionsklasse mit den Solistinnen und Solisten unserer nächsten Hochschulproduktion die Gesangspartien im Rahmen des Gruppenunterrichtes „Musikalische Einstudierung Projekte“. Nähere Absprachen mit der Regisseurin Jasmin Solfaghari, beziehen sich zunächst nur auf die Strichfassung und auf textliche Anpassungen in den deutsch gesungenen Rezitativen. Welche Probleme müssen während der musikalischen Probenphase – neben dem genauen Einstudieren des Notentextes – gelöst werden? Welche künstlerischen Entscheidungen müssen getroffen werden? Stets sieht man sich bei der Erarbeitung von Alter Musik mit den übermächtigen Vorbildern der letzten Jahrzehnte konfrontiert: Interpreten wie die des Concentus Musicus Wien unter Nikolaus Harnoncourt haben seit den 60er Jahren Maßstäbe in der Interpretation des vorromantischen Repertoires gesetzt, die in ihrer nachhaltigen Wirkung auf eine ganze Generation von Musikern nicht überschätzt werden können. Wir verdanken diesen Künstlern, die sich wissenschaftlich mit historischen Gegebenheiten, Instrumenten und Spielgewohnheiten beschäftigten, die kreative Einbeziehung musikologischer Erkenntnisse auf ihr eigenes Spiel. Man muss diesen Vorgang als Glücksfall der Interpretationsgeschichte betrachten. In der Musikkritik wird nun seit geraumer Zeit der Begriff der „Historisch informierten Aufführungspraxis“ verwendet. Zumeist versucht man Aufführungen von herkömmlichen Orchestern unter der Leitung engagierter Kapellmeister, die sich nicht nur auf das Barockrepertoire konzentrieren können oder wollen, mit dieser Formel zu beschreiben – meist mit einem leicht despektierlichen Unterton, will man ihre Ergebnisse doch von „korrekter“ historischer Interpretation unterscheiden. Bei einer neuerlichen Einstudierung einer Händel-Oper sollte man jedoch nicht vergessen, dass Musiker der Vergangenheit zu allen Zeiten eigene Wege zu Händels Musik gefunden haben. Schon kurz nach seinem Tod fanden in England Aufführungen seiner Oratorien mit hunderten Mitwirkenden statt, die sicher nicht das enge Kriterium der „historischen Aufführungspraxis“ erfüllten. Mozart erwies dem Meister durch Bearbeitungen des Messias und des Alexanderfests seine Reverenz, und in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts ging die Wiederentdeckung des Händelschen Opernschaffens durch Oskar Hagen im Rahmen der Göttinger Händelfestspiele mit drastischen Eingriffen in die Substanz der Werke einher. In den 1960er Jahren wurden bei den Hallischen Händelfestspielen die Arien auf deutsch durchtextiert, d. h. der Reprisenteil des da capos wurde mit einem neuen Text versehen, um – ganz im Sinne des Felsensteinschen Musiktheaters – dramatische Handlungsverläufe zu erzeugen. Und heute? Die Versuche zur Freilegung des Originalzustandes Händelscher Opern erfassen nun auch die Bühne: In den letzten Jahrzehnten wurde eine Anzahl bemerkenswerter historisierender Inszenierungen realisiert, etwa von der Choreografin und Tänzerin Sigrid t’Hooft. 17 Im musikalischen Bereich scheint die Notwendigkeit, die Werke des Barock mit allseits greifbaren Originalinstrumenten aufzuführen, übermächtig. Wir staunen über die Flexibilität dieser Instrumente, die Transparenz des Gesamtklangs und besonders über die kammermusikalische Freiheit des Musizierens und die elementare Spielfreude eingespielter Barockensembles; eine Spielfreude, der wir heute sonst wohl nur noch in Jazzensembles begegnen. Trotzdem wollen wir in unserer Produktion einen Weg finden, Händels Musik lebendig und sprechend auch auf unseren modernen Instrumenten und mit postbarocker Gesangstechnik darzubieten, einen Weg, der selbstverständlich das Wissen um zentrale Grundsätze barocken Musizierens voraussetzt. Gleichzeitig aber soll das Ergebnis auch unserer heutigen Sicht auf das Musiktheater entsprechen und nicht zuletzt uns selbst als Ausführende zufriedenstellen. „O voi che penate“ – Romildas rätselhaftes Auftrittslied In unserer Hochschulaufführung werden wir nicht so weit gehen, in die Substanz des Werkes so stark einzugreifen wie in den genannten Beispielen. Allerdings erwarten wir umgekehrt von einer zeitgemäßen Interpretation ein genaues Wissen um das gesungene Wort – auch und gerade im Italienischen – und dessen Reflexion in der musikalischen Interpretation. Bsp. 1: Arioso der Romilda, Einleitung Instrumentation, Metrum, Tonart, Harmonik, „pizzicato“ – Bässe, Menuettcharakter: all dies deutet auf ein lyrisch-melancholisches, pastorales Intermezzo hin. Es erklingt eine Hirtenmusik mit simulierter Lautenbegleitung. In der Sprachregelung der opera seria wäre nun etwa der Auftritt einer elegisch leidenden Dame zu erwarten, die uns – begleitet von musizierenden Gefährtinnen – in ländlicher Einsamkeit an ihrem wohligen Schmerz um den treulosen Geliebten teilhaben lässt. Es erscheint Romilda; sie singt folgenden Text: O voi che penate Per cruda beltà, Un Serse mirate Che d’un ruvido tronco acceso stà; 18 O ihr, die ihr leidet An reiner Schönheit, Bewundert einen Xerxes, Der sich von einem groben Baumstamm entflammt zeigt; E pur non corrisponde Und doch, nichts antwortet Altro al suo amor che mormorio di fronde. Auf seine Liebe als das Murmeln der Laubwerks. Offensichtlich hat sie Xerxes’ Laudatio auf den Platanenbaum (im berühmten „Largo“) aufmerksam gelauscht und macht sich nun mit gewählten, aber deutlichen Worten im musikalischen Kleid einer Pastorale über den Feldherrn und Herrscher lustig. Was diese Äußerung Romildas über eine mögliche Vorgeschichte der beiden aussagt, mag der Phantasie des Hörers überlassen bleiben. Natürlich hat umgekehrt keiner der anwesenden Männer Romilda richtig zugehört, am wenigsten Xerxes: seine Ambitionen auf die Sängerin – weniger auf die (ihm unbekannte?) Frau – geben ihn vollends der Lächerlichkeit preis: Recitativo: Xerxes Quel canto a un bel amor l’anima sforza, Per mia dama la scelgo Dieser Gesang ermutigt das Herz zu einer schönen Liebschaft, Als Geliebte erwähle ich sie. Am Anfang dieser Oper steht also eine Szene, die an subtiler Komik schwer zu überbieten ist: Der sinnierende Kriegsherr wird von Romilda delikat auf den Arm genommen, dazu lauern Arsamenes und sein Faktotum Elviro im Gebüsch und geben ihre Kommentare ab. Wie lässt sich nun diese komplexe Situation in der musikalischen Interpretation reflektieren? Übermächtig scheint das elegische Pastoralmodell die Situation zu definieren und den Affekt zu bestimmen. Bsp. 2: Arioso der Romilda Die überdeutliche Phrasierung der Zweierbindungen („Seufzer“), die Verstärkung des Spottcharakters durch deutliche, ironisierende Artikulation und Stimmfärbung, besonders bei Textwiederholungen, verschärfte Deklamation und angemessene Verzierungen werden hier einzusetzen sein, um der Doppelbödigkeit des Ariosos gerecht zu werden. Dabei muss eine klare interpretatorische Absicht erkennbar sein: Ein rein kantables legato espressivo würde der Situation nicht entsprechen und den Zuhörer in die Irre führen, vielmehr muss die pointierte Wiedergabe mit unmissverständlicher Klarheit erfolgen, um die Situation eindeutig zu charakterisieren. 19 Ferner ist es angebracht, sich für eine inégale Ausführung der Achtelbewegung in diesem Stück zu entscheiden. Die Inégalité ist ein bestens dokumentiertes und europaweit bekanntes Phänomen der französischen Musizierpraxis des Barock und war dem Kosmopoliten Händel sicher und sehr wahrscheinlich auch den ausführenden Londoner Musikern bekannt. Ein Menuettsatz wie das vorliegende Stück muss stilgerecht mit leicht punktierter Rhythmisierung ausgeführt werden; in unserer Aufführung wollen wir uns insbesondere zur Steigerung des spöttischen, tändelnden Affektes auf diese Praxis beziehen, auch wenn einschlägige Aufnahmen verdienstvoller Interpreten diese Entscheidung erstaunlicher Weise nicht nahelegen. Es lässt sich wohl nicht nachweisen, dass Händel mit der inégalen Ausführung seiner zahlreichen nach französischen Tanzmodellen geformten Arien gerechnet hat – ebensowenig allerdings das Gegenteil. Immerhin beginnen seine Opern normalerweise mit einer Ouvertüre des französischen Typus mit ihrer differenzierten Rhythmik. In diesen wird ohne Weiteres von einer „französischen“ doppelt punktierten Ausführung ausgegangen, die ihrerseits in der inégalité wurzelt. – Auch die Allemande, die den dritten Akt einleitet, erhält durch inégale Ausführung einen unverwechselbaren Charme, der die Präsenz des europaweit einflussreichen französischen Stiles glaubhaft spiegelt und erlebbar macht. „Historisch informierte Aufführungspraxis“: Dieser Begriff bezeichnet präzise eine zeitgemäße Interpretationshaltung, die zwischen historischer Musizierpraxis und heutiger Musikausübung vermitteln und sich auch unkonventionellen szenischen Lesarten nicht verschließen will. Prof. Franz Brochhagen ist als Musikalischer Leiter der Opernklasse verantwortlich für die diesjährige Einstudierung von Händels „Xerxes“ an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Er realisierte als Theaterkapellmeister zahlreiche Produktionen des gesamten Opernrepertoires vom Barock bis zur Moderne; dazu zählen „Alcina“ von Händel und „Dardanus“ von Jean Philippe Rameau sowie „Die Krönung der Poppea“ von Claudio Monteverdi (HfM Dresden 2008). 20 Das Bühnen- und Kostümbild zu „Xerxes“ Maira Bieler/Romina Kaap Händels Oper Xerxes (1738) ist im antiken Persien (480 v. Chr.) angesiedelt. Obwohl der Held des Stücks, der historische Großkönig Xerxes I., ein berühmter Feldherr und Architekt ist, setzt er sich in der gleichnamigen Oper mit privaten, zwischenmenschlichen Problemen auseinander. Während Xerxes den Feldzug gegen Europa vorbereitet, verliebt er sich unsterblich in Romilda, die Geliebte seines Bruders, und umwirbt sie mit allen Mitteln. Dabei ignoriert er Familienbande und sogar das Eheversprechen an seine rechtmäßige Verlobte Amastris. Die Oper endet mit der Niederlage des Königs im Kampf um die Frau seines Herzens. Die unterschwellige Moral ist klar: der große Kriegsfürst wird von seinen unkontrollierten Gefühlen (Affekten) zu Fall gebracht. Dieser im Stück dargebotene Begriff der „Liebe“ (Verständnis von Liebe und Ehe) kann in Frage gestellt werden. So steht Xerxes´ besitzergreifende, rasende Verliebtheit im Kontrast zu Arsamenes´ und Romildas zarter, unschuldiger Liebe. Ist der „Xerxes“-Stoff noch aktuell? Im 17./18. Jahrhundert bevorzugten Librettisten gern royale Stoffe und Figuren aus der Antike (Giulio Cesare, Rodelinda u. a.) um zwischenmenschliche Themen wie Liebe und Verrat zu behandeln. Der historische Kontext spielte dabei meist eine nachrangige Rolle. Neben der europäischen Geschichte übte die Historie des Morgenlandes mit seinen Sinnlichkeiten und Verführungen einen besonderen Reiz auf das Publikum aus. Die Menschen waren fasziniert vom „Fremden“, der Einfluss des Orients auf die Entwicklung Europas war immanent (Kunst, Schrift etc). Gleichzeitig stehen beide Kulturen im Kontrast zu unserer heutigen Weltanschauung. Zum einen die konträre, oft oberflächliche Sichtweise auf den nahen Osten: 3000 Jahre persische Hochkultur treffen auf den gegenwärtigen Iran. Zum anderen hat sich das Geschlechterkonzept dort radikal gewandelt. Im liberalen Persien existierte beispielsweise kein Kleiderkodex für die Frau, heute gilt sie als Eigentum des Mannes und ist gezwungen sich bis zum Verlust der Individualität zu verhüllen. Die ambivalente Rezeption von Persien/Iran und die veränderte frauenrechtliche Situation haben zu der Entscheidung geführt, die Ausstattung für Xerxes in einer persisch-iranisch anmutenden Welt spielen zu lassen. Händels kunstfertiger, überschwänglicher Barockmusik wird so eine persische Bildsprache gegenübergestellt. Daraus resultiert ein Szenario, in dem sich persische Figuren mit dem barocken Affekt-Kanon auseinander setzen müssen. 21 Inspiration Ausgangspunkt der Bühne ist eine durch persische Miniaturmalerei inspirierte, abstrakte, künstliche Welt. Die persische Buchillustrationskunst entwickelte sich im 10. Jahrhundert nach Christus. als Teil der persischen Literatur (bekanntestes Beispiel ist das „SchāhnāmeEpos“). Dabei handelte es sich um mehr als reine Illustrationen – sie waren selbst visuell lesbare Geschichten. Als künstlerische Ergänzung der Poesie machten sie die niedergeschriebene Handlung leichter verständlich. Thematisch bezog sich die Miniaturmalerei meist auf persische Mythologie und Dichtung. Aber auch Aktivitäten am Hof des jeweiligen Herrschers sowie Jagd- und Schlachtszenen wurden dargestellt. Als Teil der Kulturpolitik dienten sie der Selbstdarstellung eines Herrschers. Die Miniaturen sind keinesfalls als verbürgte Geschichtsschreibung zu verstehen. Viel mehr zeigen sie eine idealisierte Welt, die sich an Fakten orientiert mit dem Zweck, die Größe und Macht des Königreiches zu demonstrieren. Die Faszination der Miniaturen liegt in ihrer kraftvollen Farbigkeit, dem freien künstlerischen Umgang mit Perspektiven und Mustern, ihrer Komplexität und der verwirrenden Simultanität der gezeigten Geschichten. Dadurch lässt sich keine lineare Lesart festlegen: verschiedene Zeiten, Orte und Fokusse existieren parallel nebeneinander. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in derselben Zeichnung zugegen, es gibt kein Zentrum des Geschehens. Haupt- und Nebenspielorte lassen sich nicht von einander unterscheiden. Die Bilder sollen beobachtet werden, sie gleichen Suchbildern, die nur durch längere Betrachtung in ihrer Gänze erfasst werden können. Diese Beobachter-Perspektive, welche die LeserInnen einnehmen, findet sich auch in den Miniaturen selbst wieder. Sie sind voll von Figuren, die von Balkonen, aus Nischen und hinter Vorhängen spähend das Geschehen beobachten und sich so partielles Wissen aneignen. Ein und dieselbe Situation wird den BetrachterInnen simultan aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt, woraus sich das gleichzeitige Vorhandensein von Aufsicht, Vorder- und Seitenansicht eines Objekts (z. B. eines Turmes) ergibt. Die an eine, aus dem Barock stammende, Tiefenperspektive gewöhnten RezipientInnen werden mit der auf Schichten und Zweidimensionalität beruhenden Malweise der Miniaturen konfrontiert. Auf den zweiten Blick wird die Unwirklichkeit dieser perspektivischen Behauptungen erkennbar. Bühne Das Bühnenbild zeigt eine abstrakte, verfremdete Welt. Aus architektonischen Bruchstücken, persischer Ornamentik und Schleiern entsteht eine eigene 3D-Miniatur. Im Stück kommt es durch falsche oder manipulierte Darstellung von angeblichen Fakten zu Missverständnissen und Täuschung. Die perspektivischen Ungereimtheiten in den flexiblen Kulissenbauten sind Ausdruck der seelischen Unruhen, in denen sich die Charaktere befinden. Es herrscht ein ständiges Wechselspiel der Gefühle zwischen Vertrauen und Misstrauen. 22 Die Figuren sind gezwungen, ihre Gefühle vor anderen zu verbergen. Kommunikation findet meist hinter vorgehaltener Hand oder über Dritte statt, wodurch die Wahrhaftigkeit der Gefühle verschwimmt. Raumgreifende Schleier schaffen eine diffuse Atmosphäre, die die emotionale Zerrüttung der Charaktere wiederspiegelt. Gegen diese sich andauernd wandelnden Bilder erhebt sich statisch eine unüberwindbare, martialische Lehmmauer. Typisch für die Barockoper war das Dogma der Abwechslung. Das bedeutete möglichst regelmäßige Bühnenumbauten und Effekte. Kein Ort im Stück sollte ein 2. Mal aufgesucht werden, so auch bei Xerxes. Die Entwicklung der Bühne gleicht einer Reise von prächtigen Palastgärten und Basaren, über stürmische Meeresstrände und öde Wildnis zu einem gloriosen Hochzeitsfest. Dort finden die Konfrontation der Helden und Heldinnen sowie das (scheinbar) glücklichen Finale statt. Wirkt das Bühnenbild zu Beginn wie eine farbenprächtige, fremdartige „Märchenwelt“, so vollzieht sich im Laufe der Vorstellung eine stetige Dekonstruktion. Bühnenelemente entkleiden sich, verschwinden nach und nach bis zur (fast) leeren Bühne. Kostüm Bei der Konfrontation von historischer und moderner persischer Kleidung ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Verschleierung naheliegend. Zu Xerxes´ Regierungszeit herrschte eine weitreichende Liberalität, was die Gleichheit der Geschlechter und der Religionen betraf. Für die Frau im heutigen Iran ist die Verschleierung des Gesichts bzw. des ganzen Körpers dagegen Pflicht. Das bedeutet die Verhüllung aller weiblichen Reize (Haare, Hände, Körperformen etc.), teilweise bis zur vollkommenen Unkenntlichkeit. Andererseits tragen vor allem junge Musliminnen unter dieser dogmatischen Hülle „westliche“ Kleidung (Hosen, Absatzschuhe und Makeup). Auf diese Ambivalenz wird auch im Kostüm eingegangen. Klassische Schnitte (Kurta, Kaftan, traditionelle Verschleierung) treffen auf aktuelle Modeeinflüsse. Die Frauen im Stück gehen unterschiedlich mit Kleiderdoktrinen um: So verkleidet sich Amastris bewusst als Mann. Die kokette Atalanta wechselt spielerisch zwischen engen Kostümen mit modernen Accessoires und der traditionellen Verschleierung. Ihre melancholische Schwester Romilda hingegen wird von den Männern als Projektionsfläche (der treuen Geliebten, der devoten Gattin, der glanzvollen Königin) ausgenutzt. Im Laufe des Stücks wird sie mit mehr und mehr Stoffschichten überhäuft bis sie zu einer regungslosen, steifen Puppe geworden ist. Ihr Hochzeitskleid gleicht einem Käfig und beraubt sie gänzlich ihrer Weiblichkeit. Die Tragikomik der Oper entsteht durch die vielen Missverständnisse, denen die Figuren ausgesetzt sind oder die sie (un)wissentlich selbst herbeiführen. Zu diesen Wirrungen gehört auch das Problem der nicht immer eindeutigen Geschlechterfrage! 23 Prinz Arsamenes wird sowohl von einem Mann als auch einer Frau (Hosenrolle) dargestellt. Xerxes wäre im Barock eine Kastratenrolle gewesen wird aber von einer Frau gesungen. Kostüme und Maske der DarstellerInnen evozieren keine eindeutige Männlichkeit oder Weiblichkeit. Es gibt z. B. keine Kurzhaarperücken oder angeklebten Bärte für die Hosenrollen. Fast alle Figuren tragen somit Züge beider Geschlechter (Parallelen zur heutigen Gesellschaft: Androgynität, Emanzipation, Metrosexualität). Maira Bieler und Romina Kaap studieren Bühnen- und Kostümbild an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Diese Ausstattung ist ihr Diplom-Projekt unter der Betreuung von Prof. Barbara Ehnes und Prof. Kattrin Michel. Abbildung rechte Seite: Persische Miniaturmalerei Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die Kostümentwürfe sowie einen Bühnenbildentwurf von Maira Bieler und Romina Kaap 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Händel und seine Zeit Manuel Gervink Das Bemühen, das Werk eines „großen“ Komponisten in seiner Zeit zu sehen, dieses also nicht als unbegreifbare Schöpfung eines Genius zu betrachten, sondern in seiner Abhängigkeit von geistes-, kultur- und sozialgeschichtlichen und ökonomischen Prozessen zu sehen, kam erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auf, mithin erst lange nach Händels Tod. Biographen, die noch Zeitgenossen Händels waren, sahen sein Leben, besonders aber sein Werk unter wesentlich anderen Umständen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, doch müssen wir uns heute darüber im Klaren sein, dass unser Bild von Händel wie auch von seiner Zeit durch die Überlieferungslage bestimmt wird. Das wiederum bedeutet, dass Zeugnissen von Zeitgenossen nicht unbedingt eine objektive Wahrheit zukommt, nur weil ihre Urheber zufällig zur gleichen Zeit wie Händel lebten; der Interpretation bedürfen sie alle, ob es sich nun um scheinbar objektives Material wie Amtsakten handelt, oder ob wir es mit Briefzeugnissen unmittelbar Beteiligter zu tun haben: Fast immer müssen wir uns über die Zeitumstände informieren, die dazu geführt haben mögen, dass etwa bestimmte Formulierungen von unserem heutigen Sprachgebrauch abweichen, wodurch Aussagen missverständlich werden. Vor allem aber müssen wir dabei berücksichtigen, dass wir unsererseits gleichfalls geprägt sind durch kulturelle und gesellschaftliche Vorgänge, Prozesse, Einflüsse, Kausalitäten, die ebenso zeitbedingt und damit einer Erkenntnis von „Händel und seiner Zeit“ gewissermaßen „vorgeschaltet“ sind und diese beeinflussen. Somit ist die Erkenntnis, dass es „die“ Geschichte gar nicht gibt, mittlerweile schon zum Allgemeinplatz geworden, und konsequent erscheint es, den geschichtlichen Blickwinkel insgesamt so zu erweitern, dass einzelne überlieferte Phänomene in einem Gesamtsystem ihren Platz finden, das uns erst in die Lage versetzt, diese in ihrer singulären Bedeutung wie in ihrem systemischen Zusammenhang beurteilen zu können. In diesen Zusammenhang gehört – um nur ein Beispiel zu nennen – die demographische Situation der Städte im 17. Jahrhundert. Kriege und Seuchen veränderten in der ersten Jahrhunderthälfte diese Situation in den europäischen Ländern erheblich, und zwar so erheblich, dass erst in den 50er bis 70er Jahren des 18. Jahrhunderts der Bevölkerungsstand von um 1600 wieder erreicht wurde. In ihrer Gesamtheit führten diese Prozesse zu einer Verlagerung der großstädtischen Konzentration: Während die alten Städte in süd- und mitteleuropäischer Lage ihre Machtposition einbüßten, wuchs in den weiter nördlich gelegenen Kapitalen wie Paris, London und Amsterdam die Bevölkerung. Londons Einwohner zahl war am Ende des 17. Jahrhunderts auf das Zehnfache angewachsen; es war mit 400.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Europas, gefolgt von Paris, Konstantinopel und Neapel. London, die Stadt, in der Händels Schaffen seine größte zeitgeschichtliche Wirk samkeit entfaltete, wird vorerst Europas größte Metropole bleiben. Das wiederum bleibt nicht ohne Einfluss auch auf die kulturelle Bedeutung dieser Stadt. 33 Ludger Rémy hat im letzten, 2013 erschienenen Jahrbuch der Hochschule für Musik den Zustand Londons zur Zeit Joseph Haydns anhand zeitgenössischer Quellen rekonstruiert. Es ergibt sich eine atemberaubende Darstellung einer Metropole, die in Anlehnung an Fritz Langs berühmten Stummfilm Metropolis nicht anders denn als „Moloch“ bezeichnet werden kann: „In London ist um 1775, als Frankreich langsam seiner Großen Revolution entgegentaumelt, das kommende 19., in mancher Beziehung gar das 20. Jahrhundert bereits alltägliche Gegenwart, die Stadt ist mit keiner anderen europäischen Großstadt zu vergleichen. London ist die größte und ungewöhnlichste, kontrastreichste, chaotischste, schnellste, lebendigste, lauteste, spannendste, grausamste, schönste und dreckigste Stadt der Welt. Parks und Lustgärten, Theater, Bordelle, Vergnügungsviertel, Opernhäuser, Hochöfen, Werften, Häfen, Leicht- und Schwerindustrie – all das existiert nebeneinander, angetrieben vom Geld, vom Kapital und menschenersetzenden und -verachtenden Dampfmaschinen als anscheinend unerschöpfliche Energiequellen für alles. Metropolis schluckt und frisst das Land, auf das der Moloch Vororte, Industrieanlagen, Werften gebiert, neue Stadtteile, wohlbelüftete für Reiche im Westen, idyllisch an den lieblich-grünen Ufern der noch jungfräulich-sauberen Themse gelegen: im Osten bei den Häfen schafft man im inzwischen durch die Stadt verdreckten Fluss neuen Baugrund mit Müll- und Abfallbergen für enge Slums. Platz fürs Proletariat gibt es kaum, die Stadt ist eng, nach dem großen Brand von 1666 musste der Wiederaufbau schnell gehen, so dass man die Straßen nicht verbreitert hatte. London frisst vor allem Energie für die Industrie […]. Das bleibt nicht ohne Folgen für Umwelt und Menschen. […] Aus Millionen Schloten hustet Ruß in den Nebel, der Smog macht die Menschen trübsinnig und depressiv.“ Das also ist aus der Stadt geworden, in der Händel ein halbes Jahrhundert gelebt und gearbeitet hat!? Wie verhielt es sich zu Händels Zeit, was wissen wir überhaupt über Händels Leben? Das biographische Schrifttum, so wie wir es heute kennen und wie es sich in Titeln nach dem Muster: „[Künstler] und seine Zeit“ oder „[Künstler] – Leben und Werk“ zu erkennen gibt, existiert, es wurde bereits gesagt, erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. So war es die sog. „Göttinger Historikerschule“, in der die Überzeugung zum Ausdruck und Ansporn für zeitgeschichtlich relevante Darstellungen aufkam, dass nämlich das Streben nach historisch korrekter Darstellung nur in Ansehung sämtlicher Zeitumstände, auch der vermeintlich unbedeutenden, erfolgen könne und dürfe. Für die sich so etablierende musikhistorische Forschung gilt heute allgemein der Göttinger Universitäts-Musikdirektor Johann Nikolaus Forkel (1749–1818) als Begründer; dessen Allgemeine Geschichte der Musik (Leipzig 1788–1801), reichte von der Antike bis 1550. Danach hatte diese mit einer Ausnahme für den Verfasser kaum noch Wert; diese war Johann Sebastian Bach. In seinem Buch Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke (Leipzig 1802), die auch als Werbe34 schrift für die gerade in Angriff genommene erste Gesamtausgabe der Werke des Thomaskantors gedacht war, schildert Forkel Bach – hierin noch ganz dem 18. Jahrhundert und insbesondere der Genieästhetik des (literarischen) Sturm und Drang verpflichtet – als das Genie, das unabhängig vom Beifall (oder Missfallen) der Zeitgenossen schafft. Diese Gedankenrichtung entwickelte sich in den Jahren um Händels Lebensende in England, besonders befördert durch die Schriften von Edward Young (Conjectures on Original Composition, 1759) und Robert Wood (Essays on the Original Genius and Writings of Homer, 1769). Das „Originalgenie“ des Sturm und Drang erweist sich bereits und gerade in der – biographisch oft weniger dokumentierten – Jugend des Künstlers, besonders in anekdotischen Begebenheiten wie denen, die auch von Händel überliefert sind und in denen seine künstlerische Begabung zweifelsfrei erkennbar wird, sowie in seiner früh ausgeprägten Persönlichkeit und weitgehenden Unabhängigkeit von Zeitgeschmack und Moden. Der englische Musikhistoriker Charles Burney (1726–1814) hat in seiner Nachricht von Georg Friedrich Händel's Lebensumständen, die 1785 in der Übersetzung von Johann Joachim Eschenburg erschien, die Bedeutung der frühen Biographie von Künstlern betont, die es erst ermöglicht, die gesamte Entwicklung des Genies von seinen ersten Manifestationen an nachzuvollziehen. Auch beim jungen Händel finden sich in diesen Quellen solche ins Anekdotische gekleidete Wesenszüge: Der Knabe, der seine Begleitung zu einer Reise des Vaters ertrotzt, der den festen Willen des Vaters, dass der Sohn Jurist werden solle, beharrlich unterläuft, sowie die zunehmende Reputation des jungen Händel, dessen Begabung sich schließlich auch in Italien Bahn bricht, wo er als der „caro Sassone“ gefeiert wird. Händel war ein Komponist, der vergleichsweise viel „herumgekommen“ ist, ein (wie man heute sagen würde) europäischer Künstler, der von den Metropolen, die er besuchte und in denen er jeweils eine bestimmte Zeit lebte, unterschiedlich geprägt wurde. Seine Geburtsstadt Halle erlebte er nicht mehr als Residenzstadt, die sie als Sitz der Erzbischöfe von Magdeburg von 1503 bis 1680 gewesen war und in der unter der Regentschaft des Herzogs August von Sachsen-Weißenfels seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine rege Opernpflege erwuchs. Mit dem Tod des Herzogs 1680 fiel Halle an das Kurfürstentum Brandenburg, der Hof, an dem Komponisten wie Samuel Scheidt und Johann Philipp Krieger wirkten, siedelte nach Weißenfels um, was de facto das Ende der höfischen Musikpflege der Stadt bedeutete. Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712), der spätere Lehrer Händels, stieg in seiner Funktion als Stadtorganist an der Marienkirche und Leiter der zunehmend an Autonomie und Bedeutung wachsenden Stadtmusik zur wichtigsten Persönlichkeit im Musikleben der Stadt auf. Händels Reisetätigkeit – sie mag auch eine Flucht aus seiner vom aktuellen Musikleben abgekoppelten Heimatstadt gewesen sein – war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahezu einzigartig. Früh unternahm er Reisen in die nähere und weitere Umgebung von Halle, was wesentlich zu seiner künstlerischen Persönlichkeitsbildung beitrug: Denn nicht zuletzt lernte er, sich in der höfischen Welt einzuführen und zu behaupten; auch darin war er das völlige Gegenteil des gleichaltrigen Johann Sebastian Bach. 35 So gelang es ihm bald, Zugang zu den europäischen Höfen zwischen Neapel und London zu erhalten, und zwar in der Regel nicht durch subalterne Chargen, sondern von „ganz oben“, durch die Monarchen selbst. Sobald er einen Fürsten oder Monarchen durch sein Cembalooder Orgelspiel für sich gewonnen hatte, bat er ihn um ein Empfehlungsschreiben für den nächsten Herrscher (H. J. Marx). Nach frühen Reisen nach Weißenfels und Berlin zog er 1703 nach Hamburg, das mit seinen fünf Hauptkirchen und dem Opernhaus am Gänsemarkt ein einzigartiges Zentrum der musikalischen Zeitkultur war und wo Händel den italienischen Opernstil kennenlernte, dessen europaweite Dominanz ihn zu einem absoluten Muss für jeden jungen, auf Erfolg bedachten Komponisten machte. Und ein solcher scheint der junge Händel gewesen zu sein. Er unternahm von Hamburg aus Reisen zusammen mit Johann Mattheson (1681–1764), Sänger an der Gänsemarkt-Oper und Komponist, den Händel 1703 hier kennenlernt hatte und mit dem ihn eine durchaus komplizierte, nicht ungetrübte Freundschaft verband. So besuchten sie 1703 Lübeck, wo sie sich beide für die Nachfolge Dietrich Buxtehudes interessierten, dessen Organistenstelle an St. Marien zu besetzen war. Den Anstoß zur ersten Italienreise Händels gab vermutlich Gian Gastone de‘ Medici (Bruder des Großherzogs der Toskana), der sich 1703 in Hamburg aufhielt. Er sagte dem Achtzehnjährigen die Übernahme sämtlicher Kosten zu, was dieser ablehnte; er wollte die Kosten selbst tragen. So kann er diese für jeden aufstrebenden Musiker hochbegehrte Reise wohl erst 1706 antreten, die ihn in alle kulturell wesentlichen Städte führt: Trient, Venedig, Padua, Ferrara Bologna, Florenz, Rom, Neapel. Als Händel vier Jahre später zurück kehrt, um in Hannover seine Stelle als Hofkapellmeister unter König Georg Ludwig (dem späteren englischen König George I.) anzutreten, ist er jenseits der Alpen nicht nur berühmt, sondern auch ein intimer Kenner italienischer Musik und Stilistik. Von Hannover aus durfte Händel nur reisen, wenn der Fürst auf die Jagd ging. Diese Regel schien ihn wenig zu beeindrucken, denn gleich seinen ersten Aufenthalt in London 1710 dehnte er auf die Dauer von einem halben Jahr aus. Kein König verbrachte soviel Zeit mit der Jagd, und so musste er seinen Dienstherren um Entschuldigung bitten, die dieser offenbar gewährt hat, denn Händels Gehalt wurde fortgezahlt. Von London aus, wohin er 1712 übersiedelt war, ist er vermutlich erst 1716, im Gefolge seines ehemaligen und neuen Dienstherrn, dem jetzigen König George I. wieder auf den Kontinent gereist; 1719 besuchte er Dresden, wo er im Auftrag der neu gegründeten Royal Academy of Music die besten Sänger der vom kursächsischen Hof etablierten italienischen Oper engagieren sollte. Zehn Jahre später, die Royal Academy ist mittlerweile aufgelöst, und Händel betreibt selbst das Haymarket Theatre, reist er – wiederum zum Zweck der Sängerakquise – über Venedig und Parma nach Rom und wahrscheinlich auch Neapel, wo er Johann Adolf Hasse kennenlernt. Fragen wir uns, wie greifbar Person und Werk Händels durch die Darstellung der Zeitumstände werden, kann die Antwort kaum eindeutig ausfallen. Betrachten wir ihn als Person innerhalb des dokumentierten gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Gefüges, dann 36 kommt es uns vor, als näherten wir uns Händel. Für sein Werk aber gilt dies wohl eher nicht, da es zunächst in musikhistorischen, -ästhetischen und kompositionstechnischen Kontexten interpretierbar erscheint, die aber ihrerseits nicht außerhalb einer gesamtkulturellen Entwicklung denkbar sind; sie existieren nicht „für sich“ und werden so indirekt wieder wirksam. Damit kehren wir zurück zu den – kaum je erreichten und nach wie vor aktuellen – Idealen der „Göttinger Historikerschule“. Von der Vorstellung eines dem Genie zugebilligten „Sonderwegs“ sollten wir uns jedoch verabschieden. Prof. Dr. Manuel Gervink ist Professor für Musikwissenschaft und Leiter des Instituts für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Unter seinen zahlreichen Publikationen ist er Mitherausgeber des „Händel-Lexikons“ (Laaber Verlag, 2010). 37 Der alternde Händel oder: Über die Liebe zu Bäumen Michael Heinemann I. Xerxes’ Hymne an einen Baum, mit der Händel eine seiner letzten Opern eröffnet, ist so populär wie rätselhaft: Dass ein Herrscher ein Liebeslied an eine Platane richtet und eine sehnsuchtsvolle Melodie entfaltet, die als „Largo“ zum Inbegriff von Funeralmusik wurde, widerspricht allen Konventionen der Opera seria, musikalisch wie dramaturgisch. Kein Protagonist von Rang wäre mit einer solchen Nummer eingeführt worden, die es weder erlaubt, sängerische Virtuosität zu demonstrieren, noch ermöglicht, Eigenschaften eines charakterstarken Helden zu präsentieren. Vielmehr zeigt sich der König sentimental, nicht zur Tat entschlossen, sondern in die Natur entfliehend, der Kriegskunst die ars amatoria vorziehend; doch unsicher, nachgerade schüchtern im Umgang mit dem andern Geschlecht, wendet er sich werbend an einen Baum, in dessen Schatten er sich eher geborgen wähnt als bei einer Geliebten. Was allerdings nur die Ausgangsposition ist. Denn am Ende der Oper ist Xerxes nicht mehr allein und hat nach vergeblichen Versuchen, Romilda für sich gewinnen, zu Amastris zurückgefunden. Doch dass der Regent als gescheiterter Liebhaber eingeführt wird, der Bäume als Beziehungsobjekte adressieren muss, wäre nichts als schiere Parodie, Herrscherkritik in Zeiten brüchig gewordenen Absolutismus, zeichneten sich denn in der Musik Untertöne ab, die Verfremdung signalisieren könnten. Die lyrische Emphase aber wird nirgends unterlaufen, Kolportage ist nicht im Ansatz zu erkennen, und selbst vom Aroma des Kitsches, das dreihundert Jahre Popularisierung fast unvermeidlich hinterlassen haben, erweist sich das originale „Larghetto“ noch frei. Xerxes’ Emotion ist echt und der König, der Bäume liebt, nichts weniger als lächerlich und ganz gewiss kein dendrophiler Clown. Der Gegenentwurf dieses anfangs gynäphob und zugleich pflanzenaffin sich gerierenden Regenten aber ist Programm: Der König wird als lernfähig präsentiert und nimmt, vom Eskapismus kuriert und durch die unerschütterliche Zuneigung von Amastris bestärkt, jene Aufgaben an, die seines Amtes sind. Insofern fügt sich das Profil eines Herrschers in eine Tendenz von Aufklärung, die etwa Metastasios Opern-Libretti allenfalls als Ferment erkennen ließen. Denn vormals hatte der Regent aus Staatsraison stets nachsichtig zu sein und seine Autonomie erschien durch die Pflicht zur Gnade limitiert. Händel aber entfaltet in seinem „Larghetto“ ein Konzept von Liebe, das nicht schon im personalen Gegenüber sein Telos findet, sondern tiefer begründet ist und populär wurde, weil es ungewöhnlich plakativ zu Beginn einer Opera seria exponiert wurde: eine Idee von dauerhafter, „ewiger“ Liebe, das den Moment erotischer Verzückung transzendiert und das Pathos eines allzu emphatisch proklamierten amourösen Bekenntnisses als Phrase decouvriert. Die Pose, die das barocke Theater so schätzte, erscheint nun so unwahrhaftig wie die Manieren der Kastraten. 38 II. Xerxes’ Largo ist ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Nicht das schnelle Liebesglück artikuliert sein Text, sondern jene stille Freude, die sich durch eine dauerhafte Beziehung einstellt. Dafür ist der schattenspendende Baum ein sinnenfälliges Zeichen. Denn Bäumen eignet, wie Alain Corbin in seinem jüngsten Buch (La Douceur de l’Ombre, Paris 2013) ausführt, insbesondere die Eigenschaft, dass sie hinsichtlich ihrer Lebensdauer den Menschen weit überragen; sie sind jene Lebewesen, die am leichtesten die Erkenntnis der Begrenztheit menschlichen Lebens vermitteln. Sie signalisieren Beständigkeit und Verlässlichkeit, allein durch die Erfahrung, dass sie Jahrhunderte überdauern können. Insofern kommt ihnen ein hieratisches Moment zu: Bäume scheinen Himmel und Erde verbinden zu können, sie werden zu auratischen Orten von Kult und Ritus, exemplarisch gefasst in der Eiche, unter der Recht gesprochen wurde, oder der Linde, deren Duft als Aphrodisiakum schon der Minnesang erinnert und die mit einem Tanzpodest zu umbauen bis in die jüngste Gegenwart hinein gebräuchlich war. Zugleich ist der Baum eine Metapher von Standhaftigkeit und Unbeugsamkeit. Er bietet Zuflucht vor Unbilden der Witterung, deren Anfechtungen er sich dauerhaft widersetzt. Seine Unbeugsamkeit wird zum Zeichen einer Dignität, die menschliches Maß überschreitet: (umgangs-)sprachliche Wendungen, zu „stehen“ oder zu „fallen“ wie ein Baum, illustrieren die Intensität einer Beziehung, deren Unmittelbarkeit mythenstiftend wirkt. Dieser vielfältige Bedeutungshorizont, von Corbin eindrucksvoll historisch aufgefächert, ist in Xerxes’ Gesang allenthalben präsent: nicht bloß eskapistische Apostrophierung einer Idylle, sondern der Versuch, im Schatten des Baumes eine „reale Utopie“ (Ernst Bloch) zu konstituieren. Zugleich indiziert die Platane, die Xerxes als Objekt sucht, ein Moment nicht nur solcher Sakralität, sondern als Metapher völliger Nutzlosigkeit, die dieser Spezies botanisch eignet, eine Evokation zweckfreier Schönheit. Natur erscheint weder als Gefährdung noch als Ort betriebswirtschaftlichen Kalküls, sondern eröffnet die Möglichkeit interesselosen Wohlgefallens und zweckfreier Bindung: auch dies ein Grund, warum der Herrscher, der selbst in Liebesdingen Rücksichten zu wahren hat, sich an einen Baum wendet. Die Verweigerung von Verantwortung, die seine Zuflucht scheinbar meint, wird zum Ausweis einer Suche nach Glück, das sich erst jenseits aller Berechnung im menschlichen Miteinander einstellt. III. Xerxes’ Projektion gewinnt ihre eindrückliche Intensität durch ihre Artikulation in einem krisenhaften Moment, die mit einer kritischen Phase im Leben des Komponisten konvergiert. 1737 hatte Händel einen „stroke“ erlitten, mutmaßlich einen Schlaganfall, von dessen Folgen er sich in Aachen erholte; zu den ersten Stücken, denen er sich nach seiner Rückkehr widmete, gehörte Xerxes, an dessen Anfang das berühmte „Ombra mai fu“ steht. Die gespannte Erwartung, die das neue Werk beim städtischen Publikum hervorrief, nutzte Händel, um eine persönliche Position vorzutragen, vielleicht auch im Bewusstsein, nach jenem Zusammenbruch nur noch wenige Gelegenheiten zu erhalten, Musik zu präsentieren, die als Vermächtnis gelten könnte. 39 Mit der Voraussetzung, dass Händel sich bei der Konzeption des Xerxes in einer Krisensituation befunden habe, die sich auch im Werk manifestierte, und mit Blick auf jüngere Ergebnisse der Alternsforschung, die Andreas Kruse am Beispiel Bachs vorgelegt hat (Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach, Heidelberg 2013), wäre zunächst zu bedenken, dass Situationen, in denen die Begrenztheit des eigenen Lebens bewusst wird, außerordentliche Kräfte freisetzen können; gesundheitliche Krise bergen demnach ein Potential zur Entfaltung von Kreativität, das sich vorzugsweise in drei Momenten ausweist: 1. der Frage, was an eine künftige Generation weitergegeben werden soll, materiell wie insbesondere immateriell, als Erfahrungswissen oder „Lebensweisheit“; 2. dem Versuch der Integrierungen von Belastungen und Geschichte(n), auch summativ als Zusammenfassung eigener Lebensleistungen, sowie 3. einer „Gero-Transzendenz“, eines über sich selbst Hinausweisen auch in spiritueller Hinsicht, einer Sublimation der eigenen Individualität in einer als „göttlich“ verstandenen oder kosmischen Harmonie, doch auch mit der Perspektive einer Signalwirkung an die Nachkommen. Die Übertragung dieser Momente auf die Situation Händels in den Jahren 1737/38 erleichtert nun zunächst das Verständnis für etliche kompositorische Entscheidungen bei der Ausarbeitung des Xerxes : 1. erweist sich mit Blick auf die Entwicklung der Oper, aber auch von Wissenssystemen und Handlungsstrategien Händels seine Konzentration in der Musik auf einige wenige Motive als ein Moment, das vielleicht am deutlichsten durch Beethovens bekanntes Diktum „Händel ist der unerreichte Meister! Geht hin und lernt, mit wenigen Mitteln so große Wirkungen hervorzubringen!“ illustriert wird und vielleicht sogar als ein Indiz für ein „Spätwerk“ zu werten wäre; 2. zeigt sich die Integration der (Schaffens-)Biographie Händels in zahlreichen scheinbar längst überholten oder obsoleten Details der Dramaturgie wie der Formanlage, die auf (Venezianer) Opernkonventionen aus der Zeit der Jahrhundertwende, mithin Jugenderfahrungen des Komponisten rekurrieren; zudem indiziert die Kompensation amouröser Erfahrungen durch einen umfassenderen Agape-Begriff eine Annahme der eigenen Ehelosigkeit, auch mit der Intention, Resilienz auszuprägen und eine weiterhin tragfähige Lebensperspektive zu schaffen, als „restitutio ad integritatem“; 3. zielt gerade das „Largo“ auf den Versuch, eine „perfekte“ Musik vorzulegen, eine vollkommene Melodie in größtmöglicher Schönheit: der Ausweis einer Sozioemotionalität und nicht bloß eines künstlerischen Ethos’; dabei wird der christliche Horizont bewusst ausgeblendet zugunsten einer Orientierung an der Antike, die für das aufkommende Bildungsbürgertum, dem Händel zweifellos zuzurechnen ist, das Leitmedium von Bibel und konfessionell gebundener Dogmatik substituiert. IV. Xerxes’ Eröffnung wird damit zugleich zum künstlerischen Testament. Sich selbst in einer Krisensituation aktualisierend, in der sich berufliche und gesundheitliche Aspekte verschränken, formuliert Händel eine Komposition, die das Motiv von Initiative, von bewusster 40 Gestaltung des Augenblicks, mit einer nur zu deutlich empfundenen Vulnerabilität verbindet. Der Anspruch von Generativität, also Erkenntnisse einer folgenden Generation weiterzugeben, ließe sich nicht nur hinsichtlich der Gattungsentwicklung wie auch kompositorischer Details belegen, sondern vielleicht mehr noch einer Kreativität, die auf eine Optimierung ausdrucksstarker Gestaltungsmittel zielt. Und der Gehalt des „Largo“, die Evokation einer Erkenntnis interessefreier Schönheit, bezeichnet ein Moment von Klassizität wie auch einer gelungenen Integrierung der eigenen Biographie, die zugleich die Perspektive auf eine – glaubwürdiger Überlieferung zufolge – für Händel „göttliche“ Ordnung eröffnet, doch getragen bleibt von einer Verantwortlichkeit für Mit- und Nachwelt. Eine solche Aussage aber war prägnant an den Anfang einer Oper zu stellen und gewiss nicht möglich als Liebesduett zu gestalten, das im Blick auf die Paarbeziehung jene transzendentale Perspektive sogleich wieder verstellt hätte, die Händel insinuierte. Der Preis ist die Ambivalenz eines Largos, das, als Liebeslied intendiert, auch als Funeralmusik rezipiert werden kann. Was letztlich nicht einmal einen Widerspruch meint: Liebe, so die Quintessenz des alternden Händel, funktioniert dauerhaft nur im Modus von Treue, die sich einfacher in Bezug auf Bäume abbilden lässt als in der Beziehung zum Mitmenschen. Und die Etymologie, die „Baum“ über das englische Wort „tree“ mit dem deutschen Begriff „Treue“ verbindet, wird zur willkommenen Instanz, einen Gedanken zu verdeutlichen, den Händel ungleich leichter, sinnenfälliger und nachhaltiger in seinem Metier, musikalisch zu formulieren wusste. Prof. Dr. Michael Heinemann ist Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Unter seinen zahlreichen Publikationen ist eine Biographie „Georg Friedrich Händel“ (Rowohlt Taschenbuchverlag, 2004). 41 „Xerxes“ – politisch abwegig und emotional verwirrt Friederike Wißmann In Händels Oper Xerxes begehren zwei Brüder dieselbe Frau (Romilda); der eine ist König (Xerxes), der andere ihr Liebhaber (Arsamenes). Xerxes beruft sich auf seine überlegene Position, denn als König wähnt er sich unantastbar und bewertet sein Begehren als vorrangig. Das Verhältnis zwischen Xerxes und Arsamenes ist deshalb nicht nur ungleich, sondern auch äußerst konfliktreich. Der höfische Kodex macht Arsamenes befangen, denn als Bruder hätte er seine Ansprüche geltend machen können, als Untertan aber hüllt er sich in Schweigen und verneint sogar, die von ihm geliebte Romilda überhaupt zu kennen. Aufschlussreich ist, dass jene Lüge die Handlung vorantreibt: Weil Arsamenes die von ihm behauptete Affektkontrolle nicht aufrechterhalten kann, verrät er sich in dem Moment, in dem er Romildas Stimme erkennt. Serse: Eh! mi diceste non conoscerla. Or come? Arsamene: Sol la conosco al nome. Serse: E al canto ancora. Xerxes: Ach! Ihr sagtet mir, dass Ihr sie nicht kennt. Wie das? Arsamenes: Ich kenne sie nur vom Namen her. Xerxes: Und außerdem vom Gesang. Nicht nur Arsamenes hört Romilda, auch Xerxes vernimmt ihren Gesang, worauf er von der Platane ablässt und sich in Romilda verliebt („Quel canto a un bel’amor l’anima sforza, per mia dama la scelgo.“ – „Jener Gesang entflammt die Seele zu einer schönen Liebe, ich erwähle sie zu meiner Geliebten“). Ihr Gesang also ist es, der nicht nur Xerxes, sondern auch Arsamenes im Wortsinn aus der Rolle wirft. An dieser Stelle wird eine Parallele zur 14 Jahre früher komponierten Erfolgsoper Giulio Cesare insofern offensichtlich, als auch hier die entscheidende Verführungsszene auditiv, nämlich durch eine Himmelsmusik sich vollzieht. Wenn Cleopatra die Arie „V’adoro pupille“ singt, kann Cesare nicht länger widerstehen. Auch die Liebesgeschichte zwischen Cesare und Cleopatra ist eine Geschichte der Verführung durch Musik. In vielen Inszenierungen tanzt Cleopatra, um Cesare zu verführen; das ist schön anzusehen, aber nicht nötig, denn Händel macht deutlich, dass es die Musik ist, die die himmlische Sphäre zu assoziieren vermag. Die Melodie ist herausragend schön, und Händel interpretiert das Verliebtsein als Ausnahmezustand – musikalisch wie dramaturgisch. Händel bereitet die Schlüsselarie Cleopatras durch eine Sinfonia vor und lässt sie von einem Bühnenorchester begleiten, ebenso wie Romildas Auftritt in der zweiten Szene des ersten Akts eine Sinfonia im Larghetto einleitet. Ein entscheidender Unterschied beider Opern ist, dass Xerxesʼ Begehren willkürlich erscheint und seine „Liebe“ von Besitzansprüchen und Machtmissbrauch motiviert ist. Während sich der Opernheld in der Opera seria in der Regel im Konflikt zwischen Liebe und Pflicht misst, so wird in Händels Xerxes sogar der Zugewinn an politischer Macht zweitrangig; im Libretto sind die Eroberungspläne nur mehr ein Randereignis. Herrschaftsposen missbraucht Xerxes zur eigenen Vorteilsnahme, was in der Verbannungsszene des Bruders besonders deutlich wird. Der Tyrann setzt seine Autorität 42 nicht für politische Strategien ein, sondern missbraucht sie zur Erfüllung seines Begehrens. In der Inszenierung an der Komischen Oper Berlin (2013) ist Händels Xerxes deshalb plausibel als REX SEX annonciert. Robert Braunmüller stellt im Programmheft zur Münchner Xerxes -Inszenierung von 1996 die Heldenfigur Giulio Cesare als positives Gegenbeispiel dem wankelmütigen Xerxes gegenüber. Cesare wird als tugendhafter Regent charakterisiert, der selbst seinen Feind nicht ausliefert, während Xerxes ausschließlich Eigeninteressen verfolgt. Doch ist auch hier die Feinzeichnung der jeweiligen Rolle entscheidend: Cesare erfährt in Händels Oper im Gegensatz zur komplexen Figur der Cleopatra kaum eine Entwicklung, sondern er ist von Anfang an janusköpfig angelegt. Während er als Regent in jedem Augenblick überlegen agiert, lässt er sich von der als Lidia verkleideten Cleopatra nicht nur ver-, sondern auch vorführen. Sein Entscheidungshorizont in Liebesdingen ist wenig galant und überhaupt nicht heroisch. Folglich findet sich auch in der Oper Giulio Cesare die Idee der tollwütigen Liebe, die im Wortsinn blind macht: warum sonst erkennt Cesare nicht in Lidia die schöne Cleopatra? Xerxes ist meines Erachtens nicht als Gegenbild, wohl aber als Zuspitzung auf den Macht missbrauchenden Liebhaber interpretierbar. Dessen Herrschaftsattribute sind marginalisiert und werden einzig zur Eroberung Romildas in Anschlag gebracht. Während die Figur des Cesare ambivalent agiert, nämlich als Herrscher vernünftig und als Verehrer der schönen Cleopatra nicht Herr seiner selbst, so ist bei Xerxes die tugendhafte Seite ganz erloschen. Nicht nur die Schönheit von Romildas Gesang ist im Operneingang bemerkenswert, auch ihr selbstbewusster Auftritt im Anschluss an die berühmte Arie „Ombra mai fù“ ist außergewöhnlich. Denn Romilda ist es, die die seltsame Konstellation zwischen Xerxes und dem geliebten Baum bemerkt und so die Szene durchbricht. Während das Larghetto zunächst eine pastorale Atmosphäre aufruft, ändert sich die Szene von einem Takt auf den anderen. Interessant ist in Händels Oper, dass häufig auch den melancholischen Szenen ein ambiguitives Moment eignet. Gleich bei ihrem Auftritt adressiert Romilda Xerxes direkt („O voi che penate per cruda beltà, un Serse …“ – „Oh ihr, die ihr leidet | unter grausamer Schönheit, | einen Serse“). Anders als in vielen Opern, in denen die begehrte Frau als anbetungswürdige Schönheit eine eher passive Rolle einnimmt, wird Romilda eingeführt als eine reflektiert handelnde Figur. Und sie agiert nicht nur vernünftig, sie benennt auch die Absurdität der Situation. Corinna Herr hebt in ihrem Artikel „Der Mythos der femme forte in Händels Alcina“ die durch Händel geförderte positive Konnotation der tatkräftigen Frauengestalt hervor. Im Sinne der Aufwertung aktiver Frauenpositionen beschreibt sie – eingedenk des historischen Abstands – die Bradamante-Figur als Gegenbeispiel zum passiven Weiblichkeitsideal, wie es in Opern des 19. Jahrhunderts vorherrschend wird. Herr stellt fest, dass den Frauenfiguren bei Händel ein weiter emotionaler Radius zukommt, was sie unter die Formulierung einer ,,allgemein größere[n] Affektlizenz“ fasst (Corinna Herr, „Der Mythos der femme forte in Händels Alcina“, in: Händel-Jahrbuch 2008, S. 161–182). Dadurch, dass Romilda den Herrscher ironisch kommentiert, lässt sie, durchaus im Gegensatz zu ihrem Geliebten Arsamenes, keinen Zweifel an ihrer Ebenbürtigkeit. 43 Während in der Oper Xerxes die Hauptfigur mit einer Summe von Irrungen und Fehlleistungen aufwartet, so fungiert die Romilda-Figur als Gegengewicht. Im Gegensatz zu Xerxes ist ihre Liebe unerschütterlich – und sie bleibt sich und ihrem Geliebten Arsamenes zu jedem Zeitpunkt der Oper treu. Damit repräsentiert sie viel eher als die Hauptfigur Xerxes, der einer exzessiven Gefühls- und Triebsteuerung unterliegt, das „höfische Konversationsideal“, wie es Silke Leopold in ihrem Beitrag zur formalen Disposition der Da-capo-Arie ausführt. Udo Bermbach hat in seinen Opernstudien zu Macht und Machtrepräsentation („Die Verwirrungen der Mächtigen. Herrschertugenden und Politik in Georg Friedrich Händels Londoner Opern“) wiederholt auf die Diskrepanz zwischen Politik und Opernbühne aufmerksam gemacht und in diesem Kontext das „Durchsetzungsvermögen“ der Händelschen Frauen-Figuren unterstrichen: „In Händels Opern freilich sind die Frauen, sofern sie das Spiel um die Macht aktiv mitbetreiben, und dies tun sie überraschend häufig, selten schwächer als die Männer. Sie sind von großer Willensstärke und häufig genug auch von entschiedenerem Durchsetzungsvermögen.“ (Udo Bermbach, Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht. Politik und Gesellschaft in der Oper, Hamburg 1997, S. 61). Erkennbar wird die Parallelsetzung von Herzensdingen und Herrschertugend insofern, als Treue tendenziell mit politischer Integrität in eins gesetzt wird. Händel bringt den durch das unverhältnismäßige Begehren bedingten Irrsinn in all seinen Facetten zur Darstellung – und dies in einer Drastik, bei der auch manche ernste Szene ins Komische zu kippen droht. Prof. Dr. Friederike Wißmann ist Professorin für Musikwissenschaft am Konservatorium Wien. Unter ihren zahlreichen Publikationen zum Musiktheater ist ihre Habilitationsschrift „Abwechslungsreich. Rollenkonstellationen in den Opern von Georg Friedrich Händel“ (Druck in Vorbereitung). 44 Barocke Musiksprache – „eine alte Stadt“ Felix Diergarten „Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ So schreibt der Philosoph Ludwig Wittgenstein in seinen Philosophischen Untersuchungen, die 1953 posthum veröffentlicht wurden. Worauf will Wittgenstein damit hinaus? Er will zeigen, dass menschliche Sprache kein logisches, streng gegliedertes und konsistentes System ist, sondern ein buntes Gebilde, das sich über Jahrhunderte teils durch Planung, teils durch Chaos und Zufall in alle Richtungen entwickelt hat und weiter entwickelt. Nehmen wir ein konstruiertes, aber der Alltagssprache nachempfundenes Beispiel. Stellen Sie sich vor, jemand spräche folgenden Satz aus: „Ich glaube, er führt etwas im Schilde; bevor es eine Blamage gibt, rede ich Tacheles und schicke ihm eine SMS.“ Diese Satz besteht aus mindestens vier verschiedenen historischen Schichten. „Etwas im Schilde führen“ ist deutlich erkennbar eine mittelalterliche Redewendung aus dem Kontext des Turnierwesens; das Wort „Blamage“ ist ein pseudofranzösisches Wort der Studentensprache des 18. Jahrhunderts; „Tacheles reden“ ist eine Entlehnung aus dem Jiddischen (tachles = Zweck, zweckmäßig Handeln) und kam offenbar im 19. Jahrhundert verstärkt in Gebrauch; über den historischen Ursprung der Abkürzung „SMS“ bleibt nicht viel zu sagen außer dem Hinweis auf die angesprochene „unlogische“ Verfasstheit von Sprache, denn bekanntermaßen steht die Abkürzung für den Service, der die Nachrichten verschickt („Short message service“) und nicht für die Nachricht selbst, so dass der Satz „ich schicke ein SMS“ unlogisch und sinnlos ist. Trotzdem wird er gebraucht, denn Sprache ist – damit kommen wir auf Wittgenstein zurück – eben kein logisch deduzierbares System, sondern ein Ergebnis historisch mehr oder weniger zusammengewachsener Konventionen. Was hat das alles mit Barockmusik, mit Händels Xerxes zu tun? Sehr viel. Auch Musiksprachen sind Sprachen in diesem Sinne. Die barocke Musiksprache (und gleiches ließe sich über die klassische, romantische und jede andere Musiksprache sagen) ist ein Konglomerat der verschiedensten historischen Schichten. Eine Ausbildung in dieser Sprache bestand im 18. Jahrhundert im Wesentlichen darin, sich mit diesen Elementen nach und nach vertraut zu machen, bis man sie fließend sprechen, das heißt: aus ihnen in Echtzeit am Tasteninstrument Musik produzieren konnte. Auch Händels eigene Aufzeichnungen zur Kompositionslehre machen dies deutlich: Schritt für Schritt wird der Schüler in Händels Lehrgang am Tasteninstrument mit den einzelnen Elementen vertraut gemacht. Ich greife zur Veranschaulichung vier Elemente (man könnte auch von „Satzmodellen“, „Topoi“ oder „Schemata“) der Händel’schen Musiksprache heraus, wie sie auch in Händels Lehrgang zu finden sind. Da ist erstens der in Quarten fallende und in Sekunden steigende Bass, der etwa auch dem berühmten Kanon von Pachelbel zugrunde liegt. Er findet sich bereits im frühen 15. Jahrhundert, ist also zur Zeit von Xerxes etwa 300 Jahre alt. Im 16. und 17. Jahrhundert spielte er als „Romanesca“-Bass eine wichtige Rolle. 45 Abb. 1 Dann ist da der konsequent in Quinten aufsteigende (bzw. durch ausgleichende »Gegenschritte« in Quinten aufsteigende und in Quarten fallende) Bass, der häufig mit einer Kette von Quartvorhalten harmonisiert wird: Abb. 2 Er scheint etwas jünger zu sein und dem Zeitalter der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts zu entstammen, ist also zur Zeit Händels etwa 200 Jahre alt. Aus dem gleichen Zeitalter stammt die wichtigste Kadenzformel der Barockmusik, die sogenannten „cadenza doppia“. Abb. 3 Als ein deutlich jüngeres Element (wenige Jahrzehnte alt) könnte man die barocke Tanzsatzidiomatik mit ihren zahlreichen Verzierungen und barocken Dissonanzfiguren anführen, in der Allemande z. B. typischerweise eine auftaktige Kette von Sechzehntelfiguren in mäßigem Tempo. Versuchen wir, aus allen diesen Elementen einige Takte barocke Musik zu entwerfen und erfinden wir den Anfang einer Allemande! Der erste Teil soll aus zwei Viertaktern bestehen (Abb. 4a). Zu Beginn ist als typisches Anfangsmodell der oben in Abb. 1 wiedergegebene „Romanesca“-Bass geeignet, den wir sogleich mit einer kleinen Kadenz abschließen (Abb. 4b). Wie lässt sich nun weiterverfahren? Vielleicht als Antwort auf den fallenden Bass mit dem oben beschriebenen aufsteigenden Bass (Abb. 2)? Ebenfalls wieder mit einer kleinen 46 Kadenz abgeschlossen ergibt sich die in Abb. 4c wiedergegebene Phrase. Nun, das klingt erstens rhythmisch arg einförmig und zweitens ziemlich zusammengestückelt. Die rhythmische Einfältigkeit ließe sich beheben, indem wir das zweite Satzmodell auf einer anderen metrischen Ebene stattfinden lassen (Abb. 4d). Hieraus resultiert aber ein Problem, denn die Phrase ragt nun über den ersten Viertakter hinaus. Außerdem besteht noch immer das Problem der deutlichen Zäsur zwischen den beiden Satzmodellen. Die in Abb. 4e suggerierte Lösung schafft etwas Abhilfe für beide Probleme: Die Endnote des ersten Satzmodells und die Anfangsnote des zweiten fallen jetzt zusammen. Noch immer ragt die Phrase aber über den Viertakter hinaus. Eine weitere Komprimierung ist nötig und lässt sich leicht durch Beschleunigung der Kadenz bewerkstelligen (Abb. 4f). Ein erster Viertakter wäre damit fertig. Wie geht es weiter? Am Ende des Achttakters, beim Wiederholungszeichen, soll (dem Formmodell „Suitensatz“ gemäß) die Modulation in die Tonart der fünften Stufe stehen. Besonders schön und farbig wirkt diese, wenn ihr voraus eine kleine Ausweichung nach Moll – in die Tonart der sechsten Stufe – geht, so dass insgesamt in den Takten 5 bis 8 ein Teil einer Fonte-Sequenz (Quintfall) mit den Stufen H-E-A-D entsteht (Abb. 4g). Es bleiben noch zwei Takte zu füllen. Am Ende verdoppeln wir einfach (um den Schluss zu stärken) die Kadenz nach D (Abb. 4h). Bleibt noch ein halber Takt. Es fehlt ein Zwischenglied zwischen G-Dur und e-moll. Man könnte z. B. C und a setzen (Abb. i). Das Resultat ist nun ein schlichter Bass, dem natürlich für eine barocke Allemande noch etwas ganz Entscheidendes fehlt: die Figuration. Hierfür stehen Standard-Floskeln zur Verfügung, die wir nun über diese Zeile verteilen (Abb. 4j). 47 Abb. 4 Könnte ein derartig zusammengebastelter Bass Grundlage für eine barocke Allemande sein? Ja, er könnte. Er ist es sogar. Es ist der Bass der Allemande, die dem dritten Akt von Händels Xerxes vorangeht. Abb. 5 „Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ Wir können nun vielleicht deutlicher sehen, welche Relevanz Wittgensteins Bild von der Sprache als einer alten Stadt auch für barocke Musiksprache hat. So einheitlich und kohärent uns diese Sprache auf Anhieb auch erscheinen mag (und ob sie für Händels Zeitgenossen so einheitlich klang, bleibe hier dahin gestellt), sie ist ein Gewinkel aus verschiedenen historischen Schichten, aus alten und neuen Satzmodellen, aus Satzmodellen mit Erweiterungen aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Figurationen und Ornamenten. Dass Musiksprache nicht mit einem musiktheoretischen System erfasst werden kann, ist eine feste Überzeugung im Dresdner Zentrum für Musiktheorie. Der Grund dafür ist, wie wir hier sehen, nicht einfach postmoderner Methodenpluralismus, sondern von der Sache selbst 48 gefordert. Eine musikalische Partitur ist überhaupt kein einheitlicher Gegenstand und kann deswegen auch nicht mit einer einheitlichen Methode erfasst werden. Um das plausibel zu machen, könnte man sehr einfach auf „Intermedialität“ als eine „Grundbestimmung der Kunst“ (Georg W. Bertram, Kunst. Eine philosophische Einführung, Stuttgart 2005, S. 107) verweisen und die Oper als offensichtliches Beispiel anführen, bei dem vielschichtige theatralische und literarische Phänomene mit völlig unterschiedlichen musikalischen Parametern wie Textdeklamation, Instrumentation, Rhythmus und Klang zusammentreffen. Des Pudels Kern liegt aber anderswo. Schon für das vermeintlich nackte musikalische Material, wie es sich in den verschiedenen Epochen zeigt, gilt das, was Wittgenstein in seinem Bild von der alten Stadt zu fassen versucht hat. „Die Sprache ist ein Labyrinth von Wegen“, so Wittgenstein. „Du kommst von einer Seite und kennst dich nicht mehr aus; du kommst von einer anderen zur selben Stelle, und kennst dich nicht mehr aus.“ PS. Die Anregung zu der hier praktizierten Darstellungsmethode, bei der man aus den Einzelteilen ein Stück entstehen lässt (und nicht „analytisch“ das Stück in seine Einzelteile zerlegt), verdanke ich meinem Lehrer Clemens Kühn („Das Unerhörte erleben“, in: Diskussion Musikpädagogik 26 [2005], S. 38–40). Ihm ist dieser Beitrag deswegen in Dankbarkeit gewidmet. Prof. Dr. Felix Diergarten ist Dozent für Historische Satzlehre und Theorie der Alten Musik an der Schola Cantorum Basiliensis. Neben zahlreichen anderen Publikationen hat er mit Ludwig Holtmeier und Johannes Menke „Georg Friedrich Händel: Aufzeichnungen zur Kompositionslehre“ (Noetzel Verlag 2010) herausgegeben. 49 Warum ist Händels „Largo“ ein Hit? Johannes Menke Schon im 19. Jh. erfreute sich das fälschlicherweise meist als „Largo“ titulierte Stück großer Beliebtheit, nicht zuletzt als Instrumentalstück, als welches es bis heute – vorwiegend auf Hochzeiten und Beerdigungen – gerne gespielt wird. Auch die Schallplattenindustrie nahm sich früh der Arie an: sie wurde 1909 von Clara Butt, 1930 von Caruso und 1939 von Tauber eingespielt, eine Suchanfrage auf Youtube ergibt heute mehr als 100.000 Treffer und die Arie fehlt auf keiner „Best-of-Baroque“-CD. Eine Arie hat schon per se die Tendenz zum Populären: sie will das Publikum unmittelbar berühren und wird dazu noch von den schon zu Barockzeiten bestbezahlten Musikern, nämlich den Gesangstars, dargeboten. Zu einfach macht es sich aber derjenige, der meint, das Populäre beruhe nur darauf, dass es einfach gestrickt sei. Zum einen ist vieles einfach gestrickt ohne gleich populär zu werden, zum anderen ist vieles Populäre gar nicht einfach gestrickt, was sich jedoch oft erst auf den zweiten Blick herausstellt. Ein Hit ist nicht einfach zu komponieren! Bekanntlich wurde das Drama Il Xerse des Librettisten Nicolò Minato, auf dem Händels Libretto beruht, im 17. Jahrhundert von Francesco Cavalli und später von Giovanni Bononcini vertont. Und so haben wir zwei frühere Vertonungen von „Ombra mai fù“, deren letzte Händel auch kannte. Bei Cavalli singt Xerxes seine Ode an die Platane recht unbefangen und fröhlich in einem 3-Halbe-Takt in einem duralen D-Modus. Bei Bononcini sind wir in B-Dur und der Gestus scheint die Händelsche Arie schon ein wenig vorwegzunehmen. Tatsächlich übernahm Händel einige Gesten, so etwa die erste Akkordfolge B-Dur, F-Dur, g-Moll, die bei ihm, nach F-Dur transponiert, an der Stelle kommt, wo die Singstimme einsetzt. Freilich ist diese Akkordfolge nichts Singuläres, sie ist ein Standard und findet sich genauso im Pachelbel-Kanon. In Verbindung mit dem Text kommt ihr zwar ein gewisser Wiedererkennungswert zu, übertrieben wäre es allerdings zu sagen, Händel würde hier Bononcini zitieren. Wenn Händel das tut, hat er normalerweise keine Hemmungen, wesentlich direkter zu zitieren. Neben der anfänglichen Akkordfolge sind es aber auch die langgezogenen absteigenden Linien, die Händel übernimmt, aber noch viel mehr steigert. Bononcinis Arie ist trotz ihres weich-melancholischen Charakters noch weit entfernt von Händels großräumigem und eindringlichem Duktus. Beim Hören von Händels „Ombra mai fù“ hat man unweigerlich das Gefühl, das ganze Stück stehe unter einem großen Spannungsbogen. Man kann es schwer abbrechen oder ausblenden. Im Film Dangerous Liaisons (Gefährliche Liebschaften), wird in einer Szene das komplette Stück ohne Unterbrechung gespielt. Die Handlung steht dabei scheinbar still. Gezeigt wird zwei Minuten lang nur, wie die Protagonisten (gespielt von Glenn Close und John Malkovich) der Musik lauschen und dabei Blicke austauschen. Der Grund für diese sozusagen musikimmanente narrative Dichte der Musik ist nicht nur das Fehlen der Da-capo-Form oder die relative Kürze. Vielmehr versucht Händel auf mehreren Parametern seine Musik so zu komponieren, dass die Spannung bis zuletzt anhält. 50 Dies wird schon deutlich, wenn man sich nur die Oberstimme ansieht: Bsp. 1 Wir können fünf Phrasen unterscheiden, die hier untereinander abgedruckt sind: 1. Eine instrumentale Einleitung, 15 Takte, deren letzter Takt mit dem Einsatz der Singstimme überlappt. 2. Erster Textdurchgang, mit kurzer instrumentaler Unterbrechung, Dauer 11 Takte, Ende mit einer schwachen Kadenz auf der Terz von F-Dur. 3. Zweiter Textdurchgang, 8 Takte, Kadenz auf der sechsten Stufe d-Moll, die allerdings im Bass zu einem Trugschluss wird, der in der zeitgenössischen italienischen Theorie auch cadenza inganno oder cadenza finta genannt wurde. Die Zeile „cara ed amabile“ wird als Anhang wiederholt. 4. Dritter Textdurchgang, wiederum 8 Takte, Kadenz auf F, die wiederum durch die Begleitung zu einem Trugschluss auf der sechsten Stufe wird, also wieder eine cadenza finta. Die letzten Worte, „soave più“, werden wiederholt. 5. Ein instrumentales Nachspiel, 6 Takte, welches die zweite Hälfte der Einleitung wieder aufgreift. Ganz offensichtlich werden die Phrasen kürzer: 15-11-8-8-6, wobei der Verkürzungsprozess durch die zweitaktigen Anhänge der beiden Achttakter etwas aufgehalten wird. Quer zu diesem Verkürzungsprozess steht eine andere Proportionierung, die in vielen Kompositionen, zumal des Barockzeitalters, eine Rolle spielt: Mitte und Goldener Schnitt. Die Mitte des Stückes ist T. 26, also exakt nach dem Ende der zweiten Phrase. Der Goldene Schnitt liegt nach T. 32, also dort, wo die Singstimme etwas abstürzt, um zu einer Kadenz nach d-Moll anzusetzen, die dann trugschlüssig abgebogen wird. Überhaupt: die Kadenzen! Wer sich viel mit Händel beschäftigt, merkt, welch ein Meister der Kadenzvermeidung er ist. Händel schafft es oft über Seiten hinweg, Kadenzbildungen zu umgehen oder abzuschwächen, manchmal schweißt er ganze Satzfolgen zusammen, 51 indem er eine wirklich schlusskräftige Kadenz vorenthält. Die Großzügigkeit und der lange Atem seiner Musik rührt von dieser Technik her, so auch in unserem Stück. Für eine schlusskräftige Kadenz brauchen wir einen Quintfall im Bass und eine Sopran- oder Tenorklausel in der Oberstimme, so dass es zu einer Oktave in den Außenstimmen auf dem Schlussklang kommt. Dies geschieht zum ersten Mal in T. 46, also wenn der Sänger aufhört! Die Kadenz der ersten Phrase wird durch die Überlappung, also den Einsatz der Singstimme auf der Quinte aufgehoben. Die Kadenz der zweiten Phrase endet auf einer Terz, somit offen, die Kadenz der dritten Phrase ist ein Trugschluss (sechste statt erwartete erste Stufe von d-Moll), die erste Kadenz der vierten Phrase ist wieder ein Trugschluss auf der sechsten Stufe, diesmal sogar mit 7-6-Vorhalt, erst dann kommt es zu einer wirklich abschließenden Kadenz. Wir sehen also: Mit seiner Kadenzvermeidungsstrategie hält Händel die Spannung bis kurz vor Schluss aufrecht. Kombiniert mit der Verkürzung der Phrasen führt dies zu einer zeitlichen Verdichtung, die dem Stück eine gewisse Sogwirkung verleiht. Zur formalen Organisation gehört aber auch das motivische Gefüge. Es lassen sich sechs Motive unterscheiden, die allesamt in der Einleitung vorgestellt werden: a) Der Quartabstieg mit Überbindung, mit dem alle Phrasen, bis auf die fünfte, beginnen. b) Ein Quartaufstieg mit Sechzehntelfigur, der zur Quinte der Dominante führt. c) Ein langgezogener Quartabstieg von der sechsten zur dritten Stufe, der im Bass mit Dezimen unterlegt ist. d) Ein Quartabstieg mit Tonrepetition und Anticipatio von der ersten zur fünften Stufe. e) Eine verzierte Sopranklausel mit Leitton zur fünften Stufe. f) Eine Schlussfigur mit Transitus und Anticipatio, ebenfalls eine absteigende Quarte. Bsp. 2 Bis auf das Motiv e) beruhen alle Motive auf einer ausgefüllten Quarte. Durch rhythmische Figuren und Skalenbezug unterscheiden sie sich jedoch auf charakteristische Weise. Ihre Anordnung ist alles andere als einheitlich, abgesehen von der ersten Figur, mit der immer begonnen wird: So hören wir in der zweiten Phrase nur die ersten drei, wobei das Motiv a) wiederholt und die anderen leicht variiert werden. In der dritten Phrase wird das Motiv d) direkt hinter das erste gesetzt, wiederholt und variiert. Danach findet sich ein weißer Fleck, in dem sich zwar Bestandteile verschiedener Motive finden, jedoch keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Dies ist genau die Zone des Goldenen Schnittes, wo das Stück nach d-Moll moduliert! In der vierten Phrase werden die drei letzten Motive direkt an das erste gefügt, ein Rest des zweiten Motivs findet sich im Anhang. Das Nachspiel schließlich zitiert nochmals die letzten drei Motive. Somit wird deutlich, dass den Motiven unterschiedliche Funktion zukommt: Das erste Motiv hat Signalcharakter und ist verbunden mit „Ombra mai fù“. Alle 52 anderen Motive sind nicht an eine bestimmte Textpassage gebunden. In der ersten Hälfte dominieren die Motive b) und c), in der zweiten die letzten drei. Man hat so das Gefühl, zwar immer das Gleiche zu hören, jedoch nie in derselben Abfolge. Wiederholung und Abwechslung, Wiedererkennung und Überraschung halten sich auf elegante Weise die Balance. Abwechslungsreichtum zeigt sich auch bei der harmonischen Behandlung der Motive. Betrachten wir allein das erste Motiv: Am Anfang sitzt es auf einer aufsteigenden Skala im Bass: Wir hören dort die Bassstufen 1.-2.-3. Beim zweiten Mal (T. 16–20) wird das Motiv mit der Bassfolge kombiniert, die wir aus Bononcinis Arie und aus dem Pachelbel-Kanon kennen: terzweise versetzte Quartfälle: f-c-d-A-B-F. Beim dritten Mal (T. 27/28) ist es wie am Anfang und beim vierten Mal (T. 37/38) geht der Bass in parallelen Dezimen mit der Oberstimme. Es wird somit allmählich deutlich, dass die ganze Arie ein Gefüge motivischer Bezüge und Varianten darstellt, ohne irgendeinem eindeutigen Prinzip zu folgen. Fast alle Grundgedanken – bis auf den Pachelbel-Bass – werden in der Einleitung präsentiert. Die auffällig lange Passage, die mehr als ein Viertel der ganzen Länge ausmacht, ist für die Wirkung der Arie von entscheidender Bedeutung. Die Musik spricht zunächst wortlos zu uns. Gemeinsam mit Xerxes wird der Zuhörer von der Atmosphäre des „bellissimo giardino“, wie es in der Regieanweisung heißt, also des „überaus schönen Gartens“, gefangen genommen. Die Wirkung muss auf Anhieb sitzen. Dies gilt für die dramaturgische Situation und es gilt für jeden Hit. Betrachten wir daher genauer diese Einleitung. Tonale Klangfolgen, vor allem in der Barockzeit, werden durch die Außenstimmen definiert, also durch deren Kontrapunkt. Bsp. 3 Die drei Teilphrasen unterscheiden sich auf einer ganz prinzipiellen Ebene: Die erste Teilphrase geht von der Oktave auf der ersten Stufe aus, erreicht in sich zusammenziehender Gegenbewegung die dritte Stufe im Bass mit einer Terz und geht wiederum in Gegenbewegung auseinander, um auf der fünften Stufe auf einer Quinte innezuhalten. Die zweite Teilphrase geht schlicht in parallelen Dezimen abwärts, im Bass von der vierten zur ersten 53 Stufe, und verharrt dort mit einer sogenannten cadenza di grado, also einer Kadenz mit Tenorklausel im Bass. Wegen der Terzlage und der schwachen Wirkung dieses Kadenztypus kann hier nur von einer Zäsur, gleich einem Komma, gesprochen werden. Die letzte Teilphrase schließlich ist wiederum ganz im Modus der Gegenbewegung gehalten, mit einer kurzen Passage in der Seitenbewegung, und schließt auf der Oktave, die, wie wir gesehen haben, von der auf der Quinte einsetzenden Singstimme übertönt wird. Kontrapunkt und Intervallsatz artikulieren die Form dieser Einleitung also recht profiliert. Die Klarheit des Kontrapunkts trägt maßgeblich bei zur Fasslichkeit dieses Anfangs. Wie ist es nun um die Harmonik bestellt? In einer weitverbreiteten Händel-Monographie heißt es: „Auch ohne seinen Text […] wurde das ‚Largo‘, der Eröffnungssatz des Serse, zu einer von Händels bekanntesten Einzelnummern, die alle auch gegenwärtig noch aktuellen Kategorien für populäre Musik erfüllt: ruhig-beruhigender Grundduktus, taktweise wechselnde Grundakkorde einfachster Kadenzharmonik, schlichte, unmittelbar nachvollziehbare und häufig wiederholte melodische Gesten.“ Auf den ersten Blick scheint es sich so zu verhalten: Die Einleitung ist reines F-Dur, abgesehen vom doppeldominantischen Leitton h. Bei genauerem Hinsehen bzw. Hinhören jedoch können wir einige harmonische Details entdecken, denen dieses Stück seinen Reiz ganz maßgeblich verdankt. Seit dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts war die in unzähligen Traktaten überlieferte Oktavregel der Maßstab harmonischer Normalität. Kirnberger spricht von der „natürlichen Bezifferung“ der Skala, in italienischen Traktaten ist die Oktavregel schlicht „la scala“, selbst für Rameau hatte die Oktavregel ein normative Gültigkeit, was sich vor allem dann zeigt, wenn er über Generalbasspraxis schreibt. Der Bass der Einleitung müsste laut Oktavregel folgende Akkorde haben: Bsp. 4 Händel hat nun einige bemerkenswerte Abweichungen und Zusätze eingebaut: 54 Bsp. 5 Dies betrifft schon den Anfang. Der Septimvorhalt ist zwar eine ganz typische Verzierung, die Sexte auf der zweiten Stufe ist der Leitton, der sich nach oben auflösen müsste, so wie es alle Oktavregelschulen zeigen. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Sextakkord auf der dritten Stufe. Händel geht aber nach dieser Sexte abwärts weiter über die Quinte in die Terz der dritten Stufe. Der Leitton wird nicht aufgelöst und die Quinte tritt als Transitus zum Akkord hinzu. Diese Variante freilich ist nicht völlig singulär, wir finden sie auf einprägsame Weise z. B. in Bachs großartiger Fantasie in G für Orgel. Besonders auffällig ist weniger die nicht erfolgende Auflösung des Leittons, sondern vielmehr der melancholisch anmutende Quintsextakkord, der auf dem dritten Schlag entsteht. Dass Händel diesen Klang nicht nur als Durchgang verstanden haben wollte, zeigt die Stimmführung: Die Viola springt ins e, womit der Klang eine Akzentuierung erfährt. Der nächste spezielle Klang ist der Terzquartakkord zu Beginn der zweiten Teilphrase. Normalerweise steht hier ein Sekundakkord; weil Händel aber in Dezimen in den Außenstimmen fortschreiten will, muss die Sekunde durch die Terz ersetzt werden und es kommt eben zum Terzquartakkord: Aus 2-4-6 wird 3-4-6. Die Wirkung ist phänomenal. Die allerschönste Stelle aber ist die erste Hälfte der dritten Teilphrase: Die Gegenbewegung über den Stufen 1.-2.-3. im Bass, führt zu einem Septakkord auf der zweiten und einem Quintsextakkord auf der dritten Stufe. Letzterer ist ein recht dissonanter Klang, da er eine kleine Sekunde bzw. große Septime zwischen Quinte und Sexte aufweist. Auch hier akzentuiert Händel den Klang durch einen Sprung in der Viola. Und es ist wieder die Viola, die im nächsten Takt auf dem dritten Schlag eine Sexte bringt. Wir sind hier auf der fünften Stufe, der Dominante, dort hat eine Sexte eigentlich nichts zu suchen! Es scheint, als würde hier die Stimmführung der Bratsche über den erwarteten Klang triumphieren; die klare Kontur der Tonalität wird wie aufgeweicht durch die unstabile Sexte. Dieser Hit, mit dem Händels späte Oper beginnt, ist also zugleich fasslich (der Kontrapunkt und die klare Linienführung), vielschichtig (Form und Motivik) und raffiniert (Harmonik) komponiert. Dargestellt wird immerhin ein recht komplexer Gemütszustand: die Liebe zu einem Baum, hinter der der Wunsch nach Liebe zu einem Menschen steht. Diese Arie ist nicht deshalb zu einem Hit geworden, weil sie so schlicht ist, sondern weil wir ihre ganz eigentümliche und wundervolle Musik, die eine durchaus ungewöhnliche Szene einfangen will, immer wieder hören wollen. Prof. Dr. Johannes Menke ist Professor für Historische Satzlehre an der Schola Cantorum Basiliensis. Unter seinen zahlreichen Publikation hat er mit Felix Diergarten und Ludwig Holtmeier „Georg Friedrich Händel: Aufzeichnungen zur Kompositionslehre“ (Noetzel Verlag 2010) herausgegeben. 55 Nachwort Georg Friedrich Händels Oper Xerxes hat nicht nur für das Opernpublikum in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Die Oper ist wegen ihres Stellenwertes als eine der letzten Opern von Händel auch zunehmend von Interesse für die musikwissenschaftliche und -theoretische Forschung geworden. Die Idee dieses erweiterten Programmheftes ist es, Gedanken aus unterschiedlichen Blickwinkeln zum Thema Xerxes sowohl für das Opernpublikum als auch für die wissenschaftliche Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Die Beiträge entstammen der vom Zentrum für Musiktheorie durchgeführten Ringvorlesung „Händels Oper Xerxes“, die von Oktober 2013 bis Januar 2014 an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden stattfand. Zu diesen Ringvorlesungen wurden Spezialisten aus der musikalischen Praxis und Wissenschaft aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eingeladen, um, besonders für die Studenten der Dresdner Opernklasse, Kenntnisse dieser Oper zu vermitteln. Insofern dient dieses Heft auch als Dokumentation dieser Vorlesungsreihe. Besonders freuen wir uns darüber, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250-jähigen Bestehen der Hochschule für bildende Künste Dresden, zwei Künstlerinnen aus der Abteilung Bühnen- und Kostümbild sowohl bei der Vorlesungsreihe, als auch bei diesem Heft mitgewirkt haben. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Rektorat der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (insbesondere bei Herrn Prof. Andreas Baumann und bei Frau Judith Schinker) für ihre Unterstützung des Projekts bedanken. Auch Frau Dr. Katrin Bauer und Frau Konstanze Kremtz möchte ich einen großen Dank für die redaktionelle Unterstützung aussprechen. Und schließlich sind wir allen Autoren des Heftes bzw. Vortragenden der Reihe für ihr Engagement sehr zum Dank verpflichtet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Besuch der Dresdner Hochschulproduktion von Händels Oper Xerxes und hoffe sehr, dass dieses Heft Ihren Opernbesuch bereichert. John Leigh Leiter des Zentrums für Musiktheorie an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 56 abzugelten. Hier ist der Herausgeber bereit, nach Anforderung rechtmäßige Ansprüche In einigen Fällen konnten die Rechteinhaber nicht ermittelt werden. Wir danken den Rechteinhabern für die Reproduktionsgenehmigung. Preis: 3,00 Euro Druck: Elbtal Druck & Kartonagen GmbH Layout: Grafikbüro unverblümt Satz: Konstanze Kremtz Redaktion: Prof. Dr. John Leigh Umschlaggestaltung: Grafikbüro unverblümt Titelbild: Maira Bieler und Romina Kaap Internet: www.hfmdd.de Rektor: Prof. Ekkehard Klemm Fon 0351/4923-660, Fax 0351/4923-657 Wettiner Platz 13, 01067 Dresden Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden Impressum