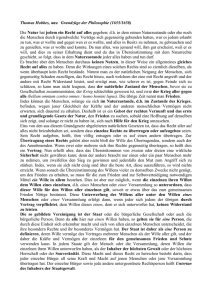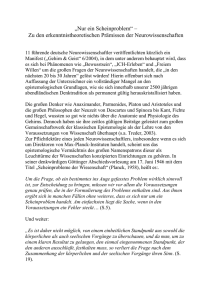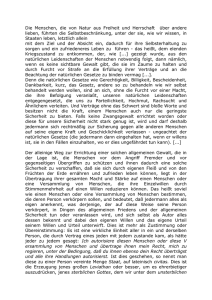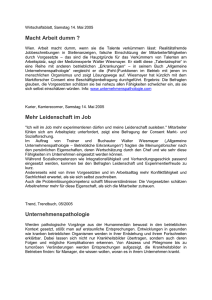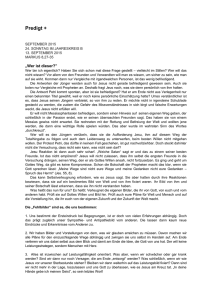Bundeswettbewerb 2013 - Philosophischer Essay - Max
Werbung
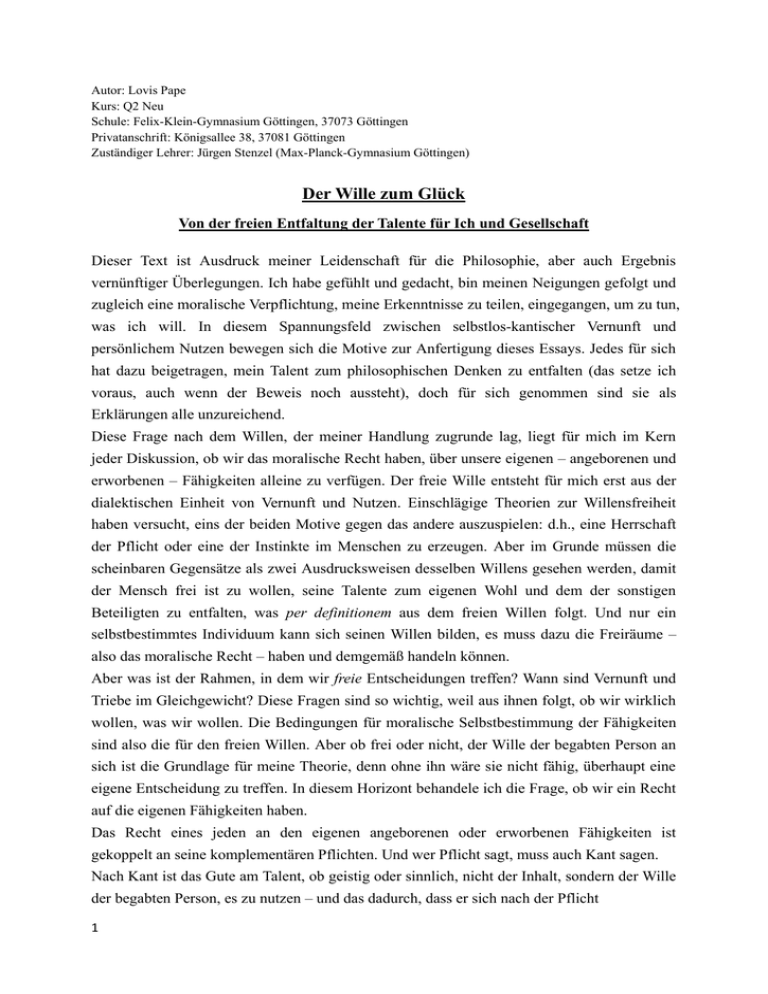
Autor: Lovis Pape Kurs: Q2 Neu Schule: Felix-Klein-Gymnasium Göttingen, 37073 Göttingen Privatanschrift: Königsallee 38, 37081 Göttingen Zuständiger Lehrer: Jürgen Stenzel (Max-Planck-Gymnasium Göttingen) Der Wille zum Glück Von der freien Entfaltung der Talente für Ich und Gesellschaft Dieser Text ist Ausdruck meiner Leidenschaft für die Philosophie, aber auch Ergebnis vernünftiger Überlegungen. Ich habe gefühlt und gedacht, bin meinen Neigungen gefolgt und zugleich eine moralische Verpflichtung, meine Erkenntnisse zu teilen, eingegangen, um zu tun, was ich will. In diesem Spannungsfeld zwischen selbstlos-kantischer Vernunft und persönlichem Nutzen bewegen sich die Motive zur Anfertigung dieses Essays. Jedes für sich hat dazu beigetragen, mein Talent zum philosophischen Denken zu entfalten (das setze ich voraus, auch wenn der Beweis noch aussteht), doch für sich genommen sind sie als Erklärungen alle unzureichend. Diese Frage nach dem Willen, der meiner Handlung zugrunde lag, liegt für mich im Kern jeder Diskussion, ob wir das moralische Recht haben, über unsere eigenen – angeborenen und erworbenen – Fähigkeiten alleine zu verfügen. Der freie Wille entsteht für mich erst aus der dialektischen Einheit von Vernunft und Nutzen. Einschlägige Theorien zur Willensfreiheit haben versucht, eins der beiden Motive gegen das andere auszuspielen: d.h., eine Herrschaft der Pflicht oder eine der Instinkte im Menschen zu erzeugen. Aber im Grunde müssen die scheinbaren Gegensätze als zwei Ausdrucksweisen desselben Willens gesehen werden, damit der Mensch frei ist zu wollen, seine Talente zum eigenen Wohl und dem der sonstigen Beteiligten zu entfalten, was per definitionem aus dem freien Willen folgt. Und nur ein selbstbestimmtes Individuum kann sich seinen Willen bilden, es muss dazu die Freiräume – also das moralische Recht – haben und demgemäß handeln können. Aber was ist der Rahmen, in dem wir freie Entscheidungen treffen? Wann sind Vernunft und Triebe im Gleichgewicht? Diese Fragen sind so wichtig, weil aus ihnen folgt, ob wir wirklich wollen, was wir wollen. Die Bedingungen für moralische Selbstbestimmung der Fähigkeiten sind also die für den freien Willen. Aber ob frei oder nicht, der Wille der begabten Person an sich ist die Grundlage für meine Theorie, denn ohne ihn wäre sie nicht fähig, überhaupt eine eigene Entscheidung zu treffen. In diesem Horizont behandele ich die Frage, ob wir ein Recht auf die eigenen Fähigkeiten haben. Das Recht eines jeden an den eigenen angeborenen oder erworbenen Fähigkeiten ist gekoppelt an seine komplementären Pflichten. Und wer Pflicht sagt, muss auch Kant sagen. Nach Kant ist das Gute am Talent, ob geistig oder sinnlich, nicht der Inhalt, sondern der Wille der begabten Person, es zu nutzen – und das dadurch, dass er sich nach der Pflicht 1 richtet.1 Die Richtung der Pflicht ist klar: Das Talent muss gefördert werden, da es dem Inhaber und ggf. der Allgemeinheit zum Vorteil gereichen wird. Schlüge er die Möglichkeit aus, würden Bequemlichkeit und kurzfristiger Lustgewinn das Motiv seines Handelns bilden. 2 Darauf ließe sich aber im Allgemeinen keine lebendige Gesellschaft bauen. Gleiches gilt, falls das Talent zum Schaden Anderer verwandt würde. Also ist der Mensch frei, wenn er diesen Widerspruch erkennt und in Reaktion vernünftig handelt. Er muss autonom entscheiden können, aber mit gewissem Ausgang. Dies ist eine gefährliche Ansicht, weil sie das Triebhafte im Menschen leugnet. Der kantische Pflichtbegriff geht in seinem abstrakten Formalismus gegen jede natürliche Neigung unserer tierischen Abstammung. So gibt er uns mitunter den Eindruck, wir müssten sie um einer höheren Gerechtigkeit willen unterdrücken. Wenn Vernunft und Neigungen im Menschen nicht im Einklang sind, ist eine Pflichtherrschaft also purer Zwang und setzt Verdrängungsmechanismen in Gang, die unseren Willen und also unsere Bereitschaft, eigene Talente zu entfalten, trüben. Außerdem ist fraglich, ob der kategorische Imperativ in seiner Allgemeinheit überhaupt dem Individuum dient, um dessen Glückes willen es seine eigenen Talente doch entfalten soll; im Gegenteil: der Mensch wird zum Erfüllungsgehilfen der abstrakten Pflicht. Umgekehrt bewirkt auch eine Triebherrschaft allein keine Willensfreiheit (und so keine Antwort auf unsere Frage): Nietzsche etwa, als Vertreter einer egoistischen Ethik, kann mit seinem anmaßenden Sozialdarwinismus nicht erklären, wie der Einzelne mit seiner Selbstsucht nicht das Glück anderer (und andere damit das seine) gefährden soll. Auch ist der Mensch in seinem evolutionären Erbe zwischen Egoismus und Altruismus gespalten. Dem entspricht eine Lehre, die zwischen diesen Anlagen, und also persönlichem und Gemeinnutzen, vermittelt: der Utilitarismus. Nur kann mit dem „größten Glück für die größte Zahl“ theoretisch jede Handlung moralisch legitimiert werden. Moralische Rechte können überhaupt nicht einheitlich formuliert werden, weil ihre Gültigkeit vom Nutzen, der oft genug nicht einmal eindeutig bestimmbar ist, in einzelnen Situationen abhängt. Demnach könnte eine Gesellschaft die Fähigkeiten einzelner Mitglieder auch (vermeintlich) nutzbringend „enteignen“, was gegen deren moralische Selbstbestimmung geht. Beide Theorien taugen also nicht, um einen Willen zu erzeugen, der dem Menschen ganz gerecht wird. Aber sie sind auch nicht ganz nutzlos: Nach Kant ist das Moralische am Talent erst der Wille des Inhabers – wie bei mir. Nach dem Utilitarismus muss stets zwischen persönlichem und Gemeinnutzen vermittelt werden – wie bei mir. Man könnte nun vorschlagen, diese Positionen miteinander aufzuwiegen, die Widersprüche abzumildern, Übereinstimmungen zu betonen. Das halte ich für grundfalsch. Beide Ansätze blieben im Grunde gegensätzlich, der Mensch ebenso zerrissen, weil er stets zwischen Pflicht und Nutzen schwankt und dabei doch nie ganz das bekommt, was er will. __________________________________________________________________________ 1 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 9 (Ausgabe hrsg. Von Jens Timmermann – Sammlung Philosophie 3). 2 Ebenda, S. 38. 2 Stattdessen stelle ich einen beinahe biblischen Grundsatz voraus: Was du verlangst, das man dir tu', das gesteh' auch allen And'ren zu. Darauf beruht schon jetzt ein Großteil gesellschaftlichen Lebens, insofern, dass wir erwarten, für unsere Funktion (idealerweise Ausdruck unserer Talente in Vollendung) ein ansonsten sorgenfreies, anregungsreiches Leben führen zu können. Demnach ist das Prinzip Ausdruck eines Systems gegenseitiger Bevorteilung, in dem die Mitglieder der Gesellschaft willens sind, ihre Talente der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen – für ihren eigenen Nutzen. Eine utilitaristische Maxime? Ja und nein, denn anders gelesen ist die Maximierung des Nutzens für die Beteiligten hiernach nicht Grundsatz, sondern Folge ihrer Gleichbehandlung. Wir wissen, was wir wollen: Eine Gesellschaft, in der niemand den Nächsten ausnutzt, stets den freien Menschen mit dem gleichen Recht auf Selbstbestimmung der Fähigkeiten sieht. Dann ist dies ein praktischer kategorischer Imperativ, der anleitet, alle Menschen so zu behandeln, wie sie es in geistiger Gleichheit verdient haben. Die Gesellschaft der gegenseitigen Bevorteilung ist genauso Kants „Königreich der Zwecke“. Nur wissen wir so gesehen doch nicht immer, was wir wollen, weil der Nutzen darin, unsere Fähigkeiten rein egoistisch auszuspielen, gesellschaftlich legitimiert ist, sich daran auch direkt nichts ändern lässt. Ein Beispiel: Ein Bauer erbt Ackerland. Einmal urbar gemacht, könnte es ihm einen auskömmlichen Lebensunterhalt garantieren. Aber das kostet Zeit und Mühen. Ebenso verhält es sich mit unseren angeborenen Talenten: Sie werden als immaterielle Güter – Naturgaben – nicht verdient, stehen uns aber zur freien Verfügung. Mit ihrer Entfaltung gehen Aufwand wie materieller oder ideeller Nutzen einher, je nach ihrer Art. Der Landbesitz bringt Rechte mit sich. So kann der Bauer sein Land brachliegen lassen, zum Eigengebrauch urbar machen oder für den freien Markt anbauen. Dabei darf er nicht der Umwelt oder Gesellschaft schaden – etwa gentechnisch veränderte Pflanzen oder verbotene Pestizide verwenden. Für unsere angewandten Talente gilt aber keine solche Schranke: Sie können nicht einfach in eine Richtung verboten werden, weil ihre „Nutzung“ in den Grenzen des Rechts unter den Grundsatz der freien Entfaltung der Persönlichkeit fällt. Wir erinnern uns: der moralische Wert eines Talents, sei es handwerklich oder kognitiv, liegt im Willen des Inhabers, es gesellschaftlich relevant im guten wie im schlechten Sinn, zu nutzen. So findet ein Unternehmer mit Überblick und Scharfsinn in der freien Wirtschaft heute sicher einen Platz als Hedgefonds-Manager im Bereich Lebensmittelspekulationen. Trotz gewisser Regulierungen wohnt jedem kapitalistischen System der Konkurrenzgedanke inne, nach dem die eigene Leistung auch auf Kosten Anderer gehen kann. Dieses Problem lässt sich auch nicht sofort und sicher nicht auf vier Essay-Seiten lösen. Talente können aber auch gleichzeitig dem Inhaber und der Gemeinschaft dienen. Dafür gehen wir zurück auf das Ich im gesellschaftlich des vernünftigen Tiers Mensch: 3 Was tut der Bauer mit dem Ackerland, wenn es zu nichts mehr als Subsistenzwirtschaft taugt? Je bessere Methoden zur Erschließung des Landes ihm zur Verfügung stehen, desto leichter wird es für ihn, desto größer wird auch seine Bereitschaft dazu, es urbar zu machen. Bekommt er Hilfe durch sein Umfeld, kann er sich die nötige Technik unabhängig von seinem Besitzstand anschaffen. Je mehr Wissen er über die Bewirtschaftung besitzt, desto leichter wird ihm infolge auch die Nutzung fallen. Genügt der Ertrag der Arbeit dann seinen Ansprüchen, erfüllt das Land seinen Zweck. Äquivalent: Wenn man auch nur die Begabung in der Philosophie, Literatur oder anderer, für das Bruttosozialprodukt völlig irrelevanter Schaffensbereiche in Betracht zieht, gelten Kriterien, nach denen die Entfaltung der Talente wollenswert wird. Den Menschen dürfen in der Entfaltung ihrer Talente keine Hindernisse im Weg stehen. Unabhängig von ihrer sozialen Klasse müssen alle mit ähnlich gut ausgeprägten Begabungen die gleiche Möglichkeit zu ihrer Entfaltung haben. Vor allem fällt es Menschen umso leichter ihre Talente zu entwickeln, wenn sie die Chance bekommen, sie zu entdecken und mit anderen Gütern abzuwägen (etwa persönlicher Bequemlichkeit). Einmal entwickelt, übt ein Talent ungeheure Anziehungskraft aus, weil es dem Inhaber ermöglicht, im Rahmen dieser Begabung außeralltägliche Handlungen zu vollführen. Wie des Bauern nun fruchtbares Land erfüllt es seinen Zweck, indem es dem Inhaber das Gefühl gibt, für seinen Einsatz belohnt worden zu sein. Dieses Potential steckt in jedem Talent: Immer nützt es in erster Instanz dem Inhaber und dann seinen Mitmenschen; wobei es in jeder Hinsicht eine natürliche Reaktion und selbstbestimmte Handlung ist, angeborene wie erworbene Fähigkeiten allen zur Verfügung zu stellen. Aus Dankbarkeit – weil ihre Entdeckung und Erschließung ohne eine solidarische Gesellschaft im Hintergrund nie möglich gewesen wäre. Aus Eigennutz – weil das Teilen der Talente Voraussetzung für eine lebendige, solidarische Gesellschaft ist. Damit haben wir den guten Willen. Er offenbart sich als Ausdruck von Vernunft und Nutzen, die zwei Seiten einer Medaille sind. Wir haben gesehen, dass die Vergemeinschaftung der Talente durch die Vereinbarung persönlichen und kollektiven Nutzens sowohl durch utilitaristische wie durch vernünftige Überlegungen möglich ist. In Einheit müssen sich diese Begründungen auch ergänzen und bestärken. Das meine ich mit Was du verlangst, das man dir tu‘, das gesteh‘ auch allen And’ren zu. Ich habe diese höhere Ordnung dialektische Einheit von Vernunft und Nutzen und ihr Ergebnis den guten Willen genannt. Wo der Wille gut ist, da ist auch ein Weg. Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe und alle Entlehnungen als solche gekennzeichnet habe. Lovis Pape 4