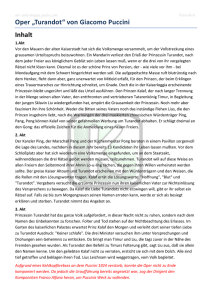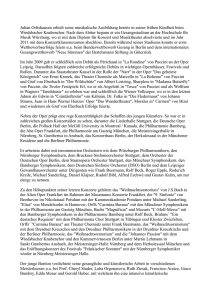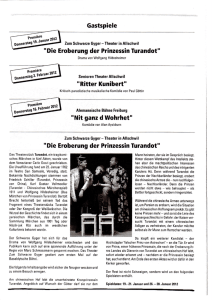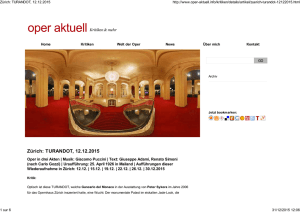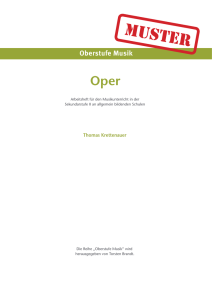Giacomo Puccini Turandot
Werbung
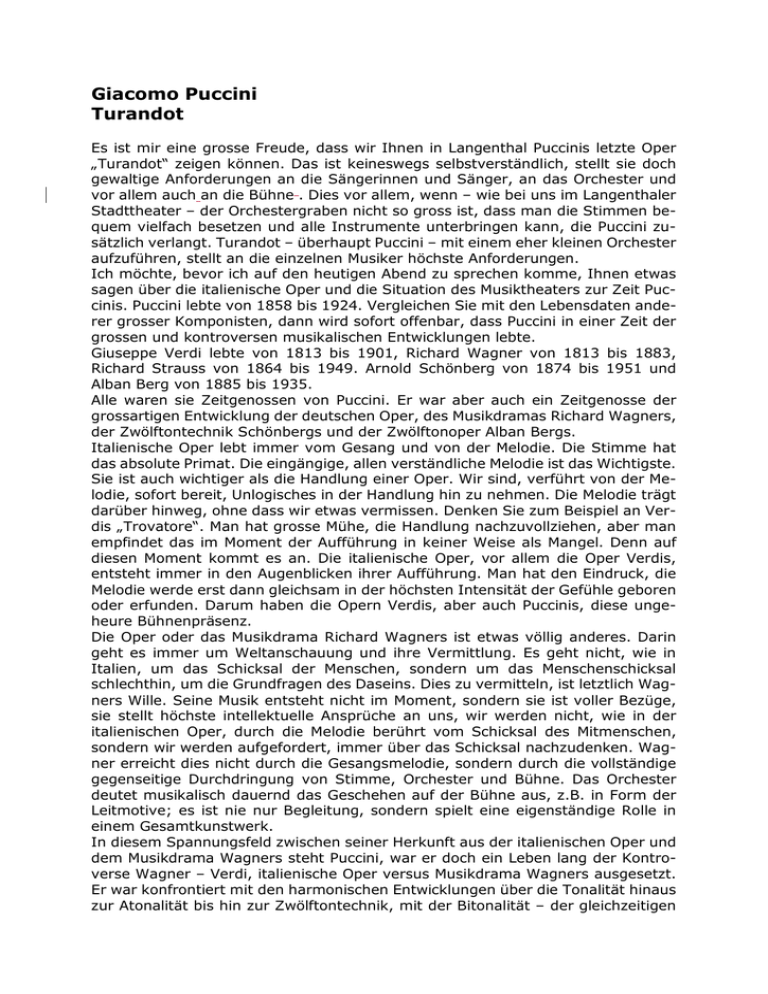
Giacomo Puccini Turandot Es ist mir eine grosse Freude, dass wir Ihnen in Langenthal Puccinis letzte Oper „Turandot“ zeigen können. Das ist keineswegs selbstverständlich, stellt sie doch gewaltige Anforderungen an die Sängerinnen und Sänger, an das Orchester und vor allem auch an die Bühne . Dies vor allem, wenn – wie bei uns im Langenthaler Stadttheater – der Orchestergraben nicht so gross ist, dass man die Stimmen bequem vielfach besetzen und alle Instrumente unterbringen kann, die Puccini zusätzlich verlangt. Turandot – überhaupt Puccini – mit einem eher kleinen Orchester aufzuführen, stellt an die einzelnen Musiker höchste Anforderungen. Ich möchte, bevor ich auf den heutigen Abend zu sprechen komme, Ihnen etwas sagen über die italienische Oper und die Situation des Musiktheaters zur Zeit Puccinis. Puccini lebte von 1858 bis 1924. Vergleichen Sie mit den Lebensdaten anderer grosser Komponisten, dann wird sofort offenbar, dass Puccini in einer Zeit der grossen und kontroversen musikalischen Entwicklungen lebte. Giuseppe Verdi lebte von 1813 bis 1901, Richard Wagner von 1813 bis 1883, Richard Strauss von 1864 bis 1949. Arnold Schönberg von 1874 bis 1951 und Alban Berg von 1885 bis 1935. Alle waren sie Zeitgenossen von Puccini. Er war aber auch ein Zeitgenosse der grossartigen Entwicklung der deutschen Oper, des Musikdramas Richard Wagners, der Zwölftontechnik Schönbergs und der Zwölftonoper Alban Bergs. Italienische Oper lebt immer vom Gesang und von der Melodie. Die Stimme hat das absolute Primat. Die eingängige, allen verständliche Melodie ist das Wichtigste. Sie ist auch wichtiger als die Handlung einer Oper. Wir sind, verführt von der Melodie, sofort bereit, Unlogisches in der Handlung hin zu nehmen. Die Melodie trägt darüber hinweg, ohne dass wir etwas vermissen. Denken Sie zum Beispiel an Verdis „Trovatore“. Man hat grosse Mühe, die Handlung nachzuvollziehen, aber man empfindet das im Moment der Aufführung in keiner Weise als Mangel. Denn auf diesen Moment kommt es an. Die italienische Oper, vor allem die Oper Verdis, entsteht immer in den Augenblicken ihrer Aufführung. Man hat den Eindruck, die Melodie werde erst dann gleichsam in der höchsten Intensität der Gefühle geboren oder erfunden. Darum haben die Opern Verdis, aber auch Puccinis, diese ungeheure Bühnenpräsenz. Die Oper oder das Musikdrama Richard Wagners ist etwas völlig anderes. Darin geht es immer um Weltanschauung und ihre Vermittlung. Es geht nicht, wie in Italien, um das Schicksal der Menschen, sondern um das Menschenschicksal schlechthin, um die Grundfragen des Daseins. Dies zu vermitteln, ist letztlich Wagners Wille. Seine Musik entsteht nicht im Moment, sondern sie ist voller Bezüge, sie stellt höchste intellektuelle Ansprüche an uns, wir werden nicht, wie in der italienischen Oper, durch die Melodie berührt vom Schicksal des Mitmenschen, sondern wir werden aufgefordert, immer über das Schicksal nachzudenken. Wagner erreicht dies nicht durch die Gesangsmelodie, sondern durch die vollständige gegenseitige Durchdringung von Stimme, Orchester und Bühne. Das Orchester deutet musikalisch dauernd das Geschehen auf der Bühne aus, z.B. in Form der Leitmotive; es ist nie nur Begleitung, sondern spielt eine eigenständige Rolle in einem Gesamtkunstwerk. In diesem Spannungsfeld zwischen seiner Herkunft aus der italienischen Oper und dem Musikdrama Wagners steht Puccini, war er doch ein Leben lang der Kontroverse Wagner – Verdi, italienische Oper versus Musikdrama Wagners ausgesetzt. Er war konfrontiert mit den harmonischen Entwicklungen über die Tonalität hinaus zur Atonalität bis hin zur Zwölftontechnik, mit der Bitonalität – der gleichzeitigen Giacomo Puccini: Turandot Verwendung zweier Tonarten -, mit der Polyrhythmik. Er konnte diese Entwicklungen in Deutschland nicht ignorieren, er musste in seinem Werk den Versuch machen, sie zu integrieren und aufzunehmen in das, was seine italienische Herkunft von ihm verlangte. Er hat bei aller Liebe zu Richard Wagner, bei genauester Kenntnis der Musik von Strauss und Schönberg seine Wurzeln, die italienische Oper, nie verlassen – im Gegenteil, es ist ihm gelungen, die deutschen Entwicklungen in die italienische Oper aufzunehmen. Das hat ihn zum bedeutendsten italienischen Opernkomponisten nach Verdi gemacht, es hat ihm aber auch den Ruf des Epigonen eingetragen. Puccini bleibt in all seinen Opern dem Gesangsideal der italienischen Oper treu und verpflichtet. Er ist ein Meister darin, die Sprache – manchmal fast die Alltagssprache – in „blumige“ Musik und Melodie zu fassen. Kaum ein anderer Komponist schafft es, das handlungsfördernde Gespräch dermassen flüssig und gleichsam „natürlich“ in Gesang zu verwandeln. Rezitative und Arien gehen nahtlos ineinander über. Alles ist Gesang! Das Primat des Gesanges bleibt in jeder Oper Puccinis erhalten, in der Sinnlichkeit des Einzelgesanges, aber auch des Ensembles liegt die Dramatik und die Kunst seiner Oper. Der „Corriere della sera“ schrieb nach der Uraufführung der Turandot: „Er ist ein wahrhaft italienischer Geist. Sein Gesang ist der Ausdruck unserer künstlerisch empfundenen Sinnlichkeit: er liebkost uns und nimmt uns ganz gefangen!“ Puccinis grosses Bestreben als Komponist war es, eine Opernbühne zu schaffen, die allen Menschen gleichermassen zugänglich ist. Es gelingt ihm, die Entwicklungen seiner Zeit aufzunehmen und gleichsam zu popularisieren. Sein Orchester ist zwar niemals nur „Begleitung“, aber es bleibt bei aller äussersten Differenziertheit der Instrumentation immer dem Gesang verbunden und deutet nicht selbstständig das Bühnengeschehen aus wie bei Wagner. Er greift die Entwicklungen der Harmonik auf, die Atonalität der Nachromantiker oder der Impressionisten ist ihm nicht fremd. Aber er baut sie ein in das Primat der italienischen Melodie, macht die damals noch unverständliche Harmonik Richard Wagners – etwa der Tristan-Harmonik, die er in seiner Messe nachahmt – verständlich, indem er sie einer Gesangsmelodie zuordnet. Oder er macht die Polyrhythmik Strawinskis, also eine Rhythmik, die gegen den Takt läuft, begreifbar, indem er ihr in der Handlung einen nachvollziehbaren Platz zuweist. Das ist Puccinis ganz grosse Leistung: Er hat die Musik seiner Zeit aufgenommen und aufgehoben in der italienischen Oper. Durch die ungebrochene Vorherrschaft des Gesangs und der Melodie hat er es geschafft, die Neuerungen verständlich und zugänglich zu machen. Und er hat die italienische Gesangsoper fortgeführt und neu begründet. Diese Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat, war eine ungeheure Belastung, der er dann trotz aller äusseren Erfolge im Kern nicht gewachsen sein konnte. Einflüsse sind unverkennbar: Salome von Richard Strauss, der Pierrot lunaire von Arnold Schönberg und vor allem Strawinksis „Sacre du printemps“ haben Puccini tief beeindruckt, gefördert, aber wohl auch verstört. Diese Leistung hat man erst in den letzten Jahrzehnten zu würdigen begonnen. Lange Zeit galt Puccini als Epigone, seinen Orchesterklang bezeichnete man als leer und seine Stoffe nur für ein wenig anspruchsvolles Publikum geeignet. Dieses Publikum aber ist diesem Urteil nie gefolgt. Es hat immer – anders als die Kritikaster - erkannt, dass hier ein ganz grosser Künstler am Werk ist. In einem Brief schreibt Puccini über sich in einer Phase der Untätigkeit: „Ich lege die Hände aufs Klavier und beschmutze sie mit Staub! Keine Spur von Musik. Die Musik? Eine nutzlose Sache. Wenn ich kein Libretto habe, wie soll ich Musik machen? Ich habe diesen grossen Mangel, dass ich nur komponieren kann, wenn 2 Giacomo Puccini: Turandot meine Marionetten aus Fleisch und Blut sich auf der Bühne bewegen. Ich könnte ein reiner Sinfoniker sein, aber dann würde ich meine Zeit und mein Publikum betrügen. Der heilige Gott berührte mich mit dem kleinen Finger und sagte: Schreibe für das Theater: hörst du – nur für das Theater, und ich hab den höchsten Rat befolgt.“ Das sind aufschlussreiche Worte. Musik ist für ihn offenbar ausschliesslich Oper, nicht Sinfonie, nicht Kammermusik, sondern ausschliesslich Oper, Theater. In diesem Brief kommt aber auch zum Ausdruck, wie entscheidend für ihn ein gutes Libretto war. Puccini war ein Leben lang auf der Suche nach guten Libretti, mit vielen Textdichtern hat er sich überworfen, weil er ganz genaue Vorstellungen hatte, wie ein Libretto auszusehen hatte. Er hatte nicht das Glück wie Richard Strauss, der in Hugo von Hofmannsthal und Stefan Zweig kongeniale Textdichter gefunden hatte. Auch konnte er nicht – wie Richard Wagner – das Libretto selber dichten. So war die Suche nach dem Textdichter und dann die Auseinandersetzung mit ihm, bis er mit dem Text einverstanden war, ein einziger Kampf. Puccini konnte nicht, wie Donizetti, einfach ein Textbuch in ein paar Wochen vertonen. Die Komposition war ein jahrelanges Ringen mit den Dichtern des Textes. Und immer auch war es ein Ringen mit der Form. Wie kann im beginnenden 20. Jahrhundert, welches die musikalischen Traditionen auflöst, italienische Oper noch geformt werden? Wie können die musikalischen Entwicklungen in die Melodie eingefügt werden, und vor allem: Welche Form und Handlung kann italienische Oper noch haben, wenn die Operntraditionen nicht mehr tragen? Mit den drei Meisterwerken, der „Bohème“, der „Tosca“ und der „Madama Butterfly“ hatte Puccini wohl die drei erfolgreichsten Opern überhaupt geschaffen. Aber er spürte, dass die Zeit der geschlossenen Opernform vorbei war. Die revolutionären Entwicklungen in der Harmonik seiner Zeit verlangten nach neuen Formen auch in der italienischen Oper, trotz des für Puccini unbestrittenen Primats der Melodie. „Keine Musik kann ohne Melodie existieren“, sagt er. An dieser Suche, an diesem grossen Versuch, nach der „Butterfly“ neue Ausdrucksformen zu finden, ist Puccini, trotz weiterer grosser Erfolge, gescheitert. Der erste Ausbruch aus der Tradition war die Oper „La fanciulla del West“, das „Mädchen aus dem goldenen Westen“. Es ist eine Goldgräberoper, in der Puccini auch Rhythmen des Jazz einzubinden versteht. Amerika war das Land der Zukunft, auch der Zukunft der italienischen Oper. Caruso trat mehr in New York auf, als in Italien. Diesem Amerika zollt Puccini seinen Tribut mit der Goldgräberoper. Der Erfolg in Amerika ist gewaltig, in Europa wird die Oper jedoch kaum zur Kenntnis genommen und nur selten aufgeführt. Eine Goldgräberoper hat etwas Anachronistisches, wenn man auf die Westernproduktionen Hollywoods blickt. Ein anderer Versuch zur neuen Form war Puccinis Gang nach Wien. Er komponierte eine Art Wiener Operette, im Stile Franz Léhars, „la Rondine“, die Schwalbe. Trotz einigen Erfolgs in Wien blieb die „seine“ leichte Oper Episode. Am tiefsten versucht wohl Puccini mit dem „Triptychon“, zu einer neuen Form zu finden. Nicht mehr eine geschlossene Handlung, sondern drei Einakter mit ganz unterschiedlichen Handlungen bestimmen die Bühne. Den einzelnen Opern ist zwar wiederum ein grosser Erfolg beschieden, besonders der letzten „Gianni Schicci“, die, umwerfend komisch, zurückgreift auf Dante und auf die Commedia dell’arte. Aber als Triptychon, als Dreiheit werden die Opern kaum je aufgeführt. Nach jahrelanger Suche greift Puccini zum Märchen. Turandot ist ursprünglich ein persisches Märchen, das im Gewande Chinas erscheint. Es ist berührend, dass Puccini im Märchen am Schluss seines Lebens die Opernform zu finden glaubt, die italienische Operntradition und musikalische Entwicklung verbinden kann. Es ist in aller Literatur immer wieder das Märchen, das in seiner Irrationalität jene Tiefe erreicht, die Gültiges zu sagen im Stande ist. 3 Giacomo Puccini: Turandot Wenden wir uns zuerst dem Inhalt der heutigen Oper zu. Wir befinden uns in Peking in einer Märchenzeit, immer und nie. Ein Mandarin verkündet dem Volke von Peking das Gesetz: Die Prinzessin Turandot ist willens, den Mann zu heiraten, der im Stande ist, ihre drei Rätsel zu lösen. Wer es nicht vermag, verfällt dem Tode. Soeben wird der junge Prinz von Persien zur Richtstätte geführt. Das Volk stürmt gegen den Palast, den Prinzen seiner Strafe zuzuführen. Im Tumult der Menge stürzt ein alter Mann, seine Sklavin bemüht sich vergeblich um ihn. Da tritt ein junger Mann hinzu und erkennt im Alten seinen Vater, den er tot geglaubt. Es ist Timur, der entthronte König der Tataren, der nun müde und schwach durch die Welt wandert. Begleitet wird er von der Sklavin Liu, die ihn ergeben umsorgt, weil der Sohn des Königs, eben jener, der jetzt vor ihr steht, ihr einmal zugelächelt hat. Der todgeweihte persische Prinz zieht vorbei und das wankelmütige Volk bittet nun, da es ihn leibhaftig sieht, um Gnade - vergebens. Timurs Sohn, der unbekannte Prinz, verflucht die blutrünstige Prinzessin. Da aber erscheint sie selbst, das Volk sinkt in die Knie, der Prinz ist mit einem Schlag von der Schönheit Turandots verzaubert , und er beschliesst, als Rätsellöser um die Hand der Prinzessin zu werben. Er ist taub für die warnenden Worte seines Vaters und für das Flehen Lius. Auch die drei Hofbeamten Ping, Pong und Pang können ihn trotz ihrer Redseligkeit und ihrer komischen Argumente nicht davon abbringen, als Freier aufzutreten. Mit kräftigen Schlägen verkündet der riesige Gong seine Ankunft als neuer Freier. Der zweite Akt beginnt mit dem Gespräch der drei Hofbeamten, drei komischen Figuren, die das schreckliche Geschehen kommentieren. Dann befinden wir uns im Thronsaal, ganz oben sitzt der Kaiser, Turandots Vater, dann seine Hofbeamten, die Schriftgelehrten, Weisen und Würdenträger des Reiches. Noch einmal versucht der Kaiser, den unbekannten Prinzen von seinem Vorhaben, die Rätsel lösen zu wollen, abzubringen. Doch der Prinz besteht darauf. Da tritt Turandot ein, schön und hochmütig. Voll Hass blickt sie auf den Mann, der um sie wirbt. In ihrer Auftrittsarie erklärt sie auch, warum sie so handelt. Vor langer Zeit sei eine chinesische Prinzessin geraubt und entführt worden, sie sei nun die Rächerin an ihrer Ahnin. Niemals werde sie einem Mann gehören, sondern sie werde sich an allen grausam rächen, die nur dran dächten, um ihre Hand anzuhalten. „Drei Rätsel ein Tod!“ sagt sie; der Prinz erwidert: „Drei Rätsel - ein Leben“. Sie stellt nun ihre drei Rätsel: Was ist das Phantom, das jede Nacht neu im Menschen geboren wird und jeden Tag in ihm stirbt? Der Prinz erkennt darin augenblicklich die Hoffnung - das erste Rätsel ist gelöst. Das zweite löst er ebenso ohne Zögern. Er erkennt das Blut, das wie eine Flamme lodert und doch kein Feuer ist und das wie Fieber rast und im Tode erkaltet. Auch das dritte Rätsel löst er: Welches ist das Eis, das verbrennen kann und umso mehr es verbrennt, desto kälter werde? Der Prinz antwortet ohne Zögern: Turandot ist das Eis. Damit ist Turandot geschlagen. Verzweifelt wirft sie sich zu Füssen des Kaisers und bittet ihn, dass er sie nicht dem Fremden überantworten möge. Doch der Kaiser ist hart und erinnert sie an die Abmachungen. Der Prinz aber handelt grossmütig. Er sei bereit zu sterben, wenn sie eine einzige Frage beantworten könne, nämlich bis zum Morgengrauen seinen Namen herauszufinden. Der Prinz verbringt die Nacht in den kaiserlichen Gärten. Die Boten Turandots durcheilen die Stadt, um jemanden zu finden, der den Namen kennt. „Keiner schlafe“ rufen sie, daraus formt der Prinz eine der schönsten Arien der italienischen Oper: „Nessun dorma“-. Der Prinz ist sich seiner Sache sicher. Doch da erinnert sich plötzlich jemand, dass er im Laufe des Tages den fremden Prinzen mit einem alten Mann und einer jungen Sklavin gesehen hat. Sofort wird diese Fährte verfolgt, und es dauert denn auch nicht lange, bis die beiden gefunden 4 Giacomo Puccini: Turandot und gefangen sind. Turandot selbst erscheint und will den beiden das Geheimnis des Namens mit der Folter entreissen. Da tritt Liu bescheiden vor und sagt, der Alte wisse nichts, sie aber wisse den Namen, werde ihn aber niemals verraten. Liu erträgt die Folter mit einem Lächeln, dann entreisst sie einem Soldaten den Dolch und stösst ihn sich ins Herz. Sterbend spricht sie die Worte: „Du, eisgepanzerte Prinzessin, auch du wirst ihn lieben, ich schliesse meine Augen, damit er nochmals siege.“ Der Prinz bleibt von diesem Opfertod merkwürdig unberührt. Bewegt zieht sich die Menge zurück. Turandot und der Prinz stehen sich Auge in Auge gegenüber. Da reisst ihr der Prinz den Schleier vom Gesicht und küsst sie leidenschaftlich. Dann gibt er seinen Namen preis und liefert sich ihr völlig aus: „Io son Kalaf“. Turandot ist von einem nie gekannten Glück erschüttert, als über Peking der Morgen graut. Ferne Trompeten künden den Schluss an: Turandot muss vor versammeltem Hofstaat den Namen des Fremden verkünden. Und unter dem Jubel des Volkes ruft Turandot: „Hoher Vater – ich kenne den Namen des Fremdlings – er heisst – Gemahl!“ Das ist die Handlung der Oper. Puccini und seine Textdichter fanden sie in einem Schauspiel des Venezianers Carlo Gozzi, einem Zeitgenossen von Carlo Goldoni. Der Stoff stammt ursprünglich aus einer persischen oder chinesischen Märchensammlung. Gozzi verteidigte gegen den Theaterreformer Goldoni die Figuren und Handlungen der Commedia dell’arte und schrieb zehn Märchenspiele, um die Bedeutung dieser Tradition zu zeigen. Turandot ist eines davon. Die Figuren der Commedia dell’arte, Brigella, Trufaldin und Pantalone nehmen sich zwar im chinesischen Milieu seltsam aus. Trotzdem war Friedrich Schiller von Gozzis Märchenspiel so beeindruckt, dass er es auf Deutsch übersetzte und im Blankvers in ein klassisches Schauspiel übertrug. Seltsamerweise behielt auch er die Figuren der Commedia bei. Überhaupt hatten Gozzis Werke in Deutschland einen grossen Erfolg. Auch Goethe hat sich für die „Turandotte“, wie er sagt, interessiert und Carl Maria von Weber hat zum Stück von Gozzi eine Schauspielmusik geschrieben, die auch schon chinesische Originalmelodien verwendet und aus der Puccini auch zitiert. Die Turandot wurde vor Puccini bereits sechsmal vertont. Heute wird das Schauspiel Schillers so gut wie nie mehr aufgeführt. Aus diesen Quellen aber schöpfte Puccini. Aber er nahm doch gewichtige Änderungen vor. Die Figuren der Commedia dell’arte reduzierte er auf die drei Hofbeamten Ping, Pong und Pang, die das schreckliche Geschehen komisch kommentieren, Distanz schaffen zu Turandot, aber trotzdem auch ganz aus der bösen Welt der Turandot stammen. Vor allem aber verlangte Puccini, dass eine zweite Frauenfigur eingefügt werde. Die Liu ist seine Erfindung. Es brauchte eine weibliche Gegenfigur zu diesem Monster Turandot, eine echt liebende Frau. Wie notwendig diese Figur ist, werden wir noch sehen. Was hat Puccini an diesem Text, an dieser Geschichte fasziniert? Puccinis Opern bisher lebten von der Individualität der Figuren. Mimi und Rodolfo in der „Bohème“, Cho-Cho-San in der „Butterfly“ sind Individuen, soweit eben Opernfiguren Individuen sein können. Hier: der reine Mythos. In „Turandot“ ist einzig die zusätzlich eingefügte Liu eine individuelle Figur. Puccini hat sie wohl deswegen “erfunden“, um einen Kontrast zur Typenhaftigkeit der anderen mythischen Figuren zu bilden; und wohl auch, um eine weibliche Figur zu haben, der er all die Fülle des Wohllauts in die Partie legen konnte. Sie ist die einzige Figur, die ans Herz rührt! Offenbar suchte aber Puccini am Schluss seines Lebenswerks nicht mehr in erster Linie die psychische Einsichtigkeit, nicht mehr wird das Menschliche, überhöht dargestellt am Schicksal des einzelnen Menschen, sondern jetzt sucht er gleichsam 5 Giacomo Puccini: Turandot die reine Form im Mythos. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist unerklärlich – wird sie auf der Bühne am Schicksal des Einzelnen dargestellt, bleibt sie immer akzidentiell, immer an das Individuum gebunden und damit immer auch die Liebe der anderen. Wenn mythische Figuren lieben, wird die Liebe als unerklärliche Urkraft sichtbar. Dies ist für den Schluss der Turandot ganz wichtig. Verstehen wir die Prinzessin Turandot und den Prinzen Kalaf als individuelle Figuren, dann ist der Schluss der Oper unlogisch und dramaturgisch unbefriedigend. Wieso soll das männermordende Monster Turandot nun urplötzlich in Liebe zu einem Mann entbrennen? Dass er die Rätsel hat lösen können, kann kein Grund sein. Diese wurden ja gestellt, um die Männer zu vernichten, nicht um sie zu gewinnen. Der Schluss ist – vom Standpunkt des Individuellen her – also nicht nachvollziehbar. Vom Standpunkt des Märchenhaften jedoch, vom Mythischen ist er wunderbar: Liebe ist und bleibt unerklärlich, märchenhaft und überraschend. Wer es trotzdem versucht, die Liebe zu erklären, zeigt die Liebe zweier Menschen aus Fleisch und Blut oder er zeigt – wie Puccini hier – ihre märchenhafte, mythische Irrationalität. Puccini hat sich trotzdem mit diesem Schluss sehr schwer getan. Noch in einem seiner letzten Briefe an die Textdichter, den er kurz vor seiner Abreise nach Brüssel geschrieben hat, verlangte er Korrekturen am Text des Schlusses. Puccini kehrte aus Brüssel nicht mehr zurück. Er stirbt am 29. November 1924 an Kehlkopfkrebs in einem Brüsseler Spital. Turandot hinterlässt er als Fragment. Die Komposition ist fertig instrumentiert, bis zum Tode von Liu. Der Schluss ist nur in etwa zwei Dutzend Skizzenblättern erhalten. Puccini hat ihn nicht mehr ausführen können.. Sein Schüler Franco Alfano hat die Schlussszene nach den Skizzen komponiert und instrumentiert, absolut glänzend, kein Zuhörer wird einen Einschnitt wahrnehmen. Aber wir wissen nicht, ob Puccini selbst auch ein so grandioses Finale komponiert hätte, die Skizzen sagen zu wenig aus. Vielleicht hätte er es ganz anders gemacht, weniger grossartig. Es gibt einen zweiten Kompositionsversuch von Luciano Berio, dem Avantgardisten, der den Schluss weit weniger pompös gestaltet. Auch in einer zweiten Hinsicht ist „Turandot“ Fragment. Puccini hat seine Oper nie gehört. Und wir wissen, dass er immer, wenn die Proben begannen, seine innere Klangvorstellung an der tatsächlichen mass und dann noch ziemlich tief greifende Korrekturen vornahm. Diese Korrekturen sind bei Turandot zwangsläufig unterblieben. Arturo Toscanini beendete die Uraufführung 1926 an der Mailänder Scala an der Stelle, an der Puccini die Feder aus der Hand gelegt hatte. Erst am nächsten Abend erklang die volle Oper mit dem Schluss von Franco Alfano. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen einiges zur Puccinis Musik sagen möchte. Man liest in den Opernführern, dass Puccinis Musik in der Turandot „exotische Elemente“ habe, also Elemente chinesischer Musik. Wir müssen hier einen kleinen Versuch machen zu erklären, was denn der Hauptunterschied zwischen der Musik des Abendlandes und der Musik des Fernen Ostens ist. Unsere Musik – seit dem 17. Jahrhundert oder ungefähr seit Bach – hat sich homophon entwickelt. Das heisst, der Zusammenklang der Stimmen im Akkord tritt in den Vordergrund. Also die Hauptlinie der Musik ist gleichsam vertikal. Akkord reiht sich an Akkord, und die Melodie wird in Funktion der Harmonie verstanden. Die einzelnen Akkorde stehen nun in einem Spannungsverhältnis zueinander, im Verhältnis von Spannung und Entspannung. Spannung wird durch bestimmte, oft dissonante Akkorde erzeugt, die sich dann in eine konsonante Harmonie auflösen. Am augen- oder besser ohrenfälligsten ist dies bei den Schlusswendungen eines Musikstücks, Dominante – mit der Septime sogar dissonant – löst sich auf in die Tonika, in den Grundakkord der Tonart. Spannung und Entspannung ist das harmonische 6 Giacomo Puccini: Turandot Grundschema der abendländischen Musik. Der dissonante Klang wird – sehr vereinfacht jetzt – möglich durch die Tatsache, dass unsere Tonleiter Halbtonschritte kennt. Mi – fa und vor allem ti – do. Ti – do ist ein Tonschritt, der in den Grundton leitet, es ist ein Leitton. Die Musik des späten 19. Jahrhunderts – also Puccinis Zeit - nützt dieses Grundschema von Spannung und Entspannung, von Leitton und Lösung nun extrem stark. Man spricht sogar von der Tyrannei des Leittons, sie gibt der Musik von Richard Strauss etwa das, was wir oft als überhitzt empfinden. Und diese Tyrannei des Leittons führt dann letztlich – in der Zeit Puccinis – zur Auflösung der Tonalität. Die chinesische Musik hat nun ganz andere Grundlagen. Sie ist einerseits viel stärker in den religiösen und gesellschaftlichen Ritus eingebunden, unterscheidet sich auch stark in der Rhythmik von unserer Musik. Aber eben auch harmonisch. Und diese Unterschiede nützt nun Puccini in der Turandot, wie bereits auch schon in der Butterfly. Sind die fernöstlichen Klänge der Butterfly noch oft Lokalkolorit, so nützt Puccini die fernöstliche Harmonik nun weit differenzierter. Östliche Musik verzichtet auf das Verhältnis von Spannung und Entspannung in harmonischem Sinne. Es gibt keinen konstituierenden Leitton. Die Oktave wird nicht in Ganz- und Halbtöne eingeteilt, sondern in Ganztöne. Die Ganztonleiter mit sechs Tonschritten innerhalb der Oktave bestimmt die Harmonie. Das gibt der Musik etwas Schwebendes, gleichsam Ortsloses, für unser Ohr auch etwas Dissonantes, das aber nicht nach einer Auflösung in die Konsonanz drängt. Die Dreiklänge der Ganztonleiter – soviel für Spezialisten – sind immer übermässig, weil nur grosse Terzen möglich sind. Das wirkt auf uns „exotisch“. Das zweite Merkmal östlicher Musik ist die Pentatonik. Die ersten fünf Quinten des Quintenzirkels werden gleichsam in einer Tonart vereinigt. Auch hier gibt es keinen Leitton. Ein simples Beispiel. Wenn Sie auf dem Klavier nur die schwarzen Tasten drücken, dann haben Sie pentatonische Harmonien. Versuchen Sie es einmal, alles, was Sie nur auf den schwarzen Tasten machen, tönt immer irgendwie richtig, passt immer zusammen, eben weil nur Ganztonschritte und eine kleine Terz erklingen, weil es also keinen Leitton gibt, der zielstrebig in eine Auflösung führt. Wenn Sie nun also heute Abend das Gefühl haben, exotische Musik zu hören, dann sind es diese beiden Elemente, die sie ausmachen: Ganztonleitern und Pentatonik. Es gibt im Japanischen – und Puccini verwendet auch diese – auch eine Pentatonik mit Halbtonschritten, die aber keine Leittöne sind. Das dritte exotische Element ist die Verwendung von chinesischen Originalmelodien. Puccini verarbeitet acht chinesische rituelle Melodien. Das ist der musikalisch-kompositorische Ausgangspunkt der Turandot: Integration der Entwicklungen seiner Zeit in die italienische Oper und Integration fernöstlicher Harmonik und Rhythmik. Ich will Ihnen einige Hinweise geben. Bereits der Beginn der Oper ist kompromisslos: Im Fortissimo erklingt ein Ganztonmotiv, das bitonal weitergeführt wird: Zwei eigentlich unvereinbare Akkorde, d-moll und Cis-Dur, erklingen penetrant miteinander und machen uns unmissverständlich klar, dass uns nichts Leichtes erwartet. Sie werden im ersten Akt nie gleichsam in den Genuss entlassen, die Rolle des Chors gemahnt an den Chor der griechischen Tragödie, der das Geschehen kommentiert. Aber der Zuhörer findet sich im Kommentar des Chores nie wieder. Dauernd wechselt der Takt von 2/4 zu ¾, die gewaltige Chorszene mit dem Aufgebot des ganzen Orchesters schwankt dauernd im Tempo und bildet die Wankelmütigkeit des Volkes ab, das zwischen Blutdurst und Bitte um Gnade hin und her pendelt. Auch die drei Hofbeamten Ping, Pong und Pang irritieren. Es sind einerseits Marionetten, andererseits Menschen, der Zuhörer kann sie nicht recht einordnen. Die ganze Komposition, bis zum Auftritt der Turandot im zweiten Akt, hinterlässt uns 7 Giacomo Puccini: Turandot Zuhörer irritiert, das Orchester denunziert gleichsam die Handlung auf der Bühne, macht uns unsicher und gibt uns preis. Einzig die beiden Arioso von Liu und Kalaf im ersten Akt lassen uns einen Moment ruhen. In der grossen Arie der Turandot im zweiten Akt, in der sie ihre Grausamkeit entfaltet, kehrt das Verstörende wieder. Das Rezitativ lässt sich in keine Tonart fassen, die Erklärung, warum Turandot die Männer mordet, ist eine Art entsetzliches Wiegenlied, dass uns die doppelten Böden der Handlung vor Augen führt. Bei Turandots Schwur, dass sie nie einem Mann angehören werde, erklingt aber im Orchester bereits das grosse Liebesmotiv, das schwelgerische Liebesthema – hier noch gestört durch völlig melodiefremde Töne in den Bläsern. Auch greift Puccini in der Arie Turandots voraus auf Motive der Todesarie der Liu. Die Rätselszene, die nun folgt, ist einer genialsten Szenen der Opernliteratur überhaupt. Die Arie stellt gewaltige Ansprüche an die Sopranistin, die riesigen Intervallsprünge und das hohe C, das im Laufe der Arie mehrfach verlangt wird, machen sie zu den gefürchtetsten Arien der Oper. Im dritten Akt erklingt eine der berühmtesten Arien für Tenor: „Nessun dorma“ „Keiner schlafe“. Leider ist diese Arie zu einem Renommierstück der Tenöre geworden, völlig aus dem Kontext herausgelöst. Puccini lässt die Arie ganz aus dem Räumlichen entstehen. Die Herolde verkünden den Befehl Turandots, nicht zu schlafen und den Namen des Prinzen bis zum Morgengrauen zu finden. Daraus, also interpretierend und nachdenkend, entwickelt Kalaf die Arie, die eigentlich gleichsam im Verborgenen gesungen werden müsste. Dass Puccini das so gemeint hat, zeigen seine ganz genauen Tempovorgaben, die kaum je eingehalten werden, vor allem aber lässt er dem Publikum keinen Moment zu applaudieren. Die Arie geht ohne Pause in die nächste Szene weiter. Auch hier – Verunsicherung, keine Tradition. Das letzte Stück, das Puccini komponiert hat, ist die Todesarie der Liu „Tu, che di gel sei cinto“ – „Du, vom Eis umgürtet“. Die Arie ist als Trauermarsch gestaltet, der aber wieder durch die Schreie des Chores gestört wird. Achten Sie darauf, wie der Schluss der Szene in einem leisen hohen Piccoloton verweht. Hier hätte die Oper enden können. Franco Alfano hat – wie gesagt – das Werk vervollständigt. So sehr wir seine Arbeit bewundern müssen, so sehr er Puccinis Klangvorstellungen hat umsetzen können, so sehr müssen wir uns doch fragen, ob Puccini nach diesem Stück der Verstörung und des dauernden Aufrüttelns einen so hymnisch problemlosen Schluss gemacht hätte. Keine der Opern Puccinis endet in dieser Art. In seinem letzten Werk verschmelzt Puccini vier Elemente auf geniale Weise: das Lyrisch-Gefühlshafte in der Figur der Liu, das Heldenhafte in den Figuren der Turandot und des Kalaf, das Grotesk-Komische in den drei Masken und das Exotische in der Harmonik. Ich lasse es, meine Damen und Herren, mit diesen paar Hinweisen bewenden. Man kann Musik kaum wirklich beschreiben. Wenn Sie nun nach meinen Worten den Eindruck bekommen haben, es erwarte Sie ein Abend voller Verstörung, so wäre das nicht richtig. Es erwartet Sie wunderbare Musik, trotz aller Irritationen und aller Widersprüche. Das ist meiner Ansicht nach, wie schon eingangs gesagt, das Geniale an Puccinis Musik: Er schafft es, alle Strömungen seiner Zeit und auch die fremde Harmonik in die Melodie und in den Gesang hinein zu nehmen. Er erschafft, um mit Thomas Mann zu reden, eine grandiose „Fülle des Wohllauts“. Darin liegt eine berührende Liebe zum Publikum, er nimmt seine Idee, Oper müsse für alle da sein, sehr ernst, indem er den Zuhörer ernst nimmt, ihn einbezieht, ihn hinein nimmt in die Melodie. Dem kommt eine Bedeutung zu, die wir nicht unterschätzen dürfen: Turandot ist vielleicht die letzten Oper überhaupt, die auf der ganzen Welt ungebrochen erfolgreich war und ist. Das liegt nicht nur an Puccinis 8 Giacomo Puccini: Turandot Genie, sondern eben auch an seinem kompromisslosen Willen, Oper für alle zu machen. 26. Oktober 2012 9