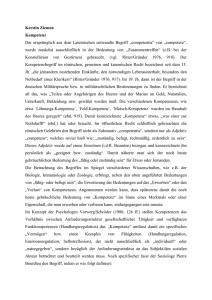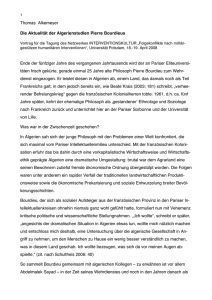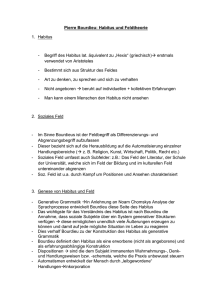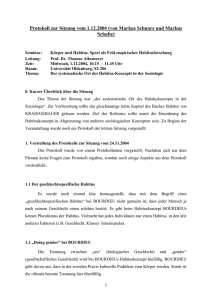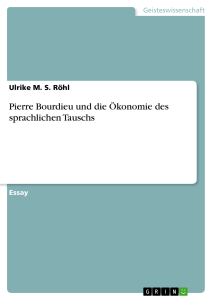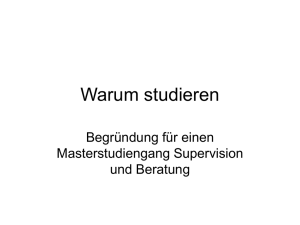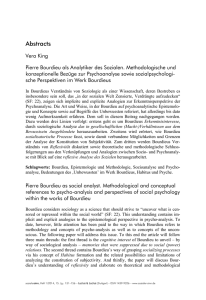Bourdieu-Oevermann
Werbung

Wintersemester 2009/2010 Dozent: Dr. Michael Tetzer Modul: 19631 000 Handlungstheorien der Sozialpädagogik Abgabetermin: 30. April 2010 Die Rezeption von Bourdieus Habituskonzept im Kontext des Professionalisierungskonzepts von Oevermann. Parallelen, Differenzen, Diffusionen. Dipl.-Psych. Hannah Denker Veerßer Str. 20 29525 Uelzen Telefon: 0581-2118660 Fax.: 0581-2118661 E-Mail: [email protected] Studiengang: Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik (M.A.) Matrikel-Nr.: 3006898 Fachsemester: 1 Fächerkombination: Deutsch/ Sozialpädagogik Inhalt 1. Einleitung ................................................................................................................ 1 2. Erkenntnistheoretische Grundpositionen Bourdieus ......................................... 2 2.1 Der strukturalistische Konstuktivismus Bourdieus ............................................ 2 2.2 Die zweite Schicht: Habituskonzeption ............................................................. 3 2.3 Soziales Feld ...................................................................................................... 6 3. Pädagogische Professionalität Oevermanns ........................................................ 9 3.1 Der interaktionistischer Strukturalismus Oevermanns....................................... 9 3.2 Soziale Deutungsmuster................................................................................... 12 3.3 Pädagogische Professionalisierungsbedürftigkeit ............................................ 16 4. Parallelen und Differenzen .................................................................................. 20 4.1 Konstruktivistischer vs. interaktionistischer Strukturalismus.......................... 20 4.2 So und so: Habitus und soziale Deutungsmuster ............................................. 21 5. Abschließende Bemerkungen .......................................................................... 23 Literatur...................................................................................................................... I 1. Einleitung Ackermann und Seek (1999: 8) verlangen im Rahmen der Professionalisierungsdebatte der Sozialen Arbeit eine eindeutige, theoretische Folie für professionelles sozialpädagogisches Handeln. Sie bestimmen Professionalität u.a. über die „strukturtheoretisch revidierte Konzeption des Professionalisierungsbegriffs“ (ebd.) von Oevermann aus den 90er Jahren. Außerdem verstehen die Autoren Bourdieus Habituskonzept als Metarahmen und erweitern dessen Begrifflichkeiten um einen „beruflichen Habitus“ (ebd.: 10). Müller und Becker-Lenz (2008: 25ff) gehen noch einen Schritt weiter und wagen den Versuch Habituserwerbsprozesse von Studierenden der Sozialen Arbeit im Studienverlauf abzubilden. Auch sie setzten an einem ‚beruflichen Habituskonzept’ an. Bereits am Artikelanfang gehen Müller und Becker-Lenz (2008: 25) in einer Fußnote auf das Professionalisierungskonzept von Oevermann ein, indem sie Soziale Arbeit als „professionalisierungsbedürftigen Beruf“ (ebd.) deklarieren. Die AutorInnen gehen davon aus, dass spezifische sozialpädagogische Kompetenzen auf einer habituellen Ebene verinnerlicht werden müssen und sehen in Oevermanns Konzept eine berufliche Habitusformation durchschimmern (vgl. ebd.). Sie berufen sich für diese Aussage v.a. auf Oevermanns Aufsatz von 2001: ‚Die Struktur sozialer Deutungsmuster’ und behaupten: "Oevermann schließt an Bourdieus Habituskonzeption an und geht darüber hinaus, indem er sich aus professionssozilogischer Perspektive mit der Bestimmung eines 'professionellen Habitus' beschäftigt“ (Müller/ Becker 2008: 26). Im Sinne einer forschungsmethodischen Reduktion haben die AutorInnen die Gemeinsamkeiten der beiden Ansätze hervorgehoben. In der vorliegenden Hausarbeit wird es darum gehen, die Parallelen und Differenzen der beiden Konzeptionen herauszuarbeiten. Die grundlegende These ist, dass es sich bei dem bourdieuischen Habituskonzept um ein deskriptives Beschreibungsmodell mit konstruktivistischen Grundpositionen und bei Oevermann um ein interaktionistisch-strukturalistisches Professionsmodell handelt. Durch einen Vergleich der theoretischen Fundierungen und methodischen Ausführungen soll verdeutlicht werden, dass zwischen den beiden Ansätzen neben Gemeinsamkeiten auch deutliche Unterschiede in theoretischer, methodologischer und forschungspraktischer Hinsicht zu verzeichnen sind (vgl. Liebau 1987: 17). Die vorliegenden Ausführungen beginnen mit den erkenntnistheoretischen Grundpositionen Bourdieus und seinen zentralen Begriffspaaren ‚Habitus’ und ‚Feld’ (Kapitel 2). Dann werden die erkenntnistheoretischen Parameter Oevermanns vorgestellt sowie seine Vorstellungen von ‚Deutungsmustern’ und ‚pädagogischer Professionalität’ (Kapitel 2) und schließlich werden die Grundstrukturen der jeweiligen Argumentationslinien auf ihre 1 Parallelen und Differenzen hin untersucht und zueinander in Beziehung gesetzt (Kapitel 4). Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse einer Bewertung unterzogen (Kapitel 5). Insgesamt werden ausgewählte Aspekte beider Forschungstraditionen berücksichtigt, die den Unterschied und die Anknüpfungspunkte der beiden Ansätze hervortreten lassen. 2. Erkenntnistheoretische Grundpositionen Bourdieus Im Folgenden wird deduktiv von der allgemeinen, erkenntnistheoretischen Perspektivierung Bourdieus (2.1) zur detaillierteren Betrachtung zentraler Begrifflichkeiten wie ‚Habitus’ (2.2) und ‚Soziales Feld’ vorgegangen. 2.1 Der strukturalistische Konstuktivismus Bourdieus Schwingel (2005: 22) betont, dass die strukturale Soziologie von Bourdieu von einem konstruktivistischen Selbstverständnis getragen ist und Liebau (1987: 69) untermauert diese Behauptung mit dem Hinweis darauf, dass Bourdieu von einer Subjektvorstellung ausgeht, die das Subjekt in eine „über Vorurteile konstruierte Welt“ (Bourdieu 1981; 149f, zitiert nach Liebau 1987: 69) setzt – die einzige Welt, die das (bourdieuische) Subjekt je kennen wird. Bourdieu geht davon aus, dass die Potentialität des Subjekts als Vernunftswesen nur eine (unter anderen) Möglichkeiten darstellt und an die historisch-gesellschaftlichen Lebensbedingungen geknüpft ist. Die gesellschaftlichen Errungenschaften sind in der Hand weniger monopolisiert (vgl. ebd.: 23). Bourdieus Perspektive ist hierbei eine „radikal historizistische“ (Liebau 1987: 23). Er hält nichts davon, die universelle Vernunft ‚theoretisch’ zu postulieren sondern fragt nach den historisch-sozialen Bedingungen der Möglichkeit, unter denen Vernunft sich potentiell entwickeln kann (vgl. ebd.: 24). Bourdieus Erkenntnisinteresse zielt auf die Rekonstruktion der ‚Ökonomie der Praxis’, wobei diese Ökonomie freilich nicht „auf den bloßen Wahrenaustausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist“ (Bourdieu 1983: 184), sondern insbesondere auch die (scheinbar) „uneigennützigen Beziehungen“ (ebd.) einer kritischen Prüfung unterzieht. Für Bourdieu erscheint das Feld der (Sozial-) Wissenschaft als eines der Orte, in denen Vernunft die Währung der Wahl darstellt und „wer gewinnen will“ (Liebau 1987: 25) muss sich mit dieser Waffe wappnen. Der Kampf im Feld der Wissenschaft gilt der Unwahrheit, der Illusion. Die soziologische Wissenschaft ist in diesem Sinne eine Erkenntnistheorie, die den Kampf um Klassifikationssysteme als Teil des Klassenkampfes zu ihrem primären Gegenstand zu machen hat, gerade weil es keinen absoluten Standpunkt, keine absolute Beobachterperspektive gibt bzw. gerade weil die gesellschaftliche Praxis permanent im Fluss ist (vgl. ebd.: 27ff). Die Folie auf deren Basis Bourdieu seine Begriffe konstruiert, bilden phänomenologische und existenzialistische Ansätze (und selbstverständlich frühe marxistische Theorien), wohingegen seine strukturalistischen Grundprinzipien in der Auseinandersetzung mit linguistischen Theorien u.a. eines de Sausurre entstanden sind (vgl. Liebau 1987: 30). Den 2 genetischen Strukturalismus Piagets und das Kompetenzmodell Chomskys re-interpretiert Bourdieu unter soziologischen Gesichtspunkten. Ein soziologischer Erkenntnismodus steht prinzipiell im Gegensatz zum ‚Schlachtgetümmel’ des Alltags und muss sich seinen Gegenstand mit eigenen Mitteln erobern. Er stellt nicht einfach eine Elaboration alltäglicher Erkenntnis dar, sondern erfordert eine Objektivierung, die das intuitiv als wahr erlebte in ein System von Relationen mit Hilfe wissenschaftlich konstruierter Begrifflichkeiten und Methoden einbettet (vgl. ebd.: 31; 54; Baumgart 2004: 199). Die phänomenologisch-subjektivistischen und die strukturalistisch-objektivistischen Erkenntnisweisen reichen Bourdieu für eine adäquate Theorie-Konstruktion nicht aus, weshalb er „sein eigenes erkenntnistheoretisches Modell“ (Liebau 1987: 32), eine praxeologische Erkenntnisweise, entwickelt. Sie soll die dialektische Beziehung zwischen objektiver Strukturen und strukturierten Dispositionen zu ihrem Gegenstand erheben. Begriffe wie ‚Kultur’, ‚Struktur’, ‚Klasse’ oder ‚Habitus’ sind wissenschaftliche Konstruktionen und keine subjektiv wahrgenommenen ‚Realitäten’ (vgl. Liebau 1987: 33; Bourdieu 1997: 61ff). Die Theorie soll vielmehr ein Bild der Welt aus einer verfremdeten wissenschaftlichen Distanz heraus entwickeln (vgl. Liebau 1987: 35). Bourdieu geht davon aus, dass Alltagserkenntnis und wissenschaftliche Erkenntnis deutlich differieren: Während die Alltagserkenntnis nach klassenspezifischen Normalitätsmustern automatisiert vollzogen wird und nur bedingt bewusstseinsfähig ist, setzt wissenschaftliche Erkenntnis das Wissen um ihre Zwecke, die Beherrschung ihrer Methodologie sowie die Kritik der BeobachterInnenperspektive voraus (vgl. Liebau 1987: 68f; Bourdieu 1997: 66). Im Rahmen dieser Ausführungen können nicht alle bourdieuischen ‚Grundbegriffe’ dargestellt werden – insbesondere da man, wie Rehbein (2006: 13) hervorhebt, davon ausgehen muss, dass seine parallel und mit den Mitteln der Empirie entwickelten Begrifflichkeiten sich im Rahmen seiner Forschungen immer wieder gewandelt und den neu gewonnen Erkenntnissen angepasst wurden. Angesicht der bestehenden Sekundärliteratur über Bourdieu scheint es jedoch gerechtfertigt das Habituskonzept und seine Theorie(n) des Sozialen Feldes als zentrale Begriffe hervorzuheben (vgl. Liebau 1987: 53; Krais 2002: 31ff; Schwingel 2005: 59ff; Fuchs-Heinritz/ König 2005: 113ff; 139ff; Rehbein 2006: 86ff; 105ff). Im folgenden Kapitel steht daher Bourdieus Habitus-Konzeption im Zentrum der Ausführungen. 2.2 Die zweite Schicht: Habituskonzeption Liebau (1987: 53) sieht das Habitus-Konzept gemeinsam mit dem Feld-Konzept als Kern des Bourdieuischen Ansatzes: Wenn Bourdieu in einem seiner zentralen Werke, ‚Die feinen Unterschiede’, den Untertitel ‚Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft’ wählt, so gemahnt er damit an aufklärerische Grundmaximen bzw. an Kants Werk ‚Kritik der reinen Vernunft’ (vgl. Liebau 1987: 55ff; Bourdieu 1987). Allerdings setzt Bourdieu sich die Befreiung Kants 3 aus seinem „philosophischen Idealismus“ (Liebau 1987: 58) zum Ziel, um ihn sozusagen materialistisch-empirisch zu erden. Bourdieu (1987: 277ff) richtet seine Aufmerksamkeit auf diejenigen Handlungen, die ‚automatisch’ vollzogen werden, denen keine bewusst-rationalen Handlungspläne zugrunde liegen, d.h. den routinisierten, alltäglichen Handlungen einer zur Gewohnheit gewordenen Lebenspraxis. Bourdieu (1987: 740) kommt zu der Einsicht, dass das bürgerliche Ideal der Mündigkeit „die Einsicht verhindert [habe], dass wir Menschen, laut Leibnitz, ‚in Dreiviertel unserer Handlungen Automaten sind’, und dass die, wie es so schön heißt, ‚letzten Werte’ nichts weiter sind als erste und ursprüngliche Dispositionen des Körpers, Geschmacks- und Ekelempfindungen“ (Bourdieu 1987: 740). Bourdieu bestimmt den Habitus als ein System verinnerlichter Muster (Inkorporationen) bzw. dauerhafter Dispositionen die die typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen in einer Gesellschaft bzw. einer Kultur erzeugen, ein generativ strukturiertes Konglomerat von erworbenen Einstellungen, Fähigkeiten, Erwartungen, ideologischen Konzeptionen und Routinen. Der Habitus stellt eine Form der ‚generativen Handlungsgrammatik’ dar, die als Vermittlungsinstanz zwischen Struktur und Lebenspraxis fungiert. Im Unterschied zum linguistischen Konzept Chomskys handelt es sich jedoch um historischkulturell wandelbare, nicht um universelle, Dispositionen. Als ‚Grammatik’ wirkt der Habitus indessen, da erworbene Kompetenzen gekonnt aber nicht gewusst werden (vgl. Liebau 1987: 63; Ackermann/ Seek 1999: 10f; Krais 2002: 33; Müller/ Becker-Lenz 2008: 26). Bourdieu versucht über den Habitusbegriff die Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft soziologisch zu überwinden, indem er mit dessen Hilfe „die Individuum gewordene Gestalt von Gesellschaft“ (Liebau 1987: 61) rekonstruiert. Bourdieu analysiert das Individuum dabei nicht als normatives Einzelwesen, sondern als sozialen Akteur par excellance, in dessen individuellen Dispositionen die kollektive menschliche Geschichte eingelagert ist (vgl. Liebau 1987: 60f; Bourdieu 1997: 61f; Fuchs-Heinritz/ König 2005: 114f). Durch seinen individuellen Lebensweg – in der Sprache Bourdieus die ‚trajectoire’ – ist der Akteur zugleich an der Produktion und der Reproduktion sozialer Strukturen beteiligt, die er selbst (auch) erleidet. Er teilt Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsmuster mit jenen sozialen Akteuren, die sich in isomorphen Lebenslagen befinden. Damit ist auch verbunden, dass sich dem sozialen Akteur nur ein (kleiner) Ausschnitt der potentiell erfahrbaren Lebenspraxis eröffnet. Der Kompetenzerwerb im bourdieuischen Sinne geschieht einerseits durch die Teilnahme an der Praxis, sozusagen als Objekt der Praxisformen, als auch als Subjekt von Praxisformen, indem diese Kompetenzen aktualisiert und erweitert werden (vgl. Liebau 1987: 83). Bourdieu unterscheidet an dieser Stelle zwischen Individualhabitus und Klassenhabitus (vgl. Liebau 1987: 61f; Schwingel 2005: 115; Fuchs4 Heinritz/ König 2005: 114f). Während der Klassenhabitus durchschnittliche, typische Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsmuster einer Klasse angibt, handelt es sich beim Individualhabitus um individuelle Stilvarianten dieser kollektiven Muster (vgl. Liebau 1987: 66; 70). Der Habitusbegriff ist ein wissenschaftlich konstruierten Begriff und ein Instrument zum Zwecke der Analyse empirischer Phänomene. Er ist an empirische Indikatoren gekoppelt. (vgl. Bourdieu 1979). Die ontologische Entwicklung des Habitus vollzieht sich, indem ein Individuum die objektiven Strukturen seiner sozialen Welt verinnerlicht, die dann wiederum die bestehende Ordnung reproduzieren. Es handelt sich also um einen doppelten Prozess der Interiorisierung der Exteriorität und der Exteriorität der Interiorität (vgl. Bourdieu 1979: 147, 164; Liebau 1987: 33, Müller/ Becker-Lenz 2008: 26). Bourdieus sozialisatorischer Fokus im Prozess des Habituserwerbs bilden die sekundären und tertiären Bildungssysteme Schule und Hochschule. Die scheinbare Neutralität von Leistungsbewertungen stellt insofern eine Vorzugsbehandlung bildungsbürgerlicher Habitusformen dar, als die Wahrscheinlichkeit von (formalen) Bildungserfolgen ansteigt, wenn schulische und familiäre Habitusformen Strukturähnlichkeiten aufweisen. Verwissenschaftlichung, Versprachlichung und Intellektualisierung (hoch-) schulischen Lehrens und Lernens zusammen mit dem Leistungsprinzip erweisen sich hier als zentrale Selektionsprinzipien und tragen zur Reproduktion gesellschaftlicher Statushierarchien bei (vgl. Bourdieu 1983: 197; Liebau 1987: 85f; Baumgart 2004: 205f). Diese Annahme wird im Übrigen durch aktuelle Lesesozialisationsforschungen bestätigt (vgl. Wieler 1997; Graf 2007). „[E]rst die Verbindung von praktischer und symbolischer Beherrschung einer Aufgabenstellung schafft die innere Komplexität des Denkens, die einen distanzierten Blick auf das Spiel mit unterschiedlichen Lösungsstrategien zulässt“ (Liebau 1987: 88). Der Habitus folgt einem Muster von Zirkularität, d.h. er weist ein Beharrungsvermögen bzw. eine Veränderungsträgheit auf, versucht sich vor Krisen und Infragestellungen zu schützen. Er bleibt in seinen Strukturen so lange erhalten, wie seine Prinzipien sich in der Lebenspraxis bewähren (vgl. Liebau 1987: 86; Müller/ Becker-Lenz 2008: 26). Der Habitus wird zur eigenen „Natur gewordene[n] Geschichte, die als solche negiert, weil als zweite Natur realisiert wird“ (Bourdieu 1979: 171). Er schreibt sich sprichwörtlich in den Körper ein und wird als ‚Hexis’ zu einer Art des Sichhaltens, Redens, Gehens und Denkens, die den eigen Rang, die Position in der gesellschaftlichen Ordnung signalisieren. Dazu gehören auch Vorstellungen vom ‚gesunden Menschenverstand’, die als Aus- und Abgrenzungsmechanismen wirksam werden. Die Alltagserkenntnis und der Habitus funktionieren nach dem Muster einer self-fulfilling-prophecy. Veränderungen sind nur möglich, wenn dieser Zirkel durch (individuelle oder kollektive) Krisen oder durch kulturelle Kontakte erschüttert wird (vgl. Liebau 1987: 63; 67f; 69; Bourdieu 1997: 62f). Dass es sich 5 bei Bourdieus Habitus-Konzeption nicht um ein rein deterministisches Modell handelt, wird von Schwengel (2005: 69ff) mit der individuelle Variabilität und von Liebau (1987: 65) mit der Möglichkeit einer ‚geregelten Improvisation’ begründet. Der Habitus verunmöglicht spontane Handlungen nicht, aber das situative Reaktionsvermögen wird vor „dem Hintergrund aller Erfahrungen, die der soziale Akteur im Laufe seiner Lebens- und Bildungsgeschichte gewonnen hat“ (Liebau 1987: 65) getroffen. Der Prozess der Interorisierung der Exteriorität stellt kein mechanisches Kausalitätsprinzip dar, sondern lässt im Sinne eines Individualhabitus eigensinnige Fähigkeiten und Kompetenzausformungen – eine relative Autonomie - des sozialen Akteurs zu. Aber selbst die ‚spontanen Improvisationen’ weisen durch den Klassenhabitus weitgehende Kohärenzen auf (vgl. ebd.: 70). Bourdieus Erkenntnisinteresse liegt demnach in der Verschmelzung individueller und kollektiver Biographien (vgl. Ackermann/ Seek 1999: 11). „Struktur, Habitus, Praxis bilden die begriffliche Trias, mit der Bourdieu das Verhältnis von Sozialwelt und Individuum zu analysieren versucht. Habitus ist dabei nicht zufällig die mittlere Kategorie; sie kennzeichnet nämlich den Ort, in dem die Praxis erzeugt wird“ (Liebau 1987: 62). In diesem Sinne wird nun unter Punkt 2.3 der Ort des Habitus in der (Lebens-) Praxis thematisiert und seine relationalen Bezüge in Politik, Ökonomie und Wissenschaft werden dargestellt. 2.3 Soziales Feld Das Habituskonzept ist nur vollständig erfassbar, wenn es in die wesentlichen gesellschaftlichen Struktureigenschaften eingebetet wird, in den sozialen Raum, indem die Kämpfe um Aufrechterhaltung oder Veränderung der Kräfteverhältnisse von Positionen in Ökonomie, Politik, Kultur, Wissenschaft und Kunst vollzogen werden (vgl. Bourdieu 1983: 184ff; Bourdieu 1987: 195ff; Liebau 1987: 71; Schwingel 1995: 59ff; Bourdieu 1997: 71ff; Krais 2002: 53ff; Fuchs-Heinritz/ König 2005: 176ff; Rehbein 2006: 90). Der Raum der Positionen ist historisch-gesellschaftlich konstituiert und zeigt die in einer Gesellschaft gegebenen Ungleichheitsstrukturen in vertikaler und horizontaler Hinsicht (vgl. Schwingel 2005: 106ff; Baumgart 2004: 210ff) - Liebau (1987: 72) spricht in diesem Kontext von einer „Rangordnung“. Der Raum sozialer Positionen wird von Bourdieu (1983: 183) aus einer erweiterten ökonomischen Perspektive rekonstruiert. Es Man darf sagen, dass ‚Feld’ und ‚Kapitalarten’ sich wechselseitig definieren und somit notwendigerweise zusammengehören (vgl. auch: Krais 2002: 53ff; Baumgart 2004: 210ff; Schwingel 2005: 82ff; Rehbein 2006: 157ff). Ein rein wirtschaftswissenschaftlich orientierter Kapitalbegriff ignoriert weitere, unerkannte Kapitalarten, „die zwar objektiv ökonomischen Charakter tragen, aber als solche im gesellschaftlichen Leben nicht erkannt werden“ (Bourdieu 1983: 184). Diese Kapitalarten erfordern einen „erheblichen Aufwand an Verschleierung“ 6 (Bourdieu 1983: 184, 197). Bourdieu (1983: 185ff) differenziert zwischen drei (bzw. vier) Kapitalformen: Das ökonomische Kapital ist unmittelbar in Geld konvertierbar und gehört zu den wirtschaftswissenschaftlich bekannten Kapitalsorten. Bourdieu (1983: 190f) stellt fest, dass es besonders zur Institutionalisierung in Form des Eigentumsrechts geeignet ist. Die Fokussierung der Wirtschaftswissenschaften auf einen solchen Kapitalbegriff führt zu der fälschlichen Annahme, dass alle nicht-ökonomischen Austauschbeziehungen uneigennütziger Art seien und damit auf eine Leugnung aller symbolischen Tauschakte. Das soziale Kapital ist eine solch ‚verschleierte’ Kapitalform. Es basiert auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ist unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches Kapital konvertierbar und wird u.a. in Adelstiteln symbolisch deutlich (vgl. ebd.:185; 190f; Schwingel 2005: 86ff). Die ‚Vererbung’ schulischer ‚Leistungstitel’ erfolgt u.a. über das soziale Kapital (vgl. Bourdieu 1983: 186). Es ist allerdings im Schwerpunkt das kulturelle Kapital, das sich besonders zur Institutionalisierung in Form von schulischen Titeln eignet (vgl. ebd.: 190). Auch diese Kapitalform ist - unter bestimmten Voraussetzungen und mit Transformationskosten verbunden - in ökonomisches Kapital konvertierbar. Es handelt sich um den Ertrag von Investionen von eingesetzter Lebenszeit (vgl. ebd.: 185f). Bourdieu (1983: 185) unterscheidet hier drei Formen: Kulturelles Kapital kann in einem inkorporierter Zustand als dauerhafte Dispositionen des Organismus, in objektiviertem Zustand in Form von kulturellen Gütern oder im institutionalisierten Zustand (z.B. Adelstitel) vorkommen (vgl. Bourdieu 1983: 185). In den Schriften Bourdieus werden diese drei Kapitalarten wiederholt betont. Allerdings fügt Bourdieu in einigen seiner Werke noch eine vierte Form des Kapitals an, das symbolische Kapital, das eine Art summarischer Zusammenführung der vorangegangenen Kapitalarten dargestellt und mit den Begriffen Prestige, Renommee u.a. in Verbindung gebracht wird (vgl. Liebau 1987: 74; Schwingel 1995: 91; Fuchs-Heinritz/ König 2005: 169). Die individuellen gesellschaftlichen Positionen bzw. Lebenslagen sind über diese drei oder vier Kapitalarten dimensional unterscheidbar. Bourdieu konstruiert auf der Basis dieser Kapitalartendifferenzierung ein Modell des sozialen Raumes, anhand dessen für jeden Akteur seine Stellung in den möglichen „Spiel-Räumen“ (Bourdieu 1985: 10, zitiert nach Liebau 1987: 74) darstellbar wird. In diesen ‚Spielräumen’ finden die materiellen und symbolischen Auseinandersetzungen zwischen den sozialen Akteuren statt (vgl. Ackermann/ Seek 1999: 11). In den jeweiligen Positionen sind entsprechende Handlungsschemata, habituelle Lebensstile und Gewohnheiten eingelagert, die eine Passung zwischen Individuum und gesellschaftlicher Position ermöglichen oder erschweren können. Im Kontext von feldspezifischen Positionen konkretisiert Bourdieu seinen Kompetenzbegriff als Trias von Handlungsbefugnissen, Handlungsmöglichkeiten und den damit notwendig werdenden Handlungsfähigkeiten. Der bourdieuische Kompetenzbegriff beinhaltet sowohl 7 personengebundene Handlungsfähigkeiten als auch positionsgebundene Handlungs- befugnisse formaler und inhaltlicher Couleur (vgl. Liebau 1987: 72; 90). Wenn Habitus und Feldposition nicht in Übereinstimmung miteinander sind, d.h. wenn es nicht zu einer Passung zwischen Sozialem Akteur und seiner sozialen Umwelt kommt, dann muss sich der soziale Akteur verändern, er muss lernen (vgl. ebd.: 91). Für Bourdieu ist hierbei zentral, dass Kompetenz nicht allein ein subjektives Vermögen bezeichnet, sondern immer der Zwang des (sozialen) Feldes mitzudenken ist. Es geht hierbei allerdings mitnichten nur um die beruflichen Qualifikationen. Diese bilden lediglich notwendige, aber keine hinreichenden Bedingungen (vgl. Liebau 1987: 75). Gesellschaftliche Entwicklung vollzieht sich nach Bourdieu in permanenten Bewegungen innerhalb der Lebensstilräume, im „Feld der symbolischen Auseinandersetzungen“ (Liebau 1987: 76). Hier kommt dem Bourdieuische Begriff der ‚Doxa’ eine gewichtige Rolle zu. Sie zeichnet die Schwierigkeiten nach, den ontogenetisch erworbenen Habitus zu verändern (vgl. Liebau 1987: 70; 77). Die Doxa enthält das (scheinbar) genuine Wissen über das, was sich gehört oder auch nicht gehört, was richtig und erstrebenswert ist (vgl. ebd.). Laut Rehbein (2006: 106) differenziert Bourdieu nicht immer exakt zwischen den Begriffen Illusio und Doxa. Beiden Begriffen ist gemeinsam, dass sie den Wahrnehmungshorizont der Akteure in den verschiedenen sozialen Feldern abbilden. Durch die Gefangenschaft im doxischen Horizont des eigenen von unten nach oben strebenende Feldes ist es den Individuen nicht möglich sich daraus zu befreien. Sie reproduzieren – wenn auch unfreiwillig – die historischaktualisierte Herrschaftsstruktur (vgl. Liebau 1987: 77; Bourdieu 1983: 198). Die Doxa entspricht einem unmittelbaren Anerkennungsverhältnis, das sich in der Praxis zwischen einem Habitus und dem Feld herstellen kann (vgl. Liebau 1987: 78; 85; Krais 2002: 55f). Der Erwerb nicht-redundanter Habitusformen ist mit der Transformation des Individualhabitus verbunden. Wenn dem System grundlegend neue Elemente zugeführt werden, dann sind alle Relationen innerhalb des Systems berührt und eine neue Ordnung muss etabliert werden (vgl. ebd.: 91f). Diese Transformation kann mit großen, individuellen Krisen verbunden sein, da Krisen einen Bruch mit der Doxa der Herkunftskultur bedeuten (vgl. Liebau: 93). Bourdieu (1987: 277ff) betont zwar, dass Laufbahneffekte im Sinne des sozialen Aufstiegs (und des sozialen Abstiegs) möglich sind, aber tendenziell eher die ‚Homologie der Räume’ und damit einhergehend die Aufrechterhaltung des Ursprungshabitus vorherrschend ist (vgl. ebd.: 367ff). Eine Möglichkeit der Evozierung solcher Veränderungen sieht Bourdieu in der „Verfremdung der eigenen Erfahrung“ (Liebau 1987: 96) wie sie beispielsweise durch ein Literaturstudium geschehen kann. Auch hier werden Bourdieus Erkenntnisse durch die aktuelle Leseforschung bestätigt: Es besteht tatsächlich eine Isomorphie zwischen Leseerfahrung und realer Erfahrung. Die (Re-) Konstruktion innerer Bilder beim Lesen aktiviert dieselben Systeme unseres Gehirns, die auch beim Sehen tätig sind, stellen Gailberger et al. (2007: 117ff) in Anlehnung an kognitionspsychologische Studien fest. Um 8 aber über einen individuellen Bruch der Doxa hinauszugehen, sind nach Bourdieu ökonomische oder politische Krisen notwendig (vgl. Liebau 1987: 93). Nachdem nun die zentralen Parameter der bourdieuschen Theorie – im Bewusstsein der eigentlich empirischen Perspektivierung – dargestellt wurden, werden im Folgekapitel die zentralen Grundsätze der theoretischen Position Oevermanns skizziert. 3. Pädagogische Professionalität Oevermanns Auch in der Annäherung an die sprachlich schwer zugänglichen erkenntnistheoretische Grundlegung Oevermanns wird eine deduktive Darstellungsweise gewählt: Zunächst werden die allgemeinen Grundzüge seiner interaktionistisch-strukturalisten Perspektive (3.1) vorgestellt, dann wird das zentrale Paradigma ‚soziale Deutungsmuster’ (3.2) erläutert und schließlich werden diese komplexen theoretischen Ableitungen im Bezug auf pädagogische Professionalisierungsprozesse konkretisiert (3.3). 3.1 Der interaktionistischer Strukturalismus Oevermanns Die widersprüchliche Zwillingsformel – oder in den Worten Reichertz (2002: 131) das ‚Oxymoron’ – ‚interaktionistische Strukturtheorie’ meint die Verbindung interaktionistischer und strukturalistischer Elemente in einem Erklärungsmodell, wie sie für Oevermanns theoretisches Konzept bezeichnend ist. Die interaktionistische Seite beinhaltet die konkrete Lebenspraxis, die unausweichlich zum Handeln und zur interaktiven Begründung des Handelns zwingt (vgl. Reichertz 2002: 131f). Oevermann sieht die Produktion von Sinn als „die Elementarform von Sozialität“ (Liebau 1987: 43) und stellt sich damit in die Tradition eines symbolischen Interaktionismus. Bezug nehmend auf die Sprechakttheorie von Searle, die Sprache als Form sozialen Handelns auffasst (vgl. Brinker 2001: 88ff), transferiert Oevermann (2001: 6) regelgeleitetes Handeln auf kommunikatives Handeln. Kurz: regelgeleitetes Handeln und Sprechakte sind strukturidentisch. Die Differenz besteht jedoch in ihrem Geltungsbereich, die sich bei kommunikativem Handeln „an der Legitimität interpersonaler Beziehungen“ (Oevermann 2001: 6) bemisst – also konsensuell validiert werden muss. Das regelgeleitete Handeln zeigt sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive als „Maxime, der das Handlungssubjekt praktisch folgt“ (Oevermann 2001: 6). Hier zeigt sich die strukturalistische Seite in der Fokussierung auf die Muster, die sich in den konkreten Handlungsstrukturen reproduzieren bzw. transformieren, die Teil der Gattung und Teil der historischen Interaktionsgemeinschaft sind (vgl. Reichertz 2002: 131f). Oevermann (2001) zieht als Basistheorien Ansätze des symbolischen Interaktionsmuses eines Mead, die Universaliendebatte eines Chomskys, psychoanalytische Subjektvorstellungen Freuds sowie phasische entwicklungspsychologische Modelle eines Piagets heran. Diese reichert Oevermann dann noch mit sprechaktheortischen Vorstellungen eines Searle, erkenntnistheoretischen Prämissen eines Peirce und Poppers an und sieht sich darüber hinaus 9 in der Tradition der kommunikativen Kompetenz habermascher Soziologietraditionen verankert. Dieses Konglomerat an theoretischen Traditionen und Strömungen wird von Liebau (1987: 47) - zu Recht – als „Eklektizismus“ (ebd.) bezeichnet und mit dem Hinweis vorgestellt, dass Oevermann „von diesen Bezugstheorien einen durchaus eigenwilligen Gebrauch macht“ (Liebau 1987: 47). Oevermanns Rekurs auf Chomsky bezieht sich auf dessen Unterscheidung von ‚Kompetenz’ als einer universalen Ausstattung des Menschen Fähigkeiten auszubilden und deren historisch-sozialer Form - der ‚Performanz’ - als dessen Gebrauchsform. Als ‚epistemische Subjekte’ verfügen Menschen – gleich einer generativen Grammatik – über universale Kompetenzen. Oevermann unterscheidet zwischen einem epistemischem Subjekt, dass universelle, zeitlose Basiskompetenzen besitzt, einem historischen Subjekt, welches nur zeitbezogen Gültigkeit besitzt und einem individuellen Subjekt, welches in Form von ‚Performanz’ die Basiskompetenzen aktualisieren kann (vgl. Liebau 1987: 103f; Reichertz 2002: 126). Da universale Kompetenzen eines epistemischem Subjekts latente Eigenschaften sind, können sie lediglich situativ über eine Diskursanalyse jedes Einzelfalls erschlossen werden. Oevermann überträgt also die Theorie einer generativen Grammatik auf Komponenten der Struktur des Geistes. Er unterscheidet dabei zwischen universellen Regeln und Strukturen einerseits und historisch bedingten gesellschaftlichen Normen andererseits (vgl. Liebau 1987: 103ff). Von Searle übernimmt Oevermann (2001: 8f) den Begriff der ‚konstitutiven Regel’, die besagt, dass über Sprechhandlungen neues Verhalten erzeugt werden kann (vgl. auch: Brinker 2001: 88ff). Für Oevermann steht allerdings nicht die Sprechhandlung, sondern die Sozialität - die Interaktion zwischen Subjekten an sich - als elementare Form des Handelns im Mittelpunkt (vgl. Liebau 1987: 106). Für seine Theorie greift er außerdem auf die konstruktivistisch-psychologische – und bereits von den Linguisten adaptierte Unterscheidung zwischen Inhalts- und Beziehungsebene von Watzlawiks zurück (vgl. Reichertz 2002: 124). Von Freud übernimmt Oevermann schließlich die Vorstellung der Individuierung des Subjekts. Allerdings in Form einer sinntheoretische Reinterpretation Freuds: Das Unbewusste ist keine verdeckte Triebnatur, sondern sind unerkannte Bedeutungen, „die ‚hinter dem Rücken des Subjekts’ ihre Wirkung tun“ (Liebau 1987: 128). Oevermann fordert in seinen frühen Schriften von Sozialwissenschaften, dass die menschliche Potentialität theoretisch und empirisch analysiert und zur interventionspraktischen Begründung wird, korrigiert diese Blickrichtung in späteren Arbeiten aber dahingehend, dass er verstärkt die „Autonomie der Lebenspraxis“ (Liebau 1987: 38; Wernet 2003: 37) postuliert. Oevermanns Theorie der Bildungsprozesse basiert auf einer anthropologisch wie historischen Subjekt-Theorie, die das ‚autonom handlungsfähige, mit sich identische Subjekt’ in das Zentrum seiner Theoriebildung rückt. Seine Theorie fußt 10 auf einem Bild vom Menschen als ‚normaler Person’ bzw. mit einem ‚normalen Bildungsprozess’. Die ‚richtige’ oder ‚normale’ Struktur der individuellen Entwicklung wird bei Oevermann gleich mit benannt: Das Subjekt soll der freien Entscheidung fähig, also autonom sein, es soll zur aktiven Bewältigung der Lebenspraxis fähig und außerdem nicht entfremdet, also kongruent mit seinen Handlungen und Zielen, sein (vgl. Liebau 1987: 37; 102). Dafür muss Oevermann eine ‚Normalitätsfolie’ des interessierenden allgemeinen Handlungstyps nachzeichnen, d.h. die universellen und historischen Regeln der normalen, vernünftigen Entwicklung bestimmen. Gedankenexperimentell wird daher zunächst Rationalität für ein gegebenes, interaktive Handlungsproblem unterstellt (vgl. Reichertz 2002: 133; 135). Die ‚Normalform’ ist nach Oevermann durch eine fundamental selbstreflexive Haltung gekennzeichnet (vgl. Liebau 1987: 110). Im Selbstverständnis eines genetischen Strukturalisten geht es Oevermann um die Re-Konstruktion dieser als Prämissen gesetzten Strukturen. Sie müssen lediglich sprachlich expliziert werden (vgl. Liebau 1987: 42). Die Versozialwissenschaftlichung der Alltagspraxis erscheint Oevermann (2001: 10ff) als eine Zerstörung der alltäglichen Erfahrungsbasis. Wissenschaftliche Forschung grenzt aus methodologischen Gründen ihren Wahrnehmungsraum ein und kann ihre Erkenntnisse nur in der Entlastung vom praktischen Alltagshandeln gewinnen, wohingegen die Praxis „überhaupt erst das Erfahrungsmaterial wissenschaftlichen Handelns liefern“ (Oevermann 2001: 12). Oevermann wählt also einen handlungstheoretisch-fundierten Wissenschaftszugriff (vgl. ebd.: 6). Nach Oevermann (2001: 12) soll Wissenschaft als Handlungssystem die Explikation und Übersetzung von praktischen Handlungsroutinen übernehmen, dadurch soll der eigentliche Erkenntnisforschritt ermöglicht werden (vgl. ebd; Liebau 1987: 42). Erkenntnislogisch wird damit die Differenz zwischen wissenschaftlicher und alltagspraktischer Erkenntnisse aufgehoben (vgl. Liebau 1987: 42). Oevermann (2001: 13) bewertet das Alltagswissen insofern höher, als im Alltag mit Paradoxien und der gesamten gesellschaftlichen Komplexität umgegangen werden muss, die innerhalb der Wissenschaft nur bedingt untersucht werden können. „Das Alltagswissen [ist] (…) dem wissenschaftlichen Wissen an Erfahrungsreichtum weit überlegen“ (Oevermann 2001: 14). Nach Oevermann (2001: 14; 17) können neue Erfahrungen letztlich nur in der Alltagspraxis vollzogen werden. Die Wissenschaft kann dort generiertes Wissen lediglich in Form institutionalisierter Kritik auf ihren Wesensgehalt prüfen (vgl. auch Liebau 1987: 39f). Oevermann (2001: 11f) geht davon aus, dass die ‚Lebenspraxis’ durch materiale Rationalität gekennzeichnet ist, die sich spontan und zukunftsoffen der Bewältigung von Handlungsproblemen auf prinzipiell nicht prognostizierbare Weise nähert (vgl. auch: Liebau 1987 39). Sie unterliegt Begründungszwängen, ohne hierbei dass einer sie Dialektik diese im von Entscheidungs- Moment der und konkreten Handlungsnotwendigkeit sofort einzulösen imstande ist. Die Wissenschaft zeichnet sich dagegen durch ihre Befreiung von konkreten Entscheidungszwängen aus, ihre Aufgabe liegt 11 „wesentlich in dem gedankenexperimentellen Konstruieren von unwahrscheinlichen Situationen des Scheiterns“ (Oevermann 1981: 15). Oevermann (2001: 4) kritisiert die aktuelle (v.a. behavioral orientierte) Forschungspraxis dahingehend, dass die dort untersuchten Fragestellungen und Indikatoren ohne die Konstruktion der Strukturen von Wertorientierungen aus einer Sinnanalyse abgeleitet werden. Oevermann schließt sich hier der „in Amerika laut gewordenen Kritik an der quantitativ ausgerichteten Form sozialwissenschaftlichen Messens“ (Reichertz 2002: 124) an. Er verlang stattdessen, dass die ‚innere Logik’ von Erwartungssystemen eines bestimmten Typus systematisch untersucht wird und daraus die strukturbedingten Handlungsprobleme extrahiert werden sollen (vgl. Oevermann 2001: 5). Er versteht Soziologie demnach als Textwissenschaft (vgl. Liebau 1987: 45; Reichertz 2002: 127), die sich das rekonstruierende Ausbuchstabierend der Geltung sozialer Deutungen zum Ziel setzt (vgl. Oevermann 2001: 20). Was aber sind ‚soziale Deutungsmuster’? Was kennzeichnet sie und auf welche Weise kommen sie zum Subjekt bzw. auf welche Art und Weise kann man ihrer habhaft werden? Diese Fragen sind Thema des Punktes 3.2. 3.2 Soziale Deutungsmuster Wie oben gesagt, beziehen sich Müller und Becker-Lenz (2008) auf den Aufsatz ‚Zur Analyse der Struktur von sozialen Deutungsmustern’ von Oevermann (2001). In diesem Aufsatz entfaltet Oevermann aus soziologischer Sicht die theoretische Basis seiner ‚obejektiv’-hermeneutischen Textanalysemethode. Seine bevorzugten Gewährsmänner sind hierbei die habermasche ‚Philosophie’ von kommunikativer Kompetenz und die Grundlegung einer Vorstellung von Welt als soziale Konstruktion nach Berger und Luckmann. Es geht Oevermann um „die Rekonstruktion mentaler Strukturen“ (Oevermann 2001: 4), die er als „Rekonstruktion von Sinnzusammenhängen und Interpretationsmustern, die dem konkreten Handlungssubjekt als objektive Strukturen gegenübertreten“ (ebd.) versteht. Indem Oevermann (2008: 60) sich auf die Sprechakttheorie von Searle u.a. bezieht und damit aus den propositionalen Aussagen eines krisenbewältigenden Subjektes Wissen (Wahrheitsgehalte?) extrahieren kann, wird es möglich Wissen wie ein Objekt bzw. Gegenstand zu bearbeiten. Dazu nutzt Oevermann (2001: 18) zwei Komponenten: Zum einen die Konstruktion eines objektiven Sinns praktischer Handlungen und zum anderen die Versprachlichungsstrategien dieses objektiven Sinns im kollektiven oder individuellen Gedächtnis der Subjekte. Diese Zweiheit bildet die Grundlage seines Deutungsmusterbegriffs: „Unter Deutungsmustern verstehe ich in erster Annäherung das ‚ensemble’ von Wissensbeständen, Normen, Wertorientierungen und Interpretationsmustern, das in einem inneren Zusammenhang stehend einen epochenähnlichen Zeitabschnitt in der 12 Entwicklung einer Gesellschaft oder eines für die Formation einer Gesellschaft wesentlichen Segments prägt. In zweiter Annäherung soll von einem Deutungsmuster nur dann gesprochen werden, wenn dieses ‚ensemble’ durch eine Struktur gekennzeichnet ist, die als ‚innere Logik’ eines Deutungsmusters nach impliziten Regeln der Konsistenz von Urteilen, Argumenten und Interpretationen rekonstruiert werden kann“ (Oevermann 2001: 9). Als ‚ensemble von sozial kommunizierbaren Interpretationen’ handelt es sich bei sozialen Deutungsmustern um instrumentelle, das kommunikative Handeln (nach Habermas) steuernde Regeln (vgl. Oevermann 2001: 5f; Baumgart 2004: 155ff). Sie bewahren Alltagserfahrungen in ihrer allgemeinen Bedeutung auf (vgl. Oevermann 2001: 14). Deutungsmustern sind entwicklungsoffene, historisch-wandelbare Weltinterpretationen mit generativ-fortschreitendem Status (vgl. ebd. 8f). Für soziologische Forschungskontexte geht es bei der Analyse darum, die ‚innere Logik’, d.h. „eine Sukzession von Versuchen der Lösung jeweils aktualisierter Kompatibilitätsprobleme“ (Oevermann 2001: 21) zu rekonstruieren. Soziale Deutungsmuster lassen sich nach Oevermann (2001: 19) nach ihrer Reichweite differenzieren: Elemente von Deutungsmustern mit großer Reichweite scheinen den Subjekten am selbstverständlichsten und sind daher am schwierigsten zu verbalisieren (vgl. Oevermann 2001: 19). Er unterscheidet also zwischen latenten und manifesten Deutungsmustern, die sich im Grad ihrer Bewusstheit der inneren Widersprüche unterscheiden. Oevermann differenziert somit zwischen einem subjektiven und einem objektiven Sinn. Während der subjektive Sinn durch Erwartungshaltungen, Bewusstseinslagen, Motiven u.ä. gekennzeichnet ist, führt die Produktion eines ‚Interaktionstextes’ darüber hinaus zu objektiven Bedeutungsstrukturen (latente Strukturen) die mehr Bedeutungsmöglichkeiten beinhalten, als dem Bewusstsein der Interaktanten möglicherweise zugänglich ist (vgl. Liebau 1987: 44; 124). Diese (latenten) Strukturen werden in den konkreten, alltäglichen Interaktionen vor Ort aufgebaut (vgl. Reichertz 2002: 126). Sie entstehen durch und in Prozessen der Reproduktion und Transformation: „Prozesse der Reproduktion sind jene Prozesse, die die Aufrechterhaltung einer zu einem Zeitpunkt oder in einer Phase eines Bildungsprozesses entwickelten (Fall-) Struktur sichern. (…) Prozesse der Transformation sind mit Bezug darauf Prozesse, die eine gegebene, sich reproduzierende Fallstruktur in Abhängigkeit von welchen zu lösenden Problemen der äußeren oder inneren Realität auch immer verändern und zu neuen Stufen der Ausbildung sich reproduzierender Strukturen führen“ (Oevermann 1981: 36). 13 Regeln haben für hierbei einen generativen Charakter. Sie sind in der Lage neues Verhalten zu erzeugen und verpflichten das Subjekt auf den durch Regeln erzeugten Sinn, d.h. sie geben dem Handeln des Subjekts einen übergeordneten Sinn. Die dadurch entstehenden sozialen Normen sind der Reflexion zugänglich und veränderbar (vgl. Oevermann 2001: 8). Sie „stellen insofern produktiv eine Leistung der Synthesis dar, durch die Praxis sich verlässlich strukturiert“ (ebd.: 18). Jeder Widerspruch, der sich in der Alltagspraxis auftut und jeder damit verbundene Lösungsversuch, führt zu neuen Unvereinbarkeitsproblemen (vgl. Oevermann 2001: 21). Diese immer wieder neuen ‚Inkompatibilitäten’ führen aber zu produktiven, neuen Denk- und Lösungsmöglichkeiten im Praxisfeld selbst (vgl. ebd.: 22). Über diesen konkreten Strukturen „thronen – gottgleich -“ (Reichertz 2002: 127) universelle Strukturen, welche der Gattung Mensch innewohnen. Diese Strukturen haben die Gestalt von Universalien (allgemeine Handlungsregeln) und Deutungsmustern (historische Handlungsregeln) (vgl. Liebau 1987: 107). Oevermann (2001: 23) geht davon aus, dass sich historische Handlungsmuster v.a. in strukturellen und krisenhaften Wandlungsprozessen entwickeln, die dann zu neuen ‚kollektiven Bewusstseinsstrukturen’ führen (vgl. Oevermann 2001: 23). Erwerb von Deutungsmustern Liebau (1987: 122) fragt sich, welche sozialisatorischen Bedingungen diese Handlungsregeln zum Subjekt bringen bzw. wie die Regeln mit denen ein Subjekt zum ersten Mal Handlungen erzeugt in das Subjekt kommen (vgl. Liebau 1987: 122). Auch hier geht Oevermann von der ‚kleinsten elementaren Einheit’, der Interaktion als Ort des Regelerwerbs aus und nimmt an, dass Kompetenzen in Interaktionen erworben werden (vgl. ebd.: 124). Oevermann versucht die Entwicklung des Bewusstseins bzw. von Deutungsmustern nicht nur über biologische Reifungsbedingungen oder individuellen psychischen Leistungen des Subjektes zu erklären, sondern aus den sozialen Strukturen, in denen das Subjekt lebt und aufwächst (vgl. ebd.: 120). Soziale Deutungsmuster werden weder als explizite Regeln erworben, „noch Element für Element“ (Oevermann 2001: 24), sondern durch das eigenständige ausbuchstabieren der Bedeutung weniger zentraler Schlüsselkonzepte (vgl. ebd.). In logischer Konsequenz seiner Orientierung an frühen psychoanalytischen Konzepten, sieht Oevermann den Mechanismus der stellvertretenden Deutung besonders in der Eltern-Kind-Interaktion wirksam werden (vgl. Liebau 1987: 125): „Vermutlich geschieht das weniger über den Mechanismus expliziter Indoktrination durch Erwachsene als durch vom Kind selbsttätig vorgenommenes ‚Ablesen’ zentraler Handlungsregeln am beobachtbaren sozialen Handeln in seiner unmittelbaren Umwelt“ (Oevermann 2001: 25). Das Prinzip der ‚stellvertretenden Deutung der latenten Sinnstrukturen’ durch Eltern oder Lehrkräfte sorgt dafür, dass objektive Verhaltensantriebe in subjektiv verfügbare Inten14 tionen des Handelns übergehen können. Dies führt zur Interiorisierung der Regeln (vgl. Liebau 1987: 126f). Ein Teil der Regeln kann erkannt und verändert werden, was die ‚Autonomie der Lebenspraxis’ auszeichnet (vgl. Liebau 1987: 129), den Bildungsinstitutionen kommt hierbei allerdings auch eine zentrale Rolle zu, da sie „in immer stärkerem Maße konkurrenzlos den Horizont von Weltinterpretationen, in den der Einzelne hineinsozialisiert wird“ (Oevermann 2001: 32) abbilden. Objektive Hermeneutik als Forschungsmethode der Wahl Die Theorie sozialer Deutungsmuster geht von zwei Grundannahmen aus: Erstens werden unter Deutungsmustern in sich konsistent-strukturierte Argumentationszusammenhänge verstanden und zweitens sind soziale Deutungsmuster immer funktional auf objektive, deutungsbedürftige Handlungsprobleme bezogen, worin Oevermanns handlungstheorische Positionierung noch einmal nachdrücklich zum Ausdruck kommt (vgl. auch: Liebau 1987: 116). Diese beiden Grundannahmen sind zirkulär miteinander verknüpft (vgl. Oevermann 2001: 5). Diese Zirkularität ist relevant, weil sie es ermöglicht zu irgend einem gegebenen historischen Zeitpunkt „Handlungsprobleme als Anfangsbedingungen für die soziale Konstruktion von Deutungsmustern“ (ebd.) zu nutzen, um darauf aufbauend, deren Verselbstständigung zu analysieren. Die von Oevermann und Kollegen entwickelte Methode der Wahl ist die ‚objektive’ Hermeneutik ein komplexes methodisches Konzept darstellt (vgl. Reichertz 2002: 123). Oevermanns (2001: 7) Forschungsmethode setzt einen soziologischen Regelbegriff voraus, der ‚Abweichung’ von konstitutiven Regeln als möglich erachtet. Zudem ist ein intersubjektiv geltender Normbegriff notwendig. Erst dann ist „ein systematisches Urteil über die Angemessenheit eines konkreten Handelns“ (Oevermann 2001: 7) möglich. Nach Reichertz (2002: 136) trifft allerdings der Ausdruck ‚Durchschnitt’ besser zu als der Normalitätsbegriff. Die ‚objektive’ Hermeneutik zielt auf die Analyse der oben beschriebenen ‚latenten Sinnstrukturen’ (vgl. Liebau 1987: 45). Oevermann geht davon aus, dass jedes Handeln als Text protokollierbar und in seinen objektiven Bedeutungsstrukturen explizierbar ist (vgl. Liebau 1987: 107; Reichertz 2002: 123; 127f). Die Methode der Deutungsmusteranalyse beinhaltet nach Oevermann (2001: 11) folgende Parameter: Zunächst werden die Äußerungen, Urteile oder Bestimmungen eines Individuums, einer Institution oder eines gesellschaftlichen Subsystems auf (soziologisch betrachtete) Inkonsistenzen hin untersucht. Dann werden alternativer Deutungsmuster konstruiert, was es ermöglicht, die Annahmen zu verstehen, die diese Inkonsistenzen inhärent als konsistent erscheinen lassen. Grundlage einer Deutungsmusteranalyse bilden somit immer die konkurrierenden Deutungsmuster der Rekonstruktion der ‚Texte’ mit der Kontrastfolie durch den Analytiker. Die Differenz im Rationalitätsgrad zwischen Analytiker und Textproduzent besteht lediglich in seiner expliziten methodisierten Geltungsüberprüfung und nicht in einem prinzipiellen erkenntnislogischen Statusunterschied (vgl. Oevermann 15 2001: 11; 27). Bei dieser Rekonstruktion ist es entscheidend, die objektiven Strukturbedingungen des geltenden Handlungsproblems zu identifizieren (vgl. ebd.: 22f). „Eine objektive Rekonstruktion objektiver Strukturen wird verstanden als Grenzwert, den man dann erreicht, wenn man nicht davon ablässt, die kanonischen Vorschriften der objektiven Hermeneutik anzuwenden“ (Reichertz 2002: 124). Für die formale Anwendung der ‚objektiven’ Hermeneutikregeln benötigt es Zeit, die nur der vom akuten Handlungsdruck befreiten Wissenschaft zur Verfügung steht. Außerdem muss sichergestellt werden, dass der hermeneutische Interpret frei von neurotischen oder ideologischen Färbungen ist - „wie dies allerdings geschehen soll, bleibt bei Oevermann unklar“ (Reichertz 2002: 127). Insgesamt bezeichnet Oevermann selbst seine Methode einer ‚generativen’ Hermeneutik aber als eine ‚Kunstlehre’, die nur ein – wie auch immer gearteter ExpertInnenkreis – zu leisten vermag (vgl. Liebau 1987: 42; Reichertz 2002: 127f). Sie soll zur Diagnose wichtiger ‚Trends’ führen, die das Verhältnis von Reproduktion und Transformation prognostizieren (vgl. Reichertz 2002: 137). Unter Punkt 4.3 wird es nun zunehmend konkret: Es geht sozusagen um die ‚pädagogischen Trends’ oder ‚Krisen’, die Oevermann mit Hilfe seines soziologischen Modells zu analysieren versucht. 3.3 Pädagogische Professionalisierungsbedürftigkeit Oevermanns Konzeption einer pädagogischen Professionalisierungsbedürftigkeit erfolgt im Kontext einer allgemeinen Professionalisierungstheorie (vgl. Wernet 2003: 35). Oevermann (2008: 56) konstatiert, dass seine revidierte Professionalisierungstheorie auch dort, „wo diese Position zitiert wird (…) häufig missverstanden“ wurde. Wenn dem so ist, dann ist allerdings die kritische Frage erlaubt, warum er diese zusammen mit einer Explizierung seiner Methodik nicht noch einmal über einzelne Artikel hinaus strukturierend zusammengefasst hat. In Bezug auf Wernet (2003) stellt Oevermann (2008: 56) fest, dass dieser nicht nur eine andere Professionsposition eingenommen hat, sondern auch, dass dieser seine Beiträge nach 1996 nicht mehr berücksichtigt hat. Hierbei kritisiert er v.a. die Kürzung seiner Ableitungsbasis. Aus sozilogischer Perspektive bildet die Grundlage ein umgekehrter Blick auf das Begriffspaar Krise und Routine: Während Krise als das überraschend - Unerwartete in einer zukunftsoffenen Praxis als Normalfall zu gelten hat, stellen Routinen Latenzzeiten solcher normalen Krisen dar. Dementsprechend lassen sich gesellschaftliche Bereiche schließlich aufteilen als klassische Bereiche der Routine (z.B. Verwaltung) und klassische Bereiche der Krise (z.B. therapeutische Bündnisse). Professionen sind für Oevermann (2008: 58) auf der Krisenseite zu verorten, allerdings sind sie rollenförmig organisiert. Ihre Gemeinsamkeit 16 besteht in der stellvertretenden Krisenbewältigung (vgl. ebd.). Oevermann (2008: 64f) unterscheidet drei Typen von Krisen: Erstens traumatisierende Krisen, worunter Kriege und Naturkatastrophen fallen, zweitens Entscheidungskrisen, der er Glaubensfragen zuordnet und Krisen, die aus Muße entstehen: „Muße liegt der Wahrnehmung von Dingen um ihrer selbst willen zugrunde“ (Oevermann 2008: 65). Oevermann und sein Forscherteam haben Ihren Untersuchungsausgang in der „klassischen Version der Professionstheorie“ (Oevermann 2008: 56) mit den Merkmalen: Autonomie, expliziter Bezug auf gesellschaftliche Werte, privilegiertes Einkommen und akademische Bildung genommen. Wie oben dargestellt bildet das Subjektmodell des ‚autonom handlungsfähigen, mit sich identischen Subjekts’ hierbei die normative Bezugsgröße (vgl. Liebau 1987: 153). Im Zuge des marxistisch orientierten Vorwurfs, dass es sich bei diesen Merkmalen lediglich um Formen der Statusmonopolisierung handeln würde, stellten Oevermann und Kollegen den klassischen Professionsmerkmalen „die Rekonstruktion der typischen Handlungslogik der Professionen in Reaktion auf das typische Handlungsproblem“ (Oevermann 2008: 56) gegenüber. Oevermann unterscheidet zwischen „der Professionalisierungsbedürftigkeit einer beruflichen Problembearbeitung und ihrer tatsächlichen Professionalisiertheit“ (Wernet 2003: 35). Erst auf der Folie der Rekonstruktion eines beruflichen Handlungsproblems folgt die Betrachtung der beruflichen Institutionalisierungsmerkmale (vgl. ebd.: 35). Entsprechend seinem Ausgangspunkt in der klassischen Version der Professionstheorien sowie seiner Darstellung von Krisen, nennt Oevermann (2008: 59f) drei Foki der Logik des professionalisierten Handelns: Erstens die Herstellung, Aufrechterhaltung, Gewährleistung und Widerherstellung einer kollektiven Praxis von Recht und Gerechtigkeit im Sinne eines die jeweils konkrete Vergemeinschaftung konstituierenden Entwurf, zweitens die Herstellung, Aufrechterhaltung und Gewährleistung von leiblicher und psychosozialer Integrität des Einzelnen im Sinne eines geltenden Entwurfs der Würde des Menschen (somatopsychosoziale Integrität) und drittens die Erzeugung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Geltung von Wissen und Erkenntnis und damit die Bewältigung von Geltungskrisen unter der regulativen Idee der Wahrheit (vgl. Brumlik 2000: 205; Wernet 2003: 36; Oevermann 2008: 59f). Der Aufrechterhaltung einer kollektiven Praxis von Recht und Gerechtigkeit ordnet Oevermann im Schwerpunkt der Jurisprudenz zu, die somatopsychozoziale Integrität obliegt vorwiegend dem medizinisch-therapeutischen Fachpersonal und für die Bewältigung von Geltungskrisen sind hauptsächlich wissenschaftliche und künstlerische Professionen zuständig. Allerdings stehen die Foki in einem Wechselverhältnis zueinander und wirken hintergründig in alle Professionen hinein (vgl. Wernet 2003: 36). 17 Bezogen auf Professionen – v.a. Medizin und Psychoanalyse, später auch auf schulpädagogische Handlungsfelder (vgl. Wernet 2003: 35ff, Oevermann 2008: 56ff) – sieht Oevermann deren Professionskennzeichen in der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und insbesondere Berufserfahrung basierenden Entscheidungs- und Begründungszusammenhang, die auf ein Verhältnis zum ‚Klienten’ gründen, die sowohl durch stellvertretende Deutung als auch durch die grundlegende Anerkennung der Autonomie der Lebenspraxis gekennzeichnet ist (vgl. Liebau 1987: 40). Erfahrung ist in diesem Prozess nicht allein durch Wissen konstituiert, sondern vielmehr durch die Auseinandersetzung mit einzelnen Lebensereignissen, die sich zur Einsicht formieren (vgl. Liebau 1987: 114; Wernet 2003: 37). Auf dieser typologischen baut sich Handlungssicherheit auf (vgl. Liebau 1987: 115). „Dazu gehört konstitutiv, dass man mit den Fällen wirklich umgegangen ist, dass man sie anschaulich und nicht nur aus der beobachtenden Distanz, sondern aus der Handlungsmethodik her kennt“ (Oevermann 1981: 12). Brumlik (2000: 206f) extrahiert aus diesen Foki Ansprüche an professionalisiertes pädagogisches Praxishandeln. Sie sind auf der Ebene der somatopsychischen Integrität zu verorten (vgl. auch: Wernet 2003: 36; Oevermann 2008: 60f) und erfordern die Kenntnis existierender Rechts- und Gerechtigkeitskonventionen sowie Kenntnisse über Konzepte persönlicher Integrität (vgl. auch: Liebau 1987: 154). Brumlik (2000: 207) fordert dann von Oevermann noch eine Ergänzung im Bezug auf die Fähigkeit zur Erörterung praktischer Geltungsansprüche bzw. moralischer Dilemmata. Spezifische pädagogische Kompetenzen stellen aber eine Kunstlehre dar, die mit dem reinen Erwerb instrumentell-technischer Kompetenzen im Sinne von Fachwissen nicht hinreichend erfüllt sind. „Die Berufsausbildung erfordert nicht nur den Erwerb von Fachwissen, sondern auch und vor allem die Ausbildung eines Professionshabitus“ (Wernet 2003: 37). Oevermann (2008: 58) selbst entfaltet zwei Modi des Wissens das Professionen zur Problemlösung anwenden und bezeichnet seine Professionstheorie auch als eine implizite „Wissenstheorie“ (ebd.: 59): Ersten die ingenieuriale Wissensanwendung, dabei handelt es sich um Wissensbeständen, die deduktiv-nomologische Problemlösungen ableiten bzw. induktiv über Erfindungen, die dann theoretisch begründet werden. Zweitens interventionspraktische Wissensanwendung, d.h. Wissen wird erklärend oder appellierend eingesetzt. Oevermann (2001: 58) verwehrt sich in seiner Bestimmung seines Professionalisierungsmodells allerdings gegen seine Rezeption, die die Beschreibung von Professionen als missinterpretieren vorwiegend (vgl. interventionspraktischen ebd.). interventionspraktisch Er sieht Wissensanwendung ausgerichtete vielmehr eine in dem Spannung Wissensanwender Schwerpunkt impliziert der zwischen „Aneignungs- und Begründungswirkung von wissenschaftlich bewährtem, methodisiertem Wissen“ (Oevermann 2008: 58) und nicht-standardisierbaren Fallrekonstruktionen. Aus 18 strukturtheoretischer Perspektive ist wissenschaftliches Wissen lediglich ein Moment von Professionen, zu dem sich die hermeneutische Kompetenz des Verstehens eines (Einzel-) Falls gesellen muss. Professionalisiertes Handeln ist demnach gekennzeichnet durch die Gleichzeitigkeit von ‚Theorieverstehen’ und ‚Fallverstehen’ (vgl. Ackermann/ Seek 1999: 9; Liebau 1987: 47). Die Fallrekonstruktion „besteht darin, dass man, um dieses Wissen anwenden zu können, jeweils die konkrete historische Lage und Situation des Klienten, worin auch immer diese besteht, rekonstruieren muss und das Problem, das dieser Klient hat, durch die Rekonstruktion hindurch so bestimmen kann, dass man es dann dem standardisierten Wissen subsumieren kann“ (Oevermann 2008: 59). Das Medium dieses Vermittlungsprozesses bildet (selbstverständlich) die stellvertretende Deutung dessen, was das ‚autonom handlungsfähige’ Subjekt für seine je konkrete Lebenspraxis zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt benötigt (vgl. Liebau 1987; Ackermann/ Seek 1999: 9). Oevermanns (2008: 61) Gesundheitsbegriff ist dementsprechend auch anders gelagert: Es ist das Maß an Gesundheit, das in einer konkreten Lebenspraxis realisierbar ist. Ziel einer ‚Behandlung’ ist also nicht die einfache ‚Symptombeseitigung’, sondern die Wiederherstellung der ‚beschädigten Autonomie einer Lebenspraxis’ (vgl. Wernet 2003: 37). Dadurch ergibt sich allerdings das strukturelle Grundparadox, dass durch die stellvertretende Krisenbewältigung gleichsam die Autonomie des Subjekts durch die Erzeugung von Abhängigkeiten beeinträchtigt wird. Oevermann versucht dieses Dilemmata aufzulösen, indem dem in seiner Autonomie beschädigten Individuum ein Maximum an ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ zugestanden wird (vgl. Wernet 2003: 37; Oevermann 2008: 62f). Professionelle Handlungskontexte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie durch eine sowohl diffuse als auch spezifische Beziehung zum Klienten gekennzeichnet sind (vgl. Wernet 2003: 37). Sie sind diffus, weil es sich um Interaktionen zwischen ‚ganzen Menschen’ handelt und gleichsam spezifisch, weil sie rollenförmig organisiert sind (vgl. Oevermann 2008: 69). Wesentlicher Bestandteil einer professionalisierten Praxis besteht dann darin, die widersprüchliche Einheit zwischen den spezifisch-organisationalen und diffusen- interaktionalen Elementen herzustellen. In diesem Kontext spricht Oevermann (2008: 71) von der Herstellung eines „Arbeitsbündnisses“ (ebd.) zwischen den Interaktanten. „Das ist sozusagen zentraler Bestandteil des Professionalisierungsprozesses“ (ebd.). Um aber ein (lehr-) pädagogisches ‚Arbeitsbündnis’ in Analogie zum patientenseitigen Leidensdruck und damit zur Behandlungsmotivation zu konstruieren, greift Oevermann für organisationalinstitutionelle Kontexte wie Schule auf die „kindlichen Neugier“ (ebd.: 64) als äquivalente Motivation für das Arbeitsbündnis zurück (vgl. auch: Wernet 2003: 37). Da Kinder von Natur aus neugierig seien, binden Kinder sich an InteraktionspartnerInnen, die ihnen die Chance zur Wissenserweiterung und Wissensaneignung ermöglichen (vgl. Oevermann 2008: 19 66). Die stellvertretende Krisenbewältigung besteht also in schulisch-pädagogischen Kontexten in dem Angebot der Wissensvermittlung. Für Oevermann (2008: 66f) stellt gesetzliche Schulpflicht allerdings ein (unüberwindliches) Hindernis in der Professionalisierung schulpädagogischen Handelns dar. Daher entwirft er gedankenexperimentell eine Schulorganisation, in der die Professionalisierungsbedürftigkeit der Schulpädagogik eingelöst wird (vgl. ebd.: 68ff). Die Argumente, die im Allgemeinen unter Begriffen wie ‚heimlicher Lehrplan’ firmieren bilden für Oevermann (2008: 72) Momente formaler und materialer Rationalität ab: Die Vergemeinschaftung über und mit (Schulklassen-) Peers sowie die sachliche Erschließung mit ihrem formalisierten Unterrichtsende. Dem steht aber der Zertifizierungskomplex und damit einhergehenden Selektionsprozessen und das sog. Disziplinierungsproblem einer professionalisierungsbedürftigen Dienstleistung für eine autonome Lebenspraxis in schulpädagogischen Kontexten entgegen – so jedenfalls Oevermann (2008: 73ff). Daher ist für eine gelungene Professionalisierung neben den professionalisierungsbedürftigen Handlungsanforderungen im Rahmen diffuser und spezieller Beziehungen auch eine adäquate Institutionalisierung notwendig (vgl. Wernet 2003: 35). Damit sind nun die theoretisch-methodischen Grundsteine des Ansatzes von Oevermann nachgezeichnet und es kann sich nun dem Vergleich der beiden Ansätze zugewendet werden (Kapitel 4). 4. Parallelen und Differenzen Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretisch-methodischen Grundlagen Bourdieus und Oevermanns skizziert wurden, werden nun die Beiden Ansätze auf der Ebene ihrer theoretischen Wurzeln (4.1), auf der Ebene der zentralen begrifflichen Parameter (4.2) und im Bezug auf ihren Praxisvorstellungen verglichen. 4.1 Konstruktivistischer vs. interaktionistischer Strukturalismus Bourdieu vertritt einen strukturalistischen Konstruktivismus, der Begriffe wie Habitus, Hexis und Doxa als wissenschaftlich erzeugte Begrifflichkeiten fasst, die nicht identisch mit der tatsächlichen Logik interaktionistischen der Praxis Strukturalismus sein müssen, vertritt, der wohingegen seinen Oevermann einen Deutungsmusterbegriff identitätslogisch begründet, um die in der Realität vorhandenen Strukturen auf den richtigen Begriff zu bringen (vgl. Liebau 1987: 18, 135). Diese Strukturen sind sozusagen in den alltäglichen Interaktionen ‚versteckt’. Bourdieu und Oevermann stimmen darin überein, dass Soziologie als eine „dialektisch-positivistische Erfahrungswissenschaft mit einem eigenen erkenntnistheoretischen Status“ (Liebau 1987: 49) mit einer autonomen Rolle aufzufassen ist. Erkenntnistheoretisch divergieren die beiden Ansätze jedoch dahingehend, dass Bourdieu 20 ein konstruktivistisches Wissenschaftsprogramm darlegt, das von einer prinzipiellen Differenz zwischen soziologisch-wissenschaftlicher und alltäglicher Erkenntnis ausgeht, wogegen Oevermann eine prinzipielle Strukturgleichheit alltäglicher und wissenschaftlicher Erkenntnis annimmt (vgl. ebd.: 49). „Bourdieus Vernunfts-Begriff erscheint gleichsam ex machina; er fällt vom Himmel, ohne dass man weiß, wie er denn dorthin gekommen ist – Oevermanns Rationalitätsbegriff ist teleologisch; er führt in den Himmel, ohne dass man weiß, auf welchem Weg“ (Liebau 1987: 132). Das bedeutet, dass Bourdieus Vernunftsbegriff den historisch-gegebenen Bedingungen zwar unterworfen wird, als Zielkategorie einer Aufklärungsphilosophie aber wie auf einer Theaterbühne plötzlich aus dem Rauch heraufbeschworen wird. Nach Liebau (1987: 132) verhält es sich bei Oevermann genau umgekehrt, seine Vernunftsphilosophie ist das Gesellschaftsziel schlechthin – ohne dass der viable Weg dorthin genauer beschrieben wird. Während Bourdieu zur Dekonstruktion der Doxa, die die Alltagspraxis beherrscht, beitragen möchte und hierbei einen radikalen Historismus vertritt (vgl. Bourdieu 1997: 74), argumentiert Oevermann „letztlich ahistorisch-anthropologisch“ (Liebau 1987: 49). Bourdieus Wissenschaftsprogramm ist letztlich ein politisch motiviertes Programm der Aufklärung, während es Oevermann um das Wesen der Sache selbst geht (vgl. Liebau 1987: 49; 130). Trotz – oder wegen – dieser erkenntnistheoretischen Differenzen, sieht Liebau (1987: 50) die beiden soziologischen Programme einerseits in einem Konkurrenzverhältnis stehen, gleichzeitig aber durchaus als Ergänzungsverhältnis. Zumindest im Hinblick auf Bourdieus und Oevermanns sozialisationstheoretisch-pädagogische Fragestellungen. Dennoch betont er, dass „die Schlüsse, die die beiden Autoren aus ihren erkenntnistheoretischen Grundannahmen ziehen, sich erheblich widersprechen“ (Liebau 1987: 51). Die Frage der Begriffsnutzung – als Ergänzung zur erkenntnistheoretischen Begriffsbestimmung – wird unter Punkt 4.2 näher betrachtet. 4.2 So und so: Habitus und soziale Deutungsmuster Bourdieu untersucht auf einer empirischen Ebene den Habitus des sozialen Akteurs als Form der zum Individuum gewordenen Gestalt von Gesellschaft. Damit will er die Gegensätzlichkeit von Individuum und Gesellschaft wissenschaftlich auflösen (vgl. Liebau 1987: 130). Er nimmt dabei v.a. institutionalisierte Formen der sekundären Sozialisation (Schule und Hochschule) in den Blick, in welchen er die Möglichkeit der Aufklärung in Verfremdungsprozessen des unaufgeklärten Habitus im Sinne der Transformation in Vernunft eingelagert sieht (vgl. ebd.: 131). Oevermann findet die konstitutionstheoretischen 21 und historischen Bedingungen von und für Vernunft in den Universalien, die als universelle Kompetenzen allen sozialisierten Subjekten prinzipiell zur Verfügung stünden. Diese Kompetenzen sind nach ihm allesamt auf Intersubjektivität und Reziprozität und auf SinnProduktion ausgelegt. Mit seiner Normalitätsfolie bestimmt er darüber hinaus die Möglichkeiten einer autonomen Lebenspraxis (vgl. ebd.: 131; Reichertz 2002: 133; Wernet 2003: 37ff; Oevermann 2008: 60ff). Auf der Ebene des empirischen Subjekts „postuliert er die autonome Lebenspraxis des Subjekts als Quelle materialer Rationalität“ (Liebau 1987: 131). Die Konsequenz dieses Ansatzes liegt darin, dass zunächst v.a. die primäre Sozialisation in der Familie in den Blick genommen wurde und erst später die die aktuellen Deutungsmuster massiv beeinflussende Schulsozialisation in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet (vgl. ebd.: 132; Oevermann 2001: 31ff; Oevermann 2008: 60ff). Auch für diese sekundären Sozialisationsprozesse versucht er allerdings von den gegebenen historischen Bedingungen (Schulpflicht) zu abstrahieren und eine fiktive Begründung einer ‚autonomen’ interaktiven Praxis zwischen zwei Subjekten (Lehrkraft-SchülerInnen) zu konstruieren (vgl. Oevermann 2008: 67ff). Es liegt in der Logik dieser erkenntnislogischen Differenzen, dass auch die Forschungstraditionen der beiden Männer deutlich divergieren: Bourdieu favorisiert quantitativempirische Feldforschungsdesigns, um der Doxa der Lebenspraxis auf die Schliche zu kommen und Oevermann bricht mit den herkömmlichen soziologischen Forschungstraditionen, indem er seine Untersuchungen auf textanalytisch-hermeneutische Methoden ausrichtet (vgl. Liebau 1987; Bourdieu 1979; Reichertz 2002; Oevermann 2001). Bourdieu untersucht die von der Wissenschaft konstruierten Strukturen, Oevermann blickt dagegen auf der Grundlage linguistischer Theoreme auf die strukturerzeugenden, generativen Regeln, die er als eigenständige Realität auffasst (vgl. Liebau 1987: 50). Auch Liebau (1987: 135f) erkennt allerdings Strukturgleichheiten zwischen dem ‚HabitusBegriff’ und dem ‚Deutungsmuster-Begriff’: Zunächst einmal neben beide Begriffe in den jeweiligen Ansätzen eine zentrale, theoriestrategische Position ein. Beiden ist gemeinsam, dass sie den Subjekten nur bedingt (oder gar nicht) bewusst sind, so lange sie nicht analysiert und in ihren Geltungsbereichen kritisch reflektiert worden sind. Sowohl im Habituskonzept als auch im Deutungsmusteransatz werden somit Transformationsmöglichkeiten im Hinblick auf deren Ausgangsbedingungen eingelagert. In beiden Ansätzen wird von einem Unterschied zwischen Kompetenz und Performanz ausgegangen. Bei Bourdieu gehört die Perfomanz jedoch zur Lebenspraxis, bei Oevermann wird sie als sinngeleitetes Handeln interpretiert (vgl. ebd.). Der Habitus-Begriff umfasst einen deutlich weiteren Referenzrahmen. Er erstreckt sich über die gesamte Lebenspraxis - sozusagen vom Lieblingsgetränk bis zur Wahl oder Abwahl eines Hochschulbesuchs. Der Deutungsmusterbegriff ist insofern eingeschränkter, als er auf der Ebene sprachlich22 symbolischer Repräsentationen verbleibt, auf „der Ebene symbolischer Sinn-Strukturen“ (Liebau 1987: 135). Insofern lässt sich der Deutungsmusterbegriff als die kognitivsprachliche Ebene des Habituskonzepts auffassen (vgl. ebd.: 136). Bourdieu zeichnet ein Subjekt, dessen Lebenspraxis zu ‚Dreivierteln’ seiner gesamten Existenz durch Automatismen geprägt ist, Oevermann dagegen ein prinzipiell ‚autonome, handlungsfähige mit sich identische Subjekt’ (vgl. Liebau 1987: 133), dessen Autonomie nur temporär beschädigt ist (vgl. Wernet 2003: 37f; Oevermann 2008: 62f). Der Pädagoge muss in Form einer stellvertretenden Krisenbewältigung diese - gesetzte Autonomie des Subjektswieder herstellen. Bei Bourdieu geht es um die Erkenntnis der gegebenen Strukturbedingungen durch (sprachliche) Verfremdungsprozesse, nicht aber um die Wiederherstellung einer bereits universell geltenden Autonomie. Auch das Feldkonzept von Bourdieu besitzt einen deutlich weiteren Interpretations- und Handlungsrahmen: Es ist eine gesamtgesellschaftliche Topographie zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt, wohingegen die konkrete Professionalisierungsbedürftigkeit für schulpädagogische Kontexte aus einem allgemeinen Professionskonzept abgeleitet wird. Man kann auch hier – wie beim Habitusbegriff – sagen, dass es sich um ein Element bzw. um das soziales Feld der pädagogischen Handlungspraxis im Konzept von Bourdieus gesamten Feldvorstellungen handelt. Bourdieus Kapitalartendifferenzierung findet in Oevermanns organisational-institutioneller Infragestellung der Professionalisierbarkeit schulpädagogischer Handlungskontexte seinen Ort wohl am ehesten im kulturellen Kapital (vgl. Oevermann 2008: 56). Auch die Modi des Wissens, die Oevermann differenziert, spiegeln nur ein Element in der Feldtheorie Bourdieus wider, sie kennzeichnen sozusagen die Sprachspiele der beruflich bedingten Felder (vgl. Bourdieu 1983). 5. Abschließende Bemerkungen Auch wenn Liebau (1987) die beiden Positionen als zugleich konkurrierend und sich komplementär ergänzend auffasst, sind doch auf den Ebenen der erkenntnistheoretischen Grundsätze (strukturalistischer Konstruktivismus dort und interaktionistischer Strukturalismus hier), auf der Ebene des Zweckes von Begriffsbestimmungen durch Wissenschaft sowie damit verbunden im Verhältnis von Wissenschaft und (pädagogischer) Praxis deutliche Differenzen in den beiden Konzeptionen auszumachen. Die Grundlegende These der vorliegenden Arbeit, dass es sich bei dem bourdieuischen Habituskonzept um ein deskriptives Beschreibungsmodell mit konstruktivistischen Grundpositionen und bei Oevermann um ein interaktionistisch-strukturalistisches Professionsmodell handelt, darf als bestätigt betrachtet werden. Darüber hinaus kann man nach dem Gesagten auch Liebaus (1987: 141) abschließende Bewertung im Hinblick auf den oevermannschen Ansatz nachvollziehen: 23 „Oevermanns identitätslogische Argumentation vermag (…) letztlich nicht zu überzeugen. Sie führt zur Verwechselung vom ‚Modell der Realität’ mit der ‚Realität des Modells’“ (Liebau 1987: 141). Liebaus (1987: 141) vernichtendes Urteil zu Oevermanns sozialisatorischem Ansatz kann sogar noch um den Vorwurf der vielen ‚Hilfskonstruktionen’ zu Ehrenrettung seiner Theorie (z.B. die Neugier des Kindes als Äquivalent zu asymmetrischen Therapeut-KlientBeziehung) ergänzt werden. Oder, wenn man es lieber in der aktuell bevorzugten denglischen Variante hören möchte: „Die Trennung von ‚logic of discovery’ und ‚logic of verification’ wird (…) zurückgenommen“ (Reichertz 2002: 138). Liebau (1987: 141) missfällt an Oevermanns Ansatz seine hermetische Geschlossenheit, die sich seines Erachtens nicht mit dem Hohelied auf die Autonomie der Subjekte verträgt. Reichertz (2002: 123, Fußnote) kritisiert bei Oevermanns Übertragung der ‚objektiv’-hermeneutischen Forschungsergebnisse auf die konkrete Lebenspraxis, v.a. dass von einer Textanalyse nicht einfach auf ‚die’ Lebenspraxis kurzgeschlossen werden könne. Auch wenn Reichertz (2002: 140f) die vernichtenden Ergebnisse Bocks bei einer Konfrontation der ‚objektiv’hermeneutischen Analyse mit empirisch-wissenschaftlichen Gütekriterien nicht sehr überraschen, ist doch zumindest die Frage berechtigt, ob nicht die in qualitativen Forschungsdesigns üblichen Äquivalente (z.B. Interraterreliabilitäten) auch dort Gültigkeit beanspruchen dürften. Bock (1984, zitiert nach Reichertz 2002: 141) kommt zu folgender Beurteilung der ‚Objektiven’-Hermeneutik: „Die theoretische Grundlegung (…) ist unvollständig (…), die Methodologie ist aporetisch (…), und die Explikationen selbst sind ohne soziologische Relevanz“. Auch wenn man diese radikale Perspektive nicht teilen muss, lassen sich theoretische Inkonsistenzen und Brückenkonstruktionen in Oevermanns Theorie nicht von der Hand weisen - insbesondere in seinen pädagogischen Konzeptionen. Liebau (1987) geht sehr wertschätzend mit der theoretischen Begriffsbestimmung von Oevermanns um, weist aber ebenso auf deren Schwächen hin und räumt Bourdieu quantitativ und qualitativ in seinem Theorienvergleich einen größeren Platz ein - vielleicht nicht ohne Grund. Reichertz (2002: 141) ist – strenggenommen – in seinem Urteil über die objektive Methodologie deutlicher radikaler, wenn er sie in Zusammenhang mit ‚Sektenbildung’ bring. Anlass für diese Zuordnung bietet die starke Personenorientierung in diesem methodischen Zugang und die Tatsache, dass Oevermann eine strukturierte und strukturierende Einführung in die ‚Objektive’ Hermeneutik bisher vermissen lässt (vgl. ebd.: 140). Dies wurde bereits von Liebau festgestellt (vgl. Liebau 1987: 20) und birgt die Gefahr kein kohärentes Bild der theoretischen und praktischen Implikationen der oevermannschen Theorie zu erhalten. 24 Will man das Habituskonzept von Bourdieu tatsächlich in die Professionalisierungstheorie von Oevermann überführen, dann ist eine theoretische (und empirische!) Adaption notwendig. In der Studie von Müller und Becker-Lenz wurde mit der Methode der objektiv hermeneutischen Sequenzanalyse gearbeitet (vgl. Müller/ Becker-Lenz 2008: 30). Eine so komplexe Methode (oder gar ‚Kunstlehre’), wie die Sequenzanalyse sollte allerdings mindestens exemplarisch - verdeutlicht werden, will man dem Anspruch an konsensueller Validierung von ‚Texten’ wirklich gerecht werden. Dies ist umso stärker angezeigt, wenn man daraus eine historisch-aktualisierte Normalitätsfolie für Soziale Arbeit entwickeln will. 25 Literatur Ackermann, Friedhelm/ Seeck, Dietmar (1999): Soziale Arbeit in der Ambivalenz von erfahrung und Wissen. Motivation-Fachlichkeit-berufliche Identität: Ergebnisse einer qualitativ-empirischen Untersuchung. In: Neue Praxis (1)/1999, S. 7-22 Baumgart, Franzjörg (2004): Die verborgenen Mechanismen der Macht. In: Baumgart, Franzjörg (Hrsg.): Theorien der Sozialisation. Erläuterungen, Texte, Arbeitsaufgaben. 3 Aufl. Bad Heilbrunn/ Obb: Klinkhardt, S. 197-231 Bourdieu, Pierre (1979): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlagen der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapitel, soziales Kapital. In: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten, Göttingen: Verlag Otto Schwartz, S. 183-198 Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Bourdieu, Pierre (1997): Der Tote packt den Lebenden. Schriften zu Politik und Kultur 2. Hamburg: VSA-Verlag Bourdieu, Pierre (1998): Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp Brinker, Klaus (2001): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5. Aufl. Berlin: Schmidt Brumlik, Micha (2000): Soziale Arbeit. Funktionale Erfordernisse, ideologische Selbstmißverständnisse und vergessene Traditionen. In: Zeitschrift für Pädagogik. 42. Beiheft. Weinheim u.a.: Beltz, S. 186-211 Fuchs-Heinritz, Werner/ König, Alexandra (2005): Pierre Bourdieu. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft Gailberger, Steffen et al. (2007): Wissen und Kompetenz im Literaturunterricht am Beispiel von Nachts schlafen die Ratten doch. In: Gailberger, Steffen/ Krelle, Michael: Wissen und Kompetenz. Entwicklungslinien und Kontinuität in Deutschdidaktik und Deutschunterricht. Baltmannsweiler-Hohengehren: Schneider Verlag, S. 97118 Graf, Werner (2007): Lesegenese in Kindheit und Jugend. Einführung in die I literarische Sozialisation. Hohengehren: Schneider Verlag Krais, Beate/ Gebauer, Gunter (2002): Habitus. Bielefeld: transcript Verlag Liebau, Eckart (1987): Gesellschaftliches Subjekt und Erziehung. Zur pädagogischen Bedeutung der Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu und Ulrich Oevermann. Weinheim u.a.: Juventa Müller, Silke/ BeckerLenz, Roland (2008): Der professionelle Habitus und seine Bildung in der Sozialen Arbeit. In: Neue Praxis (1)/2008, S. 25-41 Oevermann, Ulrich (1981): Professionalisierung der Pädagogik – Professionalisierbarkeit pädagogischen Handelns. Vortrag an der FU Berlin, verschriftetes TonbandProtokoll. Berlin Oevermann, Ulrich (2001): Die Struktur sozialer Deutungsmuster. Versuch einer Aktualisierung. In: Sozialer Sinn. H.1; S. 35-81 Oevermann, Ulrich (2008): Profession contra Organisation? Strukturtheoretische Perspektiven zum Verhältnis von Organisation und Profession in der Schule. In: Helsper, Werner et al. (Hrsg.): Pädagogische Professionalität in Organisationen. Neue Verhältnisbestimmung am Beispiel der Schule. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 55-77 Rehbein, Boike (2006): Die Soziologie Pierre Bourdieus. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft Reichertz, Jo (2002): Die objektive Hermeneutik – Darstellung und Kritik. In: König, Eckard/ Zedler, Peter (Hrsg.): Qualitative Forschung. 2. Aufl. Weinheim u.a.: Beltz, S. 123-156 Schwingel, Markus (2005): Pierre Bourdieu zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag Wieler, Petra (1997): Vorlesen in der Familie. Fallstudien zur literarischkulturellen Sozialisation von Vierjährigen. Weinheim: Juventa Wernet, Andreas (2003): Pädagogische Permissivität. Schulische Sozialisation und pädagogisches Handeln jenseits der Professionalisierungsfrage. Opladen: Leske + Budrich II