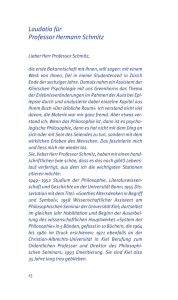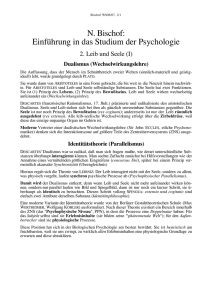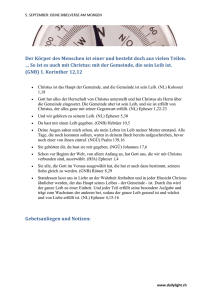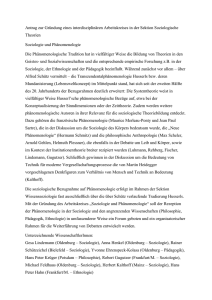Zur Wiedergewinnung des Subjekts - Ruhr
Werbung

Zur Wiedergewinnung des Subjekts – Erkenntnistheoretische Grundlagen subjektorientierter Sportwissenschaft DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Sportwissenschaft der Fakultät für Sportwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum vorgelegt von ANDRÉ HEMPEL Ruhr-Universität Bochum, 2008 Meinen Eltern Inhaltsverzeichnis Einleitung ................................................................................................ - 1 1 Das mechanistische Weltbild ...................................................... - 7 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Der dualistische Ausgangspunkt ................................................ - 8 1.1.1 Mathematisierung der Welt ........................................... - 10 - 1.1.2 Der Zweifel als Fundament der Erkenntnis................... - 14 - 1.1.3 Dualismus von Geist und Körper .................................. - 18 - 1.1.4 Descartes’ Wirkung ....................................................... - 20 - 1.1.4.1 Freiheit als Befreiung ins Leere .................................... - 20 - 1.1.4.2 Dogmatik ....................................................................... - 23 - 1.1.4.3 Der Erfolg des mechanistischen Paradigmas ................ - 25 - 1.1.5 Das Objektivitätspostulat .............................................. - 27 - 1.1.6 Die Mechanisierung des Denkens ................................. - 31 - Auswirkungen der Mechanisierung im Sport ........................... - 35 1.2.1 Der okzidentale Leistungsbegriff .................................. - 37 - 1.2.2 Die Transformation des Leibes zum Körper ................. - 42 - 1.2.3 Das Beispiel Bildungsstandards .................................... - 51 - Grenzen des objektivistischen Paradigmas............................... - 56 1.3.1 Am Beispiel des Kognitivismus .................................... - 56 - 1.3.2 Am Beispiel der Quantenphysik ................................... - 64 - 1.3.3 Die Frage nach dem Beobachter ................................... - 68 - 1.3.3.1 Beobachterproblem in der Physik ................................. - 68 - 1.3.3.2 Beobachterproblem in der Biologie .............................. - 72 - 1.3.3.3 Beobachterproblem in der Soziologie ........................... - 75 - 1.3.3.4 Beobachterproblem in der Kunst .................................. - 76 - Zwischenbilanz ......................................................................... - 77 Phänomenologie ........................................................................ - 80 - 2.1 Ansätze zur Bestimmung des Begriffes.................................... - 80 - 2.2 Erkenntnistheoretische Ausgangssituation ............................... - 83 - 2.3 Ursprung der phänomenologischen Denkweise ....................... - 87 - 2.4 Grundlagen der Husserlschen Phänomenologie ....................... - 97 2.4.1 Phänomenologie als Wesenslehre ................................. - 97 - 2.4.2 Eidetische Reduktion .................................................. - 102 - 2.4.3 Phänomenologische Reduktion ................................... - 104 - 2.4.4 Intentionalität des Bewusstseins ................................. - 110 - 2.5 3 2.4.5 Fruchtbarkeit der Phänomenologie Husserls .............. - 115 - 2.4.6 Kritische Betrachtungen .............................................. - 119 - Überlegungen zu einem weiterführenden Ansatz ................... - 124 2.5.1 Die französische Philosophie der leiblichen Existenz - 124 - 2.5.2 Mein Leib als Tatsächlichkeit ..................................... - 126 - 2.5.2.1 Zur-Welt-sein .............................................................. - 128 - 2.5.2.2 Präobjektivität ............................................................. - 131 - 2.5.3 Der Leib-für-Andere ................................................... - 133 - 2.5.4 Phantomglied............................................................... - 135 - 2.5.5 Ambiguität des Leibes................................................. - 140 - 2.5.6 Der Leib als Erkenntnismonopol? ............................... - 145 - 2.5.7 Das ontologische Konzept der Schichtung ................. - 148 - Prozesse leiblichen Erkennens ................................................ - 152 3.1 Wahrnehmung als intentionale Aktivität ................................ - 153 - 3.2 Die habituelle Konstitution von Erfahrung ............................ - 155 - 3.3 4 3.2.1 Habitualität des Leibes ................................................ - 155 - 3.2.2 Doppelter Erfahrungsbezug von Erkennen ................. - 158 - 3.2.3 Inkorporierte Sozialstrukturen .................................... - 162 - 3.2.4 Der Leib als Erkenntnisquelle ..................................... - 165 - 3.2.5 Leibliches Verstehen ................................................... - 167 - 3.2.6 Die Methode der Ideierung ......................................... - 170 - Qualitative Forschung ............................................................ - 174 3.3.1 Zur Kritik an der quantitativen Sozialforschung ......... - 175 - 3.3.2 Zentrale Prinzipien qualitativer Forschung ................. - 177 - Sportpädagogische Implikationen ........................................... - 180 4.1 Konturen einer subjektorientierten Selbstbewegungstheorie . - 181 - 4.2 Das Bildungspotenzial des Sports… ...................................... - 189 - 4.3 …und gesellschaftliche Bedingungen für dessen Realisierung- 197 - 4.4 Zur Verbesserung der Lehrerausbildung ................................ - 200 - 4.5 Fazit ........................................................................................ - 205 - 5 Literaturverzeichnis ................................................................ - 208 5.1 Husserls Werke (Husserliana = Hua) ..................................... - 208 - 5.2 Auswahlbibliographie............................................................. - 208 - Einleitung -1- Einleitung Der Ausgangspunkt für die heute noch tief verwurzelten Vorstellungen von der Welt und den Dingen reicht bis zu den alten Denkern zurück, deren Ideen in unserer heutigen okzidentalen Kultur teilweise wiedergeboren sind. Platon verurteilte Unmessbarkeit, Unwägbarkeit und Unvernunft des Bildhaften; Galilei prägte der abendländischen Gesellschaft ein, alles müsse gemessen und gewogen werden, und was nicht messbar und wägbar sei, solle mess- und wägbar gemacht werden. Alles aber, was nicht mess- und wägbar zu machen sei, existiere nicht. Solange wir messen und wiegen können, fühlen wir uns auf sicherem Grund, alles andere scheint uns verdächtig, wird uns von Jugend an verdächtig gemacht. Zwar kennen wir Hamlets „Es gibt mehr Dinge auf Himmel und Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt“, aber wir wollen es nicht hören, halten uns für Realisten und sind auch noch stolz darauf. Vor allem Zahlenmaße suggerieren eine Welt, die potenziell beherrschbar ist. Die Übersetzung der Welt in Zahlen und quantitative Maßeinheiten verheißt Sicherheit durch mögliche Kontrolle und Vorhersehbarkeit. Dieses Maß, das wir gesetzt haben und nach dem wir alles zu beurteilen versuchen, ist eine künstliche Einheit, dazu erdacht, die Dinge messbar zu machen, zu objektivieren. Wissenschaft bedarf eines solchen Systems der Objektivierung. Schon die Aktivform „objektivieren“ verrät, dass ein aktives Eingreifen nötig ist, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen, und lässt ahnen, wie es um Objektivität bestellt sein muss. Dennoch brauchen wir Systeme und Skalen, gleichsam Raster der Weltsicht, um uns in der Welt zurechtzufinden. Gleichgültig, wie die Maß-Skala, die wir aufstellen, aussieht, ihr Maß ist immer linear. Die gegebene Ordnung bestimmt, dass zwei nie vor eins kommt. Die Menschheit verfügt über sehr genaue Skalen, um die Dinge zu messen. Da unsere Skalen teilbar sind und die Einheiten dank der Einleitung -2- modernen Wissenschaft immer kleiner werden, sind die Messergebnisse genauer denn je, die Objektivität scheinbar objektiver denn je. Nun könnte man meinen, dass dieses Weltbild das Angemessenste, weil Nützlichste sei - zumal es die Voraussetzung für beachtliche Erfolge der Menschheit darstellt. Dabei übersieht man, dass durch jene objektivierende Haltung eine Trennung in analytische und intuitive Informationen betrieben wird, wobei eine Überwertung des Rationalen gegenüber dem Emotionalen augenfällig ist. Es gibt nun aber einmal Dinge, Strömungen, Informationen, die nicht messbar sind auf den linearen Skalen, sich weder messen noch wiegen lassen mit den Mitteln, die der Verstand bereithält. Das Gefühl, die Intuition, die Vorstellungskraft und Sinnlichkeit bleiben unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen; die so genannte exakte Wissenschaft setzt Messbarkeit voraus, also muss das nichtlineare Gefühl als störend empfunden, möglichst ausgegrenzt werden. Dem allgemeinen Denken wohnt nach wie vor eine Fixierung auf das Rationale und auf lineare Messbarkeit inne. Wie oft hören (oder sagen) wir den Satz: Die Sache müssen wir einmal ganz emotionslos angehen! Damit geben wir uns erneut der Illusion hin, die Dinge ließen sich alle in die lineare Ordnung bringen, für die unsere Skalen taugen. Die Welt sei eine Maschine, und wenn wir im Teilen ihrer Teile lange genug fortfahren, werden wir endgültig wissen, wie sie funktioniert, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Mit der Bevorzugung des Teilungsgedankens vor dem Ganzheitsgedanken hängt auch die enorme Wissenschaftsgläubigkeit des Okzidents zusammen. Die wurde zuletzt in der politisch aufgeladenen Zeit der 1960er Jahre als ungebremster Fortschrittsoptimismus enthüllt, der besagt: Alles was machbar ist, ist wünschenswert und wird ausgeführt. Für die damaligen Kritiker war positivistisches Denken das Problem und der Atombombenabwurf über Hiroshima das Exempel. Heute erscheinen die ethischen Debatten über Gentechnik als Neuauflage der Thematik des Positivismusstreits. Längst müssen sich Naturwissenschaften die Frage gefallen lassen, was über die Konstruktion von Tatsachen hinaus eigentlich sein soll. Gleichwohl Einleitung haben -3- die Naturwissenschaften zunehmend frühere „Lebenswissenschaften“ wie Philosophie und Theologie abgelöst. Man braucht aber nicht bis in weltpolitische Zusammenhänge vorzudringen um einzusehen, dass solcherart Fortschrittsgläubigkeit auch in anderen, kleineren Bereichen wirkmächtig ist. Prägnant ist in diesem Zusammenhang die gegenwärtige Diskussion um Standards für Bildung. Im Rahmen der Bestrebungen, Lernergebnisse von Schülern überprüfbar zu machen und also evaluieren zu können, wird die Neigung zum Messen besonders auffällig. Man versucht, Bildung in Skalen zu erfassen, die gesellschaftlich vereinbarte Maßstäbe spiegeln. Die Maßstäbe sind in industriellen Gesellschaften auf praktische und wissenschaftliche Tüchtigkeit bezogen. Bei der Fokussierung auf diese Maßstäbe scheint Entscheidendes aus dem Blick zu geraten: „Zusammenhang herstellen, Sinn geben, bewerten (nicht nur begründen), etwas auf sich beziehen, etwas genießen können, Vergangenes rekonstruieren, Künftiges entwerfen, Einzigartiges verstehen, Ambiguität oder Aporie aushalten“ (v. Hentig, 2003, V28). Die Entfaltung und Gestaltungsvermögens, Verfeinerung die des Beobachtung Wahrnehmungs- und und der Beachtung Mitmenschen, das Gemeinwohl, all dies sind Kompetenzen, die durch PISA oder TIMMS nicht gemessen werden können und deshalb außerhalb jeder evaluierenden Bestandsaufnahme verbleiben müssen. Solche Tests orientieren sich anscheinend zu sehr an formalen Kompetenzen. Nimmt man ausschließlich die Rechen- und Lesefähigkeit als Maßstab für Bildung, so überrascht es nicht, dass Japan trotz (oder wegen) seines autoritären Unterrichtsstils und einer entsprechend hohen Selbstmordrate unter Schülern im direkten Vergleich mit deutschen Schulen besser abschneidet. V. Hentig (2003, V9-V10) warnt zu Recht davor, sich an solchen Maßstäben zu orientieren und Standards für Bildung an solchen Vorbildern auszurichten. Was Bildung ausmacht, nämlich was der sich bildende Mensch aus sich macht, muss bei standardisierten Verfahren, die auf Rankingplätze schielen, notwendig übersehen werden. Einleitung -4- Dass musische Fächer wie Sport von PISA gar nicht erst erfasst und daher auch deren Optimierung den Kommissionen zur Erstellung von Standards nicht übertragen wurde, kann zugleich als eine gesellschaftliche Geringschätzung „nicht-kognitiver“ Schulfächer oder als Glücksfall verstanden werden. Dennoch gibt es durchaus Bestrebungen, Sportunterricht im Rahmen einer „Qualitätsoffensive“ zu verbessern, wobei sich dasselbe Phänomen zeigt wie in den drei von PISA bewerteten „Hauptfächern“: „Je mehr versucht wird, die gewünschten Ergebnisse des Unterrichts operational und damit testtauglich zu beschreiben, desto mehr drängen sich sportmotorische Leistungen und körperliche Fähigkeiten sowie abprüfbare Wissensbestände in den Vordergrund“ (Kurz, 2006a, 5). Was Kurz hier beschreibt, ist ein weiteres Beispiel für den gesellschaftlich inkorporierten Messfetischismus, der alsbald im Sportunterricht zutage tritt. Leistung wird generell als Messbares definiert. Nicht Messbares betrachtet man bestenfalls als nebensächlich, wenn nicht gar als nicht existierend. Die Testbatterie von FoSS1 für geplante NRW Sportschulen verdeutlicht die Virulenz dieses Phänomens. Die vorgesehenen Tests erfassen motorische Dimensionen und die „Konstitution“, die ausdrücklich durch „Wiegen, Messen und BMI“ konstruiert wird. Das Leistungsverständnis im Sportunterricht wird so auf testtaugliche motorische Fähigkeiten reduziert, wobei die Pointe darin liegt, dass der BMI auf Gewicht und Länge rekurriert, wodurch die Waage ernsthaft zur Testmethode für Schulen eingeführt werden soll (vgl. Beckers, 2006, 59). Die Aussagekraft des Tests erschöpft sich damit in der Feststellung äußerlicher Körpermaße, die nach willkürlich festgelegten Normwerttabellen bewertet werden2. Das damit zugrunde liegende 1 Forschungszentrum für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen, Karlsruhe. 2 Die Willkürlichkeit von Normwertfestsetzungen durchleuchtet Körner (2008). Seine systemtheoretische Analyse ergibt, dass die Normierung und also Entsubjektivierung der „adipösen“ Kinder durch motorische Testverfahren und BMI das gesellschaftlich nicht ohne Hysterie kommunizierte Problem Übergewicht erst kollektiv Einleitung -5- Menschbild ist erschreckend mechanistisch, zumal es in pädagogischen Einrichtungen zur Anwendung kommen soll3. Der Sinn solcher Messungen wird offenbar dem Messen an sich untergeordnet. Das hängt damit zusammen, dass quantitative Angaben einzig geeignet scheinen, Entscheidungsträger dieser Gesellschaft zu überzeugen. Viel wichtiger scheint jedoch die Frage, ob eine Verbesserung von Sportunterricht nicht gerade durch die Konzentration auf nicht-messbare Faktoren erzielt werden könnte. Folgerichtig sind Maßnahmen zur Erkenntnis solcher für den Unterricht generell maßgeblicher Faktoren, wie bspw. soziale Kompetenzen, also Empathie, Rücksichtnahme und Kooperation, zu eruieren. Dazu ist die Aufmerksamkeit von Objekten, wie Inhalten, Bedingungen und Fertigkeiten zu den in den Sportunterricht verwickelten Subjekten zu verlagern. Um die ins Blickfeld zu befördern, ist allem Anschein nach von Standardisierungen und Perspektiven der „dritten Person“ abzurücken und vielmehr die Sicht der „ersten Person“, also die individuelle Erfahrung des Subjekts - des Schülers und des Lehrers - aufzuschließen. Zu diesem Zweck erscheinen hermeneutische und phänomenologische Perspektiven zielführender als vermeintlich objektive Messungen von Äußerlichkeiten. erzeugt, weil die als fettleibig stigmatisierten Kinder die kolportierte soziale Verachtung auch selbst gleichsam durch ihre Erfahrung hindurch reproduzieren. Es scheint darauf anzukommen, „dass man durch die Ergebnisse, die man vorlegt, die Bedingungen für eine Vertragsverlängerung erfüllt“ (Luhmann. Zit. nach: ebd., 134). „Geld fungiert hier als Energieäquivalent“ (ebd.). Luhmann spricht hierbei von einer „Kybernetik des Heuschreckenschwarms“: Die gleichen Diagnostiker, die Übergewicht durch Eindeutigkeit suggerierende Daten feststellen, lancieren anschließend entsprechende Therapiekonzepte. Schließlich geht eine mittlerweile hoch ritualisierte Betroffenheitsund Alarmrhetorik in der Sache deutlich über das hinaus, was sich letztlich halten lässt (vgl. ebd., 135). Untermauert wird dieser Befund durch den Umstand, dass über untergewichtige und essgestörte Jugendliche aufgrund des aktuellen Schlankheitsideals nicht in dieser Form kommuniziert wird, obwohl es derer genauso viele gibt (vgl. Beckers, 2006, 61). Außerdem ist es zur Bewältigung des „Legitimationsproblems der Schulsportpädagogik bzw. -didaktik“ (Körner, 2008, 157) nicht ausreichend, entlang solcher Zahlen zu argumentieren, weil Sport gegen Übergewicht keine pädagogische Relevanz aufweist und - folgt man der rein quantitativen Argumentation - in den außerschulischen Bereich verlegt werden könnte. 3 Dies betrifft in zunehmendem Maße auch andere Fächer. Da alles was wir geistig tun, seelisch fühlen und in Beziehungen gestalten, seinen Niederschlag in körperlichen Strukturen findet (vgl. Bauer, 2002), macht, wie es Thure von Uexküll auszudrücken pflegt, eine Medizin für „Körper ohne Seelen“ ebenso wenig Sinn wie eine Psychologie für „Seelen ohne Körper“. Das mechanistische Weltbild -6- Das Denken in Objekten ist derartig tief in unserer Vorstellung von Welt eingegraben, dass es notwendig erscheint, etwas auszuholen um die Wurzeln dieses Denkens sichtbar zu machen, das anscheinend einem generellen Verlust des Subjekts Vorschub leistet. Um einen Beitrag zur Kompensierung des vorläufig festzustellenden Defizits - des Verlusts des Subjekts - zu leisten, werden im Verlauf der vorliegenden Untersuchung zunächst die Bedingungen der Möglichkeit analysiert, die zur Entstehung der aktuellen mechanistischen Erkenntnisperspektive führen. Anschließend werden die, sich sukzessive abzeichnenden, Grenzen dieses Paradigmas ausgelotet. Von dort aus wird unter Anwendung phänomenologischer Methodik die Suche nach alternativen bzw. komplementären Erkenntnisperspektiven aufgenommen. Die vorliegende Untersuchung zielt zwar auf Sportwissenschaft, aber deren Probleme können erst durch eine wissenschaftstheoretische Analyse verdeutlicht werden. Ziel der Analyse ist die Entfaltung erkenntnistheoretischer Begründungen für eine Theorie subjektorientierter Sportwissenschaft, die natürlich nicht erschöpfend ausgearbeitet, sondern vielmehr nur konturhaft vorgezeichnet werden kann. Die Elemente, die im Untersuchungsverlauf aufgegriffen werden, können als Fundament für weiter reichende sportwissenschaftliche Betrachtungen fungieren. Diese Dissertation wird der sportwissenschaftlichen Fakultät der RuhrUniversität Bochum vorgelegt. Ich danke meinen akademischen Lehrern, Edgar Beckers für die ausgezeichnete Betreuung und Torsten SchmidtMillard für Korrekturen und Hinweise, sehr herzlich. Besonders möchte ich meinen Eltern danken, die mein Studium zu jeder Zeit und in jedweder Form unterstützt haben. Deshalb ist ihnen dieses Buch gewidmet. Köln, im Dezember 2008 André Hempel Das mechanistische Weltbild 1 -7- Das mechanistische Weltbild Um Quellen des neuzeitlichen Weltbildes zu ermitteln, scheint es hilfreich, aus historischer Perspektive auf die Schwelle vom mittelalterlichen, mystischen Denken zur neuzeitlichen Wissenschaft hinzuweisen, da hier die Vernunft, als Bedingung der Mechanisierung, entscheidend aufgewertet wurde. Im 16. und 17. Jahrhundert formt sich jene weltanschauliche Grundeinstellung, die heute als „neuzeitliche“ bezeichnet ist4. Mit der Veröffentlichung von Kopernikus Werk De Revolutionibus Orbitum Coelestium (1543) wird nicht nur ein Weltmodell durch ein anderes ersetzt, „sondern ein neuer und universaler Wahrheitsanspruch etabliert“ (Blumenberg, 1965, 41), der aber nicht auf der göttlichen Offenbarung, sondern auf dem rationalen Denken beruht. Die Kopernikanische Revolution war eine Revolution der Denkart; sie schuf ein neues Paradigma. 4 Blumenberg identifiziert diese Zeit als Epochenschwelle, indem er den letzten noch als sicher mittelalterlich zu charakterisierenden Denker (Nikolaus von Kues 14011464) mit dem ersten schon neuzeitlichen (Giordano Bruno 1548-1600) konfrontiert und zwischen ihnen die Periode des Umdenkens ansiedelt. Das Ereignis des Epochenwandels sei fließend und innerhalb dieser Zeitspanne zu verorten (vgl. Blumenberg, 1966, 436f.). Die genannten Gestalten sind allerdings keineswegs Prototypen, an denen das Wesen der jeweiligen Epoche festgemacht werden kann. Das mechanistische Weltbild -8- 1.1 Der dualistische Ausgangspunkt Die prägende Figur für den Beginn der Neuzeit war Galileo Galilei (1564-1642). Er legte für die „Mechanisierung“, mithin den „Übergang vom antik-mittelalterlichen zum klassisch naturwissenschaftlichen Denken“ (Dijksterhuis, 1956, 372), den Grundstein, denn er unternahm den Versuch, die Welt allein durch mathematische Hinsichten zu erklären. „Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offenliegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen; ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth umher“ (Galilei. Zit. nach: Bellone, 2002, 84). Galilei beschränkte seine Studien auf Merkmale, die gemessen und quantifiziert werden können: Formen, Zahlen und Bewegungen von materiellen Körpern. Andere Eigenschaften wie Farbe, Geschmack, Klang, Geruch und Gefühle seien demnach unwissenschaftlich, da sie der quantitativen Messung nicht zugänglich sind (vgl. Bellone, 2002, 28). Durch Galilei wird das Weltbild mathematisiert, indem Welt als mechanisch bestimmbar angenommen wird. Bei ihm lässt sich der erste Ausgangspunkt für die folgenreiche Mechanisierung des Weltbildes feststellen. „Dahin schwinden Sicht, Klang, Geschmack, Berührung und Geruch, und mit ihnen sind seither dahin Ästhetik und moralische Empfindsamkeit, Werte, Qualität, Form; dahin sind auch Gefühle, Motive, Absichten, Seele, Bewusstsein, Geist. Die Erfahrung an sich ist aus dem Reich wissenschaftlicher Forschung ausgestoßen worden“ (Laing. Zit. nach: Capra, 1983, 53). Das mechanistische Weltbild -9- Durch die Reduzierung der Natur auf Quantitäten findet offenbar eine Verengung der Weltsicht statt. Fortan wird die Welt als materielle, als Objektwelt angesehen. „Man kann wohl sagen, dass erst durch Galilei die Idee einer Natur als einer in sich real abgeschlossenen Körperwelt an den Tag tritt. In eins mit der zu schnell zur Selbstverständlichkeit gewordenen Mathematisierung ergibt das als Konsequenz eine in sich geschlossene Naturkausalität, in der alles Geschehen eindeutig und im Voraus determiniert ist. Offenbar ist damit auch der Dualismus vorbereitet, der alsbald bei Descartes auftritt“ (Hua VΙ, 61). Das mechanistische Weltbild ist eng verbunden mit einem strengen Determinismus, mit der Auffassung einer kausalen und völlig determinierten kosmischen Maschine. Nach dieser Auffassung hat alles, was geschieht, eine definitive Ursache und eine definitive Wirkung. Kristallisiert hat sich diese Position später im „Laplaceschen Dämon“ (nach Pierre Simon de Laplace 1749-1829). Jener sei in Kenntnis sämtlicher Naturgesetze und in der Lage, wenn ihm einmal der Zustand der Welt zu einem einzigen Zeitpunkt vollständig bekannt sei, alle nachfolgenden und auch vorhergehenden Zustände der Welt aus den Naturgesetzen zu berechnen (vgl. Heiden, 1996, 99). „Objektiver Zufall“ (ebd.) sei demnach ausgeschlossen. Deshalb könne die Natur prinzipiell objektiv beschrieben werden. Diese Objektivität wurde zum Ideal der gesamten Naturwissenschaften und damit zur Triebfeder der Mechanisierung des Weltbildes. Die Gedanken Kopernikus’, Keplers sowie die mathematischen Erfolge Galileis bildeten den Nährboden für die Philosophie Rene Descartes’ (1596-1650), die das aristotelische Weltbild ablöste. Die Vorherrschaft des rationalen Denkens, die mit Descartes ihre Erfolgsgeschichte antritt, bringt ungeheure Fortschritte im menschlichen Können und Wissen und damit starke Veränderungen der Weltanschauung. Die Quellen der Mechanisierung des Weltbildes sind durchaus bei Galilei, aber insbesondere im Cartesianismus, der allgemeingültigen Interpretation von Descartes’ Philosophie, zu vermuten. Deshalb wird das cartesianische Denken im Folgenden auf diese Quellen untersucht, um im Das mechanistische Weltbild - 10 - weiteren Untersuchungsverlauf Anhaltspunkte für Entstehung und Struktur der mechanistischen Erkenntnisperspektive ausmachen zu können. 1.1.1 Mathematisierung der Welt Die „radikale Revolution der Weltansicht vollzieht sich in der Philosophie der Neuzeit“ (Heidegger, 1985, 17). Diese Philosophie erscheint zum ersten Mal voll ausgebildet in dem System des Descartes. Er schuf ein neues, systematisierendes und allumfassendes Weltbild, welches die Scholastik der Kirche seinerzeit immer weniger glaubwürdig bereitstellen konnte. „Descartes inauguriert eine völlig neuartige Philosophie: ihren gesamten Stil ändernd, nimmt sie eine radikale Wendung vom naiven Objektivismus zum transzendentalen Subjektivismus, der in immer neuen und doch immer unzulänglichen Versuchen auf eine notwendige Endgestalt hinzustreben scheint“ (Hua Ι, 46). Der Subjektivismus ist bei Descartes gekennzeichnet durch die zentrale Stellung des menschlichen Denkens sowie der daraus hervorgehenden Ideen. Descartes kapriziert den Subjektbegriff auf das Denken. Ähnlich der scholastischen Philosophie verfolgt er die Absicht, ein Weltbild zu entwerfen, das im Prinzip fertig ist und an dem nur noch Detailarbeit verrichtet zu werden braucht (vgl. Russell, 1970, 196). Er strebt nach absoluter Gewissheit und einem vollkommen zuverlässigen Erkenntnisfundament. Die Welt könne vollständig erkannt werden. Und die notwendige Methode dazu sei die der Mathematik. Das Ziel musste also sein, ein neues philosophisches Gedankensystem zu errichten, welches wahre Gewissheit durch Intuition und mathematische Deduktion erreicht. Dieser Glaube an absolute Gewissheit entspricht einer deterministischen Einstellung. Der Glaube an die Gewissheit wissenschaftlicher Erkenntnis bildet die eigentliche Grundlage der cartesianischen Philosophie und der daraus abgeleiteten Weltanschauung. Das mechanistische Weltbild - 11 - Es war die Grundannahme Descartes’ - der hierin Galilei folgt - dass die Struktur der Außenwelt dem Wesen nach mathematischer Art sei und dass zwischen dieser Struktur und dem mathematischen Denken des menschlichen Geistes eine natürliche Harmonie bestehe. Die neue Methodologie von Galilei beinhaltet die „Mathematisierung der natürlichen Erkenntnis. Auf dieser Basis entwickelte sich der Objektivismus: sobald Galilei die Welt als angewandte Mathematik entdeckte, verkleidete er sie wieder als Bewusstseinsleistung“ (Lyotard, 1993, 54). Descartes hat diesen, als Subjektivismus eskamotierten, objektivistischen Gedanken bis zu seinen äußersten Konsequenzen weiterverfolgt. Das heißt, er hat Mathematik, Denken und Naturwissenschaften praktisch gleichgesetzt. Und zwar nicht, indem die Mathematik den Naturwissenschaften nur diene, sondern indem der menschliche Geist das Wissen über die Natur in gleicher Weise aus sich selbst heraus erzeugt, wie er dies mit der Mathematik tue. Das gleiche macht Descartes bei seiner Philosophie. „Die gesamte Philosophie ist (also) einem Baume vergleichbar, dessen Wurzeln die Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige alle übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich auf die Medizin, die Mechanik und die Ethik“ (Descartes, 1992, 8). Über die Fundierung der Metaphysik und über die Mathematik wird hier nichts gesagt. Daraus kann man schließen, dass das mathematische Denken nach Descartes’ Auffassung diese Fundierung bietet (vgl. Dijksterhuis, 1956, 356). Im Cartesianismus avanciert die Mathematik zur Metaphysik5. 5 Das Ideal der Mathematisierung, dessen Wurzeln bis zu Pythagoras zurückreichen, kennzeichnet den europäischen Zeitgeist schon vor der Aufklärung. Man ist fasziniert von der Schönheit mathematischer Proportionen, in denen scheinbar das Geheimnis der Welt beschlossen liegt. Selbst in der Kunst der Renaissance entfaltet sich zunehmend ein mathematischer und experimenteller Charakter. Die „Erfindung der Zentralperspektive in der Malerei beispielsweise, die die Möglichkeiten der bildenden Kunst revolutionieren, ist primär ein mathematisches Problem“ (Beckers, 1997, 178). Albrecht Dürer erläutert um 1500 die wissenschaftlichen Voraussetzungen perspektivischen Zeichnens. Damit ist für Kunst nicht länger das individuelle, ästhetische Gefühl maßgebend, sondern die Proportionen des „Goldenen Schnitts“, der Das mechanistische Weltbild - 12 - Descartes war ebenfalls überzeugt von dem, was Galilei vor ihm zum Ausdruck brachte: Dass die Erkenntnis des Mathematikers sich zwar an Umfang von Gottes Erkenntnis unterscheide, aber an Qualität mit dieser gleichwertig sei (vgl. Mittelstrass, 1969, 104). Dementsprechend trägt die cartesianische Naturphilosophie einen durchweg mathematischen Charakter. Dieser besteht in dem Voranstellen von unanfechtbaren Grundsätzen und in der deduktiven Herleitung der Erscheinungen. Die Mathematik bekleidet dementsprechend im cartesianischen Denken eine Monopolstellung. Ihr wird das Potenzial zugesprochen, auch in den anderen Einzelwissenschaften sowie einem philosophischen Welterklärungssystem unzweifelhafte Erkenntnis zu gewährleisten, da die Struktur der Natur als durchweg mathematisch ergründbar angenommen wird. Aus dieser Idee leitet Descartes die Überzeugung ab, dass „perfektes Wissen“ (Schrödter, 2000, 121) existiere. Das stabilisierende Element für diesen Absolutheitsanspruch seines rationalistischen Systems findet Descartes in Gott. Der Weg zur Gewissheit sei nach Descartes auf mathematischanalytischem Wege zu bestreiten6. Zu diesem Zweck ersann Descartes seine intuitiv-deduktive Methode, die in der Mathematik auch gewaltigen Erfolg hatte. Dem Menschen stehe kein Weg zur sicheren Kenntnis der Wahrheit offen - ausgenommen die augenfällige Intuition und die notwendige Ableitung (vgl. Descartes, 1955, Regel 3). Sicheres Wissen erlange man also durch Intuition und Deduktion, und dies sind die Werkzeuge, die Descartes bei seinem Versuch benutzt, das Gebäude des Wissens auf einem neuen Fundament zu errichten. In dem Glauben, die konstruiert und berechnet werden kann (vgl. ebd., 179). „Die Harmonie der Natur war Vorbild für das vom Menschen hergestellte, die Kunst“ (Wagner, 1984, 114). Auch Leonardo da Vinci, als „Künstler-Ingenieur“ (Beckers, 1997, 179) sowie die Erfindung der doppelten Buchführung illustrieren den mathematischen Zeitgeist dieser Epoche (vgl. ebd., 183). 6 Seinerzeit gab es die Theorie der Evolution noch nicht, weshalb Descartes nichts von den Ideen eines „Weltbildapparates“ (Lorenz), oder „perceiving apparatus“ (Popper) wissen konnte. Das mechanistische Weltbild - 13 - Welt sei durchweg mathematisch determiniert, sah Descartes diese Methode als Königsweg zur Erkenntnis der Wahrheit. Die cartesianische Methode bezweckt also tatsächlich, alle Naturwissenschaften zu mathematisieren. Zu diesem Zweck postuliert Descartes eine universelle Mathematik, die alle bislang getrennten Wissenschaften zu einer Gesamtwissenschaft (mathesis universalis) zusammenfassen soll7. Dabei werden die auftretenden Merkmale eines beobachteten Dinges deduktiv geordnet, um die erworbene Erkenntnis anschließend zu axiomatisieren. Die geschaffenen letzten Beweise sind also nur durch mathematisches Denken entstanden. Das naturwissenschaftliche Denken wird in die Bahnen der Mathematik gelenkt, die ihre Erkenntnisse und Ergebnisse durch Ableitung aus Axiomen sowie Berechnungen gewinnt. Descartes begründete ein Ideal der Mathematisierung der Naturwissenschaften, in dem theoretisch alle Naturerscheinungen durch Ableitung von mathematisch eruierten Gesetzen erkannt werden können (vgl. Peters, 1979, 60f.). Zur zweifelsfreien Erkenntnis dieser mechanischen Gesetze der Natur sei nur der denkende Geist fähig, der sich in ähnlich mathematisch-analytischen Bahnen bewegt8. 7 Descartes entwickelte auch die analytische Geometrie: Er verband die beiden mathematischen Grunddisziplinen Geometrie und Arithmetik (Analysis) zu einem Gebiet. Dadurch lassen sich geometrische Körper mit algebraischen Mitteln erfassen und beschreiben, umgekehrt lassen sich algebraische Verknüpfungen im Vektorraum darstellen: mit den Gesetzen der analytischen Geometrie kann man (arithmetische) Formen als (geometrische) Kurven darstellen und Geometrisches arithmetisch berechnen (vgl. Rombach, 1980, 28). In der Antike und im Mittelalter waren Geometrie und Arithmetik getrennte Disziplinen, die zwei verschiedenen Vermögen des Menschen zugerechnet wurden: Sinnlichkeit und Verstand. Deshalb schreibt Rombach: „Zwischen Arithmetik und Geometrie verlief daher eine radikale Grenze zwischen der unsterblichen Vernunft und dem vergänglichen Sinnenbereich. Als Descartes die grundlegende, beide Wissenschaften zu einer Disziplin verbindende Disziplin entdeckte, (…) hatte die Vernunft die Grenze ihrer bisherigen Geltung überschritten und ein riesiges Feld der Sinnlichkeit als ihr zugehörig in Besitz genommen. Sie hatte damit entdeckt, dass etwas, was bislang als sinnlich galt, in Wahrheit vernünftig war und der vollständigen Aufdeckung durch die Vernunft harrte“ (ebd.). Diese Entdeckung des Zusammenhangs von Sinnlichkeit und Vernunft ermöglichte allererst das Vorstoßen der Vernunft in Gebiete, die zuvor der Sinnlichkeit vorbehalten waren: Vernunft vertreibt Sinnlichkeit. 8 „Das Denken - die res cogitans“ - funktioniert „als Regelwerk selbst wie eine Maschine“ (Meyer-Drawe, 1996, 35). Das mechanistische Weltbild - 14 - 1.1.2 Der Zweifel als Fundament der Erkenntnis In seinem Streben nach absoluter Gewissheit zweifelte Descartes an allem, was seine Sinne ihm aus der Welt übermittelten. Dabei ging er von der Vermutung aus, dass „ein böser Geist“ ihn täusche und „alle Außendinge nichts als das täuschende Spiel von Träumen seien“ (Descartes, 1994, 16). Er wolle hartnäckig an dieser Art der Betrachtung festhalten. „Ich werde so zwar nicht imstande sein, irgendeine Wahrheit zu erkennen, doch bin ich entschlossenen Sinnes, mich in Acht zu nehmen, soviel an mir liegt, nicht Falschem zuzustimmen“ (ebd.). Descartes misstraut den Sinnen und verlässt sich nur auf seinen denkenden Geist. Da dieser zweifelt, mithin denkt, steht für ihn immerhin fest: Ich bin ein „denkendes Ding“ (res cogitans) (ebd., 27). Dadurch, dass ich denke, bin ich. Das Denken ist für ihn letztlich das Einzige, was nicht angezweifelt werden kann, und das allein seine Existenz als Mensch beweist; gleichsam das einzig Gewisse: „Dubito, Cogito, ergo sum“. Durch diesen Ausspruch wollte Descartes das allein Gewisse des subjektiven Denkens, im Gegensatz zum Zweifelhaften aller räumlich ausgedehnten Dinge (res extensa), hervorheben. Das einzig Wirkliche und unbedingt Gegebene sei das Selbstbewusstsein. Nach Descartes sind wir auf unser eigenes Bewusstsein beschränkt und die Welt ist uns nur als Vorstellung gegeben. Er deckte also das Missverhältnis zwischen dem Subjektiven, oder dem Idealen, und dem Objektiven, oder Realen, auf. Diesen Gedanken äußerte er in dem radikalen Zweifel an der Existenz der Außenwelt. Die Gewissheit des „Ich bin“, die angenommene Existenz eines Zweiflers, bot für Descartes einen so festen Punkt, dass er damit die Welt wieder in die Angeln heben konnte. Die Kluft zwischen subjektiv Wahrgenommenem und objektiv Realem wusste Descartes nicht anders zu überbrücken, als einen Gott zu erfinden, der uns nicht betrügen würde. Dieser gewagte Versuch hängt sicher auch mit der Verfolgung von Gotteszweiflern durch die Inquisition zusammen, Das mechanistische Weltbild - 15 - die Descartes bei Galilei beobachtete. Überdies lässt er auf die Schwierigkeit, vielleicht Unlösbarkeit des Problems schließen. Jedenfalls zieht sich Descartes durch folgenden, „entscheidenden Denkfehler, wie einst Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf des Zweifels“ (Wittschier, 2004, 98; vgl. Schopenhauer, 1999a, 16): Er erfand einen vollkommenen Gott, den sich der Zweifler vorstellen kann. Und zu der Vollkommenheit Gottes gehört die Tatsache, dass es ihn wirklich gibt. Dieses „höchst vollkommene Wesen“ (Descartes, 1994, 60) kann aber nach Descartes’ Überzeugung keine Erfindung eines unvollkommenen Wesens sein - nämlich des Menschen. Nur der umgekehrte Vorgang ist für Descartes denkbar, womit bewiesen wäre, dass es Gott gibt. Wenn es ihn aber gibt, wird er uns bei der Wahrheitssuche immer dann tatkräftig unterstützen, wenn wir mit Hilfe des Verstandes etwas so klar und deutlich erkennen, wie ihn selbst (vgl. ebd., 78)9. Dieser ontologische Gottesbeweis erscheint scholastisch und wissenschaftlich kaum haltbar, weil er auf reiner Spekulation basiert. Die Instrumentalisierung des methodischen Zweifels führt Descartes zu der Vorannahme, dass nur das Denken gewiss sei und nur Gedachtes existiere. Somit ist die erste Bedeutung des Zweifels die Begründung des Rationalismus. Wahrheit sei nur auf das begründet, was der Verstand als richtig erkennt. „Das Denken ist’s, es allein kann von mir nicht getrennt werden. Ich bin, ich existiere, das ist gewiss“ (Descartes, 1994, 23). Dieser Einsicht folgend wird die reale, sinnliche Erfahrung nivelliert. Notwendig wahr ist für Descartes nur, dass er ein „denkendes Ding“ (res cogitans) sei. Dieser Gedanke findet sich allerdings auch schon bei 9 Den Beweis für die Existenz Gottes kann man jedoch als Zirkelschluss auffassen, da sich hierbei zwei Argumente wechselseitig bedingen: 1. Nur durch Gott wird sichergestellt, dass das, was wir klar und deutlich erfassen wahr ist. 2. Durch klares und deutliches Erfassen der Idee eines unendlichen Wesens wird bewiesen, dass Gott existiert (vgl. Descartes, 1994, 298/299). Obwohl der Vorwurf in dieser Schärfe nicht greifen kann, da Descartes Gott zuerst aus der Idee des unzweifelhaft bewiesenen Ichs ableitet, bleibt dennoch unklar wodurch die zweifelsfreie Existenz der ewigen Wahrheiten bewiesen ist (vgl. Röd, 1992, 70 sowie die Kritik der Gottesbeweise bei Kant, 1966). Das mechanistische Weltbild - 16 - Augustinus10. Das Argument des cogito und der methodische Zweifel können also nicht allein Ursache für das mechanistische Denken und den Beginn der neuzeitlichen Philosophie sein, wenn Augustinus dieses schon lange vorher gedacht hatte. Die Genese des mechanistischen Weltbildes scheint vielmehr aus Descartes’ Interpretation des cogito als res cogitans hervorzugehen. Die gesamte reale Welt wird nach dieser Auslegung nämlich als aus Dingen zusammengesetzt angenommen. Auch das Denken, das Bewusstsein, das Ich wird als Ding, als Objekt betrachtet. „Die Seele sei Reales eines gleichen Sinnes wie die körperliche Natur, das Thema der Naturwissenschaft“ (Hua VΙ, 216)11. Durch den einfachen Gedanken, dass er ein denkendes Ding sei, hat Descartes das Denken verdinglicht. Er macht das Denken, den Prozess des Denkens, den Gedankenfluss zu einem Ding, woraus dann das Bewusstsein, das Subjekt wird (vgl. Heidegger, 1950, 91f.). Durch das „Denken in Objekten“ (vgl. Weizsäcker, 1954, 30) wird das Denken schließlich selbst zum Objekt. Vielleicht ist das Objektdenken auch anders herum aus der „Verobjektivierung“ des Denkprozesses hervorgegangen. Merleau-Ponty hält es für das „Wesen des Bewusstseins (…) vor (Hervorheb. im Original) sich selbst seine eigenen Gedanken sein zu lassen wie Dinge“ (1966, 158). Von hier aus erscheint es unvermeidlich, dass die Aufwertung des Denkens mit einer Zunahme der Verdinglichung einhergehen muss. Dem „denkenden Ding“ (res cogitans), dem Geist, stellt Descartes das „ausgedehnte Ding“ (res extensa), die Natur, gegenüber. „Diese 10 „Wenn ich mich täusche, bin ich ja. Denn wer nicht ist, kann sich auch nicht täuschen; also bin ich, wenn ich mich täusche. Da ich demnach bin, wenn ich mich täusche, kann es keine Täuschung sein, dass ich bin; denn es steht fest, dass ich bin, wenn ich mich täusche. Da ich also, auch wenn ich mich täusche, sein müsste, um mich täuschen zu können, täusche ich mich darin gewiss nicht, da ich weiß: ich bin“ (Augustinus, 1955, 43). 11 Husserl sieht dieses cartesianische Vorurteil, dass die Seele und das Bewusstsein körperlich und deshalb physikalischen Messmethoden zugänglich seien, als Hauptursache für das Scheitern der Psychologie, die ja mit der Seele befasst ist, diese jedoch vollkommen falsch auffasse (vgl. Hua VΙ, 215-222). Daher seine Psychologismuskritik. Das mechanistische Weltbild - 17 - Unterscheidung bestimmt künftig ontologisch die von ‚Natur und Geist’ (Hervorheb. im Original)“ (Heidegger, 1993, 89). Seitdem wird die Welt als aufgeteilt in zwei verschiedene Seinsweisen betrachtet: Innen und Außen12. Die Sicherheit der Erkenntnis betreffe allerdings nur den Geist (res cogitans) des erkennenden Subjekts. Sein Gegenstück, der Körper (res extensa), das Objekt der Erkenntnis, dessen einziger Charakter die Ausdehnung sei, könne nach Descartes ebenso gut geträumt sein. Die sinnlich wahrgenommenen Informationen über die ausgedehnte Welt seien daher zu bezweifeln. Unzweifelhafte Gewissheit sei nur durch analytisches Denken, Einsicht einzig und allein durch den Verstand möglich (solius mentis inspectio) (vgl. Descartes, 1994, 22). Descartes zufolge sei der Verstand das probate Mittel, um zuverlässige Erkenntnis, gar letztgültige Wahrheit zu erlangen: „Denn wenn ich selbst träumte, so ist dennoch sicher alles wahr, was meinem Verstand einleuchtend ist.“ (ebd., 60). „Bloß der Verstand ist fähig, die Wahrheit zu erfassen.“ (Descartes, 1955, Regel 12). Vom Denken schließt er auf die Seele; diese sei Trägerin des Gedankens mithin gewiss. Dagegen seien die körperlichen Dinge zweifelhaft, ungewiss und dem Menschen, der wesentlich außerweltliches Subjekt sei, im Grunde wesensfremd. Deswegen spielen der Körper und seine sinnlichen Wahrnehmungsorgane in diesem Rationalismus eine untergeordnete Rolle (vgl. Franke, 2003, 21), da sie ja nur Täuschungen bzw. subjektive Projektionen hervorbringen, die zur Erkenntnis der Wirklichkeit ungeeignet seien. Der cartesianische Zweifel besagt, dass nichts dem Körper Vergleichbares zum Wesen unserer Seele gehöre. Zweifeln heißt nicht nur, die Seele vom Körper unterscheiden, sondern auch ihre wirkliche, substantielle Unterschiedenheit vom Körper anzuerkennen (vgl. Röd, 1995, 91). 12 Das klassische Körpermodell beinhaltet die „Vorstellung der seelischen Innenwelt in Gestalt der Unterstellung eines Bewusstseinskastens“ (Schmitz, 1980, 105). Das „gegenwärtige Spüren am eigenen Leibe“ habe in dieser „Innenwelthypothese“ keinen Platz (vgl. ebd., 106). Das mechanistische Weltbild - 18 - 1.1.3 Dualismus von Geist und Körper Descartes betrachtete den Körper (res extensa oder res corporea) und den Geist (res cogitans qua ego cogito) als zwei unterschiedliche und voneinander getrennte Substanzen, die über die Zirbeldrüse im Gehirn miteinander kommunizierten und über den Blutkreislauf auf mechanischem Wege Informationen in die Peripherie des Körpers transportieren, um diese Körperteile zu „beseelen“ (Metzler, 1989, 178). Daraus, dass der Geist unabhängig von allem Materiellen zu betrachten sei, folgt jedoch nicht zwingend, dass er auch „der Wahrheit der Sache nach“ (Röd, 1995, 95) vom Körper verschieden ist. Descartes glaubte jedoch dies annehmen zu dürfen. Den Beweis dafür, dass sich alles, was sich distinkt denken lässt, in Wirklichkeit verschieden ist, sieht er in der unzweifelhaften Existenz eines wahrhaften, nicht betrügenden Gottes. Allerdings könnte man ebenso gut annehmen, dass unsere Vorstellung von Körpern und diese Körper selbst Eins und Dasselbe seien. Spinoza fand beispielsweise, dass beide ein und dieselbe Substanz wären, nur von verschiedenen Seiten, also aus unterschiedlichen Perspektiven angesehen: „Einmal als substantia extensa, das andere als substantia cogitans aufgefasst“ (Zit. nach: Schopenhauer, 1999a, 17). Aufgrund dieses ungelösten Problems, der Kluft zwischen Idealem und Realem, welches Descartes als Erster aufzeigte, wurde eine Trennung von Körper und Geist in der Geistesgeschichte und der Wissenschaft postuliert. Ob Descartes’ philosophisches Denken wirklich auf die Formel „cogito ergo sum“, also den Cartesianismus, reduziert werden kann, oder ob es sich dabei schlicht um eine Fehlinterpretation handelt, ist in unserem Zusammenhang nicht von Belang, weil es gerade der Cartesianismus ist, der einen massiven Einfluss auf das neuzeitliche Denken genommen hat. Die cartesianische Spaltung von Geist und Materie wurde zur Grundlage der modernen Wissenschaften. Die von Descartes „als Faktum hingenommene Vereinigung der beiden grundverschiedenen Substanzen im Menschen ist die Achillesferse seiner Theorie“ (Metzler, 1989, 182). Das mechanistische Weltbild - 19 - Der hieraus abgeleitete Dualismus von Geist und Materie hat das philosophische Denken bis heute geprägt. „Die Spaltung (ist) in den drei Jahrhunderten, die auf Descartes gefolgt sind, sehr tief in das menschliche Denken eingedrungen, und es wird noch lange Zeit dauern, bis sie durch eine wirklich neue Auffassung vom Problem der Wirklichkeit verdrängt ist“ (Heisenberg, 1959, 61). Durch die Spaltung zwischen „Geist“ und „Körper“, die „wie ein Fluch auf der Philosophie lastet“ (Nietzsche, 1955, 306), ist es zu zwei getrennten Anschauungsformen gekommen: Dem Realismus und dem Idealismus, bzw. „Sensualismus und Positivismus“ (Weizsäcker, 1954, 95). Während der reine oder naive Realismus nur mit den Objekten der Außenwelt befasst ist und eine an sich seiende Materie annimmt (Locke)13, beschäftigt sich der Idealismus nur mit dem Inneren des Subjekts, insbesondere mit dem Denken und leugnet in seiner krassesten, solipsistischen Spielart sogar eine an sich existierende Materie (Berkeley). Durch die dualistische Auffassung von Körper und Seele „geriet die ursprüngliche Einheit in Vergessenheit, so dass man schließlich zu der Vorstellung kam, im Körperlichen und Seelischen zwei verschiedene Seinsbereiche vor sich zu haben“ (Uexküll, 1963, 127). Bruno Snell schreibt, dass „Wissenschaft überhaupt nur möglich ist, wenn zwischen Geist und Materie unterschieden wird“ (Zit. nach: Herbig, 1991, 260). Körper und Geist sind jedoch zwei Bestandteile eines Ganzen und können deshalb nicht einfach gespalten und isoliert betrachtet werden. Es scheint daher bemerkenswert, dass diese Spaltung über lange Zeit betrieben worden ist, so dass eine „harmonische Vereinigung von Körper und Geist bis heute nicht stattgefunden hat“ (Dijksterhuis, 1956, 482). Dieser Umstand führt dazu, dass „den Forschern, die stets das Ganze im Auge behalten, immer andere 13 Die unabhängig vom erkennenden Subjekt angenommene Materie entspricht dem materialistischen Glauben an eine absolute Objektivität. Deshalb schreibt Schopenhauer: „Der Materialismus ist die Philosophie des bei seiner Rechnung sich selbst vergessenden Subjekts“ (1966, 595). Das mechanistische Weltbild - 20 - gegenüber stehen, die den schon erklärten Teil mit dem Ganzen verwechseln“ (Weizsäcker, 1954, 20). Die Spaltung von Körper und Geist bezeichnet eine „undurchdringliche Scheidewand, die mitten durch die unbezweifelbare Einheit unseres Wesens geht, indem sie die Vorgänge unseres subjektiven Erlebens von dem objektiv und physiologisch erfassbaren Geschehen in unserem Körper trennt“ (Lorenz, 1973a, 225). Es ist dies „ein klaffender Hiatus in der Seinsstruktur“ (Hartmann, 1966, 137). Die Spaltung ist künstlich und in Gedanken vorgenommen worden und entspricht nicht dem Wesen der Natur. „Wenn erst einmal die Spaltung in Selbst und Ego, Innen und Außen, Gut und Böse geschieht, ist alles übrige ein infernalischer Tanz falscher Dualitäten“ (Laing, 1970, 67). Denn anscheinend kann man das Sein nicht in der Mitte spalten. Scharf unterscheiden sollte man überhaupt nicht zwischen Materie und Geist, sondern zwischen den Erkenntnisquellen der reinen Mechanik und den Erkenntnisquellen, die uns im Kontakt mit lebenden Wesen zur Verfügung stehen (vgl. Weizsäcker, 1954, 21f.). Die ontologische Verschiedenartigkeit der realen Gegenstände bringt - im Sinne Nicolai Hartmanns - eine erkenntnistheoretische Verschiedenartigkeit mit sich. „Daher sind zwei Komponenten des Erkennens zu erörtern; Verstand und Sinnlichkeit“ (Jaspers, 1985, 30). 1.1.4 Descartes’ Wirkung Zusammengefasst wirkt das cartesianische Weltbild durch die isolierte Betrachtung der zwei Seinsbereiche Körper und Geist. Innerhalb dieser Aufteilung dominiert der Verstand; die sinnliche Erfahrung hingegen wird abgewertet. Hinzu kommt eine dogmatische Grundhaltung. 1.1.4.1 Freiheit als Befreiung ins Leere Mit seinem analytischen Urteil „cogito, ergo sum“ hat Descartes eine größere Wahrheit ausdrücken wollen, als es ein analytisches Urteil kann. Er meinte eigentlich, dass nur Das mechanistische Weltbild - 21 - „dem Subjektiven, dem Selbstbewusstsein unmittelbare Gewissheit zukomme, dem Objektiven, also allem anderen, hingegen als dem durch jenes erst Vermittelten bloß mittelbare; daher dieses, weil aus zweiter Hand, als problematisch zu betrachten sei“ (Schopenhauer, 1966, 614). Der Wert dieser Einsicht ist durch die gängige Interpretation der cartesianischen Lehre nicht angemessen vermittelt worden. Man machte die Sinnlichkeit zur „Hauptquelle der Immoralität, während gerade die Sinne, da sie im Verein mit den apriorischen Funktionen des Intellekts die Anschauung hervorbringen, die lautere und unschuldige Quelle aller unserer Erkenntnisse sind, von welcher alles Denken seinen Gehalt erst erborgt“ (ebd., 855). Es erscheint wenig sinnvoll, das Denken als edelste Erkenntnisform zu isolieren: „Besagtermaßen machte man also beim Prozess des Erkennens das allerletzte Produkt desselben, das abstrakte Denken, zum Ersten und Ursprünglichen, griff demnach die Sache am verkehrten Ende an“ (ebd.). Auch Descartes selbst vermochte von seinem genialen Einfall aus kaum zu weiteren wahrheitsgemäßen Erkenntnissen vorzudringen. Denn seine Philosophie beschränkt sich auf das subjektive Denken und analogen mechanischen Abläufen; sie kapriziert sich auf diese Anschauung: „Für die Cartesianer existiert nur das Denken“ (Chardin, 1965, 166). Dabei wird die Erfahrung ausgeblendet, obwohl sie der eigentliche Bezugspunkt für jeden Gedanken ist. Wozu nützt das Denken noch, wenn es sich nicht auf die alltägliche, sinnliche und höchst reale Erfahrung bezieht? Dem forschenden Geist des Subjekts kommt die zu erforschende subjektive Erfahrung abhanden. Er denkt im leeren Raum, so dass es zu einer Übermacht des Verstandes kommt, in die „die von ihm selbst entworfene mechanistische Weltanschauung den lebendigen Körper und sogar die Seele in ihrer Abhängigkeit von dem Körper hineinzieht. In Descartes’ Philosophie geht das Sein selbst verloren, obwohl sie in ihrem Anfang das Denken mit aller Kraft gerade auf das Sein lenkt. Nicht im Ursprung seiner Philosophie, Das mechanistische Weltbild - 22 - sondern im Ergebnis ist der Verlust handgreiflich.“ (Jaspers, 1966, 79). Der ontologische Bezug zum Subjekt tritt hinter funktionalen Überlegungen zurück. Der Erfahrungsverlust des Menschen wird zu einem individuellen Sinnverlust. Dadurch, dass Descartes den denkenden Menschen auch ohne Körper schon für ganz hält, „vereinzelt (Hervorheb. im Original) er eine wesentliche und unerlässliche Möglichkeit des Menschen – die Möglichkeit eines reinen, von allem absehenden Denkens, aber er zeigt darin nur den unbestimmten und unerfüllten Raum einer leeren Freiheit“ (ebd., 80). Indem das reine Denken die sinnliche Anschauung überwindet, verliert es auch die Erfahrung. Es entfremdet sich der Natur und führt in eine „Welt ohne Menschen“ (Sartre, 1991, 402). Vor die wirkliche sachnahe Forschung schiebt sich die ausgedachte, unwirkliche Konstruktion. Die Vernunft, die sich isoliert und die sich löst von aller Erfahrung und allem Erfüllenden wird seinsleer. Descartes ist nicht bei der Erforschung der Sachen. Das reine Denken hat mit der Wirklichkeit des Lebens, mit der Erfahrung, mit dem Sein am Ende kaum noch etwas zu tun (vgl. Jaspers, 1966, 82f.). Durch diesen Grundsatz entfernt sich Descartes’ mechanistisches Denken von dem sinnlichen Menschen und seiner Realität. Dieses Problem erscheint heute im Schulunterricht, wenn Schülerleistungen auf ihre messbaren Merkmale (im Sport - motorische Fertigkeiten) reduziert werden, weil die quantifizierbar und also verallgemeinerbar sind. Ein hier verwandter allgemeingültiger Standard ist abstrakt und nirgends in der individuellen Erfahrung auffindbar. Er ist Emanat rationaler Deduktion. Nicht der Gehalt eines Ganzen, nicht der volle Mensch und die erfüllte Welt sind Gegenstand oder Ursprung von Descartes Philosophie, sondern sein abstraktes Denken ist wie „ein Bohrer, der eindringt mit aller Vorsicht, doch schließlich unbekümmert um das, was er anrichtet. Diese Radikalität ist Das mechanistische Weltbild - 23 - für den Nachahmer leicht nachzuvollziehen. Bei seiner entschiedensten Gewissheit durch unabhängiges Denken spielt das andere, das Sinnliche, die Geschichte keine Rolle, konnte beim Denken selbst vergessen werden. Durch dieses Absehenkönnen entsteht ein Freiheitsgefühl, ein Zauber sogar der grenzenlosen Möglichkeiten“ (Jaspers, 1966, 95). Dieser „Zauber der grenzenlosen Möglichkeiten“ (ebd.) kompensiert die „Entzauberung der Welt“ (Weber) durch die Wissenschaften, mit der er zusammengeht, und begründet den Fortschrittsoptimismus der modernen okzidentalen Welt. Auf diesem Grund scheint der von Fromm eingebrachte Begriff der „Fortschrittsreligion“ durchaus treffend, zumal das durch die rationalen Wissenschaften verursachte spirituelle Vakuum offenbar irgendwie ausgefüllt werden will. Descartes’ isolierte Vernunft mündet in einer leeren Freiheit, die zwar Unabhängigkeit verspricht, doch im Grunde weltfremd ist, da sie sich ausschließlich mit abstraktem Denken befasst. Die entsprechende naturwissenschaftliche Methode, die den Erfolg der Wissenschaften und die Entwicklung der Technologie ermöglicht hat, wird aus dieser Haltung heraus als Universalmethode angesehen. Es ist Descartes’ großes Verdienst, den Einfluss des Subjektiven auf das Erkannte klar benannt zu haben; es ist der Fehler insbesondere seiner Epigonen, diese Subjektivität nur als eskamotierten rationalen Objektivismus wirksam werden zu lassen, indem das Subjekt als extramundan Denkendes und nicht als weltlich Erfahrendes angenommen wird. 1.1.4.2 Dogmatik Die cartesianische Philosophie weist überdies einen dogmatischen Zug auf. Descartes verkennt nämlich allem Anschein nach den partikularen und relativen Charakter der naturwissenschaftlichen Methoden, indem er eine absolute Universalmethode etabliert. Von daher verkörpert seine Philosophie insgesamt die historische Wirkung des Einseitigen. Von ihm geht das Anregende des Radikalen aus, das keinen Widerspruch gelten Das mechanistische Weltbild - 24 - lässt. In dieser Hinsicht ist eine Parallele zum kirchlichen Dogmatismus augenscheinlich. Mit seinem vermeintlich geschlossenen System der Wissenschaft vertritt Descartes das entgegengesetzte Prinzip Wilhelm von Humboldts: „Alles beruht darauf, das Princip zu erhalten, die Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten, und unablässig sie als solche zu suchen“ (zur Gründung der Berliner Universität, 1810). Glaube und Wissen, Offenbarung und Vernunft stehen im cartesianischen Denken in ständigem Widerspruch zueinander. Die Folge ist „eine Lähmung der menschlichen Offenheit“ (Jaspers, 1966, 84) sowie der Seele und eine dogmatische Stimmung14. Auf dem Gebiet der Erkenntnis erscheint heute immer noch eine rationalistische Grundhaltung als wissenschaftlich notwendig bindend. Es bleibt die Frage, ob dieses positivistische Wissenschaftsverständnis das einzig denkbare ist. Das Dogma der Verstandesherrschaft, seiner rationalen Gütemaßstäbe und Methoden, scheint sich unbemerkt verselbständigt und ausgebreitet zu haben: Nur Zahlen gelten als Beweis. Dieses Paradigma „diffamiert alternative Denkweisen, die dem herrschenden Universum der Sprache widerstreiten“ (Marcuse, 1964, 187). Neu erscheint dieses Phänomen nicht. Weltanschauungssysteme und „ethische Pakete“ wurden auch im Altertum sowie im katholizistischen Mittelalter mit dogmatischem Gestus feilgeboten. Die Propaganda des Rationalismus wurde indes nicht auf Kreuzzügen verkündet, sondern auf subtile Weise und mit dem 14 Alternativ könnte man den Glaubensaspekt einfach aus dem Cartesianismus tilgen, um zu einer reinen widerspruchsfreien Vernunftphilosophie zu gelangen (was auch später häufig getan wurde, denn in dem cartesianischen Dualismus war von Gott immer weniger die Rede). Die Mechanisierung des Weltbildes führte mit unwiderstehlicher Konsequenz zur Auffassung Gottes als eines „Ingenieurs im Ruhestand“, und von da zu seiner völligen Ausschaltung war es nur noch ein Schritt (vgl. Dijksterhuis, 1956, 549). Allerdings würde dem felsenfesten Ausgangspunkt und der absoluten Rechtfertigung seines Gedankengebäudes mit der Entfernung des vollkommenen Gottes endgültig das tragende Fundament entzogen. Jedenfalls konnten sich Descartes sowohl vernunftbesessene Freigeister als auch orthodoxe Kirchengläubige nähern, ohne ernstlich angefeindet zu werden (vgl. Jaspers, 1966, 88f.). Das mechanistische Weltbild - 25 - Versprechen der Sicherstellung des bequemen Überlebens und der unmittelbar einsichtigen, einfachen Logik in die Geisteshaltung der industriellen Gesellschaften eingepflanzt. Nach Jaspers herrscht Descartes’ Philosophie durch die Macht des Denkens und die „Haltung einer unmerklich in seine Gefolgschaft zwingende Gebärde“ (1966, 93). Andererseits erscheint die konsequente Abstrahierung des cartesianischen Rationalismus als dogmatische Weltanschauung gar nicht geeignet, weil sie ohne sinnlichen, anschaulichen Gehalt keiner versteht. Den Darwinismus oder das überaus anschauliche heliozentrische Weltbild musste die Kirche noch bekämpfen, die moderne Genetik und die Relativitätstheorie braucht sie als Konkurrenten auf dem weltanschaulichen Gebiet nicht zu fürchten, da diese in ihrer abstrakten Unanschaulichkeit so kompliziert sind, dass kaum ein Einzelner sie noch überblicken, geschweige denn begreifen kann. Die jeweiligen Spezialisten sind aufgrund Zeitmangels häufig nicht in der Lage, in anderen Disziplinen vollständig informiert zu bleiben. Das Abstraktwerden der Welt, das durch Descartes’ Rationalismus befördert wird, könnte also umgekehrt eine Stabilisierung der Religion bewirken, die als einzige noch Begreifliches verspricht. Dies scheint durch die Hinwendung zahlreicher westlicher Menschen zu östlichen Bewegungsformen wie etwa Yoga und Tai-Chi belegt zu werden. Durch die gründliche Tilgung von Sinnlichkeit zugunsten einer durchgreifenden Intellektualisierung ist die Religion als Weltanschauungssystem erst abgelöst und heute restauriert worden. Die Sehnsucht nach und der Rückfall in Religion erscheinen als Reaktion auf eine zunehmende Sinnleere, auf das spirituelle Vakuum der intellektualisierten Welt. 1.1.4.3 Der Erfolg des mechanistischen Paradigmas Die enorme Wirkung und Durchsetzungskraft der cartesianischen Philosophie speist sich anscheinend aus mindestens zwei Quellen: Erstens: Descartes wollte von einigen als evident angenommenen Einsichten ausgehend alle zu seiner Zeit bekannten Naturerscheinungen Das mechanistische Weltbild - 26 - erklären. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg, welcher dem Cartesianismus zuteil wurde, liegt demnach in der Einheit des Weltbildes, zu dem sein Denken Naturwissenschaften, Religion und Philosophie verband. Vor dem historischen Hintergrund wird dies umso bedeutsamer, da eine solche Verbindung durch die erwiesene Unhaltbarkeit der aristotelischen Physik und die Erstarrung der scholastischen Philosophie verloren gegangen war. Es muss auf systematisierende Gemüter15 beruhigend wirken, diesen verlorenen Zusammenhang auf einer rationalen Grundlage wiederhergestellt zu sehen (vgl. Dijksterhuis, 1956, 378f.). Hierdurch wird die Welt scheinbar berechenbar. Das spätestens seit Galilei wachsende Interesse für Mathematik begünstigte ein philosophisches System, das von logischen Überlegungen ausging, um in dieser Weise zu einer Wahrheit zu gelangen, die ebenso sicher war, wie die mathematische Schlussfolgerung (vgl. Heisenberg, 1959, 59f.). Die innere Logik der Mathematik ist im Gegensatz zu der rätselhaften inneren Komplexität der Wirklichkeit überaus verführerisch. Vielleicht ist die Mathematik der Natur deswegen derart sorglos übergestülpt worden. Descartes’ rationale Gewissheit, die durch mechanisch-mathematische Gesetze unzweifelhaft untermauert sei, scheint ideal, um die Theologie zu ersetzen, von der die Naturwissenschaften zunehmend befreit wurden. Die im radikalen Zweifel zerstörte Welt wird von einem in diesem Zweifel gefundenen archimedischen Punkt aus rekonstruiert, wobei der angeblich bewiesene Gott nun die Wahrheit der Erkenntnisse über diese Welt garantieren soll16. 15 Es ist in der Art gebundener Geister, irgendeine Erklärung keiner vorzuziehen; dabei ist man genügsam. Hohe Kultur verlangt, manche Dinge ruhig stehen zu lassen (Nietzsche). 16 Es sei an dieser Stelle nur am Rande darauf verwiesen, dass die logischanalytische Denkform ihren Ursprung auch im Patriarchat zu haben scheint, weil die männliche Affinität zum machtbewussten Fordern und (Be)herrschen die insbesondere auch das Abendland geprägt hat - schon seit Jahrtausenden einen fruchtbaren Nährboden für die Entwicklung rationaler Erklärungssysteme bietet (vgl. dazu besonders: Capra, 1983, 29, 36ff.; Fromm, 2001, 139f.; Hölder, 1967, 76; Das mechanistische Weltbild - 27 - Zweitens ist der Aufstieg der westlichen Hochkultur in erster Linie mit ihrer mathematischen und also technologischen Entwicklung verknüpft. Huntington weist darauf hin, dass die „unmittelbare Quelle der westlichen Expansion eine technologische war“ (1993, 67). Die „militärische Revolution“ (ebd.) sei das Ergebnis der Mechanisierung und gleichzeitig die Ursache für die gewalttätige Ausdehnung Europas17. Der Erfolg der Mechanisierung und die daraus resultierende Erfindung von effektivem Kriegsgerät leisteten einer enormen okzidentalen Machtzunahme Vorschub. Diese „Dominanz des Westens“ (ebd., 118) äußert sich vor allem in der gelungenen Vernichtung und Unterjochung fast aller anderen Hochkulturen. Dieser Siegeszug bestätigte die Überlegenheit des mechanistischen Paradigmas stetig und nachhaltig. 1.1.5 Das Objektivitätspostulat Grundsätzlich wird Objektivität durch eine Trennung von Subjekt und Objekt, also durch dualistisches Denken, anzusteuern versucht. Die Unterscheidung des Subjekts vom Objekt steht im Dienste der objektiven Beschreibung der Natur, also auch des Subjekts selbst. Indem sich das Subjekt von den zu beschreibenden Objekten distanziert, wird es selbst zum zu beschreibenden Objekt. Die durch Descartes begründete moderne Wissenschaft beruht auf einem „reinen, für immer unbeweisbaren Objektivitätspostulat“ (Monod, 1973, 30). Die Wissenschaft ist mit dem Postulat der Objektivität gleichzusetzen. Es hat ihre außerordentliche Entwicklung seit dreihundert Jahren angeführt und es ist heute unmöglich, sich seiner zu entledigen, ohne den Bereich der Wissenschaft zu verlassen. „Man postulierte, dass unsere Erfahrung, bereits von Physik und Biologie eingeschlossen, sich endlich gänzlich in objektives Wissen auflösen müsse, wenn das System der Wissenschaften sich vollendete“ (Merleau-Ponty, 1966, 120). Thiersch, 1993, 39 sowie E. Fromms Analyse von Sophokles „Ödipus“ - Trilogie. In: Fromm, 1981, 131ff. Zu Letzterem auch: Beckers, 1995, 113-122). 17 „Imperialismus ist reine (okzidentale) Zivilisation“ (Spengler, 1923, 48). Das mechanistische Weltbild - 28 - Objektivierung, als Ideal der Wissenschaften, mündete in die Errichtung wertneutraler Gütemaßstäbe. Objektivität selbst wird als Wert aufgefasst und Quantifizierung ist das Mittel zu seiner Realisierung. Auch Bewertungen und Urteile erfolgen dadurch unter quantitativen Gesichtspunkten. Folglich werden nicht-quantitativ erfassbare Merkmale wissenschaftlich kaum beachtet; sie fallen durch diese systemimmanente Logik dem nicht-wissenschaftlichen Bereich zu, der als Mystik desavouiert ist18. Gleichwohl basiert die ethisch neutral konstruierte Ordnung der Wissenschaft und der Gesellschaft heute auf dem Maßstab der Funktionstüchtigkeit, der sich an dem Ziel des Profits orientiert, wodurch die Verflechtung von Rationalismus und Kapitalismus sichtbar wird. Das Ziel von Objektivität ist in der heutigen Zeit meist profitorientiertes Funktionieren. Maximierung von Leistung erscheint als ein solches Ziel, wobei Leistung nicht als Selbstverwirklichung des Organismus aufgefasst wird, sondern als effektive Funktion im Hinblick auf externe quantitative Vorgaben. Waldenfels spricht in diesem Zusammenhang von einem „real existierenden Funktionalismus“ (In: Bäumer, 1993, 27). Dabei ist die „menschliche Existenz (…) auf die Dimensionen des Leistens und Funktionierens reduziert, wobei der Eindruck erweckt wird, dass zu deren Beurteilung objektive Kriterien zur Verfügung stehen“ (Beckers, 1986, 52). Qualitäten, insbesondere des Menschen, werden ins Spektrum des Irrealen verlagert oder in Quantitäten übersetzt, weil mit ihnen sonst nicht wissenschaftlich weitergerechnet werden kann. Sie zählen nicht als Ergebnis. 18 Dieses Wissenschaftsverständnis wird in der modernen Philosophie nur noch von Popper und Eccles vertreten (vgl. Gissel, 2007, 9). Das mechanistische Weltbild - 29 - Diese Denkhaltung kann auf den Cartesianismus zurückgeführt werden. Denn nach dieser Auffassung können alle Geheimnisse der Welt mit dem Schlüssel der Mathematik gelüftet werden. „He had made of nature a machine and nothing but a machine, purposes and spiritual significance has alike been banished. He had reached the notion of seeking an explanation of all things in the world in purely mechanical terms. Give me extension and motion, and I will construct the universe” (Randall, 1976, 241f.). Mathematische Zahlen und Messungen finden nicht nur in der Technik Anwendung, sondern auch bei der Erforschung von Sport, Musik und lebenden Organismen. „Life becomes a mere matter of physical and chemical changes, all animals a mere automata, even the body of man is a purely physical machine“(ebd., 242). Die Unterscheidung zwischen zwei getrennten und voneinander unabhängigen Bereichen - dem des Geistes und dem der Materie - führte zu einer distanzierten Objektivierung selbst lebendiger Teile der “ausgedehnten Welt”. In dem Bestreben, perfektes Wissen über die Natur zu erlangen, dehnte Descartes seine mechanistische Anschauung der Materie auf lebende Organismen aus. Auch Pflanzen und Tiere waren Maschinen für ihn. „Das Tier, dem keinerlei Innen zugestanden wird, ist ein bloßer Automat“ (Chardin, 1965, 166). „The bird is a machine working through mathematical laws“(Randall, 1976, 236). Descartes verglich Tiere mit einer „Uhr, die aus Rädchen und Sprungfedern zusammengesetzt ist“, und transferierte diesen Vergleich auf den Menschen: „Für mich ist der menschliche Körper eine Maschine. In Gedanken vergleiche ich einen kranken Menschen und eine schlecht gemachte Uhr mit meiner Idee von einem gesunden Menschen und einer gut gemachten Uhr“ (In: Rod-Lewis. Zit. nach: Capra, 1983, 61). Nach Descartes werden Tiere als seelenlose Maschinen, der menschliche Körper als Maschine, als „Uhrwerk“ betrachtet. Die Menschen seien zwar von einer vernunftbegabten Seele bewohnt, doch der Körper des Das mechanistische Weltbild - 30 - Menschen sei ebenfalls nur eine animalische Maschine, vergleichbar mit Kleists Marionette, deren Pendel tot sind, solange der Maschinist sie nicht beseelt (vgl. Kleist, 1956, 9)19. Tiere werden zu einer Art biochemischem Komplex entwürdigt; noch heute gilt dem Gesetzgeber Tierquälerei als „Sachbeschädigung“. „Eine positivistische Beschreibung des Tieres in solchen (mechanischen) Begriffen eine Selbstentwürdigung durch Entwürdigung des Seienden selbst“ (Laing, 1970, 53). Deshalb sei „Naturwissenschaftlichkeit der Irrtum, Personen in Dinge zu verwandeln“ (ebd., 55). Positivistische Erkenntnistheorie lässt nur Zahlen, Fakten und damit beschreibbare Objekte gelten. Aus epistemologischer Hinsicht erscheinen Objektivierungen jedoch generell problematisch, weil auch Verobjektiviertes immer subjektiver Erfahrung entstammt. Der Objektivitätsbegriff leugnet eo ipso das menschliche Subjekt und seine konkrete, situationsabhängige und individuelle Erfahrung, was zu einem Widerspruch führt, denn „dieser Begriff lief letzten Endes auf den einer ‚leeren Welt’ oder einer ‚Welt ohne Menschen’ hinaus, d.h. auf einen Widerspruch, denn eine Welt gibt es nur dank dem Menschenwesen. So zerstört sich der Objektivitätsbegriff (…) selbst, sobald man ihn völlig durchführt“ (Sartre, 1991, 402/403). Trotzdem erscheint das Streben nach Objektivität als elementares Merkmal der okzidentalen Kultur. Es ist tief in das Denken der wissenschaftlichen Gesellschaft eingedrungen und bestimmt die Haltung der Gesellschaftsmitglieder grundlegend. 19 Schopenhauer verweist auf die moralische Tragweite dieser Vorstellung: „Die vermeinte Rechtlosigkeit der Thiere, der Wahn, daß unser Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie es in der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Thiere keine Pflichten gebe, ist geradezu eine empörende Rohheit und Barbarei des Occidents (...). In der Philosophie beruht sie auf der aller Evidenz zum Trotz angenommenen gänzlichen Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier, welche bekanntlich am entschiedensten und grellsten von C a r t e s i u s ausgesprochen ward, als eine nothwendige Konsequenz seiner Irrthümer.“ (Züricher Ausgabe, Werke in zehn Bänden, Band VI [detebe 140/VI], S. 278). Das mechanistische Weltbild 1.1.6 - 31 - Die Mechanisierung des Denkens Der Mensch ist eine perfekte Maschine, lobte auf dem Höhepunkt der Mechanisierung auch Julien Offroy de La Mettrie (Man a Machine 1748). Ein materialistischer Gedanke, der trotz der Behauptung, Menschen seien die besseren Maschinen, so viel Wut weckte, dass sein Urheber aus seinem Heimatland fliehen musste. Die Verfolgung des Denkers konnte die Umwälzung des Menschenbildes allerdings nicht stoppen. Was seinerzeit eine heidnische Neuigkeit gewesen war, entwickelte sich mit dem Eindringen der Technik in den Alltag zur normalen Erfahrung. Das menschliche Bewusstsein wird stets von den kulturell bevorzugten Denkarten und Verhaltensweisen geformt, hält diese schließlich für die einzig vernünftigen und für selbstverständlich. Die Bewusstseinsstrukturen, die Art und Weise, wie das Bewusstsein arbeitet, verändern sich im Lauf der Kulturgeschichte und spiegeln das jeweils aktuelle Paradigma der Epoche wider. In der heutigen Zeit ist das Bewusstsein von mechanischer Denkform. „Was den modernen Geist charakterisiert, das ist die logischmathematische Formalisierung“ (Lyotard, 1993, 53). An der Mechanik entwickelte Denkweisen setzen sich in nicht-mechanischen Gebieten, wo sie unangemessen sind, dennoch fort. Die Maßstäbe, die nur das verstandesmäßig Erfassbare als real bewerten, haben den Geist der in diese Vorgänge verwickelten Menschen nicht unbeeinflusst gelassen. Diese Einstellung hat sich von der Naturwissenschaft, in der sie sich entwickelt hat, über die Grenzen jener hinaus bis in andere, bis in zwischenmenschliche Bereiche hinein verbreitet. Der genuine Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften ist auf alle „vormals philosophischen oder nicht-naturwissenschaftlichen Gegenstandsbereiche ausgedehnt“ (Janich, 2000, 70). Selbst der Mensch wird bisweilen aus dieser Perspektive betrachtet. Das mechanistische Weltbild - 32 - Mechanische Prinzipien, wie das des größtmöglichen Effektes bei sparsamsten Mitteln, finden breiteste Anwendung. Der Gütemaßstab der Optimierung ist heute nicht nur in mechanischen Konstruktionen wirkmächtig, sondern ebenfalls in alltäglichen Situationen, die mit lebenden Menschen zusammenhängen. „Instrumentelles Verhalten wird damit zur Normalität des Umgangs“ (Heitmeyer, 2005)20. Das kann man bspw. in der rationalisierten Arbeitsteilung und dem Hochleistungssport erkennen, wo zweckrationale Prinzipien dominieren, deren Einhaltung und Umsetzung am pekuniären Gewinn abzulesen sind. Das Objektivitätspostulat führt anscheinend zu einer Versachlichung des lebenden Menschen. "Wenn alle Psychologie seit der des Protagoras den Menschen erhöhte durch den Gedanken, er sei das Maß aller Dinge, so hat sie damit von Anbeginn zugleich ihn zum Objekt gemacht, zum Material der Analyse, und ihn selber, einmal unter die Dinge eingereiht, deren Nichtigkeit überantwortet" (Adorno, 1969, 248). Folgt man Adorno, so scheint der Mensch sich selbst auf seine Maschinendimension zu reduzieren. Er wird als solche betrachtet und seine Bewusstseinsform gleicht sich maschinellen Strukturen an. Die mechanistische Betrachtung des Körpers als Maschine kommt heute in der alltäglichen Sprache deutlich zum Ausdruck: Seit es mechanische Geräte gibt, läuft alles wie geschmiert, wenn wir auch bisweilen fürchten müssen durchzudrehen. Die Erfindung von Hebeln und Getrieben erlaubt, schneller zu schalten. Wie die Dampfmaschine arbeiten wir unter Hochdruck und fragen uns, ob einer noch ganz dicht sei. Seit der Elektrifizierung stehen wir unter Strom, fiebern in Hochspannung und hoffen, dass uns nicht eine Sicherung durchbrennt und wir eine Kurzschlusshandlung begehen. Diese Beispiele aus dem normalen Sprachgebrauch sind Indiz für eine Umformung der Denkstrukturen. 20 Heitmeyers Studie zufolge führt die „Ökonomisierung des Alltags und des Denkens“ dazu, die „Sicherung des Zusammenlebens (…) unter Effizienzgesichtspunkten zu organisieren“. Das mechanistische Weltbild - 33 - Nicht die Denkinhalte, sondern die Denkart spiegelt durch ihre Sprache die Mechanisierung der Welt. Das Selbst- und Weltverständnis des Menschen hat sich in seiner Sprache niedergeschlagen. In verwandten Begriffen ist generell ein jeweils ganz bestimmter Weltbezug schon immer enthalten. In den Wörtern selbst schlummern bereits Assoziationen und Verdikte, die meist unbewusst hingenommen und daher mitgetragen werden. Anhand der Sprache wird offensichtlich, dass die Strukturen des Denkens durch die Mechanisierung verändert werden. Der Glaube an die „Maschinentheorie des Lebens“ führt zu einer „Mechanisierung des Bewusstseins“ (Jaspers, 1966, 103), das durch die Naturwissenschaften und die Technik entstanden ist, aber dann, durch deren enormen Erfolg in „der gesellschaftlichen Wirklichkeit verankert, gleichsam die freie Selbstmacht erlangte und jetzt als die progressive Bewusstseinsform dieses Zeitalters mit der Unwiderstehlichkeit eines Verhängnisses sich ausbreitet“ (Gehlen, 1957, 30). Dieser moderne Geist ist nicht durch mechanische Inhalte charakterisiert, sondern durch seine Form sich zu mathematisieren und den Nutzen formaler Denkmittel optimal auszuschöpfen. Statt Herr der möglichen Mechanismen zu sein, wird das Bewusstsein mechanisiert (vgl. Jaspers, 1966, 103f.; Gehlen, 1957, 45f.). Diese Denkart mag in technischen Kontexten ausgesprochen hilfreich sein, in pädagogischen Zusammenhängen, die Menschen betreffen, ist sie es nicht. Von daher ist das Gesagte insbesondere auch bei sportpädagogischen Theoriebildungsprozessen stets zu berücksichtigen, worauf später zurückzukommen ist. Die mechanisierten Denkstrukturen sind in der Tat infolge der ungebremsten Objektivierung aufgetreten. Die Objektivierung des Menschen. „und die durch sie begründete Wissenschaft hat in drei Jahrhunderten ihren Platz in der Gesellschaft erobert (…) und Das mechanistische Weltbild - 34 - ist als neue und ausschließliche Quelle der Wahrheit bestimmt worden“ (Monod, 1973, 208). Sie ist in alle Lebens- und Wissenschaftsbereiche vorgedrungen und hat beträchtliche Fortschritte im menschlichen Können und Wissen ermöglicht. Andererseits reinigt sie den Menschen offensichtlich von allen qualitativen Merkmalen, die der Objektivität im Wege stehen. Von daher schreibt Marcuse: „Wir sind gereinigte Subjekte des wissenschaftlichen Messens“ (Marcuse, 1964, 199). Das objektivierende Paradigma, führt zur Errichtung entsprechender Gütemaßstäbe, die sich am „Uhrwerkprinzip“ orientieren. Die Gütemaßstäbe dieses Paradigmas sind in den Denk- und Sprachformen der heutigen Menschen auszumachen. Sie sind in die kollektiven Bewusstseinsstrukturen eingelassen. Durch eine Verabsolutierung des Verstandes und die gegenwärtige Tendenz zur Objektivierung ist das Bewusstsein tendenziell mechanisiert. Neuzeitliches wissenschaftliches Denken wird von der Annahme getragen, die Welt sei eine Anhäufung von Einzelteilen, die nur durch das Band der Kausalität verbunden seien. Solches Denken ist auf Objekte kapriziert und findet seine Grenze im Verständnis von Lebendigem. Deshalb ist die Mechanisierung des Denkens Ursache für einen Abbau des Sinnlichen. Das mechanistische Weltbild - 35 - 1.2 Auswirkungen der Mechanisierung im Sport Zur Erschließung und zum Verständnis menschlicher Selbstbewegung werden allerdings sinnliche Erkenntnisvermögen benötigt. Für die Ausbildung der menschlichen Leiblichkeit und also der Sinnlichkeit war im Kanon der Wissenschaften die Leibeserziehung zuständig. Dieser Name wurde nach der „Realistischen Wende“ in den 1960er Jahren in „Sportwissenschaft“ verwandelt. Nicht zufällig ist darin das Wort „Leib“ verschwunden. Die Leibeserziehung ist nämlich vor allem wegen ihrer Forschungsschwäche von der Sportwissenschaft abgelöst worden (vgl. Prohl, 2006, 210). Die resultierte aus dem Umstand, den lebendigen Leib nicht objektiv fassen zu können, wie es das moderne Wissenschaftsverständnis jedoch einfordert. Um das Schicksal der Leibeserziehung nicht zu teilen und um die Akzeptanz der Universitäten zu gewinnen, übernimmt naturwissenschaftliche die Methoden Sportwissenschaft und sozial- Erkenntnisse, um und ein hinreichendes Maß an „Wissenschaftlichkeit“ nachweisen zu können (vgl., ebd.). Im Verlauf dieser Bemühungen hält der objektivierende Zeitgeist Einzug in die Wissenschaft der menschlichen Leiblichkeit. Sport ist daher keineswegs von der Mechanisierung des gegenwärtigen Zeitgeistes ausgeschlossen. Mengden befindet bereits 1958, er habe vielmehr „typische Attribute der Technokratie“ (18) angenommen. Die Rationalisierung des Bewegungsverhaltens im modernen Sport mit Quantifizierung, Leistungssteigerung und Regelbildung erscheint als kausale Auswirkung der industriellen Arbeitswelt (vgl. Eichberg, 1986, 203). Dieser Wirkungszusammenhang ist heute kaum noch zu übersehen, zumal Profisport offensichtlich von Profitdenken durchsetzt ist. „Wie jede Zeit ihre artgemäße Kultur hat, so hat jede Kultur auch die ihr wesensgleiche, von ihr geformte Leibesübung, ihr wesensgemäß nach Form und Zielsetzung“ (Wildt, 1957, 4). Das mechanistische Weltbild - 36 - Demnach ist Sport Ausdruck seiner Zeit; heute der Zeit der Industriegesellschaft. Sport ist „Ausdruck der Industriekultur und ihrer Lebensstrukturen“ (Kuchler, 1969, 170). Deren Zielsetzungen sind: „Höher, schneller, stärker“ (Eichberg, 1986, 185f.). Noch härter bringt Jünger (1959) diese These zum Ausdruck: „Die Sports (…) sind das Kennzeichen einer maßlos gewordenen, mechanisierten Arbeitswelt, die auch das Spiel umformt und unter mechanische Bedingungen stellt“ (168). Der Sport ist nicht „Begleitphänomen, sondern Spiegel der Gesellschaft“ (Beckers, 1993, 16). In ihm spiegeln sich die westlichen Gütemaßstäbe der Rationalisierung und Objektivierung. Deswegen kann der moderne Sport auf Ausprägungen dieser Rationalität befragt werden, um sie beispielhaft zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang sind besonders zwei Aspekte abendländischer Rationalität aufschlussreich: Der moderne Leistungsgedanke sowie die Instrumentalisierung des Leibes. Das mechanistische Weltbild - 37 - 1.2.1 Der okzidentale Leistungsbegriff Eichberg (1986) hat durch die Untersuchung fremder Kulturen und ihrer Bewegungsspiele nachweisen können, dass jede Kultur ihre eigenen gültigen Gütemaßstäbe hervorbringt, denen entsprechend Bewegungsmuster geformt werden. Umgekehrt kann man sportlichen Erscheinungsformen Aufschlüsse über die aktuelle Kultur entnehmen. „Spiel und Sport erweisen sich als Indikatoren gesellschaftlichen Verhaltens und gesellschaftlicher Veränderungen“ (ebd., 266). Arbeitsund Sozialnormen sowie „Konfigurationen auf dem Spielfeld“ zeigen „parallele Tendenzen“ (ebd.). Leistung bezieht sich auf dasjenige Handeln, das sich „an den spezifischen Gütemaßstäben einer Gesellschaft orientiert“ (Eichberg, 1986, 10). In verschiedenen Kulturen herrschen unterschiedliche Gütemaßstäbe und damit andere Definitionen von Leistung. In Indonesien existiert beispielsweise eine „Relationsgesellschaft“ (ebd., 15). Dort gelten Gütemaßstäbe, die weniger auf quantifizierbare Produkte als auf qualitative Prozesse abzielen. Im indonesischen Sepak takrawSpiel beispielsweise (vgl. Jost, 1991, 137f.), oder auch beim Basketballspiel der Navajo-Indianer (vgl. Allison, 1983, 116f.) ist die Leistungsbewertung prozessorientiert, das heißt der Vollzug des Spiels steht im Vordergrund und ist als Zweck legitimiert. Das genaue Zuspiel und die Integration der Mitspieler werden honoriert und gewürdigt. Leistung bezeichnet in den Kulturkreisen der Indianer und Indonesier Interaktions- und Relationsleistung. Siegen erscheint dort nicht als Zwang. Im Gegenteil würde es einem Dakota- Zuni- oder Hopi-Indianer grausam vorkommen, sich über das Missgeschick Anderer zu freuen. „Wettbewerb als Erfolgsgewinn aus dem Versagen anderer ist eine Form der Folter, die wettbewerbsfreien Kulturen fremd ist“ (Laing, 1970, 62). Leistung wird in Abhängigkeit von dem Kulturbereich, in dem sie ausgeführt wird, bewertet. Sie ist nur unter den bestehenden Bedingungen als solche gültig. Sie erfährt ihre Definition durch Das mechanistische Weltbild - 38 - kulturspezifische Gütemaßstäbe. Dementsprechend ist auch der moderne Leistungsbegriff des Westens, dessen Folgen nun nachgezeichnet werden, keineswegs allgemeingültig, sondern relativ. Im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts verändert sich der Leistungsbegriff. Während die adelig-ständischen Exerzitien des 17. und 18. Jahrhunderts ohne zahlenmäßige Leistungsangaben auskamen und an Normen orientiert waren, taucht mit der industriellen Gesellschaft die Quantifizierung von Leistung auf. Normenmaße wurden durch Zahlenmaße ersetzt (vgl. Eichberg, 1986, 17). In der Folge werden u.a. Bewegungsmechanismen standardisiert, um Leistung vergleichbar zu machen. Dadurch wird „Gerechtigkeit und Chancengleichheit, aber auch Wettbewerb und Konkurrenz“ (Beckers, 1993, 20) garantiert. Diese Definition von Leistung entspringt den kulturspezifischen Maßstäben des Okzidents. Andere Arten von Leistung, wie z.B. Hilfsbereitschaft, Kooperation und Rücksichtnahme seien nach Eichberg im westlichen Sport „weitestgehend abwesend“ (1986, 266). In Abgrenzung zu anderen Kulturen ist daher im Westen eine außergewöhnlich starke Produktorientierung feststellbar. Denn hier ist das Ergebnis des Spiels von überragender Bedeutung, weil dadurch Leistung „objektiv“ messbar gemacht werden kann, um vergleichbar zu sein. Rekorde avancieren zum „Idol menschlichen Fortschritts“ (Kuchler, 1969, 104)21. Die Ziele der Fortschrittsgesellschaft - Maximierung, Quantifizierung und Optimierung - sind allesamt dem „Fortschritt durch Rationalität“ verpflichtet und werden als Maßstäbe in Geltung gebracht. „In der westlichen Kultur liefert die Messbarkeit (Quantifizierung) der Leistung den Gütemaßstab“ (Beckers, 1993, 20). Wie diese Maßstäbe den Sport affizieren, ist nun zu zeigen. 21 Diese sportliche Rekordorientierung spiegelt die gesellschaftlich-politische Fortschrittsreligion der Neuzeit. Von hier aus wird auch verständlich, dass der Systemvergleich des kalten Krieges im Medium Sport ausgetragen wurde. Das mechanistische Weltbild - 39 - Der Leistungsbegriff, der auf Fortschritt durch Konkurrenz zielt, wirkt sich nicht nur positiv aus. Gerade im Kulturbereich Sport sind ebenso bedenkliche Folgen auszumachen. Beckers et al. (1986) haben darauf hingewiesen, dass durch starke Reglementierung die persönliche Entwicklung stagnieren kann, weil Freiheitsgrade eingeschränkt sind. Dies beinhaltet pädagogische und gesundheitliche Konsequenzen. Folgt man Huizinga, so geht dem Sport durch stets zunehmende Systematisierung und Disziplinierung etwas von seinem reinen Spielgehalt verloren, der durch das intentionale Subjekt der Bewegung getragen ist. Er wird zur „unfruchtbaren Funktion, in der der alte Spielfaktor zum großen Teile abgestorben ist. Der Sport ist allzu ernst geworden, die Spielstimmung ist mehr oder weniger aus ihm gewichen“ (1956, 188). Der messbare Leistungsvergleich als Übertreibung des sportlichen Wettkampfs münde in „unfruchtbarem Können, das die geistigen Fähigkeiten nur einseitig schärft und die Seele nicht bereichert“ (Aristoteles. Zit. nach: ebd., 189). Folglich droht die Entwicklung des Individuums im modernen Sport kaum noch gefördert zu werden. Gleichzeitig spielt die Gemeinsamkeit, das Soziale, im Sport eine herausragende Rolle. Für sehr viele Menschen gerade im Breitensport ist dies ein zentrales Motiv. Schon beim gemeinsamen Lauf erfüllt die gegenseitige Steigerung der Kräfte einen Sinn. Im Wettlauf des heutigen Hochleistungssports wird allerdings nicht mehr gegen einen Mitbewerber gelaufen, sondern gegen die Uhr. Es geht dabei um Rekorde, um maximierte Leistung. Die gemeinsame Aufgabe wird bei dieser Form der Konkurrenz nicht mehr erfahren. Zur Lippe bemerkt lakonisch: „Die Bewegung ist zur Strecke gebracht“ (1991, 52). Das Wesentliche der sportlichen Bewegung, das gemeinsame Erleben der einander anspornenden Anstrengung, das die Beziehungen der Menschen zueinander und zu der Sache, um die es geht, vertieft, kommt bei gemessenen Rekorden abhanden. Selbst beim Tennismatch, wo doch eigentlich zwei Rivalen direkt gegeneinander spielen und so miteinander spielen müssen, ist die Motivation stark von Preisgeldmengen, Das mechanistische Weltbild Investitionen in - 40 - Ausrüstung, Training und Kondition sowie Übertragungsrechten und -bedingungen von außen festgelegt. Der Maßstab der Maximierung zielt nicht auf Sinn und Freude von Bewegung oder auf die Kräfte, die aus der gemeinsamen Betätigung entspringen, sondern bloß auf Quantitatives wie finanzieller Erfolg oder Marketingtauglichkeit. Das Ergebnis wird nach Preisen und Mengenmaßen bewertet, nicht nach dem Sinn für das Ganze (vgl. Lippe, 1991, 56). Dadurch werde verhindert, dass Sport „sich zu einer kulturschöpferischen Betätigung emporheben kann“ (Huizinga, 1956, 188). Neben „seelischen“ scheinen folglich auch soziale Kompetenzen des Subjekts durch Objektivierung unzureichend angesteuert zu werden. Bewegung kann nämlich ebenso durch ästhetische Zwecke, vielleicht auch nur durch Freude am Spiel und am sozialen Zusammensein motiviert sein. Wenn Bewegungserfahrungen nicht über den mechanischen Zweck hinauskommen, verzichtet der Sportler auf diese möglichen Sinngehalte der Bewegungshandlungen, wodurch sich das bildende Potenzial des Sports bestenfalls in der Ausbildung motorischer Fertigkeiten erschöpft. Tatsächlich orientiert sich der heutige Sportunterricht zuweilen an idealen Technikvorbildern von Topsportlern, die natürlich für Schüler nicht erreichbar sind. Können, Sollen und Wollen klaffen dadurch auseinander, was Unzufriedenheit Vorschub leistet. „Aus einem unbedingten Gültigkeitsanspruch externer Sollwerte entsteht eine Sinnverlagerung, durch die der Sinn von Bewegungen primär an die Erfüllung soziokultureller Werte gebunden und zum Maß individueller Zufriedenheit wird“ (Beckers, 1986, 126). Durch diese eigentümliche Außenorientierung scheint die freie und individuelle Entfaltung des Sportlers inhibiert. Übertriebenes Konkurrenzdenken im Sport kann darüber hinaus zu gesundheitlichen Konsequenzen führen. Die Konkurrenzhaltung ist im Hochleistungssport und insbesondere bei den modernen olympischen Spielen sehr auffällig. Lenk schreibt 1964: „Unter den Olympiakämpfern Das mechanistische Weltbild - 41 - selbst ist diese Haltung der Steigerung und des Willens zur höchsten Leistung voll ausgeprägt“ (282)22. Durch die Fixierung auf den „Binärcode Sieg-Niederlage“ (Bette, 1989), entsteht die Gefahr der Übertreibung des Wettkampfgedankens, der für Sportler sogar gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen kann. Man denke in diesem Zusammenhang an die Protagonisten des Turnens, des Eiskunstlaufs sowie des Radsports, von denen manche bereits in frühen Entwicklungsphasen zur Leistungsmaximierung bewogen werden und später bisweilen psychische und physische Schädigungen aufweisen. Doping ist an dieser Stelle ein gutes Beispiel für die Verschränkung von drei Auswirkungen der Objektivierung: Die Auffassung des Leibes als Werkzeug, die gesundheitliche Tragweite dieses Habitus und seine gesellschaftliche Zementierung. Doping wird trotz seiner moralischen Bedenklichkeit theoretisch unentbehrlich für jeden Spitzensportler. Denn der aktuelle Rekord könnte von einem gedopten Sportler aufgestellt worden sein und ist im natürlichen Zustand nicht zu überbieten. Der ambitionierte Sportler muss also zu solchen Hilfsmitteln greifen, sollte ein Rekordversuch unternommen werden. Aus aktuellen Vorkommnissen im Radsport wird ganz deutlich, dass flächendeckende Kontrollen und die Sanktionierung der verantwortlichen Funktionäre nicht erwünscht sind. Die einschlägige Berichterstattung ist mittlerweile verstummt. Sportler werden als Täter hingestellt, obwohl sie der Eigendynamik des Systems zum Opfer fallen23. Hierdurch soll nur knapp angedeutet werden, dass objektivierende Gütemaßstäbe ein überpersonales Motiv vorgeben, dem sich der Sportler nicht entziehen kann, ohne sein berufliches Fortkommen zu gefährden. Aus dieser Hinsicht erscheint die freie und selbständige Entfaltung des Sportlers auf sublime Weise behindert. Sein fremdbestimmtes Handeln 22 Die Olympiade sei „eine Feier zu Ehren des Siegers, des Stärksten, des Durchsetzungsfähigsten, wobei das Publikum bereit ist, die schmutzige Mischung aus Geschäft und Publizität zu übersehen, die die heutige Version der griechischen olympischen Spiele kennzeichnet“ (Fromm, 2001, 138). 23 Vgl. zur Dopingproblematik: Caysa, 2003, 212 ff. Das mechanistische Weltbild - 42 - sorgt für das Fortbestehen eines Kreislaufs, dessen Funktionieren durch die Gesetze der leistungsorientierten Kultur gewährleistet ist, die im Sport ihr Abbild findet. Die Gesetze der „produktorientierten Kultur“ (Slusher, 1967, 210) lassen nur das eindeutige und zählbare Ergebnis zu. Der Sport soll berechenbar sein. Alternative Sichtweisen werden vom Kollektiv nur selten gebilligt und finden daher wenig Anerkennung. Geht man den Gründen für die genannten erzieherischen und gesundheitlichen Probleme der Objektivierung nach, so wird augenfällig, dass das Denken den Körper offenbar „verdinglicht“, um über ihn zu verfügen wie über einen Gegenstand der Umwelt24. 1.2.2 Die Transformation des Leibes zum Körper Plessner (1975) hat völlig zu recht die Unterscheidung von „Leib sein“ und „Körper haben“ eingeführt. Von außen gesehen erscheint der Leib zweifellos als Objekt, das in der Raumzeit ausgedehnt ist. Mein eigener Leib hingegen tut sich mir durch meine Empfindungen kund. Diese zwei Seinsarten des Leibes sind beide real. Durch die Trennung von Körper und Geist werden allerdings nicht beide „Substanzen“ als gleichwertig betrachtet. Vielmehr steht die Dominanz des Verstandes, der als höchste Erkenntnisquelle eingestuft wird, einem bloß mechanischen Leib gegenüber. Der Leib wird zum Körper, zum Ding unter anderen ausgedehnten Dingen25. Der berühmte Ausspruch „Cogito ergo sum“ lässt erkennen, wie sehr Descartes das Denken gegenüber dem Körper bevorzugt. Er reduziert das Subjekt auf sein Denken. Dieser Subjektbegriff führte zu der objektiven 24 „Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine Hand seines Willens“ (Nietzsche, 1930, 35). Nun zwingt anscheinend der eiserne Griff des Geistes den Leib in seine Gewalt. 25 Ein Beispiel für die Tendenz zur Verdinglichung des lebendigen Körpers ist das Phänomen des „Bodybuilding“. Bereits der Bezeichnung darf man entnehmen, dass der Athlet seinem Körper gegenüber distanziert ist und ihn so zu einem gegenständlichen Ding macht: Man kann an dem Körper (body) bauen (building) – wie an einem leblosen Objekt (vgl. Beckers, 1988, 162f.). Auch die Wettkämpfe der Bodybuilder verweisen auf diese Verdinglichung, denn sie entbehren jeglicher Bewegung, so dass das posierend ausgestellte Muskelfleisch gleichsam leblos, tot erscheint. Der Körper hat dabei „keine andere Funktion, als sich selbst zu produzieren“ (ebd., 172, vgl. Caysa, 2003, 227). Das mechanistische Weltbild - 43 - Betrachtung des eigenen Körpers als Maschine. Der Leib und die Sinneswahrnehmungen werden vor dem Hintergrund seiner Vorannahme, dass nur das Denken gewiss sei, als „Träume“ (Descartes, 1994, 21) betrachtet, die nicht dem wahren Wesen der Dinge entsprechen, sondern lediglich subjektive Reaktionen seien. Da sinnliche Empfindungen nicht exakt genug durch Begriffe wiedergegeben werden können, wie bspw. in Form einer mathematischen Gleichung, handele es sich bei den beschreibenden Begriffen wie warm, spröde, sauer usw. um Bewusstseinsinhalte und -projektionen des wahrnehmenden Individuums. Deshalb seien diese Informationen über die Außenwelt in hohem Maße subjektiv und können daher auch keine Wahrheit beanspruchen. Intentionalität und zielgerichtetes Handeln des Menschen werden damit ebenfalls dem Zweifel preisgegeben. Diese Annahme, dass praktisch nur quantitative Merkmale eines Körpers, nur Ausdehnung, Figur, Lage und Bewegung, apriori in diesem Körper gegeben sind, führt zu einer überaus objektivierenden Sicht der Welt, die nur die (durch den Geist) objektivierbaren Dinge anerkennt. Die Abwertung des Körpers und seines Erkenntnisvermögens ist hierbei ostentativ. In dieser Hinsicht hat Platons Definition von dem Körper „als Kerker der Seele“ durch Descartes und seine Epigonen eine Renaissance erfahren. Descartes res cogitans bezeichnet den linear-analytisch arbeitenden Verstand, der nur die drei Ausdehnungen kennt und daher hervorragend dazu geeignet ist, mechanische Aspekte der Welt zu begreifen. Wenn dieser Verstand aber die absolute Erkenntnisfunktion innehat, welche epistemologische Bedeutung kommt dann dem Leib zu? Wird er bei dieser Haltung nicht auf seine reine Arbeits- und Werkzeugfunktion beschränkt? Descartes prägte die Metapher des „Körpers als Uhrwerk“. Der Körper fungiere nämlich als von dem Geist unabhängige Maschine nach mechanischen Gesetzen, die mathematisch erklärt werden können. Das mechanistische Weltbild - 44 - „Wir sehen künstliche Brunnen, Mühlen und ähnliche Maschinen, die, obwohl nur von Menschenhand gemacht, doch fähig sind, sich von selbst auf verschiedene Weise zu bewegen. Ich sehe keinerlei Unterschied zwischen Maschinen, die von Handwerkern hergestellt wurden, und den Körpern, die allein die Natur zusammengesetzt hat“ (Descartes. Zit. nach: Russell, 1970, 192). Descartes ging davon aus, dass alle materiellen Dinge aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt sind. Folglich könne man durch analytische Reduktion der Dinge auf ihre kleinsten Bestandteile zum Verständnis der Welt sowie des menschlichen Körpers gelangen. Er anerkennt zwischen natürlichen Körpern und von Menschen konstruierten Maschinen und Kunstwerken nur einen größenmäßigen Unterschied. Zwischen einem wachsenden Baum und einem laufenden Uhrwerk sei kein Unterschied. Tiere seien seelenlose Maschinen (vgl. Descartes, 1992, 126). Da nun aber der Körper des Tieres und folgerichtig ebenfalls der des Menschen als mechanische Maschine aufgefasst wurden, musste, um „den vollständigen Parallelismus zwischen Erfahrungen des Geistes und des Körpers zu verstehen, auch der Geist völlig bestimmt sein durch Gesetze, die denen der Physik und Chemie entsprachen“ (Heisenberg, 1959, 60). Diese ganze Beschreibung hat durchaus etwas Künstliches und zeigt die schweren Mängel der cartesianischen Spaltung. Andererseits war diese Spaltung in der Naturwissenschaft für drei Jahrhunderte außerordentlich erfolgreich (vgl. ebd.). Durch die cartesianische Philosophie wird der gelebte Leib zum Körper, der durch den Verstand dirigiert wird. Diese Einstellung ist heute immer noch wirksam, obwohl kaum noch jemand den Dualismus ausdrücklich befürwortet26. Um die aktuelle Auffassung von Leiblichkeit näher zu erörtern, ist es hilfreich, zunächst eine analytische Unterteilung sowie eine Ausdifferenzierung des Körperbegriffes vorzunehmen. Eine grobe 26 Goethe schrieb dazu folgendes Gedicht: Wer will was Lebendiges beschreiben, versucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand. Fehlt – Leider! – nur das geistige Band. Das mechanistische Weltbild - 45 - Aufteilung in „pathischen Leib“ und „Arbeitsleib“ schlägt Buytendijk (1956) vor. Er weist damit auf die sinnliche und funktionale Dimension des Körpers hin. Die zwei Dimensionen begründen zwei Betrachtungsweisen auf den menschlichen Körper, die allerdings in permanenter Interrelation zueinander stehen. Sie seien keinesfalls als isoliert voneinander zu begreifen. Der Mensch erfahre „im Vollzug seines Daseins (…) seinen Leib sowohl als ein Ding - als ein kompliziert konstruiertes, mehr oder weniger vorstellbares, verfügbares System von Organen und zugleich als das leibliche Ich, d.i. der unverstellbare, gelebte Zugang zur Welt die er selbst erschließt“ (Buytendijk, 1956, 37). Hier kann man auch die reale Manifestation der antiken Ideen von Mythos und Logos wieder entdecken. Es ist jedoch ausschlaggebend, dass Buytendijk, im Gegensatz zu Descartes, nicht das Maschinenmodell des Menschen im Vordergrund sieht, sondern das Wesen des Menschen jenseits der funktionalen Dimension verortet. Auch Merleau-Ponty schreibt in der Phänomenologie der Wahrnehmung (1966), dass der Leib nicht mit einem physikalischen Gegenstand, sondern eher mit einem Kunstwerk zu vergleichen sei. Aus objektivistischer Sicht erscheint der Leib jedoch primär als „Werkzeugleib“, „Arbeitsleib“ (Buytendijk, 1956, 37), „instrumenteller Leib“ (Grupe, 1976, 7), oder „Energiekörper“ (Preuss-Lausitz, 1987, 300). In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, den Unterschied zu beachten, den die deutsche Sprache zwischen „Körper“ und „Leib“ macht. De Chardin bemerkt, es sei eine „schlechte anthropozentrische Betrachtungsweise, wenn der Geist sich durch die Zerstückelung der Natur nicht ihre unermesslichen Weiten bewusst macht. Daher auch die bei Männern der Wissenschaft noch fühlbare Abneigung, den Menschen als Studienobjekt anders zu nehmen denn als Körper“ (1965, 22). Der Terminus anachronistisch, „Leib“ gilt im weil er zur heutigen Sprachgebrauch alltäglichen Benennung als des Menschenkörpers kaum noch verwandt wird. Der Leibbegriff stammt Das mechanistische Weltbild - 46 - anscheinend aus einer Zeit, in der die Mechanisierung der Welt noch nicht von so durchgreifender Wirkung war wie heute. Der Begriff „Körper“ wird hingegen ebenso für leblose Dinge verwandt. So wird bspw. ein abgetrenntes Glied gleichviel als Körper bezeichnet wie ein Stein, oder der Menschenleib. Eigentlich sei der „Leib“ der beseelte Körper des Menschen oder Tieres, wobei man unter „Körper“ die uns umgebenden sinnlich wahrnehmbaren Dinge zu verstehen habe (vgl. Hoffmeister, 1955, 359/360). Die Unterscheidung von subjektiv erlebtem Leib und objektiv feststellbarem Körper spiegelt die cartesianische Auffassung, die im Grunde nur den äußerlich erfahrbaren Körper anerkennt. Die nahezu ausschließliche Verwendung des Begriffes „Körper“ im alltäglichen Sprachgebrauch gibt Aufschluss über den Vorzug von mechanischen, leblosen gegenüber lebendigen Aspekten der Welt. Die Sprache des gegenwärtigen Zeitalters enthüllt die mechanistische Perspektive auf den Menschen. Der menschliche Leib wurde in Abhängigkeit von aktuellen kulturellen Umständen stets verschiedenartig betrachtet und bewertet (vgl. Beckers, 1997, 206f.). Die Zähmung und Domestizierung des Körpers setzt während der Entstehung der höfischen Gesellschaften ein (vgl. Elias, 1991, Band І, 153). Der vormals im Zentrum stehende Körper wird zugunsten von zunehmenden Rationalisierungsprozessen zurückgedrängt (vgl. Klinge, 1998, 42). Die gelungene Körperdistanzierung zeigt sich in „courtoisen“ (Elias, 1991, Band І, 153) Verhaltensweisen und vorschriften wie geziertem Sprechen und Sitzen, verhaltenem Atmen, gesittetem Essen und Trinken, Benutzen von Schnupftüchern etc. (vgl. ebd.). Der Körper wird diszipliniert, sinnliche Bedürfnisse und Affekte werden zugunsten des Werkzeug- und Symbolkörpers verdrängt. Das mechanistische Weltbild - 47 - „Die den Körper priesen, die Turner und Geländespieler, hatten seit je zum Töten die nächste Affinität, wie die Naturliebhaber zur Jagd. Sie sehen den Körper als beweglichen Mechanismus, die Teile in ihren Gelenken, das Fleisch als Polsterung des Skeletts. Sie gehen mit dem Körper um, hantieren mit seinen Gliedern, als wären sie schon abgetrennt. Sie wiederholen in blinder Wut am lebendigen Objekt, was sie nicht mehr ungeschehen machen können: Die Spaltung des Lebens in Geist und seinen Gegenstand“ (Adorno, 1969, 249). Mit diesen Worten deutet Adorno die Konsequenzen einer uralten Haltung an, die den lebendig sich bewegenden Menschen zum toten Arbeitsmaterial macht. Diese Haltung geht bis auf das alte Testament zurück, in dem der Befehl enthalten ist, sich die Erde untertan zu machen. Mit dem Ackerbau und der Viehzucht beginnt die Unterdrückung der Natur (vgl. Kamper, 1976, 247). Die Einstellung gegenüber dem Körper als einem zu beherrschenden Stück Natur, beinhaltet die Vorstellung des Körpers und der Sinnlichkeit als etwas Niederem. Der Leib wird vom Selbst getrennt, so dass eine umfassende, stabile und höchst differenzierte „Selbstzwangapparatur“ (Elias, 1991, Band ІІ, 378) entstehen kann, in der der gesamte Mensch unter ständiger Geisteskontrolle gehalten wird. Im zivilisierten Körper entstehen neue Sinnes-Hierarchien, so z.B. die „Dominanz des Auges“ (Herzog, 1985, 279)27 und neue Zeit-, bzw. Beschleunigungsmechanismen. Die rationale Kontrolle der Welt, die seit Bacon und Descartes wissenschaftliche Forschung bestimmt, umfasst den „Prozess der Zivilisierung und Disziplinierung des Körpers (…) seiner auf den Augenblick gerichteten triebhaften Regungen“ (Beckers, 1997, 206) und erscheint als subversives Herrschaftsprogramm, das unkontrollierbare Phänomene wie den Leib mit seinen unwillkürlichen Prozessen nivellieren und möglichst ausschalten will. 27 Das Gesicht, insbesondere das Sehen, sei der Sinn des Verstandes (vgl. Schopenhauer, 1966, 610f.). „Demzufolge lebt der denkende Geist mit dem Auge in ewigem Frieden, mit dem Ohr in ewigem Krieg“ (ebd.). Das mechanistische Weltbild - 48 - In der heutigen Welt der Technik und Marktwirtschaft, die sämtlich rationalen Prinzipien folgt, um funktionieren zu können, ist es notwendig, den pathischen Leib auszuschalten, damit dem reibungslosen Ablauf rationaler Planung keine Emotionen und Affekte im Wege stehen. Der Mensch muss lernen, seinen seit der Geburt affektdurchdrungenen Leib zu einem Instrument umzubauen, das je nach den Anforderungen der Situation von einer Kontrollzentrale aus auf jeweils zweckmäßige Affektdurchlässigkeit eingestellt werden kann (vgl. Rumpf, 1981, 44). Allerdings zeichnet sich der Mensch wesentlich durch Assoziationen, Gefühle wie Hoffnung, Angst, Schwermut, Heiterkeit und Erinnerung aus. Sollten sich solche natürlichen Empfindungen durch spontane Eindrücke oder Begebenheiten in Form von Lachen, Stöhnen, Zittern, oder Schreien Ausdruck verschaffen, so ist dies in der zivilisierten Gesellschaft häufig mit existentiellen Problemen verknüpft. Denn solche Reaktionen fügen sich nicht den Forderungen nach sachlich-rationalen Reaktionen auf Menschen, Dinge, Räumlichkeiten oder Situationen. Gefühlsmäßiges Verhalten kann also in unserer Zivilisation schnell peinlich sein, oder gar den Weg ins soziale Abseits ebnen. Besonders die leiblichen Phänomene der Ausscheidung und Sexualität gelten immer noch als obszön und vulgär (vgl. Bornhöft, 1997, 19-24)28. Anscheinend gilt es auch heute noch, Aspekte des Körpers zu finden und zu kultivieren, die den gesellschaftlich geforderten Formen von Arbeit, Bewegung und von sozialen Beziehungen keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen. Wenn der Leib zu einem handhabbaren, kontrollierbaren und in seinen Reaktionen planbaren Apparat würde, wäre das Ziel der möglichst weiten Unabhängigkeit von pathischen Erfahrungsprozessen erreicht. Ein so gezüchtigter Leib soll die objektiven Informationen aus der Welt herausfiltern, um effizient zu 28 Wahrscheinlich sind Frauen wegen ihrer leiblichen Phänomene der Menstruation, Schwangerschaft und Geburt als „des Teufels“ Jahrhunderte lang unterdrückt und in den Hexenprozessen sogar verfolgt worden. Leiblichkeit gilt offenbar als „das Dämonische in ästhetischer Indifferenz“ (Kierkegaard, 1998, 98). Das mechanistische Weltbild - 49 - reagieren. Die subjektiven, qualitativen Informationen aus der Umwelt, wie Ermunterung, Verwirrung, Genießen, müssen weitestgehend unterdrückt werden, weil sie sich der Beherrschung und Vorhersagbarkeit entziehen. „Dieses falsche Bewusstsein hat sich im herrschenden, technischen Apparat verkörpert, der es wiederum reproduziert“ (Marcuse, 1964, 161). Übermäßiges Denken Mehrdimensionalität widerspricht des jedoch Menschen, der natürlichen weswegen es Zivilisationskrankheiten verursacht. In dem zur Disposition stehenden Fragenkreis ist allerdings wichtiger, dass die Kaprizierung des Subjekts auf Denken eine Degeneration der leiblichen Sinne evoziert. Wahrnehmungsfähigkeiten liegen brach und verkümmern, was auf die erkenntnistheoretische Sprengkraft der Umwandlung des Leibes zum Körper hinweist. Natürlich findet sich diese Entwicklung auch und gerade in den Erziehungsanstalten wieder29. Die technische Rationalisierung der heutigen Zivilisation übergeht die Sinnlichkeit. Rumpf hat zu dieser Problematik erkenntnisreiche Arbeiten vorgelegt: Der sinnliche Leib werde verdrängt. Die Lehranstalten verkommen zu „Schulen der Körperlosigkeit“ (Rumpf, 1980, 452ff.), wo die Körper als „Prothese für Hören, Sehen, Lesen, Schreiben“ (Rumpf, 1983b, 335) im Unterricht benutzt und damit stillgelegt und störungsfrei werden. Hier werde der Körper als Werkzeug und Instrument zur Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen eingeübt und perfektioniert (vgl. ebd.). Sportunterricht wird in der Tat häufig auf diese Aufgabe reduziert. Und die schulische 29 Aktuell sind Rationalisierungstendenzen an folgenden Phänomenen zu beobachten: 1. Die Schulzeit wird verkürzt, um Absolventen schneller dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Die persönliche Entwicklung der Schüler tritt in den Schatten von ökonomischem Nutzen. „Nebenfächer“ werden voraussichtlich weiter an Bedeutung verlieren. 2. Studienreformen verkürzen Studiengänge auf Kosten der umfassenden Bildung der Studenten. 3. Studiengänge werden verschult, um Beschleunigung und Kontrolle der Ausbildung zu verschärfen. Das mechanistische Weltbild - 50 - Ausbildung ist ohnehin fast ausschließlich von kognitiven Fächern dominiert, was auf die Verabsolutierung der Außenperspektive hinweist, die Bildung notwendig auf Wissen, Können und „Intelligenz“ reduziert, auch um sie vermessen und vergleichen zu können. In unserer vergeistigten Gesellschaft gibt es kaum noch Bereiche, in denen der Leib eine ernst genommene Rolle jenseits seiner Werkzeugfunktion spielt und demzufolge zu freier Entfaltung gelangen kann. Selbst im Sportunterricht, der offenbar als eine Art Kompensation für die Kinder der vergeistigenden Erziehung angesehen wird, steht Funktionalität insbesondere für Lehrer der „alten Schule“ noch heute im Vordergrund. Es geht häufig um die Beherrschung von vorgegebenen sportlichen Fertigkeiten, die entsprechend geschlossen vermittelt werden. Hier werden Bewegungsstandards „affektneutral und im Hinblick auf einen vorausgesetzten Zweck optimiert“ (Klein, 1984, 10). Daher wird der Leib im Sportunterricht meistens den genannten „Beherrschungsprinzipien“ (Klinge, 1998, 44) untergeordnet: „Straff, fertigkeitenorientiert, allzeit sprung- und startbereit, asketisch und bedürfnislos“ (Rumpf, 1983b, 345). Nicht der „Menschenkörper“ (ebd., 1983a, 10) mit all seinen Dimensionen steht im Mittelpunkt, sondern der ausdifferenzierte, entsinnlichte „Bewegungsapparat“ (ebd.) als „Werkzeug- oder Sportkörper“ (ebd., 1983b, 333). Hier ist jene Dimension des Leibes beschrieben, die durch eine mechanistische Perspektive konstituiert wird. Das mechanistische Weltbild - 51 - 1.2.3 Das Beispiel Bildungsstandards Diese Sichtweise spielt auch in der aktuellen Debatte um Bildungsstandards eine gewichtige Rolle, da standardisierte Fähigkeiten oder Kompetenzen ja immer von außen, also aus „objektiver“ Perspektive festgelegt werden, die dem rationalen Denken entspringt und dem Ziel der Berechenbarkeit, bzw. Überprüfbarkeit dient. Die Standardisierungsdebatte wird zumeist aus der Perspektive der dritten Person geführt, wodurch das Subjekt der eigentlichen Erfahrung übersehen wird30. In der Folge wird ein Schüler nicht mehr in seiner ganzen Persönlichkeit beurteilt, sondern als Lernender, der Englisch, Mathematik oder Geschichte, an einem Standard gemessen, besser oder schlechter beherrscht. Grundlage der Beurteilung sind auch nicht Zuneigung und Verständnis für die individuellen Besonderheiten, sondern vereinbarte Kompetenzen, die von außen abprüfbar sind31. Die moderne Neigung zum Messen kommt anscheinend daher, dass man von außen auf Menschen schaut. Aus diesem Blickwinkel konstituiert man den Menschen schon vor aller empirischen Forschung als Objekt unter Objekten. Dies kann exemplarisch an der aktuellen Debatte um Bildungsstandards veranschaulicht werden. Bildungstheoretiker denken seit PISA besonders intensiv darüber nach, wie man das deutsche Schulwesen verbessern kann. Sie tun das insbesondere deshalb, weil zwischen Dezember 2001 und Juli 2002 im SPIEGEL, im FOCUS und in der ZEIT insgesamt 317 Artikel publiziert wurden, die sich auf PISA beziehen (vgl. Tillmann, 2004, 479). Der öffentlich inszenierte Druck auf die für die kolportierte Bildungsmisere zuständigen Kultusminister hat jene dazu veranlasst, 30 Im Übrigen dringt im Verlauf dieser Debatte offenbar bildungspolitisches Denken in bildungstheoretische Fragestellungen ein, insofern überwiegend öffentlichkeitswirksame Steuerungselemente des KMK-Handlungskatalogs umgesetzt werden (vgl. Tillmann, 2006, 33). 31 Die Vorstellung eines Körpers, den man hat und über den man wie über ein Werkzeug verfügen kann, scheint zudem begünstigt durch das kapitalistische Wirtschaftssystem, in dem alles zur Ware, zum Gegenstand wird (vgl. Fromm, 2001, 121, Eppler, 2008, 23). Der Körper und seine Bildung sind aber keine Waren, die käuflich und messbar wären, sondern der Leib ist lebendig und Bildung ist ein Menschenrecht (vgl. ebd.). Das mechanistische Weltbild - 52 - einen Handlungskatalog vorzulegen, der den Ergebnissen von PISA schnell und wirksam Rechnung tragen soll (vgl. Tillmann, 2006, 24). Dieser Katalog umfasst sieben „Handlungsfelder“ 32, in denen zum Teil langfristige und weitsichtige Maßnahmen vorgeschlagen sind. Im Rahmen des „Umdenkens von der Input- zur Output-Steuerung“ (Kurz, 2006, 3) wird allerdings die Finanzierung und Umsetzung von „InputInstrumenten“, wie „Lehrplänen, Unterrichtsstunden, Lehrkräften und deren Qualifikation, die Ausstattung der Schulen und die Lehrmittel“ (ebd.) zugunsten der Förderung von Output-Werkzeugen, also Ergebnis messenden Verfahren, zurückgestellt. Die Förderung von Schulqualität wird folgerichtig auf Handlungsfeld fünf kapriziert (vgl. Tillmann, 2006, 27f.), das zeitnah und vor allem quantitativ überprüfbar ist. „Qualitätssicherung“ soll vor allem durch Evaluation erzielt und gewährleistet werden. Die anderen sechs Handlungsfelder, die von der KMK am Tage der PISA-Veröffentlichung vorgeschlagen wurden, sind nur ausgesprochen rudimentär umgesetzt worden33, weil hier keine standardisierten Tests möglich sind, die offenbar einzig die Öffentlichkeit überzeugen, auf deren Sympathie die Politik sich angewiesen wähnt (vgl. Tillmann, 2006, 30). Zentrales Element in Handlungsfeld fünf sind „Bildungsstandards“, die ein scheinbar adäquates Mittel an die Hand geben sollen, um die Qualität von Unterricht zu sichern. Die Festlegung von Standards könne durchaus helfen, sich auf die Vermittlung von Kernkompetenzen bei schwächeren Schülern zu konzentrieren, diese „empirisch“ zu überprüfen und 32 1. 2. 3. Handlungsfelder des KMK-Handlungskatalogs (06.12.2001): Verbesserung der Sprachkompetenz bessere Verzahnung von Vor- und Grundschule, frühzeitige Einschulung Verbesserung der Grundschulbildung (Lesekompetenz, mathematischnaturwissenschaftliche Kompetenz) 4. bessere Förderung bildungsbenachteiligter Kinder 5. Qualitätssicherung durch verbindliche Standards und Evaluation 6. Stärkung der diagnostischen und methodischen Kompetenz der Lehrkräfte 7. Ausbauschulischer und außerschulischer Ganztagsangebote 33 „In den Handlungsfeldern, die auf verbesserte Lerngelegenheiten und auf verstärkte Förderung zielen, finden sich zwar in verschiedenen Bundesländern einzelne Aktivitäten; aber durchgängige oder gar länderübergreifende Maßnahmen lassen sich kaum ausmachen“ (Tillmann, 2006, 28). Das mechanistische Weltbild - 53 - Leistungen zu vergleichen (vgl. Fessler, 2006, 7). Kurz weist mit Blick auf das Fach Sport darauf hin, dass dadurch die „Wirkungen des Unterrichts bei den Schülern einer Überprüfung zugänglich“ (2006, 2) gemacht werden können und fügt hinzu: „Dagegen kann man doch eigentlich nichts haben…“ (ebd.). Die Bildungsstandards, die zum bildungspolitischen „Heilswort“ (Schratz. Nach: Fessler, 2006, 6) geworden sind, sollen jedoch „in einem weiteren Sinne als Standards für (sport)pädagogisches Handeln begriffen werden, bei dem nicht nur Leistungsergebnisse berücksichtigt werden“ (ebd., 7), sondern auch „die - zugegebenermaßen schwer mess- und erfassbare - Qualität der Schule als Lebens- und Erfahrungsraum“ (ebd.). Die schwer messbare Schulqualität soll also messbar gemacht werden, um sie anhand von Standards sichern zu können. Offensichtlich muss dazu die „komplexe pädagogische Wirklichkeit“ (ebd.) erst maßstabsgerecht aufbereitet werden, um überhaupt Standards zur Anwendung bringen zu können. Dies würde allerdings in einer Reduzierung von Bildung auf Objekthaftes münden, das messbar ist. Folgerichtig fällt eben das weg, was Bildung ausmacht; v. Hentig spricht deshalb von „Vermessener Bildung“. Außerdem steht „objektiver“ Leistungsvergleich nicht nur im Dienste der Gerechtigkeit, sondern befördert zugleich das über Gebühr ausgeprägte Problem der Selektion im deutschen Schulwesen. So gesehen verschärfen Standards auch Ungerechtigkeit. Begriffe wie „Input“, „Output“ und „Standard“ - die an die überkommene Denkweise des Behaviorismus erinnern - sind den Wirtschaftswissenschaften entlehnt. Deren Maßnahmen „sollen nun dem kranken Bildungssystem auf die Beine helfen“ (Kurz, 2006, 3). Eine zunehmende Orientierung des Bildungswesens an ökonomischem Denken ist also offenkundig (vgl. Schierz, 2005, 28f.). Deshalb geht es bei der ganzen Diskussion „weniger um Bildung als um Standards“ (Beckers, 2006, 41). Das mechanistische Weltbild - 54 - Problematisch ist dies, insofern Bildung dadurch automatisch nach ökonomischen Maßstäben definiert wird34. Bockrath (2007a, 130) stellt fest: „Bildung wird als Ware traktiert“. Diese Maßstäbe orientieren sich nicht an der Entwicklung der einzelnen Person hin zu einem selbst bestimmten Leben, sondern an deren Funktionstüchtigkeit mit Hinblick auf externe Vorgaben. Beispielsweise geht es in standardisierten Testaufgaben nie darum, die Bedeutung eines Lerninhaltes für den individuellen Schüler selbst aufzudecken. Zusammenhang herstellen, Sinn geben, bewerten (nicht nur begründen) und etwas auf sich beziehen, wird nicht getestet. Die Maßstäbe sind viel weniger subjekt- als objektorientiert. Um auf diesem scheinbar objektiven Weg Schule nachweisbar zu verbessern, finanzieren die Bundesländer das 2004 gegründete Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Das ist mit der Erstellung von objektiv überprüfbaren „Testaufgaben, die passend für den Computereinsatz gemacht werden“ (Wiarda, 2008, 63) beauftragt worden. Durch dieses Vorgehen kommen anscheinend nur Aspekte von „Bildung“ in den Blick, die von Computern erfasst werden können. Eine Schwäche des hier zugrunde gelegten Bildungsbegriffs ist in der Scheidung von tätig sich bildendem Subjekt und objektiv konstruierter Überprüfung auszumachen. Die Tests zur Überprüfung gleichen einer Schablone, die das Subjekt verdeckt. Nur erwünschte Ausschnitte werden sichtbar. Folglich gilt es, das Subjekt wieder sichtbar zu machen. Eine Erkenntnishaltung, die sich an Computerprozessen orientiert, erscheint zu mechanisch, um kreatives und eigenständiges Denken nachdrücklich fördern zu können. Köller, der IQB Institutsdirektor, räumt ein: „Vom Testen wird kein Schüler besser“ (ebd.). Und er fügt hinzu: „Aber keine Frage, bei der Unterrichtsentwicklung besteht ein enormer Nachholbedarf, auch finanzieller Art“ (ebd.). Trotzdem kaprizieren sich 34 In seinem Vortrag Die Formen des Wissens und die Bildung liefert Scheler eine angemessenere Definition: „Bildung ist nicht ‚Ausbildung für etwas, ‚für’ Beruf, Fach, Leistung jeder Art, noch gar ist Bildung um solcher Ausbildung willen. Sondern alle Ausbildung ‚zu etwas’ ist für die aller äußersten ’Zwecke’ ermangelnde Bildung da – für den wohlgeformten Menschen selbst (Hervorhebungen im Original)“ (Scheler, 1925, 17). Das mechanistische Weltbild - 55 - die landespolitischen Anstrengungen um Qualitätsverbesserung des Unterrichts offenbar auf Handlungsfeld fünf35. Es scheint, dass Bildung zugunsten von Standardisierung ins Hintertreffen gerät. Die Entfaltung des sich bildenden Subjekts wird anscheinend hinter Normierungen zurückgestellt. Die Vernachlässigung einer intensiven Umsetzung der anderen sechs Handlungsfelder der KMK, die eine ausdauernde und subjektorientierte Förderung anschieben wollen, und die unverhältnismäßige Schwerpunktsetzung auf Evaluation durch Tests erscheinen als Ausfluss dieses Habitus. Für den vorliegenden Gedankengang ist festzuhalten, dass durch die Abwertung des Leibes zum Objekt gleichfalls bedeutende Erkenntnisvermögen des Leibes ausgeblendet und nivelliert werden. Aus mechanistischer Hinsicht werden erwähnenswerte Erkenntnisfunktionen dem Leib zuerkannt. offenbar Dies kaum erscheint überdenkenswert, weil der Leib das entscheidende Medium zum Erkennen der Welt ist. Er ist die Bedingung der Möglichkeit jedes menschlichen Erkennens. Gleichwohl ist er dem seit Jahrhunderten andauernden Rationalisierungsprozess gleichsam zum Opfer gefallen. An den Beispielen der Transformation des Leibes zum Körper und der Diskussion um Bildungsstandards zeigt sich das Paradigma, welches Wissenschaft seit Descartes beherrscht: Die Welt und die Menschen werden verdinglicht, um kontrollierbar zu sein. Das entscheidende Defizit dieses Denkens wird in einem generellen Verlust und Abbau von Sinnlichkeit handgreiflich. Um Erkenntnisse über jenes Areal zu gewinnen, das sich dem objektivistischen Paradigma entzieht, müssen dessen Grenzen ausgelotet werden, die eo ipso Demarkationslinien zu sinnlicher Erkenntnis sind. 35 Nach der Standardisierung von Haupt- und Realschulabschlüssen soll „demnächst die Entwicklung von Abi-Standards“ (Wiarda, 2008, 63) erfolgen. Deshalb wird das IQB bereits ausgebaut. Das mechanistische Weltbild - 56 - 1.3 Grenzen des objektivistischen Paradigmas Dass jede Perspektive wie auch jedes Paradigma notwendig begrenzt ist, kann man bei Kuhn (1976) ausführlich nachlesen. Hier stellt sich die Frage, wo Begrenzungen des geschilderten und heute wirkmächtigen Paradigmas sich abzuzeichnen beginnen. Zur Darstellung der Grenzen sind ganz bewusst zwei naturwissenschaftliche Disziplinen ausgewählt worden, weil dadurch die generelle Notwendigkeit zur Erweiterung des Blickwinkels - über Geisteswissenschaften hinaus - deutlich werden soll. 1.3.1 Am Beispiel des Kognitivismus Wenn man über die Wahrnehmung des Menschen, über menschliches Erkennen sowie die Leistungen des erkennenden Subjekts spricht, scheint es geboten, die Kognitionswissenschaften zu befragen, wie es sich mit der Funktion des Gehirns verhält. Es ist derzeit von großen Fortschritten in dieser Disziplin die Rede. Doch kann sie das Denken und das Wahrnehmen, also das Erkennen des Menschen erklären und verstehen? Philosophen entgegnen schlicht: „Das Gehirn denkt nicht“. Doch mögen die Erkenntnisse des Kognitivismus am Beispiel eines seiner Entwicklungsstränge, der Hirnforschung, zunächst auf ihren Gehalt überprüft werden. Das erkenntnistheoretische Problem der Wahrnehmung wird aus philosophischer Sicht schon lange kontrovers diskutiert. Die Vorsokratiker und Aristoteles nähern sich der Frage nach der Wahrnehmung auf zumeist spekulativem Weg. Vor allem Demokrit und Leukipp vertreten eine Ansicht, die als Atomtheorie bezeichnet wird (vgl. Heisenberg, 1959, 21). Danach bestehe die Welt aus kleinsten Teilchen, den Atomen. Auf ihre mannigfaltige Zusammensetzung könne man die Erklärung der Welt und die des menschlichen Erkenntnissystems zurückführen. Ohne die Errungenschaften der modernen Experimentalphysik sind diese Naturforscher also durch bloßes Nachdenken erstaunlich weit gekommen (vgl. ebd.). Das mechanistische Weltbild - 57 - Die atomistische Lehre taucht vor allem seit Newton wieder in der Geschichte auf und wird heute noch als Grundannahme vertreten. Der stringente Determinismus, der sich aus der atomistischen Vorstellung ergibt, lässt besonders in Anbetracht mancher kognitiver Leistungen des Menschen einige Fragen offen. Zum Beispiel, wie wir moralisch bewerten und frei entscheiden können, wenn doch unser Verhalten durchweg bestimmt ist durch die Naturgesetze. Das sind Fragen, denen sich die interdisziplinäre Hirnforschung stellen muss. Für unseren Gedanken ist es wichtig zu sichten, welche Informationen die moderne Hirnforschung zum Thema Wahrnehmung zur Verfügung stellt. Dies insbesondere, da Wahrnehmung als Einheit von Empfinden und Sichbewegen aufgefasst werden muss (vgl. Marlovits 2001; Straus, 1956) und von daher aufs engste mit sportwissenschaftlichen Forschungsgebieten verwoben ist. Vergleichbar mit den Vorstellungen der griechischen Atomisten geht man in der Hirnforschung davon aus, dass durch die Untersuchung und Analyse der anatomischen und physiologischen Struktur des Gehirns seine Funktionsweisen ergründet werden können. Dieses Projekt nähert sich nun nach jahrelanger Forschung seinem Abschluss. Fast alle unterscheidbaren Strukturen sind mit Namen belegt. Bald wird es möglich sein, strukturelle und funktionelle Organisationen der wichtigsten Schaltkreise am Computer zu simulieren. Dadurch weiß man immerhin, welche Nervenzellen miteinander verschaltet sind und wie sie kommunizieren. Bemühungen, die Aktivitäten dieser Teile (Neuronen) anhand von Bild gebenden Verfahren sogar sichtbar zu machen (vgl. Elst, 2007, 22), sind jedoch nicht Ausdruck eines zunehmenden Verständnisses der Prozesse. „Die bunten Bilder aus dem Kernspintomographen zeigen eben doch nur den Blutfluss im Gehirn und nicht das Denken selbst“ (Schnabel, 2008, 38). Das kann nämlich aus der Perspektive der dritten Person, die nur Physiologisches sehen kann, gar nicht erkannt werden. Vielmehr geben solche Verfahren Aufschluss über den Vorstellungsrahmen der Wissenschaftler, der durch konkrete, sichtbare Objekte begrenzt scheint. Dies umso mehr, als diese bunten Das mechanistische Weltbild - 58 - Bilder immer nur einen Schnitt durch das ganze Hirn abbilden und überdies auch nur grobe Berechnungen von Daten repräsentieren (vgl. Elst, 2007, 22). Von daher können sie nichts über die Bedeutung der neuronalen Aktivitäten aussagen. Sie erscheinen als Manifestation unserer Vorstellungswelt und sind daher als äußerst trügerisch zu beurteilen. Wir können bspw. anhand dieser Bilder nichts über die Absichten und die Motivationen des Probanden wissen (vgl. ebd.). Dieser Eindruck wird dadurch untermauert, dass die Kognitionswissenschaften das Gehirn als informationsverarbeitendes System auffassen und den Geist folgerichtig mit Computermodellen zu erklären versuchen. Problematisch erscheint dabei, dass solche Computermodelle ja Produkt eben dieses Geistes sind und daher Voraussetzungen geltend gemacht werden, die erst durch den zu erforschenden Geist erzeugt worden sind. Es bleibt daher weiter ungeklärt, auf welchen informationsverarbeitenden Prinzipien kognitive Leistungen des Gehirns, wie Empathie, soziale Kompetenz und moralisches Urteilen beruhen. Es gibt nämlich kein Zentrum, in dem alle Informationen zusammenfließen und Entscheidungen getroffen werden. Das Gehirn stellt sich als ein dezentral organisiertes System dar (vgl. Varela, 1992, 124f.). Offenbar hat die Evolution das Gehirn mit Mechanismen zur „Selbstorganisation“ (ebd.) ausgestattet, die auf eine übergeordnete Instanz verzichten können. Auf welche Weise ohne eine solche Ordnungsinstanz Vorsätze gefasst werden und Handlungsentwürfe entstehen, bleibt ungeklärt und eine wichtige Herausforderung für die Hirnforschung (vgl. ebd.). Der Ansatz zur Lösungssuche scheint geprägt von einer deterministischen Vorstellung. Die Hirnforscher stimmen nämlich in der Grundannahme überein, dass sich die Funktionen des Gehirns - zumal kontinuierlich evolutionär gewachsen - „naturwissenschaftlich erklären und beschreiben lassen müssen“ (Singer, 2007). Die aktuelle Annahme lautet: Jede Entscheidung beruht auf neuronaler Aktivität. Die folgenden festen Naturgesetzen, die man bis heute herausfinden konnte. Freier Das mechanistische Weltbild - 59 - Wille sei Illusion36. Diese ausgesprochen deterministische Haltung wird von Hirnforschern kollektiv akzeptiert, weil sie noch nicht widerlegt werden konnte. Allerdings zeigen sich Lücken in dem streng kausalistisch konstruierten Erklärungsmodell. Das wird besonders deutlich, wenn man auf das Phänomen der Freiheit schaut. Bei totaler Determination des Individuums durch seine neuronalen Schaltkreise kann man ihm nicht die Schuld für seine Handlungen zuweisen. Auch ethische Fragen würden sich erübrigen. Die kausalistische Grundannahme der heutigen Hirnforschung steht also in „eklatantem Widerspruch“ (Singer, 2007) etwa mit unserem Rechtsystem und generell unserer demokratischen Grundordnung, die wesentlich aus selbständig und eigenverantwortlich handelnden Individuen bestehen muss. Normatives Handeln des Menschen lässt sich nicht allein aus der Biologie ableiten (vgl. Wingert, 2007, 34). Dass dies allen Widersprüchen zum Trotz weiterhin versucht wird, scheint dem Kontrollfetischismus der neuzeitlichen Wissenschaften geschuldet, der insbesondere mit Blick auf ethische Fragen menschenverachtende Züge anzunehmen droht und deswegen als demokratiefeindlich abzulehnen ist. Der zentrale Einwand gegen die deterministische Hypothese, der vielleicht auch deren Absurdität („Der Mensch kann nicht entscheiden was er tut“) auflösen kann, lautet: Neurophysiologische Prozesse könnten ebenso gut die Folge von Entscheidungen sein und Entscheidungen des Subjekts Ursache biologischer Abläufe. Aufmerksamkeitslenkungen des Subjekts verändern nachweislich synaptische Verschaltungen im Hirn und sogar genetische Dispositionen, also die biologische Struktur des Menschen, wie der Mediziner und Genetiker Bauer jüngst ausgeführt hat (vgl. Bauer, 2002). Überdies legen auch Erkenntnisse der modernen 36 Singer anerkennt die erfahrungsabhängige Ausprägung neuronaler Verschaltungen und begreift das Gehirn als „soziales Organ“ (Singer, 2008a, 39), das „nicht nur von genetischen Dispositionen geprägt, sondern auch von unserer Erziehung, den Werten und moralischen Kategorien, die uns vermittelt wurden“ (ebd.). Der „Übergang von neuronalen Prozessen zu subjektiv erfahrenen Bewusstseinsprozessen“ (ebd.) (Qualia) scheint von neurophysiologisch orientierter Gehirnforschung allerdings nicht erschlossen werden zu können. Das ist auch logisch, weil man die Ursache von physiologischen Prozessen - die Intentionalität des Subjekts - übersieht, um Kontrolle inszenieren zu können. Das mechanistische Weltbild - 60 - Genetik37 nahe, dass im Rahmen gängiger Auffassungen Grund und Folge verwechselt werden. Mit dieser Grundannahme würde auch der Entscheidungsfähigkeit des Subjekts besser entsprochen, deren Evidenz schließlich offenkundig ist. Die Hirnforschung übergibt dieses Problem an die Humanwissenschaften. Singer spricht von einer „längst überfälligen Rezeption naturwissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Humanwissenschaften“ (2007). Es gibt keinen Anlass zu der Vermutung, dass die Sportwissenschaft von dieser Herausforderung ausgenommen sein sollte, zumal es ja auch hier um eine selbst verantwortete Handlungsfähigkeit geht. Wiewohl sich die moderne Hirnforschung anscheinend ausschließlich in dem engen Rahmen der klassischen Naturwissenschaften bewegt und ethische Dimensionen ihrer vorläufigen Erklärungen an die Wissenschaften von dem Menschen delegiert, tauchen von ihrer Seite zunehmend Überlegungen auf, die die deterministische Grundannahme scheinbar untergraben. Man sei noch „weit davon entfernt, die Prinzipien zu verstehen, nach denen sich die verteilten Prozesse im Gehirn zu kohärenten Zuständen verbinden“ (Singer, 2007). In Ermangelung eines alternativen Ansatzes versucht man nun zu einem Verständnis zu 37 Auch aus biologischer Perspektive werden Beschränkungen des objektivistischen Denkens nun unübersehbar: Neueste Erkenntnisse der Genetik sprengen deren bisherige Denkmuster, die sich bislang „auf dem Stand des Augustinerpaters Gregor Johann Mendel (1822-1884) befinden, des Urvaters und Begründers der Erblehre. Demgemäß beschränkt sich das Wissen über die Gene vielfach darauf, dass Merkmale der biologischen Grundausstattung eines Organismus im Rahmen eines festgelegten Erbganges an die Nachkommen weitergegeben werden“ (Bauer, 2002, 9). Die Genetiker müssen sich jetzt von der Vorstellung stabiler Gene verabschieden; wie die Atomphysiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Annahme von stabilen Elementarteilchen aufgeben mussten. Das Genom ist kein stabiler Text; es ist in beständigem Umbau begriffen. Genetische Prozesse bilden ein offenes System, das „keineswegs vorbestimmt ist“ (Bahnsen). Der Genetiker Venter räumt ein: „Unsere Annahmen waren so naiv, dass es fast peinlich ist“ (ebd.). Nicht nur die Genkonglomerate, sondern die Identität des einzelnen Gens verändert sich, jüngsten Erkenntnissen zufolge, ständig. Unter der „Wucht der Befunde zerbröselt nun die Idee, das Genom stelle eine naturwüchsige Konstante dar“ (ebd.). Auch eineiige Zwillinge sind biologisch nicht identisch. Soziale und materiale Außenfaktoren verändern Genfunktionen fortwährend. Erfahrung erzeugt biologische Strukturen. Die Komplexität und Unbestimmtheit genetischer Prozesse entspricht quantenphysikalischen Erkenntnissen auf subatomarem Gebiet. Damit ist gleichzeitig der simple Glauben an die Determiniertheit des Subjekts mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden widerlegt und seine Freiheit vorläufig bewiesen. Das mechanistische Weltbild - 61 - gelangen, indem man die einzelnen neuronalen Prozesse als jeweilige Entsprechungen eines kognitiven Objektes betrachtet. Sie seien als komplexes raumzeitliches Erregungsmuster in der Großhirnrinde gespeichert, gleichsam als Bestandteile der Erkenntnis. Diese Teile, die Neuronen, werden mit einer begrenzten Zahl von Symbolen oder „Buchstaben“ (ebd.) verglichen, deren Rekombination die Grundlage zur Entstehung neuer Erregungsmuster bildet. Durch die kleinsten Teile lassen sich dann „nahezu unendlich viele Objekte der Wahrnehmung repräsentieren“ (ebd.). Man geht davon aus, dass „wir uns als neuronale Entsprechung, als Korrelat (Hervorheb. d. Verf.) von Wahrnehmungen komplexe, raumzeitliche Erregungsmuster vorstellen müssen, an denen sich jeweils eine große Zahl von Nervenzellen in wechselnden Konstellationen beteiligt“ (Singer, 2007). Es ist bemerkenswert, dass an dieser Stelle in Singers Aufsatz eine Parallele zur phänomenologischen Bewusstseinsforschung auftaucht. Phänomenologen sprechen ebenfalls von Bewusstseinsstrukturen als Korrelat der objektiven Außenwelt, die sich diesen gegenüber als etwas ausweist. Das „Herzstück“ (Gadamer, 1960, 231) der phänomenologischen Forschung - der Korrelationsgedanke - ist offenbar auch eines der Resultate der Hirnforschung. Damit liefert die Hirnforschung das als Resultat, was die phänomenologische Forschung bereits vor gut hundert Jahren als Ausgangspunkt nutzte. Auch unter diesem Aspekt sind die Erwartungen an die Hirnforschung erheblich zurückzusetzen. Hirnforscher können, aller geleisteten Erklärungen zum Trotz, anscheinend nicht plausibel begründen, wie das Subjekt erkennt, denn Singer schließt mit den Hinweisen darauf, dass die „wechselwirkenden Neuronen (…) ein Maß an Komplexität aufweisen, das unser Vorstellungsvermögen übersteigt“ (Singer, 2007). Er fügt hinzu, dass die zukünftigen Beschreibungen der neuronalen Vorgänge „abstrakt und unanschaulich“ sein werden und dass sie „keine Ähnlichkeit aufweisen, mit den Vorstellungen, die auf diesen neuronalen Zuständen beruhen“ (ebd.). Das zeigt sich auch im so genannten Konnektivismus, der als Das mechanistische Weltbild - 62 - Spielart des Kognitivismus ähnliche Schlüsse nahe legt (vgl. Varela, 1992, 125-147). Am Beispiel der Hirnforschung wird ein atomistischer Vorstellungsrahmen erkennbar. Man kann sich die Welt offensichtlich nicht anders vorstellen als aus einzelnen Atomen zusammengesetzt. Dieser kausalistische Rahmen bereitet heute auch den Neurowissenschaftlern Probleme, weil er kaum über das Erklären des anatomischen Aufbaus des Gehirns hinaus trägt. Dieses über Jahrhunderte eingeübte Denkmuster ist derart wirkmächtig, dass es Forscher wie bspw. Singer in seinem Bann zu halten scheint. Im Dialog mit dem ehemaligen Molekularbiologen Matthieu Ricard, der sich entschieden hat, kontemplative Erkenntnisquellen zu erforschen, führt dieser aus, dass reines Bewusstsein mit dem Ozean vergleichbar ist und mentale Prozesse mit den Wellen, die Teil des Ozeans, aber nie von diesem getrennt sind. Singer vermutet hier einen „Dualismus“: „Ich kann mir kein von allen Inhalten entleertes Bewusstsein vorstellen“ (Singer, 2008, 17)! Unser eingeübter Vorstellungsrahmen scheint das entscheidende Hindernis für prozessorientiertes Denken zu sein. Durch die Anerkennung einer prozessorientierten Ontologie - wie sie bspw. dem Schichtungsgedanken (vgl. Kap. 2.5.7) zugrunde liegt - kann dieser Rahmen für Einsichten geöffnet werden, die sich nicht aus der Rekonstruktion von irgendwie zusammengesetzten elementaren Bausteinen und deren Repräsentation im Bewusstsein herleiten lassen. Die entscheidenden Fragen auch der Hirnforschung erscheinen schließlich noch immer ungeklärt: „Wie bringt das Nervengeflecht in unserem Kopf Gedanken hervor, auf welche Weise führt das Neuronenfeuer zu so etwas wie Bewusstsein, kurz: Wie entsteht aus Materie Geist?“ (Schnabel, 2008, 38). Die objektivistische Perspektive der dritten Person kann diese Fragen anscheinend nicht klären. Der skizzenhafte Exkurs in die faszinierende Welt der Gehirnforschung soll verdeutlichen, dass auch hier eine Beschränkung des Vorstellungsrahmens vorliegt, die ein tiefer gehendes Verständnis des Das mechanistische Weltbild - 63 - Subjekts nicht zulässt. Weil der Mensch eher ganzheitliche Gestalten wahrnimmt als Einzelteile der Erfahrung, scheint es generell zweifelhaft, ob man durch das Betrachten der einzelnen Neuronen und ihrer Wechselwirkungen mit anderen überhaupt etwas über die Ausbildung von Wahrnehmungen wissen kann. Um der Wahrheit näher zu kommen, braucht es eine alternative Sichtund Denkweise, die andere Voraussetzungen in Betracht zieht und daher andere Phänomene sieht. Hierbei handelt es sich nicht um eine neue Interpretation alter Daten, die die Philosophie besorgen muss. Deutungen können sich immer nur der Daten bedienen, die aus einer bestimmten Perspektive erhoben wurden und also immer schon durch das in der Perspektive wirksame Paradigma begrenzt sind. Objektive Tatsachen gibt es nicht. Jede Erkenntnis ist zutiefst standpunktabhängig. Die Daten selbst werden sich bei anderer Hinsicht verändern, so dass der von Singer geforderten „überfälligen Rezeption naturwissenschaftlicher Erkenntnisse“ durch die Philosophie ein Perspektivwechsel der Naturwissenschaften vorausgehen muss. Die Wissenschaftler sollten Datenerhebungen aus einer anderen Perspektive als der deterministischen ins Auge fassen, was in letzter Konsequenz auch die Aufwertung kontemplativer Erkenntnisquellen erforderlich macht. So generierte Daten könnten mit den bereits verfügbaren Daten verglichen bzw. ergänzt werden, um damit zu einer umfassenderen Ansicht fortschreiten zu können. Mit der Anwendung von gleichen Instrumenten auf die gleichen Objekte können dann neue Erkenntnisse gewonnen werden38. Die Begrenztheit objektivistischen Denkens wird durch die folgende Rezeption der Quantentheorie weiter untermauert. 38 Für die Sportpädagogik scheint das insofern relevant, als aus objektivistischer Perspektive bspw. die Intentionalität der Wahrnehmung fast vollständig im Dunkeln bleibt. Die Hirnforschung konnte zwar nachweisen, dass intentionale Akte (Aufmerksamkeitsrichtungen) zu korrelierenden neuronalen Aktivitätsverschiebungen führen. Das sagt aber nichts über Grund und Bedeutung dieser Aufmerksamkeitsverschiebungen. Das geltende Paradigma bleibt auf Erklärungen und Symptome beschränkt, weil physiologische Prozesse nicht als Folge von intentionalen Erkenntnisakten angesehen werden. Das mechanistische Weltbild - 64 - 1.3.2 Am Beispiel der Quantenphysik Die Entdeckung der Quantentheorie vor allem durch Bohr und Heisenberg gibt Aufschluss über den Aufbau der Welt. Mit zunehmendem Verständnis dieser Theorie39 gelangt man zwingend zu einem sukzessiven Nachdenken über ihre epistemologische Bedeutung. Denn die Gesetze der Quantenmechanik beinhalten eine Vorstellung vom Wesen menschlichen Erkennens, das jener der klassischen Physik gänzlich fremd ist, weil die quantenmechanischen Gesetze unseren heutigen Vorstellungen und unserem kausalen Weltbild völlig zuwider laufen. Die Ergebnisse der Deutung der Quantentheorie, die für das vorliegende Anliegen von Bedeutung sind, sollen kurz erörtert werden40. Am 14. Dezember 1900 stellte Max Planck an der Friedrich-WilhelmUniversität zu Berlin (heute Humboldt-Universität) seine Hypothese über die Quantelung der Energie der elektromagnetischen Strahlung vor. Dieses Ereignis wird allgemein als der Anfang der Quantenphysik angesehen (vgl. Röthlein, 1999, 17). Plancks Forschungen gehen zurück auf die alte Kontroverse um die Natur des Lichts. Newton postuliert die so genannte Korpuskulartheorie (Opticks 1704). Danach bestehe das Licht aus Partikeln, also aus Materie. Der niederländische Naturforscher Huygens vertrat dagegen die Ansicht, das Licht bestehe wesentlich aus Wellen. Obwohl dieser Streit nicht entschieden werden konnte, dachte man bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, das Licht bestehe einfach aus schnell fliegenden Teilchen (vgl. ebd.). 39 Heisenberg bemerkte, dass wer behauptet, er hätte diese Theorie verstanden, sie nicht verstanden hat. Feynman, einer der gründlichsten Kenner der Quantenmechanik: „(Im Gegensatz zur Relativitätstheorie) kann ich mit Sicherheit behaupten, dass niemand die Quantentheorie versteht“ (1993, 159). Gemeint ist: Im Gegensatz zur speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, die zwar eine gründliche Revision des früheren Weltbildes verlangen, deren ungewohnte Vorstellungen von Raum und Zeit sich jedoch aus logischem Denken ergeben, hält die Quantenmechanik Rechenverfahren bereit, aus denen man die „exaktesten und erfolgreichsten numerischen Vorhersagen in der Geschichte der Naturwissenschaften gewinnt und die sich leicht ausführen lassen – ohne wirklich zu verstehen, warum die Verfahren klappen oder was sie im Grunde bedeuten“ (Greene, 2000, 110). 40 Es kann hier nicht der Ort sein, um die Quantentheorie genauer zu beleuchten. Für ausführlichere Einblicke vgl. u.a. Greene (2000), Heisenberg (1959 & 1969), Bohr (1958), Röthlein (1999). Das mechanistische Weltbild - 65 - Es war vor allem Einstein, der Plancks Entdeckung einen wirklichen physikalischen Sinn verlieh (vgl. Greene, 2000, 117). Planck hatte gezeigt, das Wellen jeder Art - er befasste sich zunächst mit elektromagnetischen Wellen - aus Energiequanten bestehen. Also aus kleinen Energiepaketen. Der Physiker Gamow beschrieb dies sehr anschaulich: Es sei, als erlaube uns die Natur einen halben Liter Bier oder gar kein Bier zu trinken, aber nichts dazwischen. Planck postulierte, dass die Frequenz einer Welle immer proportional ist zu dem kleinsten Energiebündel, das sie tragen kann. Dieser Proportionalitätsfaktor wird heute als Plancksche Konstante bezeichnet und ist so winzig, dass er in unserer täglichen Erfahrung nicht erscheint (vgl. ebd., 115). Für die Experimentalphysiker bedeutete die Plancksche Konstante jedoch einen großen Fortschritt. Auf der von Planck geschaffenen Grundlage konnte Einstein nämlich 1905 bei der Untersuchung des Photoeffektes zeigen, dass Wellen - auch Lichtwellen - aus Photonen bestehen, die kleine Pakete oder Quanten des Lichts sind. Hatte Newton also Recht mit seiner Teilchenstromtheorie? Der englische Physiker Thomas Young zeigte mit seinen Experimenten, dass Newton unrecht gehabt hatte. Das berühmteste von Youngs Experimenten ist das Doppelspaltexperiment. Bei diesem Experiment wird ein Lichtstrahl auf eine Trennwand geworfen, in der sich zwei Spalte befinden. Das Licht, das durch die Trennwand gelangt, wird von einer photographischen Platte aufgezeichnet, wenn ein Spalt oder beide offen sind. Wenn der rechte Spalt abgedeckt wird, konzentriert sich das Licht auf den linken Bereich der photographischen Platte und umgekehrt. Sind beide Spalte geöffnet, führt Newtons Teilchenhypothese des Lichts zu der Vorhersage, dass zwei Linien rechts und links auf der photographischen Platte sichtbar werden. Man kann sich Newtons Lichtkorpuskel vorstellen, als wären sie kleine Geschosse, die auf die Trennwand abgegeben werden. Die durch die Spalten gelangen, müssten in den zwei Bereichen hinter der Trennwand abgebildet werden. Die Wellenhypothese des Lichts lässt einen ganz anderen Ausgang des Experimentes erwarten. Wellen sind Das mechanistische Weltbild - 66 - nämlich an dem so genannten Interferenzphänomen zu erkennen. Sobald Wellen aus dem Spalt hervorkommen, überlagern sie sich und zeigen bei dem beschriebenen Experiment eine Sequenz von hellen und dunklen Streifen; ein Interferenzmuster (vgl. Bohr, 1958, 36). Young führte eine Version dieses Experimentes durch, er schickte Licht durch die zwei offenen Spalten in der Trennwand und das Ergebnis war ein Interferenzmuster auf der photographischen Platte. Newtons Korpuskulartheorie war widerlegt, die Wellentheorie des Lichts scheinbar bewiesen. Nun besteht auch Wasser aus Teilchen, aus Wassermolekülen und weist trotzdem Interferenzeigenschaften auf. Es spricht also kein vernünftiges Argument dagegen, dass Welleneigenschaften wie etwa Interferenzmuster auch möglich sind, wenn das Licht Teilchencharakter hat. Doch Young setzte seine Experimente fort und gelangte zu ausgesprochen kuriosen Ergebnissen. Er feuerte einzelne Photonen (Elementarteilchen) eines nach dem anderen auf die Trennwand ab. Erstaunlicherweise ordnen sich die Einzelpunkte auf der photographischen Platte immer noch zu einem Interferenzmuster. Nach herkömmlicher Vorstellung müsste jedes Photon entweder durch den linken oder den rechten Spalt gelangen, doch das ist nicht der Fall. Einem Elektron, das den rechten Spalt durchquert, sollte es egal sein, dass es auch einen linken Spalt gibt, und umgekehrt. Doch das hervorgerufene Interferenzmuster lässt darauf schließen, dass sich etwas, das auf die Existenz beider Spalte reagiert, überlagert und vermischt. Irgendwie verkörpern Photonen - obwohl sie Teilchen sind - auch die Wellennatur des Lichts. Man muss sich mit der neuen Vorstellung abfinden, dass das Licht sowohl Welle, als auch Teilchen ist. Obwohl es Worte gibt wie Welle-Teilchen-Dualismus bleibt dieses Verhalten der Natur für uns schwer vorstellbar und kaum verständlich (vgl. Greene, 2000, 135). Der theoretische Physiker Feynman erklärte, jedes Elektron durchquere beide Spalte. Es lege auf dem Weg von der Quelle zum Schirm jede mögliche Bahn gleichzeitig zurück. Laut Feynman ist es so, dass das Das mechanistische Weltbild - 67 - Elektron jede mögliche Bahn ausprobiert. Er konnte seine Annahme mit der „Pfadintegralmethode“ untermauern. “Die Natur, wie sie die Quantenmechanik beschreibt, erscheint dem gesunden Menschenverstand absurd. Dennoch decken sich Theorie und Experiment. Und so hoffe ich, dass Sie die Natur akzeptieren können, wie sie ist - absurd“ (Feynman. Zit. nach: ebd., 137). Das Teilchen wird anscheinend durch den Vorgang des Beobachtens auf eine Bahn festgelegt. Dies ist die wahrscheinlichste Bahn. Deswegen erscheint uns die makroskopische Welt als den Newtonschen Gesetzen folgend. Das kommt daher, dass sich die Wahrscheinlichkeiten ausmitteln. In Wirklichkeit haben wir in der Alltagswelt nur den Eindruck, dass Objekte sich auf einer festgelegten Bahn bewegen. Bei mikroskopischen Objekten zeigt Feynmans Methode, dass viele verschiedene Wege zur Bewegung eines Objektes beitragen können und dies in der Regel auch tun. Die klassische Mechanik Newtons und das zugrunde liegende Naturgesetzt der Kausalität funktionieren in der uns erscheinenden (makroskopischen) Welt so gut, dass man mit deren Hilfe nicht nur in der Technik, sondern sogar in Elektrodynamik und Wärmelehre ziemlich genaue Aussagen formulieren kann. In kleineren (Atome) und größeren (Kosmos) Bereichen werden Messverfahren der Mechanik allerdings so ungenau, dass für den subatomaren Bereich die Quantentheorie und für den kosmologischen Bereich die Relativitätstheorie entwickelt werden mussten, um sinnvolle Ergebnisse generieren zu können. Die Grenze des mechanistischen Weltbildes fällt offenbar mit den Grenzen des an der makroskopischen Welt ausgebildeten menschlichen Erkenntnisvermögens zusammen, das ausschließlich an Objekte gewöhnt ist und daher nur einen ausgesprochen kleinen Teil der Wirklichkeit erfassen kann - eben den Teil, den es als Betrachter habituell konstituiert. Anscheinend ist der Beobachter, also das Subjekt ein entscheidender Parameter für alle Erkenntnis. Heisenberg nennt dies das Einbezogensein des Beobachters. Das mechanistische Weltbild - 68 - 1.3.3 Die Frage nach dem Beobachter Gibt es die objektive Welt, die Welt an sich. Oder liegt eine solch feste Realität im Auge des Betrachters. Was Wissenschaft über die Welt aussagen kann, ist ein großes philosophisches Problem. Denn jede Erkenntnis, auch die eines jeden Wissenschaftlers, ist immer Jemandes Erkenntnis, also durch ein Subjekt hervorgebracht. Daran ändert auch Intersubjektivität nichts, weil die intersubjektive Welt in Form von Begriffen zuvor von einem Kollektiv vereinbart wurde, um eine Verständigung zu ermöglichen. Es ist ein Fehler, diese intersubjektive Konstruktion mit Objektivität zu verwechseln. Dieser Fehler ist jedoch zur Grundlage des verinnerlichten objektivistischen Paradigmas geworden, so dass der Wissenschaftler sich überhaupt nicht mehr als Subjekt wahrzunehmen braucht. Er übergeht deswegen die Beobachterfrage und nimmt sich selbst in seinem Wesen und Wirken als Beobachter nicht an. Auf dem skizzierten Hintergrund und insbesondere mit Hinblick auf die Intentionalität von Wahrnehmung erscheint dies leichtfertig, was sich in zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen langsam abzuzeichnen beginnt. Um dies zu veranschaulichen, wird das Beobachterproblem entlang ausgewählter Wissenschaftsdisziplinen aufgebrochen. Das ist allein deswegen aufschlussreich, weil die Sportwissenschaften auf ihre jeweiligen Mutterwissenschaften rekurrieren. Und die sind mit dem Beobachterproblem konfrontiert. 1.3.3.1 Beobachterproblem in der Physik Belastbare Beweise für die Beobachterabhängigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis sind - im Anschluss an, aber ohne ausdrückliche Bezugnahme auf Husserl (vgl. 2.4.4) - durch die moderne Physik vorgebracht worden. Denn im subatomaren Bereich gestaltet sich unsere Wirklichkeit als nur eine von vielen möglichen Wirklichkeiten. Dieses Phänomen scheint in dem vorliegenden Kontext von besonderer Bedeutung. In der klassischen Physik sind Masse, Zeit und Raum die maßgeblichen Beobachtungskategorien, die unabhängig von dem Erkenntnisvermögen Das mechanistische Weltbild - 69 - des Beobachters postuliert werden. Schließlich sind sie ja kohärent. Das heißt, alle Vorgänge werden in ihrem Sinne schlüssig erklärt. „Doch was anderes sind Masse, Zeit und Distanz als Setzungen, also Produkte des Beobachters?“ (Maturana 1994, 67). Er hat diese Kategorien der Wirklichkeit begrifflich so festgelegt und erkennt deswegen zunächst nur entsprechende Wirklichkeitsausschnitte. Diese Setzung des Beobachters ist die stillschweigende Voraussetzung seines Standpunktes, der bislang selten ausdrücklich thematisiert wird. Atomphysiker mussten hingegen zur Kenntnis nehmen, dass dieses Vorgehen notwendig in Paradoxien mündet, die zu alternativen metatheoretischen Überlegungen zwingen, weil Erkenntnisse sich redundant als standpunktabhängig erwiesen. Die Entwicklung der modernen Physik hat gelehrt, dass Wissenschaft prinzipiell nichts beobachterunabhängig erklären kann. Das liegt daran, dass die Welt relativen Charakter hat. Einstein hat das gezeigt, indem er u.a. feststellte, dass ein Beobachter innerhalb eines Systems durch kein Experiment bestimmen kann, ob das System in Ruhe oder in Bewegung ist (vgl. Greene, 2000, 47). Wenn man diese These selbst nachvollziehen will, genügt es, erst mit bloßem Auge, dann im Mikroskop die Bewegung eines Körpers auf einen anderen hin zu beobachten. Im zweiten Fall erscheint die hundertmal schneller, obwohl sich der in Bewegung befindliche Körper seinem Ziel um nichts mehr genähert hat und doch einen hundertmal größeren Raum durchlaufen hat. Alle Erkenntnis ist standpunktabhängig, ist abhängig vom Beobachter41. Aufgrund dieser Aporie waren die Atomphysiker gezwungen, sich eingehend mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen auseinander zu setzen. Bohr schreibt: „Wir können von der Wechselwirkung zwischen Messinstrument und Untersuchungsobjekt nicht absehen“ (1958, 7). In der Atomphysik trete „eine fundamentale Begrenzung unserer gewohnten Vorstellung einer von den Beobachtungsmitteln unabhängigen Existenz 41 Hier liegt auch der Knackpunkt der Kontroverse um die Natur des Lichts: Auch Licht erscheint in Abhängigkeit der Beobachterperspektive einmal als Welle und einmal als Teilchen.(vgl. Röthlein, 1999, 19f.). Das mechanistische Weltbild - 70 - der Phänomene“ auf (ebd.). Um dieser ursprünglichen Beziehung des Menschen zu den Dingen und seinem Platz in der Welt Rechnung zu tragen, entwarf Heisenberg schließlich die Unschärferelation. Und was Broglie „Erfahrung“42 nennt, ist ein System eindeutiger Relationen, aus dem der Beobachter nicht ausgeschlossen ist. Standpunktfreie Erkenntnis kann es nicht geben, weil der Forscher zwangsläufig zu jeder Zeit an seinem Platz in der Welt er selbst ist (vgl. Sartre, 1991, 420). Wissenschaftlicher Erkenntnis geht also immer meine Entscheidung darüber voraus, was ich als objektiv anzuerkennen bereit bin. Diese Entscheidung wird gewöhnlich im Kollektiv getroffen. Die Gemeinschaft entscheidet, was wahr und was Täuschung ist. Diese vereinbarten Maßstäbe darf man nicht mit objektiver Wahrheit verwechseln. Atomphysikalische Probleme zeichnen sich dadurch aus, dass „sie eine unvermeidliche Wechselwirkung zwischen Objekten und den Messgeräten sowie die Unmöglichkeit einer scharfen Unterscheidung zwischen objektivem Inhalt und beobachtendem Subjekt (beinhalten)“ (Bohr, 1958, 30)43. Dieser Umstand ist nicht auf die Beobachtung lebloser Materie begrenzt. Im Hinblick auf kulturelle Fragestellungen betont Bohr, dass „Ethnologen ja nicht nur der Gefahr begegnen, solche (fremde) Kulturen durch den unvermeidlichen Kontakt zu verderben, sie erfahren oft selbst, wie tief ihre eigene Lebenseinstellung durch solche Studien beeinflusst wird“ (ebd.). So werden Vorurteile von Entdeckungsreisenden in ihren Grundfesten erschüttert. Umgekehrt kann man fremde Kulturen nicht verstehen, wenn man von seinen eigenen Maßstäben ausgeht. Man unterstellt den Fremden gewisse „Tatsachen“, die nur in der eigenen kulturellen Vorstellungswelt gelten, und verzerrt durch seine subjektive 42 Zur sportpädagogischen Analyse von Erfahrung vgl. vor allem Beckers et al. (1986), Thiele (1996), Prohl (2006, 163-176) und aktuell Giese (2007), der sportunterrichtspraktische Implementierungen seiner Ergebnisse generiert. 43 Bridgman schreibt in einem Artikel über die erkenntnistheoretische Haltung Bohrs: „The object of knowledge and the instrument of knowlegde cannot legitimately be seperated , but must be taken together as a whole“ (Zit nach: Lorenz, 1973a, 12). Das mechanistische Weltbild - 71 - Perspektive das beobachtete Verhalten der fremden Kultur44. Der ethnographische Untersuchungsansatz, mit dem in der Soziologie gearbeitet wird, versucht dieses Problem zu überbrücken. Dieser Ansatz beinhaltet einen anthropologischen Blickwinkel des Forschers45. Dieser Gedanke ist auch für Unterrichtsprozesse relevant, in denen eine Verständigung von Lehrer und Schüler durch zuweilen divergierende Vorstellungswelten erschwert sein kann. Der Quantentheoretiker Schrödinger hat das Beobachterproblem in der Atomphysik anhand eines Gedankenexperiments veranschaulicht. Das Szenario könnte von einem Tierquäler stammen: Man stelle sich eine Kiste vor, in die man nicht hineinsehen kann und aus der keine Geräusche herauskommen können. In dieser Kiste sitzt eine Katze. Neben ihr befindet sich ein Apparat, der darauf wartet, dass ein radioaktives Präparat irgendwann in der nächsten Stunde zerfällt. Dann setzt dieser Apparat ein Gift frei, an dem die Katze zugrunde geht. Nichts von alledem ist außerhalb der Kiste wahrzunehmen. Keiner weiß, ob der radioaktive Zerfall schon stattgefunden hat oder nicht. Radioaktive Elemente besitzen nämlich die Eigenschaft, dass ihre Atome nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zerfallen, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Man kann also nicht genau sagen, wann das Atom zerfällt, sondern nur, dass es während der nächsten Stunde geschehen wird. Kein Beobachter kann also wissen, ob die Katze noch lebt oder nicht. Sie ist gewissermaßen in einem Mischzustand zwischen Leben und Tod. Man erlangt Gewissheit erst dann, wenn man die Kiste öffnet (Nach: Röthlein, 1999, 9-14). Schrödinger hat diese Versuchsanordnung gedanklich konstruiert, um dem Laien die grundlegenden Gesetze der Quantenmechanik zu veranschaulichen. Die sagen aus, dass alles und jedes in Wirklichkeit 44 Diesen Mechanismus konnte der Autor auf zahlreichen Reisen bestätigt finden, indem er seine subjektive Erfahrung durch Introspektion einer kritischen Analyse unterzog. Diesbezügliche Studien, die Wiederholbarkeit garantieren, versucht vor allem Knorr-Cetina (2002a & 2002b), die wissenschaftliche „Erkenntnisfabrikation“ beispiellos dekonstruiert. In weiterem Sinne: Eichberg (1986) und Smidt (1991). 45 Vgl. Knorr-Cetina, 2002a; Gehrau, 2002, 18/19, 112-115. Das mechanistische Weltbild - 72 - ungewiss ist. Kein Teilchen, kein Lichtstrahl befindet sich zu einer bestimmten Zeit genau an einem bestimmten Ort. Diese seltsame, ungewisse Welt des Verschwommenen und Ungenauen verwandelt sich jedoch schlagartig in unsere gewohnte, fest gefügte Welt des Erfahrbaren, wenn man daran geht, etwas zu messen. In dem Moment, wo ein Messgerät ins Spiel kommt, verändert sich die Wirklichkeit so, dass man sie exakt beschreiben kann. Bei der Katze ist das „Messgerät“ der Beobachter, der die Kiste öffnet und hineinschaut. Durch unser bloßes Auftreten in der Welt entscheiden wir offenbar über Morphologie und Identität von Betrachtetem. 1.3.3.2 Beobachterproblem in der Biologie Auch in der Biologie waren die Forscher außerstande, experimentelle Ergebnisse sinnvoll zu deuten, ohne die Beobachterfrage zu stellen. Lorenz hat sie an einem eingängigen Beispiel verdeutlicht: Ich komme von einem Winterspaziergang nach Hause und treffe meinen Enkel, der am Kaminfeuer sitzt und spielt. Ich lege ihm meine kalte Hand auf die Wange und stelle eine erhöhte Temperatur bei ihm fest. Erst danach wird mir klar, dass es meine kalte Hand ist, die diese Feststellung hervorruft und nicht die Wange meines Enkels (vgl. Lorenz, 1973a, 47). Die Wahrnehmung des Beobachters erzeugt also sein subjektives Erleben, seine Realität. Die Wange des Enkels ist nicht Forschungsobjekt an sich, sie erscheint durch das Forschen der prüfenden Hand genau so, wie es die Strukturiertheit der Hand vorgibt. Gleiches geschieht im Hinblick auf andere Erlebnisse, die durch die Struktur unserer Einstellung gefärbt sind. Die biologische Struktur des Beobachters erscheint von konstitutiver Bedeutung, als die ultimative Bedingung der Möglichkeit aller Beobachtung. Aus biologischer Sicht versteht man apriorische Kategorien anscheinend als evolutionär gewachsene Schemata. So argumentiert auch die Evolutionäre Erkenntnistheorie. „Unser Erkenntnisapparat ist ein Ergebnis der Evolution“ schreibt Vollmer. „Die subjektiven Das mechanistische Weltbild - 73 - Erkenntnisstrukturen passen auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben“ (2002, 102). Diese Erkenntnisstrukturen kann man zwar nicht direkt verändern, doch man kann sie sich und ihren Einfluss auf das Erkennen möglichst bewusst halten und sie analysieren. Molekularbiologische und neurophysiologische Erkenntnisse bestätigen die Annahme, dass man seine eigenen mentalen Prozesse erkennen und beeinflussen kann. Bei Meditierenden konnte eine starke Zunahme von „Synchronisation oszillatorischer Aktivität im Gamma-Frequenzband“ (Singer, 2008b, 52) festgestellt werden, die mit Einsichten buddhistischer Philosophie konform gehen, dass „ein Blick auf das Wesen kognitiver Prozesse“ (ebd., 23) möglich und in Anbetracht der vorliegenden Überlegungen sogar notwendig erscheint, um sie als integralen Bestandteil von Erkenntnis ausweisen zu können. Nach Maturana (1994) und Varela (1992) sei der menschliche Organismus ein „strukturdeterminiertes System“. Es mag aus den Einflüssen der Umwelt hervorgegangen sein, doch es gehorcht seinen eigenen, strukturimmanenten Gesetzen. Die Außenwelt kann nur Anstöße zu Reaktionen geben. Die eigentümliche Funktionsweise des systemischen Erkenntnisvorgangs wird dadurch nicht verändert. Deshalb kann Maturana sagen: „Als molekulare Systeme bilden sie (Lebewesen) Netzwerke der Molekülproduktion, worin die aus Wechselwirkungen hervorgehenden Moleküle sowohl das sie erzeugende Netzwerk konstituieren als auch seine Ausmaße und Grenzen bestimmen“ (1994, 35). Lebewesen wirken innerhalb der Umwelt eigenständig. Von daher muss man erst erkennen, was ihre Grenzen und Ränder als Dimension des Ganzen konstituiert. Alles, was in Lebewesen vorgeht, ist streng durch ihre Struktur determiniert und äußere Einwirkungen können nur zuvor schon determinierte strukturelle Veränderungen auslösen. Damit steht für Maturana fest: Als strukturdeterminierte Systeme sind wir von außen prinzipiell nicht gezielt beeinflussbar, sondern reagieren immer im Sinne Das mechanistische Weltbild - 74 - der eigenen Struktur (vgl. ebd., 37)46. So legt nicht die Welt an sich fest, was ich sehe, sondern meine Struktur, meine Befindlichkeit. Von daher bin ich allein verantwortlich für das, was ich sehe. Deshalb muss in Beobachtungssituationen ein „Doppelblick“ (Maturana, 1994, 45) Anwendung finden, der einerseits nach außen und andererseits auf mein Inneres gerichtet sein muss, um eine möglichst hohe Annäherung an ein Verständnis der sich mir gegenüber ausweisenden Situation gewährleisten zu können. Nimmt man dies ernst und stellt die Beobachterfrage, so kann man nicht darauf verzichten, den Ablauf anzugeben, der zum Beobachten führt. Verwirft man die Frage, setzt man voraus, trotz seiner konstitutiven Beobachterrolle eine unabhängige Außenwelt zu erklären. Der Körper tritt dann nur als Ausdrucksmittel oder Werkzeug des Beobachters auf. Wenn man die Beobachterfrage verwirft, instrumentalisiert man den Leib. So bietet etwa die Röntgenabbildung meines Körpers dem Arzt eine objektive Perspektive auf meinen Leib, den ich dagegen als gelebten Zugang zur Welt erfahre und erst durch einen Vernunftschluss - also mittelbar und sekundär - als Körperskelett. Die Wahl der Perspektive (Außen oder Innen) erzeugt die entsprechende Erscheinung (Objekt oder Subjekt). Der physiologische Sehvorgang gibt keine Aufschlüsse über das blickende Subjekt, denn das Erkenntnissubjekt kann nicht im Sehvorgang des Auges präsent sein. Auch die bildgebenden Verfahren der modernen Hirnforschung zeigen nur zahlreiche neuronale Aktivitäten, die jedoch nicht meine Erfahrung abbilden können. Hier wird zwar eine Hinwendung zum Erkenntnisvermögen des Subjekts versucht; sie verbleibt dabei allerdings im Denkschema der dritten Person und geht damit unvermeidlich an dem Gegenstand - der individuellen Erfahrung - vorbei. Das wird notwendig so bleiben, weil physiologisches Erkenntnisinteresse wesentlich kognitive Erkenntnis zur Anwendung bringt. Deshalb muss der 46 Zu Maturanas Begriff der „Autopoiese“ vgl. Holz (1996, 116-130), der dessen Gedanken zur biologischen Eigenart von Kognition nachzeichnet. Das mechanistische Weltbild - 75 - Meditierer Ricard seinen Freund, den Physiologen Singer, belehren: „Du kannst deine Kognition nicht für die Introspektion deines Gehirns benutzen!“ (In: Singer, 2008b, 34). Anscheinend muss menschliche Erfahrung auf anderem Weg verstanden werden. 1.3.3.3 Beobachterproblem in der Soziologie Luhmann, als Vertreter der Soziologie, dachte mit Blick auf die Problematik des Beobachtens auf ganz ähnlichen Geleisen. Er schreibt von ontologischen Theorien der Realität als einer „Umweltbeobachtung erster Ordnung“ (1986, 59). Diese Theorien seien überhaupt nicht in der Lage, ein Problem zu erfassen, weil die Frage nach dem Beobachter, der „objektives Wissen“ über ein Problem sammelt, nicht gestellt wird. Bei Beobachtungen erster Ordnung unterschlägt der Beobachter sich selbst und seine unwillkürliche Einflussnahme auf das Beobachtete. Nach Luhmann ist nur ein Reflexionspunkt zweiter Ordnung, also eine Beobachtung des Beobachters, angemessener Ausgangspunkt. Danach „muss man sehen können, dass man nicht sehen kann, was man nicht sehen kann“ (Luhmann, 1986, 58). Es sei deshalb erforderlich, im Hinblick auf das wissenschaftliche Objektivitätsideal ein Beobachten von Beobachtungen auszudifferenzieren und mit Theorie zu versorgen. Hierdurch könne man zumindest feststellen, unter welchen Beschränkungen wissenschaftliche Erkenntnis entstehe. Diese trete oft als „Besserwissen“ (ebd., 60) auf, obwohl es sich in Wahrheit doch nur um eine besondere Art des Beobachtens der eigenen Umwelt handele. Es bleibe also tatsächlich genügend Raum für Einsichtsgewinne anderer Art. Allerdings gibt es strukturelle Beschränkungen jeder Beobachtung. Darauf macht die Beobachtung zweiter Ordnung aufmerksam. Das so erworbene Wissen um die Beschränkungen muss der Beobachter auf sich selbst anwenden, um eine bessere Einschätzung der Lage zu ermöglichen47. 47 Vgl. Zum Problem des Beobachters aus soziologischer Perspektive vgl. auch: Glanville (1988) und Knorr-Cetina (2002a). Das mechanistische Weltbild - 76 - 1.3.3.4 Beobachterproblem in der Kunst Auch manche Künstler und Wissenschaftler der Kunstgeschichte thematisieren das Problem des Beobachters. Das kann man anhand einschlägiger Werke deutlich erkennen. Die minimalistische Kunst (minimal arts und arte povera) veranschaulicht die Bedingtheit eines Erkenntnisobjektes durch den subjektiven Betrachter sowie seiner persönlichen Vorerfahrungen und urteile. Diese Kunstrichtung trägt dem werdenden Charakter der Welt Rechnung, indem sie auf ein Wissen, das man vor der Begegnung mit dem (Kunst-) Objekt hatte, hinweist und dieses bewusst macht. „Die Arbeit kann nicht rational gesehen werden, vielmehr kann sie nur wahrgenommen werden unter dem Aspekt ihres gegenwärtigen Werdens, als ein Objekt, das uns gegeben ist“ (Krauss, 1995, 233). Von hier aus wird bei D. Judd die subjektive, perspektivische Ansicht, die nur eine mögliche Erscheinung des Objektes konstituiert, als Illusion entlarvt. Die minimalistischen Künstler fordern dazu auf, ihre Skulpturen nicht mehr als die „Summe der Serie von Feststellungen zu sehen, dass sie diese oder jene Form hat, soundsoviel Raum einnimmt, mit dieser Farbe gemalt und aus diesem Material gemacht ist“ (ebd., 230). Die Arbeiten gehen nicht aus von „Behauptungen über Materialien und Formen, also von apriori gesetzten Behauptungen, die die Objekte zu Beispielen eines Theorems oder eines allgemeineren Falles machen würden, sondern sie sind offensichtlich als Objekte der Wahrnehmung gedacht, Objekte, die in der Erfahrung ihrer Betrachtung zu verstehen sind“ (ebd.). Zu diesem Gedanken zitiert Krauss Merleau-Ponty, der in Sinn und Unsinn (1948) schreibt: „Die Wahrnehmung gibt mir keine Wahrheiten, wie die Geometrie, sondern Gegenwärtiges“. Ein bedeutender Protagonist der arte povera (arme Kunst) ist der Italiener Mario Merz. Eines seiner Ausstellungsstücke trägt den Schriftzug: „Objet cache-toi“ (Objekt versteck Dich). Das Objekt soll nicht mehr als alleiniger Erkenntnisträger aufgefasst werden, wie das naturalistische Das mechanistische Weltbild - 77 - Denkstile fraglos tun. Es soll in den Hintergrund treten, sich verstecken, damit sich die Aufmerksamkeit des Erkennenden einmal auf seinen eigenen Erkenntnisvollzug richtet. Das erkennende Subjekt soll sich mit dem Objekt wiedervereinen, um es wirklich zu erkennen. Somit verleiht Merzens Kunstwerk Adornos Gedanken der „Negation der Verdinglichung“ einen phänomenologischen Ausdruck. 1.4 Zwischenbilanz In den genannten Gebieten ist es anscheinend unverzichtbar, die Wirkung des beobachtenden Wissenschaftlers in die Erkenntnisgewinnung mit einzubeziehen. Dass diese Hinwendung zur subjektiven Erkenntnisfähigkeit von den neuzeitlichen Wissenschaften insgesamt offenbar nicht konsequent unternommen wird, ist ihre entscheidende Schwachstelle. Dieses Versäumnis erscheint als Kardinalursache dafür, dass unsere „Objektivität“ stets mangelbehaftet bleibt. Es mangelt an der Betrachtung und Analyse des Objektivität konstruierenden Subjekts48. Nimmt man die Ergebnisse der Quantenphysik ernst, so folgt hinsichtlich des menschlichen Erkennens, dass wir als Betrachter durch unseren momentanen Hinblick immer nur eine von anscheinend unendlich vielen möglichen Welten konstituieren. Die Welt der Möglichkeiten gerinnt durch unseren Hinblick zu einer festen Realität. Die cartesianische Hypothese, dass die Welt aus Objekten bestehe, die unabhängig vom Subjekt in ausschließlich kausaler Wechselwirkung stehen, erscheint daher als 48 nur eine mögliche Sicht, die eine entsprechende Aus diesem Grund schlagen Varela (1992, 298ff.) und Ricard (In: Singer, 2008, 10/11) vor, die buddhistische Philosophie des Ostens, die viel mehr als Wissenschaft des Geistes denn als Religion aufgefasst werden müsse (vgl. ebd.), diesbezüglich zu befragen. Die empirische Erforschung des Subjekts habe dort, so Ricard, in über 2000 Jahren einen ungeheuren Schatz an vergleichbarer und daher für jeden Menschen überprüf- und wiederholbarer Erfahrung gehortet. Die Ergebnisse der modernen Psychologie dagegen begann erst mit William James vor wenig mehr als hundert Jahren. Die reine Datenmenge, die kontemplative Wissenschaften in die Psychologie einbringen können, lässt komplexe Theorien über den Geist, wie sie bspw. Freud entwickelt hat minderwertig erscheinen (vgl. In: ebd.). Solche intellektuellen Abenteuer können 2000 Jahre direkter Erforschung der Arbeitsweise des Geistes anhand ergründender Introspektion nicht ersetzen. Das mechanistische Weltbild - 78 - Erscheinungswelt allererst erzeugt. Deswegen muss man von einer Beschränkung durch das traditionelle Objektdenken ausgehen. Als Zwischenbilanz ist festzuhalten, dass den Erkenntnissen der Quantenphysik und Genetik zum Trotz keine dem Cartesianismus an Durchsetzungskraft ebenbürtige Alternative existiert. In weiten Teilen der Gesellschaft und selbst der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind die Ergebnisse der modernen Physik nicht einmal zur Kenntnis genommen worden49. Soll sich diese „Krise der europäischen Wissenschaften“ (Husserl) nicht zum deren Verhängnis ausweiten, ist die Suche nach Alternativen allgemein zu befürworten und zu fördern. Diese Suche ist allem Anschein nach auf die Erforschung des Subjekts auszurichten, was übrigens keinesfalls zu einem Rückfall in idealistische Denktraditionen führen darf. Das klassische Paradigma ist offenbar an eine Grenze gestoßen, weil der „Verlust des Subjekts“ - also die mangelhafte Analyse des empirischen Erkenntnisvermögens des Menschen - zu Defiziten in der Erkenntnis führt. Auf dem Hintergrund der skizzierten Probleme, die durch die überwiegende Anwendung rein kausalen Denkens auftauchen, erscheint es erforderlich, nach alternativen Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung Ausschau zu halten, die folglich auf die Wiedergewinnung des Subjekts in der Wissenschaft gerichtet sein müssen. Im Sinne Kuhns (vgl. 1976, 107ff.) ist dies eine Phase des Suchens und der konkurrierenden Theorien. 49 Man ist wenig informiert über die Fortschritte, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Physik gemacht worden waren. Houellebecq beschreibt das in seinem Roman Elementarteilchen so: „Die Biologen taten so, als seien die Moleküle getrennte materielle Elemente; ihre Vorstellung vom Atom unterschied sich kaum von jener, die bereits Demokrit vertrat. Sie trugen aufwendige, sich wiederholende Daten zusammen, nur um sofort irgendwelche industriellen Anwendungen dafür zu finden, ohne sich je klar zu werden, dass die theoretische Basis ihres Ansatzes unterminiert war (…). Sobald man wirklich die atomaren Grundlagen des Lebens untersuchen würde, würden die Fundamente der gegenwärtigen Biologie gesprengt werden“ (27). Dies ist durch die Erkenntnisse der modernen Genetik ja seit 2007 belegt - allerdings ohne dass Massenmedien darüber berichtet hätten. Das mechanistische Weltbild - 79 - Bereits um 1900 ist eine Denkrichtung entstanden, die diese konsequente Hinwendung zum Subjekt, das als zusammenhängend mit der Welt begriffen wird, voranzutreiben philosophische Erkenntnismethode. sucht: Die Phänomenologie als Phänomenologie 2 - 80 - Phänomenologie Zur Überwindung des dominierenden Objektdenkens erscheint es notwendig, dualistische Denkmuster aufzugeben. Diese (Wieder) vereinigung von Subjekt und Objekt wird durch phänomenologisches Denken versucht, das als schwieriger Versuch wider den Zeitgeist erscheint. 2.1 Ansätze zur Bestimmung des Begriffes Der Termini „Phänomen“ und „Logos“ gehen auf das Griechische zurück. Erstes bedeutet: sich zeigen; also als Substantiv: Das „Sichzeigende“ (Heidegger, 1993, 28). „Logos“ kann als Lehre, Rede, Sinn, Gedanke, Begriff, aber auch als „ordnende, göttliche Vernunft; das Weltgesetz“ (Kronseder, 2000) übersetzt werden. Der Begriff Phänomenologie taucht erstmals 1762 bei dem Philosophen Johann Heinrich Lambert (1728-1777) auf. Dieser definierte Phänomenologie als die Lehre von den Beziehungen zwischen Schein und Wahrheit. Er dachte darüber nach, wie man von der Erscheinung zum wahren Sein vordringen kann (vgl. Holzhey, 2004, 134). In seinem Neuen Organon trug er „Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein“ (Haym, 1846, 382) vor. Seitdem ist der Terminus in verschiedensten Bedeutungszusammenhängen verwendet worden; immer häufiger in der Medizin, wo von Symptomen als „Krankheitserscheinungen“ die Rede ist. Hegel nahm Husserl die Devise „zu den Sachen selbst“ voraus und veröffentlichte 1807 die Phänomenologie des Geistes. Die Phänomenologie als eigene Denkrichtung ist allerdings hauptsächlich mit dem Namen Edmund Husserl verbunden, dessen Logischen Untersuchungen (LU) seit ihrem Erscheinen 1900/01 sehr viel Beachtung zuteil wurde und die über die deutschen Grenzen hinaus einen massiven Einfluss auf das Denken des 20. Jahrhunderts genommen haben. Phänomenologie - 81 - Hedwig Conrad-Martius bezeichnet den Namen „Phänomenologie“ in dem Vorwort zu Adolf Reinachs Vortrag Über Phänomenologie als „keinen glücklichen“, weil es der Phänomenologie nicht nur um das Beschreiben (Deskription) der bloßen Erscheinungen gehe, sondern gerade auch um „ein An-sich und dessen fortschreitende Bloßlegung: Des unerschöpflichen Reiches der Wesenheiten“ (1951, 5/6). Daher findet sie den Namen „Wesenslehre“ angemessener. Dass unter „Phänomenologie“ durchaus Unterschiedliches verstanden werden kann, soll anhand von drei bedeutenden Vertretern dieser Denkrichtung verdeutlicht werden. Husserl versteht unter dem Begriff des Phänomens vor allem die Erscheinung eines Objektes im Bewusstsein. Gegenstände wären für den Erkennenden nämlich nichts, wenn sie ihm nicht „erschienen“, d.h. wenn er von ihnen kein „Phänomen“ hätte (Hua XV, 70). Daher bezeichnet „Phänomen“ für Husserl alle im Bewusstsein enthaltenen Bestände oder Inhalte. Die Phänomenologie ist damit die Wissenschaft vom Bewusstsein überhaupt, genauer gesagt die Wissenschaft von aller Art Gegenständen, insofern diese als Bewusstseinsakte erscheinen. Die Phänomenologie will feststellen „wie jedes Denken das Gedachte phänomenal in sich ‚hat’ (Hervorheb. im Original), wie im ästhetischen Werten das Gewertete, im handelnden Gestalten das Gestaltete als solches aussieht usw. Was sich in dieser Hinsicht in theoretischer allgemeiner Gültigkeit aussagen lässt, dass will sie feststellen“ (ebd., 72). Heidegger, ein Schüler Husserls, interpretiert „Phänomen“ dagegen als das „Sich-an-ihm-selbst-zeigende, das Offenbare. Die „Phänomene“ seien dann, so schreibt er, „die Gesamtheit dessen, was am Tage liegt, oder ans Licht gebracht werden kann“ (1993, 28). „Logos“ übersetzt er als Rede und wovon „die Rede“ ist. Daher lautet Heideggers Phänomenologiebegriff: „Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen“ (ebd., 34). Weil die Phänomenologie in Frankreich ein besonders großes Echo fand, ist Lyotards Definition des Begriffes „Phänomenologie“ aufschlussreich: Phänomenologie - 82 - „Es geht darum, dieses Gegeben zu erforschen, ‚Sache selbst’ (Hervorheb. im Original), die man wahrnimmt, denkt, von der man spricht, und keine Hypothesen zu bilden, weder über die Beziehung, die das Phänomen mit dem Sein der Sache verbindet, deren Phänomen es ist, noch über die Beziehung, die es an das Ich bindet, für das es Phänomen ist“ (Lyotard, 1993, 9/10). Der Ausdruck Phänomenologie bedeutet Untersuchung der „Phänomene“, das heißt dessen, was gegeben ist50. 50 Dazu eine Anekdote: Raymond Aron, ein Freund von Jean-Paul Sartre hatte 1932 in Berlin die Schriften Husserls studiert. „Als er nach Paris kam, erzählte er Sartre davon. Wir bestellten die Spezialität des Hauses: Aprikosen-Cocktail. Aron wies auf sein Glas: ‚Siehst du, mon petit camarade, wenn du Phänomenologe bist, kannst du über diesen Cocktail reden, und es ist Philosophie!’ Sartre erbleichte vor Erregung; das war genau, was er sich seit Jahren wünschte: man redet über den nächstbesten Gegenstand, und es ist Philosophie. Aron überzeugte ihn, dass die Phänomenologie genau diese Forderung erfüllte: Überwindung von Idealismus und Realismus, Bejahung der Souveränität des Bewusstseins und der Präsenz der Welt, wie sie uns gegenwärtig ist. Sartre kaufte am Boulevard Saint-Michel das Werk von Lévinas über Husserl und hatte es so eilig, sich zu informieren, dass er im Gehen das noch nicht aufgeschnittene Buch durchblätterte“ (Beauvoir, 1969, 118/119). Phänomenologie - 83 - 2.2 Erkenntnistheoretische Ausgangssituation Aus der Mechanisierung der westlichen Geisteshaltung ist eine vorwiegend kalkulierende Erkenntnishaltung entsprungen. Dieser „eiserne Rationalismus“ (Schmitz, 1980, 6) ist im vorigen Kapitel als Konsequenz der Mechanisierung ausgemacht worden. Er führt zum Reduktionismus, d.h. zur Nivellierung der qualitativen Nuancen der Lebenserfahrung durch bloße Ableitung. Letztlich wird angeblich Unerklärtes zu einem Noch-nicht-Erklärten; Stegmüller spricht von „Erklärbarkeitsbehauptungen“ (1969, 128) die etabliert würden. „Neuzeitliche Wissenschaften repräsentieren mit ihrem permanenten Gestus des ‚noch-nicht’ das Reich unbegrenzter Möglichkeiten. Sie gestalten die Welt zum ‚großen Objekt’ (Hervorheb. im Original)“ (Meyer-Drawe, 1996, 175). Dieser Weg wurde durch Demokrit, Descartes und Galilei geebnet; wiewohl der cartesianische Ursprungsgedanke phänomenologisch war, weil Descartes am Anfang seiner Meditationen über die Grundlagen der ersten Philosophie noch keine gewagten Gedankenkonstruktionen vornimmt, sondern überaus kritisch einen festen Ausgangspunkt im Gegebenen sucht (vgl. Hua Ι, 48/49; Schmitz, 1980, 14). Gleichzeitig kann man den phänomenologischen Ursprungsgedanken als cartesianisch auffassen, weil Husserl wie Descartes glaubte, mit der Begründung der Philosophie und der Wissenschaften ganz von vorne beginnen zu können. Beide wollen die Philosophie als universale Einheit der Wissenschaften mit einer absolut rationalen Begründung etablieren; beide streben nach der „absolut unzweifelhaften Grundlage der Erkenntnis“ (Kolakowski, 1986, 10). Deshalb kann Husserl Descartes zu Anfang der Cartesianischen Meditationen als den eigentlichen „Erzvater der Phänomenologie“ (Hua Ι, 3) bezeichnen. Es entsteht bei beiden eine subjektiv gewendete Philosophie, die gleichzeitig nach einem zweifellos sicheren Anfang sucht. Der Rückgang auf das ego cogito ist eine radikale Wendung „vom naiven Objektivismus zum transzendentalen Subjektivismus“ (vgl. Hua Ι, 46; Peursen, 1969, Phänomenologie - 84 - 13). Husserl folgt Descartes in seiner Methode, zunächst nichts wissenschaftlich anzuerkennen und nur die Sachen selbst zu befragen. Zudem hält Husserl ebenso wie Descartes an der Unterteilung von res cogitans und res extensa fest, so dass „wir in der Phänomenologie (…) Zügen rationalistischer Tradition begegnen“ (Peursen, 1969, 11). Die weiterhin von Descartes unternommenen Interpretationen dieser Einsichten lehnt Husserl allerdings fast vollständig ab (vgl. Hua Ι, 43). Da die Differenz von Vorgestelltem und Vorstellen, die Beschreibbarkeit der Welt gewährleistet und bestimmbare Gegenstände konstituiert, sei es sinnlos, die subjektiv sinnstiftenden Leistungen des Bewusstseins durch methodische Vorkehrungen zu neutralisieren. „Denn mit ihnen würde auch die Objektwelt verschwinden. Dass das vergessen wurde, war nach Husserl der Irrweg der galileiisch-cartesianischen Wissenschaftsidee“ (Luhmann, 1996, 33/34). Der cartesianische Dualismus verteilt den Menschen auf Körper und Geist. Das Spüren des Subjekts sowie die Art, wie sein Bewusstsein auf etwas gerichtet ist, liegen jedoch in diesem künstlich geschaffenen Spannungsfeld zwischen Körper und Geist. Die Gefühle und sinnlichen Wahrnehmungen wie bspw. Hunger, Angst, Beklommenheit, Müdigkeit, Unlust, Kitzeln etc. Gegenstandsbereiche, sind die der keineswegs Illusionen, Erforschung würdig sondern sind. Das mechanisierte Weltbild ist dennoch auf berechenbare Quantifizierung ausgerichtet und bemerkt deshalb vornehmlich Dinge, die in das physikalische Erkenntnissystem passen. Daher kann es diese Erforschung nicht leisten. Wie kann man also Erkenntnisse über die qualitativen Aspekte der Realität gewinnen? Wie kann man diese Dinge erkennen, wie sie wirklich sind? Die Fortsetzung von Descartes’ dualistischer Philosophie und insbesondere die allgemeine Interpretation seines Denkens, also der Cartesianismus, verdinglichen die mechanistischen Perspektive, Welt die und münden sich im in einer bisherigen Untersuchungsverlauf als beschränkt und verengend herausgestellt hat. Phänomenologie - 85 - Daher scheint es einleuchtend, dass eine offenere Perspektive als die cartesianische erforderlich ist, um die gesamte Wirklichkeit zutreffend zu erkennen. Warum kann gerade Blickwinkelverengung die Phänomenologie korrigieren? Die die eigentlichen neuzeitliche Phänomene definieren sich durch ihre Zusammenhänge und durch die Perspektive, aus der sie betrachtet werden. Die phänomenologische Methode ist dafür zuständig, diese Bedeutungszusammenhänge zu beleuchten und unvoreingenommene Perspektiven zu erschließen, die den Sachen näher kommen als einseitige Betrachtungsweisen. Sie scheint durch eine Öffnung der Sichtweise, durch eine permanente Offenheit gegenüber der Welt und gegenüber dem erkennenden Subjekt die verengende Perspektive mechanistischen Denkens kompensieren zu können. Von daher scheint es nahe liegend, die phänomenologische Perspektive als Möglichkeit vorzustellen, die notwendige Blickwinkelerweiterung herbeizuführen. Heidegger hat bei der Betrachtung gegebener Gegenstände, konkret am Beispiel eines Hammers, auf den grundlegenden Unterschied von „Vorhandenheit“ und „Zuhandenheit“ hingewiesen. Der Hammer, der als „Ding“ auf dem Tisch liegend „begafft“ wird, werde immer nur hinsichtlich seines Gewichtes, seines Alters, seiner Länge oder Farbe erforscht. Das Wesen des Hammers aber, das im Hämmern liegt, bleibe dabei verdeckt. Das Feuerzeug, als lediglich Raum füllendes Ding, kann nicht als Feuer schaffendes Ding oder Bierflaschenöffner erkannt werden, solange man nicht diese, seine wesentliche Funktion erforscht, sondern nur seine räumlichen Ausdehnungen (vgl. Heidegger, 1993, 68). Die Funktion des „Zeugs“ bezeichnet Heidegger als „Zuhandenheit“. Und die Seinsart von Zeug ist Zuhandenheit. „Zuhandenheit ist die ontologisch-kategoriale Bestimmung von Seiendem, wie es ‚an sich’ ist“ (ebd., 71). Vor allem die Wissenschaften reduzieren die Gegenstände auf ihre Vorhandenheit und verfehlen damit ihr Wesen, anstatt das Zeug in Phänomenologie - 86 - seiner Zuhandenheit zu sehen (vgl. ebd., 361). Deshalb richtet sich die phänomenologische Kritik an den Naturwissenschaften nicht prinzipiell gegen diese und ihre empirische Denk- und Arbeitsweise, sondern vielmehr dagegen, dass sie ihre Beschränktheit als ein bloßer Teil der Wahrheit häufig vergessen haben und ihre Basis, ihre Fundiertheit in das naive ganzheitliche Vorverständnis so aus dem Blickfeld verlieren51. Um zu prüfen, ob die phänomenologische Methode diese Fundiertheit wiederherstellen, gleichsam die sakrosankten objektivistischen Denkens sowie die Vorannahmen des Subjekt-Objekt-Spaltung überwinden kann, um zu den Sachen, den Phänomenen an sich zu gelangen, ist es zunächst erforderlich, genauer zu erörtern, welche Ursprünge der phänomenologischen Geisteshaltung zugrunde liegen. 51 Vgl. dazu die sportpädagogischen Analysen zur Gesundheitsbildung von Erlemeyer, 1997, 62f. Phänomenologie - 87 - 2.3 Ursprung der phänomenologischen Denkweise Die Phänomenologie Husserls keimte in der Krise des Subjektivismus und des Irrationalismus am Anfang des 20. Jahrhunderts. Husserl sieht die Idee der Wissenschaft mit der abendländischen Kultur untrennbar verbunden. Mit der Renaissance verändert sich das Verhältnis von Wissenschaft und Kultur in einer Weise, die bis heute bestimmend ist. Auf der einen Seite entwickelt sich die exakte Naturwissenschaft, deren methodischanalytisches Vorgehen vorbildhaft für jedes wissenschaftliche Arbeiten schlechthin wird. Auf der anderen Seite stehen die Geisteswissenschaften, die diesen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden können, da sie sich nicht auf Allgemeines, sondern vielmehr auf Individuelles beziehen. Es geht ein Riss durch die Kultur, so dass derer zwei entstehen, die bis heute unverbunden sind (vgl. Snow). Die zwei Kulturen der Naturwissenschaft und der Technik einerseits, der Geisteswissenschaften und Künste andererseits stehen fortan nebeneinander. Diese Trennung ist nicht zuletzt durch die cartesianische Spaltung von Körper und Geist geboren worden. Husserl fand, dass die objektiven, dem Ideal mathematischer Exaktheit verpflichteten Wissenschaften nicht gehalten haben, was sie lange zu versprechen schienen: Sie brachten uns der Wahrheit nicht näher; ihr Objektivismus habe sich als falscher und unechter Rationalismus erwiesen, dessen Folge die Sinn- und Kulturkrise der europäischen und europäisierten Menschheit sei (vgl. Melle. In: Sepp, 1988, 46). Die von Husserls Wissenschaften“ werde diagnostizierte durch das „Krise der Supponieren europäischen mechanistischer Vorausannahmen katalysiert. Einmal festgelegte letzte Beweise fungieren als Grundlage für alle Wissenschaften. Husserl musste während der Arbeit an den LU zu seinem Entsetzen feststellen, dass selbst die Logik nicht zur wahrheitsgemäßen Fundierung der Wissenschaften taugt, weil auch sie auf unbewiesenen Axiomen gründet, so dass das logischmathematische System, welches zweifellos in sich schlüssig und richtig Phänomenologie - 88 - ist, genauso gut von entgegengesetzten Vorannahmen ausgehen könnte, um in sich schlüssig zu sein (vgl. Reinach, 1951, 37f.). Die logischen Lehrsätze vor allem der Mathematik sind leere Tautologien, die zwar zuweilen Kausalverhältnisse abbilden können, jedoch nichts über die Grundlagen der Welt aussagen. „Deduktives Denken impliziert stets eine petitio principii, insofern die Schlüsse immer schon in den Prämissen enthalten sind“ (Kolakowski, 1986, 16). Indem man sich auf eine angenommene Objektivität der realen Welt beruft, verkennt man den subjektiven Charakter derselben. Das subjektive Bewusstsein, die individuelle Wahrnehmung mischt bei jedem Erkenntnisvorgang mit, so dass es sich bei einer „objektiven Realität“, die intersubjektiv identisch ist, um eine Illusion handeln muss - wenn auch um eine sehr bequem zu handhabende. Der Realismus gibt sich füglich das Ansehen, tatsächlich zu sein, allerdings „geht er von einer willkürlichen Annahme aus und ist mithin ein windiges Luftgebäude, indem er die allererste Tatsache überspringt oder verleugnet, diese, dass alles, was wir kennen, innerhalb des Bewusstseins liegt“ (Schopenhauer, 1966, 587)52 . Schließlich unterzieht Husserl in Formale und transzendentale Logik die logischen Grundprinzipien einer Kritik ihrer Geltung (vgl. Hua XVΙΙ, 157f.) Die Vorannahmen aller Wissenschaft, für die die Philosophie allererst die Verantwortung trägt, müssen nach Husserls Ansicht auf den Prüfstand. Anderenfalls würde das „Versagen“ der Philosophie die abendländische Kultur untergraben. Er sieht das „Versagen“ der als strenge Wissenschaft sich ausgebenden Philosophie also in dem Umstand, dass diese keine zuverlässige Grundlegung der letzten Beweise bereitzustellen 52 vermag. Diese grundsätzliche Unklarheit am Schopenhauer geht wie Berkeley sogar davon aus, dass die Welt nicht nur in höchstem Maße durch das subjektive Erkennen definiert sei, sondern, dass die Welt gänzlich verschwände, wenn es keine wahrnehmenden Subjekte mehr gebe; dass es ein Widerspruch sei, wenn die Welt, „unabhängig von „allen Gehirnen, als eine solche, dasein sollte“ (ebd., 1966, 588). Die Existenz der gesamten Objektwelt sei gleichsam „im Subjekt prädisponiert“ (ebd., 590). Phänomenologie - 89 - Ausgangspunkt jeder Wissenschaft, für deren Klärung die Philosophie zuständig und verantwortlich ist, resultiere in einer geistigen Krise der neuzeitlichen Wissenschaften und deren Menschentums. Wie einst Descartes sah sich Husserl gezwungen, ein stabiles, tragfähiges und gänzlich neuartiges Fundament für die Wissenschaften zu erarbeiten. Seine Lebensaufgabe und damit auch die Aufgabe der Phänomenologie war es, die Grundzüge einer ganz neuen, grundlegenden Wissenschaft vorzulegen. Den Schlüssel zur wahren Erkenntnis der Welt vermutet er, ähnlich wie Schopenhauer, in dem subjektiven Bewusstsein selbst. Von daher ist in der phänomenologischen Idee eine durchaus idealistische Affinität auszumachen. Dies umso mehr, als dass Husserl das Ziel der Erneuerung scheinbar paradoxerweise im Rahmen der alten rationalistischen Tradition verfolgt, weil er Descartes’ Anfang des subjektiven Idealismus, das ego cogito, übernimmt. Viele Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts fingen an, dem stringenten Rationalismus zu misstrauen. Dies mag als Erklärung dafür dienen, dass die phänomenologische Idee Husserls, trotz der eher trockenen Darstellung seiner LU, auf derart fruchtbaren Boden fiel. Die Voraussetzungslosigkeit dieser neuen Methode war gleichsam eine Verheißung, eine Chance gerade auch für die Geisteswissenschaften, deren Untersuchungsgegenständen die festgefahrenen, voraussetzungsvollen Methoden der traditionellen Naturwissenschaft allzu oft nicht angemessen sind. Deshalb schreibt Husserl: „So begreift es sich, dass die Phänomenologie gleichsam die geheime Sehnsucht der ganzen neuzeitlichen Philosophie ist“ (Hua ΙΙΙ /1, 133). Das Gebot der Stunde lautete damals: Die Vorausannahmen des rationalistischen (mechanistischen) Denkens verschleiern den Blick auf die Wirklichkeit; sie verfälschen jede Forschung bereits vor deren Beginn. Die verschiedenen Einzelwissenschaften beschäftigen sich zumeist mit der durchaus notwendigen Analyse entweder der zu erkennenden Körper oder der erkennenden Subjekte. Wie wir oben sehen konnten, sind sie entweder idealistisch-subjektbezogen oder realistisch-objektorientiert. Phänomenologie - 90 - Indes interessiert die Phänomenologie vornehmlich die Struktur der Relation zwischen Objekt und Subjekt, die maßgeblich von den Bewusstseinsleistungen abhängt. Letztlich will sie, als Ganzes gesehen, die cartesianische Subjekt-Objekt Spaltung überwinden, die von Husserl jedoch zunächst beibehalten wird. Vor dem dualistischen Hintergrund seiner Epoche erschien es Husserl als virulente Aufgabe, die Bewusstseinsleistungen zum Untersuchungsgegenstand zu erheben, um eine wirklich umfassende Grundlegung von Wissenschaft vornehmen zu können. Es sei erforderlich, deren subjektive Grundlagen erkenntnistheoretisch zu klären. Dazu übernahm er zunächst die „psychologische Analyse“ seines Lehrers, des Philosophen Brentano. Er bemerkte jedoch bald, dass die Psychologie als empirische Einzelwissenschaft niemals geeignet sei, eine „universale Wissenschaftslehre zu begründen“ (Peuker, 2002, 162). Zur subjektiv orientierten Klärung der Grundlagen von Wissenschaft radikalisiert Husserl daher die Psychologie zu einer eidetischen und nichtempirischen Methode, die er dann nicht mehr „deskriptive Psychologie“, sondern „Phänomenologie“ nennt (vgl. ebd.). Seine Aufgabe ist keine geringere als die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit des Erkennens überhaupt. Deshalb musste Husserl in das Dilemma von Idealismus und Realismus geraten, welches die Philosophie spätestens seit Descartes beschäftigt. Er versucht also das Verhältnis Subjekt-Objekt zu klären, indem er die Korrelationen der beiden untersucht. Das Anliegen, die Subjekt-Objekt Relation zu beleuchten, erweist sich in zweierlei Hinsicht - zum einen unter philosophiehistorischem und zum zweiten unter epistemologischem Gesichtspunkt - als überaus problematisch: 1. Nach Orth (1976) kann man im 20. Jahrhundert von zwei charakteristischen Wissenschafts- (Erkenntnis) theorien sprechen, zu denen die Phänomenologie als intentional-analytischer Ansatz hinzu-, oder besser dazwischentritt: Phänomenologie - 91 - Zum einen die transzendentalphilosophische Wissenschaftstheorie der Neukantianer (subjektivistisch) und zum anderen die „logischanalytische der Gegenwart“ (objektivistisch) (ebd., 8). Man könnte der Phänomenologie eine vermittelnde Position zwischen diesen beiden Auffassungen zusprechen. Wiewohl alle drei Denkrichtungen in einem kritischen Rationalismus gründen, besteht eine bemerkenswerte gegenseitige Ablehnung, die durch verschiedene Interpretationen der Rationalität ausgelöst ist. So bewertet der Neukantianismus zwar positiv an der Phänomenologie, dass diese der genauen Beschreibung der unterschiedlichsten inhaltlichen Sachverhalte nachkommt. Jedoch erfasse sie den Begriff der transzendentalen Subjektivität nicht zutreffend und falle durch die „phänomenologische Gegenstandsbezogenheit“ wieder in den Realismus zurück. Die logischanalytische Schule schätzt das logische und gewissenhafte Vorgehen des Phänomenologen, Wissenschaft kritisiert auf hingegen Husserls Versuch, alle transzendental-phänomenologischer Bewusstseinsphilosophie zu basieren und sieht darin überdies einen Rückfall in „konstruierende Spekulation oder intuitiven Mystizismus“ (ebd., 10/11), der die Phänomenologie wieder um ihre logischen Errungenschaften bringe. Zudem opponiert die Phänomenologie gegen das bestehende Begriffssystem der Sprache, da ihr Untersuchungsfeld, das Erfahrungsfeld des transzendentalen Bewusstseins, vor aller begrifflichen Prägungen liegt und demnach auch keine geprägten und akzeptierten Begriffe zur Verfügung stehen. 2. Überdies trägt ein weiterer Umstand dazu bei, dass die Phänomenologie schwierige Voraussetzungen vorfindet. Die zu erhellende Relation von Mensch und Welt kann nämlich nicht ohne weiteres und objektiv bezeichnet werden, weil der Relationsforscher ja immer innerhalb dieser Verbindung, gleichsam mit seinem Gegenstand verquickt, dasteht und deshalb auch immer nur so tun kann, als ob er die Relation von einer Metaebene beschreiben würde (vgl. Thiele. In: Bette, 1993, 78). Dem Phänomenologen geht es wie dem Psychologen, der - Phänomenologie - 92 - anders als der Chemiker oder Physiker, der nicht selbst der Gegenstand ist, von dem er zu reden hat „grundsätzlich selbst die Tatsache (ist), von der er zu handeln hat. Er ist diese Leibvorstellung, diese magische Erfahrung, die er so distanziert betrachtet, er erlebt sie im gleichen Augenblick, in dem er sie denkt“ (Merleau-Ponty, 1966, 121). Er muss sich also seiner ureigensten Subjektivität entledigen, um Erkenntnisse über seine subjektiven Erkenntnisprozesse gewinnen zu können. Husserl wollte diese Verstricktheit des phänomenologischen Forschers überwinden, indem er die „natürliche Einstellung“ ausschaltet. Dieser Sprung zur transzendentalphilosophischen Ausrichtung der Phänomenologie, das heißt einer Philosophie, die die Bedingungen dafür, dass so etwas wie menschliches Erkennen überhaupt möglich ist, überprüft, führte zu dem Vorwurf seiner Anhänger, er habe gleichsam als Defätist einen Rückfall in die überwunden geglaubte idealistische Tradition erlitten. Der Kontakt zwischen Husserl und seinen Göttinger Schülern (Max Scheler, Hedwig Conrad-Martius, Alexander Pfänder) löste sich, als Husserl mit seinen 1913 veröffentlichten Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie die Wende von der deskriptiven zur transzendentalen Phänomenologie vollzog. Husserls „transzendentale Wende“ wurde als „Verrat an den Sachen“ interpretiert. Deshalb verwandelte beispielsweise Heidegger Husserls phänomenologischen Ansatz in ein Seinsdenken. Insbesondere die französischen Phänomenologen Sartre53 und Merleau-Ponty bewegten sich daraufhin in die Richtung der Existenzphilosophie. Das „konstituierende“ transzendentale Bewusstsein, an das nach Husserl alles sinnhafte Sein gebunden sei, erschien ihnen offenbar als zu idealistisch. Folgt man Landgrebes Interpretation (vgl. 1969, 33), so belegen diese 53 Sartre war davon überzeugt, dass das Sein eines Seienden genau das ist, als was es erscheint. Er nennt das den „Monismus des Phänomens“: „Die Erscheinung verbirgt nicht das Wesen, sie enthüllt es: sie ist (Hervorheb. im Original) das Wesen“ (Sartre, 1991, 10). Phänomenologie - 93 - Ereignisse, dass Husserls fundamentale Idee der Intentionalität nicht verstanden wurde. Nachdem Husserl in Freiburg 1928 emeritiert wurde, schrieb er, zunehmend durch das nationalsozialistische Regime isoliert, sein letztes Werk. Die ersten zwei Teile der Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936) mussten zu dieser Zeit bereits in Belgrad veröffentlicht werden. Die darin beschriebene Krise beinhaltet einen mit der geschilderten Grundlagenproblematik verwobenen Doppelaspekt: Das Objektivitätspostulat, das jede Skepsis überwunden hat und seine Axiome als unanfechtbar ansieht und den fragwürdigen wissenschaftlichen Fortschritt, der „im unglücklich verengten Sinne zum Inbegriff der Wertschaffung geworden (ist)“ (Lorenz, 1983, 20). Diese zwei Gesichtspunkte müssen näher beleuchtet werden, um das genuin phänomenologische Agens deutlich zu machen. Zum einen ist die Krise aus dem Objektivismus entstanden. „Es handelt sich nicht eigentlich um die Krise der physikalischen Theorie, sondern um die Krise, die die Bedeutung der Wissenschaften für das Leben selbst betrifft“ (Lyotard, Objektivierbarkeit 1993, ist die 53). Durch sinnvolle das Erkenntnisideal Einbindung der der einzelnen Fachwissenschaften in den gesamtwissenschaftlichen Erkenntnisprozess aufgelöst und durch eine disziplinär beschränkte Perspektive verzerrt worden. Denn eine Gesamtdeutung der Wirklichkeit wird nur durch das Begreifen aller Einzelwissenschaften als Teile einer Universalwissenschaft möglich. Den sinnstiftenden Rahmen dafür schuf einst die Metaphysik. Die Krise der europäischen Wissenschaft sei ausgelöst durch eine Abtrennung der Lebenswelt von der Wissenschaft. Die Abhängigkeit aller wissenschaftlichen Theorien von der Lebenswelt sei in Vergessenheit geraten. Da sich wissenschaftliche Konstruktionen jedoch dann als sinnvoll darstellen, wenn man sich ihres Zusammenhanges mit der als sinnvoll erlebten Umwelt bewusst ist, verlieren sie ihren Sinn, wenn dieser Zusammenhang in Vergessenheit Phänomenologie - 94 - gerät (vgl. Aguirre, 1982, 71f.). Deshalb muss der verloren gegangene Sinn durch eine Rückbesinnung auf die lebensweltlichen Ursprünge der Wissenschaft wieder gefunden werden. Husserls berühmtes Diktum „zurück zu den Sachen“ impliziert unter anderem auch diese Ambition. Die Phänomenologie wendet sich Tatsachenwissenschaften, wenn diese verabsolutieren. Tatsachenwissenschaften „Bloße kategorisch ihren gegen die Erkenntnisanspruch machen bloße Tatsachenmenschen“ (Hua VΙ, 4). Auch heute wird die Phänomenologie als Wissenschaftskritik betrieben, weil die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften verbunden ist mit der Loslösung von ihrer ursprünglichen Wurzel, der Lebenswelt54. Diese Entwicklung beinhaltet zugleich eine Eliminierung der Subjektivität aus der wissenschaftlichen Erkenntnis. Sobald sich die objektive Wissenschaft des Subjektiven bemächtigt, erscheint der Objektivismus entfremdend. Dies umso mehr, als das Subjekt die Objekte konstituiert. Inwieweit die Phänomenologie ein Potenzial birgt, die vorwissenschaftliche Lebenswelt, das vorobjektive Leben zu rehabilitieren, ist später zu verhandeln. Der frühe Husserl glaubte jedenfalls, ein solches Potenzial annehmen zu dürfen. Zum anderen wird der Fortschritt, auf den sich die Wissenschaften fortwährend berufen, der gleichsam ständig als Legitimationsgrundlage für die zunehmende „Verwissenschaftlichung“ der heutigen Gesellschaft herangezogen wird, nach stillschweigend vorausgesetzten Gütemaßstäben bemessen (vgl. Meinberg. In: Bette, 1993, 23), die in dem ersten Teil dieser Untersuchung ausführlich dargelegt wurden. Die Schattenseiten eines solchermaßen definierten Fortschrittes werden in ökonomischen und geistig-seelischen Krisen der modernen westlichen Gesellschaft unübersehbar. Deshalb gehört die wissenschaftliche Rationalität auf den Prüfstand. Es ist zu erörtern, welche weiteren Formen von Rationalität es noch gibt, weil nicht feste Maßstäbe, sondern 54 Bei der experimentellen Loslösung von zu untersuchenden Phänomenen im Labor werden lebensweltliche Zusammenhänge oft nicht hinreichend erfasst. „Ein jeder Versuch ist eigentlich ein isolierter Teil unserer Erkenntnis“ (Goethe, 1998, 384). Man müsse sich hüten die so gewonnen Daten in seine „Sinnesart“ einzupassen, wenn man mit einer gefassten Idee eine einzelne Erfahrung verbinde (vgl. ebd., 385). Phänomenologie - 95 - dialektische Argumente, gleichsam „ganz neue Rationalitätsformen“ (Feyerabend, 1981, 98)55 sich als besonders fruchtbar für den Erkenntnisprozess erweisen können. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts findet Husserl die geschilderte Krise der europäischen Wissenschaft vor und beschließt sie zu lösen, indem er eine „neue, erfahrungsgegründete Fundamentaldisziplin entwirft, die zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, sie zugleich beide untergründend, vermitteln kann: Die Psychologie“ (Avé-Lallemant. In: Sepp, 1988, 65). Husserl sieht den damaligen Psychologismus jedoch als Spielart des Naturalismus und mithin einer Kritik bedürftig. Deshalb unterscheidet er die logische Psychologie, als Anleitung zum richtigen Denken, von der Psychologie des menschlichen Bewusstseins, als ihr theoretisches Fundament. In den LU stößt er schließlich auf die Phänomenologie als neue Grundwissenschaft der Geistesgeschichte. Die Krise des Menschentums, die auf eine Sinnentleerung durch wissenschaftlich bedingte Technisierung zurückweist (vgl. Waldenfels. In: Bäumer, 1993, 105), erfordert von der Phänomenologie eine Formulierung der Frage nach dem Ursprung dieser technisch wissenschaftlichen Weltauffassung und keineswegs die Etablierung einer anti-wissenschaftlichen Metaphysik. Die seinerzeit aufkommenden „Strömungen wie Weltanschauungs- Lebens- und Existenzphilosophie, die sich als Restitutionsversuche ‚eigentlichen’ (Hervorheb. im Original) Menschentums“ (Kühn, 2003, 32, Fußnote 5) verstehen, sind Zielscheibe von Husserls Kritik, weil er sie als unwissenschaftlich ansieht. Husserl schreibt in diesem Zusammenhang: „Die Reaktion der verschiedenen guten, aber auch zum Teil selbst verfehlten Lebensphilosophien gegen die rationalistische Wissenschaft hat ihren tiefsten Grund darin, dass man dessen höchst unbehaglich innewurde, dass die Rationalität des höchst abstrakten Denkens der exakten 55 In Anlehnung an Merleau-Ponty (1966, 364) schlägt Franke (2004) aus sportphilosophischer Perspektive die Vorstellung von einer „anderen Vernunft“ vor, die „als ‚Ordnungskraft’ (Hervorheb. im Original) der Sinnlichkeit aus der Leistungsfähigkeit der Sinne selbst erschlossen werden kann“ (29). Phänomenologie - 96 - Wissenschaften doch nicht diejenige Rationalität, diese volle und letzte Verständlichkeit sei, die man von ihr erhofft und durch die man ein wahres und dann menschlich-ethisch fundiertes Weltverständnis erhofft hatte“ (Zit. nach: ebd.). Deshalb möchte Husserl seine Phänomenologie auch als „strenge Wissenschaft“ verstanden wissen und nicht als beliebige Mystifizierung. „Als akribisches am Detail orientiertes Forschen brauchte die Philosophie sich nicht länger vor den übermächtigen Forschungsinstrumentarien der Naturwissenschaften zu verstecken, sondern konnte erhobenen Hauptes (wieder)eintreten in die scientific community“ (Thiele. In: Bette, 1993, 79). Husserl bleibt damit der rationalistischen Tradition des ausgehenden 19. Jahrhunderts durchaus verhaftet, indem er sich gegen die aufkommenden irrationalen Strömungen stellt; doch zugleich sucht er einen Ausweg aus dem rationalistischen Paradigma, indem er andere Formen von Rationalität anstrebt als die rein mathematische. Husserls Philosophie steht am Ende eines Denkens, das mit Descartes begann und sich über die Transzendentalphilosophie Kants bis hin zu Hegels „objektivem Idealismus“ entwickelte und dessen Denken immer am Bewusstsein orientiert war. Die „Begrenzungen des bewusstseinsphilosophischen Denkens“ (Römpp, 2005, 11) werden am Beispiel der Phänomenologie und aus ihr heraus sichtbar, insofern der Mensch nicht unbedingt „zum wirksamen Nachdenken über sein Denken fähig ist“ (Lem, 1984, 89)56. Lem glaubt sogar, hierin einen grundsätzlichen Irrtum der Erkenntnistheorie ausmachen zu können. 56 16). „Es gibt kein Denken, das all unser Denken umfasste“ (Merleau-Ponty, 1966, Phänomenologie - 97 - 2.4 Grundlagen der Husserlschen Phänomenologie 2.4.1 Phänomenologie als Wesenslehre Phänomenologie ist die philosophische Lehre von der Entstehung und der Form der Erscheinungen im Bewusstsein. Sie zielt als universale Sinnund Bedeutungsforschung darauf, das im Bewusstsein Gegebene rein in seiner Wesenheit zur Anschauung zu bringen (Wesensschau) (vgl. Waldenfels, 1992, 17). Sie versteht sich als eine streng beschreibende Form der Philosophie, mithin als Erkenntnismethode. Es ist schwierig, die Phänomenologie eindeutig zu definieren, weil sie als Wesenslehre im Grunde eine Erkenntnishaltung ist, eine Einstellung. Phänomenologie als Wesenslehre versucht die eigentliche, originäre Wesenhaftigkeit der Dinge zum Vorschein zu bringen. Alle Begriffe und Vorstellungen, die wir haben, sind Abstraktionen und subjektive Interpretationen der natürlichen Dinge der Welt. Sie enthüllen nicht das wahre Wesen der Dinge, sondern sind allesamt Vor-urteilen verhaftet, die mit der eigentlichen Wesenhaftigkeit des Dinges an sich verwechselt werden. Ein letztes Maß (vgl. Hua ΙΙ, 31/32), eine letztbegründete Gegebenheit, liegt demnach zunächst nicht vor. Deshalb darf auch nichts vorausgesetzt werden, wenn man das wahre Wesen der Dinge erkennen will57. Das Voraussetzen und Präjudizieren sei in den Wissenschaften allerdings Usus. Reinach führt ein aufschlussreiches Beispiel hierfür an: Die direkte Erfassung des Wesens ist so ungewohnt und schwierig, weil die tiefeingewurzelte Einstellung des praktischen Lebens die Objekte mehr ergreift und mit ihnen hantiert, als dass sie sie kontemplativ anschaut und in ihr Eigensein eindringt. Es ist der Stolz des Mathematikers, das nicht zu kennen, von dem er spricht. Aus dem abstrakten Satz a+b=b+a wird in rein logischen Ketten ein 57 „Philosophie darf keinesfalls irgendwelche vorgefertigten Resultate von den Wissenschaften akzeptieren und sie ‚generalisieren’ (Hervorheb. im Original). Ihre Berufung ist vielmehr, die Bedeutung und Fundierung dieser Resultate zu erforschen. (…) Die Idee einer Erkenntnistheorie, die auf einer Wissenschaft basiert wäre, insbesondere auf Psychologie, ist in empörendem Maße absurd“ (Kolakowski, 1986, 13). Phänomenologie - 98 - ganzes System aufgebaut, das absolut gehaltsleer ist. Denn es wird prinzipiell verzichtet auf eine Einsicht in die Struktur der Objekte. Was ist a oder b? Die Evidenz der letzten Grundsätze bleibt ungeklärt und vollständig im Dunkeln. Die einzige Einsicht, die dabei benötigt wird, ist eine logische. Die Axiome, die zugrunde gelegt werden, werden nicht in sich selbst geprüft. Es sind Ansetzungen, neben denen andere, entgegengesetzte möglich sind. Ebenso gut kann man versuchen, in sich widerspruchslose Systeme von Sätzen auf völlig anderen Ansetzungen aufzubauen. Die Entfernung von allem anschaulich Vorfindlichen ist in der Mathematik besonders deutlich (vgl. Reinach, 1951, 36f.), weil abstrakte Zahlen ausgesprochen un-sinnlich sind58. Die Aufgabe der Phänomenologie ist es, voraussetzungsfrei die Wirklichkeit zu schauen. Insofern ist sie eine „Absage an die Wissenschaft“ (Merleau-Ponty, 1966, 4), die in der Weigerung besteht, zur Erklärung überzugehen. Denn von dem Erschauen beispielsweise eines Baumes zu seiner Erklärung überzugehen, bedeutet genauso genommen, von diesem Baum abzusehen, heißt ihn als Anhäufung von Atomen zu betrachten, heißt „etwas“ an seine Stelle zu setzen, nämlich den physikalischen Gegenstand, der für mich aber überhaupt nicht mehr „die Sache selbst“ ist. Denn das Wesen dieses Baumes erscheint ja in den (unsichtbaren) Atomen gar nicht mehr. Deshalb kann vielleicht das Wesen der Atome erkannt werden, nicht jedoch das dieses Baumes. Was im Wesen von Objekten gründet, kann in der Wesenserschauung zur letzten Gegebenheit gebracht werden. Die letztanschauliche Gegebenheit darf nicht aus anderen, uneinsichtigen Fakten begründet werden, die doch selbst erst durch jene begründet werden können (vgl. Reinach, 1951, 61). Die wesenhafte Struktur der Dinge ist zu untersuchen, nicht indem man 58 Das Ergebnis der Gaußschen Entdeckung war, dass es mehrere gleich richtige Strukturen der dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt. Die Mathematik beschäftige sich mit „völlig von Leben, Zeit und Schicksal abgehobenen, rein verstandenen Systemen, Formenwelten reiner Zahlen, deren Richtigkeit - nicht Tatsächlichkeit – zeitlos und von kausaler Logik ist wie alles nur Erkannte und nicht Erlebte. Damit ist die Verschiedenheit der lebendigen Anschauung von der mathematischen Formensprache offenbar geworden“ (Spengler, 1923, 223). Phänomenologie - 99 - Farben auf Schwingungen zurückführt, denn Wesenheiten können nicht auf andere Wesenheiten zurückgeführt werden. „Es gibt immer etwas Präreflexives, ein Ungedachtes, ein Vorprädikatives, auf das sich die Wissenschaft stützt und das sie immer unterschlägt, wenn sie über sich selbst Rechenschaft ablegen will“ (Lyotard, 1993, 10). Gleichzeitig will die Phänomenologie jedoch auch die Fundamente der Wissenschaft festigen, indem sie sich weigert, die Möglichkeiten der Erkenntnis weiterhin aus konstruierten Axiomen abzuleiten. Von daher ist die Phänomenologie wesentlich eine Erkenntnis der Erkenntnis, eine philosophische Erkenntnismethode. Sie ist allererst eine „Wissenschaft der Ursprünge“ (Hua ΙΙΙ/1, 136), die die Letztbegründungen nicht einfach hinnehmen, sondern fortwährend neu reflektieren will. Husserl will die Quellen, Grenzen und Sicherheiten der Erkenntnis neu fundieren. Dies soll durch eine „Synthesis sensualistischer und rationalistischer Einsichten und Verfahrensweisen erfolgen, um den die Kultur gefährdenden Erscheinungsweisen von Skeptizismus und Dogmatismus eine Absage zu erteilen“ (Waldenfels, 1993, 266). Die dafür aufzuweisende Beziehung zwischen Subjektivem und Objektivem, die Husserl in deren Einheit sieht, wird dabei nicht mehr nur in der logischen Erkenntnis, sondern universal in allen Erkenntnisgebieten thematisiert (vgl. Janssen, 1986, 9). Er erhebt den Anspruch, „dem einheitlichen, ganzheitlichen Phänomen der Korrelation von subjektivem Erkennen, Gegebenheit des Gegenständlichen und Gegenständlichem Rechnung zu tragen“ (ebd.). Es zeigt sich also, dass wir neben Subjekt-Objekt noch ein Drittes nennen müssen: Den korrelativen Aspekt von Ich und Welt. Die Phänomenologie beansprucht ein neues Verständnis der Einheit von Subjekt und Objekt: Sie werden korrelativ aufgefasst. Der letzte Geltungsgrund (Evidenz) dieses Anspruches findet sich für Husserl nicht wie für Descartes in Gott, sondern im Wesen des Phänomenologie - 100 - Subjektiven selbst, in der Bewusstseinsimmanenz. Das heißt, nur das im Bewusstsein Selbstgegebene, nur die in ihm selbst aufscheinenden „Sachen selbst“ können als zuverlässiger Ausgangspunkt für eine Theorie der Erkenntnis dienen. Deshalb ergibt sich für die Phänomenologie ihr Forschungsgebiet in der Beschränkung auf jenes, als was sich das Objektive unserem Bewusstsein gegenständlich gibt. Kurz: Die Bewusstseinserlebnisse einschließlich ihrer gegebenen Gegenstände werden untersucht. Andererseits ist Husserl genau wie Descartes der Ansicht, dass das „Sein der cogitatio unzweifelhaft ist“ (Hua ΙΙ, 4). Beide finden in dem denkenden Bewusstsein den unanzweifelbaren Ausgangspunkt der ersten Philosophie. Doch sei die schauende Erkenntnis der cogitatio immanent, wohingegen die Erkenntnis der objektiven Wissenschaften transzendent sei (vgl. ebd.). Deshalb wird die cogitatio selbst zu Husserls Untersuchungsgegenstand, der unter Ausschluss aller transzendenten Setzungen (thesis) operationalisierbar gemacht werden soll. Phänomenologie ist Wesensforschung, sie ist Bewusstseinsanalyse. Um das Wesen der Dinge zu bestimmen, soll die Erfahrung direkt beschrieben werden, so wie sie ist, ohne Verfälschungen durch die natürliche Einstellung. Das erfolgt durch einen Rückgang zur Naivität des Lebens, aber eben in einer über sie sich erhebenden Reflexion (vgl. Husserl VΙ, 60). Die Phänomenologie will die Sichtweise auf die Gegenstände ihres Forschens verdeutlichen, weil die realen Gegenstände immer nur perspektivisch, in „Abschattung“ (Holzhey, 2004, 141), erfasst werden. Die perspektivische Abschattung der Dinge erwächst aus der natürlichen Einstellung, die unsere situative Wahrnehmung der Welt individuell determiniert. Die Perspektive, aus der der Phänomenologe auf die Welt blickt, wird also nicht einfach vorausgesetzt, wie das weitgehend im physikalischen Weltbild - aber auch in der Lebenswelt sowie der Wissenschaft - der Fall ist, vielmehr wird sie selbst fortwährend hinterfragt. Offenheit ist daher eine wesentliche Eigenschaft des Phänomenologen, der demnach nicht nach einfachen, fertigen und Phänomenologie - 101 - dogmatischen Lösungen strebt, sondern die werdende Komplexität der Welt anerkennt und ihre Abhängigkeit vom Standpunkt des Betrachters berücksichtigt, um dadurch die idealen Gegenstände mit Hilfe der Ideation (Wesensschau) erkennen zu können. Insgesamt gilt es zu beschreiben, nicht zu analysieren und zu erklären. Die unvollständige Beschreibung eines Phänomens durch die phänomenologische Deskription dient als Wegweiser zum Phänomen. Die Phänomenologie will strenge Wissenschaft sein, weil sie sich direkt beschreibend auf die Lebenswelt bezieht und weniger auf die sekundäre Welterfahrung, die immer nur meine Sicht der Welt ist. Aus diesem Grund sei die Phänomenologie wesentlich eine Wissenschaft der Ursprünge (vgl. Hua ΙΙΙ/1, 136). Die phänomenologische Deskription versucht das Phänomen des Bewusstseinsaktes zu umreißen. Danach sieht die phänomenologische Methode vor, dieses grobe Bild des Phänomens zu verfeinern, indem seine allgemeinen Wesenszüge untersucht werden. Die allgemeinen Strukturen des Phänomens werden herauspräpariert (vgl. Spiegelberg. Zit. nach: Thiele. In: Bette, 1993, 93/94). Das Einzelphänomen dient dabei nur als Beispiel für die allgemeine Phänomengruppe, ist musterhaft für das Wesen des Phänomens. Dieses gedankliche Vorgehen beizeichnet Husserl als Wesensschau. Das bezeichnete Wesen der Dinge erinnert nur vordergründig an die Ideen Platons; in Wirklichkeit ist das Husserlsche Konzept „dem platonischen Realismus entgegengesetzt“ (Kolakowski, 1986, 55). Denn die platonischen Ideen seien in einem jenseitigen Reich zu verorten, wohingegen das Wesen der Dinge nach Husserl in den subjektiven Bewusstseinsakten selbst, bewusstseinsimmanent und damit unmittelbar gegeben vorzufinden sei. „Wir halten also den Blick fest gerichtet auf die Bewusstseinssphäre (…) und studieren, was wir in ihr immanent finden. Zunächst, noch ohne jene eigenartige phänomenologischen Urteilsausschaltungen zu vollziehen, unterwerfen wir sie einer systematischen Wesensanalyse (…). Was uns durchaus nottut, ist eine gewisse allgemeine Einsicht in das aus rein innerer Erfahrung, bzw. rein innerer Phänomenologie - 102 - Anschauung überhaupt zu schöpfende Wesen Bewusstseins überhaupt (…).“ (Hua ΙΙΙ/1, 71). des Gleichwohl: „Den Boden der natürlichen Einstellung haben wir nicht preisgegeben“ (ebd., 87). Die allgemeine Wesensschau aus der „natürlichen Perspektive“, die eidetische Reduktion bereitet den darauf folgend skizzierten Verfahrensschritt der phänomenologischen Reduktion vor. 2.4.2 Eidetische Reduktion Die allgemeinen Wesenszüge stehen in relationaler Wechselwirkung zueinander. Um diese Beziehungen zum einen zwischen den verschiedenen Wesenszügen eines einzelnen Wesens und zum anderen zwischen denen verschiedener Wesen zu erfassen, schlägt Husserl das Verfahren der „eidetischen Reduktion“ vor. Dabei wird das Einzelphänomen in der Phantasie in jede erdenkliche Form variiert, so dass schließlich Invarianzen erkennbar werden, wesentliche Eigenschaften des Phänomens, die trotz jeder Abwandlung immer gleich bleiben. Diese Invarianzen besitzen eine allgemeine Form, ein Wesen (eidos). Durch das eidetische Variieren soll von der Faktizität zum Wesen vorgedrungen werden. Am besten kann das Prinzip dieser Methode an einem Beispiel veranschaulicht werden: „Angenommen, ich hätte auf diesem Schreibtisch, von einer Lampe beleuchtet, einen roten hölzernen Würfel von einem Zoll Kantenlänge vor mir. In natürlicher Einstellung nehme ich das Ding, das die erwähnten Qualitäten und Eigenschaften hat, als fraglos wirklich wahr. In der phänomenologisch reduzierten Sphäre behält das Phänomen Würfel - wie er mir erscheint – diese gleichen Qualitäten als intentionaler Gegenstand meines wahrnehmenden Aktes“ (Schütz, 1971, 131). Wenn ich aber nun die allen Würfeln gemeinsamen Qualitäten finden möchte und nicht die Methode der Induktion benutzen will, die nicht nur die Existenz ähnlicher Gegenstände voraussetzt, sondern auch gewisse Phänomenologie unberechtigte logische - 103 - Voraussetzungen impliziert59, kann ich folgendermaßen vorgehen: „Ich habe nur diesen einzelnen konkreten Gegenstand vor mir, den ich wahrnehme. Ich kann aber ungehindert diesen wahrgenommenen Gegenstand in meiner phantasierenden Vorstellung verändern, indem ich nacheinander seine Merkmale variiere – seine Farbe, seine Größe, das Material, aus dem er gefertigt ist, seine Beleuchtung, seine Umgebung und seinen Hintergrund, die Perspektive, in der er erscheint, und so fort. So kann ich mir eine unendliche Zahl verschiedener Würfel vorstellen. Aber diese Variationen lassen eine Gruppe von Merkmalen unberührt, die allen vorstellbaren Würfeln gemeinsam ist, z.B. ihre Rechtwinkligkeit, ihre Begrenzung in sechs Quadraten, ihre Körperlichkeit. Diese in allen vorstellbaren Transformationen des konkreten wahrgenommenen Dinges unveränderliche Gruppe von Merkmalen – sozusagen der Kern aller vorstellbaren Würfel – wird man als die wesentliche Charakteristik des Würfels bezeichnen, bzw. mit dem griechischen Begriff, als sein eidos. Es ist kein Würfel denkbar, der nicht diese wesentlichen Merkmale hätte. Alle anderen Qualitäten und Merkmale des beobachteten konkreten Gegenstandes sind nicht wesentlich“ (Schütz, 1971, 131). Das auf diese Weise erkannte Wesen eines Phänomens stellt sich dem Blick des Betrachters jedoch keinesfalls einfach an sich seiend dar. Im Gegenteil ist es vielmehr so, dass die subjektive Perspektive des Betrachters das Phänomen mit konstituiert. Deshalb ist es notwendig, die subjektive Perspektive entweder zum Bewusstsein des Betrachters zu bringen, das heißt sie gleichsam reflektierend zu erkennen, oder seine individuell gefärbte Sichtweise „einzuklammern“. Indem Husserl zu den Sachen selbst gelangen will, nimmt er ein jedem Wirklichen zugrunde liegendes Wesen an, das nicht in einer mystischen Erleuchtung, sondern in einem methodischen Verfahren anschaulich werde. Die reine Beschreibung der Sachen erfordert eine ständige Reflexion der im Bewusstsein ablaufenden Akte. Dabei muss von den 59 „Ein Induktionsschluss ist der von unzähligen Fällen auf alle, das heißt eigentlich auf den unbekannten Grund, von welchem alle anhängen“ (Schopenhauer, 1966, 108). Vgl. dazu auch die Falsifikationstheorie des kritischen Rationalismus (Popper, 1973, 20ff.). Phänomenologie - 104 - Gegenständen, die durch die phänomenologisch zu behandelnden Akte Seinssetzungen erfahren haben, abgesehen werden, um die sprachlichen Begriffe nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Den Zugang zu der transzendentalen Betrachtungsweise bildet die phänomenologische Reduktion, die als Methode den Grundpfeiler der Husserlschen Phänomenologie darstellt. Sie ermöglicht den Rückgang auf das reine Bewusstsein (phänomenologisches Residuum). In ihm erschauen wir das Wesen des Gegenstandes wie es zum Bewusstsein kommt. 2.4.3 Phänomenologische Reduktion Die Konstitution der Gegenstände im Bewusstsein ist Mittelpunkt Husserlschen Denkens. Während in den LU noch die Rede von deskriptiver Psychologie war, und zwar verstanden als empirische Phänomenologie, ist Husserl bereits seit der Idee der Phänomenologie (1907) mit transzendentaler Phänomenologie befasst (vgl. Hua ΙΙ, 9). Er verabschiedet sich an diesem Punkt von formal logischen Betrachtungen der Mathematik und Geometrie und konzentriert sich auf das konstituierende Bewusstsein, in welches objektive Axiome nicht hineingehören (vgl. ebd., 11). Alle empirischen Setzungen sollen bei der transzendentalen Betrachtung eines Phänomens ausgeschaltet werden. Husserl fordert einen Rückgang zur totalen Unerfahrenheit des Verstandes, zu einer „tabula-rasa-Position, in der unsere Weltsicht in keiner Weise durch Sprache oder unser kulturelles Erbe verschleiert wird“ (Kolakowski, 1986, 92). Die Aufgabe der transzendentalen Phänomenologie bestehe darin, „die Korrelation zwischen Akt, Bedeutung und Gegenstand zu erforschen“ (ebd., 10). Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, entwickelte er eine spezielle Methode. Den Anfang der Phänomenologie stellt die phänomenologische Reduktion als „methodische Operation“ (Hua ΙX, 187) dar. Von ihrem Verständnis „hängt das Verständnis der gesamten Phänomenologie ab“ (ebd., 188). Husserl hält sie für den wichtigsten Bestandteil und die Phänomenologie - 105 - weitreichendste Entdeckung seiner Philosophie60. Auf dem Weg zu einem „transzendentalen Bewusstsein“ muss der Phänomenologe die „natürliche Einstellung“ (Hua ΙΙΙ/1, 62ff.), die Naivität61, hinter sich lassen. „Jedermann hat eine intensive Verlern-Schulung nötig, bevor er die Welt frisch zu erfahren beginnen kann – in Unschuld und Wahrheit“ (Laing, 1970, 20). Philosophische Einsichten seien aus einer „naiven“ Perspektive nicht zu gewinnen (vgl. Hua ΙΙΙ/1, 136f.). In der natürlichen Einstellung fragt man nicht nach der Möglichkeit der Erkenntnis, man ist, im Leben und auch in der Wissenschaft, um die Schwierigkeit der Erkenntnismöglichkeit noch vollkommen unbekümmert. Die natürliche Einstellung ist „diejenige, in der der Mensch zunächst und zumeist vorstellend, fühlend, urteilend, wollend immer schon lebt“ (ebd., 56/57). Die Wirklichkeit finde ich als daseiende vor und nehme sie, wie sie sich mir gibt, auch als daseiende hin (vgl. ebd., 61). In der natürlichen Einstellung wird die Welt als Wirklichkeit gesetzt. „Das Voraushaben der Seinsgeltung der Welt vor allen Einzelgeltungen ist die Generalthesis der natürlichen Einstellung“ (Fink, 1985, 28). Über diese natürliche Einstellung geht Husserl hinaus, indem er die ganze Welt „in Klammern“ setzt. Dies nennt er phänomenologische Epoché. Die phänomenologische Epoché wird von Husserl eingeführt als Methode der Urteilsenthaltung. Das griechische Wort Epoché bezeichnet ursprünglich eine prinzipielle Anweisung zur Urteilsenthaltung, zum „Ansichhalten“ oder „Zurückhalten“ eines Urteils (im Unterschied zum Dogma), zum „Innehalten“ aufgrund der Mannigfaltigkeit der Meinungen, um so zur Wahrheit zu gelangen (vgl. Becke, 1999, 41). Husserl hält sich also ganz an die reinen Phänomene. Es soll 60 Bergson behauptet, dass jeder Philosoph in seinem Leben nur eine Sache sagt, eine leitende Idee oder Intuition, die all seine Werke mit Bedeutung ausstattet. Husserls grundlegende Intuition betrifft zweifellos die Grundlage der Erkenntnis (Intentionalität) und die Methode zu diesem Ziel zu gelangen: Die phänomenologische Reduktion. 61 Was Husserl als naive, natürliche Einstellung bezeichnet, kommt uns eher vor wie die Haltung der Erwachsenen. Denn Kinder blicken noch in wahrhaft unvoreingenommener, gleichsam phänomenologischer Weise auf die Welt, bevor sie durch die jeweilige Gesellschaft „indoktriniert und zu neuen Rekruten“ (Laing, 1970, 57) ausgebildet werden und damit das vorherrschende, gesetzte Begriffssystem adaptieren. „Kinder sind noch keine Narren“ (ebd., 51). Phänomenologie - 106 - „jede Urteilssetzung einer an sich seienden Welt inhibiert werden, die Welt soll als rein vermeinte, wie sie im Bewusstsein vermeint ist, rein als Phänomen des Bewusstseins genommen werden“ (Landgrebe, 1969, 83). Das bedeutet, die Welt der natürlichen Einstellung soll eingeklammert werden. Folglich gilt es, die naive Ebene durch die phänomenologische Epoché zu verlassen und so zu einem transzendentalen, reinen Bewusstsein zu gelangen. Die transzendentale Epoché, schreibt Husserl, sei „die radikale und universale Methode, wodurch ich mich als Ich rein fasse, und mit dem eigenen reinen Bewusstseinsleben, in dem und durch das die gesamte objektive Welt für mich ist, und so, wie sie eben für mich ist“ (Hua Ι, 60). Das bedeutet, dass die Welt, die ansonsten immer im Voraus gegeben ist, überhaupt nicht als bestehend angenommen wird, wie es hingegen im praktischen Leben der Fall ist. Die phänomenologische Haltung erfordert also ein Aufgeben der natürlichen Einstellung, aus der wir alles in Abhängigkeit zu unserer Zeit und unserer Erfahrung betrachten und erklären. Dies habe durch die systematische „Einklammerung“ jeder theoretischen Auslegung des Gegenstandes zu erfolgen. Der Phänomenologe müsse sich „dem Weltglauben enthalten“ (Hua XXXΙV, 163). Dazu gehöre eine gewisse Disziplin. Um die phänomenologischen Verhältnisse rein auf sich wirken und seine persönlichen Erfahrungen außen vor zu lassen, sei ein persönlicher Entschluss erforderlich, der einen „Willen“ voraussetzt, welcher die Epoché begründet (vgl. Hua VΙΙΙ, 145; Hua ΙX, 343). Überdies ist die reduktive Methode auf Übung angewiesen. Immer wieder können mundane Elemente sich einschleichen und einen Rückfall in die Naivität herbeiführen (vgl. Hua XXXΙV, 294/295). Persönliche Erfahrungen, Vorurteile, Einstellungen, Beweisführungen und subjektive Wünsche werden bei der phänomenologischen Reduktion außer Betracht gelassen, ohne dass ihre reale Existenz infrage gestellt Phänomenologie - 107 - würde. Obwohl der Glaube an die reale Welt ausgeschaltet wird, verneint Husserl weder ihre Existenz noch zweifelt er an ihr. „Ich negiere diese Welt also nicht, als wäre ich Sophist, ich bezweifle ihr Dasein nicht, als wäre ich Skeptiker, aber die beständig als seiend vorgegebene Welt nehme ich nicht so hin, so wie ich es im gesamten natürlich-praktischen Leben tue“ (Hua ΙΙΙ/1, 67). Damit wird auch der Boden der positiven Wissenschaften verlassen, die eine im Voraus seiende Welt annehmen. Im Rahmen der Epoché wird vor diese Annahme zurückgegangen. Die Ausschaltung, bzw. Einklammerung der Generalthesis der Welt ist indifferent gegenüber der Frage nach Sein und Nicht-Sein. Die Epoché des reflektierenden Philosophen befreit ihn von den innerweltlichen Interessen und Zwecken und lässt ihn dadurch zu einem unbeteiligten Zuschauer werden. Die Methode der Einklammerung meint den „im Grunde asketischen Akt der Entwirklichung“ (Scheler. Zit. nach: Misch, 1967, 249; vgl. 3.2.2). Als Resultat der Reduktion verbleibt ein reines Bewusstsein als Residuum. Dieses nennt Husserl „transzendentales Bewusstsein“. „Die Ausschaltung der Thesis der Welt der Natur war für uns das methodische Mittel, um die Blickwendung auf das transzendental reine Bewusstsein überhaupt zu ermöglichen“ (Hua ΙΙΙ/1, 136). Das „transzendentale Ich“, als Residuum der transzendentalen Reduktion, ist das „Erfahrungsfeld“ der transzendentalen Phänomenologie. Die transzendentalen Erfahrungen seien eigenständig und unabhängig von Setzungen; sie seien „uroriginal“ (Hua XXXΙV, 165), im Gegensatz zu „sekundären Originalitäten“, wie beispielsweise Erinnerungen (vgl. ebd.). Deshalb ist bei der geschilderten Operation von transzendentaler Epoché die Rede. Weil diese Einklammerung schrittweise vor sich geht, spricht Husserl dabei von phänomenologischer Reduktion. Diese Reduktion soll dazu dienen, das wahre Wesen der Dinge zu schauen, weil die Dinge nun im Bewusstsein seien. Das bedeutet, die Wesensschau erfolge durch die Konzentration auf das Wesen des Phänomenologie - 108 - Gegenstandes und die dieses Wesen erfassenden psychischen Akte. Die reinen Wesenheiten der Dinge sollen in dem durch die phänomenologische Epoché entstandenen transzendentalen Bewusstsein zur Anschauung kommen. Die Bewusstseinsakte des transzendentalen Subjekts sind das eigentliche Untersuchungsgebiet der Phänomenologie. Sie bringen die Welt der idealen Wesenheiten hervor, welche ihrerseits die „Urstätte aller Sinngebung und Seinsbewährung“ (Hua ΙΙΙ/1, 139) ist. Es sei die Aufgabe des Phänomenologen, eine vorurteilslose Deskription des Noema, des geistig Wahrgenommenen, und der Noesis, dem geistigen Wahrnehmen, zu geben, wie sich der Gegenstand dem Betrachter im Schauen zeigt, wie er sich im Bewusstsein konstituiert. Die Phänomenologie will also vor allem beschreiben und nicht analysieren. Die Aufgabe des Philosophen sei es, zu beschreiben und nicht zu entscheiden, was sinnvoll ist (vgl. Hems. In: Dufree, 1976, 56). Deswegen lautet die phänomenologische Forderung: „Zurück zu den Sachen selbst“ (vgl. Heidegger, 1993, 27). Husserl will zu einer Welt vor aller Erfahrung zurückkehren, von der die Erkenntnis immer spricht und im Verhältnis zu der jede wissenschaftliche Bestimmung zeichenhaft und abhängig ist. „Zurückgehen auf die ‚Sachen selbst’ heißt zurückgehen auf diese aller Erkenntnis vorausliegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wissenschaft notwendig abstrakt, signitiv, sekundär bleibt, so wie Geographie gegenüber der Landschaft, in der wir allererst lernten, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluß überhaupt ist“ (Merleau-Ponty, 1966, 5). Es handelt sich dabei um einen Zustand der reinen Erkenntnis vor aller nachträglichen Erfahrung. Das phänomenologische Interesse ist „ein Interesse für das Subjektive“ (Hua ΙX, 190). Die transzendentale Subjektivität ermöglicht das unmittelbare apriorische Erschauen eines Phänomens, dessen reines Wesen sich nur so dem Bewusstsein des Betrachters offenbart. Phänomenologie - 109 - Abb. 1 (vgl. dazu: Hua ΙΙΙ/1, 217ff.) Das rein transzendentale Bewusstsein befasst sich nach vollzogener Epoché wieder mit der natürlichen Lebenswelt, derer es sich dann erst bewusst ist. Durch die Reflexion erscheint die alte Naivität dann als ein gegen sich selbst verschlossenes transzendentales Leben. Nach Husserl ist es dann durchaus möglich, „in meine Rolle als Mensch in meiner Menschheit, in meiner Welt zurückzukehren“ (Husserl VΙ, 214), allerdings kann ich „die alte Naivität nicht mehr erlangen; ich kann sie nur verstehen“ (ebd.). Von einer unreflektierten Hingabe an die Sachen kann also bei Husserl nicht die Rede sein. Die phänomenologische Reflexion findet im Gegenteil ständig und in jedem Augenblick statt. Es handelt sich bei ihrer Methode der Reduktion keineswegs um einen einmaligen Prozess, sondern vielmehr um ein fortdauerndes, perpetuelles Reflektieren der Bewusstseinsakte. Die phänomenologische Reduktion ist zentraler Bestandteil der phänomenologischen Haltung und niemals abgeschlossen, weil das reine Bewusstsein zu jedem Zeitpunkt durch sie neu freigelegt wird. Dies entspricht einer Gegenwart, die „als Urphänomen (zeitlich) strömend (ist)“ (Hua XXXΙV, 166). Die Akte des reinen Bewusstseins sind überdies immer auf etwas gerichtet; sie sind intentional. Husserl hielt an dem Kernargument Brentanos fest, dass das Bewusstsein immer „Bewusstsein von Etwas“ (Kastil, 1951, 102) sei. Er spricht in diesem Zusammenhang von „intentionalen Akten“ des Bewusstseins. Es ist intentional auf die Dinge der Welt gerichtet und konstituiert diese gleichzeitig durch seine Intentionalität. Phänomenologie - 110 - 2.4.4 Intentionalität des Bewusstseins Brentano lehnte die Voraussetzung ab, dass Ideen einfach so im Bewusstsein sind. Er war der Überzeugung, dass jede Form des Bewusstseins immer ein „Bewusstsein von Etwas“ sei. Ferner seien die Ideen notwendige Bestandteile der Bewusstseinsfunktionen, wie Wollen und Urteilen, wobei Wollen und Urteilen nicht ohne Rückbestand in diese Ideen, oder Abwandlungen von ihnen, analysiert werden können62 (vgl. Ryle. In: Durfee, 1976, 18). Brentano und seine Schüler hielten also die mentalen Funktionen des Bewusstseins für eine Sache und die statistisch-experimentelle Suche nach Naturgesetzen, die das Auftreten von mentalen Akten auslösen, für eine ganz andere. Das von der Welt gelöste transzendentale Bewusstsein sei niemals reines Bewusstsein. „Es gehört zum Wesen jedes aktuellen cogitatio, Bewusstsein von Etwas zu sein“ (Hua ΙΙΙ/1, 79). Das „Bezogensein auf Etwas“ des Bewusstseins nennt Husserl seine Intentionalität. „Intentional“ ist dabei nicht im Sinne von beabsichtigen zu verstehen, sondern der Begriff bezeichnet vielmehr den Umstand, dass mentale Aktionen immer von Gegenständen handeln. Wünschen ist sich etwas wünschen, erinnern ist sich an etwas erinnern, erwarten ist etwas erwarten, entscheiden und wählen sind etwas entscheiden und wählen. Jede mentale Funktion ist intrinsisch auf etwas bezogen, das der Gegenstand dieser Funktion ist63 (vgl. Ryle. In: Dufree, 1976, 21). Dabei gibt es verschiedene Arten der intentionalen Bewusstheit, die sich durchaus auf das gleiche Objekt beziehen können. So kann man sich an den gleichen Gegenstand erinnern, den man bedauert. Manches „Bewusstsein von“ ist die Grundlage für ein anderes. Man kann einen Gegenstand nicht bedauern, ohne sich an ihn zu erinnern, man kann sich jedoch an ihn erinnern, ohne ihn zu bedauern. Alle diese intentionalen 62 “So that while ‘ideas’ may be necessary ingredients in judging and wanting, judging and wanting cannot be analysed without residue into ‘ideas’ (Hervorheb. im Original) or complexes of them” (ebd.). 63 “To every piece of mental functioning there is intrinsically correlative something which is the ‘accusative’ (Hervorheb. im Original) of that functioning” (ebd.). Phänomenologie - 111 - Erfahrungen, ganz unabhängig von dem intendierten Gegenstand, gehören zu einem erfahrenden Subjekt, sie erfordern es. Deshalb ist die cartesianische Formel „Ich denke, also bin ich“ ein grundlegendes Element in Husserls Phänomenologie. Die Frage danach, was dieses Ich sei, ist ein zentrales Anliegen der phänomenologischen Philosophie. Husserl legt dar, dass das cartesianische Ego letztlich keine wirklich unabhängige Substanz ist, sondern vielmehr das „Residuum“ oder die Grenze der Quantifizierung (vgl. Hua VΙ, 81). Nach Descartes wäre die denkende Ichsubstanz der res extensa verwandt, wohingegen bei Husserl die cogitatio die res extensa individuell konstituiert (vgl. dazu: Marcuse, 1964, 167/168). Im Gegensatz zu Descartes sieht Husserl das erkennende Subjekt und das erkannte Objekt also keineswegs als getrennte und voneinander unabhängige Substanzen, wiewohl er während der phänomenologischen Reduktion das transzendentale Bewusstsein zu vereinzeln sucht und daher zunächst dieselbe Unterscheidung vornimmt. Husserl bestreitet nicht die äußere Welt, um das Denken zu verabsolutieren, obwohl er im Rahmen der phänomenologischen Reduktion alle äußeren Faktoren allererst außer Acht lässt. Vielmehr ist er sich darüber im Klaren, dass beides, Ich und Welt, keinesfalls als voneinander unabhängig verstanden und beschrieben werden können. Sie bedingen und konstituieren sich gegenseitig. Die Intentionalität des Bewusstseins ist zugleich Gerichtetsein auf einen Gegenstand und Sinngebung für diesen Gegenstand. Die intentionale Analyse deckt die durch das Subjekt vorgenommene Konstitution des Objektes auf, was Intentionalität zu dem Kerngedanken der Phänomenologie macht. Er trägt in sich die weit reichende Konsequenz, dass die Erscheinung erkannter Objekt immer maßgeblich durch das erkennende Subjekt konstituiert wird. Erkenntnis ist notwendig gleichsam erfahrungsdurchtränkt. Dadurch wird die konsequente Hinwendung zum Subjekt der Erkenntnis legitimiert. Phänomenologie - 112 - Aufgrund dieses Umstandes will Husserl nicht mehr die Gegenstände der Außenwelt zu Objekten der Erfassung machen. „Wir sollen unser theoretisches Interesse nicht auf diese Gegenstände richten, nicht sie als Wirklichkeiten setzen, so wie sie in der Intention jener Akte erscheinen oder gelten, sondern im Gegenteil eben jene Akte, die bislang gar nicht gegenständlich waren, sollen nun die Objekte der Erfassung und theoretischen Setzung werden“ (Hua XΙX/1, 14). Die intentionalen Bewusstseinsakte selbst werden zum Gegenstand der Untersuchung. Nicht die Materie, sondern die Form, wie das Bewusstsein sie erkennt, ist vorrangig. Die Realität wird also weder in der Materie, noch in den Ideen angenommen, sondern in dem Prozess des Bewusstseins des Subjekts (vgl. Hua XΙX/1, 343f.). „Die beobachteten Strukturen der Materie wären somit Spiegelungen der Strukturen unseres Bewusstseins“ (Capra, 1983, 99). Dabei steht die Intentionalität im Vordergrund. Das Bewusstsein ist immer Bewusstsein von Etwas, es meint immer etwas, ist also intentional, auf ein Objekt gerichtet, dessen verschiedene Aspekte jeweils „Träger einer Intentionalität“ (Hua ΙΙΙ/1, 81) sind. Demzufolge kann es weder ein „leeres“ Bewusstsein geben, noch ein „allgemeines“ im Sinne von Kant (vgl. Jaspers, 1985, 42/43). Es gebe keine Trennung von Objekt und Subjekt, keine doppelte Realität: eine äußere und eine innere. Immanenz und Transzendenz können niemals getrennt werden. Ich und Erscheinung bilden einen einheitlichen intentionalen Erlebniskomplex. Intentionalität ist wie ein ständiges Dahinfließen, wie ein Strom, in dem sich das Noema, der Inhalt der Intention, mit der Noesis, der intellektuellen Anschauung, vereint. „Ich spreche von erlebten Inhalten und nicht von Erscheinungen, erdachten Gegenständen oder Personen. All das, woraus sich das individuelle ‚erlebende’ (Hervorh. im Original) Bewusstsein reel konstituiert, ist erlebter Inhalt. Was es wahrnimmt, erinnert, vorstellt u. dgl., ist vermeinter (intentionaler) Gegenstand“ (Hua XΙX/1, 35). Phänomenologie - 113 - Aus dem Noema und der Noesis ergibt sich durch das intentionale Erlebnis der Gegenstand und um ihn herum der Horizont, die Welt in die er gestellt ist. „Gegenständlichkeit existiert nur als Pol eines intentionalen Gerichtetseins, das ihm seine objektive Bedeutung verleiht“ (Lyotard, 1993, 47). Das Phänomen selbst ist im Zusammenhang damit keine substantielle Einheit, es besitzt keine realen Eigenschaften, sondern es intendiert etwas, es meint etwas Gegenständliches, es ist das Bewusstsein von Etwas, es ist ein erlebter Bewusstseinsinhalt, der aufgehen kann im intentionalen Gegenstand oder selbst ein solcher Gegenstand ist. Im Gegensatz zu Descartes Überzeugung ist das Phänomen nicht aus realen Teilen bestehend, objektiv-kausalen Gesetzen unterworfen, nicht einmal nur als Erscheinendes zu erfahren, sondern in der Reflexion erschautes Erlebnis. Ein Gegenstand ist ohne wahrnehmenden Akt des Bewusstseins nicht denkbar. Deshalb können Gegenstand und Akt nur in ihrer Einheit verstanden werden64. Die Welt konstituiert sich nach Husserl erst in den Akten des intentionalen Bewusstseins, sie ist intendierter Gegenstand. In der phänomenologischen Reflexion ergründet das Bewusstsein den Sinn der Intentionen. Durch die Reflexion beobachtet der Phänomenologe die intentionalen Erlebnisse (vgl. Hua ΙΙΙ/1, 83). Sie ist die Grundlage für die phänomenologischen Analysen (vgl. ebd., 144). Dabei wird das Erleben und Wahrnehmen reflektiert, nicht der erlebte Gegenstand. Dieser revolutionäre Ansatz, die Denk- bzw. Bewusstseinsakte zum eigentlichen Gegenstand der Forschung zu machen und damit 64 Schmitz glaubt hingegen eine Scheidung von Objekt und Subjekt beobachten zu können: Die „Intentionalitätstheorie kann es nicht lassen, Akt und Gegenstand zu trennen“ (1968, 9). Sie verharre damit in der dualistischen Tradition, die auch unsere Sprache geprägt hat. Dies könne man u.a. daran erkennen, dass unsere (indogermanische) Sprache uns zwinge „jedes Geschehen mit Hilfe von Verben im Aktiv oder Passiv als ein Tun oder Leiden auszugeben, wodurch sich der Unterschied zwischen Akt und Gegenstand der Wahrnehmung als etwas ganz selbstverständliches und vom Sprecher jeweils schon Zugegebenes aufzudrängen scheint“ (ebd., 8). Akt und Gegenstand werden von Husserl in Wahrheit jedoch nur sprachlich getrennt, um so auf ihre Einheit hinweisen zu können. Unterbliebe dies, könnte man über diese Einheit nur schweigen. Phänomenologie - 114 - anzuerkennen, dass die Wirklichkeit durch die subjektive Apperzeption determiniert wird, läuft der verbreiteten „schlicht-objektiven Denkhaltung zuwider“ (Hua XΙX/1, 15). Die Schwierigkeit erwächst deshalb aus dem Denken in Objekten, dessen Ausdrücke für Erlebnisse sehr rar sind. Es gebe nur einige mehrdeutige Begriffe, die am Rande des Gebietes heimisch sind, welches die Sprache benennen kann: Empfindung, Vorstellung, Wahrnehmung (vgl. ebd., 16). Phänomenologie - 115 - 2.4.5 Fruchtbarkeit der Phänomenologie Husserls Die phänomenologische Wesensschau erschließt Gebiete, die der kritischen Methode entgehen und die die Wissenschaften übergehen. Sie tut das, indem sie unmittelbar und ursprünglich von den Intentionalitäten ausgeht, die unsere Welt konstituieren. Das phänomenologische Schauen als intuitive Haltung bezieht sich auf den ursprünglichen Bereich, vor aller Trennung in „Geistiges“ und „Sinnliches“. Damit stellt das „Schauen des Phänomenologen die ursprünglich gegebene Einheit wieder her, es heilt den Bruch, der auch noch in Kants Zweikomponententheorie des durch Raum und Zeit a priori gebildeten Substrats sinnlicher Anschauung gegenüber dem unanschaulichen Begriffsmäßigen des Denkens bestehen geblieben war“ (Redeker, 1993, 54). Die Phänomenologie bewegt sich somit in einer ursprünglicheren Schicht unserer Erfahrung als der, wo die kritische Reflektion beginnt. Sie entzieht sich damit dem analytischen Erkenntnisprinzip, da sie die Bedingungen eines solchen Ansatzes selbst untersucht. Deshalb kann Fink sagen, dass die Phänomenologie, anders als der Kritizismus, die Frage nach dem „Ursprung der Welt“ stellt, dieselbe Frage, die sich auch Religionen und Metaphysiken stellten (Zit. nach: Lyotard, 1993, 42/43). Die Suche nach absoluter Gewissheit von Erkenntnis, die Husserls Hauptziel war, hat wenig zu tun mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik. „Ihr Hintergrund ist eher religiöser, als intellektueller Natur“ (Kolakowski, 1986, 95). Sie ist eigentlich eine Suche nach Sinn, die in der Tat kultur-stiftend ist. Wissenschaft ist außerstande, uns mit dieser Art von Sinn und Gewissheit zu versehen. Der phänomenologische Erkenntnisansatz ist in seinem Versuch, zum erkenntnistheoretisch Absoluten zu gelangen, gescheitert, wie alle Versuche, die auf absolute Wahrheit zielten, vor ihm ebenso fehlschlagen mussten. Trotzdem ist Husserls Werk, sein Anstoß zum phänomenologischen Denken, ausgesprochen wertvoll, weil es uns, folgt man Kolakowski, zwingend mit folgendem „peinlichen Dilemma des Wissens“ (ebd., 96) konfrontiert: Phänomenologie - 116 - Wollen wir einem konsequenten Empirismus vertrauen, der durchaus entmutigend, wenig sinngebend und tatsächlich ruinös für die Kultur65 sein kann, oder bevorzugen wir einen transzendentalistischen Dogmatismus, der letztlich durch nichts bewiesen werden kann und deshalb ein willkürlicher Entschluss bleibt (vgl. ebd.). Über diese unbequeme Wahrheit hinaus erscheint die Phänomenologie als fruchtbare Alternative zur Erkenntnis von Wahrheit, insofern sie das neuzeitliche spirituelle Vakuum mit ursprünglicheren, wissenschaftlichen Erkenntnissen zu füllen versucht. Die Fruchtbarkeit der phänomenologischen Methode nährt sich füglich aus dem Umstand, dass sie sowohl eine Alternative zum mathematisch-wissenschaftlichen als auch zu dem spirituell-unwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn anbietet. In der Dimension der Intentionalität sind das Sinnliche und das Denkende noch nicht getrennt. Dieses Ursprüngliche ist nicht auf Mathematisches beschränkt, sondern es umfasst den gesamten Menschen. Das „Auffassen“ (Apperzipieren) der Phänomenologie regelt eine Haltung, die „das unentbehrliche Mittel zu einer permanenten Revision der Grundlagen“ (Plessner. Zit. nach: Redeker, 1993, 56) ist, was dem offensichtlichen Prozesscharakter der Welt Rechnung trägt. Sie ist ferner das „Gegengift gegen austrocknende, lähmende Prinzipien“ (ebd.), gegen rationale Disziplinierung, durch die der Wissenschaft der echte Kontakt mit dem Untersuchungsgegenstand verloren gehen kann. Die Erfahrung liegt dem objektiven Denken sicherlich zugrunde, selbst wenn das Erfahrungsorgan des Menschen, der Leib, schon objektiviert und gleichsam vergegenständlicht wurde. Die Erinnerung an diesen Umstand sieht Husserl auch als Therapie gegen die Lebensweltvergessenheit (vgl. Aguirre, 1982, 90f.). Deshalb kann er sagen, dass die wissenschaftliche Objektivität ihre Quellen, die sinnliche Erfahrung, vergessen hat. 65 Eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Skeptikern besteht und keinen Platz mehr hat für Menschen, die nach Gewissheiten und Sinn streben, wäre in der Tat arm und erbärmlich. Sie würde in der „Suppe der Nützlichkeit“ (Heinrich Heine) ertrinken und hätte wahrscheinlich erst gar keine „Kultur“ hervorgebracht. Phänomenologie - 117 - Weil Galilei und seinen Nachfolgern die Verbindung zu den Quellen verloren ging, aus welchen „die so genannte geometrische Anschauung, d.h. die mit Idealitäten operierende, allererst ihren Sinn schöpfte“ (Hua VΙ, 49), komme es zu einer „Unterschiebung“ der mathematischen Welt des Objektiven hinsichtlich der alltäglichen Lebenswelt (vgl. ebd.). Der Transfer von Konkretem in abstrakte Größen resultierte schließlich darin, „für wahres Sein zu nehmen, was eine Methode ist“ (ebd., 52). Die Naturwissenschaften erkennen nicht, dass die von ihnen gering geschätzten „bloß sinnlichen Qualitäten“, die konkreten Erfahrungen, nichts anderes sind als die Grundlage aller Naturwissenschaft. Deshalb bezeichnet Husserl die Lebenswelt als „vergessenes Sinnesfundament der Naturwissenschaften“ (ebd., 48). Die sinnliche Welt sei also der Boden für das objektivierende Tun der Wissenschaft und der Zweck dieses Tuns. Auch in der wissenschaftlichen Arbeit manifestiert sich also die menschliche Leistung des Subjekts, weshalb das objektiv-logische Ergebnis letztlich Teil der subjektiv-relativen Welt ist. Die objektiven Leistungen strömen gleichsam in die universal-konkrete Lebenswelt ein (vgl. ebd., 141). Diese konkrete Lebenswelt schließe das ObjektivLogische in sich ein, sie saugt es auf (vgl. Claesges, 1973, 100). Das bedeutet nicht, dass die Lebenswelt unsere Subjektivität überschreitet, sondern dass alles in der Welt subjektiv-relativ ist, aber das ObjektivLogische ist es „in einer anderen Weise“ (ebd., 101). „Der Rückgang auf die so genannten lebensweltlichen Voraussetzungen auch der Wissenschaft zeigt nur, wie sehr es der Mensch ist, der die Weltentwürfe alle insgesamt wagt. Dies vermag die Reflexion aufzudecken. Sie weist dann nach, dass z.B. auch die in Technik umgearbeitete wissenschaftliche Weltauffassung auf ganz bestimmten subjektiven Voraussetzungen beruht“ (Funke, 1966, 155). Husserls Werk bleibt insbesondere durch seinen Hinweis auf die Lebensweltvergessenheit der objektiven Wissenschaften fruchtbar. Er verdeutlicht dadurch die epistemologische Relevanz der subjektiven Erfahrung. Phänomenologie - 118 - Husserl lehnt die dualistische Sicht des Menschen als res extensa und res cogitans ab. Es gebe keine zwei getrennten Realitäten, die nur miteinander verbunden sind. Für ihn ist der Mensch nicht als „psychophysische Dualität, sondern als komprehensive Leib-Geist Einheit“ (Bäumer, 1993, 259) zu sehen. Der Mensch, sei „durch und durch seelenvoller Leib. Jede Bewegung des Leibes ist seelenvoll, das Kommen und Gehen, das Sitzen und Stehen, Laufen und Tanzen etc. Ebenso jede menschliche Leistung, jedes Erzeugnis und so weiter“ (Hua ΙΙΙ/1, 240). Nach Husserl sei der Leib etwas Drittes, jenseits der Dichotomie von materiellem Ding und immateriellem Geist. Er repräsentiere die Einheit des Menschen. Andererseits sei „alle Erkenntnis auf ihre intuitiven Urquellen im Bewusstsein, in der inneren Erfahrung zurückzuführen und aus diesen aufzuklären“ (Hua VΙΙ, 144). Wiewohl Husserls Überlegungen zunächst von dem gleichen Ansatzpunkt ausgehen wie die Descartes’, befürwortet er im Gegensatz zu jenem eine Aufwertung der seither als subjektiv verdammten Erfahrung, plädiert gleichsam für eine Renaissance der leiblichen Sinnlichkeit, die er als Nährboden für jede objektive Theorie auffasst. Warum monopolisiert Husserl angesichts dieser Einsicht weiterhin getreu der überkommenen Bewusstseinsphilosophie - das Bewusstsein? Wäre es an diesem Punkt nicht zwingend notwendig, den Leib und seine sinnlichen Erkenntnisfunktionen aufs gründlichste zu untersuchen? Einerseits gebe es keine zwei getrennten Realitäten und die Wirklichkeit sei demzufolge in der Einheit zu finden, die durch den Leib repräsentiert wird. Es ist bemerkenswert, dass er sich andererseits der virulenten Konsequenz seiner Lehre verweigert, indem er fortfährt, nur das „reine Bewusstsein“ zu untersuchen. Dieser ostentative Widerspruch lässt den Phänomenologen Husserl als Hypokrit erscheinen, denn er hält an einem Rationalitätsideal fest, das cartesianisch anmutet. Er gibt die Idee eines sich selbst vollkommen transparenten Subjekts nicht auf (vgl. Meyer-Drawe, 1984, 133ff.). Phänomenologie - 119 - Husserls Phänomenologie operiert hauptsächlich mit Kunstgriffen des Verstandes. Es bleibt dabei merkwürdig im Dunkeln, inwieweit die rationale Erkenntnisfunktion hinsichtlich bspw. der menschlichen Selbstbewegung überhaupt Erkenntnisfunktionen ertragreich werden im Rahmen ist. der Die sinnlichen Reduktion nicht thematisiert und füglich marginalisiert. So lässt die Forderung nach reiner Bewusstseinsimmanenz verbunden mit dem subjektiv-idealistischen Element der Husserlschen Phänomenologie diese als paradoxen Versuch erscheinen, eine theoriefreie Theorie zu schaffen66. 2.4.6 Kritische Betrachtungen Nach Waldenfels erweckt Husserls phänomenologische Lehre bisweilen den Eindruck einer distanzierten Beobachtung, einer „Abschirmung von aller Welt und Gemeinschaft“ (1970, 51). Die sinnlichen Empfindungen, der natürliche Instinkt würden übergangen und als „Selbstverlorenheit“ diffamiert. Aufgrund der erforderlichen ständigen geistigen Reflexion kann man bei Husserls Phänomenologie auch wohl tatsächlich nicht von einer sinnlichen Gegenwartsorientierung sprechen. Die phänomenologische Reduktion erscheint mitunter recht künstlich, weil mit der Ausschaltung der Welt ja auch das Ich selbst ausgeschaltet wird. Husserl räumt hinsichtlich des Vorgehens im Rahmen der transzendentalen Reduktion ein: „Tue ich so für mich selbst, so bin ich nicht menschliches Ich“ (Hua ΙX, 274). Das transzendentale Ego ist letztlich eine Erfindung, ein gedankliches Konstrukt, dessen Unterscheidung vom psychologischen (weltlichen) Ego nur intelligibel erscheint, wenn wir es oft genug wiederholen (vgl. Kolakowski, 1986, 52/53). „Aber das ist eine illusorische Intelligibilität“ (ebd., 53). Das ganze Verfahren der Einklammerung erinnert durchaus an das 66 „Was sie erschaut, hat sie erzeugt, um zu begründen, dass sie schaue. Die im Namen der Deskription so genannter Sachverhalte oder Vorfindlichkeiten des reinen Bewusstseins eingeführten Begriffe halten dafür her, im Rahmen der ‚Reduktion’ etwas wie eine strukturelle Einheit zu ermöglichen“ (Adorno, 1956, 136). Phänomenologie - 120 - mathematische Einklammern und könnte auf die mathematische Prägung Husserls zurückweisen. Überdies sei, so Heidegger, das reine Bewusstsein als thematisches Feld nicht phänomenologisch im Rückgang auf die Sachen selbst, sondern im Rückgang auf die traditionelle, bewusstseinsphilosophische Idee Descartes’ entstanden. „Sowohl der Seinscharakter des Bewusstseins als auch seine Intentionalität bleiben deshalb weiterhin ungeklärt“ (Heidegger, 1988, 147). In dieser Hinsicht folgt die phänomenologische Idee der Voraussetzungslosigkeit ihrem eigenen Grundsatz nicht, weil sie das Sein des Bewusstseins als apriori gegeben annimmt und nicht weiter hinterfragt. „Wesenlos bleiben die Wesen, mit denen der willkürliche Gedanke des Subjekts dem verödeten Seienden Ontologie einzubilden sich vermisst“ (Adorno, 1956, 134). Der reale Gegenstand selbst, die Welt sei, laut Husserl schon da vor aller künstlichen Erzeugung und Herleitung. „Die ontologische Frage wird einfach vernachlässigt“ (Kolakowski, 1986, 53). Die Gegebenheit des Dinges in der Welt, des Noematischen, gilt Husserl als gewiss. Das Sein der Welt wird einfach affirmiert: „Die Welt ist“ (Hua VΙΙΙ, 36). Es komme nur darauf an, die Wahrnehmung (Apperzeption) des Gegebenen, die Noesis, zu beleuchten. Da das Gegebene Teil des Subjekts sei, brauche der Phänomenologe es nicht mehr zu denken, sondern ohne Gefahr des Irrtums nur noch hinzunehmen. Husserl setzt die erkennbaren Tatsachen voraus, blendet die Frage nach dem Sein überhaupt aus, um seine Überlegungen ganz auf die Art und Weise des Erkennens des Bewusstseins zu konzentrieren. Heidegger griff die bis dahin ungeklärte Frage nach dem Sein des Daseins, seiner ganzheitlichen Grundstruktur der von ihm so getauften „Sorge“ (Heidegger, 1993, 191f.) - auf und kritisiert seinen Lehrer, weil er dies versäumt habe: „Vorhandenes! Aber das menschliche Dasein „ist“ so, dass es, obzwar Seiendes, nie lediglich vorhanden ist“ (Heidegger. Zit. nach: Hua ΙX, 274, Fußnote 2). Aus phänomenologischer Sicht kam es Heidegger inkonsequent vor, das Sein als Gegebenes einfach ungeprüft vorauszusetzen. Dieses „Dogma von der Urgegebenheit (…) von dem Gegebenen, als absolutem Besitz des Phänomenologie - 121 - Subjekts, bleibt der Fetisch auch des Transzendentalen“ (Adorno, 1956, 145). Adorno sieht hierin sogar eine positivistische Tendenz der Husserlschen Phänomenologie. Husserl übernahm die Unterscheidung zwischen psychischen intentionalen Akten und physischen Objekten von Brentano und konstatierte ein transzendentales Bewusstsein, das von den Körperobjekten zu unterscheiden sei. „Die Unterscheidung zwischen den immanenten Gegebenheiten und den transzendenten Gegebenheiten, auf die Husserl die erste Trennung von Bewusstsein und Welt gründet, ist noch eine weltliche Unterscheidung“ (Lyotard, 1993, 43). In diesem zentralen Punkt bleibt er der dualistischen Tradition, die Bewusstsein und Körperobjekt trennt, anscheinend verhaftet und erschwert dadurch selber das von ihm propagierte unvoreingenommene Schauen des Wesens der Dinge, welches ja jenseits aller gedanklichen Trennung existiere. Der mächtige Einfluss des rationalistischen Denkens veranlasse ihn dazu, gleichsam „neuen Wein in alte Schläuche zu gießen“ (Schmitz, 1980, 7). Das transzendentale Ich ist erst durch eine künstlich gedachte Abspaltung von der Welt entstanden und soll dann als Instrument zur Erkenntnis der Welt vor dieser Spaltung fungieren. Auch wenn Husserl durch seine Phänomenologie den Grundstein für die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung gelegt hat, „bleibt er dem cartesianischen Dualismus von res cogitans und res extensa noch ganz verpflichtet“ (Becke, 1999, 32). Diese Trennung am Anfang der Phänomenologie diene dazu, mit dem durch sie geschaffenen transzendentalen Ich die Einheit der Welt erkennen zu können. Husserl kritisiert in der Krisis ja auch ausdrücklich die Physikalisierung durch den cartesianischen Dualismus (vgl. Hua VΙ, 61/62/216f.). In dem von ihm ausgewiesenen transzendentalen Bewusstsein, Phänomenologie - 122 - „in dieser erkennenden Subjektivität, diesem transzendentalen Ich bündeln sich nicht, wie Empiristen meinen, Vorstellungsatome oder Wahrnehmungspartikel, die das Bewusstsein von außen treffen und die es passiv und rezeptiv aufnimmt, um es dann – nach Abgleichung mit Bildern in seinem Inneren – als Repräsentanten bestimmter Dinge und Sachen zu identifizieren. Vielmehr stiftet dieses Bewusstsein dauernd Einheit und Sinn, bevor es eventuell beginnt das Erkannte und Wahrgenommene zu zergliedern und zu analysieren“ (Danzer, 1995, 114). Der sinnliche Leib scheint durch diesen Erkenntniszugang übergangen zu werden, weil sinnliche Erkenntnisfunktionen in Husserls Phänomenologie nicht hinreichend zur Geltung gebracht werden. Die im Rahmen der transzendentalen Phänomenologie übergangene Leiblichkeit wird dadurch deutlich, dass das transzendentale Ego „niemals sterben zu müssen scheint. Es braucht seinen Leib allenfalls, wenn es vom Schreibtisch ein paar Schritte tun muss, um ein Ding von verschiedenen Seiten sehen und so zugänglicher beschreiben zu können“ (Pöggeler, 1990, 74). Dennoch erscheint eine phänomenologische Perspektive prinzipiell außerordentlich wertvoll, das Subjekt im Erkenntnisprozess wieder zu gewinnen. Allerdings muss eine solche phänomenologische Perspektive vor allem auch leibliche Erkenntnisfunktionen des Menschen in Betracht ziehen. Sie ist zwar auch dann noch beschränkt, wie dies eine einzelne Perspektive notwendig immer sein muss; dennoch scheint sie dem ganzheitlichen Wesen des Lebendigen weitaus besser Rechung tragen zu können, zumal es sich bei ihr ja gerade nicht um ein fertiges, dogmatisches Welterklärungskonzept handelt, sondern um einen prinzipiell offenen Ansatz. Der phänomenologische Ansatz, der das Subjekt wieder zu gewinnen versucht, muss zudem selbiges als leiblich thematisieren. Es ist Husserls Verdienst, den Weg der Phänomenologie aufgezeigt zu haben; beim Voranschreiten in die von ihm gewiesene Richtung sind noch viele fruchtbare Erkenntnisse zu gewinnen. Zwar hat er die Trennung von Subjekt und Welt überwunden, die cartesianische Spaltung Phänomenologie - 123 - des Subjekts in Verstand und Körper scheint er allerdings beizubehalten. Von daher hat Husserl den Dualismus nur halb auflösen können. Schließlich ist es ihm nicht gelungen konsequent zu prüfen, welche Rolle die Leiblichkeit im Rahmen des phänomenologischen Erkenntnisansatzes einnimmt. Er gerät gleichsam in den Fallstrick der rationalistischen Bewusstseinsphilosophie, die die Bedeutung der menschlichen Leiblichkeit nicht hinreichend berücksichtigt. Um diesem Mangel konstruktiv begegnen zu können wird nachfolgend der erkenntnistheoretische Rahmen der Phänomenologie ausgedehnt, indem existenzialistische Überlegungen Erkenntnisvermögen eingeführt werden. hinsichtlich leiblicher Phänomenologie - 124 - 2.5 Überlegungen zu einem weiterführenden Ansatz Es erscheint folgerichtig als Aufgabe einer Phänomenologie der Leiblichkeit - die gleichwohl auf Husserls Gedanken aufbaut - die Erkenntnisquelle des Leibes ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Heidegger hat dieses Thema in seinem Hauptwerk Sein und Zeit vertagt (vgl. 1993, 111/112); bei Merleau-Ponty wird dieser Aspekt hingegen aufgenommen und ausführlich betrachtet. Er hat zusammen mit Sartre phänomenologische Analysen des Leibes vorangetrieben und dadurch die französische Phänomenologie der leibhaften Existenz maßgeblich geprägt (vgl. Waldenfels, 1992, 53f.). Das heißt, er versteht die „Leiblichkeit als Angelpunkt der Welt“ (Merleau-Ponty, 1966, 106), als „Angelpunkt der menschlichen Erkenntnisentwürfe“ (Waldenfels, 1992, 58). Diese Erkenntnishaltung erscheint geeignet, dualistische Denkweisen gleichsam zu unterlaufen, indem der Einheit von Subjekt und Welt die Einheit von Geist und Leib zur Seite gestellt wird. 2.5.1 Die französische Philosophie der leiblichen Existenz Wenn man mit ihnen darüber nachdenkt, was der Leib eigentlich sei, scheint es unerlässlich, auf seine verschiedenen Seinsdimensionen hinzuweisen, die sich von jenen anderer Naturgegenstände erheblich unterscheiden, weil diese nicht lebendig sind. Gleichwohl erscheint der Leib, wie jeder andere Naturgegenstand, immer in Abhängigkeit von einer bestimmten Perspektive, die ihn allererst definiert. Die Gegenstände sind „an Perspektiven gebundene Anblicke“ (MerleauPonty, 1966, 95); so auch der Leib. Vergleichbar etwa mit den Quanten im subatomaren Bereich ist die Natur des Leibes mehrdeutig. Diese Ambiguität ergibt sich zweifellos aus den verschiedenen Perspektiven, die ihm gegenüber eingenommen werden können. Gleichzeitig kann der Leib nur auf polyperspektivische Weise in seiner ureigenen und realen Mehrdimensionalität erkannt werden. Man darf also die eine Erscheinungsform des Leibes, die durch nur eine perspektivische Ansicht zum Vorschein kommt, nicht mit seinem gesamten Sein verwechseln. Phänomenologie - 125 - Von einem physikalischen Standpunkt aus erscheint der Leib vor allem als Gegenstand unter den anderen Objekten in der Welt. Gemäß einer solchen Außenbetrachtung ist es klar, dass er dann als „lebendiger Gegenstand“ erscheint, „bestehend aus einem Nervensystem, einem Hirn, Drüsen, Verdauungs-, Atmungs-, und Kreislauforganen, deren Materie selbst chemisch in Wasserstoff-, Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphoratome usw. analysierbar ist“ (Sartre, 1991, 398). Sartre weist darauf hin, dass der Leib von dieser Perspektive aus als der „Leib-fürden-Anderen“ (1991, 439) erscheint, als „Leib an sich“ (Merleau-Ponty, 1966, 107). Auch wenn ich meinen eigenen Leib von einer distanzierten Position aus anblicke, etwa wenn ich meinen verletzten Arm begutachte oder ihn berühre, erfasse ich ihn zuvorderst als ein „Stück in der Welt. Zweifellos habe ich selbst bei einer Röntgenuntersuchung meine Wirbelsäule auf dem Schirm abgebildet gesehen, aber da war ich eben genau außen, ein Stück in der Welt. Ich erfasste einen völlig konstruierten Gegenstand als ein ‚Da’ inmitten von anderen ‚Da’, und nur durch einen Vernunftschluss setzte ich ihn als meinen: er war vielmehr bloß mein Eigentum als mein Sein (Hervorheb. im Original)“ (Sartre, 1991, 399). Diese Außenperspektive auf den Leib, die ihn als Gegenstand auffasst, entspricht einer mechanistischen Sichtweise. Die Beschränktheit dieser Perspektive ist leicht daran zu erkennen, dass sie den Leib auf nur eine Seinsdimension begrenzt, genauer: dass sie nur eine Art des Leibseins sieht. „Das Sein, das mir so geoffenbart wird, ist Sein-für-Andere (Hervorheb. im Original)“ (ebd., 1991, 400). Diese bestimmte Seinsdimension ist die physikalische. Die eigentliche Beschränkung wird aber erst dadurch inauguriert, dass die Erkenntnisse, die aus dieser einzelnen Perspektive stammen, mit denen, die aus einer polyperspektivischen Hinsicht resultieren würden, verwechselt werden, wenn also eine Sichtweise verallgemeinert und als allgemein gültig gesetzt wird. Dieses führt zu gründlichen epistemologischen Verwirrungen. Es ist ja nicht zu leugnen, dass der Leib noch aus anderen Perspektiven betrachtet werden kann, die andere Seinsdimensionen sichtbar werden lassen. Phänomenologie - 126 - Diese zweite Dimension des Leibes kann nicht von einer äußeren Ansicht her beschrieben werden, denn es handelt sich bei dieser Seinsdimension um den Leib, wie er mir selbst erscheint, also wie ich „meinen Leib existiere“ (Sartre, 1991, 454). Zur Erkenntnis dieser Dimension ist es notwendig, eine innere Perspektive zu beziehen, die allein mir Erkenntnisse über meine Empfindungen offenbaren kann, die die „Faktizität“ des Leibes als „Für-sich-sein“ (ebd., 401) sind. Das zentrale Problem, insbesondere mit Hinblick auf Selbstbewegung, die von Innen her initiiert wird, ergibt sich aus dem Umstand, dass die subjektive Seinsdimension des Leibes, die der objektiven Ebene konstituierend zugrunde liegt, aus objektiver Perspektive nur schwer erkannt werden kann. Diese scheinbar unüberwindliche Schwierigkeit erwächst aus der Tatsache, dass ich nicht in den Anderen hineinsehen kann, um seine inneren Empfindungen zu kennen, die Grundlage für sein äußeres Verhalten sind und diesem überhaupt erst einen Sinn geben. Zum Verständnis der Innenperspektive des Anderen benötige ich also angemessene Erkenntnisfunktionen. Begnügt man sich mit objektivierenden Erkenntnisansätzen, begeht man den schweren Fehler, die aktive Selbstbewegung von Subjekten mit dem passiven beweget werden von Objekten verwechselt. Die zwei Existenzebenen des Leibes müssen nun ausführlicher dargestellt werden, um aus dieser ontologischen Betrachtung epistemologische Anhaltspunkte gewinnen zu können. Die müssen darauf zielen, das leibliche Erkenntnisvermögen des Subjekts zu beleuchten. 2.5.2 Mein Leib als Tatsächlichkeit Eine phänomenologische Betrachtung des Leibes enthüllt ihn gleichzeitig als lebendigen Gegenstand und als gelebten Leib. Für Andere ist mein Leib zunächst ein Objekt unter anderen Objekten in der Welt, über die er selbst prinzipiell verfügen kann. Analog dazu ist der Leib Anderer für mich zuerst Objekt-für-mich. Er ist dem primären Anschein nach Werkzeug, „potenzielles Zeug“ (Heidegger, 1993, 131). Phänomenologie - 127 - Für mich ist mein Leib erst sekundär ein „Zeugding“ (ebd.) und zuvorderst mein gelebter Zugang zur Welt, durch den ich die Objektwelt allererst erkennen kann. Er ist die lebendige Voraussetzung für mein Sein zur gegenständlichen Welt, die ich mir erst im Anschluss daran unter Umständen nutzbar machen kann. Von daher scheint es geboten, den Leib zunächst in seiner faktischen Dimension des Für-sich-seins zu betrachten, um überhaupt zu einem Verständnis des Objektleibes zu gelangen. Sartre weist darauf hin, dass viele Denker bei der Untersuchung des Leibes von der objektiven Außenperspektive, gleichsam von der sekundären Erscheinungsweise des Leibes ausgegangen seien und damit „das Problem völlig auf den Kopf gestellt“ (1991, 462) haben. Was ist das nun: Mein Leib, der sich der objektiven begrifflichen Fassung weitgehend entzieht und der sich mir vielmehr durch meine subjektiven Empfindungen kundtut? Um das Sein zu beschreiben, ist Heidegger davon ausgegangen, dass der Mensch nicht einfach ist, sondern zu jeder Zeit bereits in der Welt ist. Dieser Gedanke des „In-derWelt-seins“ beinhaltet die zutreffende Annahme, dass der Mensch und also sein Leib als „Für-sich-Sein“ immer schon in bedeutungsgeladener Beziehung zu der Welt an sich stehen. Deshalb kann Sartre sagen: „Es gibt das nicht: auf der einen Seite ein Für-sich, auf der anderen Seite eine Welt, sozusagen zwei geschlossene Ganze, für die man dann die Weise ihres Verbundenseins suchen müsste“ (1991, 401). Eine solch überkommene Haltung ist dem cartesianischen Dualismus entsprungen, „der immer nur bis Zwei zählen kann“ (Mittelstrass, 1991, 13). Sein Blick auf den Menschen spaltet mein faktisches Dasein in einen „gelebten Leib und einen erkannten Körper“ (Waldenfels, 1992, 58). Das Sein sei durch den dualistischen Blick „zerrissen“ (ebd.). In Wirklichkeit vollzieht sich die Einheit von Leib und Seele „von Augenblick zu Augenblick in der Bewegung der Existenz selbst“ (Merleau-Ponty, 1966, 114). Mein Leib ist genuin nicht nur in der Welt, sondern immer auch Phänomenologie - 128 - schon zur Welt; er trägt sich der Welt in jeder Situation mit all seinen Möglichkeiten entgegen, um sie zu erfahren. 2.5.2.1 Zur-Welt-sein Merleau-Ponty hat das leibliche Merkmal des „Zur-Welt-seins“ aufgedeckt und diese Einsicht seinem gesamten Werk aufs Gründlichste einverleibt. Sein Hauptinteresse ist dabei auf das Menschliche gerichtet, also nicht auf bloße Reiz-Reaktions-Mechanismen. Er wird angetrieben von der Frage nach der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt sowie einem Faktor, der dem Dualismus von Subjekt und Objekt ein Ende setzt: Die Natur der Wahrnehmung. Wenn diese wirklich, „konstitutiv von Seiten des Subjekts und präsentierend von Seiten des Objekt (ist), dann vermengen sich die beiden – Subjekt und Objekt – darin“ (Konstantinovic, 1973, 148)67. Merleau-Ponty spricht von einer „horizontalen Verklammerung“ von leiblichem Organismus und Umwelt im Verhalten (vgl. 1976, 140). Auch Viktor von Weizsäckers Gestaltkreis beschreibt die Relation von Mensch und Welt als Dialog zweier gleichberechtigter Partner, als dialektisches Verhältnis (vgl. ebd., 165)68. Durch situativ variierende Wechselwirkung entstehe ein ausbalanciertes Verhältnis, ein „biologisches Gleichgewicht“ (ebd.). Merleau-Pontys Begriff der Dialektik beinhaltet sogar ein noch weitergehendes Verständnis der Idee der Wechselwirkung, welches keinen Widerspruch mehr in sich enthalten soll: 67 In ähnlichem Zusammenhang kritisiert Schmitz den Deutungsansatz der Wahrnehmungspsychologie anhand eines Hegel-Zitats: Ein Akt des Sehens oder Hören und ein gesehenes Objekt zu unterscheiden scheine zwar „ganz trivial und selbstverständlich“, doch die Entgegensetzung von Objekt und Subjekt falle in der Anschauung selbst weg, ihre Verschiedenheit ist nur eine Möglichkeit der Trennung“ (Zit. nach: Schmitz, 1968, 8/35). Gerade beim schlichten, hingegebenen, ungehemmten Wahrnehmen schwinge der Leib gleichsam mit den Dingen und Themen, womit sich der Mensch gerade befasst, mit. Der spürbare Leib sei dann gleichsam in das Wahrgenommene ergossen (vgl. ebd., 45). 68 In dem Gestaltkreis bemerkt Viktor v. Weizsäcker: „ Ich sehe diesen Vogel“ oder „Ich fühle diesen Schmerz“ – in der Aktualität dieser Wahrnehmung ist zunächst nichts von einer Trennung oder einem Neben- oder Nacheinander von Ich und Gegenstand enthalten; wenn, dann wären in der Wahrnehmung selbst diese beiden verbunden und in Begegnung verschmolzen (vgl. 1947, 121). Phänomenologie - 129 - „Dialektik ist nicht ein Verhältnis zwischen einander widersprechenden und doch voneinander unablöslichen Gedanken: sondern die Spannung der Existenz auf eine andere Existenz hin, die sie verneint, und ohne die sie doch sich selbst nicht aufrechtzuerhalten vermag“ (1966, 200). Merleau-Ponty beschreibt hiermit eine grundsätzliche Ambivalenz aller Grundverhältnisse, die auf den relativen Charakter der Welt zurückweist. Das heißt, das Subjekt-Objekt Verhältnis ist durch instabile, gleichzeitige und gegenseitige Beeinflussung ausgezeichnet: Es ändert sich in jeder Situation, es genügt nicht einer zeitlich strukturierten Abfolge, und Bedingungen führen ebenso zu Ursachen, wie Ursachen zu Bedingen führen (vgl. ebd., 1976, 147). Es handelt sich dabei um eine totale Wechselwirkung, in dem Sinne, dass sie situativ, zeitgleich und wechselseitig ist. Deswegen lässt das Subjekt die Dinge erst durch sein Sein sein und vice versa. In Anbetracht dieser Einsicht erscheint die objektivistische Perspektive, die an alle Phänomene von außen herantritt und bei der Natur an sich endet, als obsolet. Sie sieht sich einer subjektivistischen Perspektive reziprok gegenüber, die alle Phänomene von innen her erschließen will und bei einem reinen Bewusstsein endet. „Der lebendige Bezug zwischen Bewusstsein und Natur wird zerrieben zwischen äußerer wissenschaftlicher Explikation und innerer philosophischer Reflexion“ (Waldenfels, 1983, 149). Vor dem Hintergrund dieses Umstandes sieht Merleau-Ponty eine Notwendigkeit, die tradierte Sichtweise zu ändern. „Man muss Kategorien revidieren, die – solange man an ihnen festhält – den ständigen Konflikt zwischen dem positiven Wissen und der Philosophie immer wieder aufleben lassen und ein reichhaltiges, aber blindes empirisches Wissen mit einem philosophischen Bewusstsein konfrontieren, das zwar einen Blick hat für die Eigenart des Menschen, aber nicht weiß, das es entstanden ist, und vor dem die äußeren Ereignisse, die es am direktesten angehen, ohne Sinn bleiben“ (Zit. nach: ebd.). Phänomenologie - 130 - Merleau-Ponty vermutet diesseits von reinem Subjekt und reinem Objekt eine „dritte Dimension“, in der sich die zwei scheinbar konträren Komponenten nicht mehr widersprechen. Der Leib eröffne diese dritte Dimension, diesseits von „reinem Bewusstsein und reiner Natur; diesseits auch von reflexivem und positivem Wissen“ (Waldenfels, 1983, 149; 1992, 60). Merleau-Ponty fasst die Sinnlichkeit in Form des Leiblichen als ein Zwischen, als Drittes zwischen Innerem und Äußerem auf, welches diesen als Ursprüngliches vorausliegt. Dieses Sinnliche sei, so Merleau-Ponty, nicht durch ein nur denkendes cogito zu erfassen, sondern eines, das seine Existenz durch sein „Zur-Welt-Sein“ definiert. „Das wahre cogito definiert die Existenz des Subjekts nicht durch sein Denken zu existieren (…) Vielmehr lässt es mein Denken selbst noch als unaufhebliches Faktum erkennen und schließt jederlei Idealismus aus, indem es mich selbst entdeckt als ‚Zur-Welt-sein’ (Hervorheb. im Original)“ (Merleau-Ponty, 1966, 10). Dieser Überzeugung zufolge ist der Mensch eingebunden in die Umstände der ihn umgebenden und auch maßgeblich beeinflussenden Umwelt. In diesem Spannungsverhältnis zwischen Ich und Welt ist vor allem die Gerichtetheit des Subjekts entscheidend, seine Intentionalität, die wiederum die Wahrnehmung prägt. Subjektivität zeichnet jeden Leib allererst aus, noch bevor er überhaupt beschrieben werden kann. Ausgehend von Heideggers „In-der-Welt-sein“ gelangt Merleau-Ponty so zu der Vorstellung des „Zur-Welt-seins“. Das bedeutet, man ist in jeder Situation leiblich auf die Welt gerichtet und handelt stets in der dargelegten Form der Wechselwirkung mit der Umwelt. Der sinnliche Leib erscheint aus dieser Perspektive nicht als Instrument, „nicht als Gegenstand der Welt, sondern als Mittel unserer Kommunikation mit der Welt“ (Merleau-Ponty, 1966, 117), gleichsam als Schnittstelle zwischen Subjekt und Objekt. Der Leib ist das Medium meines Zur-Welt-seins. „Der Mensch ist zur Welt, er kennt sich allein in der Welt“ (ebd., 464). Aus dieser Perspektive ist der Leib der gelebte Zugang zur Welt. Phänomenologie - 131 - Das reine Denken ist ohne die leibliche Sinnlichkeit von der realen Umwelt grundsätzlich isoliert, unfähig sie wahrzunehmen69. Es wird für seine synthetischen Analysen ständig auf den Leib als Zulieferer verwiesen. „Was ehemals sich als Dirigent wähnte, der Geist, erscheint nun als das untergründig dirigierte“ (Schmidt-Millard, 1995, 103/104)70. Für die Theorie des Erkennens bedeutet dies, dass der Leib aufgewertet werden muss. Er erscheint weniger als stummer Zulieferer von Sinnesdaten denn als mundane Repräsentation des der Welt intentional zugewandten Subjekts, das alles Denken mit verkörpert und für uns unbemerkt beeinflusst. 2.5.2.2 Präobjektivität „Mit der Verwandlung des Bewusstseins in eine leibliche Existenz, die selbst dem zugehört, was sie konstituiert, ändert sich das transzendentale Gefüge grundlegend“ (Waldenfels, 1992, 59). Das leibliche Verhalten verteilt sich nicht auf blinde Mechanismen und bewusste Akte, es antwortet auf den Anspruch einer Situation und ist darin zu Neuem fähig, das sich geltenden Regeln entzieht. Die „fungierende Intentionalität ist in der Wahrnehmung stets schon am Werk. Die Wahrnehmung ist, wie auch der Leib, ein Grundphänomen, vergleichbar mit der Zeit“ (ebd., 60; ebd., 2000, 15). Deswegen ist das Verhältnis des Objektes zum Erkennenden in seinem Verstehen immer schon mit einbegriffen. Jedes unmittelbare Begreifen beinhaltet ein Selbstverstehen – vor aller Objektivierung in der Aussage (vgl. Landgrebe, 1969, 140). Von diesem Standpunkt aus erscheint der Leib als Medium zur Welt und zugleich als eine Verankerung in der Welt (vgl. Merleau-Ponty, 1966, 171/176). Für sich genommen ist der Leib weder Ding noch Bewusstsein, sondern eine unentbehrliche Vorgabe meiner selbst; er ist „mein Angelpunkt der Welt“ (ebd., 106), Standpunkt und Ausgangspunkt 69 „Begriffe ohne Anschauungen sind leer“ (Kant). Kant hat zur Veranschaulichung dieser Einsicht die Metapher einer Taube gezeichnet, die ohne den Luftwiderstand nicht fliegen kann. 70 Phänomenologie - 132 - zugleich. Deshalb kann Merleau-Ponty schreiben: „Ich bin selbst mein Leib“ (1966, 234). Der Leib wird durch seine subjektive Wahrnehmung zu dem „Organ einer ursprünglichen Sinnbildung“ (Waldenfels, 1983, 168). Er prägt meine Selbsterfahrung grund-legend. Die Sinneswahrnehmung ist als ein Prozess zu begreifen, der noch vor der begrifflichen Verarbeitung stattfindet, sie ist vorprädikativ. Deshalb kann ich auch den Prozess des Sehens oder Fühlens nicht erkennen. „Ich kann nicht probeweise meinen Leib verlassen, damit ich ihn als meine Wohnung überseh’. Ich kann mein Bild nicht auf dem Spiegel fassen, auch dort nicht lassen, wenn ich geh’“ (Schulte, 1979, 8). Ich kann sehend Objekte erkennen und auch mein Auge mithilfe eines Spiegels als Objekt betrachten, aber keinesfalls kann ich das Sehen sehen. Sartre zitiert hierzu Comte: „Das Auge kann sich selbst nicht sehen“ (1991, 413), weil das augenblickliche Sehen immer schon vergangen ist, sobald ich darüber nachsinne. Gleiches gilt für meinen gesamten Leib: Er ist das ständig „Überschrittene“ (ebd., 425) und entwirft sich unaufhörlich in Beziehung zur Welt; er trägt sich ihr entgegen. Ich überschreite meinen Leib in der stets schon vergangenen Gegenwart auf die Welt hin, die dadurch für mich ist. Das heißt, ich „überschreite die Welt und lasse sie im Überschritt über sie für mich sein“ (ebd., 426). Merleau-Ponty bezeichnet das „Zur-Welt-sein“ als „präobjektive Sicht“ (1966, 104), insofern sich der Leib schon vor einem etwaigen objektiven Denkvorgang anschickt, den Dingen zu begegnen, die sich zu jedem Zeitpunkt fragend an ihn wenden. „Wesensnotwendig geht die Wahrnehmung über sich selbst hinaus auf das Handeln zu“ (Sartre, 1991, 420). Sie kann sich überhaupt nur durch Handlungsentwürfe enthüllen. „Der Intellekt ist sekundärer Natur“ (Schopenhauer, 1966, 847). Aus der präobjektiven Sicht des Zur-Welt-seins sind alle Erkenntnisse der Wissenschaften nur Erfahrungen aus zweiter Hand. Sartre spricht in diesem Zusammenhang von einem „präreflexiven Bewusstsein“ (1991, 413). Vor aller objektiven und wissenschaftlichen Festlegung bin ich immer schon zur Welt durch das Vehikel meines Leibes (vgl. Merleau- Phänomenologie - 133 - Ponty, 1966, 106). Dies ist das wesentliche Merkmal der leiblichen Existenzebene des Für-sich-seins, meines tatsächlichen Leibes. Eine objektiv-wissenschaftliche Sicht auf den Leib entspricht hingegen der Perspektive, die ich dem Leib eines Anderen bzw. er meinem Leib gegenüber hat. In diesem Fall sehe ich den fremden Leib zunächst als Objekt, das sich mir zeigt und das mir potenziell zuhanden ist. Die Dimension des Für-sich-seins des Anderen erscheint mir dabei nur auf sublime und mittelbare Weise. Dennoch ist es für das Verstehen des Anderen unverzichtbar, das Augenmerk auf sein aktuelles Für-sich-sein zu richten, das seine Handlungen allererst mit Sinn und Bedeutung ausstattet. 2.5.3 Der Leib-für-Andere Auf mechanistischem Standpunkt erscheint der Leib in seiner zweiten Dimension: Als physikalisches Naturobjekt an sich. Von hier aus betrachte ich daher den „Leib (…) als einen unter den Gegenständen dieser Welt“ (Merleau-Ponty, 1966, 95). Ich muss mich meiner perspektivischen Erfahrung nicht widersetzen, um den Leib eines Anderen als Objekt zwischen anderen Objekten in der Welt aufzufassen, denn das subjektive Für-sich-sein seines Leibes erscheint mir ja ohnehin nur untergründig. Von außen trete ich also an die Gegenstände heran. In Ermangelung einer Einsicht in die subjektiven Empfindungen des Anderen sehe ich seinen Leib bald nicht mehr als einmalig und persönlich, sondern als verallgemeinerbar. Korrespondierend sehe ich ihn nicht länger aus meiner Perspektive, sondern von überall her – „objektiv“. Auf diese Weise wird der Leib allgemeingültig gesetzt. Diese Setzung eines Gegenstandes überschreitet die perzeptive Erfahrung und ist prinzipiell nur möglich durch einen „polythetischen Akt“ (ebd.), der dem Einzelnen nicht verfügbar ist. Deshalb wird ein Gegenstand als Phänomenologie - 134 - identisch für jedermann, für alle Zeit und jeden Ort angenommen: Der Gegenstand als Objekt71. Die Idee eines Gegenstandes, als Substitution des eigentlichen Gegenstandes, bildet eine objektive Welt, in der von der Erfahrung zur Idee übergegangen werden muss (vgl. Merleau-Ponty, 1966, 96). Durch das objektive Denken verlieren wir füglich jeden Kontakt mit der perzeptiven Erfahrung. Deswegen schreibt Merleau-Ponty: „Die absolute Setzung eines Gegenstandes ist der Tod des Bewusstseins, da sie (…) alle Erfahrung erstarren lässt“ (ebd.). Diese Setzung ist bereits sekundär und keine uroriginale Erfahrung mehr, weil der aktuell erfahrende Leib aus der Betrachtung ausgegrenzt bleibt. Die der Betrachtung zugrunde liegende Erfahrung wird überhaupt nicht mehr beachtet. Der erlebende Leib wird dann von außen betrachtet, als Objekt, das Stück der gegenständlichen Welt ist. Diese Objektivierung setzt ein getrenntes Sein von verschiedenen Leibesdimensionen voraus, nämlich das Für-sich-sein, also das Empfinden und Wahrnehmen meines eigenen Leibes, und das An-sich-sein, also den physiologischen Körper. Aufgrund dieser gedanklichen Trennung der zwei Ebenen kommt es zu einer verzerrten Erkenntnis des Leibes, den ich ja nur verstehen kann, „indem ich selbst dieser einer Welt sich zuwendende Leib bin“ (ebd., 99). Und zwar bin ich, und auch jeder Andere, in Wirklichkeit zuallererst dieser gelebte Leib. Erst aus objektivierender Sicht reduziere ich den Leib zum physikalischen Körpergegenstand. Solche „Beschneidung“ geschieht phänomenologisch gesehen - a posteriori. Diese Ordnung schlägt auch Sartre in seiner Leibanthropologie vor, wenn er zunächst den „Leib als Für-sich-Sein“ (1991, 401f.) analysiert und erst danach auf den „Leib für-den-Anderen“ (ebd., 439f.) eingeht. Dabei betont er, dass diese zwei Aspekte des Leibes keinesfalls tatsächlich voneinander getrennt seien, sondern dass sie höchstens zu analytischen 71 „Auch das bin ich: Auf der anderen Seite Objekt, tot“ (Schulte, 1979, 13). Phänomenologie - 135 - Zwecken vorübergehend geteilt beleuchtet werden können; sie „sind streng untrennbar voneinander“ (ebd., 454). In Analogie zu Sartres Gedanken des zweidimensionalen Leibes weist Merleau-Ponty auf eine ihm entstammende „Zweideutigkeit des Wissens“ hin, die darauf zurückzuführen sei, dass „unser Leib in sich gleichsam zwei unterschiedliche Schichten trägt, die des habituellen und die des aktuellen Leibes“ (1966, 107; vgl. Waldenfels, 2000, 181f.). Die Zwei Seinsdimensionen werden an folgendem Beispiel genauer erörtert. 2.5.4 Phantomglied Man kann sogar seinem eigenen Leib gegenüber eine objektive Position beziehen, obwohl diese immer sekundär und also dem gelebten Leib nachgeordnet bleibt. Man sieht diesen dann in jener Weise, in der man den Leib des Anderen erblickt. Durch eine gedankliche Distanzierung betrachte ich meinen Leib dann als Gegenstand. Um zu veranschaulichen, dass ich auch meinem eigenen Leib gegenüber zwei Perspektiven einzunehmen imstande bin, zieht Merleau-Ponty das Phänomen des Phantomgliedes heran. Dieser Begriff bezeichnet ein amputiertes mithin fehlendes Glied, in dem beispielsweise Kriegs- oder Verkehrsverletzte bisweilen immer noch Schmerzen empfinden. Die Betroffenen sehen ihren Leib dabei, offenbar durch die Macht der Gewohnheit, weiterhin als voll funktionsfähigen Mechanismus, der allerdings nur noch einer allgemeingültigen und unpersönlichen Vorstellung entspringt. Sie tun dies, weil eine gewohnte (habituelle) Auffassung des Leibes, gleichsam die objektivierte und allgemeingültige Idee eines vollständigen Leibes, die psychische Vorstellung, ja sogar die physiologische Wahrnehmung affiziert. Von diesem äußeren Standpunkt aus sollte das amputierte Glied, zum Beispiel der Arm, noch da und verfügbar sein, denn er war zu einem Arm geworden, über den man verfügen kann, zu einem Arm an sich. Der aktuelle, empfindende Leib, mit dem ich mich jetzt der Welt zuwende und der jetzt meines Armes verlustig ist, wird aus dieser habituellen Sichtweise nur marginal erfasst. Immerhin weiß der Betroffene ja, dass Phänomenologie - 136 - der Arm fehlt (vgl. Plügge, 1967, 61f.). Trotzdem pocht der habituelle Leib auf sein Recht und verweist mich auf die objektive Perspektive des Anderen, die ich daraufhin meinem eigenen Leib gegenüber latent aber realiter einnehme. Nicht der gegenwärtige und höchst reale Leib, sondern der objektivierte Leib wird durch die ihm entsprechende Perspektive und der Wirklichkeit zum Trotz ins Recht gesetzt. Der Betroffene befinde sich somit in einer „Scholastik der Existenz“ (Merleau-Ponty, 1966, 108), in dem Sinne, dass er weiterlebe, ohne auf die Gegenwart mit ihren neuen Anforderungen zu reagieren. Für Merleau-Ponty wird das Phänomen des Phantomgliedes erst aus der Sicht des Zur-Welt-seins verständlich: Der Betroffene wendet sich habituell der gewohnten Welt zu, obwohl er, seines Gliedes beraubt, unfähig ist, mit diesem zu hantieren (vgl. ebd., 106). Anscheinend ist das „Hantierbare für mich“ zu einem „Hantierbaren an sich“ (ebd., 107) geworden. Und ebenso ist mein subjektiv erlebender Leib gleichviel objektiver und unpersönlicher Leib, der erlebt wird. Auch Schmitz legt am Beispiel des Phantomgliedes dar, dass das „eigenleibliche Spüren“, als Korrelat zu Merleau-Pontys „Für-michsein“, nicht identisch ist mit Organempfindungen, „d.h. Manifestationen von Zuständen sicht- und tastbarer Körperteile im Bewusstsein“ (Schmitz, 1968, 88/89), die Merleau-Pontys Terminus des „An-sichseins“ entsprechen. Nur den Ort haben die gespürten „Leibesinseln“ mit den materialen Körperteilen meist - mit Ausnahme des Phantomgliedes gemeinsam (vgl. Schmitz, 1968, 89)72. Das inkongruente Verhältnis zwischen gegenwärtiger und objektiver Erfahrung verweist auf die Unmöglichkeit, meinen gelebten Leib von dem Leib als allgemeinem Körperding zu trennen. 72 Schopenhauer sieht in dem Phänomen des Phantomgliedes einen Beweis dafür, dass es sich bei der Erkenntnis, auch des eigenen Leibes, allererst um ein Gehirnphänomen handele; dass der eigentliche Ort (Hervorheb. des Verfassers) der Wahrnehmung im Gehirn liegt. Die „auf der gänzlichen Intellektualität der Anschauung beruhende scheinbare Unmittelbarkeit derselben“ habe „ein Analogon an der Art, wie wir die Teile unseres eigenen Leibes empfinden“ (ebd., 1966, 607). „Daher fühlt endlich der, der ein Glied verloren hat, doch noch bisweilen Schmerz in demselben, weil die zum Gehirn gehenden Nerven noch da sind“ (ebd.). Phänomenologie - 137 - „Das Verständnis des Phantomgliedes setzt also eine Theorie des Leibes voraus, die den oben skizzierten Dualismus73 sprengt und dem leiblichen Leben seine Welthaftigkeit, seine Selbst- und Fremdbezüglichkeit zurückgibt“ (Waldenfels, 2000, 30). Das Phänomen des Phantomgliedes ist überdies aufschlussreich, weil es zeigt, dass die subjektive und die objektive Sichtweise auf den Leib je ein konkretes Pendant zu den zwei Existenzebenen - Für-sich-sein und Ansich-sein - sind, die in diesem Ausnahmefall gleichzeitig erscheinen. Plessner spricht in diesem Kontext von „Leibhaben und Leibsein“ (In: Meyer-Drawe, 1996, 179). Dies ist als Beleg dafür aufzufassen, dass die zwei Seinsdimensionen des Leibes in Wahrheit eins sind und dass ihre Trennung, wie der dualistische Gedanke überhaupt, nur ein illusionärer Ausfluss des menschlichen Geistes ist. Die Betrachtung eines isolierten Organs oder Körpergliedes, die die bedeutungsvolle Interaktion von Leib und Welt ignoriert, kann nicht zu einem Verständnis des lebendigen Leibes gelangen, weil sie von einem bewegungslosen und nicht-handelnden Objekt ausgeht; von einem „Leichnam“ (Sartre, 1991, 445), der zu allen übrigen Objekten lediglich in „Äußerlichkeitsbeziehungen“ (ebd.) steht. Der Leib des Anderen ist ganz anders als die übrigen leblosen Objekte, die ich in der Welt wahrnehme, weil seine Handlungen bedeutungsvoll auf die Dinge der Welt gerichtet sind und nur in diesem Bedeutungszusammenhang erkennbar werden. Dadurch, dass die Physiologie und die Biologie den Leib als „morphologisch determiniertes und reguliertes Funktionssubstrat“ (Plügge, 1967, 35) begreifen, wird der leibliche Reiz „nicht in seiner Bedeutung, sondern in seinen physikalischen Bestimmungen definiert. Dadurch kommt es zu einer Isolierung des Organismus von allem ihm welthaft Begegnenden“ (ebd.). Die Erkenntnisse, die anhand eines Leichnams gewonnen werden, können 73 Waldenfels hält Descartes’ Erklärung des Phantomgliedes, die dieser in der seiner vierten Meditation vorstellt, für „einfach“ (2000, 25), da das Phänomen dort auf eine schlichte „Wahrnehmungstäuschung“ zurückgeführt werde und damit vollständig „im Dunklen“ (ebd.) bleibe. Phänomenologie - 138 - aber nicht einfach auf den lebendig sich bewegenden Menschen übertragen werden, weil das bedeutungstragende Element der lebendigen Selbstbewegung bei einem toten Körper fehlt. „Der Körper für Andere, den ich wahrnehme, verweist also auf den Lebenszusammenhang im Sinne einer individuell vollzogenen spontanen Überschreitung der Faktizität des Fürsich. Deshalb ist es auch nicht möglich, ein Körperteil isoliert wahrzunehmen, ohne zugleich den Lebenszusammenhang aufzuheben“ (Schmidt-Millard, 1995, 146). Der anatomische Aufbau des Körpers ist auf diese Weise wohl zu erkennen, die Bedeutung der Bewegungen des Leibes hingegen niemals. Sartre nennt dafür zwei aufschlussreiche Beispiele: Wir nehmen einen gebrochenen Arm, der deformiert an dem Leib herunterhängt, als beunruhigend und „schauderhaft“ (1991, 448) wahr, weil er aussieht, als gehöre er nicht zum Leib. Die flüchtige Wahrnehmung einer Hand, die sich scheinbar selbständig bewegt und wie eine Spinne krabbelt, erscheine ebenso „desintegriert“ (ebd.) weil sie zunächst nicht als bedeutungsvolles Element des lebendigen Leibes erkannt wird, das sie ist. Die von den sinngeladenen und allererst definierenden Situationen losgelösten Bestandteile des Leibes können keinen Aufschluss geben über sein tatsächliches Wesen. Eine Erkenntnis des mehrdimensionalen Leibes ist auf diesem Standpunkt ausgeschlossen. Der Andere ist nicht bloß Körperobjekt und dementsprechend nicht genau wie die anderen Objekte der Welt wahrnehmbar. Der Leib des Anderen darf nicht mit seiner Gegenständlichkeit verwechselt werden. Sein Leib ist ureigentlich sein Bezugszentrum zur Welt und für ihn erst danach ein Gegenstand in der Welt. Deshalb kann Sartre sagen, dass der Leib des Anderen vollkommen anders als die anderen Körperobjekte wahrgenommen werde (vgl. 1991, 448). Den Anderen wahrnehmen heißt „sich durch die Welt sagen lassen was er ist“ (ebd.). Dies wird umso einleuchtender, als dass der Leib des Anderen immer in Bedeutungszusammenhänge involviert ist, durch die er allererst definiert wird. Von daher ist der Leib des Anderen, im Gegensatz zu einem Phänomenologie - 139 - Leichnam, bedeutungs-tragend. „Ein Leib ist Leib, insofern sich diese Fleischmasse, die er ist, durch den Tisch, den er betrachtet (…) definiert“ (Sartre, 1991, 446). Füglich kann der Leib nicht erscheinen, „ohne mit der Gesamtheit des Seienden in Bedeutungsbeziehungen zu stehen“ (ebd.). Er ist „transzendierte Transzendenz“ (ebd., 448), weil ich das Fürsich-sein eines Anderen, indem ich ihn wahrnehme, immer schon mit begreife, weil seine Handlungen sonst überhaupt keinen Sinn für mich ergeben würden. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Leib als Gegenstand, als „Leibfür-den-Anderen“ (Sartre, 1991, 439), mehr als nur objektivierter Körper ist, insofern sein Wahrgenommenwerden immer schon einen „interpretativen Akt“ (Schmidt-Millard, 1995, 139) und also Verstehen einschließt. „Verstehen des wahrgenommenen menschlichen Körpers ist aber in eins die Anerkennung des Anderen als Für-sich-sein, d.h. Freiheit“ (ebd.). Das vollständige Erkennen des Anderen gleicht jedoch einem gordischen Knoten, weil man sich nicht wirklich in einen Anderen „hineinversetzen“ kann. Man sieht im Gegenteil den Leib des Anderen zunächst immer als Objekt, als Widerstand, als Zeug, das mir zuhanden ist (vgl. Heidegger, 1993, 67-72). „Zunächst existiert der Andere für mich, und erst dann erfasse ich ihn in seinem Leib; der Leib des Anderen ist für mich eine sekundäre Struktur“ (Sartre, 1991, 440). Von hier aus wird es verständlich, wenn Sartre schreibt: „Ich taste dein Gesicht, nicht deinen Blick“ (ebd., 358). Merleau-Ponty bemerkt in diesem Zusammenhang, dass der Andere „unmittelbar mich selbst auf den Zustand eines Objektes für ihn reduziert“ (1966, 131/132, Fußnote 18). Bei der Betrachtung des Phänomens Phantomglied zeigt sich, dass habituelle und aktuelle Perspektiven auf meinen Leib möglich sind. Die erschließen offenbar korrelierende Seinsdimensionen desselben. Interessant ist, dass die habituelle Perspektive, die objektiviert, anscheinend durch die pure Macht der Gewohnheit, Dinge „sieht“, die überhaupt nicht mehr da sind. Dies verweist nachdrücklich auf die Phänomenologie - 140 - Notwendigkeit, seinen Blickwinkel fortwährend zu prüfen, um Defiziten in der Erkenntnis vorzubeugen. Zur Verfestigung und Komplettierung der gewonnen Einsichten über die zwei Existenzdimensionen des Leibes muss nun ihr Verhältnis erörtert werden - zumal sonst der Eindruck entsteht, Innen und Außen würden als voneinander getrennt begriffen. 2.5.5 Ambiguität des Leibes Der Leib ist sowohl ein gegenständlicher Teil der Welt (Objekt), als auch Teil und Bedingung des subjektiven Bewusstseins (Subjekt). Er ist sowohl Körperding, ein Teil von mir, als auch ich selbst, der dieses Ding ansehen kann. Der Leib ist als Ding ebenso konstituiert, wie die übrigen Dinge der Welt. Doch überdies ist er auch selbst konstituierend (vgl. Thiele. In: Bette 1993, 107). Aus phänomenologischer Sicht ist er vor allem eines: Mein Leib. Als konstituiert-konstituierendes Phänomen erschließt er meinen Zugang zur Welt; ist Medium meines Zur-Welt-Seins und dadurch die Bedingung der Möglichkeit für meinen Zugang zur Welt. Der Mensch-Welt Bezug besitzt in der Leiblichkeit eine entscheidende Nahtstelle. Von hier aus „wird man bald dessen inne, dass, was wir normalerweise schlechthin als die Welt erfahren, einen Weltsinn bezeichnet, der an der Voraussetzung der normalen Leiblichkeit hängt und ihrem normalen Funktionieren“ (Hua ΙX, 199). Dem Leib kommt aus transzendentalphänomenologischer Sicht eine zentrale Bedeutung zu, weil er das Bewusstsein mit konstituiert; aus weltlicher Sicht ist der Leib interessant für die Phänomenologie, weil er als durch das Bewusstsein konstituiertes Ding erscheint, wie auch die anderen Dinge der Außenwelt. „Wenn meine rechte Hand meine linke berührt, empfinde ich sie als eine physische Sache, aber im selben Augenblick tritt, wenn ich will, ein außerordentliches Ereignis ein: auch meine linke Hand beginnt meine rechte zu empfinden, sie wird Leib, sie empfindet. Die physische Sache belebt sich – oder genauer: sie bleibt, was sie war (…) Ich berühre sie also Phänomenologie - 141 - berührend, mein Körper vollzieht eine Art Reflexion!“74 (Merleau-Ponty, 1984, 52)75. Die so genannten Doppelempfindungen unterstreichen die Ambiguität des Leibes. Es sei eine „Kuriosität unserer Konstitution“, dass es uns möglich ist, „in bestimmten, wohl definierten Fällen unserem Leib gegenüber den Standpunkt des Anderen einnehmen (zu) können“ (Sartre, 1991, 462). Ich nehme meinen eigenen Leib als Gegenstand wahr, wenn mein Bewusstsein in ein distanzierendes, verdinglichendes Verhältnis zu meinem eigenen Körper tritt: „Die junge Frau gibt ihre Hand preis, aber sie merkt nicht, dass sie sie preisgibt. Sie merkt es nicht, weil es sich zufällig so fügt, dass sie in diesem Augenblick ganz Geist ist. Sie (…) spricht vom Leben, von ihrem Leben, sie zeigt sich unter ihrem wesentlichen Aspekt: eine Person, ein Bewusstsein. Und inzwischen ist die Scheidung von Körper und Seele vollbracht; die Hand ruht inert zwischen den warmen Händen ihres Partners: weder zustimmend noch widerstrebend – ein Ding“ (Sartre. Zit. nach : Schmidt-Millard, 1995, 55). Schmidt-Millard weist anhand dieses Zitates darauf hin, dass der Instrumentalisierung des Körpers zum Gegenstand, zum Mittel des Erreichens von (mitunter externen) Vorgaben, eine Selbsttäuschung vorausgeht. Dies insofern sich das Bewusstsein als absolut frei setzt und über den Körper wie über ein passives Ding verfügt (vgl. 1995, 55/56). Sartre meint in diesem Zusammenhang eine Flucht in die Innerlichkeit, die den Körper in einen Gegenstand verwandele (Zit. nach: ebd., 57). Dies scheint auch die Haltung der Wissenschaft zu sein, die Erkenntnisfunktionen des Leibes-für-sich aufgrund ihrer angeblichen Subjektivität als unwissenschaftlich ablehnt und also unterschlägt. Sich 74 Die Worte „eine Art Reflexion“ hat Merleau-Ponty anscheinend von Husserl (Hua Ι, 128) übernommen. Sie kommen allerdings nur in der französischen Übersetzung von Husserls Werk (auf Seite 81) vor (vgl. Merleau-Ponty, 1966, 118). 75 Buytendijk berichtet, dass auch ein „Tier – wie der Mensch – den Unterschied des Berührens und Berührtwerdens bemerkt (…) Ein Beispiel: Berührt man eine vordere Armspitze (des geblendeten Tintenfisches) mit einem Glasstab, dann wird der Arm zurückgezogen. Berührt das Tier durch seine Selbstbewegung den Stab, so erfolgt kein Zurückziehen, sondern ein Abtasten mit einem oder mehreren Armen“ (1958, 43). Beim Tier wie auch beim Menschen ist die Bedeutung eines Reizes stets situationsabhängig; überdies wird die Fähigkeit, die zwei Leibdimensionen wahrzunehmen, bestätigt. Phänomenologie - 142 - dieser Subjektivität zu entledigen, heißt aber immer, die primäre Existenzebene des Menschen übersehen. Hier liegt die Hauptschwäche aller objektivierenden Wissenschaft. Trotz der bemerkenswerten Fähigkeit zum Perspektivwechsel ist die Bewegung des Leibes keinesfalls ausschließlich auf kausale Verhältnisse zurückzuführen. Die erste Seinsebene des Für-sich-seins verschwindet also nicht einfach, indem ich in ein distanziertes Verhältnis zu meinem Leib trete und so seine Objektseite aktuell werden lasse. Mein Wille und also meine Intention sind auch jetzt noch gegenwärtig. Sie sind gleichzeitig mit der Körperhandlung in der Situation wirksam. Keineswegs ist also der unmittelbare „Willensakt ein von der Aktion des Leibes Verschiedenes und beide durch das Band der Kausalität verknüpft, sondern beide sind eins und unteilbar. Sie sind zugleich. Sie sind ein und dasselbe, auf doppelte Weise wahrgenommen“ (Schopenhauer, 1966, 617). Deshalb weist auch Landgrebe auf „die unlösbare Zusammengehörigkeit von Empfinden und spontaner kinästhetischer Bewegung“ (1969, 135) hin. Nur die Vorausannahme von allgegenwärtigen Kausalzusammenhängen veranlasst uns zu glauben, Inneres und Äußeres seien zwei voneinander geschiedene Gegenstände. In Wirklichkeit ist das, was sich der inneren Wahrnehmung als „Willensakt“ (Schopenhauer), bzw. „Empfindung“ (Landgrebe) kundgibt, zeitgleich das, was sich der äußeren Anschauung, „in welcher der Leib objektiv dasteht, sofort als Aktion desselben“ (Schopenhauer, 1966, 617) darstellt. Empfindung und Bewegung stehen also nicht in kausaler und notwendig getrennter, sondern vielmehr in gleichzeitiger und daher einheitlicher Relation76. Deshalb „lassen sich ‚Empfindung’ und ‚Handeln’ gar nicht voneinander unterscheiden“ (Sartre, 1991, 418); sie „haben sich vereinigt und machen nur noch eins aus“ (ebd., 424). In nämlichem Verhältnis stehen der wahrnehmende und der wahrgenommene Leib. Der Leib-für- 76 Für die Sportwissenschaft hat Marlovits (2001) eine phänomenologische Analyse der Einheit von Empfinden und Sich-Bewegen in Anlehnung an das ausgezeichnete Werk von Straus (1956) vorgelegt. Phänomenologie - 143 - sich und der Leib-für-Andere sind eins, sie werden nur gleichzeitig doppelt wahrgenommen. Ich existiere für mich auch „als vom Anderen als Leib Erkannter“ (Sartre, 1991, 454). Dies sei die „dritte ontologische Dimension“ (ebd.) des Leibes, die insofern aufschlussreich ist, als dass sie beide bisher dargestellten und scheinbar konfligierenden Seinsebenen zu einer je aktuellen Konfluenz führt. Schließlich ist der Leib, dessen Selbstbewegung ich in den Sportwissenschaften erkennen will, sowohl der einer individuellen Person, die Absichten und Gefühle in ihre Bewegungshandlungen einbringt, als auch der mir erscheinende äußere Leib, der aber nicht bloß Gegenstand ist, sondern ein Gegenstand, der seine ganze Bedeutung sowie seine Identität durch sein persönliches Fürsich-sein überhaupt erst erfährt. Und zwar ist er all dies gleichzeitig und genuin. Die ganze Unterteilung, die bis hierhin vorgenommen wurde und die auch Sartre in ähnlicher Form vorgetragen hat, entspricht insofern nicht der Realität, als das realiter nichts je getrennt vorkommt77. Wir können bei der gedanklichen Analyse nur nicht ohne intellektuell anschauliche Unterteilungen auskommen. Dies weist zurück auf die Beschränktheit der rationalen Erkenntnisfähigkeit78. In Wahrheit ist der Leib immer seine dritte ontologische Dimension. Er ist immer alles Gesagte auf einmal, gleichzeitig und gegenwärtig. 77 Hier liegt sicher auch der Ansatzpunkt von Waldenfels Kritik, wenn dieser Sartre Ontologie als „dualistisch“ (1983, 82) bezeichnet. 78 „Man hat die Vernunft des Menschen als eine abgetrennte Kraft in die Seele hineingedacht, die den Menschen als eine Zugabe vor allen Tieren zu eigen geworden – das ist freilich, es mögen es so große Philosophen sagen, als da wollen, philosophischer Unsinn. Alle einzelnen Kräfte unserer und der Tierseelen sind nichts als metaphysische Abstraktionen, Wirkungen. Sie werden abgeleitet, weil sie von unserem schwachen Geiste nicht auf einmal betrachtet werden konnten; sie stehen in Kapiteln, nicht weil sie so kapitelweise in der Natur wirken, sondern weil ein Lehrbuch sie so am besten entwickelt. Überall aber wirkt die ganze Seele“ (Herder: Über den Ursprung der Sprache. Preisschrift. 1770). Eine derartige theoretische Abgrenzung dient immer nur „der Identifikation von grundlegenden Absichten“ (Schmidt-Millard, 1995, 102). Die unterschiedlichen Dimensionen treten niemals isoliert auf (vgl. ebd.). Phänomenologie - 144 - Die gebotene Sichtweise auf den Leib oszilliert zwischen zwei Extrempunkten: Den Werkzeugkörper (Leib an sich) und den pathischen Leib (Leib für sich), die nicht in ein dualistisches Schema des EntwederOder gehören, sondern zuvorderst nur Anhaltspunkte für die gedankliche Einordnung anzeigen. Das heißt, der Mensch ist nicht die Dualität nur dieser zwei Dimensionen sowie der ihnen zugehörigen Perspektiven, sondern er bewegt sich immer irgendwo zwischen diesen zwei Polaritäten, die füglich durchweg dialektisch aufzufassen sind. Dabei kann der Leib durchaus instrumentelle Funktionen ausfüllen. Dennoch darf er nicht auf diese Werkzeugfunktion reduziert werden. Er muss immer auch als bedeutungsvoll agierender Mittler zwischen Ich und Umwelt gesehen werden, um in seinem ganzen Wesen zutreffend erkannt werden zu können. „So ist die Bewegung als Medium des Verhaltens auch Mittler zwischen Geist und Natur“ (Buytendijk, 1963, 5). Es wäre absurd, die mechanisch-physiologischen Vorgänge und Abläufe des Körpers abzustreiten. Doch die Erklärung der Physiologie des Körpers führt nicht zum Verständnis der Selbstbewegung, die „jedenfalls niemals eine Resultante mechanischer Abläufe“ (ebd.) ist. Deswegen ist gleichviel die empfindende Dimension des Leibes zu beachten. Es scheint eine dialektische Vorstellung des Leibes erforderlich, die nicht bei den physikalischen Aspekten des Leibes verharrt, sondern auch sein intentionales Verhältnis zur Welt in Betracht zieht. Dadurch scheint es möglich, den Kontext, die Bedeutung und insbesondere das Subjekt der Bewegung für die Forschung zurück zu gewinnen. Im Übrigen lässt sich so ein Bildungspotenzial von Sport begründen. Die ontologische Bilanz der phänomenologischen Leibanalysen: Der Leib ist in erster Linie mein Leib, dass heißt, er ist mein gelebter, faktischer Zugang zur Welt: Das Ich. Sein zweiter Aspekt ist der äußere Leib, der Körper, das Werkzeug: Das „Man“. Ich kann mein Ich anhand von Empfindungen erkennen, ich kann sogar mein Ich als ein „Man“ betrachten, indem ich meinen Körper wie den eines Anderen ansehe, als Gegenstand. Man kann mein Ich nur als äußere Erscheinung erkennen, Phänomenologie - 145 - aber nicht unmittelbar als mein Ich. Umgekehrt kann ich das „Man“ eines Anderen in seiner Äußerlichkeit wahrnehmen, die durch sein Ich geprägt ist, das mir allerdings weitgehend verborgen bleibt. Die Ambiguität des Leibes ist nicht allein ontologisch von Interesse. Überdies halten die verschiedenen Seinsdimensionen des Leibes auch ihnen entsprechende Erkenntnisfunktionen bereit, die ebenso wenig stringent voneinander zu scheiden sind, wie diese Dimensionen selbst. Rationales und sinnliches Erkennen müssen sich ständig ergänzen, obwohl analytische und ganzheitliche Wahrnehmung über inkommensurable Nomenklaturen verfügen. Diese Diskrepanz ist auszuhalten und macht dialektisches Denken unverzichtbar. Kritiker der leibanthropologischen Phänomenologie argumentieren, das reine Bewusstsein werde einfach durch eine Art „reinen Leib“ ersetzt, womit nichts gewonnen sei. Um derartige Einwände zu würdigen wird der Erkenntnisanspruch des Leibes kritisch hinterfragt. 2.5.6 Der Leib als Erkenntnismonopol? Der erkenntnistheoretische Entwurf Merleau-Pontys, seine „immer entschiedenere Abkehr von einer Bewusstseinsphilosophie“ (Waldenfels, 1983, 45) wirft die Frage auf, ob er im Anschluss an Husserl das „transzendentale Bewusstsein nur verleiblicht“ (Waldenfels, 1992, 131). Grenzt Merleau-Ponty das Bewusstsein einfach aus? Waldenfels sieht die Gefahr, „dass die Privilegien des Bewusstseins lediglich an eine andere Instanz, nämlich den Leib delegiert werden“ (1985, 165). Der Leib werde, „im Gegensatz zum Bewusstsein, in den Rang eines Unbedingten erhoben“ (ebd.). Wenn dies der Fall wäre, würde - von epistemologischem Standpunkt aus - in Merleau-Pontys leiblicher Phänomenologie der gleiche dualistische petitio principii zum Tragen kommen wie in idealistischen Ansätzen. Die verengende Einseitigkeit des erkenntnistheoretischen ganzheitlichen entgegenstehen. Ausgangspunktes Erkenntnisgewinn fundamental würde und einem dauerhaft Phänomenologie - 146 - Die Dichotomie von Leib und Bewusstsein, die insbesondere die cartesianische Zwei-Substanzen-Lehre trägt, welche von Husserls Phänomenologie nicht überschritten werden konnte und die sogar Sartres - nach Waldenfels - „dualistischer Ontologie“ (1983, 82) des „An-sich“ und „Für-sich“79 zugrunde liege, ist wirksam im okzidentalen Denken eingegraben und wirft die Frage auf, ob das verführerisch eindeutige Zwei-Komponenten-Schema von Erklärungsmodellen, das über Jahrhunderte hinweg als Wahrheit kolportiert wurde, überhaupt durch den dementsprechend geprägten - also unseren - Geist überwunden werden kann. Jedoch ist durch Merleau-Ponty vielmehr ein überaus fruchtbarer erkenntnistheoretischer Anstoß erfolgt, in dessen gespanntem Rahmen der Leib nicht verabsolutiert, sondern sein Erkenntnis fundierendes Recht untermauert wird, weil der vorwissenschaftliche und also realitätsnahe Charakter der leiblichen Erkenntnisweise durch Merleau-Ponty hervorgehoben wird. Deshalb kann man bei seinem Werk durchaus von einer alternativen Form der Phänomenologie sprechen, die sich zusehends von den Fesseln der dualistischen Tradition freimacht. Indem Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung sowohl mit der mechanistischen Vorstellung eines bloß reaktiv und mechanisch ablaufenden Körpers als auch mit der Husserlschen Idee eines reinen Bewusstseins bricht, fördert sie mit einer „Rehabilitierung der vorwissenschaftlichen Erfahrung“ (Lippitz. Zit. nach: Waldenfels, 1992, 101) gleichzeitig die Vindizierung der Lebenswelt. 79 Waldenfels leitet aus Sartres Phänomenologie einen Dualismus ab, weil das „An-sich und Für-sich unvermischt in der Erfahrung“ aufträten (vgl. 1983, 82; 1985, 151). Schmidt-Millard, der Sartres Philosophie ausführlich für die Sportpädagogik bearbeitet hat, teilt diese Auffassung nicht (vgl. 1995, 105), weil Sartre schreibt: „es gibt da keine ‚seelischen Phänomene’, die mit dem Leib erst zu vereinigen wären; es gibt nichts hinter dem Leib, sondern der Leib ist ganz und gar ‚seelisch’“ (1991, 401). Auch von Sartres Gedanken der dritten ontologischen Dimension des Leibes aus ist es ganz unverständlich, wie Waldenfels zu dem Eindruck gelangt, es handele sich bei Sartres Betrachtungen um eine solche dualistischer Prägung. Ein derartiger Anschein entsteht ja nur bis zu diesem finalen Gedanken über das Sein des Leibes; von hier aus (vgl. Sartre, 1991, 455f.) tritt die zweiteilige zugunsten einer holistischeren Betrachtung in den Hintergrund. Phänomenologie - 147 - Diese präobjektive Sicht ermöglicht eine von allen Reizen und allem willentlichen Denken relativ unabhängige Existenz der Welt, die sowohl eine Reduktion des Zur-Welt-seins auf eine Summe von Reflexen, als auch eine Reduktion des Zur-Welt-seins auf einen Akt des Bewusstseins ausschließt (vgl. Merleau-Ponty, 1966, 104). Bei Merleau-Ponty bedeutet die phänomenologische Reduktion nicht Rückgang auf ein transzendentales Bewusstsein, sondern ein Bewusstwerden des immer schon in der Welt seins (vgl. ebd., 11). Die eidetische Reduktion wird als Mittel angesehen, die Welt als das anzusehen, was sie ist: Das von uns Wahrgenommene. „Die Welt ist das, was wir wahrnehmen“ (ebd., 13). Schließlich sei die Intentionalität nicht Aktintentionalität, sondern „fungierende Intentionalität“ (ebd., 474), in der die „natürliche vorprädikative Einheit der Welt und unseres Lebens gründet“ (ebd., 15). Von daher erkenne der Mensch nie, ohne in der Erkenntnis immer persönlich engagiert zu sein (vgl. Sartre, 1991, 404). Das „Bewusstsein verkennt seine elementare Gebundenheit an den Körper, indem es sich dem Körper gegenüber setzen will“ (Schmidt-Millard, 1995, 107). Doch „selbst wenn das Bewusstsein seine Verwicklung mit der Lebenswelt ignoriert, entkommen kann es ihr nicht“ (Meyer-Drawe, 1996, 180). Merleau-Ponty hat diesen Widerspruch ins hellste Licht gestellt und ist vor allem dadurch über Husserl hinausgegangen. Nachdem die Grundlagen einer Phänomenologie der Leiblichkeit vorgestellt wurden erscheint es nun passend, einen ontologischen Gedanken einzuführen, der den Sinn der Anwendung leiblicher Erkenntnisvermögen weiter begründen und gleichzeitig als Beitrag zur Überwindung ausschließlich objektorientierter Wissenschaft angesehen werden kann. Diese ontologische Alternative zum Teilungsdenken ist das Konzept der Schichtung, das aus phänomenologischer Hinsicht gut nachvollziehbar erscheint. Phänomenologie - 148 - 2.5.7 Das ontologische Konzept der Schichtung „Der Dualismus zwischen einem seelischen und einem körperlichen Bereich ist nichts Primäres, von Anfang an Vorgegebenes, sondern eine Vorstellung, die nur unter bestimmten Umständen eintritt und ständig überwunden werden muss - im Grunde also ein unnatürlicher Zustand“ (Uexküll, 1963, 128f.). Das Ideal der Objektivierung verhindert aber die Zurückführung in den natürlichen Zustand der Einheit, da es auf der Distanzierung von Körper und Geist sowie der distanzierten Betrachtung des Leibes basiert, der so zum Körper transformiert wird. Die natürliche Einheit von physiologisch erforschbarer Körperlichkeit und subjektiver Erfahrung wird durch Objektivierung aufgehoben, um sie dann aus der abstrakten Analyse mechanischer Einzelteile wieder herzuleiten. Das Wesen des Menschen wird so als „Konglomerat aus Dingrudimenten“ (Schmitz, 1980, 8), als merkwürdig lebloses Amalgam aufgefasst. Das Wesensmäßige des Lebens erschließt sich aber nicht aus seinen Einzelteilen. Nicolai Hartmann (vgl. 1966, 22ff.) hat ausgeführt, dass die Summe seiner Teile nicht mit dem Wesen des ganzen Menschen korreliert. Es sei vielmehr durch seine Gesamtheit und durch die wechselseitigen Zusammenhänge der einzelnen Fragmente konstituiert. Es weise eine schichtenhafte Strukturiertheit auf. Der Schichtungsgedanke bezüglich des Seins ist schon sehr alt. Plotin hat von fünf Seinsstufen gesprochen, die er Hypostasen nennt. Aristoteles hat die Seelenlehre Platons bereichert, indem er von je einer anorganischen, organischen, seelischen und geistigen Schicht spricht, die in ihrer Gesamtheit das Leben formen (vgl. Konstantinovic, 1973, 63f.). Die antike Stufengliederung der Seinsformen wurde durch Hegel und vor allem Schelling in die Neuzeit vermittelt (vgl. Misch, 1967, 250). Die Schichtenlehre Nicolai Hartmanns beinhaltet den Gedanken, dass die reale Welt aus Materiellem hervorgegangen ist. Das Organische setzt die anorganischen, physikalischen Verhältnisse und Gesetzmäßigkeiten voraus, „es ruht auf ihnen auf, wenn schon diese keineswegs ausreichen, Phänomenologie - 149 - das Lebendige auszumachen“ (Hartmann, 1966, 59). Dieses Aufruhen bedeutet, dass Lebendiges durch materielle Verhältnisse bedingt ist, doch zugleich selbständig und eigengesetzlich ist. Das Wesen des Lebendigen ist wohl abhängig von seinen einzelnen funktionalen Teilen, aber es verändert als Ganzes sein Wesen, es gehört dann zu einer höheren Seinsschicht, welche nicht mehr vergleichbar und keinesfalls identisch ist mit denen ihrer separaten Untereinheiten. Die einzelnen, unabhängig funktionierenden Untersysteme können keinen Aufschluss geben über das Wesen des lebendigen Systems, wiewohl dieses aus ihnen besteht. Die spezielle Eigenart des integrierenden Systems tritt erst nach der Konfluenz der Einzelteile in Existenz80. Gleichwohl versucht man heute, das ganze Weltgeschehen mit den Gesetzlichkeiten der klassischen Mechanik zu erklären, mit der Funktion von Teilsystemen. Diese Haltung scheint durch das Bedürfnis nach einem möglichst einheitlichen Weltbild motiviert. Deshalb wird der menschliche Leib in dem mechanisierten Weltbild als Maschine betrachtet, die nach den gleichen Gesetzen funktioniert, wie die physikalischen Mechanismen, aus denen er sich zweifellos zusammensetzt. Das erklärt auch, warum man die Wahrnehmung auf Verlagerung von Molekülen respektive elektrischen Reizen in der Raumzeit reduziert. Dabei wird übersehen, dass das organische System Mensch die physikalischen Grenzen in seinem Erleben und Empfinden, das Erkennen überhaupt erst möglich macht, überschreitet. Durch seine Fähigkeit zum Erleben und durch seine individuelle Subjektivität ragt das Wesen des Menschen über die mechanischen Gesetze einer Maschine 80 Bollnows Analyse des „Prinzips des Nichts-anderes-als“ (1975, 97-102) ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Er weist nämlich auf ein Prinzip hin, nach dem Formen der Wirklichkeit beschrieben werden, indem man beispielsweise sagt: „Die Materie ist nichts anderes als eine Zusammenwirken von chemischen Molekülen (philosophischer Materialismus), der Staat ist nichts anderes als eine Rechtsorganisation, oder: Der Mensch ist nichts anderes als ein Reiz-ReaktionsSystem“. Diese reduktionistische Vereinfachung beinhalte zugleich eine „abwertende Tendenz, von der eine eigentümliche Suggestionskraft ausgeht“ (ebd., 99). Diese Haltung berge auch die Gefahr, das schöpferisch Neue, das im Übergang von der ‚niederen’ zur ‚höheren’ Schicht hinzukommt, zu verkennen“ (ebd., 99/100). In ähnlicher Weise verkennt auch ein prinzipieller Mechanizismus die eigentliche Wesenhaftigkeit des Lebendigen. Phänomenologie - 150 - empor, ist es etwas völlig anderes. Goldstein und seine Schüler haben dies erkannt: „Der Erkenntnisfehler liegt in der falschen Bewertung der analytisch gefundenen Tatsachen, in dem Umstand, dass man sie als Teiltatsachen des wirklichen Seins auffasst, aus denen sich das ganze Sein aufbauen soll“ (Goldstein, 1934, 244). Materielle Bestandteile des menschlichen Organismus verraten bspw. nichts über Absichten und Gefühle, die Antrieb seiner Selbstbewegung sind81. Das Wesen des genuin leiblich-sinnlichen Menschen wird also aus mechanischer Perspektive übersehen. Trotzdem sind messbare Daten im geltenden Wissenschaftsverständnis anscheinend unantastbar; Messbarkeit wird oft als Bedingung der Erkenntnis vorausgesetzt. Im Sport führt dies dazu, dass emotionale und generell nicht quantitativ messbare Resultate von Erkenntnisprozessen ausgelassen werden. Als Auswirkung der so verkürzten Erkenntnis über qualitative Dimensionen des Menschen erscheint eine Abwertung der menschlichen Empfindung und damit einhergehend die Nivellierung sinnlicher Erkenntnisquellen. Wenn der Sinnlichkeit des Menschen aber keine besondere Beachtung zuteil wird, heißt das, wir machen uns auch unsere Verstricktheit in Gewohnheiten und leibliche Automatismen nicht bewusst. Der gesamte Bereich der Wahrnehmung wird überhaupt nicht aufgeschlossen. Wahrnehmungsvorgänge werden von den Naturwissenschaften als physiologische Vorgänge angesehen, von denen man annimmt, sie hätten epistemisch nur rezeptiven Charakter. Dass während des Wahrnehmungsvorgangs immer schon semantische Entscheidungen unbewusst gefällt werden, wird weitgehend einfach übersehen. Die mechanistische Haltung ist die Art, wie wir heute auf die Welt blicken. Sie bezeichnet die selbstverständlichen Vorannahmen, mit denen wir gewöhnt sind, uns auf die Welt zu richten. Diese Vorannahmen und urteile bleiben meist unhinterfragt. Diese objektivistische Weltsicht gilt 81 Vgl. zur bewegungstheoretischen Bedeutung des Schichtungsgedankens Kap. 3.2.1. Phänomenologie - 151 - als ein Paradigma. Weil man die Welt auch anders sehen kann, trägt jedes Paradigma eine Begrenzung in sich. Mit Hinblick auf das Gebiet der Erkenntnis heißt das, die Welt würde aus einem anderen Paradigma heraus betrachtet anders erscheinen. Das Denken in Objekten entmündigt die sinnliche Erfahrung und leugnet deren Erkenntnisanspruch. Dass es als Alternative zu diesem Teilungsdenken nicht nur diffuse Ganzheitstheorien oder mystische Spekulationen gibt, sollte durch die Skizze des Schichtungsgedankens von Nicolai Hartmann klar geworden sein. Um zu verstehen, was Erkennen und Wahrnehmen ausmacht, ist das Teilungsdenken zu überwinden. Diese eingeübte, unbewusste und gewohnte Denkart des Menschen, lässt ihn seine eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten nicht erkennen, nicht verstehen und nicht benutzen. Damit wird nur die Wahrheit erkannt, die ohnehin schon feststeht. Von hier aus scheint es nötig, das menschliche Erkenntnisvermögen genauer in den Blick zu nehmen. Prozesse leiblichen Erkennens 3 - 152 - Prozesse leiblichen Erkennens Auf Grundlage der dargestellten phänomenologischen Auslegung von Leiblichkeit kann das Erkenntnisvermögen des leiblichen Subjekts genauer untersucht werden. Dessen Berücksichtigung erscheint als Bedingung für eine Wiedergewinnung des Subjekts (vgl. S. 117). Dazu muss der Dualismus auf zwei Ebenen überwunden werden. Einmal ist es nötig, die Trennung von Subjekt und Welt aufzuheben und beide als Einheit zu denken, wie das bspw. Viktor von Weizsäcker in dem Gestaltkreis und Husserl mit seinem Kerngedanken der Intentionalität getan haben. Zweitens ist das Subjekt selbst als untrennbare Einheit von Körper und Geist anzusehen. Auf diesem phänomenologischen Fundament und innerhalb dieser Systematik können zwei erkenntnistheoretische Gesichtspunkte benannt und entwickelt werden: Es sind dies der Prozess subjektiven Erkennens in Verschränkung mit Welt sowie leibliches Verstehen des erkennenden Subjekts in Ergänzung zu rationaler Erkenntnis. Hierdurch soll ein Anstoß zur Reintegration von Sinnlichkeit in wissenschaftliche Erkenntnisprozesse erfolgen, wobei naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Bestätigung von phänomenologisch bereits bekannten Vorgängen herangezogen werden können. Um Prozesse leiblichen Erkennens zutreffend charakterisieren zu können, müssen Subjekt und Welt als ineinander verschränkt, als Einheit aufgefasst werden. Auf diesem ontologischen Verständnis beruht der existenzielle Modus des „Zur-Welt-Sein“ (vgl. 2.5.2.1). Diese permanente Gerichtetheit erfolgt stets leiblich, weshalb der intentionalen Wahrnehmung aus epistemologischer Sicht eine Schlüsselrolle zufällt. Prozesse leiblichen Erkennens - 153 - 3.1 Wahrnehmung als intentionale Aktivität Wahrnehmung ist nicht gleichbedeutend mit Informationsaufnahme82. Vielmehr arbeitet sie bereits während ihrer Aktivität - genau wie Werten und Urteilen - durch Vergleich. Als Wahrnehmender ist man keineswegs passiv und nur empfangend. Der zumeist unhinterfragte Begriff Wahrnehmung zeigt an, dass hier eine aktive Handlung vorliegt: Man nimmt etwas als „wahr“83. Dabei rekurriert sie nicht nur auf angeborene und vorgespeicherte Informationen, also auf das, was unsere Gene „thesaurieren“, sondern ebenfalls auf durch Erziehung und Sozialisation Vermitteltes sowie eigene Erfahrung. Darüber hinaus ist Wahrnehmung zielgerichtet und selektiv (vgl. Roth, 1994, 69f.). Was von den zahllosen Umwelteinflüssen ausgewählt und also bewusst verarbeitet wird, ist wesentlich davon abhängig, worauf unser Sinn gerichtet ist. Hirnforscher haben diese These u.a. anhand des Experiments zum „binokularen Wettstreit“ erhärtet: Wenn beiden Augen zwei Muster dargeboten werden, die nicht fusioniert werden können, wird jeweils nur immer eines der beiden Muster wahrgenommen, entweder das Muster, das dem rechten Auge dargeboten wird, oder das Muster, welches das linke Auge sieht. Wenn dem rechten Auge ein vertikales und dem linken ein horizontales Muster gezeigt wird, nimmt man nicht die Überlagerung der beiden Gitter wahr, sondern man sieht entweder das vertikale oder das horizontale Gitter, und diese beiden Wahrnehmungen alternieren nach einem ganz bestimmten, vom Gehirn festgelegten Rhythmus. 82 Die Frage, was Wahrnehmung ist lässt sich nicht auflösen durch die Frage, wie sie faktisch zustande kommt. Wahrnehmung lässt sich nicht von außen beschreiben. Die Argumentation: „Jemand nimmt etwas wahr, weil Lichtwellen seine Sehorgane treffen, die Sinneszellen reizen usw.“, ist für ein tiefgehendes Verständnis der Wahrnehmung nicht tragfähig genug. Auf diesem Weg können physikalische Epiphänomene von Wahrnehmung erklärt werden. Intentionale Bezüge, als Verursacher von Wahrnehmungen, können aus einer physiologischen Betrachtung weder abgeleitet noch erkannt werden (vgl. Waldenfels 2000; Straus, 1956 und Fuchs, 2000, 63). 83 „Wahrnehmen ist nicht lediglich passives Aufnehmen, sondern Bestandteil der aktiven Lebenstätigkeit (Hervorheb. im Original) des Menschen“ (Holzkamp, 1976, 29). Prozesse leiblichen Erkennens - 154 - „Beide Augen sehen immerfort jeweils dieselben Muster, aber das beobachtende Subjekt nimmt entweder nur das vertikale oder das horizontale Gitter wahr. Selektion ist ein natürlicher Prozess, der den Sehvorgang begleitet“ (Singer, 2008b, 55). Dieses Phänomen der „interokularen Suppression“ (ebd.) bemerken wir erst unter experimentellen Bedingungen. Forscher mit neurophysiologischem Erkenntnisinteresse konnten feststellen, dass dieser Wechsel in der Wahrnehmung – also ihre Intentionalität – mit einer Veränderung der Synchronisation neuronaler Antworten auf die jeweiligen Muster einhergeht. Die physikalischen Eigenschaften der beiden Muster verändern sich dabei natürlich nicht (vgl. ebd.). Dies kann als neurophysiologischer Beweis für die Intentionalität der Wahrnehmung aufgefasst werden. Wahrnehmung ist immer gerichtet; sie ist intentional. Um dies an einem einfachen Beispiel aus dem Alltag weiter zu verdeutlichen: Ein Mann und eine Frau gehen in die Stadt. Er hat Hunger und sie nicht. Was nimmt er wahr? Nicht die Menschen, die Straßen, das Hupen der Fahrzeuge oder die Leuchtreklamen der Kaufhäuser und Boutiquen, sondern den Duft von Backfisch, Pommes und Pizzas. Was nimmt sie wahr? Vielleicht die Mode in den Schaufenstern, Galerien, Interaktionen von Passanten, je nachdem wonach ihr der Sinn steht. Wir nehmen von der Welt dasjenige wahr, was unserer derzeitigen Verfassung, unseren Bedürfnissen und Zielen entspricht. Was uns als relativ genaue Abbildung der Welt vorkommt, ist stets nur „ausschnitthaft“ (Roth, 1994, 72). Die Wahrnehmung erkennt diesen Ausschnitt der Welt richtig. Sie bezieht sich auf tatsächliche Gegebenheiten, auch wenn diese nur einen Ausschnitt der Welt repräsentieren. Erinnert man diesen Umstand, wird man bescheidener, was die Vollständigkeit unseres Weltbildes betrifft. Wir sehen oft, was wir sehen wollen, vielleicht weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn uns etwas nicht behagt, missverstehen wir, weil wir missverstehen wollen und machen uns selber blind. Feststeht, dass unsere selektive und eingeschränkte Wahrnehmungsgabe nur wenig von der Komplexität der Prozesse leiblichen Erkennens - 155 - Welt erkennen lässt. Daran ändern auch wissenschaftliche Raster der Weltsicht wenig, weil die ja auch immer an individuell und kollektiv Erfahrenes, kulturell Vermitteltes sowie gemeinschaftlich Vereinbartes gebunden respektive daraus hervorgegangen sind. Die Erfahrungsabhängigkeit intentionaler Wahrnehmung ist näher zu erörtern, um sie bei wissenschaftlichem Arbeiten in Rechung stellen und Erkenntnisse dadurch präzisieren zu können. 3.2 Die habituelle Konstitution von Erfahrung Behält man die durch Erfahrung strukturierte Intentionalität der Wahrnehmung des stets einbezogenen Subjekts im Gedächtnis, so gerät unmittelbar ein weiteres Phänomen ins Blickfeld: die menschlichen Gewohnheiten. Dass der Mensch gewohnheitsmäßig wahrnimmt, denkt und handelt, ist keine Hypothese, sondern aus phänomenologischer Perspektive offensichtlich. 3.2.1 Habitualität des Leibes Auch naturwissenschaftliche Perspektiven haben belastbare Beweise für die Evidenz von Gewohnheiten erbracht. „Mit Hilfe der funktionellen Kernspintomographie (lässt sich) nachweisen, dass gut eingeübte Fertigkeiten, sobald sie automatisiert und unbewusst erbracht werden können, von anderen Hirnstrukturen verwaltet werden als jenen, die zu Beginn des Trainings involviert waren“ (Singer, 2008b, 40). Neurophysiologische Beweise sprechen demnach dafür, dass automatisierte Verhaltensmuster „einverleibt“ werden, wenn solche Beweisführungen sich auch auf das Gehirn beschränken. Jeder kann an seiner subjektiven Erfahrung überprüfen, dass er bestimmte leibliche Verhaltensmuster an den Tag legt. Das wird bereits daran erkennbar, wie man sich gewöhnlich die Schuhe bindet, ein T-Shirt anzieht oder die Zähne putzt. „Einmal eingeübt können erlernte Fertigkeiten schnell, mühelos und ohne kognitive Kontrolle ausgeführt werden“ (Singer, 2008b, 38). Die beanspruchten neuronalen Netzwerke wachsen, während unbenutzte degenerieren und synaptische Prozesse leiblichen Erkennens - 156 - Verknüpfungen sich wieder lösen. Im Sport sind solche Muster des geformten Verhaltens besonders wichtig. Ohne motorische Gewohnheiten wäre es bspw. dem Turner, dem Skifahrer oder dem Basketballer nicht möglich, schwierige und komplexe Handlungsmuster abzurufen oder Kunststücke zu bewerkstelligen. Dies betrifft allerdings nicht nur Handlungsmuster, sondern gleichviel Denk- und Wahrnehmungsmuster, die - wie oben gezeigt werden sollte ebenfalls als aktive Vorgänge, also als Handlungen verstanden werden müssen! Wir nehmen gewohnheitsmäßig wahr. Menschliche Gewohnheiten erscheinen als Ausbildung von Automatismen, das heißt von VerhaltensDenk- und Wahrnehmungsformen des Menschen, die auf einen gegebenen Reiz hin automatisch ablaufen. Motorische Handlungen, aber auch Gedanken und Wertgefühle, sind häufig automatisiert, um dem Menschen die ständig neue Auseinandersetzung mit der Umwelt zu erleichtern. Kognitive Automatisierungsschemata sind versachlicht, und das an der Sache automatisierte Denken ist kritikfest und immun gegen Einwände. Deshalb halten viele Menschen ihre Gewohnheiten unbewusst für die Grundregeln der Welt. Bei motorischen Gewohnheiten ist die Kritikfestigkeit an dem starken Widerstand zu erkennen, den diese ihrer Auflösung und Neukombination entgegenstellen. Auch das „Aufgeben oder (die) Revision von Werthaltungen und Gewohnheiten, die das bisherige Leben bestimmt haben“ (Beckers, 1992, 67), sind sehr mühsam. Durch Gewohnheiten ist der Mensch an die diversen Anforderungen der Umwelt angepasst. Sein Können hinsichtlich einer bestimmten Funktion wird immer differenzierter, seine Aufmerksamkeit ermüdet langsamer, wodurch seine Leistungsfähigkeit steigt84. 84 In unserer arbeitsteiligen Kultur ist es der Fachmann, der die effizienteste Habitualisierung verkörpert (vgl. Veblen. In: Gehlen, 1957, 105f.). Prozesse leiblichen Erkennens - 157 - Im Sport werden optimale Bewegungsabläufe durch die Fixierung auf gelungene Kohärenzen reproduziert. Die dafür notwendige Lenkung bzw. Automatisierung der Wahrnehmung resultiert in der Habituation derselben (vgl. Beckers, 1986, 94). Infolgedessen kommt es, insbesondere im Hochleistungssport, zu einem „Bewegungs- und Wahrnehmungsautomatismus“ (ebd., 107). Ein erfolgreicher Bewegungsablauf ist auf externe, objektive Vorgaben ausgerichtet und nur insofern auf interne, subjektive Wahrnehmungen, als sie zur optimalen Ausführung von standardisierten Bewegungsabläufen nützlich sind (vgl. ebd., 16). Dadurch kann die persönliche Entwicklung stagnieren. Um sie wieder zu mobilisieren, ist eine „Ent-habituation, bzw. Deautomatisierung“ (Ornstein. Zit. nach: ebd., 95) erforderlich. Durch Automatisierung von Verhaltens- und Erkenntnisweisen kann neues und exploratives Verhalten unterbunden sein. Dies ist allerdings Voraussetzung für erfolgreiche Anpassung und Erkenntniszuwachs, wie andererseits tradierte und bewährte Verhaltensmuster das Überleben erleichtern können. Durch die konventionelle Reglementierung von nicht unmittelbar erkennbar Funktionalem oder zweckfreiem Verhalten wird ein gewisser Erkenntnisverlust verursacht, weil neue Erkenntnisse über die unbekannte eingeschliffenen und sich Denk- ständig ändernde Handlungs- und Welt nicht vor aus allem Wahrnehmungsmustern gewonnen werden können (vgl. Feyerabend, 1997, 89/188ff.). Um neue Erkenntnisse zu gewinnen, müssen eingefahrene Erkenntnismuster überwunden werden, denn die Wirklichkeit wird durch ein erfahrungsabhängiges Filtersystem gesehen. Das ist leicht nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass nur der kleinste Teil der wahrgenommenen Daten überhaupt ins Bewusstsein vordringt. Das Gehirn zieht immer voreilige Schlüsse, es filtert aus dem Wahrgenommenen nur das Nötigste heraus, trifft vorbewusst semantische Entscheidungen. Es entwickelt seine Vorurteile auch in Anlehnung an gültige Konventionen, die dadurch das Erkennen ungewohnter Wirklichkeitsaspekte und -zusammenhänge verhindern. Prozesse leiblichen Erkennens - 158 - Durch die Reflexion und Variation von subjektiven Automatismen sind folglich neue Erkenntnisse generierbar. Internalisierte Wahrnehmungsgewohnheiten wirken meist unbewusst. Der intentionale Leib führt mit der Welt „einen verborgenen Dialog“ (Gordijn. Nach: Trebels, 1992, 24). Levinas nennt dieses Phänomen „anonym fungierende Intentionalität“ (2007, 42), die den Weg zum Anderen eröffne (vgl. ebd., 138/139). Das Eingreifen des Denkens in diese anonym fungierende Leiblichkeit führt sogar zur Störung ihrer erfolgreichen Ausführung, was an dem Beispiel des Pianisten deutlich wird85. Diese phänomenologische Erkenntnis passt zu dem neurophysiologischen Befund, dass die zuständigen Hirnstrukturen weniger aktiv werden, sobald eine gewisse Fertigkeit erworben wurde. „Es wird dann offenbar ein ökonomischer neuronaler Code eingesetzt“ (Singer, 2008b, 40). Diese Ökonomisierung von Handlungen kann dazu führen, dass der Mensch sich nur widerstrebend mit neuen Wahrnehmungsmustern vertraut zu machen versucht. 3.2.2 Doppelter Erfahrungsbezug von Erkennen Der erste Bezug zur Erfahrung meint die Geprägtheit von Wahrnehmungsrastern durch Erfahrung. Der zweite Bezug bezeichnet die Konstitution von Erfahrung durch diese Wahrnehmungsraster. Gewohnheiten entstehen nicht ohne weiteres, sondern sind ein genaues Abbild der akkumulierten Erfahrung des Subjekts, die dessen habituelle Leiblichkeit 85 konfiguriert. Die Erfahrung von etwas geht mit Der Pianist hat das Stück in seinen Fingern. Deshalb braucht er nach einiger Zeit des Einübens auch keine Noten mehr. Er kann während des Spiels seinem eigenen Leib zuhören, der die Musik in Erscheinung bringt ohne dass die Finger bewusst gelenkt würden. Die erworbene motorische Gewohnheit ist erstaunlich komplex und wird durch Denken sogar gestört. Der „Leib wird nicht gelenkt, sondern er korrespondiert selbst der ertönenden Musik“ (Merleau-Ponty, 1966, 176). Das hier wirksame „implizite Wissen“ hat Bockrath (2007) mit Bezug auf Bordieu und Polanyi in die sportpädagogische Debatte um Grenzen der Standardisierung eingebracht. Fuchs (2000) spricht in diesem Kontext von „Leibgedächtnis“ (316). Schmidt-Millard (2007, 10) beleuchtet das Phänomen in Anlehnung an Waldenfels (1999, 2000) aus bildungstheoretischer Perspektive. Prozesse leiblichen Erkennens - 159 - „Veränderungen in den synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen“ (Singer, 2008b, 62) einher. Auch die auf kausale Strukturen gerichtete Perspektive der Neurophysiologie belegt anscheinend die Erfahrungsabhängigkeit von Wahrnehmungsmustern. Da Wahrnehmung in Abhängigkeit von Erfahrung selektiert und Wahrgenommenes mit Bekanntem vergleicht, wird häufig das bewusst gesehen, was bekannt ist. Die durch Erfahrung geprägte habituelle Wahrnehmung bestimmt, was wir von dem sehen, worauf wir blicken. Neues bleibt unsichtbar. Wir erkennen stets innerhalb eines Paradigmas. Drei Beispiele mögen zur Veranschaulichung der unbewussten Produktivität von Wahrnehmung hilfreich sein. 1. Es findet ein Kartenspiel statt, in dem „anomale“ Spielkarten ausgeteilt werden. Das sind eine schwarze Herz Fünf und eine rote Pik Neun. Die Versuchsperson bemerkt keinen Unterschied zu herkömmlichen Karten (vgl. Kuhn, 1976, 75f.). Erst durch eine äußere Autorität, der man glaubt - nämlich den Experimentator -, wird die Probandin überzeugt, dass sie ohne Rücksicht darauf, was sie gesehen hat, die ganze Zeit auf eine schwarze Herz Fünf geblickt hat. 2. Die Einwohner der karibischen Inseln hatten vor der Invasion durch Kolumbus noch nie ein Flagschiff oder eine Karavelle gesehen. Ihr Medizinmann bemerkte Wellen in der Bucht, ohne die spanischen Schiffe zu sehen. Erst nach Tagen tauchten sie für ihn auf, obwohl sie die ganze Zeit dort waren. Als die anderen Stammesmitglieder auf das gekräuselte Wasser der Lagune blickten, konnten sie auch nichts erkennen, was auf die Ursache für die Wellen schließen ließ. Bis der Medizinmann ihnen von den Schiffen erzählte und darauf hinwies. Weil sie ihm - der anerkannten Autorität - glaubten, sahen auch sie die Schiffe. Man sieht also nur was man glaubt (vgl. Maturana, 1994, 36). Jedenfalls nur das, was man schon kennt: Erkannt wird Bekanntes. 3. Ein Himmelskörper, der im 18 Jahrhundert Jahrzehnte lang beobachtet werden konnte, wurde als ungewöhnlich großer Fixstern angesehen. Da Prozesse leiblichen Erkennens - 160 - dies der Wirklichkeit nicht gut entsprach, hatte der Astronom Lexell später die Idee, es könne ein Planet sein. Als man diese Anregung akzeptiert hatte, gab es in der Welt der Astronomen einen Fixstern weniger und einen Planeten mehr. Dieser Himmelskörper wurde nach 1781 anders gesehen, da er, genau wie die anomale Spielkarte, nicht länger in die von dem früher vorherrschenden Paradigma gelieferten Wahrnehmungskategorien eingeordnet werden musste. Die Folgen dieser Wahrnehmungsverschiebung reichen so weit, dass die Astronomen, weil sie darauf vorbereitet waren weitere Planeten zu finden - in den ersten fünfzig Jahren des 19. Jahrhunderts zwanzig weitere Planeten mit Standardinstrumenten identifizieren konnten (vgl. Kuhn, 1976, 127f.). Die Leichtigkeit und Schnelligkeit mit der die Astronomen jetzt neue Dinge sahen, wenn sie mit alten Geräten alte Objekte betrachteten, verleitet Kuhn zu der Aussage, dass sie „fortan in einer anderen Welt lebten“ (vgl. ebd., 128). Um feste Blickwinkel zu überwinden bedarf es anscheinend eines Fingerzeigs von außen; von jemandem, dem man glaubt. Doch von wo soll dieser Hinweis für die scientific community herkommen? Diese Gemeinschaft versteht sich ja selbst als Autorität auf dem Gebiet der Wahrheitsfindung. Folglich entscheidet diese Gemeinschaft selbst über Wahrheit und Täuschung. In einem letzten Schritt wird der zweite epistemische Bezug zur Erfahrung vertiefend erörtert. Es ist der gleiche Bezug zwischen Erfahrung und Wahrnehmung, nur in umgekehrter Richtung: Durch Erfahrung konturierte Wahrnehmungsraster erzeugen ihrerseits entsprechende Erfahrungen. Es ist zu zeigen, dass die vorgestellten Erkenntnisraster auch immer wieder die ihnen entsprechende Erfahrung erzeugen, die deshalb auch an der Konstitution des Subjekts als Selbst Anteil nehmen86. 86 Franke (2004, 181f.) hebt bei einer Kritik an Trebels Darstellung des dialogischen Bewegungskonzeptes darauf ab, die Konstitution des Subjekts werde übersehen. Nachfolgend soll deutlich werden, dass das Subjekt als Konstituiert- Prozesse leiblichen Erkennens Durch Erfahrung wird - 161 - das Erkenntnisvermögen des Subjekts konfiguriert. Es erkennt fortan Bekanntes. Das Erkannte bildet das Fundament für Handlungen und Handlungsmuster, die ihrerseits eine ihnen korrelierende Erfahrung produzieren. Diese Erfahrung - sie ist der Vorherigen zumindest ähnlich, wenn nicht gleich - aktualisiert Wahrnehmungsraster, die durch ihre Intentionalität Welt hervorbringen. Der doppelte Erfahrungsbezug mündet gleichsam in einen Kreislauf. Dies ist der Grund, warum viele von uns immer wieder die gleichen Erfahrungen machen und immer wieder die gleiche Realität „konstituieren“. Abb. 2 Erzeugungsprozess von Erfahrung Um sein Leben oder seine Persönlichkeit zu verändern und weiter zu entwickeln, muss man diesen Kreislauf erkennen, um ihn bewusst durchbrechen zu können. Das heißt, man ändert seine gewohnte Perspektive, erkennt Neues, handelt ungewohnt und erzeugt eine andere Erfahrung - der Kreislauf wird zur Spirale und eine persönliche Entwicklung möglich. Krankhafte und schädliche Verhaltensmuster müssen reflektiert werden, um durch andere ersetzt werden zu können. Dieser subjektive Bildungsprozess ist durch zielgerichtete (Hochschul- und Schul)Erziehung zu katalysieren (vgl. Kap. 3.2.3), weil das Subjekt allein - ebenso wie eine intersubjektiv konstituierende Gemeinschaft - aufgrund der erläuterten Charakteristik des habituellen Erzeugungsprozesses von Erfahrung kaum einen Ausweg aus dem Kreislauf finden kann. Die konstituierendes aufgefasst werden muss. Maturana Selbstkonstitution des Subjekts als „Autopoiesis“ bezeichnet. (u.a 1994) hat die Prozesse leiblichen Erkennens - 162 - „Macht der Gewohnheit“ - also die kritikfeste anonym fungierende Intentionalität - verhindert das. Dieser Gedanke scheint nicht allein pädagogisch, sondern insbesondere erkenntnistheoretisch relevant. 3.2.3 Inkorporierte Sozialstrukturen Erkenntnisprozesse sind hochgradig abhängig von der Umgebung des Subjekts, das nicht nur physikalisch-biologischer, sondern vor allem sozio-kultureller Natur ist. Als Ansatzpunkt zum Verständnis und zur Transformation des geschilderten Kreislaufs zu einer Spirale erscheint also das soziale Feld, dem das Subjekt ausgesetzt ist. Die angewöhnten Muster der Wahrnehmung sind nämlich nicht nur durch individuelle Erfahrungen geformt, sondern außerdem durch „kulturelle Gütemaßstäbe“. Beckers (1993, 12f.) weist darauf hin, dass kulturelle Gütemaßstäbe sich in „Mustern des geformten Verhaltens“ (ebd.14) spiegeln, die aus in einem bestimmten Umfeld akkumulierten Erfahrungen hervorgehen und nur in diesem gültig sind (vgl. ebd., 15). Dieser Gedanke entspricht dem Habitus-Konzept des Soziologen Bourdieu, das vor allem durch Bockrath (2007) und Franke (2001) in die sportpädagogische Diskussion eingeführt wurde. Bourdieu hat auf dem phänomenologischen Fundament des Zur(Sozial)Welt-Seins das Konzept des Habitus entwickelt, das die Inkorporation des Sozialen im Subjekt bezeichnet. Der Körper ist in der Sozialwelt, wie die Sozialwelt im Körper ist. Der Habitus ist ein „System von Dispositionen und Schemata, das als Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmatrix fungiert“ (Bohn, 1991, 32), durch die soziale Welt bestätigt, bzw. reproduziert wird. Im Gegensatz zu einer materialistischen Theorie des Erkennens, die Erkenntnis auf einen Aufnahmevorgang, einen Widerspiegelungsakt reduziert und die tätige Seite des Erkennens dem Idealismus überlässt, impliziert das Habitus-Konzept, dass jede Erkenntnis einen spezifischen Denk- und Ausdrucksschemata ins Werk setzenden Konstruktionsakt darstellt (vgl. Bourdieu, 1987, 729). Diese strukturierende Tätigkeit ist Prozesse leiblichen Erkennens - 163 - keineswegs Ausfluss universeller Kategorien und Formen, wie es intellektualistische Idealisten behaupten, sondern sie fungiert gemäß inkorporierten Schemata. Damit erscheint der Habitus zugleich „als Erzeugungsprinzip - modus operandi“ (Bohn, 1991, 32) und als Erzeugtes. Als strukturiertstrukturierendes generatives Prinzip87. Die von den sozialen Akteuren im praktischen Erkennen eingesetzten kognitiven Strukturen sind inkorporierte soziale Strukturen, die als geschichtlich ausgebildete Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata „jenseits von Bewusstsein und diskursivem Denken“ (Bourdieu, 1987, 730) arbeiten88. Dieser Gedanke erklärt auch die intersubjektiv einheitliche Erscheinung von Welt. Dies schließt jede Trennung von Subjekt und Welt aus, „weil der Körper (…) exponiert ist, weil er in der Welt ins Spiel, in Gefahr gebracht wird, (…) ist er in der Lage, Dispositionen zu erwerben, die ihrerseits eine Öffnung zur Welt darstellen, d.h. zu den Strukturen der sozialen Welt, deren leibgewordene Gestalt sie sind“ (Bourdieu, 2001, 180). Deshalb seien die „von der Wissenschaft konstruierten Objekte die sozialen Bedingungen der Möglichkeit des ‚Subjekts’ und die möglichen Grenzen seiner Objektivierungsakte zu suchen“ (Bourdieu, 1996, 249). Von hier aus sieht Bourdieu die Erforschung des Unbewussten des Forschers als „absolute Voraussetzung für die wissenschaftliche Praxis“ (ebd., 248). Die erste Neigung des Habitus sei schwer zu kontrollieren, schreibt Bourdieu mit Verweis auf die Stoiker89, „aber die reflexive Analyse, die uns lehrt, dass wir selber der Situation einen Teil der Macht geben, die sie über uns hat, 87 „Die sozialen Akteure bedingen, vermittelt über sozial und historisch zustande gekommene Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, aktiv die Situation, die sie bedingt“ (Bourdieu, 1996, 170). 88 Klinge stellt daher fest: „Wahrnehmung findet also immer im Rahmen verinnerlichter, inkorporierter Erfahrungen statt. Ein voraussetzungsloses, ‚authentisches’ Wahrnehmen gibt es deshalb nicht“ (2008, 2).Die „bestimmte Weise“, in der wir die Dinge immer schon wahrnehmen (vgl. Meyer-Drawe. Zit. nach: ebd.) ist folglich zu beleuchten, um „authentischem“ Wahrnehmen ein Stück weit näher zu kommen. 89 Die pflegten zu sagen: Über die erste Regung vermögen wir nichts, wohl aber über die zweite. Prozesse leiblichen Erkennens - 164 - ermöglicht es uns, an der Veränderung unserer Wahrnehmung der Situation und damit unserer Reaktion zu arbeiten“ (1996, 170). Durch die Einsicht in unsere Wahrnehmungsschemata versetzen wir uns in den Stand, Bedingtheiten und Dispositionen zu überwinden. Folgt man dieser These und verbindet sie dann mit dem oben (Teil 1) Dargelegten, so ergibt sich, dass heutige Wahrnehmungsraster, die überwiegend Quantifizier- und Messbares sichtbar werden lassen, emotionale Bewusstseinszustände wie bspw. Empathie, Mitgefühl, Liebe, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Treue häufig unbewusst ausselektieren. Hier bestätigt sich der Erkenntnisakt als ein „die höchste Form der Anerkennung der Sozialordnung implizierenden Akt der Verkennung“ (Bourdieu, 1987, 735), weil sein Zusammenhang mit der von ihm reproduzierten realen Ordnung verborgen bleibt. Deswegen wiederholt und belebt das Subjekt das „ökonomische Verdikt in dem Glauben, es sei sein eigenes“ (ebd.). Eingedenk der oben geschilderten vorbewussten Erkenntnismechanismen, die allem Anschein nach außerordentlich machtvoll sind, zeigt sich das Subjekt des Erkenntnisprozesses als vergessenes und dadurch sich selbst vergessendes Subjekt90. Um zur ständigen Reflexion dieser Zusammenhänge in der wissenschaftlichen Praxis und somit auch zur Realisierung pädagogischer Ansprüche beizutragen, müssen Anhaltspunkte für eine adäquate Erkenntnishaltung gewonnen werden, die vor allem der tätigen Seite menschlichen Erkennens Rechnung tragen. Dieses Erfordernis verweist erneut und nachdrücklich auf das Subjekt und dessen leibliche Erkenntnispotenziale. 90 „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus – der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt – entwickelt“ (Marx Thesen über Feuerbach. Zit. nach: Bourdieu, 1976, 137). Prozesse leiblichen Erkennens - 165 - 3.2.4 Der Leib als Erkenntnisquelle In Kapitel 2.5.6 wurde erörtert, dass leibliche Erkenntnis nicht verabsolutiert werden braucht, um deren Erkenntnispotenziale fruchtbar machen zu können. Vielmehr erscheint die Nutzung leiblicher Erkenntnisquellen in der Wissenschat als Desiderat und sollte demgemäß als Ergänzung zu rationaler Erkenntnis in Betracht gezogen werden. Innerhalb der erläuterten Einheit von Subjekt und Welt, die durch Wechselwirkung charakterisiert ist und auf Seiten des Subjekts durch dessen Habitus zum Tragen kommt, existiert das erzeugende und erzeugte Subjekt. Dieses Subjekt muss als untrennbare Einheit angesehen werden, zumal alle Teilungen sich bis hierhin als artifiziell entpuppt haben. Das Subjekt ist die untrennbare Einheit von Körper und Geist, die nachfolgend Leib genannt wird. Aufgrund seiner ontischen Ambiguität ist der Leib mit rationalen Erkenntnisquellen allein - die infolge seiner Fragmentierung aufgewertet wurden - nur bedingt fassbar. Was das Denken an ihm zum Vorschein bringen kann, ist im Grunde genommen nur die Außendimension, den Leib-für-Andere. Indes: „Der Andere-als-Gegenstand ist nur eine unaufrichtige Modalität des Anderen“ (Merleau-Ponty, 1966, 509). Der Objektivierung des Leibes scheint es geschuldet, dass der Leib des Forschers als Erkenntnisinstrument von der Wissenschaft bisher nicht systematisch genutzt wurde. Das rationale Denk- und Beschreibungssystem der Wissenschaft, das Fühlen und Spüren immer in Zeichen übersetzt, stößt deshalb insbesondere bei dem Versuch, den Anderen - der ja fühlendes Subjekt ist - zu verstehen, bald an Grenzen. Und die durch die gültigen Wissenschaftskriterien eingeforderte Distanz zum Gegenstand mündet in einer beschränkten Nutzung des beträchtlichen Erkenntnispotenzials der eigenen, leiblichen, sinnlichen und bewusstseinsmäßigen Erfahrung, die den Zugang zum Anderen erschließen kann. Diese leibliche Erfahrung Prozesse leiblichen Erkennens - 166 - bezeichnet nicht bloße Empfindung91, sondern einen Zusammenschluss von sinnlichen und intellektuellen Erkenntnisquellen, die im Leib vereint sind. Leib - in Abgrenzung zum Körper - muss als geistiger Leib und leiblicher Geist verstanden werden, wodurch Geist nicht auf rationale und technische Intelligenz reduzierbar ist. Dieser begriffliche Apparat ist konstruiert, um bei der Suche nach alternativen Quellen menschlicher Erkenntnis dualistische Denkschemata gleichsam zu unterlaufen. Ein entsprechendes Verständnis von Erkenntnis unterstreicht die Mechanismen seiner Hervorbringung, die gemäß dem oben Ausgeführten (3.1.2.2) eine Trennung von Subjekt und Welt sowie von Geist und Körper ausgeschlossen erscheinen lassen. Demgemäß kann leibliche Erkenntnis keinesfalls innerhalb des Einzugsgebietes rationalen Denkens verortet werden, das - wie gezeigt werden sollte - nur seiner materialen und sozialen Strukturierung korrelierende Dimensionen von Welt hervorbringen kann. Leibliche Erkenntnishaltung muss sich vielmehr auf die Wiedervereinigung des Denkers mit dem Gedachten, des Spürenden mit dem Gespürten richten, die diese Haltung erst ermöglicht. Vor allem aus der Soziologie sind Anregungen zum Verständnis des Leibes als Erkenntnisquelle hervorgegangen92. In der Sportwissenschaft hat sich unter anderen besonders Franke ausdrücklich mit dieser Thematik befasst. Er findet in präreflexiver Erkenntnis mit Waldenfels das Moment der Rhythmisierung, das die vorbewusste Synthesis von Wahrnehmungsprozessen kennzeichne (vgl. Franke, 2003a, 31-33). Raum, Bewegung und Rhythmus seien „nicht nur kontext-relevante Faktoren für den Körper“, also Aspekte, die von außen betrachtet Bedeutung haben, „sondern gleichzeitig immer auch konstitutive Bedingungen für die Ausprägung einer bestimmten Form von Körperlichkeit“ (Franke, 2008, 16). Von diesem Gedanken aus erscheint 91 Das bloße Empfinden ist immer perspektivisch gebunden und deshalb nicht mit Erkennen gleichzusetzen. 92 Knorr-Cetina befürwortet den Einsatz des Leibes als „Weltsondierungsinstrument“ (2002b). Bourdieu (1996; 1987, 738-740) sieht ihn als Speicher von Erfahrung. Implizites Wissen sei primär leiblich verankert (vgl. Bockrath, 2007). Prozesse leiblichen Erkennens - 167 - rhythmisches Schwingen von Lebendigem - in Abgrenzung zur mechanischen Taktung - als Bezugsphänomen für Ein- und Mitfühlung und also als erkenntnistheoretisch relevantes Merkmal zum Fremdverstehen. 3.2.5 Leibliches Verstehen Nicht rationale Weisen der Wirklichkeitserfassung, die vorbewusst von dem Leib geleistet werden, erscheinen als Wissen sui generis, das zu Erkenntnissen anderer Art führen kann. Folgerichtig scheint durch die gezielte Nutzung leiblicher Erkenntnisquellen - komplementär zu systematischem, explizitem Wissen - umfassendere Erkenntnis gewonnen werden zu können. Derartiges Wissen außerordentlich scheint relevant. in pädagogischen Beispielsweise ist Zusammenhängen das Problem der Fremderfahrung zwischen Erzieher und Zögling hier ein zentrales Phänomen93. Die Stimme, das Gesicht, der Blick, die Haltung, die Pausen, der Ausdruck des Gegenübers verraten nicht die Logik des Inhalts, sondern die Inszenierung der Rede, die kognitiv nicht fassbar ist. Man spürt vielmehr eine Stimmung, die nur unter dem Verlust von Wesentlichem in Sprache übersetzbar erscheint. Der Andere scheint mir eher als „Spur“ (Levinas, 2007) denn als Eindeutiges gegeben. Leiblich-affektive Wahrnehmungen können hier einen alternativen Zugang zum Verstehen des Anderen bedeuten. Abraham greift Levinas’ Motiv der Spur auf: „Die auf diese Weise eingeholten Erkenntnisse tragen den Charakter einer ‚Spur’. Sie können den Weg weisen“ (2002, 203). Solche Erkenntnisse sind zur Realisierung pädagogischer Ansprüche unverzichtbar. Denn pädagogisch wichtige Phänomene wie Kooperation, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Rücksichtnahme, Verantwortung und 93 Der Erzieher darf bei dem Erkennen des Schülers nicht einfach von sich ausgehen, wie das einfache Einfühlungstheorien, wie die von Th. Lipps (Hua XV, 319f.; Hua Ι, 91f.), vorgeben. Er muss „Befreier“ (Nietzsche) sein und den Zögling „an sich gewahr werden lassen, wie der Mensch immer von innen heraus leben muss“ (Goethe, 1998, 374). Prozesse leiblichen Erkennens - 168 - Freude sind nur ganzheitlich wahrnehmbar. Es nützt zu deren Verständnis nichts, sie in irgendwelche Teile zu zerlegen oder sie zu kategorisieren, um sie wissenschaftlich überprüfbarem Denken zugänglich zu machen. Sie werden offenbar anhand des Ausdrucks des Anderen unmittelbar leiblich erkannt. Als Forscher oder als Lehrer erkennt man den Blick, die Haltung, die Mimik eines zu Untersuchenden und fühlt mit. Nur durch ein solches leibliches Mitschwingen wird die pädagogisch interessante Gefühlswelt des Anderen überhaupt aufschliessbar. Phänomene der Imitation scheinen diesen Aspekt der Selbstbewegung, den Tamboer „Weltverstehen in Aktion“ (Tamboer, 1994, 37) nennt, zu belegen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene ahmen Gesten und Wörter nach. Verbringen zwei Menschen viel Zeit gemeinsam, so werden sie sich in Sprache, Haltung und Gestik angleichen. Auf der ursprünglichsten präobjektiven Ebene der Koexistenz sehe ich im Anderen immer nur soviel, als ich selbst in mir trage. Nach Sartre ist mir der Andere unmittelbar und präreflexiv gegeben. Merleau-Ponty versucht die Frage nach dem Verstehen des Anderen zu beantworten, indem er auf eine dem Denken vorausliegende Sphäre der Zwischenleiblichkeit verweist: „Es ist mein Leib, der den Leib des Anderen wahrnimmt, und er findet in ihm so etwas wie eine wunderbare Fortsetzung seiner eigenen Intentionen, eine vertraute Weise des Umgangs mit der Welt“ (Zit. nach: Seewald, 1995, 217). Die starke Ähnlichkeit des Leibes ermögliche so etwas wie leibliches Verstehen. Das Verstehen des Anderen „gründet sich auf die wechselseitige Entsprechung meiner Intentionen und der Gebärden des Anderen, meiner Gebärden und der im Verhalten des Anderen sich bekundenden Intentionen“ (Merleau-Ponty, 1966, 219). Abraham schreibt Zwischenleiblichkeit: mit Bezug auf dieses Phänomen der Prozesse leiblichen Erkennens - 169 - „So ist der Leib in der Lage, die Intentionen eines anderen Leibes wahrzunehmen, was sich in unwillkürlichen Mitbewegungen oder auch in Konterbewegungen zeigen kann, ohne dass dabei das Bewusstsein eingeschaltet werden müsste. Der Leib reagiert auf den Leib des Anderen über seine eigenen Kanäle“ (2002, 191). Die „Vermöglichkeit meines Leibes“ messe sich dem Leib des Anderen an (vgl. Merleau-Ponty, 1966, 219). Verständnis werde möglich, wenn mein Leib in der so angezeigten Richtung seinen eigenen Weg finde (vgl. ebd.). So bestätigt der Andere mich und ich ihn. Unmittelbare Verständnisprozesse laufen also nicht nur in eine Richtung, sondern sie sind Wechselspiel. Leibliches Verstehen richtet sich in eins auf den Anderen und zurück auf mich. Das Verstehen des Anderen lässt mich nicht unberührt. Die Situation macht etwas mit mir. Sie ergreift mich, lässt mich schaudern, schmunzeln oder nachsinnen. Ich verstehe den Anderen, indem ich mich ihm einfüge und der ursprünglichen Bewegung meines Leibes folge. Um dieses Mitschwingen des eigenen Leibes mit dem Anderen bewusst und kommunikabel zu machen, um also an jene Schichten der Welt und des Beobachters heranzukommen, die vor dem Denken und Sprechen liegen, ist es - so Seewald – notwendig, den Weg vom vorstellenden zum erlebenden Bewusstsein zurückzufinden (vgl. 1995, 214f.). Der Blick des Gegenübers zeigt Gefühlswelten, die sich dem Denken entziehen. Trotzdem gewährt er Einsichten von hohem epistemischen Wert. Eigentlich kann von Phänomenen wie dem Blick sowie der Haltung des Anderen gar nicht abgesehen werden, wenn man diesen verstehen will94. Obwohl so gewonnene Erkenntnis kaum verallgemeinert und also überprüfbar erscheint, darf sie nicht einfach geleugnet und übersehen werden. Sie muss mit anderen Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung ergänzt und abgeglichen werden. Dabei gilt es, Widersprüche nicht einzuebnen, sondern sie auszuhalten. Denn es bleibt 94 Sartre hat das ambivalente Phänomen des Blicks umfassend bearbeitet (vgl. 1991, 338f.). Prozesse leiblichen Erkennens - 170 - sicherlich ein unauflösbarer Rest, ein „Bedeutungsübergang“ (Seewald, 1995, 232), den man ertragen muss. Wissenschaftler fortwährend hierauf aufmerksam zu machen erscheint somit als lohnenswertes Ziel. Ansätze zur Kultivierung leiblichen Erkennens sollten im Rahmen zukünftiger Forschungen dezidiert vertieft werden. 3.2.6 Die Methode der Ideierung Die Haltung, aus der leibliches Verstehen möglich ist, wird nachfolgend durch eine Skizze Max Schelers’ Philosophie konkretisiert. Damit wird einer doppelten Forschungsfeld Zielsetzung nachgegangen. „intentionale Leiblichkeit“ Erstens soll Vorwürfen das der „Unwissenschaftlichkeit“ entzogen werden und zweitens soll eine Methode angerissen werden, die in sportpädagogisch relevante Fragenkreise eingeführt werden könnte. Ein erweitertes Erkenntnisquellen Wissenschaftsverständnis verwenden, die könnte empathische einer „leiblichen in Erkenntnishaltung“ münden, um an den Bereich der primären Erfahrung heranzukommen, ohne auf den Aufstieg von Empfindung zu Erkenntnis zu verzichten. Scheler hat hierzu die phänomenologische Methode der „Entwirklichung“ eingeführt, die von folgenden ontologischen Grundgedanken ausgeht. Zur Wiedergewinnung des Subjekts gehört die Anerkennung der subjektiven Gefühlswelt. Die ist offensichtlich höchst real und keineswegs geträumt oder ausgedacht. Scheler wandte die phänomenologische Methode in modifizierter Weise auf den Bereich der Gefühle an, der Husserls Interessen kaum berührte95. 95 Er tat dies in ausdrücklicher Abgrenzung zu Kant, wenn er schreibt: „Was wir also – gegenüber Kant – hier entschieden fordern, ist ein Apriorismus des Emotionalen und eine Scheidung der falschen Einheit, die bisher zwischen Apriorismus und Rationalismus bestand. (…) Das Fühlen, das Vorziehen, das Lieben und Hassen des Geistes (Leibes d. Verf.) hat seinen eigenen apriorischen Gehalt, der von der induktiven Erfahrung so unabhängig ist, wie die reinen Denkgesetze. Und hier wie dort gibt es eine Wesensschau der Akte und ihrer Materien, ihrer Fundierung und ihrer Zusammenhänge. Prozesse leiblichen Erkennens - 171 - Scheler unternahm es also, den riesigen Bereich des Irrationalen in Erkenntnisprozesse mit einzubeziehen96. Dies ist eine klare Absage an den Intellektualismus, der den Anderen doch letztlich immer als Objekt ansieht. Will man den Anderen jedoch in seiner Person erkennen, ist ein umgekehrter Zugang „transzendentalen Ego“ nötig. Man (Husserl), beginnt dem der nicht bei Anschein einem eines solipsistischen Konstrukts anhaftet, sondern bei dem Gedanken, den Scheler prägnant formuliert: „Es gibt kein ich ohne ein Wir“ (1954, 90)97. Das Wesen meines Seins ist schon Sein-mit-Anderen, oder wie Sartre sagen würde „Sein-für-Andere“, weshalb ich den Anderen schon vor aller Intellektualisierung immer durch meinen Leib verstehe. Die alltägliche Erfahrung, dass es ein außerhalb von mir existierendes Du gibt, wird mir zur Bestätigung meiner eigenen Existenz. Dieses Du ist wie ich selbst zuvorderst Person und nicht Sache. Will man den Anderen als Person, also in seinem eigentlichen Wesen entdecken, so sind nicht nur intellektuelle, sondern emotionale Akte zu analysieren, wie sie uns täglich vorkommen98. Die Einsicht in die wechselseitige Konstitution von Subjekten innerhalb des Sozialen scheint durch Schelers Gedanken vertieft werden zu können. Der aktiv konstituierende Charakter von Wahrnehmung, der oben (3.1.f.) umrissen wurde, erscheint dabei als zentrales Motiv von Erkenntnis überhaupt. Und hier wie dort gibt es ‚Evidenz’ und strengste Exaktheit der phänomenologischen Feststellung“ (Scheler, 1954, 85f.). Bei der Untersuchung der Grundlagen der Ethik könne man, so Scheler, die Gefühle nicht einfach übergehen. 96 So konnte Scheler (Nach: Pivcevic, 1972, 131f.) durch die Anerkennung des Wertes der „nicht-intellektuellen Akte“ besser zum Bereich der Intersubjektivität Zugang finden, der sich Husserl ja so hartnäckig entzog (vgl. Hua XV, 249, 320, 427). 97 Dieser Gedanke ist Grundlage der existenzialistischen Philosophie vor allem Sartres, die Schelers Ontologie aufruht. 98 Schelers These ist, dass naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht die höchste Form der Erkenntnis darstellt, deren ein Mensch fähig ist. Sie bediene sich jener „technischen Intelligenz“, deren auch Tiere bis zu einem viel geringeren Grad fähig sind. Der Unterschied des Menschen zum Tier werde durch die menschliche Fähigkeit zur metaphysischen Erkenntnis über sich selbst begründet und erst dadurch sei ein Wesensunterschied von Mensch und Tier begründet (vgl. Scheler, 1954, 92; 1995, 36). Der Mensch allein habe Zugang zum Reich der Essenzen, von dem auch Husserl sprach und das jetzt durch Scheler um die emotionalen Akte erweitert wird. Diese Rede verleiht der Schelerschen Ontologie einen deutlichen platonischen Anstrich. Prozesse leiblichen Erkennens - 172 - Scheler sieht den Menschen als der Welt triebhaft zugewandt. Ähnlich wie Straus (vgl. 1956, 207f.) findet er zwei Modi des menschlichen Gerichtetseins auf die Welt: „Auf-zu oder Von weg“ (ebd.); „Verlangen oder Abscheu“ (Scheler, 1995, 54). Eine solche Zuwendung müsse vorhanden sein, wenn es auch nur zur einfachsten Empfindung kommen soll. „Das ursprüngliche Wirklichkeitserlebnis als Erlebnis des Widerstandes der Welt geht also allem Be-wußtsein, geht aller Vor-stellung, aller Wahr-nehmung vorher (Hervorheb. im Original)“ (ebd.). Denn Wahrnehmung sei schon geformt durch mannigfaltige und zufällige Abschattungen der Dinge, die immer nur ihr „Sosein“, aber nie ihr „Dasein“ geben. „Was uns das Dasein gibt, das ist vielmehr das Erlebnis des Widerstandes der schon erschlossenen Weltsphäre“ (ebd., 53). Deshalb sind andere Personen als Personen nicht gegenstandsfähig. Das Subjekt sei wesentlich „ein stetig sich selbst vollziehendes Ordnungsgefüge von Akten“ (ebd., 48). Der selbst mentale Prozesse noch schauende Leib, den Scheler „Geist“ nennt und der jedem Subjekt zugesprochen werden könne, sei nicht objektivierbar. „Nur dadurch können wir an (Personen) wissenden Anteil gewinnen, dass wir ihre freien Akte nach- und mitvollziehen (Hervorheb. im Original) durch (…) jenes die Haltung der geistigen Liebe mögliche ‚Verstehen’, das äußerstes Gegenteil aller Vergegenständlichung ist“ (ebd.). Erkenntnis liegt also niemals nach oder vor den Dingen, sondern in und mit ihnen. Darum ist ein „Mitvollzug dieser Akte nicht ein bloßes Auffinden oder entdecken eines von uns unabhängigen Seienden, sondern ein wahres Mithervorbringen, ein Miterzeugen (…) aus dem Zentrum und Ursprung (Hervorheb. im Original) der Dinge selbst heraus“ (ebd., 49). Die aktive Weltzuwendung des Subjekts entspringe dem „Lebensdrang“ des Menschen. Das Subjekt konstituiert deswegen schon während jedes Erkenntnisaktes Welt als Soseiende. Das Dasein der Welt bleibt gleichsam hinter den zufälligen Abschattungen der Welt verborgen. Der Prozesse leiblichen Erkennens - 173 - Mensch kann also aufgrund seines Lebensdranges, aufgrund seiner tief verwurzelten Triebhaftigkeit, seiner Existenzmodi des ‚Auf zu’ oder ‚Von weg’, das Dasein der Wirklichkeit nicht erkennen. Dies ist auch die Existenzweise des Tieres, das wie ‚fest gekettet am Pflock des Augenblicks’ (Nietzsche) die Welt immer bejahen muss. Auch wenn es verabscheut und flieht, sagt es noch ja zu der Welt, die primär Widerstanderlebnis ist. Folglich gelte es, diese Triebhaftigkeit zu inhibieren. Dabei gehe es um eine „Außerkraftsetzung des Lebensdranges“ (Scheler, 1995, 55), um einen Akt der „Entwirklichung“ (ebd.), den Scheler als „ideierenden Akt“ bezeichnet. Der Mensch sei das einzige Lebewesen, das dazu in der Lage sei. Er sei der „Asket des Lebens“, der „ewige Protestant gegen die Wirklichkeit“ (ebd.); er sei der Neinsagenkönner. Durch die Technik der Entwirklichung soll also nicht nur das Existenzurteil aufgehoben werden, wie Husserl meinte. Die Urteilsenthaltung anerkennt ja schon ein widerstandabhängiges Erlebnis. Vielmehr sei das „Realitätsmoment“ selbst zusammen mit seinem „affektiven Korrelat“ aufzuheben (ebd. 54). Denn jede Wirklichkeit sei durch ihren Widerstandscharakter „für jedes lebendige Wesen zunächst ein hemmender, beengender Druck und die reine Angst (ohne jedes Objekt) ihr Korrelat“ (ebd. 55). Die phänomenologische Reduktion wird gleichsam eine Ebene tiefer und mit Blick auf Emotionales vollzogen. Überdies ist das exekutive Zentrum der Reduktion nicht das reine Bewusstsein, sondern der Leib. Wenn Dasein Widerstand ist, kann der Akt der Entwirklichung nur in der Aufhebung jenes Lebensdranges bestehen, im Verhältnis zu dem die Welt vor allem als Widerstand erscheint, und der zugleich die Bedingung aller sinnlichen Wahrnehmung des zufälligen Soseins ist. Und den Akt der Außerkraftsetzung des Lebensdranges kann nur der Leib vollziehen. Es ist dies ein Willens- und ein Hemmungsakt zugleich. Prozesse leiblichen Erkennens - 174 - Diese Modifikation der phänomenologischen Reduktion realisiert ein Schauen, das an einen Ausspruch Buddhas erinnert: ‚Herrlich ist es, jedes Ding zu schauen, furchtbar es zu sein’. Empfindung und technische Intelligenz können durch den besagten Willensakt in Erkenntnis überführt werden. Diese kontemplative Methode macht Fremdverstehen dadurch möglich, dass das Wesen des Anderen, d.h. seine Person, unmittelbar geschaut wird99. Dabei spielt die Fähigkeit zur Empathie, also zur Mit- und Einfühlung, eine elementare Rolle. Außerdem können inkorporierte Sozialstrukturen des erkennenden Subjekts reflexiv in den Erkenntnisprozess mit eingebracht werden, um Erkenntnisse zu präzisieren. Komplementär zu der phänomenologischen Wiedervereinigung von Subjekt und Welt wird durch diese Haltung die artifizielle Trennung von Verstand und Körper des Subjekts aufgehoben, um das Subjekt auf zweifache Weise für die Wissenschaft zurück zu gewinnen. 3.3 Qualitative Forschung Die Geschichte der Phänomenologie dokumentiert in erhellender Weise Ursprung und Genese Paradigmenwechsels (vgl. eines Kap. derzeit 2.2f.), sukzessive der auch stattfindenden die Lehre wissenschaftlicher Methoden nicht unbeeinflusst lässt. Phänomenologie und Hermeneutik bilden die „wissenschaftstheoretische Basis für qualitative Forschungsmethoden“ (Lamnek, 1988, 49). Qualitative Methoden erscheinen als konsequente Weiterführung subjektorientierter Erkenntnistheorien. Fundament qualitativer Forschung sind beispielsweise die phänomenologisch begründete Lebensweltanalyse Husserls (Kap. 2.4), die phänomenologische Hermeneutik Heideggers (1993, 152f, 312f.), die existenzialistische Philosophie der französischen Phänomenologen (Kap. 2.5) sowie die philosophische Hermeneutik Gadamers (1960), der Heideggers Schüler war und bei dem sich die 99 Das meint Mach, wenn er sagt: „Das Auge darf keinen Umweg über den Verstand nehmen“. Prozesse leiblichen Erkennens - 175 - Notwendigkeit einer Wendung zum Subjekt auch in methodologischer Dimension deutlich abzeichnet. 3.3.1 Zur Kritik an der quantitativen Sozialforschung Das Erfordernis die in jedem Erkenntnisprozess involvierten Subjekte auch methodologisch ausdrücklich in Rechnung zu stellen kann mit Lamnek (1988, 6f.) entlang „wichtiger Kritikpunkte an der traditionellen quantitativen gleichzeitig Sozialforschung“ eine objektivistischen einsichtig Zusammenfassung Denkens darstellen oben und gemacht werden, entfalteter den die Probleme methodologischen Gegenentwurf qualitativer Sozialforschung besser begreifbar machen. Quantitative Erhebungsverfahren reduzieren die stets subjektive Erfahrung auf objektivierbare Häufigkeiten. Die dergestalt restringierte Erfahrung geschieht zum Zwecke der Kontrollierbarkeit der Welt (Kap. 1.1.6) und zur Stabilisierung von Herrschaft (Kap. 3.2.3). Nach naturwissenschaftlichem Vorbild wird das Subjekt zum Objekt transformiert (Kap. 1.2.2). Der Forschungskontext wird häufig ausgeblendet. Ein bestimmter Methodenapparat verselbständigt sich gegenüber den Sachen, wodurch die eigentliche Struktur eines Gegenstandes der eigenen Methodologie zuliebe verleugnet wird (vgl. Lamnek, 1988, 12f.; vgl. Feyerabend, 1997). Die Sache wird hinter die Methode zurückgestellt, was offenbar Ausfluss der Faszination vom „Gesetz der großen Zahl“ (Kap. 1.1.1) und des daraus erwachsenen Messfetischismus ist. Forschungsfragen, die mit der verfügbaren Methodologie nicht exakt erfasst werden können werden ausgeschlossen, anstatt sie zum Anlass zu nehmen, für sie adäquate Methoden zu entwickeln. Quantitative Methodologien halten hartnäckig an diesem „Primat der Methode“ (vgl. Lorenz, 1973a, 43) und also an der Außenperspektive der „dritten Person“ fest100. Dem ist eine Verdinglichung der beforschten 100 „Aber der Umstand, dass für die Erkenntnistheorie der Standpunkt der dritten Person charakteristisch ist, sollte uns nicht blind machen gegen die Tatsache, dass die tatsächliche Ontologie der Geisteszustände eine Ontologie der ersten Person ist“ (Searle, 1996, 30). Prozesse leiblichen Erkennens - 176 - Subjekte geschuldet, durch die das Subjekt-für-sich, also dessen individuelle Perspektive, nicht in den Blick geraten kann. „Die Dinghaftigkeit der Methode, ihr eingeborenes Bestreben, Tatbestände dingfest zu machen, wird auf ihre Gegenstände, eben die ermittelten subjektiven Tatbestände übertragen, als ob diese an sich dingfest wären“ (Adorno, 1972, 514). Die unreflektierte Anwendung außenperspektivischer Erhebungsmethoden hat sich besonders in den Naturwissenschaften trotzdem als außerordentlich hilfreich erwiesen. Leblose Untersuchungsgegenstände sind gemäß ihrer Struktur, die keine Innenperspektive und also keine Subjektivität aufweist, quantitativ ziemlich101 gut fassbar. Die beteiligte Subjektivität des Forschers kann häufig ignoriert werden, Messungenauigkeiten auftreten. ohne dass Wenn dadurch dieser gravierende Forscher hingegen Menschen beforscht ist man unleugbar mit dem objektiven Faktor Subjektivität - und dann streng genommen auf doppelte Weise (Betrachter und Betrachteter) - konfrontiert. „Von der naturwissenschaftlichen Methodologie müssen sich die Sozialwissenschaften schon deshalb unterscheiden, weil ihr Gegenstand eben nicht naturwissenschaftliche Objekte, sondern menschliche Subjekte sind“ (Lamnek, 1988, 14). Durch standardisierte Methoden werden die beforschten Menschen zu puren „Datenlieferanten“ (ebd.). Ent-subjektivierung und Depravation können aber keine Kriterien für Wissenschaftlichkeit sein, unter anderem weil es ja gerade die Subjekte sind, über die man etwas wissen will. Während die Verabsolutierung der naturwissenschaftlichen Außenperspektive folglich als Vorbild für Wissenschaften vom Menschen ungeeignet erscheint, versuchen qualitative Verfahren, die Lebenswelt und die Subjekte nicht in den Schatten einer Methode zu 101 Erst auf subatomarem und kosmologischem Gebiet ist die durch die subjektive Perspektive des Betrachters bedingte „Verzerrung“ so beträchtlich, dass außenperspektivische Methodologie offenkundig versagt (vgl. Kap. 1.3.3). Prozesse leiblichen Erkennens - 177 - stellen, sondern die Methode sich allein aus dem Gegenstand entwickeln zu lassen, den sie konstituiert. Dergestalt generierte Methoden erscheinen gegenstandsadäquat und also besser geeignet, den Menschen als Subjekt zu erfassen. „Dies impliziert auch die Berücksichtigung der Individualität und Einzigartigkeit des beforschten Objekts als Subjekt“ (Lamnek, 1988, 12). Elementares Bestreben qualitativer Verfahren ist es, eben diese Perspektive der „ersten Person“ aufschließen um an die genuine Erfahrung des Subjekts zu gelangen. Naturwissenschaftliche Außenbetrachtungen müssen durch hermeneutisch-phänomenologischen Nachvollzug der Innenperspektive des zu untersuchenden Menschen zumindest ergänzt werden. Beispielsweise kann man anhand quantitativer epidemiologischer Studien zu Erkenntnissen über die Häufigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in NRW gelangen. Die Beweggründe der Frauen, die sich zu einem Abbruch entscheiden, kann man hingegen zutreffender durch qualitative Verfahren ermitteln. 3.3.2 Zentrale Prinzipien qualitativer Forschung Die Grundlagen qualitativer Sozialforschung werden nachfolgend nur rudimentär erörtert, weil die Zielrichtung der vorliegenden Untersuchung erkenntnistheoretischer und nicht methodologischer Provenienz ist102. Gleichwohl erscheint es aus pragmatischer Hinsicht sinnvoll, zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung anzumerken, die aus erkenntnistheoretischen Überlegungen stammen. Hochstandardisierte Antwortkategorien Erhebungstechniken nivellieren und vorformulierte möglicherweise die Informationsbereitschaft des Befragten. Aus diesem Grund verzichtet qualitative Sozialforschung weitgehend auf Hypothesenbildung und verlagert den Schwerpunkt der Forschung von standardisierenden Techniken zur sorgfältigen Felderkundung. Hypothesenbildung ohne vorgängige ausführliche Exploration des Feldes gilt qualitativen 102 Zur erschöpfenderen Würdigung qualitativer Forschungsmethodologien vgl. Lamnek, 1988 und Strauss, 1996. Prozesse leiblichen Erkennens - 178 - Forschern als fährlässig, weil bei der Überprüfung der entworfenen Hypothesen nur Phänomene erfasst werden, die nicht durch das theoretische Hypothesenkonstrukt ausgesiebt wurden (vgl. Kap. 3.2). Deshalb versteht sich „qualitative Sozialforschung nicht als hypothesenprüfendes, sondern als hypothesengenerierendes Verfahren“ (Lamnek, 1988, 23). Der Hypothesenentwicklungsprozess beginnt nachdem Daten erhoben und Feldbeobachtungen durchgeführt wurden und rekurriert zu jeder Zeit auf die gewonnen Daten um fortwährend aktualisiert werden zu können. Jede so generierte Hypothese wird als vorläufig angesehen. Strauss (1996) spricht bei diesem methodischen Vorgehen von „Gegenstandsverankerung“, weil Theoriebildungsprozesse nicht lebensweltvergessen, sondern unter ständiger 103 Bezugnahme auf Lebenswelt vorangetrieben werden konkreter . Von hier aus erscheint eine prinzipielle Offenheit des Wissenschaftlers unverzichtbar. Die zu untersuchende Gegebenheit sowie die Konzeption des Gegenstandsbereiches sollen folgerichtig als vorläufig angesehen werden. Dadurch wird eine offene Erkenntnishaltung kultiviert, die dem kommunikativen Prozesscharakter von Gegenstand und Froscher Rechnung trägt. Die Untersuchungspersonen, Offenheit den des Forschers gegenüber Untersuchungssituationen und den den Untersuchungsmethoden ist ein wichtiges Charakteristikum qualitativer Forschung. Die Verzögerung einer theoretischen Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch Hypothesensysteme entspricht zudem nicht allein dem Prinzip der Offenheit, sondern ebenfalls der Einsicht, dass Forschung als Kommunikation zwischen Forscher und Beforschtem zu begreifen ist. Die Einflüsse dieser Interaktionsbeziehung werden nicht als „Störgrößen“ aufgefasst, die durch Verfeinerung der Methode zu eliminieren sind. Vielmehr wird dieses kommunikative Verhältnis als konstitutiver Bestandteil des Forschungsprozesses angesehen. Damit ist jede Datengewinnung schon eine kommunikative Leistung. Das Prinzip 103 Kodiertechniken der Grounded Theory finden sich bei Strauss, 1996, 43-148. Prozesse leiblichen Erkennens - 179 - „Forschung als Kommunikation“ (Lamnek, 1988, 23) entspricht dem wichtigen Gedanken, dass jede Erkenntnis der Wirklichkeit standpunktabhängig ist und Wirklichkeitsdefinitionen folglich perpetuell zwischen den Teilnehmern des Kommunikationsprozesses ausgehandelt werden (vgl. Kap. 3.1 und 3.2). Aus der Sicht qualitativer Forscher seien deswegen in Beobachtung und Interview möglichst „natürliche Kommunikationssituationen“ (Lamnek, 1988, 24) zu schaffen, deren Dialogcharakter durch standardisierte Erhebungen natürlich nicht entsprochen werden kann. Der Grundannahme des „interpretativen Paradigmas“ (ebd., 43) folgend, verweist jede Äußerung des Menschen auf den Zusammenhang, in dem sie vollzogen wird. Die Bedeutung jeder menschlichen Handlung wird als kontextgebunden begriffen und verweist stets auf das Ganze der Situation. Sinnkonstitution und Sinnverstehen sind demnach zirkulär. Die zu analysierende Sinnkonstitution erfordert eine Verstehensleistung, die produktiv auf diesen Zirkel reflektiert. Gadamer spricht dabei vom „hermeneutischen Zirkel“. Insofern zunehmend Konstituiertes verstanden und reflexiv in künftiges Verstehen eingebracht wird, kann man diesen Zirkel allerdings zutreffender als Spirale bezeichnen (vgl. Kap. 3.2.2), weil immer weiter und höher reichendes Verstehen möglich wird. Die qualitative Sozialforschung folgt diesem hermeneutischen Zirkel, indem sie während des Forschungsprozesses fortlaufend zum Phänomen zurückblickt und am Ende dieses Prozesses zum Ausgangspunkt zurückkehrt (vgl. Lamnek, 1988, 27). Praktisch gewendet bedeutet dies, dass spontanes Reagieren auf neue Konstellationen für den Forscher möglich bleiben muss. Er muss für Unerwartetes offen und flexibel bleiben und sein Methodeninstrumentarium anpassen können. Flexible Erhebungsverfahren können sich den jeweiligen Eigenheiten des Untersuchungsgegenstandes besser anpassen. Offenheit, Kommunikation, Lebenswelt und Subjekt können zusammenfassend als zentrale Merkmale qualitativer Sozialforschung konstatiert werden. Sportpädagogische Implikationen - 180 - Qualitative Forschungsmethoden - als methodologisches Produkt phänomenologisch-hermeneutischer Erkenntnistheorien - führen in jenen Wissenschaftsbereichen zu sinnvollen Ergebnisse, in denen es um menschliche Subjekte geht. Von daher kann es nicht überraschen, dass Verfahren qualitativer Sozialforschung auch in der Sportpädagogik seit Mitte der achtziger Jahre an Bedeutung gewonnen haben (vgl. Hunger, 2000, vgl. Miethling, 2004). Der Paradigmenwechsel von objekt- zum subjektorientiertem Denken scheint dennoch in den Sportwissenschaften nur ausgesprochen schleppend Fuß fassen zu können. Um diesen Wechsel konstruktiv zu beschleunigen wird nachfolgend versucht, die phänomenologische Erkenntnishaltung in die Wissenschaften vom Sport zu überzuführen, um elementare Grundlagen einer subjektiv akzentuierten Sportwissenschaft entfalten zu können. 4 Sportpädagogische Implikationen Um die phänomenologische Erkenntnishaltung auf die sportpädagogische Denk- und Handlungsrealität anzuwenden werden abschließend exemplarische Ansätze zu deren Implementierung in Bewegungs- und Bildungstheorie vorgezeichnet. Diese zwei Themenkreise sind ausgewählt, weil sie den Gegenstand des Sports (Bewegung) sowie den der Pädagogik (Bildung) unmittelbar betreffen. Auf wissenschaftstheoretischer Ebene wird eine subjektorientierte Bewegungstheorie aufgerissen (3.2.1), die nötig ist, weil Selbstbewegung keine „Resultante mechanischer Abläufe“ (S. 137) ist. Unter bildungstheoretischem Gesichtspunkt wird das bildende Potenzial des Sports in den Blick genommen (3.2.2), dass nur aus einem prinzipiell „offenen Erkenntnisansatz“ (S. 115) und vermittels einer konsequenten Wendung zum Subjekt erschlossen werden kann. Abschließend werden Gedanken und Ideen zur Optimierung einer dementsprechend ausgerichteten Lehrerausbildung entwickelt (3.2.3), durch die die „andere Vernunft“ (S.88) zugleich aktiviert und umgesetzt werden soll. Mithilfe Sportpädagogische Implikationen - 181 - des erörterten epistemologischen Instrumentariums wird also versucht, sich sportwissenschaftlichen Problemen von der Subjektseite her zu nähern. 4.1 Konturen einer subjektorientierten Selbstbewegungstheorie Bei Versuchen, das Subjekt für die Wissenschaft zurück zu gewinnen, beansprucht das Problem des Einbezogenseins des Beobachters (vgl. Kap. 1.3.3) elementaren Stellenwert. Das betrifft ebenmäßig die Sportwissenschaft, was anhand ihres Gegenstandes - der Selbstbewegung - deutlich gemacht werden kann. Erkenntnis und Interesse sind immer eng verflochten (vgl. Habermas, 1968), weil die Perspektive eines Beobachters den Gegenstand konstituiert. Vor dem Hintergrund unseres mechanistischen Weltbildes kann es also nicht verwundern, dass heute dominierende Bewegungstheorien Sich-bewegen als primär mechanischen Vorgang erscheinen lassen. Bewegungstheorien, die das Subjekt ausklammern, sind bei pädagogischen Fragestellungen allerdings kaum hilfreich, sie sind dafür auch nicht entwickelt worden. Trebels stellt unter Bezugnahme auf maßgebliche Beiträge zur Bewegungslehre von Willimczik/Roth (1983) und Meinel/Schnabel (1976) fest, dass „Bewegung als der äußerlich beobachtbare Aspekt und Motorik als der Innenaspekt“ des Bewegungsgeschehens ausgelegt werden. „Orts-, Zeit- und Geschwindigkeitsmerkmale“ einerseits und „Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer sowie Koordination“ andererseits stehen „im Zentrum der Bewegungsforschung“ (1992, 20). Dabei werde nur der „Außenaspekt“ von Bewegung zum „objektivierbaren Untersuchungsgegenstand“ gemacht, was Bewegung auf mechanische Abläufe reduziert. „Wenn vom Lebendigsein des menschlichen Körpers abgesehen wird“ sei dies „der Preis für die Objektivierung“ (ebd., 21). Die menschliche Selbstbewegung muss aus dieser Perspektive unverständlich bleiben, weil das Subjekt der Bewegung, die konkrete Bewegungssituation sowie die Bedeutung, die die Bewegungsaktion leitet, unzureichend berücksichtigt werden. Sportpädagogische Implikationen - 182 - Die Art, wie Bewegung gedacht wird, zeigt sich bei entsprechenden Erhebungsverfahren, bspw. bei Messungen. Eine Messung ist immer mit epistemologischen Schwierigkeiten verbunden. Denn Messgeräte verkörpern gültige Gütemaßstäbe, weil sie entwickelt worden sind, um ganz bestimmte Aspekte der Wirklichkeit reliabel festzuhalten. Und zwar nur die Aspekte, die für wichtig gehalten werden. Andere Aspekte werden nicht verzeichnet. Durch diese Perspektive auf das Untersuchte wird somit nur der Wirklichkeitsaspekt beleuchtet und vertieft, der schon bekannt ist. Dieser Ausschnitt ist durch den Betrachter - in diesem Fall das Messinstrument - konstituiert, so dass die Ergebnisse vor allem Aufschluss über die Erkenntnisraster desjenigen offenbaren, der das Instrument konstruiert hat. Die Struktur des Gerätes bestimmt die Auswahl des Erkannten. Bezogen auf die besondere Erfahrungsform des Messens entsprechen die vom Menschen „künstlich herbeigeführten und aufrechterhaltenen, unverzichtbaren Messgeräteigenschaften dem kantischen Apriori“ (Janich, 2000, 66). Keine Vermessung und Berechnung ist voraussetzungsfrei. „Messende Wissenschaften verkennen manchmal, dass ohne vorgängige, d.h. (relativ) apriorische Zwecksetzung für die moderne Technik des Messens (und übrigens auch des Experimentierens) keine Erfahrung in Form von Messdaten zustande kommt“ (ebd., 70)104. Dadurch kann nur die Wahrheit erkannt werden, die ohnehin schon feststeht. Erst durch auftretende Anomalien wird die Konstruktion anderer Messgeräte initiiert, die dann neue Phänomene vertiefen. Neuigkeiten entdecken kann die Messung kaum, auch weil der Sinnzusammenhang von menschlicher Selbstbewegung in ihrem Kontext durch ein Messgerät 104 Das bedeutet, dass kein Objekt innere Eigenschaften besitzt, die von seiner Umwelt unabhängig sind. Seine Eigenschaften „hängen von der experimentellen Situation ab, das heißt von der Apparatur, zu der es in Wechselbeziehung treten muss“ (Capra, 1983, 81/82). Befunde der Quantenphysik und neuerdings der Genetik untermauern damit Niels Bohrs Idee der wechselseitigen „Komplementarität“ (Bohr, 1958, 20), womit die klassische Vorstellung von festen und getrennten Objekten obsolet ist. Sportpädagogische Implikationen - 183 - nicht „gesehen“ wird. Der Versuch, Selbstbewegung zu messen, beinhaltet demnach prinzipiell die Gefahr, Selbstbewegung mit Bewegung im Sinne von bewegt werden zu verwechseln. Da Sportwissenschaft sich als Handlungswissenschaft (Franke, 1978) versteht, „in deren Mittelpunkt das sportliche wie auch spielerische Bewegungshandeln des Menschen steht“ (Meinberg, 1996, 14), muss sie jedoch vorrangig versuchen, Sinn- und Bedeutungszusammenhänge von Bewegung zu erschließen. Um diese Zielsetzung ansteuern zu können, reichen quantitative Erhebungen nicht aus. Vielmehr ist der Wissenschaftler auf direkte Beobachtung angewiesen. Bei den „Sachen selbst“ erscheint es möglich, neue Phänomene zu entdecken, die vielleicht von Tragweite auch für andere Forschungsrichtungen sind. Beachtet man hierbei die intentionale Verwicklung des Beobachters in den Beobachtungsprozess, so können dessen erfahrungsabhängig geformte Perspektive sowie sein Erkenntnisinteresse transparent gemacht werden. Von hier aus kann es gelingen, die Aufmerksamkeit aktiv und selbstreflexiv auf neue Phänomene zu richten, wodurch dessen Konstituierung stattfinden kann. Durch diese phänomenologische Methode des Schauens sollen solche Aspekte von Selbstbewegung sichtbar werden, die durch herkömmliche Bewegungstheorien unsichtbar und damit nicht verständlich blieben. Diese Probleme sind heute von einigen Vertretern der Bewegungslehre erkannt worden. Neumaier stellt hinsichtlich der Bewegungsbeurteilungsqualität in der Sportpraxis fest: „Die im Beurteiler selbst wirksamen individuellen Einflüsse auf den Wahrnehmungsprozess (müssen) diagnostiziert werden“ (1988, 21). Das Verständnis von sportlicher Bewegung erfordert demnach eine gründliche Auseinandersetzung mit der Beobachterfrage. „Es ist also nochmals ausdrücklich hervorzuheben, dass die Erfahrungs- und Wissensstruktur einer Person entscheidende Einflussgrößen auf die visuelle Wahrnehmung sind. Je komplexer ein Wahrnehmungsgegenstand ist, desto mehr Gewicht kommt diesen Faktoren zu“ (ebd., 163). Sportpädagogische Implikationen - 184 - Die „subjektive Situationseinschätzung“ (Neumaier, 2003, 61) des sportwissenschaftlichen Beobachters oder Theoretikers ist genau wie die „Bewegungskoordination“ des Sportlers als „intentional“ (ebd.) zu begreifen. Hieraus folgt, dass sportwissenschaftliche Bewegungsforschung die Intentionalität und damit die Subjektivität sowohl des Sich-bewegenden als auch des Beobachters von Selbstbewegung nicht übersehen darf. Die Intentionalität des Subjekts muss schon im Verlauf von Theoriebildungsprozessen ausgewiesen werden, weil jede intentionale Gerichtetheit nur bestimmte Wirklichkeitsaspekte beleuchtet. Diese unterschiedlichen Blickrichtungen sind im Interesse eines umfassenderen Erkenntnisgewinns zusammenzuführen. Dies erfordert interdisziplinäre Forschungen und integrative Ansätze. Ein diesbezüglich beispielhafter Ansatz der neueren sportwissenschaftlichen Bewegungslehre liegt durch Neumaier (2003) bereits vor. Darin neurophysiologische fließen und morphologische, biomechanische, handlungstheoretische Betrachtungen zusammen. Dieses Modell ist auch deswegen interessant, weil im Rahmen der so genannten „handlungstheoretischen Grundauffassung von Bewegung“ (Neumaier, 2003, 56f.) mit Nitsch/Munzert (1997) „Bewegen als Handeln“ begriffen wird. Aus dieser Hinsicht erscheinen drei konstitutive Merkmale von Selbstbewegung, die zugleich als Unterscheidungskriterien von Bewegung und Selbstbewegung fungieren. 1. Bewegung wird als „Systemprozess“ verstanden, in den immer „Personen als Ganze“ verwickelt sind. 2. Um Bewegung verstehen zu können, muss der „situative Kontext“ berücksichtigt werden. 3. „Bewegungen sind immer intentional organisiert, d.h. wir bewegen uns“ (Neumaier, 2003, 56/57). Diese drei Merkmale von Selbstbewegung implizieren zwei grundlegende Gedanken: Einerseits wird durch Aufwertung des Umweltbezugs der Verschränktheit von Subjekt und Welt Rechnung getragen. Andererseits wird das Subjekt als ganzheitlich und intentional Sportpädagogische Implikationen - 185 - verstanden. Offenbar wird dem intentionalen Subjekt der Bewegung zumindest in Teilen der zeitgenössischen Bewegungsforschung eine zentralere Bedeutung beigemessen. Im Licht dieser Tendenz erscheint es nicht abwegig, einen solchen Subjektbegriff auch in geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu gebrauchen. Für die Sportpädagogik ist dies von Gordijn (1975) vermittels des dialogischen Bewegungskonzepts unternommen worden. Seine phänomenologische Charakterisierung von Selbstbewegung erscheint nahezu identisch mit der Neumaiers. Unter Bezugnahme auf Buytendijk (1956) stellt er drei Merkmale von Selbstbewegung heraus, die sie von einer „physikalischen Bewegungstheorie als Ortsveränderung eines Körpers in Raum und Zeit“ (In: Trebels, 1992, 22)105 unterscheiden. Bewegung des Lebendigen sei nur begreifbar zu machen, wenn Bezug genommen werde auf 1. einen Aktor, der Subjekt der Bewegung ist, 2. eine konkrete Situation, in die die Bewegungsaktion eingebunden ist, 3. eine Bedeutung, welche die Bewegungsaktion leitet und sie in ihrer Struktur begreiflich macht. In Übereinstimmung mit den drei Aspekten, die Neumaier unter handlungstheoretischer Perspektive beleuchtet, konvergieren auch die von Trebels genannten Gesichtspunkte auf die Verschränkung von Subjekt und Welt sowie den darin zu verortenden Faktor „intentionales Subjekt“. Dieses Verständnis von Selbstbewegung hat allerdings noch nicht in alle sportwissenschaftliche Teildisziplinen Eingang gefunden, was aktuelle Standardisierungstendenzen dokumentieren, die Subjekte notwendig ausgrenzen. Das Phänomen der Intentionalität bewirkt anscheinend in naturwissenschaftlichen Forschungsfeldern ein Umdenken. Dualistisches 105 Das Werk Gordijns ist bisher nicht aus dem Niederländischen übersetzt worden. Deshalb ist man bei dem Studium des dialogischen Bewegungskonzeptes auf seinen Schüler Tamboer verwiesen. Außerdem hat Trebels Gordijns Schriften in die deutsche Sportpädagogik eingeführt. Sportpädagogische Implikationen - 186 - Ursache-Wirkungs-Denken wird sukzessive als Hindernis für das Denken neuer Bewegungsstrukturen wahrgenommen. „Man kommt mit der Übernahme von gebräuchlichen Bewegungsanweisungen, die nur Einzelaspekte der Bewegung betreffen, nicht aus, sondern wir brauchen für die Praxis eine ganzheitliche Sicht der wesentlichen Bewegungszusammenhänge“ (Kassat, 1995, 56). Kassat spricht von Bewegungsbetrachtung“, einem der „grundsätzlichen nötig sei (ebd., Wandel in 40/41). der Beim Bewegungsgeschehen ist die Frage „Was soll erreicht werden“ (ebd., 51) ganz entscheidend, ja konstitutiv für die Bewegung. Dies befördert das intentionale Subjekt ins Blickfeld. Das deutet schon Meinel an wenn er schreibt: „Die Struktur der Bewegung ist durch den Zweck bestimmt, der verwirklicht werden soll. (…) Die Bewegungsstruktur bildet sich in der zweckbestimmten Auseinandersetzung mit der Umwelt heraus“ (Meinel, 1960, 148). Leider vertieft Meinel diesen Gesichtpunkt kaum. Doch muss dieser „Zweck, der verwirklicht werden soll, (…) in irgendeiner Weise Inhalt der Bewegungsaufgabe“ (Kassat, 1995, 77) sein. Um eine Bewegung zu verstehen, erscheint es demnach nötig, den Zweck dieser Bewegung zu betrachten. Was Meinel „Zweck“ nennt, betrifft zweifellos die Intentionalität von Bewegung. Die muss anscheinend ausdrücklich thematisiert werden, um Bewegungen überhaupt verstehen zu können. Doch nicht nur die Intentionalität von Bewegung, sondern ebenso jene der Wahrnehmung des Beobachters von Bewegung ist bei der Entwicklung von Bewegungstheorien konsequent zu beachten. Insofern „Theorie“ dem griechischen Wortsinn nach Blicklenkung bedeutet, lässt sie bestimmte Wirklichkeitsaspekte hertreten. Theorien, die Bewegung von außen beschreiben wollen, implizieren also eine Haltung, die auf mechanische Gesichtspunkte von Selbstbewegung konzentriert ist. Kassat liefert hierfür eine leicht verständliche Formulierung: „Bei den bisher üblichen Betrachtungen der äußeren Bewegung blieb der Aspekt Bewegungsaufgabe meist im Hintergrund und fand teilweise überhaupt keine Berücksichtigung. Ausgangspunkt der Bewegungsbetrachtungen waren in der Regel Sportpädagogische Implikationen - 187 - Bewegungsbeschreibungen, bei denen die Bewegungsaufgabe keine Rolle spielt. Wir müssen aber gerade diesem Aspekt eine primäre Bedeutung zuordnen, weil dem Bewegungsgeschehen sonst der eigentliche Sinn fehlt und es dann logischerweise nicht zu verstehen ist.“ (Kassat, 1995, 77). Die Unterscheidung von Bewegungsaufgabe und Bewegungsbeschreibung ist also nicht nur didaktisch relevant, sondern in der Bewegungsaufgabe wird das Subjekt wichtig, in der Bewegungsbeschreibung nur die Sache. Die Gerichtetheit des sichbewegenden Subjekts kann erst durch Reflexion und gegebenenfalls Variation der Wahrnehmungsintentionalität eines Beobachters erkannt werden, wodurch die Intentionalität des Beobachters mit jener des Sichbewegenden korrespondiert. Aufzählungen und Erörterungen von Einzelaspekten können die Bewegung von toten Objekten, aber nicht den Sinn der Selbstbewegung erschließen. Denn Teile erhalten ihren Sinn erst vom Ganzen. Nicolai Hartmanns ontologisches Konzept der Schichtung findet damit in der Bewegungslehre eine Bestätigung (vgl. Kap. 2.5.7.). Der Schichtungsgedanke bezeichnet einen Wesensunterschied zwischen einem Ganzen und dessen Einzelteilen. In der ganzen Bewegung liegt eine Kraft beschlossen, die mehr ist als jede ihrer Äußerungen. Dazu bemerkt Musil: „Auf geheimnisvolle Weise geht im Leben das Ganze vor den Einzelheiten“ (1987, 194). Für die Bewegungslehre bedeutet dies, dass äußerlich sichtbare Einzelaspekte von Selbstbewegung nie mit der intentional aufgeladenen Bedeutung der ganzen Selbstbewegung gleichzusetzen sind. Die Selbstbewegung und deren Beobachter sind durch das Band der Intentionalität miteinander verknüpft, das die Identität beider als relativ, als dialektisch ausweist. Um Selbstbewegung besser verstehen zu können, muss dieses intentionale Band zwischen sich ausweisendem Noema und intentionaler Noesis (Objekt und Subjekt) in Selbstbewegungstheorien reflexiv modifiziert werden, d.h. Sportwissenschaft muss ihren Gegenstand anders sehen lernen. „Es besteht die Notwendigkeit, Bewegung anders zu Sportpädagogische Implikationen - 188 - denken“ (Kassat, 1995, 115). Elementarer Bestandteil dieses neuen Denkens könnte der Gedanke der Intentionalität sein. Die dominierende Perspektive auf Bewegung und die durch sie konstruierte Bewegungstheorie ist anscheinend auf doppelte Weise um den Faktor Subjekt (Subjekt der Bewegung und beobachtendes Subjekt) zu erweitern, damit zu einer ganzheitlicheren Theorie von Selbstbewegung vorangeschritten werden kann. Die exemplarischen Schlussfolgerungen dieses erkenntnistheoretischen Beitrags treten somit neben die seit längerer Zeit verfolgten didaktischen Bemühungen um den offenen Unterricht, der ebenfalls auf einem phänomenologischen Grund steht (vgl. Funke, 1991). Dort sollen u.a. die Wahrnehmungsfähigkeiten der Schüler durch Sport gefördert werden (vgl. u.a. Balz et al., 1997, 21f., Franke, 2003, 18; Klinge, 2008, 4ff.). Das vorliegende Kapitel bezieht sich dagegen nur indirekt auf Schüler, weil ein Anstoß zur Verbesserung von Forschung und Unterricht via Erkenntnisfähigkeitsentwicklung des Wissenschaftlers, oder auch des Sportlehrers gegeben werden soll, der seinen Niederschlag schon während Theoriebildungsvorgängen, bzw. Unterrichtsplanungen und damit letztlich auch in didaktischen Verfahren finden muss. Diese erkenntnistheoretische Begründung phänomenologischer Bewegungstheorien ist aufs engste mit der Frage nach dem bildenden Potenzial des Sports bzw. sportlicher Bewegung verflochten. Auf diesem Fundament erscheint das Subjekt nämlich eindeutig als Sinn stiftend, weswegen es sinnvoll erscheint, subjektorientierte Bewegungstheorien für die Sportwissenschaft weiter zu entwickeln und entsprechende Ansätze, wie etwa den phänomenologischen, auch in pädagogischdidaktischer Hinsicht weiter zu denken. Sportpädagogische Implikationen - 189 - 4.2 Das Bildungspotenzial des Sports… Um Sport als Schulfach zu legitimieren, reicht es nicht aus, ausschließlich sportliche Inhalte zu vermitteln. Vielmehr bedarf es in Ergänzung hierzu eines ausdrücklich pädagogischen Anspruchs dieses Unterrichts, der kaum mit inhaltsleeren Etiketten wie „immanentem Sinn“ (Bernett, 1965) oder „Sinnmitte“ (Kurz, 1986) des Sports begründet werden kann. Erst von einer überzeugenden Begründung der Notwendigkeit eines pädagogischen Anspruchs aus gewinnt eine Verankerung des Schulsports in dem Curriculum der Schule ihre eigentliche pädagogische Berechtigung. Sport als Schulfach muss sich an seinem pädagogischen Anspruch messen lassen, der zugleich die Aufgabe des Sportunterrichts darstellt, die für Grupe „Bildung“ (1967, 131. Zit. nach: Beckers, 2006, 43) ist. Resultate aktueller Anstrengungen, Sport als Schulfach zu legitimieren, werden nachfolgend kurz zusammengefasst. Von dem aktuellen Diskussionsstand aus wird plausibel, dass der zuvor entfaltete Begriff des intentionalen Subjekts als ein Beitrag zur aktuell notwendigen „bildungstheoretisch begründeten Positionierung des Faches Sport“ (Schmidt-Millard, 2007a, 105) angesehen werden kann. Passender Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist die so genannte „Instrumentalisierungs-Kontroverse“ 139/141/163), in Bildungsbegriffes der es im Grunde um für die Sportpädagogik (vgl. eine geht. Prohl, Deutung Obwohl 2006, des diese Kontroverse in dem hier verfügbaren Rahmen nicht in Gänze gewürdigt werden kann, soll sie in wenigen Strichen nachgezeichnet werden. Auf der einen Seite betont Beckers die Wichtigkeit einer qualitativen Erweiterung des Subjekt-Welt-Verhältnisses, die nicht durch eine zu starke Orientierung an der „normativen Kraft des faktischen Sports“ erreichbar sei (1987, 242), sondern immer auch über den Sport hinaus weise. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass Sport keinen kulturunabhängigen, immanenten Sinn aufweise, sondern sich mit der Kultur verändert, die sich im Bewegungsverhalten der jeweiligen Zeit Sportpädagogische Implikationen - 190 - spiegelt (vgl. 1993a, 227). Auf der anderen Seite sieht Schaller Sport als „Selbstzweck“ an. Eine „programmatische Vereinnahmung des Sports für Zwecke jeder Art“ (1992, 11) sei daher strikt abzulehnen. Sinn sei stringent und exklusiv aus dem Basisphänomen Sport zu gewinnen. Die Persönlichkeitsentwicklung der im Sportunterricht vorkommenden Subjekte trete dabei als Epiphänomen auf. Auf dieser Argumentationslinie spricht Brettschneider von dem „Geist des Sports“ und Kurz proklamierte im Rahmen einer pragmatischen Sportdidaktik „Handlungsfähigkeit im Sport“ (1990). Diese Ansichten implizieren einen Bildungsbegriff, nach dem die Bedeutung des „Kulturgeists Sport“ vor der der Subjekte des Sportunterrichts rangiert. Hierbei ist ein pädagogischer Anspruch kaum erkennbar, denn Ziel eines derart konzipierten Unterrichts ist es offenbar nicht, die „Handlungsfähigkeit“ der Subjekte auch über den Sport hinaus zu fördern106. Von daher erscheint diese „traditionalistische Position“ (Schmidt-Millard, 2007a, 105), die einen Rückfall in längst überholte „materiale Bildungsvorstellungen“ (vgl. ebd.) bedeutet, für eine Erziehung zum selbständig denkenden, handelnden und fühlenden Subjekt wenig hilfreich, weil ein pädagogischer Anspruch allein aus der Sache Sport und unter „Ausklammerung des Subjekts“ (vgl. ebd.) begründet wird. Der materiale Bildungsbegriff, der dieser Position innewohnt, hat in eine Legitimationskrise des Schulfaches Sport geführt. Auf diesem Hintergrund wird der Auftrag des Schulfachs Sport derzeit immer noch gegensätzlich diskutiert (vgl. Kurz, 2008). Der Instrumentalisierungsstreit dauert im Gewand anderer Begriffe fort. Die sportpädagogische Fachgemeinschaft gliedert sich heute grob in zwei Lager: Eine Gruppe betont die inhaltliche Ebene des Schulsportunterrichts (Brettschneider, Hummel)107, die andere hebt die 106 Vgl. dazu die damalige Kritik an der pragmatischen Sportdidaktik von Dietrich / Landau, 1990, 75f.; Schmidt-Millard, 1992 und Grössing 1997, 34f. 107 Diese Autoren stellen den Doppelauftrag ausdrücklich in Frage und erachten Entwicklungsförderung als „nachrangig“ (vgl. Brettschneider, 2005, 321) und auf die Förderung der körperlichen und motorischen Entwicklung zu konzentrieren (vgl. Hummel, 2005, 353). Diese Tendenzen erscheinen als Ausfluss eines objektivistischen Paradigmas, das zu der Suche nach Verbesserungen von pädagogisch akzentuiertem Sportpädagogische Implikationen - 191 - dort involvierten Subjekte (u.a. Beckers, Prohl, Schmidt-Millard, Thiele) hervor (vgl. Kurz, 2008, 5). Diese Aufteilung entspricht einer Fragmentierung des v. Hentigschen Ausspruchs: „Die Sache klären, die Menschen stärken“. Dieser traditionellen Auffassung von der zweifachen Aufgabe der Erziehung soll nun auch im Sportunterricht entsprochen werden. Auf dem Weg zu einem Kompromiss war sodann von Handlungsfähigkeit im und durch Sport die Rede. Schließlich kam man überein, den Doppelauftrag von Schulsport in den NRW Richtlinien von 1999 wie folgt auszuformulieren: „Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spielund Sportkultur“. Schulsportunterricht soll innerhalb dieses Spannungsfeldes oszillieren; er soll sich zwischen Inhalten und Personen abspielen108. Um neben der Vermittlung von sportlichen Inhalten ebenso die Ausbildung subjektiver Kompetenzen zu gewährleisten sind sechs pädagogische Perspektiven entwickelt worden, die pädagogisch relevante Aspekte109 der Unterrichtsinhalte hervortreten lassen. Hierdurch wird die inhaltliche Ausrichtung des Sportunterrichts durch den Gesichtpunkt der Persönlichkeitsentwicklung ergänzt. Damit gerät das sich bildende Schulsportunterricht wenig Konstruktives beizutragen scheint. Entsprechende Positionen bedeuten ja im Wesentlichen nur einen Rückschritt zu dem Sportartenkonzept (vgl. Kurz, 2008, 4). Brettschneider (2005, 321) bekämpfe damit den pädagogischen Anspruch, an dessen Stelle wieder der „vermeintliche Sinn des Sports“ treten solle (vgl. Beckers, 2006, 47). „Das ist eine klare Wiederbelebung der überwunden geglaubten Position von 1982“ (ebd.). Außerdem bleibt unklar, warum Persönlichkeitsentwicklung, um die es bei erziehendem Sportunterricht wesentlich geht, dem Bereich „Spaß- und Kuschelpädagogik“ (Hummel, 2005, 353) zufällt. Sie steht ja vielmehr im Zentrum der Entwicklung von mündigen Bürgern und ist damit grundlegend für die Existenz demokratischer Gesellschaften. Demokratie braucht „reflexive Kooperation“ (Honneth) entwickelter und also selbständig denkender Individuen, für deren Erziehung der schulische Unterricht zuständig ist. Um derartige Rückfälle künftig zu verhindern, müssen Lehrer und Theoretiker mit leiblichen Erkenntnishaltungen vertraut gemacht werden. 108 Die Wendung vom sportartenorientierten Lehrplanwerk der 80er Jahre zur aktuellen Lehrplangeneration wird von Stibbe prägnant zusammengefasst: „Von einem instruktionsorientierten Sportunterricht, der auch erzieht, zu einem erziehenden Sportunterricht, der auch instruiert“ (2000, 217). 109 Die pädagogischen Perspektiven, die den Doppelauftrag konkretisieren sollen, rücken folgende Kompetenzen des Schülers ins Blickfeld: Wahrnehmungsfähigkeit, Bewegungserfahrung, Wagen und Verantworten, Leistung reflektieren, Kooperation, Verständigung, Wettkämpfen und Gesundheitsbewusstsein. Die korrekt ausformulierten pädagogischen Perspektiven, die auf diese Kompetenzen zielen, finden sich bei Kurz, 2006 oder Prohl, 2006, 178. Sportpädagogische Implikationen - 192 - Subjekt explizit ins Blickfeld, womit die Grundlage für eine Erziehung zum mündigen Subjekt auch im Sportunterricht geschaffen ist. Der pädagogische Grundgedanke des Doppelauftrags, mit dem sich gegenwärtig der Begriff Erziehender Sportunterricht verbindet, erfährt allerdings auch massive Kritik110. Für Prohl (2006) ist die Anzeichen eines „Begründungsproblems (Doppelauftrag), das ein der pädagogischen Orientierungsproblem der Grundlegung didaktischen Umsetzung (Mehr- Vielperspektivität) nach sich zieht“ (ebd., 182). Ausgehend von einem dieser Kritikpunkte kann verdeutlicht werden, warum der Doppelauftrag noch nicht hinreichend begründet ist und auf welchem tiefer reichenden Aspekt diese Begründung vorgenommen werden kann. Thiele bezeichnet die sechs pädagogischen Perspektiven als willkürlich ausgewählt und theoretisch unbegründet. Er sieht dabei die Gefahr einer „pädagogischen Orientierung im Sinne der vorwegnehmenden Ausrichtung an materialen Wertvorgaben“ (2001, 47). Dies stehe im Zusammenhang mit dem ungeklärten Verhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung, das zwischen pädagogischen und Sinnperspektiven feststellbar sei (vgl. ebd., 46). Obwohl durch die pädagogischen Perspektiven eine deutliche Wendung zum Subjekt und seinen Kompetenzen erfolgt - die über den Sport hinaus in seinem persönlichen Leben von Bedeutung sind - erscheint jedoch vor allem unzureichend, dass die ausgewählten pädagogischen Ansprüche von außen an das Subjekt gerichtet werden. Es müssen folgerichtig Wege ausgelotet werden, den Schüler und dessen Innenperspektive in noch umfangreicherem Maße in die Gestaltung von Unterricht mit einzubeziehen. Die Beachtung der Innenperspektive des Subjekts erscheint als fehlendes Glied in der Begründungslogik des erziehenden Sportunterrichts. Sportlicher Inhalt und persönliche Kompetenzen des Subjekts werden durch den Doppelauftrag berücksichtigt. Kaum aber der Umstand, dass das Subjekt-für-sich Sinn stiftend auf die Welt gerichtet ist und vielmehr sich bildet als gebildet wird. Der Gesichtpunkt der 110 Zur Kritik an dem Konzept des Erziehenden Sportunterrichts vgl. Thiele, 2001, Beckers, 2003, Balz, 2004, Laging, 2005. Sportpädagogische Implikationen - 193 - Innenperspektive des Schülers muss also als dritter Bezugspunkt pädagogischen Denkens neben Inhalt und Person gestellt werden. Unter diesem Aspekt kann das Bildungspotenzial des Sportunterrichts weiter begründet werden. Ein möglicher Weg, das Bildungspotenzial des Sports aus der Bildsamkeit des Subjekts begründen zu können, nimmt seinen Ausgang bei Erwin Straus’ (1956) Gedanken der Einheit von Empfinden und SichBewegen. Aus phänomenologischer Sicht erscheint der Mensch seiner ontischen Struktur gemäß als ein empfindendes und sich-bewegendes Wesen. Er bewegt sich entweder auf die Welt zu oder von ihr weg. Umgekehrt erscheint die Welt ihm attraktiv oder abstoßend111. Diese dialektische Struktur menschlichen Verhaltens hat Freud in seiner Trieblehre anhand der zwei Grundtriebe „Eros und Destruktionstrieb“ (1972, 12) charakterisiert. Diese Grundtriebe alles empfindenden Lebens finden ihre Entsprechung in der Außenwelt qua Grundkräfte112, durch die jedwede Bildung von Subjekten und Objekten sich vollzieht. Subjektive Zuwendung, bzw. Abneigung fallen mit ihren objektiven Korrelaten Anziehung und Abstoßung zusammen, weil Subjekt und Welt untrennbar sind. Innerhalb dieser Verschränktheit von Subjekt und Welt erscheint das Subjekt als fortwährend auf die Welt gerichtet. Dieses intentionale Zur-Welt-Sein des Subjekts konturiert sich während des prozesshaften Mensch-Welt-Bezugs. Die Ausbildung der Intentionalität des Subjekts geschieht in der Begegnung mit Welt, die Objekt- oder Sozialwelt ist. Dabei ist das Subjekt nicht passiv, sondern es formt sich aktiv an der Umwelt, der es durch sein Erkennen und Handeln Sinn verleiht. Sinnfindung obliegt damit der Bildsamkeit des Schülers (vgl. Laging, 2005, 278). Das Subjekt bildet sich selbst an Objekten der Außenwelt, die auch andere Subjekte sein können, weil der Andere mir primär als Objekt vorkommt (vgl. Kap. 2.5.3). Auf den Sport zugespitzt impliziert 111 Scheler hat dieses ontologische Strukturmoment anhand der Begriffe Sympathie und Antipathie analysiert (vgl. 1954). 112 „Über den Bereich des Lebenden hinaus führt die Analogie unserer beiden Grundtriebe zu dem im Anorganischen herrschenden Gegensatzpaar von Anziehung und Abstoßung (Freud, 1972, 12). Sportpädagogische Implikationen - 194 - dies: Der zu überwindende Bock beim Gerätturnen, der zu erzielende Korb beim Basketball oder eben der verteidigende Mitspieler, den es zu überwinden gilt, sind Objekte, an denen das Subjekt sich potenziell bilden kann. Das bildende Potenzial des Sports liegt in der aktiven Begegnung von Subjekt und Weltobjekten beschlossen, die sich relativ bedingen, also auch in den mit der sportlichen Tätigkeit verbundenen Umständen. In diesem dialektischen Prozess findet das Subjekt Widerstände, an denen es Kompetenzen entwickeln kann, die nicht unbedingt nur in sportlichen Situationen nützlich sind. Weiterhin ist Sport - der genuin Sich-bewegen beinhaltet - als Medium außergewöhnlich gut geeignet, diese Bildung am eigenen Leibe zu erfahren. Die Bewegung auf Objekte zu oder von ihnen weg findet schließlich im Sport nicht etwa nur gedanklich und im Sprechen, sondern, viel archaischer, unmittelbar leiblich statt. Selbstbewegung lässt also die Wirkung der Grundkräfte der Welt, die in dem Individuum als Zuwendung und Abneigung angelegt sind, deutlich sichtbar und damit für das Subjekt selbst erfahrbar werden. Diese Erfahrung bildet eindrücklicher als Worte. Die Situationen, die zur bildenden Weltzu- oder abwendung aufgesucht und gestaltet werden, sind allerdings so weit wie möglich in die Wahl und somit Verantwortung des Subjekts zu stellen. Dies entspricht der „Aufrechterhaltung der Leitidee eines prinzipiell selbsttätigen und selbstverantwortlichen Individuums“ (Thiele, 2001, 47). In diesem Sinne muss der Lehrer attraktive Situationen als Aufgaben arrangieren mit denen sich der Schüler auseinander setzt. Für die Art und Weise, wie er das tut, ist der Schüler selbst zuständig. Indem man ihm etwas zutraut und Verantwortung überträgt, steigt seine intrinsische Motivation. Umgekehrt werden Zwangsmaßnahmen und Beharren auf idealtypischen Bewegungsausführungen die intrinsische Motivation und die Gestaltungsfähigkeit des Schülers lähmen. Bildung muss von dem Subjekt selbst ausgehen, das durch pädagogische Intervention dazu angeregt wird, indem Erfahrungsfelder zum Sich-bilden bereitgestellt Sportpädagogische Implikationen - 195 - werden. Die Welt konstituierende Intentionalität des Subjekts ist Beweis für die selbst verantwortete Bildsamkeit des Individuums. Aus phänomenologischer Sicht erscheint das bereits während des Erkenntnisaktes aktiv erzeugende Subjekt also als mächtiger Einflussparameter, dem es mit Sicherheit auch didaktisch zu entsprechen gilt. Den Schüler als intentional konstituierendes Subjekt anzuerkennen, bedeutet in eins Anerkennung seiner Freiheit und Anerkennung der Tatsache, dass Bildung immer reflexiv ist. Der Aspekt der freiheitlichen Entfaltung des Subjekts muss im Unterricht zielsicher angesteuert werden. skizzierten Didaktische Umsetzungsvorschläge für die pädagogischen Leitideen sind allerdings nicht leicht zu finden. Auf diese „Vermittlungslücke“ (Prohl, 2004, 117f.; 2006, 187) zielt der folgende Gedanke. Das intentionale Subjekt Schüler ist, gemäß der Theorie der habituellen Konstitution von Erfahrung (vgl. Kap. 3.1.2), zu jeder Zeit Sinn stiftend an der Konstitution der Unterrichtsinhalte beteiligt, wodurch es zugleich sich als Selbst konstituiert. Für diese zweifache Konstitution durch den Schüler muss ein gebührender Raum geöffnet werden; ein Erfahrungsfeld, in dem Schüler Bewegungserfahrungen zur Einübung leiblicher Reflexivität im Rahmen „ästhetischer Bildungsprozesse“ (Franke, 2003) generieren können. Das leitende Prinzip gewinnt dieses Vorgehen aus der allgemeinen Pädagogik: „Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit“ (Benner, 2001). Hier können methodische Übungsreihen nicht helfen, vielmehr ist eine Öffnung von Unterricht (vgl. Funke, 1991) gefragt, um den nötigen Entfaltungsraum zu gewinnen. Aus dieser Hinsicht erscheint die Konstruktion von Bewegungsfeldern, die in den aktuellen Richtlinien vorgenommen wurde, sehr hilfreich. Die entsprechen nämlich treffender dem vielen Perspektiven vorausliegenden Dasein von objektiven Inhalten, als die konkreten Sportarten, die immer schon durch eine einzige Hinsicht zu Soseiendem geronnen sind. Durch Bewegungsfelder kann die Gelegenheit zu deren konkreter Konstitution in die Verantwortung der Subjekte gestellt werden, die dadurch das Privileg der individuellen Gestaltung von weniger unverfälschter Sportpädagogische Implikationen - 196 - Lebenswelt (wieder)gewinnen. Damit werden sie als aktiv erzeugende Individuen ernst genommen. Geschlossener Unterricht, der mit Bewegungsanweisungen operiert, geht dagegen von der Passivität der Schüler aus, weil sie lediglich Demonstriertes nachmachen sollen. Dies ist hinsichtlich mancher Unterrichtsgegenstände sicherlich sinnvoll etwa wenn ganz grundlegende Techniken im Sinne der Einführung in die bestehende Sportkultur vermittelt werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass durch bloßes Vor- und Nachmachen ein gewaltiges Potenzial bezüglich der Kompetenz zum aktiven Gestalten von Welt verschenkt wird. Schließlich geht es dem erziehenden Sportunterricht um Bildung und Erziehung. Dem anthropologischen Merkmal der intentionalen Weltzu- oder auch abwendung des Subjekts kann vielmehr durch Bewegungsaufgaben entsprochen werden. In Form von Aufgaben können vielfältige Bewegungsanregungen- und aufforderungen in den Schülerhorizont gebracht werden. Dort ereignet sich Bildung, weil Schüler gefordert sind, selbständig Lösungen für ein Bewegungsproblem zu entwickeln. Um die Kooperationsfähigkeit zu schulen, sollte dies möglichst häufig in Gruppen geschehen. Die Verantwortung, die Schülern durch geöffneten Sportunterricht zuteil werden kann, trägt nachhaltig zur Entwicklung von Selbständigkeit und Selbstvertrauen bei, weil die eigenen Fähigkeiten sich in dem „Werk“ spiegeln und als wertvoll erfahren werden können. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Lehrer die Übernahme von Verantwortung durch den Schüler zulässt. Um dies im Unterrichtsprozess zu realisieren, könnte der Lehrer im Sinne eines negativen Erziehungskonzeptes (Rousseau) Zurückhaltung üben. Er beschränkt sich darauf, Bewegungsfelder zu arrangieren und Bewegungserfahrungen zuzulassen, ohne Anordnungen zu treffen und normierte Vorgaben zu postulieren. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Unterrichtsinhalte und -phasen ein deduktives Vorgehen zweckmäßiger erscheinen lassen. Besonders durch induktive Unterrichtsmethoden gewinnt der Schüler jedoch Gelegenheiten, eigene und selbst verantwortete Erfahrungen zu machen. Durch Erfahrung und Sportpädagogische Implikationen - 197 - anschließende Reflexion in der Gruppe kann der Schüler seine individuellen Muster erkennen um sie gegebenenfalls zu variieren. Einer Stagnation der persönlichen Entwicklung kann dergestalt durch Enthabituation (vgl. Kap. 3.2.1) entgegengewirkt werden. Das Ziel dieses Verfahrens besteht darin, dem Schüler Gelegenheiten zu eröffnen, seine Identität vermittels Erfahrung selbst zu konstituieren. Der Schüler soll als individuelle Person aktiviert werden, wodurch zugleich intrinsischer Motivation Vorschub geleistet wird. Pädagogische Perspektiven, die subjektive Kompetenzen fördern sollen und deshalb als Meilenstein in der Entwicklung von Sportunterricht erscheinen, messen der Intentionalität des sich bildenden Subjekts und damit dessen Innenperspektive anscheinend nicht hinreichend Geltung bei. Das Konzept des Doppelauftrags muss folglich um den Gesichtpunkt der Innenperspektive des Subjekts bereichert werden, der anscheinend auf die Aktivierung dieses Subjekts abzielen muss, das allein Sinn erzeugen kann. Diese Zielsetzung erfordert auf der einen Seite eine konsequente Umsetzung des Doppelauftrags, um überhaupt zum Subjekt zu gelangen, und andererseits die Schaffung von offenen Unterrichtssituationen, die diesen Subjekten Gelegenheiten bieten, ihrer individuellen Innensicht entsprechende Bewegungserfahrungen zu erzeugen. Damit wird die Innenperspektive des Schülers erschlossen und damit der Prozess des Sich-bildens angestoßen. 4.3 …und gesellschaftliche Bedingungen für dessen Realisierung Zumindest die Implementierung des Doppelauftrags scheint allerdings gegenwärtig nicht uneingeschränkt gewährleistet zu sein (vgl. Beckers, 2003, 165f.) und wird durch Standardisierungstendenzen, die „gerade das ausblenden was Bildung ausmacht“ (Kurz, 2006, 5) zusätzlich erschwert. Erinnert man an dieser Stelle die erkenntnistheoretischen Untersuchungen Bourdieus (vgl. Kap. 3.2.3), so werden die Ursachen und Gefahren für aktuelle Bildungsfragen klarer erkennbar. In gegenwärtigen bildungspolitischen Verfahren spiegeln sich nämlich Sportpädagogische Implikationen - 198 - kollektive Denkmuster und damit verknüpfte Erkenntnishaltungen. Das Profitdenken der Wirtschaft und die Normierung der Industrie - in diesen Bereichen zweifellos sinnvoll - sind von der Gesellschaft eingeübt und scheinen sich nun in andere Gesellschaftsbereiche, wo sie unangemessen sind, fortzupflanzen. Ökonomische Ziele werden dabei mit solchen der persönlichen Entwicklungsförderung identifiziert, weswegen entsprechende Maßnahmen zwanglos von einem Bereich auf den anderen übertragen werden. Offensichtlich bestätigt sich hier Bourdieus Theorie der unbewussten Reproduktion von sozialen Ordnungen; denn das „ökonomische Verdikt“ (1987, 735) wird von Protagonisten des Bildungssystems - als ihr scheinbar eigenes - fortwährend erneuert. Mit Blick auf die Arbeit Bourdieus wird deutlich, dass es bei standardisierenden Vorgehen anscheinend weniger um einen produktiven Beitrag zur Verbesserung von Schule oder um gerechtere Förderung einzelner Schüler zu gehen scheint - denn durch standardisierte Tests wird beides bestenfalls sekundär erzielt - als tatsächlich um eine eigentümliche Zementierung sozialer Ordnung. Bourdieu hat plausibel machen können, dass sich die eigentliche Wirksamkeit von Macht nicht auf physischer Ebene entfaltet, sondern auf der „Ebene von Sinn und Erkennen“. Die sozialen Akteure seien durch eine Beziehung „hingenommener Komplizenschaft“ verbunden, „die bewirkt, dass bestimmte Aspekte dieser Welt stets jenseits oder diesseits kritischer Infragestellung stehen“ (1992, 82). Die soziale Ordnung ist heute durch ein „Denken in Objekten“ kontaminiert. Diese Ordnung wird durch die sozialen Akteure selbst getragen und vitalisiert. Gesetze und Methoden der Ökonomie scheinen also die Strukturen und Gehalte des Bildungswesens evokativ und gleichsam durch die sozialen Akteure hindurch zu tangieren. Die Subjekte reproduzieren das Objektdenken vermittels ihres vorreflexiv tätigen Erkenntnisvermögens. Um das Subjekt an und für sich auch im Bildungswesen zurück zu gewinnen, sind die Akteure dieses Systems als tätig erkennende zu beleuchten. Auf Grundlage dieser Reflexion können dann die in diesem Sportpädagogische Implikationen - 199 - System involvierten Subjekte als Personen gezielt gefördert werden. In diesem Licht scheint okzidentale Prägung pädagogisches Denken und Arbeiten nicht einfacher zu machen. Vielmehr erscheint es zunehmend schwierig, pädagogische Ansprüche überhaupt zu verwirklichen. Um einen Rückfall in die pragmatische Sportdidaktik oder das überkommene Sportartenkonzept zu verhindern muss deshalb den hohen Ansprüchen, die mit den aktuellen Richtlinien an Lehrer gerichtet werden eine angemessene Ausbildung ihres leiblichen Erkenntnisvermögens (insbesondere Wahrnehmungsfähigkeit und Empathie) gegenübergestellt werden. Dadurch werden Lehrer gleichzeitig in den Stand gesetzt, der Innenperspektive des Schülers besser zur Entfaltung verhelfen zu können und also offenen Unterricht erfolgreich zu inszenieren. Um die Überschrift Erziehender Sportunterricht mit Inhalt zu füllen, müssen Doppelauftrag und offener Unterricht konsequent umgesetzt werden, womit nicht gesagt werden soll, dass Unterricht ausschließlich offen erfolgen kann. Dazu müssen den Neuerungen in den Richtlinien neue Ansätze im Bereich der Lehrerbildung zur Seite gestellt werden. Sportpädagogische Implikationen - 200 - 4.4 Zur Verbesserung der Lehrerausbildung In dem skizzenhaft aufgespannten Rahmen der aktuellen Kontroverse um eine angemessene Ausrichtung von Sportunterricht wird das Hauptaugenmerk nun aus dreierlei Gründen auf das Subjekt Lehrer gewendet: 1. Lehrer sind an vorderster Linie für die Umsetzung des Doppelauftrags verantwortlich. 2. Die Gestaltung von offenen Unterrichtsarrangements kann nicht genau vorgegeben werden, sondern fordert Lehrern ein pädagogisches und didaktisches Gespür ab, das eingeübt werden kann. 3. Erkenntnistheoretische Gedanken, die die Rolle des Lehrers betreffen erscheinen - im Gegensatz zu dem im vorherigen Kapitel thematisierten Subjekt Schüler - in der Sportpädagogik als Desiderat. Mit Blick auf die im Einzugsgebiet der „Qualitätsdiskussion“ (Kurz, 2006) angestrebte Verbesserung von Unterricht sind „Input-Steuerungen“ nicht zu vernachlässigen, obwohl sie schwierig durch quantitative Erfassung kontrolliert werden können. So scheint es etwa zielführend, Struktur und Gestaltung der Ausbildung von Lehrern weiter zu überdenken und zu fördern113. Um das bildende Potenzial des Sports überhaupt für Schüler aktivieren zu können, müssen Lehrer nicht nur in Unterrichtsplanung, Durchführung und Reflexion ausgebildet sein, sondern überdies pädagogische Kompetenzen entwickeln, die wesentlich von der Schulung von Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeiten abhängen. Die Kultivierung von Leiblichkeit bedeutet allerdings in eins, die „Tendenz zur Kognitivierung“ an den Hochschulen zurückzufahren, die „die Sicherheit des Denkens und Besprechens der Welt nur ungern verlassen“ (Seewald, 1996, 89). Die Abtrennung der Wissenschaft von der Lebenswelt manifestiert sich mit Hinblick auf die Lehrerausbildung in einer Kluft zwischen Theorie und Praxis. Die wissenschaftliche 113 Einer aktuellen Infratest dimap Umfrage zufolge denken 63 Prozent der Bundesbürger, dass die Ausbildung von Lehrern den Anforderungen, mit denen sie im Schulalltag konfrontiert sind, nicht entspricht (vgl. Otto, 2008, 65). Sportpädagogische Implikationen - 201 - Ausbildung von Lehrern, insbesondere in der ersten Phase, ist ausgesprochen theorieorientiert und taugt häufig nicht, um den praktischen, zumeist sozialen und personalen, Problemen des Schulalltags sinnvoll zu begegnen. Solche Probleme müssen jedoch gerade heute professionell angegangen werden, um eine Vermittlung von Inhalten überhaupt erst zu ermöglichen114. „Schulen erproben seit gut 15 Jahren Formen des offenen Lernens, des handlungsorientierten Lernens und des Projektlernens; Lehrer und Schüler entwickeln in Teams Ideen, gehen Probleme fächerübergreifend an und beziehen außerschulische Lernorte ein. Lehrerbildung dagegen findet vorwiegend sitzend, hörend und darüber-redend statt“ (Bastian et al., 1993). Alles geht über die Theorie und welche Beziehungen sich da herstellen lassen. Sinnliche Erkenntnispotenziale der angehenden Lehrer werden dabei überhaupt nicht aktiviert115. Angesichts der Theorielastigkeit und gleichzeitigen Entsinnlichung von fachlichen und personalen Bezügen hat es die (Unterrichts)Praxis besonders schwer angenommen und verstanden zu werden. „Praxis bedeutet hier, sich persönlich verwickeln zu lassen, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Diese Erfahrungen münden in Kompetenzen, die 114 Um den lebensweltlichen Bezug von Lehrern, der sich auch in sozialen Kompetenzen niederschlägt, zu gewährleisten, könnte man Quereinsteigern aus der Berufswelt – wie das im Journalismus Usus ist – nach pädagogischer Ausbildung und Probezeit, den Einstieg in den Schuldienst möglich machen. Außerdem könnten Auslandaufenthalte von angehenden Lehrern subventioniert werden, damit sie praktische Erfahrungen mit Menschen gewinnen, die zweifellos den Umgang mit Schülern erleichtern. Gelingender Umgang ist Grundlage für jeden „Verständigungsprozess“ (Funke, 1991, 13) und damit gleichzeitig für die erfolgreiche Vermittlung von Fachwissen. 115 Auf struktureller Ebene sind bereits Veränderungen feststellbar: Durch einen aktuellen Gesetzesentwurf soll ab 2009 die Lehrerausbildung reformiert werden. Man beabsichtigt, ein zehnwöchiges obligatorisches Praktikum vor dem Studium einzuführen. Außerdem soll ein „außerschulisches Praktikum in der Kinder- und Jugendarbeit vorgeschrieben“ werden (Szymaniak, 2008b, 3). Anscheinend hat man erkannt, dass die Lebenswelt ultimativer Bezugspunkt auch für jeden kognitiven und wissenschaftlichen Überbau der Lehrerausbildung sein muss. Umgekehrt erscheint es auch denkbar, die derzeit vorgeschlagenen Lehrerfortbildungen an der Universität (vgl. Szymaniak, 2008a, 1) mit Wahrnehmungsschulungen zu versehen, die dann außergewöhnlich konkret auf die praktische Unterrichtserfahrung des fortzubildenden Lehrers rekurrieren können. Dieser Vorschlag bezieht sich auf die Ebene der Gestaltung der Lehrerausbildung und war bis zum Regierungswechsel in NRW sogar schon vorgesehen. Sportpädagogische Implikationen - 202 - nicht theoretisch erworben werden können“ (Seewald, 1996, 89). Sie holen das „Andere der Vernunft“ aus dem Schattendasein heraus und machen es greifbar. „Zurück zu den Sachen“ muss also nicht nur als erkenntnistheoretische Devise, sondern ebenso als Motto für die Lehrerausbildung auch der ersten Phase verfolgt werden. Seewald betont, dass man leibliches Spüren üben kann (vgl. 1997, 12). Um verstehend arbeiten zu können, muss viel Aufmerksamkeit auf die Ausbildung der Fähigkeit der Selbstbeobachtung gelegt werden. Dies ist der Lehrerausbildung anhand umfassender Praxiserfahrung zu gewährleisten. „Die entscheidende Ausstattung der neuen Lehrerin scheint die Fähigkeit, zu beobachten und hinzuhören. Der entscheidende Fehler der alten und noch gegenwärtigen Konstruktion ist, dass man in der Hochschule gesagt bekommt, was man nachher in der Schule sehen werde. Ja, das sieht man dann auch – und nichts anderes“ (v. Hentig, 2003, 253). Man sieht, was man kennt. Die Lehrerbildung muss in allererster Linie zu einer Schule der Wahrnehmung werden, die leibliches Verstehen intensiv ausbildet und einübt. Im Gegensatz zu der strukturellen Ebene der Lehrerausbildung, wo neuerdings einige Veränderungen auf den Weg gebracht werden sollen (vgl. Szymaniak, 2008b, 3), scheint die qualitative Verbesserung der Gestaltung dieser Ausbildung aufgrund ihrer schwierigen Fassbarkeit noch nicht hinreichend berücksichtigt zu werden. Gerade hier, auf der Ebene der Gestaltung von Lehrerausbildung, kann die leibliche Erkenntnishaltung für die Verbesserung von Unterricht fruchtbar gemacht werden, indem Wahrnehmungsschulungen intensive angeboten und langfristige werden, die (Selbst-) etwa zur Verbesserung von Fremdverstehen beitragen. Zu einem ernst gemeinten Subjektbezug im Blick auf den Lehrer gehört, die eigenen Erfahrungen des Lehrers, die Merkmale der eigenen Person, die eigenen Interessen, seine Biographie in die Lehrerrolle mit einzubeziehen, die schon während dessen erkennender Weltzuwendung Sportpädagogische Implikationen - 203 - Wirkungen zeitigen. „Die Person des Lehrers ist sein bestes Curriculum. Und davon darf er durch die Lehrerbildung nicht abgehalten werden“ (v. Hentig, 2003, 251). Um sich als aktiv erzeugendes Subjekt in jedem Erkenntnisprozess zu analysieren, sind Videographien sinnvoll. Die Videoaufnahmen geben dem Lehrer Gelegenheit, sein Verhalten von außen zu betrachten, um Wirkungen seines Verhaltens zu verstehen. Die Arbeit mit diesen technischen Hilfsmitteln haben sich bislang für Studierende als sehr hilfreich erwiesen116. Im Rahmen solcher Schulungen kann die ausdauernde Erarbeitung und Kultivierung leiblicher Erkenntnishaltung anschaulich durchgeführt und reflektiert werden117. Diese anspruchsvolle Entwicklung der Person des Lehrers muss in seiner Ausbildung einen entsprechend großen Raum einnehmen, damit die nötigen Erkenntnisfähigkeiten durch Wiederholung geschult werden können. Der Persönlichkeitsentwicklung des Schülers geht dabei ein Training von entsprechenden Erkenntnisfähigkeiten auf Seiten des Erziehers voran. Inhalte dieses Trainings können anhand einer doppelten Zielsetzung präzisiert werden: Erstens lernen die angehenden Lehrer, sich als Fremde, also von außen wahrzunehmen. Dieser Perspektivwechsel ermöglicht es ihnen, die Wirkungen ihres Handelns zu erkennen und damit einer möglichen Modifikation zuzuführen. Zweitens können sie durch videographisch gestützte Reflexionen habituelle Wahrnehmungsmuster erkennen, um ihren individuellen Erzeugungsprozess von Erfahrung (vgl. Kap. 3.1.2.2) zu durchbrechen. Durch diese Methode können Erkenntnisfähigkeiten ausgebildet werden, mit deren Hilfe man pädagogisch bedeutsame Phänomene wie Kooperation und Verantwortung „sehen“ kann. Durch ausdauerndes und 116 Vgl. zum Ertrag videographischer Aufnahmen für die Lehrerausbildung: Hietzge, 2008, 295f. Der Verfasser kann diese Einschätzungen aufgrund von Erfahrungen im Seminar „Schulpraktische Studien“ bestätigen. 117 Ausblickend scheint es ertragreich, auf dem vorliegenden epistemologischen Fundament elaborierte Ausbildungskonzepte zu entwickeln. Sportpädagogische Implikationen - 204 - wiederholtes Training könnten solche Fähigkeiten eingeübt werden118. Es gibt keinen Anlass zu der Vermutung, dass Erkenntniskompetenzen nicht ebenso der Gewöhnung und damit der mühelosen Ausführung zugeführt werden können, wie motorische oder rationale Handlungsgewohnheiten. Damit ist nicht allein die Schulung der Fähigkeit zum Perspektivwechsel (vgl. Balz, 2004) gemeint, sondern die Ausbildung einer Haltung des Schauens, die allen Perspektiven vorausliegt und schon das „Einrasten“ von Perspektiven überhaupt inhibiert. Der künftige Lehrer soll üben, leiblich zu erkennen. Dazu muss er angeleitet werden, sich der erscheinenden Wirklichkeit nicht rückhaltlos auszuliefern, sondern nach dem Wesenskern der Erscheinungen, die ja nur Abschattungen sind, zu fragen. Folgt man Scheler, so muss der Lehrer nicht nur fragen: Warum erscheint mir der Schüler jetzt und hier zum Beispiel verunsichert, sondern in einer „distanteren, besinnlichen, kontemplativen Haltung zu diesem selben Erlebnis“ (Scheler, 1995, 49): Was ist denn eigentlich Verunsicherung, abgesehen davon, dass sie mir jetzt und hier vorkommt und wie muss der Grund der Dinge beschaffen sein, damit so etwas wie Verunsicherung überhaupt möglich ist (vgl. ebd.). Ein ideierender Akt versetzt den Lehrer in den Stand, Wesenserkenntnisse zu gewinnen, die in jedem Einzelfall wirksam sind119. Durch eine solche empathische Einstellung werden Gefühle erst erkennbar; sie begründet deswegen zugleich eine soziale Kompetenz des Lehrers, die durch theoretische Erörterungen nicht eingeübt werden kann. Die Schulung dieser Erkenntnishaltung füllt also eine Lücke in der Lehrerausbildung, weil zwar pädagogische Perspektiven von Seiten der Universität theoretisch eingeführt wurden, die Kompetenzen zu deren praktischer Umsetzung jedoch nicht konsequent trainiert werden. Um pädagogische Phänomene erschließen zu können, müssen Haltungen 118 Die finden sogar sukzessive ihre neuronalen Entsprechungen im Hirn (vgl. Singer, 2008b, 63). 119 Die einzelne Abschattung gleicht also einem ‚Fenster ins Absolute’ (Hegel). Diese Methode darf nicht mit dem rationalen Schließen der Induktion verwechselt werden. Sportpädagogische Implikationen - 205 - eingeübt werden, die geeignet sind, diese Phänomene zu erkennen. Die konkrete Umsetzung pädagogischer Perspektiven im Schulalltag, wie sie theoretisch in den aktuellen Richtlinien zum Schulsport in NRW verankert sind, kann durch das Einüben leiblichen Erkennens besser realisiert werden. Dadurch kann der Lehrer bei Schülern mehr erkennen und also fördern als nur Wissen, Können und „Intelligenz“. Auch psychosoziale Ressourcen, wie soziale und personale Kompetenzen, die Sygusch als „Schlüsselqualifikationen“ (2006, 27) von Schülern bezeichnet und deren Schulung er zu Recht einfordert, werden auf die untersuchte Weise allererst durch den Lehrer erkenn- und also förderbar. Außerdem prägt der Lehrer mit dieser Haltung eine Sensibilität aus, die als unabdingbar für eine erfolgreiche Inszenierung schülerorientierten Unterrichts erscheint. 4.5 Fazit Rückblickend ist das Erfordernis einer Theorie subjektorientierter Sportpädagogik in drei Schritten hergeleitet worden. Eine phänomenologische Bewegungstheorie (1.) begründet die Möglichkeit und Gelegenheit, durch Sport zu erziehen (2.). Die Umsetzung der erörterten pädagogischen Leitideen obliegt Sportlehrkräften, die mit entsprechender Akzentuierung ausgebildet werden müssen (3.). Um das vorgezeichnete Theoriekonzept einer Verwirklichung näher bringen zu können, scheint es geboten, das Subjekt auf drei Ebenen zurück ins Blickfeld zu befördern: 1. Der Schüler muss als einzigartiger Mensch Möglichkeiten geboten bekommen, fernab jeder Normierung (Fremdbestimmung), selbst bestimmte und selbst verantwortete Erfahrungen zu machen, was meist zeitaufwändig und nie messbar ist. 2. Der Lehrer muss sich die tätige Seite von Erkennen beim Schüler und bei sich selber bewusst halten, was zu einer Steigerung der Sportpädagogische Implikationen - 206 - Sensibilität im Umgang mit den Schülern führt, die sich in entsprechend offenen Unterrichtsarrangements spiegelt. 3. Beides scheint vor allem durch „Input-Steuerungen“ (Lehrerausund fortbildungen) anscheinend in erreichbar den zu Mittelpunkt sein, weswegen der Bemühungen diese um Verbesserung von Schule und Sportunterricht zurückgeführt werden müssen. „Output-Steuerungen“ (Qualitätssicherung durch Tests) können bestenfalls mittelbar Verbesserung bringen. Diese Ebene verweist auf die Protagonisten des Bildungswesens, die sich ihrer Rolle als aktiv erkennende Reproduzenten des aktuellen Gesellschaftscharakters bewusst werden müssen. Resümierend liefern die vorliegenden phänomenologischen Analysen einen Beitrag zur erkenntnistheoretischen Begründung für subjektorientierten Sportunterricht. Entlang der Argumentation wird überdies ersichtlich, dass der Faktor Subjekt auch bei der Konstruktion von sportwissenschaftlichen Theorien generell stärker zu beachten ist, um wahrheitsgemäße Erkenntnisse sicherstellen zu können. Eine hierfür notwendige Theorie subjektorientierter Wissenschaft kann in dieser Untersuchung nicht zur Gänze geleistet werden, weil eine solche Theorie einen vollzogenen Paradigmenwechsel markieren würde, der heute noch als Fernziel erscheint. Einzelne Elemente dieses neuen Paradigmas sind in der vorliegenden Untersuchung aufgegriffen worden und müssen künftig weiter entwickelt werden. Hinsichtlich sportwissenschaftlicher Probleme erscheint es ausblickend beispielsweise lohnend, bewegungsaufgabenorientierte Sportunterrichtskonzepte zu konstruieren und zu begründen, die konsequent auf phänomenologische Bewegungs- und Bildungstheorien rekurrieren. In der Bewegungsforschung liegen subjektorientierte Konzepte - die zwar nicht ausdrücklich, aber inhaltlich phänomenologisch begründet sind (vgl. Neumaier, 2003; Kassat, 1995) bereits vor. In der Sportmedizin scheint es hinsichtlich subjektorientierter Gesundheitskonzepte noch erheblichen Forschungsbedarf zu geben. Sportpädagogische Implikationen - 207 - Schließlich müssen die geisteswissenschaftlichen Fächer, die genuin mit dem Subjekt befasst sind, den Trend zur Objektivierung ihres Gegenstandes zurückfahren und von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen lernen, dass Wissenschaft ohne Bezug auf die darin verwickelten Subjekte notwendig an Grenzen der Erkenntnis stößt. Insgesamt ist eine Erkenntnishaltung zu kultivieren, die das Subjekt-fürsich zurückgewinnen und damit ein erweitertes Wissenschaftsverständnis sowie umfassendere Erkenntnis schaffen will. Diese offene Haltung macht die Welt zwar nicht beherrschbar, aber sie schließt sie auf. Literaturverzeichnis 5 - 208 - Literaturverzeichnis 5.1 Husserls Werke (Husserliana = Hua) Hua Ι: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Hrsg. Und eingeleitet von St. Strasser. Den Haag. 1950. Hua ΙΙ: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Hrsg. und eingeleitet von W. Biemel. Den Haag. 1950. Hua ΙΙΙ/1: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Hrsg. von W. Biemel. Den Haag. 1950. Hua VΙ: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrsg. und eingeleitet von W. Biemel. Den Haag. 1962. Hua VΙΙΙ: Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion. Hrsg. und eingeleitet von R. Boehm. Den Haag. 1959. Hua ΙX: Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925. Hrsg. und eingeleitet von W. Biemel. Den Haag. 1962. Hua XV: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929-1935. Hrsg. und eingeleitet von I. Kern. Den Haag. 1973. Hua XVΙΙ: Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. Hrsg. und eingeleitet von P. Janssen. Den Haag. 1974. Hua XΙX: Logische Untersuchungen. Zweiter Band. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Hrsg. und eingeleitet von U. Panzer. Den Haag. 1984. Hua XXXΙV: Zur phänomenologischen Reduktion. Hrsg. und eingeleitet von S. Luft. Dordrecht. 2002. 5.2 Auswahlbibliographie Abraham, A. (2002). Der Körper im biographischen Kontext. Ein wissenssoziologischer Beitrag. Westdeutscher Verlag: Wiesbaden. Adorno, Th. (1956). Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien. Kohlhammer: Stuttgart. Adorno, Th. / Horkheimer, M. (1969). Dialektik der Aufklärung. Fischer: Frankfurt. Literaturverzeichnis - 209 - Adorno, Th. (1972). Soziologie und empirische Forschung. In: Topitsch, E. (Hrsg.) (1972). S. 511-525. Aguirre, A.F. (1982). Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt. Allison, M.T. (1983). Basketball – wie ihn die Anglo-Amerikaner verstehen und die Navajo ihn spielen. Ein kulturspezifischer Zugang zur Sportsozialisation. In: Becker, P. (Hrsg.). Sport und Sozialisation. Reinbek. S. 115-132. Augustinus, A. (1955). Vom Gottesstaat. Elftes Buch. Kap. 26. Zürich. Bacon, F. (1984). Von der Interpretation der Natur. Hrsg. Franz Träger. Königshausen und Neumann: Würzburg. Bahnsen, U. (2008). Erbgut in Auflösung. In: DIE ZEIT. Nr. 25. Bäumer, A./ Benedikt, M. (Hrsg.) (1993). Gelehrtenrepublik – Lebenswelt. Edmund Husserl und Alfred Schütz in der Krisis der phänomenologischen Bewegung. Passagen: Wien. Balz, E. / Brodtmann, D. / Dietrich, K. / Funke-Wieneke, J. / KlupschSahlmann, R. / Kugelmann, C. / Miethling, W.D. / Trebels, A.H. (1997). Schulsport - wohin? Sportpädagogische Grundfragen. In: Sportpädagogik. Heft 1. S. 14-28. Balz, E. (2004). Methodische Prinzipien mehrperspektivischen Sportunterrichts. In: Balz, E. / Neumann, P. (Hrsg.). Mehrperspektivischer Sportunterricht. Hofmann: Schorndorf. S. 86-103. Bastian, J., Köpke, A., Oberliesen, R. (1993). Zur Revision der Lehrerbildung in Hamburg, Dokumentation einer Tagung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und des Amtes für Erziehung, Hamburg. Bauer, J. (2002). Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Eichborn: Frankfurt. Beauvoir, S. de (1969). In den besten Jahren. Reinbek: Hamburg. Becke, A. (1999). Der Weg der Phänomenologie. Kovac: Hamburg. Beckers, E. / Kruse, C. (Hrsg.) (1986). Gesundheitsbildung durch Wahrnehmungsentwicklung und Bewegungserfahrung Bd. Ι. Theoretische Grundlagen. Strauss: Köln. Beckers, E. (1987). Durch Rückkehr zur Zukunft? Anmerkungen zur Entwicklung der Sportpädagogik. In: Sportwissenschaft 17. S. 241-257. Beckers, E. (1988). Körperfassaden und Fitness-Ideologie. In: Schulz, N.; Allmer, H.: Fitness-Studios. Anspruch und Wirklichkeit. Brennpunkte der Sportwissenschaft. Heft 2. Literaturverzeichnis - 210 - Beckers, E. / Kruse, C. (Hrsg.) (1991). Gesundheitsbildung durch Wahrnehmungsentwicklung und Bewegungserfahrung Bd. ΙΙ. Gesundheit und Bewegung. Didaktische Umsetzung und praktische Perspektiven. Strauss: Köln. Beckers, E. / Holz, O. / Jansen, U. / Mayer, M. (1992). Gesundheitsorientierte Angebote in Sportvereinen. Schriftenreihe des Kultusministeriums. Verlagsgesellschaft Rittebach. Heft 34. Beckers, E. (1993). Bewegungskultur – Kultur und Bewegung. In (Ders.): Sport Bewegung Kultur. Im Auftrag der Trägergemeinschaft „Woche des Sport“ der Ruhrfestspiele Recklinghausen. Beckers, E. (1993a). Der Instrumentalisierungs-Vorwurf: Ende des Nachdenkens oder Alibi für die eigene Position?. In: Sportwissenschaft 23, 3. S. 233-258. Beckers, E. (1995). Vom Gang des Bewusstseins – und dem Schwinden der Sinne. Bd. 1. Mythos, Sinnlichkeit, Körperlichkeit. Academia: Sankt Augustin. Beckers, E. (1997). Vom Gang des Bewusstseins – und dem Schwinden der Sinne. Bd. 2. Der Körper zwischen Religion und Wissenschaft. Academia: Sankt Augustin. Beckers, E. (2003). Das Unbehagen an neuen Richtlinien und Lehrplänen – oder: Zur schleichenden Restauration des Alten. In: Franke, E. / Bannmüller, E. (Hrsg.). Ästhetische Bildung. Afra: o.O. S. 154-168. Beckers, E. (2006): Die Sinnmitte des Sports, Bildungsstandards und adipöse Kinder – Zur Wiederkehr der pädagogischen Anspruchslosigkeit im Sportunterricht. In: Fessler, N. / Stibbe, G. (Hrsg.) Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung: Standardisierung Profilierung Professionalisierung. Schneider: Hohergehren Bellone, E. (2002, 2. unveränd. Auflage): Spektrum der Wissenschaft. Biographie. Galileo Galilei. Leben und Werk eines unruhigen Geistes. Heidelberg. Benner, D. (2001, 4. Aufl.). Allgemeine Pädagogik. Juventa: Weinheim. Bergson, H. (1921). Schöpferische Entwicklung. Diederichs: Jena. Bernett, H. (1965). Grundformen der Leibeserziehung. Hofmann: Schorndorf. Bette, K.H. (1989). Körperspuren. Zur Semantik und Paradoxie moderner Körperlichkeit. Berlin. Bette, K.H. et al. (Hrsg.). (1993). Zwischen Verstehen und Beschreiben. Forschungsmethodologische Ansätze in der Sportwissenschaft. Sport und Buch Strauss: Köln. Literaturverzeichnis - 211 - Bittner, G. (1985). „Auf zwei Beinen stehe“. Eine pädagogische Vergegenwärtigung des Leibes. In: Bäcker, G. et. al. (Hrsg.). Ordnung und Unordnung. H. v. Hentig zum 23. September 1985. Weinheim. (S.301-325). Blumenberg, H. (1965). Die kopernikanische Wende. Frankfurt. Blumenberg, H. (1966). Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt. Bockrath, F. (2007). Implizites Wissen – Körperliches Wissen – Negatives Wissen. Vortrag zur DGFE Tagung in Berlin im November. Bockrath, F. / Boschert, B. / Franke, E. (2008). Körperliche Erkenntnis. Formen reflexiver Erfahrung. Transcript: Bielefeld. Bohn, C. (1991). Habitus und Kontext. Ein kritischer Beitrag zur Sozialtheorie Bourdieus. Westdeutscher Verlag: Opladen. Bohr, N. (1958). Atomphysik und menschliche Erkenntnis. Vieweg & Sohn: Braunschweig. Bourdieu, P. (1976). Entwurf einer Theorie der Praxis. Auf einer ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt. Bourdieu, P. (1987). Die feinen Unterschiede. Kritik gesellschaftlichen Urteilskraft. Suhrkamp: Frankfurt. der Bourdieu, P. (1992). Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur. VSA-Verlag: Hamburg. Bourdieu, P. (1996). Reflexive Anthropologie. Suhrkamp: Frankfurt. Bourdieu, P. (2001). Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Suhrkamp: Frankfurt. Bornhöft, P. (1997). Die Mysterien des Körpers. Über Schlaf, Liebe, Versenkung und Tod. Ein Essay. Snayder: Paderborn. Bollnow, O.F. (1975). Das Doppelgesicht der Wahrheit. Philosophie der Erkenntnis. Zweiter Teil. Kohlhammer: Stuttgart. Brettschneider, W. D. (2005). Brennpunkt: Vonnöten: Eine strukturelle und inhaltliche Neuerung des Sportunterrichts. In: Sportunterricht 11/05. Buytendijk, F.J.J. (1956). Allgemeine Theorie der menschlichen Haltung und Bewegung als Verbindung und Gegenüberstellung von physiologischer und psychologischer Betrachtungsweise. Berlin. Buytendijk, F.J.J. (1958). Mensch und Tier. Ein Beitrag zur vergleichenden Psychologie. Rowohlt: Hamburg. Buytendijk, F.J.J./Christian, P./Plügge, H. (1963). Über die menschliche Bewegung als Einheit von Natur und Geist. Hofmann: Schorndorf. Literaturverzeichnis - 212 - Capra, F. (1983, 4. Auflage): Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. Scherz: München. Caysa, V. (2003). Körperutopien. Eine philosophische Anthropolgie des Körpers. Campus: Frankfurt. Chardin, T. de (1965, Sonderausgabe): Der Mensch im Kosmos. Beck: München. Claesges, U. (1973). Zweideutigkeiten in Husserls Lebensweltbegriff. In: Perspektiven transzendentalphänomenologischer Forschung. Den Haag. Danzer, G. (1995). Psychosomatische Medizin – Konzepte und Modelle. Frankfurt: Fischer. Descartes, R. (1955). Regeln zur Leitung des Geistes. Die Erforschung der Wahrheit durch das natürliche Licht. Meiner: Hamburg. Descartes, R. (1992, 8. Auflage). Die Prinzipien der Philosophie. Übers. und mit Anm. versehen von Artur Buchenau. Meiner: Hamburg. Descartes, R. (1994). Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen. Übers. und hrsg. von Artur Buchenau. Unveränd. Nachdruck der 1. Aufl. von 1915. Meiner: Hamburg. Dietrich, K. / Landau, G. (1990). Sportpädagogik. Rowohlt: Reinbek. Dijksterhuis, E. J. (1956). Die Mechanisierung des Weltbildes. Springer: Berlin. Durfee, H.A. (Hrsg.) (1976). Analytic Philosophy and Phenomenology. Nijhoff: Haag. Elias, N. (1991). Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Band І und ІІ. Suhrkamp: Frankfurt. Elst, L.T.v. (2007). Alles so schön bunt hier. In: DIE ZEIT. Nr. 34. Emrich, E. / Flatau, J. (2006): Zur Rolle von Lehrkräften im Kontext der neueren Schulentwicklung – Der Lehrer zwischen Erzieher, Sozialingenieur und institutionalisiertem Sündenbock. In: Fessler, N. / Stibbe, G. (Hrsg.) Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung: Standardisierung Profilierung Professionalisierung. Schneider: Hohergehren Eppler, E. (2008): Kleine verzichten und Grosse kassieren. In: DIE ZEIT. 17. Erlemeyer, R. (1997). Gesundheitsbildung im Sportunterricht. InauguralDissertation an der Ruhr-Universität Bochum. Fessler, N. / Stibbe, G. (2006). PISA, SPRINT und die Folgen für den Schulsport. In: (Ders.). Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung: Standardisierung Profilierung Professionalisierung. Schneider: Hohergehren. Literaturverzeichnis - 213 - Feyerabend, P.K. (1981, 2. Auflage): Erkenntnis für freie Menschen. Suhrkamp. Frankfurt. Feyerabend, P.K. (1997, 6. Auflage): Wider den Methodenzwang. Suhrkamp. Frankfurt. Feynman, R. (1993). Vom Wesen physikalischer Gesetze. München. Fink, E. (1985). Einleitung in die Philosophie. Würzburg. Franke, E. (2003). Ästhetische Erfahrung im Sport - Ein Bildungsprozess?. In: Franke, E./Bannmüller, E. (Hrsg.): Ästhetische Bildung. Afra: Butzbach-Griedel. Franke, E. (2003a). Dialog – ein passender Begriff? Anmerkungen zum dialogischen Bewegungskonzept. In: Bach, I. / Siekmann, H. (Hrsg.). Bewegung im Dialog. Czwalina: Hamburg. S. 25-36. Franke, E. (2004). Körperliche Erkenntnis – Die andere Vernunft. In: Bietz, J. / Laging, R. / Roscher, M. (Hrsg.). Bildungstheoretische Grundlagen der bewegungs- und Sportpädagogik. Band 2 (S. 180-201). Schneider: Baltmannsweiler. Franke, E. (2008). Raum, Bewegung, Rhythmus. Zu den Grundlagen einer Erkenntnis durch den Körper. In: Bockrath, F. / Boschert, B. / Franke, E. Körperliche Erkenntnis. Formen reflexiver Erfahrung. Transcript: Bielefeld. S. 15-41. Fromm, E. (1981). Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache. Rowohlt: Reinbek. Fromm, E. (2001, 30. Auflage): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Dtv: München. Funke, G. (1966). Phänomenologie – Metaphysik oder Methode? Bouvier: Bonn. Funke, J. (1991). Unterricht öffnen – offener Unterrichten. In: Sportpädagogik 15/1991. Heft 2, S. 12-18. Gadamer, H.G. (1960). Wahrheit und Methode…. Gehlen, A.: Die Seele im technischen Zeitalter. Rowohlt. Reinbek. 1957 Gehrau, V. (2002). Die Beobachtung in Kommunikationswissenschaft. Methodische Ansätze Beispielstudien. UVK: Konstanz. der und Giese, M (2007). Erfahrung als Bildungskategorie. Eine sportsemiotische Untersuchung in unterrichtspraktischer Absicht. Meyer & Meyer: Aachen. Gissel, N. (2007). Von der neuen Theorie des Geistes zu einer neuen Pädagogik des Körpers? In: Sportwissenschaft. Heft 1. Glanville, R. (1988). Objekte. Merve: Berlin. Literaturverzeichnis - 214 - Goethe, J.W. (1998). Goethe Werke. Jubiläumsausgabe. Sechster Band. Insel: Frankfurt. Goldstein, K. (1934). Der Aufbau des Organismus. Nijhoff: Haag. Greene, B. (2000). Das elegante Universum. Siedler: Berlin. Größing, S. (1997). Bewegungskulturelle Bildung statt sportlicher Handlungsfähigkeit. In: Balz, E. / Neumann, P. (Hrsg.). Wie pädagogisch soll der Schulsport sein? Hofmann: Schorndorf. S. 33-45. Grupe, O. (1976). Bewegung und Sport – Möglichkeiten der Erfahrung und Selbstverwirklichung? In: Hecker, G./ Menze, C. (Hrsg.): Der Mensch im Sport. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Liselott Diem: Schorndorf. S.16-29. Habermas, J. (1968). Erkenntnis und Interesse. Suhrkamp: Frankfurt. Hartmann, M. (1959, 2. überarbeitete Auflage). Die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften. Erkenntnistheorie und Methodologie. Fischer: Stuttgart. Hartmann, N. (1962, 4. unveränderte Auflage). Ethik. De Gruyter: Berlin. Hartmann, N. (1966). Der Aufbau der realen Welt. De Gruyter. Berlin: Haym, R. (1846). Allgemeine Encycklopedie der Wissenschaften und Künste. Ersch & Gruber: Leipzig. Heidegger, M. (1950). Holzwege. Frankfurt. Heidegger, M. (1985, 8. Auflage). Gelassenheit. Neske: Pfullingen. Heidegger, M. (1988, 2. Auflage): Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Gesamtausgabe Bd. 20). Hrsg. von Petra Jäger. Frankfurt. Heidegger, M. (1993, 17. Auflage). Sein und Zeit. Niemeyer: Tübingen. Heiden, U. (1996). Chaos und Ordnung, Zufall und Notwendigkeit. In: Küppers, Günther: Chaos und Ordnung. Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Reclam: Stuttgart. Heisenberg, W. (1959). Physik und Philosophie. Ullstein: Frankfurt. Heitmeyer, W. (2005). Die verstörte Gesellschaft. In: DIE ZEIT Nr. 51. S.24. Hentig, H.v. (2003). Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. Beltz: Weinheim. Herbig, J. (1991). Der Fluss der Erkenntnis. Vom mythischen zum rationalen Denken. Hoffmann und Campe: Hamburg. Herzog, W. (1985). Der Körper als Thema in der Pädagogik. In: Petzold, H. (Hrsg.): Leiblichkeit. Paderborn. S.259-301. Literaturverzeichnis Hietzge, - 215 - M. (2008). Videogestützte Selbstreflexion in der Sportlehrerausbildung – Reaktivität, Akzeptanz und „how to do“. In: Oesterhelt, V. et al. (2008). Sportpädagogik. Im Spannungsfeld gesellschaftlicher Erwartungen, wissenschaftlicher Ansprühe und empirischer Befunde. Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 7.-9. Juni in Augsburg. Czwalina: Hamburg. S. 295-299. Hoffmeister, J. (1955, 2. Auflage). Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg. Hölder, A. (1967). Das Abenteuerbuch im Spiegel der männlichen Reifezeit. Ratingen. Holz, O. (1996). Zur Neuorientierung des Gesundheitsbegriffs: Plädoyer für die individuelle Auslegung eines komplexen Phänomens. Hofmann: Schorndorf. Holzhey, H. / Röd, W. (2004). Geschichte der Philosophie. Band 12: Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20.Jahrhunderts. Neukantianismus, Idealismus, Realismus, Phänomenologie. Beck: München. Holzkamp, K. (1976). Sinnliche Erkenntnis – Historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung. Althenäum: Kronberg. Huizinga, J. (1930, 17. Auflage). Im Schatten von Morgen. Zürich. Huizinga, J. (1956). Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Rowohlt: Reinbek. Hummel, A. (2005). Brennpunkt: Üben, Trainieren, Belasten – Elemente einer Neuorientierung des Sportunterrichts. In: Sportunterricht 12/05. Hunger, Ina & Thiele, Jörg (2000). Qualitative Forschung in der Sportwissenschaft. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1, Art. 8, http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs000185. (Zugriff am 08.12.08). Huntington, S.P. (1997, 5. Auflage). Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europa: München. Janich, P. (2000). Was ist Erkenntnis? Eine philosophische Einführung. Beck: München. Janssen, P. (1986). Einleitung zu E. Husserl: Die Idee der Phänomenologie. Hamburg. Jaspers, K. (1966, 4. Auflage). Descartes und die Philosophie. De Gruyter: Berlin. Jaspers, K. (1985, 3. Auflage). Kant. Leben, Werk, Wirkung. Piper: München. Literaturverzeichnis - 216 - Jost, E. (1991): Labu labu – Ein indonesisches Regelspiel. In: Jost, E. (Hrsg.). Spielanregungen – Bewegungsspiele. Afra: Karben. Jünger, F.G. (1959). Die Spiele. List-Bücher 128. München. Kamper, D. / Rittner, V. (1976). Zur Geschichte des Körpers. Perspektiven der Anthropologie. Hanser. Kant, I. (1966, 2. Auflage). Kritik der reinen Vernunft. Reclam: Stuttgart. Kassat, G. (1995). Verborgene Bewegungsstrukturen. Grundlegende sportpraktisch-theoretische Bewegungsbetrachtungen. Fitness Contur Verlag: Münster. Kastil, A. (1951). Die Philosophie Franz Brentanos – Eine Einführung in seine Lehre. Verlag das Bergland-Buch: Salzburg. Kierkegaard, S.A. (1998, 5. Auflage). Entweder-Oder. Teil Ι & ΙΙ. Dtv: München. Klein, M. (1984). „Social body“. Persönlicher Leib und der Körper im Sport. In: Ders. (Hrsg.): Sport und Körper. Reinbek. S.7-20. Kleist, H.v. (1956). Über das Marionettentheater. Insel Nr. 481: Wiesbaden. Klinge, A. (1998). Sport und Gewalt: zur Thematisierung von Gewalt in der Sportlehrerausbildung. Butzbach-Griedel. Klinge, A. (2008). Körperwahrnehmung. Den Körper wahrnehmen, mit dem Körper wahrnehmen und verstehen. In: Laging, R. (im Druck). Inhalte und Themen. Basiswissen Didaktik des Bewegungs- und Sportunterrichts, Band 2. Schneider: Hohengehren. Knorr-Cetina, K. (2002a). Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft. Suhrkamp: Frankfurt Knorr-Cetina, K. (2002b). Wissenskulturen. Ein Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen. Suhrkamp: Frankfurt. Kolakowski, L. (1986). Die Suche nach der verlorenen Gewissheit. Denkwege mit Edmund Husserl. Piper: München. Konstantinovic, Z. (1973). Phänomenologie und Literaturwissenschaft. List: München. Körner, S. (2008). Dicke Kinder – revisited. Zur Kommunikation juveniler Körperkrisen. Transcript: Bielefeld. Krauss, R. (1995). Allusion und Illusion bei Donald Judd. In: Minimal Art. Eine kritische Retrospektive. Hrsg. Von Gregor Stemmrich. Dresden, Basel: Verlag der Kunst. Kronseder, D. (2000). Virtuelles Lexikon. Wissen digital Software Verlags GmbH: München. Kuchler, W. (1969). Sportethos. Barth: München. Literaturverzeichnis - 217 - Kühn, R. / Staudigl, M. (2003). Epoché und Reduktion. Formen und Praxis der Reduktion in der Phänomenologie. Königshausen & Neumann: Würzburg. Kuhn, T.S. (1976, 2. Auflage). Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp: Frankfurt. Kurz, D. (1986). Vom Sinn des Sports. In: Deutscher Sportbund (Hrsg.). Die Zukunft des Sports. Materialien zum Kongreß „Menschen im Sport 2000“. Hofman: Schorndorf. S. 44-68. Kurz, D. (1990, 3. Auflage). Elemente des Schulsports. Hofmann: Schorndorf Kurz, D. (2006). Bildungsstandards für das Fach Sport. Vortrag beim 5. Osnabrücker Kongress für bewegte Kindheit am 24.03. Kurz, D. (2006a). Vorschläge zur Entwicklung von Qualitätsstandards für den Sportunterricht in Nordrhein-Westfalen. In: Aschebrock, H. (Red.) (2006). Werkstattberichte, Heft 3. Landesinstitut für Schule und Qualitätsentwicklung: Soest. Kurz, D. (2008). Der Auftrag des Schulsports. Vortrag bei der Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik und dem DSLVBundeskongress, Köln, 24. Mai 2008. Laging, R. (2005). Bildung im Bewegungs- und Sportunterricht. In: Bietz, J. / Laging, R. / Roscher, M. Bildungstheoretische Grundlagen des Bewegungs- und Sportunterrichts. Schneider: Baltmannsweiler. S. 271-308. Laing, R.D. (1970, 3. Auflage). Phänomenologie der Erfahrung. Suhrkamp: Frankfurt. Lamnek, S. (1988). Qualitative Sozialforschung. Band 1. Methodologie. Psychologie Verlags Union: München und Weinheim. Landgrebe, L. (1969, 3. Auflage). Der Weg der Phänomenologie. Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung. Mohn: Gütersloh. Lem, S. (1984). Also sprach Golem. Insel: Frankfurt. Lenk, H. (1964). Werte, Ziele, Wirklichkeit der modernen Olympischen Spiele (Beiträge zur Lehre und Forschung der Leibeserziehung Bd. 17/18). Schorndorf. Levinas, E. (2007, 5. Auflage): Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Alber: Freiburg Lippe, R.z. (1991). Freiheit die wir meinen. Rowohlt: Reinbek. Lorenz, K. (1943). Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. In: Zeitschrift Tierpsychologie (S.235-409) Heft 5. Lorenz, K. (1973a). Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. München: Piper. Lorenz, K. (1973b). Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. Piper: München. Literaturverzeichnis Lorenz, K. (1983). Der München/Zürich. - 218 - Abbau des Menschlichen. Piper: Lorscheid, B. (1962). Das Leibphänomen. Eine systematische Darbietung der Schelerschen Wesensschau des Leiblichen in Gegenüberstellung zu leibontologischen Auffassungen der Gegenwartsphilosophie. Bouvier: Bonn. Luhmann, N. (1986). Beobachtung von Beobachtung. In: Ökologische Kommunikation. Westdeutscher Verlag: Opladen. Luhmann, N. (1996). Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Picus: Wien. Lyotard, J.F. (1993). Die Phänomenologie. Junius: Hamburg. Marcuse, H. (1964). Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Hermann Luchterhand Verlag: Darmstadt und Neuwied. Marlovits, A. (2001). Über die Einheit von Empfinden und SichBewegen. Eine Einführung in die phänomenologische Bewegungstheorie von Erwin Straus. Czwalina: Hamburg. Maturana, H. (1994). Was ist Erkennen. Piper: München. Meinberg, E. (1996, 3. Auflage). Hauptprobleme der Sportpädagogik: Eine Einführung. Wiss. Buchges.: Darmstadt. Meinel, K. (1960). Bewegungslehre. Volk und Wissen: Berlin (Ost). Mengden, G.v. (1958). Grundsätzliches zum Problem der Freizeit. In: Jahrbuch des Sports. Hrsg. vom Deutschen Sportbund. Merleau-Ponty, M. (1966). Phänomenologie der Wahrnehmung. De Gruyter: Berlin. Merleau-Ponty, M. (1976). Die Struktur des Verhaltens. De Gruyter: Berlin. Merleau-Ponty, M. (1984). Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Meiner: Hamburg. Metzler, J.B.(1989). Philosophenlexikon. Verlagsbuchhandlung: Stuttgart. Metzlersche Meyer-Drawe, K. (1984). Leiblichkeit und Sozialität. Phänomenologische Beiträge zu einer pädagogischen Theorie der Inter-Subjektivität. München. Meyer-Drawe, K. (1996). Menschen im Spiegel ihrer Maschinen. Fink: München. Miethling, W.D. / Krüger, C. (2004). Schüler im Sportunterricht. Die Rekonstruktion relevanter Themen und Situationen des Sportunterrichts aus Schülersicht (RETHESIS). Hofmann. Literaturverzeichnis - 219 - Misch, G. (1967, 3. Auflage): Lebensphilosophie und Phänomenologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt. Mittelstrass, J. (1969). Die Galileische Wende. Das historische Schicksal einer methodischen Einsicht. In: Landgrebe, L. (Hrsg.): Philosophie und Wissenschaft: Düsseldorf. Mittelstrass, J. (1991). Geist, Natur und die Liebe zum Dualismus. Wider den Mythos der zwei Kulturen. In: Bachmaier, H./ Fischer, E.P. (Hrsg.): Glanz und Elend der zwei Kulturen. Konstanz. S. 928. Monod, J. (1973, 3. Auflage). Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie. Piper: München. Musil, R. (1987). Der Mann ohne Eigenschaften. Rowohlt: Reinbek. Nietzsche, F. (1930). Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Kröner: Leipzig. Nietzsche, F. (1955). Die Geburt der Tragödie. Der griechische Staat. Stuttgart. Nietzsche, F. (1959). Die fröhliche Wissenschaft. Goldmann: München. Neumaier, A. (1988). Bewegungsbeobachtung und Bewegungsbeurteilung im Sport. Academia: Sankt Augustin. Neumaier, A. (2003, 3. Aufl.). Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining. Grundlagen, Analyse, Methodik. Sport und Buch Strauß: Köln. Onkelbach, C. (2008). Der Geist ist schwach. In: WAZ. 16/6. Orth, E.-W. (1976). Die Phänomenologie und die Wissenschaften. Alber: Freiburg/München. Otto, J. (2008). Die Angst der Lehrer. In: DIE ZEIT. Nr. 40. S.85-88. Peters, K. (1979). Erkenntnisgewissheit und Deduktion. Zum Aufbau der Philosophischen Systeme bei Descartes, Spinoza, Leibniz. Luchterhand: Darmstadt und Neuwied. Peuker, H. (2002). Von der Psychologie zur Phänomenologie: Husserls Weg in die Phänomenologie der „Logischen Untersuchungen“. Meiner: Hamburg. Peursen, C.A.v. (1969). Phänomenologie und analytische Philosophie. Kohlhammer: Stuttgart. Pivcevic, E. (1972). Von Husserl zu Sartre. Auf den Spuren der Phänomenologie. List: München. Plessner, H. (1975, 3. Aufl.). Die Stufen des organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. De Gruyter: Berlin. Plügge, H. (1967). Der Mensch und sein Leib. Niemeyer: Tübingen. Literaturverzeichnis - 220 - Popper, K.R. (1973). Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hoffmann & Campe: Hamburg. Pöggeler, O. (1990, 3. Auflage). Die Denkwege Martin Heideggers. Neske: Pfullingen. Preuss-Lausitz, U. (1987). Körper und Politik. Zur historischen Veränderung der Körpersozialisation im 20.Jahrhundert. In: Deutsche Jugend. Heft 7 und 8. S.299-312. Prohl, R. (2004). Vermittlungsmethoden. Eine erziehungswissenschaftliche Lücke in der Bildungstheorie des Sportunterrichts. In: Schierz, M / Frei, P. (Hrsg.). Sportpädagogisches Wissen. Czwalina: Hamburg. S. 117-127. Prohl, R. (2006, 2. Auflage). Grundriss der Sportpädagogik. Limpert: Wiebelsheim. Randall, J.H. (1976). The making of the modern mind. A survey of the intellectual background of the present age. Columbia: New York. Redeker, H (1993). Helmuth Plessner oder die verkörperte Philosophie. Duncker & Humblot: Berlin. Reinach, A. (1951). Was ist Phänomenologie? Kösel: München. Riedl, R. (1980). Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft. Parey: Hamburg. Röd, W. (1992). Der Gott der reinen Vernunft. Beck: München. Röd, W. (1995, 3. ergänzte Auflage). Descartes. Die Genese des cartesianischen Rationalismus. C.H. Beck: München. Römpp, G. (2005). Husserls Phänomenologie - Eine Einführung. Marix: Wiesbaden. Röthlein, B. (1999, 2. Auflage). Schrödingers Katze. Dtv: München. Rombach, H. (1980). Phänomenologie des gegenwärtigen Bewusstseins. Freiburg/München. Roth, G. (1994): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Suhrkamp: Frankfurt. Rumpf, H. (1980). Schulen der Körperlosigkeit. Über einige Fortschritte der Entsinnlichung und das neue Wagenschein-Buch. In: Neue Sammlung. (S.452-463). Heft 4. Rumpf, H. (1981). Die übergangene Sinnlichkeit. Drei Kapitel über die Schule. Juventa: München. Rumpf, H. (1983a). Der Menschenkörper – Ein Bewegungsapparat? Rückfragen zur biomechanischen Sportwissenschaft. In: Sportpädagogik Sonderheft: Annäherungen, Versuche, Betrachtungen, Bewegungen zwischen Erfahrung und Erkenntnis. Seelze. Literaturverzeichnis - 221 - Rumpf, H. (1983b). Beherrscht und verwahrlost. Über den Sportkörper, den Schulkörper und die ästhetische Erziehung. In: Zeitschrift für Pädagogik. (S.333-346). Heft 3. Russell, B. (1970). Denker des Abendlandes. Geschichte der Philosophie in Wort und Bild. Verlag Buch und Welt: Klagenfurt. Sartre, J.-P. (1991). Das Sein und das Nichts. Versuch einer ontologischen Phänomenologie. Reinbek. Schaller, H.-J. (1992) Instrumentelle Tendenzen in der Sportpädagogik. In: Sportwissenschaft 22, 1. S. 9-31. Scheler, M. (1925). Bildung und Wissen. Bouvier: Bonn. Scheler, M. (1954). Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Francke: Bern. Scheler, M. (1995, 13. Auflage). Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bouvier: Bonn. Schmidt-Millard, T. (1992). Der pädagogische Sportwissenschaft 22/92. S. 304-322. Bezug. In: Schmidt-Millard, T. (1995). Authentizität – Bildung – Körperbildung. Sartres Menschenbild in pädagogischer Sicht. Academia: Sankt Augustin. Schmidt-Millard, T. (2007). Lernen als Neuordnung der Horizonte. Bildungstheoretische Anmerkungen zum Lernbegriff in der Sportdidaktik. Schmidt-Millard, T. (2007a). Erziehender Sportunterricht oder Erziehung durch Sport-Unterricht? In: Sportunterricht 4/07. Schierz, M. / Thiele, J. (2005). Schulsportentwicklung im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Standardisierung. In: Gogoll und Menze-Sonneck. S. 28-41. Schmitz, H. (1968). Subjektivität. Beiträge zur Phänomenologie und Logik. Bouvier: Bonn. Schmitz, H. (1980). Neue Phänomenologie. Bouvier: Bonn. Schnabel, U. (2008). Im Labyrinth des Denkens. In: DIE ZEIT. Nr. 15. Schopenhauer, A. (1966). Die Welt als Wille und Vorstellung. Atlas: Köln. Schopenhauer, A. (1999a). Sämtliche Werke Band 5. Parerga und Paralipomena. Skizze einer Geschichte der Lehre vom Idealen und Realen. Mundus. Schopenhauer, A. (1999b, 2. Auflage). Philosophie für den Alltag. Manuscriptum: Leipzig. Literaturverzeichnis - 222 - Schrödter, H. (2000). Der Gottesgedanke in der Metaphysik des Ich als substantia cogitans. In: Niebel / Horn /Schnädelbach (Hrsg.): Descartes im Diskurs der Neuzeit. Schulte, G. (1979). Leibperspektiven. Radierungen und Texte zur Phänomenologie der Wahrnehmung. Balloni: Köln. Schütz, A. (1971). Gesammelte Aufsätze Bd. Ι. Den Haag. Searle, J. R. (1993). Die Wiederentdeckung des Geistes. Suhrkamp: Frankfurt. Seewald, J. (1995). „Entstörungsversuche“ – Bewegung motologisch verstehen. In: Prohl, R. / Seewald, J. (Hrsg.). Bewegung verstehen. Facetten und Perspektiven einer qualitativen Bewegungslehre. Hofmann: Schorndorf. S. 199-235. Seewald, J. (1996). Motologie im Fernstudium? Über Erfahrungen in der motologischen Lehre. In: Motorik 19. Heft 2. S. 87-89. Seewald, J. (1997). Der “Verstehende Ansatz“ und seine Stellung in der Theorielandschaft der Psychomotorik. In: Praxis der Psychomotorik. Jg. 22. Heft 1. S. 4-15. Sepp, H.R. (Hrsg.) (1988, 2. Auflage). Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Alber: Freiburg/München. Singer, W. (2007). Auf der Suche nach dem Kern des Ich. In: DIE ZEIT. 38. Singer, W: (2008a). Ein soziales Organ. In: DIE ZEIT. Nr. 15. Singer, W, Ricard, M.: (2008b). Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog. Suhrkamp: Frankfurt. Slusher, H. S. (1967). Man, Sport and Existence. Philadelphia. Smidt, T. (1991). Bintang aleah – Kann man „Indonesisch spielen? In: Jost, E. (Hrsg.). Spielanregungen – Bewegungsspiele (S. 130137). Afra: Karben. Snow, C.P. (1967). Die zwei Kulturen. Literarische naturwissenschaftliche Intelligenz. Klett: Stuttgart. und Spengler, O. (1923). Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Bd. Ι: Gestalt und Wirklichkeit. Beck: München. Spinoza, B.de (1927, 3. Auflage). Vom Weg der Erkenntnis. Mit Versen des Angelius Silesius. Gutenberg Presse: Frankfurt. Stegmüller, W. (1969). Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und der analytischen Philosophie Bd. Ι. Berlin/Heidelberg/New York. Stibbe, G. (2000). Vom Sportartenprogramm zum erziehenden Sportunterricht. In: Sportunterricht 49, 7. S. 212-219. Straus, E. (1956, 2. Auflage). Vom Sinn der Sinne. Springer: Berlin. Literaturverzeichnis - 223 - Strauss, A. / Corbin, J. (1996). Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Beltz: München und Weinheim. Sygusch, R. (2006). Persönlichkeits- und Teamentwicklung in der sportlichen Kinder- und Jugendarbeit – ein Rahmenkonzept zur Förderung psychosozialer Ressourcen. In: Sportjugend Nordrhein-Westfalen. Die zukunft des Kinder- und Jugendsports. Rhiem: Voerde. S. 41-44. Szymaniak, P. (2008a). „Lehrer zurück an Unis“. In: WAZ. Nr. 144. Szymaniak, P. (2008b). Praxissemester wird Pflicht. In: WAZ. Nr. 146. Tamboer, J.W.J. (1994). Philosophie der Bewegungswissenschaften. Afra: Butzbach-Griedel. Thiele, J. (1996). Körpererfahrung – Bewegungserfahrung – leibliche Erfahrung: sportpädagogische Leitideen der Zukunft? Academia: Sankt Augustin. Thiele, J. (2001). Von „Erziehendem Sportunterricht“ und „pädagogischen Perspektiven“. Anmerkungen zum Bedeutungsgewinn pädagogischer Ambitionen im sportpädagogischen Diskurs. In: Sportunterricht 50/01. S. 4349. Thiersch, H. (1993). Abenteuer – Ein Weg zur Jugend? In: Runtsch, B.: Abenteuer – Ein Weg zur Jugend? Erlebnispädagogische Maßnahmen in der ambulanten und stationären Jugendhilfe. Dokumentation der Fachtagung in Marburg. Frankfurt. Tillmann, K.J. (2004). Was ist eigentlich neu an PISA? Neue Sammlung, 44 (4). S. 477-486. Tillmann, K.J. (2006): Qualitätssicherung durch Leistungsvergleiche und Bildungsstandards? Oder: Kritische Anmerkungen zum bildungspolitischen Zeitgeist. In: Fessler, N. / Stibbe, G. (Hrsg.) Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung: Standardisierung Profilierung Professionalisierung. Schneider: Hohergehren. Trebels, A.H. (1992). Das dialogische Sportunterricht (S. 20-29). Heft 41. Bewegungskonzept. In: Uexküll, Th.v. (1963). Grundfragen der psychosomatischen Medizin. Rowohlt: Reinbek. Varela, F. (1992). Der mittlere Weg der Erkenntnis. Scherz: Bern. Vollmer, G. (2002, 8. Auflage). Evolutionäre Erkenntnistheorie. Hirzel: Stuttgart. Wagner, I. (1984). Die neue Ordnung der Welt. Zur Sozialgeschichte der Naturwissenschaften 1500-1700. Wien. Waldenfels, B. (1971). Das Zwischenreich des Dialogs. Den Haag. Literaturverzeichnis - 224 - Waldenfels, B. (1983). Phänomenologie in Frankreich. Suhrkamp: Frankfurt. Waldenfels, B. (1985): Das Problem der Leiblichkeit bei Merleau-Ponty. In: Petzold, H. Leiblichkeit. Philosophische, gesellschaftliche und therapeutische Perspektiven. (S. 149-172). Paderborn. Waldenfels, B. (1992). Einführung in die Phänomenologie. Fink: München. Waldenfels, B. (1993). Husserls Verstrickung in die Erfahrung. In: Waldenfels, B. (Hrsg.). E. Husserl: Arbeit an den Phänomenen. Ausgewählte Schriften. Frankfurt. Waldenfels, B. (2000). Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. Suhrkamp: Frankfurt. Weber, M. (2000, 3. Auflage). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Beltz Athenäum Verlag: Weinheim. Weizsäcker, C.F.v. (1954, 6. Auflage). Zum Weltbild der Physik. Hirzel: Stuttgart. Weizsäcker, C.F.v. (1962). Die Geschichte der Natur. Göttingen. Weizsäcker, C.F.v. (1963). Bedingungen des Friedens. Vandenhoek & Ruprecht: Göttingen. Weizsäcker, C.F.v. (1979, 2. Auflage). Deutlichkeit. Hanser: München. Weizsäcker, V.v. (1947). Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Suhrkamp: Frankfurt. Wiarda, J.M. (2008). Der kleine Bildungsriese. In: DIE ZEIT. Nr. 28. Wildt, K.C. (1957). Leibesübungen im deutschen Mittelalter. Versuch einer kulturhistorischen Deutung. Frankfurt. Wingert, L. (2007). Der Geist bleibt unfassbar. In: DIE ZEIT. Nr. 36. Wittschier, M. (2004, 3. Auflage). Abenteuer Philosophie. Piper: München. Literaturverzeichnis - 225 - Curriculum vitae André Hempel, geboren am 3. April 1976 in Datteln. Jan.-Aug. 1993: USA-Aufenthalt mit Abschluss der amerikanischen Highschool in San Marin/CA 1986- 1995: Abitur am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium in Velbert 1995-1996: Zivildienst bei der Velberter Feuerwehr 1996-1998: Lehramtstudium Sportwissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln; Englisch, Philosophie und Geschichte an der Universität zu Köln und Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1998-2003: Diplomstudium der Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum 2000-2004: Produktionsassistent WDR 5 LebensArt 2003-2005: Freier Redakteur bei WDR 5 LebensArt und Scala 2005: Studienreisen nach Südafrika, Australien, Neuseeland, Fiji Seit 2006: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem sportpädagogischen Lehrstuhl der Ruhr - Universität Bochum. Erklärung Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die in der Arbeit angegebenen benutzt habe. Darüber hinaus ist die Dissertation noch nie vorher als Prüfungsarbeit bei einer akademischen oder staatlichen Abschlussprüfung verwendet worden. Dies ist mein erster Promotionsversuch. André Hempel Köln, im Dezember 2008