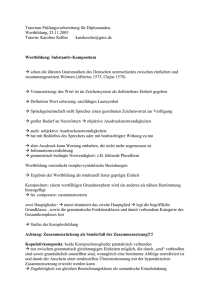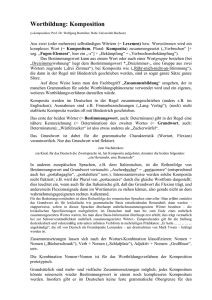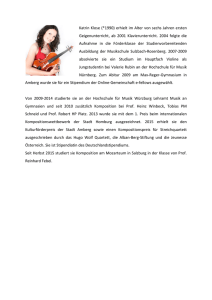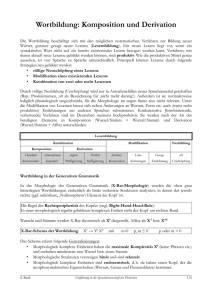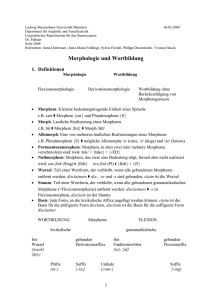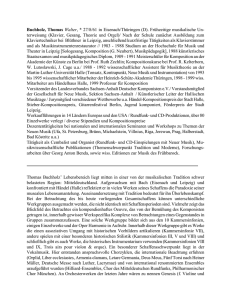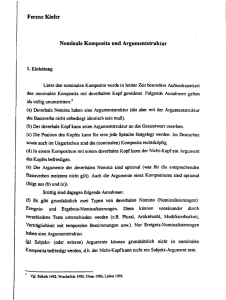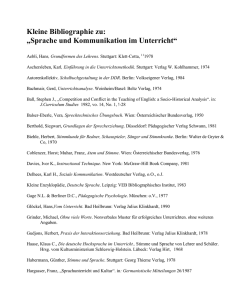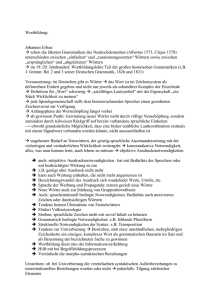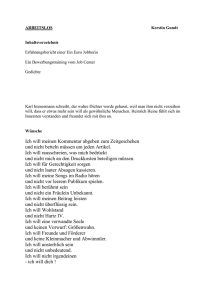Die Stellung der Wortbildung im System kognitiver Module
Werbung

Beiträge aus Forschung und Anwendung Grammatik und Spracherwerb Die Stellung der Wortbildung im System kognitiver Module* Gisbert Fanselow, Passau 0 Das Problem Unleugbar hat die Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des natür­ lichen Spracherwerbs die linguistische Theoriebildung in den letzten beiden Deka­ den entscheidend vorangetrieben. Im Vordergrund stand dabei die Auseinander­ setzung mit dem sogenannten „logischen Problem des Spracherwerbs“ . Die gram­ matischen Systeme natürlicher Sprachen sind ein hochkomplexes Regelwerk, das von Prinzipien gesteuert ist, die mit oberflächlich orientierten Generalisierungen über sprachliche Strukturen nur sehr wenig gemein haben. Es läßt sich zeigen, daß diese zugrundeliegenden Prinzipien und Generalisierungen nur dann korrekt er­ schlossen werden können, wenn dabei marginale Daten und negative Evidenz, also Information über die Ungrammatikalität von Strukturen, berücksichtigt werden (cf. FELIX 1984). A uf Grund von Untersuchungen wie BRAINE (1971) gilt allge­ mein als unbestritten, daß Kinder nicht über negative Evidenz verfügen, und margi­ nale Strukturen können naturgemäß nur eine vemachlässigbare Rolle im Spracher­ werb spielen. Damit ist aber unklar, wie Kinder über Lernprozesse zu den korrekten Generalisierungen über die Struktur ihrer Sprache gelangen sollten. * Dieser Aufsatz ist die partiell erweiterte, partiell revidierte Version des Vortrags, den ich auf der 6. Tagung der Gruppe GGS im Juni 1984 in Wien gehalten habe. Bei den Tagungsteil­ nehmern bedanke ich mich für Hinweise und Kritik, besonders bei Josef Bayer, Ria de Bleser, Hubert Haider und Peter Staudacher, vor allem aber bei Sascha Felix. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Luise Haller für das Schreiben des Manuskripts. Linguistische Berichte 96/1985 © Westdeutscher V erlafcs »U)t l.'V X.-Ic.T. S^rCCiV .iL - ü'ihücihek - Von den verschiedenen logisch denkbaren Lösungen dieses P roblem s erscheint vor dem H intergrund heutigen Wissens über die m enschliche K o g n itio n einzig die An­ nahme vielversprechend, daß die entscheidenden P rinzipien der natürlichen Spra­ chen nicht erlernt w erden müssen, weil sie im genetischen P rogram m des Menschen bereits vorspezifiziert sind (CHOMSKY 1980 a, b ; LIG H TFO O T 1982; h a t t e t.t j . PALMARINI 1980; FANSELOW & FELIX 1984). Für die k o n k re te Ausgestaltung dieses genetischen Program m s sind eine R eihe spezifischer V orschläge vorgelegt w orden (CHOMSKY 1981, 1982a; BRESNAN 1 982; GAZDAR 1982), und die kon­ troverse Diskussion hat tiefgehende E insichten in die S tru k tu r m enschlicher Spra­ chen erm öglicht. Erst in jüngster Zeit (WHITE 1981, 1982; FEL IX 1 9 8 4 ) ist eine w eitere Perspektive bei der U ntersuchung des Spracherw erbs u n te r th e o re tisch e n G esich tsp u n k ten aus­ gew ertet w orden, näm lich das „E ntw icklungsproblem des S p rach erw erb s“ . Natür­ licher Spracherw erb ist kein k ontinuierlich er P ro zeß , e r ist in S tad ien organisiert. Innerhalb solcher Stadien sind die sprachlichen System e des K indes, bezogen auf bestim m te K onstruktionstypen, unverändert, die Stadienübergänge erfolgen auch relativ abrupt. N icht für alle S tru k tu re n , die w äh ren d d er einzelnen Stadien ver­ w endet w erden, ist auch ein entsprechendes M odell in d e r Erw achsenengram m atik vorhanden. Dabei scheint vor allem von Belang, in w elchem V erh ältn is die „G ram m atiken“ der einzelnen Stadien zu den genetisch fixierten P rinzipien n atü rlich er Sprachen stehen. Nach WHITE gehorchen alle S tadien diesen P rin zip ien , w ährend FELIX davon ausgeht, daß ein Teil dieser Prinzipien sich erst im L aufe des Spracherwerbs en tfaltet. Dabei scheint seine Analyse eh er in d er Lage, k o n k re te Stadienüber­ gänge wie beim Erwerb der N egation oder d er V erbstellung zu erk lären . In diesem A ufsatz soll einer der frühesten Stadienübergänge d en H intergrund bil­ den. Im frühen Stadium der Zw eiw ortphase sind die sprachlichen Ä ußerungen des Kindes sem antisch gesteuert, und nicht sy n tak tisch -fo rm alen Prinzipien unterlie­ gend (BLOOM 1970). Dem steh t gegenüber, daß die S y n ta x sp äterer S tadien wie die des Endm odells sicher nich t sem antisch fu n d ie rt ist. Bis zu ein em b estim m ten Zeit­ p u n k t sind also die Ä ußerungen des K indes von einem sem an tisch begründeten Sy­ stem gesteuert, w ährend danach ein syntaktisch-form ales S y stem die Steuerung der Sprache übernim m t. Das syntaktisch-form ale S ystem ist in F o rm d er Vorschläge von FELIX oder WHITE m it dem System der genetischen Prinzipien für Sprache, der Universalgram m atik, identifizierbar. Zwei Fragen schließen sich an: was ist die N atu r des sem antisch begründeten Sy­ stem s und „ stirb t“ dieses m it dem H eranreifen d er sy n tak tisc h e n Universalgram­ m atik, oder finden sich auch in der Sprache von E rw achsenen Ä ußerungstypen, die nicht von der U niversalgram m atik gesteuert sind, so n d ern eb en von dem frühen Sprachsystem ? Sinnvoll sind beide Fragen nur vor dem H intergrund des m o d u laren A nsatzes zur Sprachfähigkeit von CHOMSKY (1 9 8 0 a). CHOMSKY zufolge ist „S p rach e“ ein Epiphänom en des W irkens verschiedener M odule o d e r K o m p eten zen , wie der 92 formal-grammatischen Kompetenz (also der Universalgrammatik), der konzep­ tuellen Kompetenz (Semantik), der pragmatischen Kompetenz u.s.w. Innerhalb dieses Rahmens werde ich zu zeigen versuchen, daß das semantisch be­ gründete System in engem Zusammenhang zu einer allgemeinen Symbolfähigkeit und zur konzeptuellen Kompetenz steht. In Wortbildungsstrukturen und gewissen Aspekten nicht-konfigurationaler Syntaxen werde ich die Elemente identifizieren, die auf ein Weiterwirken des semantisch begründeten Systems im sprachlichen Verhalten auch des Erwachsenen hinweisen. 1 Steht die Wortbildung tatsächlich in der Grammatik? Den Nachweis der beiden angesprochenen Hypothesen will ich beginnen, indem ich zeige, daß Wortbildung, speziell die Komposition, außerhalb des Erklä­ rungsbereiches der formal-grammatischen Kompetenz, der Universalgrammatik, steht. Zieht man Bilanz über die zwei letzten Jahrzehnte Wortbildungsforschung, so kann man erhebliche Fortschritte feststellen, insbesondere, was die Beiträge aus dem generativen Linguistikparadigma betrifft. Beispielsweise zeigt sich, daß die korrekte Bedeutung eines Kompositums nicht allein über syntaktisch orientierte Prinzipien erklärbar ist, sondern wesentlich pragmatisch-kontextuelle Relationen mit berück­ sichtigen muß (cf. DOWTY 1979). Im Anschluß an CHOMSKY (1972) entwickelte Modelle erlauben Vorhersagen darüber, weshalb ein Kompositum oder ein Derivat in welchen Eigenschaften mit seinem Kopf übereinstimmt (cf. HÖHLE 1982; WIL­ LIAMS 1981; SELKIRK 1982; TOMAN 1983). Allgemeine Gesetze geben an, welche Eigenschaften des Determinans in einem Kompositum oder einem Derivat sich an das Wortbildungsprodukt vererben, welche nicht, welche Valenzen des Determi­ nans wann an das Wortbildungsprodukt weitergegeben werden, warum also die Bestechung der Politiker grammatisch ist, aber nicht das Wartezimmer auf den Arzt (cf. LIEBER 1983; FANSELOW 1984a), warum bestimmte Wortbildungsmuster prinzipiell unrealisierbar sind (cf. LIEBER 1983; FANSELOW 1984a,b). Diesem Fortschritt in der Beschreibung und Erklärung von Wortbildungsprozessen steht ein recht großes Defizit auf der eher theoretisch-konzeptuellen Seite gegen­ über. Die Frage nach der „Stellung der Wortbildung in der Grammatik“ wird nicht oder nicht mehr gestellt. Wenn man die eine oder andere Regel im Wortbildungsbe­ reich formuliert, ist nicht von vornherein klar, worüber damit eine Aussage ge­ macht wird. Sicherlich wird ein empirischer Anspruch über einen Teil unserer menschlichen Sprachfahigkeit erhoben. Aber CHOMSKY hat erkannt (cf. CHOMS­ KY 1980a), daß es in unseren Gehirnen vermutlich kein solches mentales Organ „Sprachfähigkeit“ gibt. Vielmehr scheint sich diese, wie gesagt, aus einem Zu­ sammenspiel von autonomen Einzelmodulen oder Teilkompetenzen zu ergeben. Jedes dieser Einzelmodule folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten, und unsere Spra­ che ist ein Epiphänomen der Interaktion dieser Teilkompetenzen. So stellt sich die Frage, welches Modul die Kompositionsfahigkeit erklärt. Verschiedene Antwor93 ten auf diese Fragen sind denkbar. Die Wortbildungskompetenz könnte ein Teil unserer grammatischen Kompetenz sein, oder aber ein mehr oder minder direktes Abbild von einer sprachunspezifischen „language o f mind“ . Eine weitere Inter­ pretation wäre diese: die Gesetzmäßigkeiten bei der Wortbildung spiegeln den Stand einer onto- wie phylogenetisch frühen Variante des genetischen Programms des Menschen für Sprache wider. Wenden wir uns zunächst der Annahme zu, die Wortbildung entspringe dem Wirken der syntaktisch-formalen Kompetenz des Menschen. Dies scheint die verbreitetste Hypothese zu sein. Robert LEES hat sein Werk zur englischen Wortbildung eben „the grammar of English nominalization“ genannt, und in Referenzwerken findet sich die Wortbildung stets in Zusammenhang mit der Morphologie oder der Syntax abgehandelt. Die Gründe, so vorzugehen, mögen in der traditionellen Grammatik eher intuitive sein. Erstmals in LEES (1960) wurden empirische Fakten aufgezeigt, die eine enge Beziehung zwischen Syntax und Komposition nachzuweisen schienen. Der Gedankengang war im Prinzip dieser: wenn Komposition nicht in einer Be­ ziehung zu Relativsätzen zum Beispiel steht, dann kann die linguistische Theorie wichtige Generalisierungen nicht ausdrücken. Eine Konstruktion, die aber in Ver­ bindung mit Relativsätzen steht, muß in der Syntax erzeugt werden. Vor allem be­ zog man sich dabei auf drei Phänomene: a) phrasale Ausdrücke wie Haus, das aus Holz ist, oder Haus aus Holz sind zu Komposita wie Holzhaus synonym; b) Komposita können mehrdeutig sein (Holzschuppen: Schuppen für Holz oder Schuppen aus Holz); c) bestimmte Modifikations- und Komplementationsverhältnisse finden sich so­ wohl bei phrasalen Ausdrücken als auch bei Komposita. In er macht die Uhr ist Uhr das thematische Objekt von machen, genauso wie in der Zusammen­ setzung Uhrmacher. Wie schon MOTSCH (1970) beobachtete, liegt die Schwäche solcher Argumentatio­ nen gerade in der Tatsache, daß sich die herangezogenen Fakten auf den Bedeu­ tungsaspekt der Konstruktionen beziehen, und nicht auf formale Gegebenheiten. Nur wenn man die Theorie vertritt, daß die Interpretation eines Ausdrucks seiner Tiefenstruktur abgelesen wird, nur wenn man meint, daß Ambiguitäten ausschließ­ lich dadurch erklärt werden, daß einer Oberflächenkette mehrere Tiefenstruk­ turen zugeordnet werden, nur unter diesen Voraussetzungen sind die in (a)—(c) angesprochenen Argumente stichhaltig. Wenn nämlich Holzhaus und Haus, das man aus Holz gemacht hat synonym sind, und sich die Bedeutung aus der Tiefenstruktur errechnet, dann muß die Tiefenstruktur von Holzhaus mindestens so komplex sein, wie die der Nomen + Relativsatzkonstruktion. Der Weg von diesen komplexen, zugrundeliegenden Strukturen in die einfache Oberflächenverzweigung wird dann nur über Transformationen begehbar sein (cf. etwa BREKLE 1970; KÜRSCHNER 1974 für konkrete Vorschläge). Transformationen sind aber ein Standardbestand­ 94 teil des syntaktisch-formalen Inventariums, also wäre auch der Wortbildungsprozeß im Kern syntaktisch-formal. Im Rahmen der Semantikkonzeption der Standard-Theorie (CHOMSKY 1965) er­ scheint also ein Syntaxbezug der Komposition nicht unplausibel. Aber die Argu­ mentation fällt in sich zusammen, wenn diese Bedeutungstheorie zusammenfällt, und eben diese Aspekte-Semantik mußte sehr bald aufgegeben werden. Es zeigte sich nämlich, daß die semantischen Regeln nicht allein auf die Tiefenstruktur Bezug nehmen können. Vergleichen wir hierzu Beispiel (1) (cf. dazu und für weitere Beispiele JACKENDOFF 1969; CHOMSKY 1972, 1977): (la) (lb ) beavers build dams dams are built by beavers Nach Annahmen der Standardtheorie wird der Satz (lb ) vermöge der Passivtrans­ formation aus einer Struktur, die zu (la ) korrespondiert, abgeleitet. Da die Inter­ pretation nur von der Tiefenstruktur abgelesen wird, muß also den Sätzen (la) und (lb ) dieselbe Interpretation zukommen. Diese Vorhersage steht aber in Kon­ flikt mit den Fakten, (la ) ist eine wahre Aussage über Eigenschaften von Bibern, (lb ) eine falsche über Eigenheiten von Dämmen. Wenn (la ) und (lb ) nicht ein­ mal denselben Wahrheitswert besitzen, können sie kaum dieselbe Bedeutung tragen. Darüberhinaus gibt es noch weitere empirische Argumente dafür (CHOMSKY 1972, 1977, 1981), daß die Interpretation an der Oberflächenstruktur abgelesen wird. Damit aber werden alle Argumente für eine syntaktische Fundierung von Kompo­ sita qua Transformation hinfällig. Tatsächlich sind die angesprochenen Phänomene ohne syntaktische Fundierung erklärbar, wenn man etwas reichere Annahmen über die Struktur des semantischen Interpretationssystems macht, wie MOTSCH (1970) schreibt. In den letzten fünf Jahren sind mehrere spezifische Vorschläge vorgebracht worden, wie dieses reichere Interpretationssystem für Komposita genau aussehen könnte (cf. DOWTY 1979; FANSELOW 1981, 1984a). Selbstverständlich ist durch diese Überlegungen noch nicht erwiesen, daß Wortbil­ dung kein von der Universalgrammatik gesteuertes Phänomen ist; sie haben nur ge­ zeigt, daß für die gegenteilige Position kaum Argumente zu finden sein werden. Gegen die Integration der Wortbildung in die Grammatik sprechen jedoch Daten und Erklärungsansätze, die v.a. aus zwei Evidenzbereichen stammen, einmal aus der allgemeinen Grammatiktheorie und andererseits aus der Neuro- und Psycholin­ guistik. Für den Bereich der Syntax hat sich im letzten Jahrzehnt erwiesen, daß die gramma­ tischen Prozesse von einer Reihe abstrakter und vermutlich angeborener Prinzi­ pien gesteuert sind, der sogenannten Universalgrammatik. Uber die spezifische Na­ tur der UG scheinen heute schon konkrete Aussagen möglich, wie sie etwa in den Teiltheorien „X-bar-Schema“ , „Bindungstheorie“ , „Kontrolltheorie“ , „Theorie der thematischen Rollen“ , „Theorie der Grenzknoten“ , etc. im Rahmen des Sy­ stems der ,Lectures on Government and Binding4 formuliert werden. Im folgen­ den wird gezeigt, daß keine dieser Subtheorien vermutlich in die Wortbildung ein­ 95 greift. Die vermutlich genetisch vorgegebenen Prinzipien spielen nun nicht nur keine Rolle bei der Wortbildungserzeugung, sie werden obendrein in mehrfacher Weise von Komposita- oder Derivatsstrukturen verletzt. Die Vorhersagen, die aus einer Integration des Wortbildungsprozesses in das System der Universalgrammatik folgen, treffen also nicht zu, was für den nicht-grammatischen Charakter des Phä­ nomens spricht. Ich möchte diese Aussage an zwei Bereichen von Prinzipien der Universalgrammatik exemplifizieren, der X-bar-Theorie und der Theorie der thema­ tischen Rollen. Traditionell bestand die kategoriale Komponente der Grammatik, die die Tiefen­ oder D-Strukturen erzeugte, aus einer Menge expliziter Phrasenstrukturregeln wie (2): (2a) (2b) (2c) VP -» V NP (PP) NP -> Det (AP) N (PP) PP P NP Mit solchen Regeln sind eine Vielzahl konzeptueller Probleme verbunden, sie sind keine wahrscheinlichen Kandidaten für Prinzipien der Universalgrammatik, u.a. we­ gen ihrer offensichtlichen Sprachspezifität. CHOMSKY (1972) hat zur Überwindung dieser Probleme die X-bar-Notation vorgeschlagen; auf dieser Grundlage konnte die Theorie der kategorialen Komponente entscheidend weiterentwickelt wer­ den. STOWELL (1982) wies nach, daß diese einzig aus einer Instruktion wie (3), dem sogenannten X-bar-Schema besteht. (3) Xi+ 1 -*■ ....X1....; w obei.... eine Folge maximaler Projektionen Über jeder lexikalischen Kategorie X sind eine Folge von sog. Projektionen oder Kategorien X' definiert. Der maximale Wert von i (z.B. 3 o.ä.) definiert die sog. maximale Projektion von X, deren kategorialer Status im wesentlichen den her­ kömmlichen phrasalen Knoten NP, PP, AP etc. entspricht. Das X-bar-Schema ga­ rantiert einerseits, daß in jeder NP, VP etc. jeweils ein lexikalischer Kopf der gleichen Kategorie (also N bzw. V) steht, andererseits werden nur maximale Pro­ jektionen als Schwesterknoten in den Projektionen toleriert. In offensichtlicher Weise wird (3) Ubergenerieren, also Strukturen wie (4) erzeugen. Diese unerwün­ schten Derivate werden allerdings von Prinzipien wie Subkategorisierungstheorie, der Kasustheorie, der Theorie thematischer Rollen herausgefiltert (vgl. CHOMSKY 1981; STOWELL 1982 und Kap. 2 von FANSELOW 1984c): (4) *John loves yesterday him in the park Mary every time Wenn die transformationelle Ableitung von Komposita andererseits unplausibel ist, dann muß das Regelsystem die Oberflächenverzweigungen direkt erzeugen können. Für das Deutsche könnte man geneigt sein, Regeln wie (5) anzusetzen: (5a) (5b) (5c) 96 N -* N + N N -*• A + N N -*• V + N Nagelfabrik Schnellbahn Mähmaschine (5d) (5e) (5 0 (5 g ) (5h) (5 0 (5 j) (5k) (5 1 ) N -►P + N V -*N + V V-*- A + V V ^ V +V V ^P +V A -►N + A A -*■A + A A^V+A A-*-P + A Vorzug, Unterbau radfahren, bergsteigen festschrauben mähdreschen nachwinken, zulächeln winterfest hellgelb waschecht vorschnell (5) bringt nun nur sehr indirekt zum Ausdruck, daß für die Komposition generell gilt, daß ein Bestandteil —der Kopf, das Determinatum - mit der Gesamtkonstruk­ tion in allen wesentlichen kategorialen Merkmalen übereinstimmen muß. Der Regel­ typ in (5) läßt eine Regel wie (6) als genauso plausibel erscheinen wie z.B. (5e), ob­ wohl entsprechende Kompositionsregeln in keiner bekannten Sprache realisiert sind. (6) A -*>P + V Einen ersten Ausdruck der Übereinstimmung von Kopf und Komposition gibt die Reformulierung (7). Wir sehen dabei davon ab, daß PA-Zusammensetzungen im Deutschen kaum realisiert scheinen, da diese Bildungsform aus inhaltlichen Gründen unmöglich scheint (cf. FANSELOW 1984a, b). (7a) (7b) (7c) (7d) X -»>N + X X -*• A + X X -»>V + X X -*• P + X In (7) wird unmittelbar gefordert, daß Kompositum und Determinatum in den kategorialen Merkmalen übereinstimmen. X läuft dabei als Variable über die Wer­ te N, V und A. Wiederum lassen sich inhaltliche Gründe formulieren (FANSE­ LOW 1984 a, b), die ein Kompositum mit präpositionalem Kopf blockieren. Es ist daher unproblematisch, für X auch P als Wert anzusetzen. Wie (7) weiter spe­ zifiziert, ist andererseits aber auch als Wert des Determinans jede lexikalische Ka­ tegorie erlaubt. Also läßt sich (7) zu (8) verallgemeinern: (8) X -*• Y + X (8) ist nun korrekt für das Deutsche oder das Englische, aber nicht für Sprachen, deren Determinatum am Anfang der Zusammensetzung steht. Dort müßten in der entsprechenden Regel die Positionen von X und Y rechts vom Regelpfeil vertauscht werden. Es ist aber kaum plausibel, daß im menschlichen Gehirn die beiden Optio­ nen derart unabhängig voneinander repräsentiert sind. Die offensichtliche Gene­ ralisierung ist, daß einer der beiden Bestandteile der Zusammensetzung die katego­ rialen Merkmale des Kompositums in allen Sprachen bestimmt, wobei es auf dessen Position selbst nicht ankommt. Man extrahiert also die Forderung nach kategoria97 ler Übereinstimmung aus (8), postuliert also (9), legt Sprache für Sprache (=(10)) fest, wo der „Kopf“ der Konstruktion steht und fordert allgemein für alle Spra­ chen, daß Kopf und Gesamtkonstruktion in allen Merkmalen übereinstimmen. (9) (10) X -* Y Z Deutsch/Englisch: In ( x Y Z) ist Z Kopf von X Französisch/Hebräisch: In ( ^ Y Z) ist Y Kopf von X Ein Vergleich von (9) mit (3) läßt einige wenige Parallelen zwischen Kompositum und Satzsyntax erkennen, die letztendlich nur darin bestehen, daß (3) und (9) relativ triviale Regelungen sind. In dem Bereich freilich, in dem (3) nichttriviale Setzungen vomimmt, verstößt (9) gegen die Forderungen der X-bar-Theorie. Erstens wird in (3) ein Werteabstieg in der Projekttionstiefe gefordert: N3 kann stets nur N2 dominieren, N2 nur N 1, aber nicht etwa N 1 N2 oder N1. Dies ist in der Wortbildung anders: hier dominiert stets ein Element auf der Lexem-Ebene (X°) zwei weitere X°-Elemente. Noch auf eine zweite Weise ist das X-bar-Schema mit (9) verletzt: in der X-bar-Theorie wird gefordert, daß die Nicht-Kopf-Bestandteile einer Struktur sämtlich maximale Projektionen darstellen müssen — in Wort­ bildungskonstruktionen hingegen sind die Determinanten alle auf der X°-Projek­ tion; alle anderen Projektionswerte sind in Komposita verboten. Sicher kann man auf die eine oder andere Weise mit Taschenspielertricks etwa die Projektionsalge­ bra so formulieren, daß „0-1“ wiederum „0“ ergibt und so (9) zu (3) in Beziehung setzen, doch überdeckt man damit nur die wesentliche Aussage, daß phrasale Strukturen tiefgreifende Unterschiede zu Wortbildungsstrukturen, wie sie von WILLIAMS (1981), LIEBER (1980, 1981, 1983), SELKIRK (1982), HÖHLE (1982) oder TOMAN (1983) postuliert wurden, aufweisen. Wortbildung ist also nicht von der kategorialen Komponente der Universalgrammatik gesteuert. In der Theorie der thematischen Rollen geht man davon aus, daß Prädikate in phrasalen Strukturen ihren Argumenten und präpositionalen Ergänzungen sog. „thematische Rollen“ wie Agens oder Experiencer zuweisen, also etwas, was grob gesprochen, dem FlLLMORE’schen Tiefenkasus entspricht. So bekommt in (11) Hans von küßt die thematische Rolle Agens zugewiesen, und Maria Patiens oder Benefizient. (11) Hans küßt Maria Soweit ist die Angelegenheit noch trivial und ohne wesentlichen Aussagewert. Weit­ reichende empirische Vorhersagen ergeben sich aber dann, wenn man als gramma­ tisches Prinzip ansetzt, daß jeder NP oder PP in einem Satz nur genau eine thema­ tische Rolle zugewiesen werden darf, und jede thematische Rolle, die ein Prädikat zu vergeben hat, auch einer NP oder einer PP zugewiesen sein muß. Technisch nennt man dieses Prinzip das „Theta-Kriterium“ . Dieses Theta-Kriterium ist nun in Kompositionsstrukturen mehrfach verletzt. Vergleichen wir dazu (12): 98 (12) Ziehbrücke Ziehen ist ein zweiwertiges Verb, das seinem Subjekt die thematische Rolle „Agens“ und seinem Objekt die thematische Rolle „Patiens“ zuweist. In Ziehbrücke ist aber das „Subjekt“ des Ziehens überhaupt nicht ausgedrückt, die thematische Rolle „Agens“ kann an keine NP zugewiesen werden. Ganz analog wird in Suchhubschrauber „Patiens“ keiner NP zugewiesen. Wir verletzen also in diesen Strukturen das Theta-Kriterium. Zweitens wird in der Syntax eine thematische Rolle stets nur einer NP zugewiesen, oder einer PP, aber niemals einem Nomen. Für (12) müßten wir nun aber annehmen, daß die Patiensrolle von ziehen an Brücke, ein einfaches Nomen, zugewiesen wird. Drittens ist in (13) das Kompositum, wie generell, in einen Satzverband integriert. (13) Wir gehen über die Ziehbrücke gehen über weist hier Ziehbrücke, oder genauer, dessen referentiellem Index eine thematische Rolle zu, welcher aber auch von ziehen thematisch markiert wird. Hier treffen also zwei Rollen auf einen Träger, was wiederum das Theta-Kriterium verletzt. Ein weiteres Argument gegen eine syntaktische Fundierung des Kompositionspro­ zesses läßt sich aus BREKLE (1970) herauslesen, wenn man die Arbeit vor dem Hintergrund neuerer theoretischer und empirischer Erkenntnisse interpretiert. LEES (1960) ging davon aus, daß Komposita über eine Reihe von Tilgungsopera­ tionen aus Tiefenstrukturen abgeleitet werden, die vollwertigen Relativsätzen zu­ grunde liegen könnten, wenn nur eine alternative syntaktische Transformationsfol­ ge auf sie angewendet würde. BREKLE führte nun eine ganze Reihe guter Argu­ mente dafür an, daß dies nicht richtig sein kann. Wenn etwa Artikel in der Tiefen­ struktur von Komposita Vorkommen könnten, dann sollte der Automotor auch als Interpretation haben: ein Motor, der alle Autos antreibt, der kein Auto an­ treibt, oder der zwei Autos antreibt. Alle diese Lesarten hat das Kompositum nicht. Vielmehr ist die Artikelwahl, semantisch gesehen, völlig undeterminiert. Je nach dem Kontext, in dem z.B. Briefmarkenausstellung gedeutet wird, kann es sich um eine einzige Briefmarke (z.B. die orange Mauritius) oder um mehrere han­ deln. Auch sind Komposita bezüglich ihrer modalen Struktur nicht festgelegt, also bezüglich dessen, was Syntaktiker unter den Knoten AUX zusammenfassen. Ein Automotor ist nicht unbedingt einer, der ein Auto faktisch antreibt, sondern es kann auch einer sein, der aufgrund seiner Konstruktion ein Auto antreiben könnte. Nicht einmal Tempus scheint in den Strukturen fiir Komposita vorliegen zu dürfen. Wenn Holzhaus in (14) ein Haus bezeichnet, das jetzt aus Holz ist, und diese Struk­ tur stets Holzhaus zugrundeliegt, dann kommt man mit (15) in Schwierigkeiten: (14) (15) Das Holzhaus ist wunderschön Das Holzhaus ist abgebrannt 99 (15) drückte unter dieser Strukturierung nun die widersinnige Behauptung aus, daß ein Haus abgebrannt ist, welches jetzt aus Holz ist. Also muß wegen (15) auch das Tempus „Perfekt“ in den Kompositatiefenstrukturen zulässig sein. Man schließt mit dieser Strategie zwar Lücken in der Vorhersagekraft der Theorie, reißt aber anderswo solche wieder auf: wenn „Perfekt“ in den Tiefenstrukturen von Kom­ posita vokommen dürfte, müßte (14) nun die Lesart besitzen können, „etwas, was früher aus Holz gewesen ist (und heute ansprechend aus Marmor nachgebaut ist) ist wunderschön“ . Ganz eindeutig liegt diese Lesart bei (14) aber gerade nicht vor! Sicherlich sind diese Aussagen in der einen oder anderen Weise präziser zu fassen (BREKLE 1973; FANSELOW 1981), doch beschreiben sie ein m.W. vor BREKLE (1970) nicht beachtetes Faktum: während für die semantische Struktur von Kom­ posita über die Bedeutungen der Bestandteile hinaus noch erschlossene Relationen o.ä. anzusetzen sind, fehlen in diesen Strukturen regelmäßig gewisse Bedeutungs­ bestandteile von Satzstrukturen, bzw. sie sind nicht von der Grammatik her be­ stimmt. Man mag sich fragen, was an dieser Beobachtung von Belang sein mag. Interessant wird das Fehlen gewisser Bedeutungselemente freilich erst dann, wenn man die Frage stellt, welche gemeinsamen Eigenschaften diese in Kompositionsbedeutun­ gen nicht regelhaft induzierten Bedeutungselemente haben —sie finden syntaktisch ihren Ausdruck in der Klasse der „kleinen“ Wörter, den Funktionswörtem oder der Flexion. Nehmen wir also an, aus irgendwelchen Gründen seien die Bedeutungen von Funk­ tionsmorphemen, und diese selbst, beim Kompositionsprozess nicht zugänglich. Welche empirischen Vorhersagen lassen sich über die beiden angesprochenen Phä­ nomenbereiche „Fehlen von Q ualifikation“ und „Fehlen modaler Elemente“ aus dieser Annahme ableiten? Wie von BREKLE (1970) beobachtet, geht den semantischen Strukturen von Kom­ posita die Negation ab (in dem Sinne, daß negative Bedeutungen nur dann ausge­ drückt sein können, wenn das Negationsmorphem an der Oberfläche erscheint, wie in Nichtwähler). Keinesfalls sind die Gründe hierfür pragmatisch-semantischer Natur (cf. DOWNING 1978). Das Fehlen von Negation ist insofern also un­ geklärt, doch vorhergesagt, wenn allgemein Funktionswortbedeutungen nicht in Komposita induziert werden können. Eine weitere Klasse von Funktionswörtem sind die Pronomina. Wenn Pronomina­ bedeutungen in der semantischen Struktur von Komposita fehlen müssen, ist korrekt vorhergesagt, daß Bindung in Wortbildungsprodukte hinein nicht mög­ lich ist, d.h., daß Wörter also „anaphorische Inseln“ sind. So kann jeder Mann kennt das Blumengeschäft nicht bedeuten: jeder Mann kennt das Geschäft, in dem er Blumen kauft, obwohl an sich nichts gegen eine solche semantische Repräsen­ tation auch für Komposita spricht (cf. FANSELOW 1984b für Details). Das Fehlen von Funktionswortbedeutungen in Komposita wäre nun wiederum selbst erklärt, wenn aus irgendwelchen, gleich noch zu klärenden Gründen, der gesamte Lexemeintrag für Funktionsmorpheme nicht für Kompositionsprozesse 100 akzessibel wäre. Unter dieser Voraussetzung folgt unmittelbar, weshalb die Kom­ positionsregel (9) auf lexikalische Kategorien eingeschränkt ist, weshalb also Bil­ dung mit Artikeln (Der-Mann, Jedfrau) Hilfsverben (Hab-Schläfer), Pronomina (Er-Geßhl, Sich-Bezug) usw. alle ungrammatisch sind, weshalb Kasus- und Nu­ merusmorpheme in Komposita nicht regiert sein können, weshalb keine Inflektion bei verbalen Bestandteilen auftritt, weshalb keine Kongruenz zu Adjektiven auftritt, und vieles andere m ehr.1) Mit der angesprochenen Hypothese lassen sich also eine Vielzahl von korrekten und nicht-trivialen empirischen Vorhersagen machen, und sie dürfte daher zu­ treffen. Die Frage ist aber, warum sie gelten sollte. Man könnte einerseits wie von WILLIAMS (1981) aus anderen Gründen vorge­ schlagen so vorgehen, daß in der allgemeinen Kompositionsregel (9) der Variab­ lenwert X, Y und Z jeweils auf Nicht-Funktionswortkategorien beschränkt ist. (9) X -* Y Z Die hauptsächliche Schwierigkeit, in die man sich mit diesem Ansatz begibt, ist, daß die Beschränkung „keine Funktionswörter“ eben nicht nur für die .Ober­ flächen* von Komposita gilt, sondern auch für nicht-oberflächlich realisierte Elemente in der semantischen Repräsentation dieser Wortbildungsprodukte. Es ist kein Weg in Sicht, wie man dies in Griff bekommen sollte, wenn der Kompo­ sitionsprozess Teil der Syntax ist. Denn hier stehen die Funktionswörter und ihre Bedeutungen uneingeschränkt zur Verfügung, und man müßte eine reine Sti­ pulation vornehmen (nämlich: keine Funktionswortbedeutungen in den seman­ tischen Repräsentationen von Komposita), für die unklar ist, wieso sie bestehen sollte, und die zu formulieren gar nicht so einfach ist. Auch ist selbst die Einschränkung der Variablenwerte für (9) eine Stipulation, die in keinem Zusammenhang steht zu den bereits oben angesprochenen Fakten, daß ein Teil der syntaktischen Prinzipien in Komposita verletzt sind, und der Rest „leer“ appliziert. Ein ganz anderes Bild ergibt sich freilich, wenn wir die Hypothese aufgeben, daß Wortbildung, Komposition, sich als eine der verschiedenen syntaktisch fundierten Ausdrucksmöglichkeiten erklärt. Es ist mehrfach festgestellt worden, so etwa von CARLSON (1982), daß ein enger Zusammenhang zwischen syntaktischen Regularitäten und Strukturen einerseits, und Funktionsmorphemen andererseits besteht. Häufig werden Inhalte, die eine Sprache mit Funktionsmorphemen ausdrückt (etwa: Frage im Latein), in anderen Sprachen rein syntaktisch (durch Wortstellung, im Deutschen) oder durch über diese syntaktischen Strukturen projizierte Intonationskonturen ausgedrückt. Funk­ tionsmorpheme signalisieren syntaktische Strukturierungen und erscheinen daher häufig, wie CARLSON (1982) zeigt, in Positionen, die ihrem semantischen Beitrag nicht entsprechen. Es scheint kaum einen Unterschied zu machen, ob sie mit den kategorialen Expansionsregeln wie Inhaltswörter in Strukturen eingeführt werden, oder synkategorematisch mit den syntaktischen Regeln selbst (MONTAGUE 1973) 101 oder durch einen Zuweisungsprozeß (CHOMSKY 1 9 8 1 ) oder durch eine Kombina­ tion dieser Möglichkeiten. Vielfach nehmen die Funktionsm orphem e auch bloße syntaktische Funktionen ohne Bedeutungsbeitrag wahr, etwa bei Präpositional­ objekten. Hierbei läßt sich feststellen, daß teilweise Lexeme in beide Klassen ein­ geordnet werden können. So läßt sich der Einwand gegen die oben angesprochene Hypothese des Fehlens von Funktionsmorphemen in WB-Strukturen ausräumen, der auf Wörter wie Vor-Zug o.ä. verweist. Gerade bei den Präpositionen ist die­ se Doppelfunktion deutlich und auch psycholinguistischen M ethoden nachweis­ bar (FRIEDERIC3 1983); dementsprechend sind auch die Kompositionsmöglich­ keiten zweigeteilt. Setzt man z.B. ein nomen agentis zusammen mit einem No­ men, und wird das Verhältnis zwischen den beiden in der phrasalen Syntax durch eine Präposition wiedergegeben, dann finden wir akzeptable wie nicht-akzeptable Verbindungen. Wo die Präposition starken semantischen Gehalt hat wie für in käm pfen für (und nicht gegen) den Frieden, ist Komposition zulässig, cf. Friedens­ kämpfer. Wo der Präposition nur syntaktische Funktion zukom m t wie bei den­ ken an (es ist sinnlos zu sagen: ich denke nicht an Luise, sondern zwischen Luise) ist eine Komposition blockiert, cf. * Mädchendenker. Alles in allem deuten die angesprochenen Punkte also auf eine enge Verbindung zwischen Syntax und Funk­ tionsmorphemen hin, beide scheinen sich aus einem Kognitionsbaustein, der Univer­ salgrammatik, zu erklären. Diese Vermutung wird durch Psycho- und Neurolinguistik bestätigt. Bei der BrocaAphasie stellt man beispielsweise einen selektiven Ausfall von Funktionswörtem fest (CARAMAZZA/BERNDT 1978), der nicht, wie KEAN ( 1 9 8 2 ) vorschlägt, durch gemeinsame phonologische Eigenschaften bedingt sein kann (vgl. etwa BAYER/ DE BLESER 1984), sondern in deren syntaktischer Funktion beruhen m uß; der Aus­ fall von Funktionsmorphemen ist also begleitet von syntaktischen Störungen und vice versa. Ganz analog dazu fallt bei der Tiefendyslexie selektiv Lesefahigkeit für Funktionswörter aus, wohingegen Inhaltswörter weiterhin in gewissem Sinne gut gelesen werden. Hierbei erklärt sich ein Syntaxbezug insofern, als man dafür argumentieren kann (COLTHEART 1 979), daß die Leseleistung der Tiefendyslektiker allein aus den sprachlichen Funktionen der rechten Hemisphäre resultieren, welche nicht formal, syntaktisch, sondern semantisch fundiert sind. Auch dabei stehen also syntaktisch-formale Mängel mit Mängeln bei Funktionsw örtern in enger Beziehung. Aus der unmittelbaren Verbindung zwischen Funktionsw örtern und dem gramma­ tisch-syntaktischen System lassen sich also weitere Argumente für eine Stellung des Kompositionsprozesses außerhalb der eigentlichen Gram m atik finden. Mit dieser Annahme erklärt sich mithin auch das Fehlen von „kleinen“ W örtern und Morphe­ men im Wortbildungsprozeß. 2 Entstammen Komposita einer „language of the m ind"? Ich habe in (1.) relativ ausführlich darzustellen versucht, weshalb der Wort­ bildungsprozeß kein Bestandteil der formalen Kompetenz des Menschen, kein Er­ gebnis des Wirkens der syntaktischen Module seiner Sprachfahigkeit sein kann. Man 102 muß sich nun nach plausiblen alternativen Lokalisierungen der Wortbildungsfähig­ keit umsehen. Eine solche Alternative hat BREKLE (1970) formuliert. Nach BREKLE liegen so­ wohl den Phrasen als auch den Komposita sogenannte Satzbegriffe zugrunde. Wenn man so will, sind diese wesentlich abstraktere, nach logischen und nicht nach sprachlichen Prinzipien organisierte Tiefenstrukturen von Sätzen, wie man sie auch in der Generativen Semantik findet. Durch eine Reihe von Prozessen werden diese Satzbegriffe auf Oberflächenketten abgebildet. Satzbegriffe können, aber müssen nicht Funktionswortäquivalente enthalten. Satzbegriffe, bei denen diese fehlen, fuhren zu Komposita oder anderen syntaktisch armen Strukturen, und zwar durch einen Prozeß der Topikalisierung gewisser Prädikate innerhalb der Satzbegriffe. Wir würden etwa bei Nagelfabrik als Satzbegriff zugrunde legen: JEMAND PRO D U ZIERT IN FA BR IK NAGEL, und erhielten das Kompositum, in dem wir primär F A B R IK , sekundär N A GEL topikalisieren. Auf die Gefahr hin, Herbert BREKLE über- und/oder fehlzuinterpretieren, könnte man nun folgende Vermutung anstellen: es gibt so etwas wie eine „language of mind“ , die im wesentlichen begrifflich aufgebaut ist (cf. etwa JACKENDOFF 1983) und aus der allein Kompositionsstrukturen aufgebaut sind. Bei syntaktischen Phrasen wird diese „language o f mind“ mit Elementen angereichert (Strukturen und Funktionsmorpheme), welche eine eindeutige Interpretation erzwingen und sich weniger aus einer inhaltlichen Funktion als aus syntaktischen Gegebenheiten ergeben. Mir scheint diese Sichtweise, daß Komposition auf einem Repräsentations­ system beruht, das qualitativ betrachtet weniger Information und Elemente wieder­ gibt, recht plausibel, aus den in Abschnitt 1 vorgebrachten Gründen: die Annahme, daß der mit der Komposition verbundene Prozeß auch prinzipiell zurückgreifen kann auf syntaktisch-funktionales Material, fuhrt nur zu großen deskriptiven und explanativen Problemen. Die Frage, die verbleibt, ist, welchen Status dieses Reprä­ sentationssystem besitzt. Aus BREKLE (1970) könnte man den Schluß ziehen, daß dieses Repräsentationssy­ stem eben das System ist, in dem mental Bedeutungen repräsentiert sind. Diese mentalen Bedeutungsrepräsentationen können, müssen aber nicht, wie dargestellt, Funktionswortäquivalente bzw. deren Interpretation enthalten. Da wir nun zu die­ ser „language o f m ind“ keinen direkten Zugang haben, ist die Frage eher die, abzu­ schätzen, inwieweit eine solche Interpretation plausibel sein kann. Ganz allgemein muß man an eine „language of mind“ die Forderung stellen, daß sie Bedeutungen, oder deren mentale Repräsentationen enthält. Etwa könnte man sich — in einer liberalen Wittgensteininterpretation — nun denken, daß Inhalts­ wörter ihre Entsprechung in der „language of mind“ in einem Bild oder Modell finden (cf. JOHNSON-LAIRD 1983), (real interpretiert oder eher abstrakt im Wittgenstein’schen Sinne), wohingegen die logischen Wörter nicht bildlich ausdrückbare Beziehungen zwischen Bildern, oder die Art und Weise, wie Bilder zu deuten sind, angeben — man kann ja den Sachverhalt, daß Maria nicht raucht, genauso wenig eindeutig durch ein Bild wiedergeben, wie den Sachverhalt, daß alle Menschen ge­ rade den Arm heben (wie sollte man ins Bild integrieren, daß die abgebildeten 103 Menschen tatsächlich alle Menschen abbilden?) (aber cf. JOHNSON-LAIRD 1983). Insofern mag diese Überlegung nahelegen, daß eine Unterscheidung in der „language of mind“ wie die eben anvisierte (zwischen solchen Repräsentationen, die logische Wörter enthalten, und solchen, die das nicht tu n ) gar nicht unplausibel erscheint. Betrachten wir aber nun ein konkretes Kompositum bezüglich der Frage der Reali­ sierung von „logischen“ Funktionen wie etwa dem Tempus. Ich hatte oben bei­ spielsweise in Anlehnung an KÜRSCHNER (1974) argumentiert, daß für die System­ bedeutung von Holzhaus von (16) nicht Präsens* angesetzt werden darf, da sich sonst große Probleme mit der Verwendung von Holzhaus in anderen temporalen Kontexten ergeben würden. (16) ich gehe in das Holzhaus Wie ist es nun aber zu verstehen, daß Tempus in der Bedeutung des Kompositum Holzhaus fehlt? Sicherlich kann dies nicht bedeuten, daß man sich bei der konkre­ ten Verwendung von Holzhaus in einem K ontext wie (16) nicht darauf festlegt, daß das Haus hier und heute aus Holz gebaut ist! Satz (16) ist nicht schon allein dadurch wahr, daß ich in ein Haus gehe, das irgendwann einmal aus Holz gewesen ist, oder sein wird, es muß tatsächlich zum Zeitpunkt des Hineingehens auch aus Holz sein. Offensichtlich liegt bei Holzhaus wie bei einer anderen großen Klasse von Komposita die (inhaltlich begründbare) Forderung vor, daß die relational er­ schlossene Eigenschaft (hier: bestehen aus) zum gleichen Zeitpunkt auf das Objekt zutreffen muß, wie die vom zweiten Bestandteil denotierte und als Oberbegriff auf das Kompositum selbst übertragene. Betrachtet man nun einen Satz wie (17), so stellt man dasselbe fest: (17) Das Holzhaus ist abgebrannt Der gesamte Satz steht im Perfekt, die ausgedrückte Eigenschaft m uß also zu einem Zeitpunkt vor dem Sprechzeitpunkt realisiert sein (cf. BÄUERLE 1979 für eine an­ gemessene Perfektdeutung). Diese Forderung „Zutreffen vor dem Spechzeitpunkt“ uberträgt sich nun in aller Regel auf alle anderen vom Verb regierten nominalen Prädikate. Wenn ich sage: das Haus ist abgebrannt, dann ist dieser Satz genau dann wahr, wenn es ein Objekt x gibt, das zu einem Zeitpunkt t abbrennt und t vor der Sprechzeit liegt, und wenn dieses x zu t ein Haus ist (war). Für (17) gilt genauer, daß das Objekt nicht nur zu t ein Haus gewesen sein muß, sondern zu t auch not­ wendig aus Holz bestanden haben muß. Auch hier findet sich Gleichzeitigkeit des Zutreffens von induzierter Relation und Kompositumsbedeutung. Über diese Gleichzeitigkeitsforderung kann man für (17) nun unm ittelbar ableiten, daß, bezogen auf den Sprechzeitpunkt, eben die Eigenschaft „besteht aus Holz“ per­ fektivisch zu interpretieren ist. Anders formuliert: bei jeder konkreten Verwendung eines Kompositums ist die erschlossene Relation temporal spezifiziert. Nur ist diese temporale Spezifikation nicht selbständig vom Kompositum induziert, sondern sie ergibt sich durch einen Schlußprozeß aus a) dem Wissen, daß für Komposita des Holzhaustyps aus unabhängigen Gründen Gleichzeitigkeitsforderung vorliegt und b) 104 aus der übergeordneten temporalen Einbettung des Kompositums durch das Satz­ prädikat bzw. dessen temporale Spezifikation. Welchen Schluß haben wir daraus zu ziehen? Wenn die Bedeutung eines jeden konkret verwendeten Kompositums also temporal spezifiziert ist, dann kann eine mentale Repräsentation, die diese temporale Spezifikation nicht enthält, nicht die Bedeutung dieses Kompositums widerspiegeln. Wenn es also aus den diskutierten Gründen eine mentale Repräsentation von Komposita geben muß, die keine tempo­ ralen Elemente enthält (also etwa BREKLEs Satzbegriffe oder irgendein Äquivalent dazu), dann kann diese Repräsentation nicht aus der „language of mind“ stammen, dem System von Bedeutungsrepräsentationen. Ähnliche Argumente lassen sich auch für die anderen Aspekte von Kompositionsbe­ deutungen anführen, die lt. BREKLE (1970) den Kompositatiefenstrukturen oder Satzbegriffen fremd sind. D.h., daß die semantischen Repräsentationen eines Wort­ bildungsproduktes, eines Kompositums, stets vollständig sein müssen, während ge­ wisse Aspekte dieser semantischen Repräsentationen wie Tempus, Modus, Q u a li­ fikation etc. nicht von der Struktur des Kompositums systematisch induziert sind, sondern von Gegebenheiten in seinem konkreten Verwendungskontext. Daraus folgt aber unmittelbar, daß die ärmeren „Satzbegriffe“ , die ärmeren Struk­ turen, denen Komposita Ausdruck verleihen, keine semantischen Repräsentationen, keine „language of mind“ sein können. Weder die grammatische Hypothese noch die semantische Hypothese zum Ursprung der Produktionsregeln für Komposita sind also empirisch und konzeptuell gesehen vertretbar. 3 Die globale, primitive Symbolfähigkeit des Menschen Mit der Darstellung, aus welchen Gründen welche Hypothesen über den möglichen Ursprung der Kompositionsfahigkeit des Menschen unplausibel sein müssen, ergibt sich noch nicht unmittelbar eine Antwort auf die Frage, welches Modul nun wirklich für diese Kompositionskompetenz verantwortlich sein könnte. Da weder Phonologie noch Pragmatik in Frage kommen werden, mag man sich wundern, welche möglichen Systeme nach der Widerlegung von syntaktischer und semantischer Fundierung überhaupt noch vorhanden sein können. Allerdings wissen wir aus der Sprachpathologieforschung, daß sich die sprachlich bezogenen Fähigkeiten des Gehirns nicht auf die Teilmodule beschränken, für die man linguistisch auf Grund von Autonomieüberlegungen argumentieren kann. Ins­ besondere scheint unbestreitbar zu sein, daß neben der i.d.R. links lokalisierten, eigentlichen Sprachkompetenz des Menschen auch in der rechten Hemisphäre ein System vorliegt, mit dem Sprache in relativ primitiver Form verstanden und produ­ ziert werden kann. Patienten mit Durchtrennung des corpus callossum, bei denen also die Verbindung zwischen den beiden Hirnhemisphären unterbrochen ist, kön­ nen gewisse Aspekte von Sprache auch mit ihrer isolierten rechten Hemisphäre ver­ arbeiten. Kinder, denen die linke Hemisphäre vor dem Einsetzen des Spracherwerbs entfernt werden mußte, erwerben zu einem beträchtlichen Ausmaße Sprache, wobei 105 allerdings charakteristische Fähigkeiten - eben aus dem Bereich der Syntax - ihnen unzugänglich bleiben. Da vergleichbare Kinder mit Entfernung der rechten Hemis­ phäre aber auch diese syntaktischen Regularitäten erwerben können, kann das Defi­ zit der ersteren Gruppe nicht in einer allgemein verringerten kognitiven Kapazität bei Fehlen einer Hemisphäre begründet sein. Vielmehr mögen eben bestimmte for­ male Aspekte von Sprache tatsächlich nur in der linken Hemisphäre repräsentierbar sein. Ähnliche Ergebnisse lassen sich für ,,Genie“ (cf. CURTISS 1977) finden. Ihr Spracherwerb begann erst nach der Pubertät; für sie ist anzunehmen, daß ihre Sprachfähigkeit rechts lokalisiert ist. Auch für sie war ein beträchtliches Sprachsy­ stem zugänglich, wobei sich allerdings wiederum die charakteristischen Defizite im formal-syntaktischen Bereich zeigten. Wie sieht nun aber die zugrundeliegende, primitivere Sprachkompetenz der rechten Hemisphäre aus (im folgenden als SR bezeichnet)? Relativ deutlich wird dies bei der Betrachtung des Syndroms der Tiefendyslexie, einer zentralen Störung der Lese­ fähigkeit. Es gibt gute Argumente dafür (cf. COLTHEART 1979), anzunehmen, daß Patienten, die unter diesem Syndrom leiden, mit dem Sprachsystem ihrer rechten Hemisphäre lesen. Charakteristisch ist, daß die Patienten bestimmte Wörter nicht oder nur falsch lesen können. Wir finden erstens die Unfähigkeit, Nonsenswörter zu lesen, also aus einer Graphemkette wie flap die phonologische und phonetische Re­ präsentation abzuleiten. Zweitens sind charakteristischerweise alle Funktionsmor­ pheme von der Lesestörung betroffen, Präpositionen, Pronomina, Inflektionsmorpheme, etc. werden nicht korrekt gelesen. Für die Inhaltswörter finden sich seman­ tische Paralexien, d.h. es wird anstelle des graphemischen Stimulus häufig ein Wort vorgelesen, das in einer semantischen Beziehung zu diesem Wort steht. Darüberhinaus ist bezeichnend, daß die Lesefähigkeit für Nomina besser ist als für Adjek­ tive, und wiederum besser ist für Adjektive als für Verben. Ganz analog liegen die Einschätzungen für die Sprachfähigkeit in der rechten Hemisphäre, die man etwa durch Tests wie dichotisches Hören o.a. erhält. Die Parallele zu den Gesetzmäßigkeiten bei Komposita liegt auf der Hand. Auch hier fehlen, wie gesagt, die Funktionsmorpheme ganz. Auch hier sind für die Inter­ pretation die assoziativen Beziehungen relevant, und auch hier finden wir eine Gradierung in der Kompositionsfähigkeit: Nominalkomposita werden viel häufiger und mit wesentlich weniger Restriktionen gebildet als Adjektivkomposita, wäh­ rend die Verbalkomposition — im Deutschen zumindest —praktisch gar nicht reali­ siert wird. Wir würden also all die Eigenschaften von Komposita, die wir bislang betrachtet haben, sofort in den Griff bekommen, wenn wir von folgender Annahme ausgehen: die Komposition ist weder von unserer grammatischen Kompetenz, noch von der konzeptuellen Kompetenz des Menschen gesteuert, sondern ist das Produkt des Wirkens der rudimentären Sprachfähigkeit SR, die sich in der rechten Hemis­ phäre wiederfindet. Damit soll nicht behauptet werden, daß man Sätze mit der linken Hemisphäre bildet, und Komposita mit der rechten. Die rudimentäre primi­ tive Sprachfähigkeit ist, so kann man argumentieren, tatsächlich in beiden Hemis­ phären vorhanden. Was ihre Existenz in der linken Hemisphäre betrifft, so e rsch ein t sie normalerweise nicht in den experimentellen Ergebnissen, weil in der linken He­ 106 misphäre zusätzlich noch die grammatische Kompetenz — vielleicht im Broca-Zentrum - operiert, und diese die Aufgabenlösung generell dann übernimmt, wenn sie Zugang zu dem Problem hat. Dieses Phänomen kann man allgemein in der Neuropsychologie feststellen: prinzipiell können beide Hemisphären bestimmte Aufgaben wie räumliche Orientierung von Objekten u.ä. bearbeiten, wobei je nachdem manch­ mal die rechte Hemisphäre überlegen ist, manchmal die linke. Sobald die Aufgabe aus irgendwelchen Gründen auch sprachlich angehbar ist, verschwindet jede Domi­ nanz, die man üblicherweise bei der rechten Hemisphäre beobachten kann. Es scheint eine allgemeine Strategie des Gehirns zu sein, Aufgaben dann mit der sprachlichen Kompetenz und ihren Teilmodulen zu lösen, wann immer dies nur möglich ist. Auf Grund der aus der Neuropsychologje gewinnbaren Evidenz kann man also da­ von ausgehen, daß neben der rein links angesiedelten formal-grammatischen Kom­ petenz des Menschen für Sprache in seinem Gehirn noch eine zweite, einfachere Symbolkompetenz besteht, die es erlaubt, einfache Strukturen zu produzieren und zu verstehen, denen die charakteristischen Elemente der Syntaxsteuerung jedoch fehlen. SR und die formal-grammatische Kompetenz haben Zugriff auf dasselbe Inventar an Inhaltswörtern, und es sieht ganz so aus, als entsprächen die bei der Komposition beobachtbaren Gesetzmäßigkeiten den simplen, primitiven Prinzipien von SR. Ist nun SR eine kompositions- oder wortbildungsspezifische Fähigkeit, die aus irgendwelchen Gründen bei Menschen anzusetzen ist? Die Steuerung von Äuße­ rungen in natürlichen Sprachen Erwachsener durch SR scheint sich nicht auf Komposita bzw. Wortbildung zu beschränken. Insbesondere dürften „nicht-konfigurationale“ Phänomene in verschiedenen Sprachen in der einen oder anderen Weise auf SR reduzierbar sein. Es ist hier nicht der Ort, auf die neuere Konfigurationalitätsdiskussion in extenso einzugehen. Im wesentlichen handelt es sich bei dieser Diskussion um die Frage, ob in allen Sprachen grammatische Funktio­ nen wie Subjekt oder Objekt konfigurational, d.h. in Begriffen von Dominanz­ verhältnissen definiert werden können, wie es CHOMSKY (1965) z.B. für das Sub­ jekt als „die NP, die unmittelbar von S dominiert wird“ vorgeschlagen hat. Spra­ chen, in denen das nicht der Fall zu sein scheint, nennt man „nicht-konfigurational“ . Ihre Grammatik kann dann nicht strukturell fundiert sein, sondern muß in relationalen Termini organisiert sein, was entsprechende Konsequenzen für die Form und Natur der Universalgrammatik mit sich zöge. Anders als konfigurationale Sprachen, wie z.B. das Englische, zeichnen sich nicht-konfigurationale Spra­ chen durch folgende Charakteristika aus: a) oberflächlich sind keine Bewegungen bei Passiv und ähnlichen Regeln erkenn­ bar (vgl. dt.: weil Monika mir einen Brief schickte und weil mir ein Brief geschickt wurde) b) die Sprachen weisen freie Wortstellung auf c) die Sprachen erlauben diskontinuierliche Konstituenten (vgl. dt.: Sozialdemokraten hat er keine eingeladen) 107 d) die Sprachen besitzen keine grammatisch erzwungenen Expletiva e) die Sprachen haben ein reiches Kasussystem 0 die Sprachen erlauben frei die Weglassung von Pronomina (Aufstellung nach Haie 1983), vgl. jap.: tabeta = ich/du/er/sie/es hat/habe(n) es gegessen Sieht man sich freilich die Sprachen genauer an, die Charakteristika aus (a)-(f) aufweisen, so stellt man in allen Fällen fest, daß ihre Nicht-Konfigurationalität nur scheinbar besteht; eine korrekte Grammatik erfordert auch hier eine konfigurational orientierte Syntax (cf. HORVATH 1981 für Ungarisch; SAITO & HOJI 1983 für das Japanische; JELINEK 1984 für Warlbiri; FANSELOW 1984c für das Deutsche). Allgemein läßt sich dafür argumentieren, daß Konfigurationalität als solche ange­ boren sein muß (FANSELOW 1984c), und daß sich die Eigenschaften (a)—(e) voraus­ sagekräftiger in einer konflgurationalen Syntax behandeln lassen (cf. die o.a. Ar­ beiten). Kritisch ist dabei nur noch die Eigenschaft (f), also die freie Weglassbarkeit von Pronomina in einer Reihe von Sprachen. Sie kann kaum etwas mit der eigentlichen Konfigurationalitätsdiskussion zu tun haben, weil eindeutig konfigurationale Sprachen, wie z.B. Chinesisch, sie besitzen, und andererseits der „beste“ Kandidat für angebliche Nicht-Konfigurationalität, Warlbiri, sie nicht besitzt (JELI­ NEK 1984). Die freie Weglassbarkeit von Pronomina ist durch ein Beispiel wie (18) aus dem Japanischen exemplifizierbar. JELINEK (1984) stellt eine Beziehung zwischen Konstruktionen wie (18) einerseits, und Telegrammstiläußerungen wie (19) an­ dererseits, her: (18) (19a) (19b) (19c) (19d) (19e) daigaku-de yonda Universität-in lesen (Vergangenheit) ich/du/er/sie/es/wir/ihr/sie las(en) es in der Universität Bilanz des Unfalls: 3.000. —Sachschaden Tante erkrankt. Kommen unmöglich! Prüfung bestanden. habe bestanden! bestanden! Sicher ist es nicht so, daß Äußerungen wie (19) von der eigentlichen Satzgrammatik erzeugt werden sollten, obwohl auch hier in (18) wie in (19) selbstverständlich grammatische oder morphologische Restriktionen hineinspielen. Sie sind zwar ak­ zeptabel, andererseits jedoch eindeutig keine grammatischen Sätze oder Konstruk­ tionen des Deutschen. Man kann ohne weiteres erwarten, daß Sprecher in der Lage sind, Äußerungen wie (19) außerhalb ihrer syntaktischen Kompetenz zu interpre­ tieren, weil sie aufgrund allgemeiner Intelligenz und Kontextwissen aus Daten wie (19) Sinn zu machen verstehen. Verständnis und Produktion entstammen also für (19) nicht allein der formal-syntaktischen Kompetenz. Darüberhinaus scheinen die Deutungsprinzipien für Äußerungen wie (19) ganz nahe an denen für Komposita zu liegen (cf. FANSELOW 1981). Auch ist das Fehlen von Funktionswörtem in unterschiedlichem Ausmaß vorgeschrieben (?? die Prüfung bestanden; Operation 108 gelungen - Patient to t vs. ?? er tot) und stets möglich. So ist also eine Beziehung zwischen SR und (19) kaum leugbar. Sprachen können sich nun, wie JELINEK (1984) schreibt, durchaus darin unter­ scheiden, inwieweit nicht-syntaktisch generierte Äußerungen im normalen Diskurs verwendet werden dürfen. Es liegt dann nahe, auch Äußerungen wie (18) eher über ein diskursmäßig lizensiertes Einfließen von SR-Konstruktionsprinzipien zu deuten; auch im Deutschen ist ja der Dialog (20) denkbar: (20) A: Sag mal, was machen eigentlich die Marzipanhasen, die ich dir aus dem Femen Osten mitgebracht habe? B: Schon aufgegessen! Japanisch und Deutsch würden sich diesbezüglich also nicht in ihrer Satzgrammatik unterscheiden (die unzuständig ist), sondern bezüglich ihrer Diskursregeln: im Japa­ nischen ist es eher möglich, SR-basierte Äußerungen in den Diskurs einzubringen. Eine ähnliche Analyse für das Chinesische gibt HUANG (1983). Eine ausschließlich formal-grammatische Interpretation von (18) scheint hingegen unmöglich. Der Vergleich von (18) und (20) motiviert also die Annahme, daß Sprachen in verschieden starkem Maße SR zur Produktion von Äußerungen heranziehen kön­ nen. Dies ist ohnehin sehr plausibel, weil sich Sprachen ja auch in der Produktivität von Wortbildungsprozessen unterscheiden können. Generell ist damit noch eine weitere Frage verbunden: wieso bestehen zwischen Sprachen auch innerhalb der Komposition selbst Unterschiede z.B. in den Stellungsregeln von Kopf und Determinans? Wie sind diese Unterschiede erlernt worden? Ich möchte diese beiden Fra­ gen im anschließenden Kapitel ansprechen. 4 Einige Erweiterungen des Ansatzes Ich habe in 3. versucht, die Hypothese zu beweisen, daß sich Komposition aus Prozessen ergibt, die nicht der grammatischen Module der menschlichen Sprachfähigkeit entspringen, sondern an Gesetzmäßigkeiten orientiert sind, die ein rudi­ mentärer Sprachcode SR umschreibt, welcher dem gemeinsamen Nenner der lin­ guistischen Kapazität beider Hirnhemisphären entspricht. Kommt diese Hypothese nun nicht in Schwierigkeiten mit dem offensichtlichen Faktum, daß dennoch „syn­ taktische“ Gesetzmäßigkeiten bei Komposita festzustellen sind, daß sprachspezifische Regelungen vorzuliegen scheinen? Und wie kann mit dieser Hypothese die Derivation angegangen werden? Wie wird die Hypothese mit der Beobachtung fer­ tig, daß Aphasiker auch ein abweichendes Kompositionsverhalten zeigen können? 4.1 Die Beschreibung zwischensprachlicher Unterschiede Viele Untersuchungen haben gezeigt, daß Komposition und Wortbildung in unterschiedlichem Maße in unterschiedlichen Sprachen realisiert sind. Was im Deutschen erlaubt ist, ist nur eine magere Version der Möglichkeiten, die sich im Sanskrit oder im Japanischen auftun. Andererseits sind deutsche Komposita meist 109 nicht in französische Komposita übersetzbar, weil dieser Sprache nur wenige Kom­ positionstypen zugänglich sind (ROHRER 1967). Und im Kembereich semitischer Sprachen fällt Komposition als Möglichkeit ganz aus (cf. CHOMSKY 1982a). Die beobachtbaren Unterschiede sind zunächst einmal jedoch v. a. quantitativer Art, in dem Sinne, daß kompositionsfreudigere Sprachen stets durch die Addition von Wortbildungstypen entstehen. Anders formuliert: es scheint ein universales In­ ventar von Interpretationsmöglichkeiten zu geben für X + Y-Zusammensetzungen, aus dem die Sprachen jeweils verschieden viel realisieren, wobei obendrein eine Im­ plikationsbeziehung feststellbar ist: jede Sprache, die Determinativkomposita auf­ weist (Deutsch), hat auch wnd-Komposita, aber nicht umgekehrt (Französisch); jede Sprache, die Possessivkomposita produktiv bildet (Sanskrit), weist auch De­ terminativkomposita produktiv auf, etc. Dadurch reduziert sich „das logische Pro­ blem des Kompositionserwerbs44 beträchtlich. Da Komposita oder Strukturen wie (18) der Universalgrammatik zuwiderlaufen, kann man davon ausgehen, daß die Ausgangshypothese des Kindes im kritischen Erwerbsstadium (siehe dazu Kap. S) die ist, daß SR-Strukturen nicht zur Sprache gehören sollten. Je nachdem, in wel­ chem Ausmaß, bezogen auf die o.a. Implikationsskala, nun SR-Elemente im Input des Kindes vorhanden sind, wird es dementsprechende Modifikationen an Fest­ legungen für seine Sprache vornehmen, sodaß der Erwerb von Komposition un­ problematisch erscheint. Ich möchte versuchen, diesen Gedankengang am Beispiel der sog. dvandva-Komposition zu verdeutlichen. Wir finden in Sanskrit Bildungen wie (21), die im Deut­ schen keine Analoga finden (cf. (22)): (21) (22) simhavyährän Löwe-Leopard-Dual („der Löwe und der Leopard“) *Leopardlöwe (in der Deutung von (21)) ’•‘Rhein-Main (in der Deutung: Rhein und Main) *Caesar-Brutus (in der Deutung: Caesar und Brutus) In FANSELOW (1984a) habe ich gezeigt, daß das Verbot von Bildungen wie (22) aus einer Kollision von morphologischem Merkmal und Bedeutung folgt. Im Sy­ stem der konzeptuellen Kompetenz des Menschen scheint es eine Verknüpfungs­ regel zu geben, welche zwei Denotate kopulativ in der in (21) und (22) angedeu­ teten Weise zu verbinden erlaubt, also Rhein-Main eben die Deutung „Rhein und Main44 zuwiese. Rhein-Main oder Leopard-Löwe bezieht sich also in der dvandvaDeutung auf zwei Entitäten. Andererseits befolgt das Deutsche relativ strikt die oben in 1. angesprochene Perkolationsregel: sämtliche Merkmale des zweiten Kom­ positumsbestandteils vererben sich auf die Gesamtkonstruktion. Folglich steht auch Leopard-Löwe im Singular. Singularische Nomina von Typ der Gattungsnamen wie Löwe dürfen sich aber im Deutschen nur auf ein einziges Individuum beziehen. Eine Zusammensetzung wie Leopard-Löwe oder Rhein-Main verletzt diese Be­ schränkung und scheint daher im Deutschen nicht realisierbar2) (vgl. FANSELOW 1984a für weitere Details und Argumente für diese Lösung). 110 Wenn wir nun annehmen, daß aus irgendwelchen Gründen die Perkolation von Merkmalen den unmarkierten Fall abgibt, dann bietet sich folgendes Bild: von den Gesetzmäßigkeiten, die SR anbietet, steht nichts gegen die Zusammensetzung Leopard-Löwe. Auch können die Interpretationsregeln, die das konzeptuelle Sy­ stem der menschlichen Sprachfähigkeit zugrundelegt, Leopard-Löwe eine dvandvaInterpretation geben. Das Ergebnis verletzt freilich wegen seiner singularischen Form bei pluralischer Bedeutung eine Beschränkung, die die Grammatik den Sprachen auferlegt, und kann daher nicht in einem System verwendet werden, dessen Wirken hauptsächlich von diesen grammatischen Prinzipien gesteuert ist. Im Sanskrit liegt nun folgende Regelung vor: abweichend von der Merkmalsperkolationsregel richtet sich der Numerus von (21) nicht nach dem angemessenen Merkmal für vyäghr „Leopard“ , sondern er ist semantisch bestimmt. Referiert das dvandva-Kompositum auf zwei Individuen, so tritt der Dual ein (obwohl keiner der beiden Bestandteile dualisch ist). Referiert es auf mehr Individuen, so tritt Plural bzw. die dazu semantisch äquivalente Form Neutrum Singular (Massen­ terme!) auf. Offensichtlich regelt also das Sanskrit seine Merkmalszuweisung nicht strikt nach den formal-morphologischen Gesetzmäßigkeiten, sondern erlaubt Ab­ weichungen davon, wenn ein entsprechendes Prinzip der Verwendung eines Kompo­ situms sonst entgegenstünde. Sowohl an der morphologischen Form von (21), als auch an der Tatsache des Auftretens von dvandvas allein kann (konnte) ein Sanskrit erwerbendes Kind ablesen, daß in seiner Sprache die Merkmalszuweisung seman­ tisch gesteuert ist. In diesem Fall können dann keine Konflikte zwischen Morpho­ logie und Interpretation auftreten, die sonst in Sprachen wie Deutsch oder Eng­ lisch die Verwendung von dvandvas blockieren. Es läßt sich also durchaus vertre­ ten, daß ein „logisches Problem“ für den Erwerb von Wortbildungsmustern nicht besteht, daß also von daher keine SR-spezifischen angeborenen Prinzipien inner­ halb der UG angenommen werden müßten, die den Ansatz von Kap. 3 in einige Schwierigkeiten brächten. 4.2 Kompositionsstörungen bei Aphasikern In ganz ähnlicher Weise sind auch Abweichungen in der Kompositions­ leistung bei Aphasikern anscheinend erklärbar. Die Differenzen zur nicht-pathologischen Sprache liegen weniger im formalen als im interpretativen Bereich. So wird oft Wörtern wie Ringfinger (Josef BAYER, p.M.) inkorrekterweise eben eine solche kopulative Deutung wie bei den indischen dvandva-Komposita zugewiesen. An sich würde die Theorie von Kap. 3 widerlegt sein, wenn im Kompositionsverhalten von Aphasikern, deren formal-syntaktisches System gestört ist (Broca-Aphasie), auch die Komposition beeinträchtigt ist, die Kap. 3 zufolge mit diesem System nichts zu tun haben soll. Aber hier ist ganz eindeutig aufgrund obiger Beschreibung von (21) und (22) die Sachlage unproblematisch. In der nicht-pathologischen Sprachverwendung ist die Benutzung von dvandva-Bildungen blockiert, weil die von SR und dem konzeptuellen System hergestellten dvandva-Deutungen nur unter 111 Verletzung von formal-grammatischen Prinzipien integriert werden könnten. Fällt wie im Sanskrit durch explizite „Ausnahme“-Regelungen oder durch eine patho­ logische Beeinträchtigung des formal-grammatischen Systems diese Blockade weg, dann steht dem Eingang dieser SR-Bildungen in die Sprache nichts entgegen, was der Datenlage genau entspricht. Beobachtungen aus dem aphasischen Bereich, wie die hier diskutierten, bestätigten also den Ansatz aus Kap. 3 mehr als sie ihn problematisieren. Grundidee der Beschreibung von zwischensprachlicher Variation im uns interessierenden Bereich ist also die Annahme, daß das aus UG und einzel­ sprachlichen Fixierungen resultierende grammatische System in verschieden star­ kem Ausmaß vom Kind modifiziert werden kann, sodaß ein Teil der von SR er­ zeugten Strukturen auch Eingang in das normalerweise von der UG gesteuerte Sprachverhalten finden kann. 4.3 Die Kopfstellung Unter letzterer Annahme lassen sich noch weitere „syntaktische“ Regularitäten von Komposita als Korrolar der Theorie darstellen. Für jede Sprache scheint angegeben werden zu müssen, auf welcher Seite in der binären Verzwei­ gung der Kopf steht, und es ist allgemein zu spezifizieren, daß Kopf und Kompo­ situm, Exozentrika abgerechnet (cf. FANSELOW 1984b), alle wesentlichen syntak­ tischen Merkmale teüen. Im wesentlichen scheinen alle anderen Stellungs- oder Vorkommensbeschränkungen aus einem Zusammenspiel von Morphologie und Se­ mantik ableitbar, wie ich in FANSELOW (1984a) zu begründen versucht habe. Be­ ginnen wir bei der Wegerklärung angeblich syntaktischer Prinzipien in Kompo­ sita zunächst mit der Kopfstellung. Hier mag es zunächst so aussehen, als bestünde ein enger Zusammenhang zur Stellung von Köpfen in der Satzsyntax. Das Deutsche ist beispielsweise syntaktisch eine kopffinale Sprache3), und auch in den Komposita steht der Kopf der Kon­ struktion an zweiter Stelle. Französisch ist andererseits so aufgebaut, daß der Kopf einer Konstruktion sowohl in Syntax wie in Kompositum an der Spitze der Gesamtkonstruktion zu stehen kommt. Ein enger Zusammenhang zwischen diesen Kopffixierungsregularitäten kann aber nicht bestehen. Englisch hat z.B. syntaktisch dieselbe Regelung wie das Französische, aber bei Komposita dieselbe wie das Deutsche. Der Zusammenhang zwischen Komposition und Syntax bezüglich der Kopfstellung ist im Deutschen also ein rein zufälliges Phänomen. Allerdings läßt sich nicht abstreiten, daß diese Stellungsregel existiert. Hierauf aber nun ein Argument aufbauen zu wollen, daß Syntax bei den Komposita mit im Spiel ist, beruhte auf einer Miskonzeption des Begriffes Syntax als rein deskrip­ tiver Terminus. Wenn wir bestimmte Prinzipien einer syntaktischen Komponente der Universal­ grammatik zuschreiben, dann ist der Grund dafür nicht, daß bestimmte stellungs­ relevante Regularitäten vorliegen. Das Vorliegen derselben ist weder eine hinrei­ chende noch eine notwendige Bedingung für die Zurechnung zur Universalgram­ matik und ihrer sprachspezifischen Ausprägung. Die Annahme einer solchen auto­ 112 nomen syntaktischen Komponente rechtfertigt sich vielmehr allein aus dem lo­ gischen Problem des Spracherwerbs. Man kann zeigen (cf. FANSELOW & FELIX 1984), daß bestimmte syntaktische Regularitäten, wie etwa die Gesetze der Frage­ bildung oder der Verteilung der Komplementsätze nicht über allgemeine Intelligenz­ strategien erschlossen werden können. Ein Erwerb der hier einschlägigen Generali­ sierungen wäre nur dann möglich, wenn das Kind über negative Evidenz verfügte (also auch Informationen bekäme, welche Strukturen ungrammatisch sind), und Zugang zu extrem marginalen Konstruktionen hätte, und beides ist nicht der Fall. In der Regel sind die in der Satzbildung zugrundeliegenden Regularitäten und Prin­ zipien auch so komplexer Natur, daß überhaupt nicht ersichtlich ist, wie das Kind aufgrund des relativ kleinen Datenausschnitts, den es während des Spracherwerbs zu hören bekommt, diese Regularitäten und Prinzipien erschließen könnte. Daher nimmt man an, daß das Kind bereits über grammatikspezifische Informationen in seiner Grammatikmodule verfügt, die nicht erlernt zu werden brauchen. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, daß syntaktische Regularitäten im des­ kriptiven Sinne (also Abfolgebeziehungen etc.) auch von der allgemeinen Kogni­ tion bewältigbar sind. Beispielsweise scheint der postpubertäre Zweitsprachenerwerb von einem Versuch bestimmt zu sein, die syntaktischen Gesetzmäßigkeiten einer Sprache auch mit Mitteln der allgemeinen Intelligenz zu bewältigen (cf. FELIX 1982). Aus dieser Hypothese lassen sich eine Reihe von empirischen Vor­ hersagen über den Ablauf und Erfolg des postpubertären Spracherwerbs ableiten, welche mit den Fakten übereinzustimmen scheinen (vgl. FELIX 1982; CLAHSEN & MUYSKEN 1984). Die eigentliche Frage, die man sich also stellen muß, will man entscheiden, ob die stellungmäßigen Regularitäten der Komposita etwas mit Syntax im engeren Sinne zu tun haben, ist nun die, ob diese Regularitäten von der allgemeinen Intelligenz her erkannt werden können oder nicht. Sicher ist diese Stellungsregularität für den Kopf äußerst trivial: der Kopf steht immer entweder rechts oder links. Es ist ziemlich offensichtlich, daß diese Regel dann unproblematischerweise erkannt werden kann, wenn das Kind von der Hy­ pothese ausgeht, daß nur eine der beiden Stellungsregeln richtig sein kann. Kön­ nen wir davon ausgehen, daß solch eine Annahme ein Bestandteil des rudimentären Sprachcodes sein könnte? Selbst für die von Schimpansen erlernten Sprachsysteme können wir genau dies feststellen. TERRACE (1983) berichtet, daß sein Schimpanse für Wörter wie give oder more Stellungsregularitäten aufweist. Diese Stellungsregularitäten sind, wie TERRACE argumentiert, nicht ausschließlich ein auswen­ diges Nachahmen des Modells, sondern implizieren bei den transitiven Verben einen aktiven Lernvorgang des Schimpansen. FOUTS (1983) berichtete ebenso von er­ kennbaren erworbenen Stellungsregularitäten, und lt. PASSINGHAM (1981) gelang es FOUTS, einem Affen beizubringen, A ist in B und B ist in A durch Wortstellung zu unterscheiden. Die Hypothese, daß bestimmte Relationen auch durchgängig mit einer Wortstellung zu verbinden sind, scheint also ein plausibler Bestandteil der Ausstattung für einen einfachen Sprachcode zu sein. Bis zum Beweis des Ge­ 113 genteils können wir davon ausgehen, daß die Wortstellungsregularität bei Kompo­ sita mit der allgemeinen Intelligenz erfaßt werden kann. Es bleibt zu überlegen, weshalb der Kopf in seinen kategorialen Merkmalen mit dem Kompositum übereinstimmen muß, also weshalb überhaupt ein Kopf exis­ tieren muß. Hier ist nun wieder von Belang, daß sich das Kompositum in die Struk­ turen einfugen muß, die von den grammatischen Modulen her erzeugt werden. Dies scheint nur möglich durch den Prozeß der lexikalischen Einsetzung. Folglich muß ein Kompositum X Y unter einer der lexikalischen Kategorien Z° eingesetzt werden. Es sei also X Y von der Kategorie Z°. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kön­ nen wir davon ausgehen, daß X = A und Y = N. Als lexikalische Kategorie steht AN unter einer maximalen Projektion Zmax. Zmax wird in der einen oder anderen Weise regiert, vom verbalen Prädikat, oder vom INFL-Knoten, oder es werden Zmax von INFL Merkmale zugewiesen (falls Zmax = VP). Mit dieser Merkmalszuweisung ist jeweils die Notwendigkeit gegeben, Kasus, Inflektionsmorpheme, Kongruenz­ kasus etc. innerhalb von Zmax zu realisieren. Diese Realisation findet stets auf Z° statt. Jeder der lexikalischen Kategorien sind nun aber für sie spezifische Mor­ pheme zugeordnet: ein Verb kann keinen Kasus tragen, ein Nomen keine Tempo­ ralsuffixe etc. Damit die zugewiesenen Merkmale realisiert werden können, muß also mindestens einer der beiden Bestandteile des Kompositums mit der Katego­ rie des Kompositums Z° übereinstimmen, d.h. in unserem Fall, AN kann nur un­ ter A oder N eingesetzt werden. Nun hat die Sprache noch festzulegen, ob das Inflektionsmorphem zwischen die Bestandteile treten kann, oder aber nicht. Wir haben oben bei unseren Überlegungen zum Kopf der Konstruktionen gesehen, daß jede Sprache nur eine der Optionen wählen wird. Je nachdem, welche Option gewählt wird, ergibt sich über die Notwendigkeit, Inflektionsmorpheme zu akzep­ tieren, eine weitere Einschränkung in der kategorialen Bestimmung. Tritt das In­ flektionsmorphem an den zweiten Bestandteil, dann kann AN nicht anderes sein als N, Q.e.d. 4.4 Komposita und Derivation Als letztes „syntaktisches“ Phänomen im Wortbildungsbereich ist noch der Zusammenhang zwischen Komposita und Derivata zu behandeln. WILLIAMS (1981), HÖHLE (1982) und TOMAN (1983) haben einige Gründe dafür vorgebracht, weshalb man davon ausgehen könnte, daß Komposition und Deriva­ tion zwei Aspekte ein- und desselben Phänomens, einer allgemeinen Wortbildungsregularität, sein sollten. Empirische Analysen, die diese Position voraussetzen, sind nicht immer ganz problemlos (cf. REIS 1983). Vor allem aber würde eine Gleichsetzung von Komposition und Derivation unseren Ansatz in große Schwierig­ keiten bringen. Was die generelle Sprachfahigkeit beider Hemisphären betrifft, so gilt für sie, daß das Phänomen Derivation von ihr nicht erfaßt wird. Patienten mit Tiefendyslexie beispielsweise haben größte Schwierigkeiten bei dem Versuch, Inflektions-wie Derivationsmorpheme korrekt zu lesen. 114 Wenn Komposition ein Ergebnis des Wirkens eines primitiven Sprachcodes ist, dann kann sie mit Derivation nichts zu tun haben. Zunächst einmal steht aber nichts dagegen,gewisse Suffixe als kompositionsähnlich zu betrachten, aber eben nicht alle. Dafür gibt es sogar gute empirische Gründe, die Höhle angesprochen hat: a) Linkstilgung ist bei Komposita möglich, jedoch nur bei bestimmten Suffixen: Herbst- und Frühlingsblumen; käfer- oder spinnenhaft: *Säuf- und Lügner; *Streich- und Schaffung von Planstellen b) Auslautverhärtung tritt an der Morphemgrenze bei Komposita und bei einer Teil­ klasse von Suffixen auf: [vant ur ] [ktnt enlip] aber [geba] nicht [gepa] [kmdifl und nicht [kmtifl. Wir können nun Morpheme wie haft oder ähnlich durchaus als nicht frei zu verwen­ dende, volle Lexeme betrachten. Ähnlich finden wir in der Komposition ja präfixähnliche Vorderglieder wie Pseudo oder Lieblings (cf. FANSELOW 1981, REIS 1983) und nicht-freie Lexeme wie Elektro oder Anthro. Anders als Bildungen auf -er oder - ung fügten sich also Wörter wie laienhaft, Elektroauto oder Pseudokompositum mit der Regel der Komposition zusammen. Das einzig verbleibende Argument, das man noch dafür anflihren könnte, daß auch Suffixe wie er der Komposition ähnlich sind, liegt noch in der Beobachtung, daß wie bei der Komposition im Deutschen das zweite Glied der Derivation, nämlich er selbst angibt, von welcher Kategorie das Derivat ist. Nun ist dies aber, wie LIE­ BER (1981) beobachtete, gar keine korrekte Generalisierung über das Deutsche. Bei den Affigierungen auf entf ver oder be gibt der erste Bestandteil die Kategorie der Gesamtbildung an, nämlich V (cf. entlauben, bekugeln, verfilmen). Anders als Höhle meint, scheint die Gesetzmäßigkeit eher die zu sein, daß stets das Affix die Kategorie der Ableitung bestimmt, egal wo es stehen mag. TOMAN (1983) beobachtete weiter, daß anders als bei Komposita sich bei gewis­ sen Ableitungssuffixen wie er oder ung die semantische Valenz des Vordergliedbestandteils auf die gesamte Konstruktion überträgt (cf. Rächer der Enterbten, Ver­ sorgung der Beerbten vs. *Suchhubschraüber des Verletzten, *Wartezimmer auf den Arzt). Daraus kann gefolgert werden, daß Derivationssuffixe wie er und ung als Funktion wesentlich nur die Anzeige des Kategorienwechsels besitzen, aber keinen eigenständigen semantischen Beitrag (wie ein Kompositionsglied) leisten (vgl. da­ zu auch FANSELOW 1984b).4) Mithin entspricht der deskriptiven Klasse „Wortbildung“ kein einheitlicher theore­ tischer Bereich. Komposition und ein Teilbereich der Suffigierung gehören dem rudimentären Sprachcode an, wohingegen Suffigierungen auf er, ung etc. sich aus der syntaktisch-grammatischen Komponente der Universalgrammatik erklären.*) Auf den Zusammenhang von Derivation und SR werde ich im anschließenden Ka­ pitel noch einmal zurückkommen. 5 Onto- und phylogenetische Aspekte des Ursprungs von SR Neurolinguistische Untersuchungen zu Aphasien und Dyslexien haben gezeigt, daß neben der formal-grammatischen Kompetenz der Mensch über eine rudimentäre Sprachfähigkeit verfugt, die durch das Fehlen von syntaktischer Or­ ganisation, das Fehlen von Funktionsmorphemen, eine semantische Fundierung, ein Übergewicht referentiell nominaler Elemente gekennzeichnet ist. Wortbildungs­ strukturen, insbesondere im Bereich der Komposition, und „nicht-konfigurationale“ Phänomene wie die freie Weglassbarkeit von Objektspronomina, TelegrammStiläußerungen deuten darauf hin, daß dieser einfache Code SR auch im Sprachverhalten von Erwachsenen eine Rolle spielt. Seine Verwendung ist dabei einge­ schränkt durch die Notwendigkeit, die SR-generierten Strukturen in das System der UG zu integrieren, wobei Sprachen dies in unterschiedlichem Ausmaß lizensieren. Wo kommt nun die Kompetenz für SR her? Wie wird sie vom Kind erworben? Be­ trachtet man den Ablauf des kindlichen Spracherwerbs, dann gewinnt man den Eindruck, als würden sehr frühe Stadien des Spracherwerbs ausschließlich von SR gesteuert. BLOOM (1970) und BROWN (1973) haben intensiv Gesetzmäßigkeiten in derZweiwortphase des Spracherwerbs untersucht. Beide konnten keinerlei syntaktische Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Menge der Zweiwortsequenzen finden, insbe­ sondere aber die Hypothese der Existenz einer pivot-Grammatik widerlegen. Für Kombinationen des Typs N+N lassen sich vielmehr semantische Regularitäten fest­ stellen. Eine Klassifikation dieser Äußerungen in Kategorien wie „Agens + Objekt“ oder „Agens + Lokation“ ist möglich. Über diese lassen sich einerseits Stellungsregularitäten und andererseits auch Kombinationsbeschränkungen formulieren. Neben syntaktischer Strukturierung fehlen Funktionswörter im strengen Sinne. Ein Übergewicht für nominale Strukturen ist erkennbar. Die Interpretation der Äußerungen hängt stark von einem Erschliessungsprozeß ab, der auf kontextuelles oder allgemeines Wissen über Relationen zwischen Dingen zurückgreifen muß. In­ sofern ist das frühe Zweiwortstadium streng parallel zu SR und den Gesetzmäßig­ keiten bei der Komposition. Insbesondere lassen sich eine große Menge von Paralle­ len zwischen den Klassifikationen von BLOOM und BROWN für das Zweiwortkorpus einerseits und den in den siebziger Jahren vorgelegten Klassifikationen für Kompo­ sita andererseits (etwa LEES 1970; ROHRER 1967; THIEL 1973) feststellen. Neben den „Inhaltswörtern“ lassen sich im Zweiwortstadium eine Menge von „se­ mantischen“ Relatoren wie „this“ oder „mommy“ finden, welche von BLOOM und BROWN als pivots bezeichnet wurden. Auch sie haben eine Parallele im Bereich der Wortzusammensetzung. Elemente wie Pseudo oder Nicht lassen sich am besten als semantische Funktoren oder Relatoren behandeln (FANSELOW 1981; REIS 1983). Nicht erscheint daher im Deutschen polyfunktional: einerseits als Funk­ tionswort in von der UG konstruierten Satzverbänden, andererseits als semantischer Funktor in Wortbildungsstrukturen. Das Auftreten von Bildungen wie Nicht-Wähler widerlegt also kaum die Hypothese des Fehlens von Funktionswörtem bei Kompo­ sition und in SR. Und wieder sind Komposition und Zweiwortstadium einander 116 so nahe, daß davon ausgegangen werden muß, beide würden vom selben kognitiven Modul gesteuert. Freilich, ein Unterschied zwischen Komposita und Zweiwortäußerungen ist nicht zu leugnen. N+N ist in der Erwachsenensprache (abgesehen von Äußerungen des Typs von (21)) stets ein nominales Lexem, in der Zweiwortphase aber keinesfalls nominal. Syntaktisch hat es „Satzcharakter“ und semantisch wird eine Proposi­ tion ausgedrückt, keine Eigenschaft wie bei einer Zusammensetzung ä la Nagel­ fabrik. Gerade dieser Unterschied entspricht aber einer empirischen Vorhersage, die aus dem bislang Gesagten sofort deduzierbar ist. N+N-Strukturen können im Erwachsenensystem keinen „Satzcharakter“ besitzen, weil, wie gesagt, die Erfordernis besteht, die SR-basierten Äußerungen in das Sy­ stem von Konstruktionen zu integrieren, das die UG bereitstellt. Wir haben in Kap. 4 bereits gesehen, daß dies nur möglich ist, wenn N+N selbst nominal ist. Für die Kindersprache während der frühen Zweiwortphase ist die Hypothese aber gerade, daß ausschließlich SR die Äußerungen steuert. Der Zwang, N+N nomi­ nal zu verwenden, besteht also nicht. N+N kann unter „S“ gehängt werden, wenn dieses Knotenetikett in einer nicht-syntaktischen Phase überhaupt gerechtfertigt werden kann. Betrachten wir nun eine Bildung wie Brandt-Biograph. Sie muß in der Erwachse­ nensprache eine Eigenschaft ausdrücken, nämlich die Eigenschaft, ein Biograph von Willy Brandt zu sein. Wie ich in FANSELOW (1984a) gezeigt habe, ist dies zunächst von den Interpretationsregeln, die das konzeptuelle System bereitstellt, nicht er­ zwungen. Unter den Interpretationsregeln befindet sich z.B. die Funktionalappli­ kation, d.h. die Operation, eine Funktion (Eigenschaft) wie .Biograph* auf ein an­ gemessenes Argument anzuwenden. In der Technik der Montague-Grammatik wird eine Eigenschaft wie »Biograph* als die Funktion f repräsentiert, die Indivi­ duen in Wahrheitswerte abbildet, so daß f (x) wahr ist, dann und nur dann, wenn x ein Biograph ist. Brandt denotiert ein Individuum, nämlich Willy Brandt, welches ein mögliches Argument ist für die von Biograph denotierte Funktion. Also kann man Brandt-Biograph über Funktionalapplikation deuten, und erhält als Ergebnis einen Wahrheitswert, oder, arbeitet man intensional, die Proposition, daß Brandt ein Biograph ist, und das bedeutet Brandt-Biograph in der Erwachsenensprache sicher nicht. Aber man muß mit dieser Konklusion vorsichtig sein, liest man in der Zeitung eine Überschrift wie SCHILY KANZLER!, dann ist gerade die propositionale Deutung angemessen. Wie wir schon bei den dvandva-Bildungen in Kap. 4 gesehen haben, und wie ich in FANSELOW (1984a) ausführlicher begründet habe, sind die Deutungen von Zusammensetzungen dadurch restringiert, daß grammatische Korrelationen zwi­ schen Syntax und Semantik etabliert sind. Ein Nomen kann nur eine ein- oder zweistellige Eigenschaft denotieren (Mann, Bruder), Verben nur null- bis drei­ stellige Eigenschaften (regnen, schlafen, lieben, geben), etc. Eine Proposition oder ein Wahrheitswert kann nie eine mögliche Nomen-Bedeutung sein, und daher kann Brandt-Biograph auch nicht mit der Interpretation verwendet werden, die sich an 117 sich aus den allgemeinen Deutungsprinzipien des konzeptuellen Systems der UG ergeben kann. Für die korrekte Deutung dieses Wortes im Erwachsenensystem sorgt ein Zusammenspiel anderer Interpretationsprinzipien (cf. FANSELOW 1984a, b). In jedem Fall ergibt sich also das Verbot eines propositionalen Denotats für N+N- oder ähnliche Bildungen aus deren nominalen Charakter, der wiederum, wie gezeigt, aus dem Hereinspielen der UG folgt. Wo dies nicht vorliegt, wo also N+N nicht nominal sein muß, existiert auch kein Verbot eines propositionalen Denotats für mommy sock oder Papa Auto, und diese Vorhersage für ein nur von SR regiertes System trifft im frühen Zweiwortstadium zu. Das Kind beginnt seinen Spracherwerb also vermutlich mit dem System SR, und es verliert im Verlauf der Sprachentwicklung, wie Komposition zeigt, nicht die Fähig­ keit, mit SR Äußerungen zu produzieren. Für die weitere sprachliche Reifung sind nun zwei Systeme logisch denkbar. Einerseits könnte SR immer mehr differen­ ziert werden, also auch die Erwachsenengrammatik semantisch fundiert sein, oder irgendwann könnte sich UG „einschalten“ und mehr und mehr Kontrolle über die Sprachproduktion gewinnen. Da wir wissen, daß natürliche Sprachen keinesfalls semantisch basiert sind, ist die erstere Alternative sofort auszuschließen. FELIX (1984) hat ein Modell des Reifeplans für Sprache vorgelegt, das die hier auf­ gestellte Hypothese unterstützt. Er geht davon aus, daß ein Teil der Stadienüber­ gänge im Spracherwerb nicht durch eine neue Perzeption der Daten oder ein gestei­ gertes Kommunikationsbedürfnis verursacht sind; denn alle Versuche, über solche Konzepte Stadienübergänge zu erklären, sind bislang letztendlich gescheitert. Stattdessen nimmt FELIX an, daß die Umorganisation der kindlichen Grammatik bei ge­ wissen Stadienübergängen dadurch bedingt ist, daß beschränkende Prinzipien der Universalgrammatik zu einem Zeitpunkt tj ihr Wirken entfalten. Vor tj sind die kindlichen Äußerungen durch eine Regel R gesteuert. Zu ti beginnt das UG-Prinzip Pj zu wirken. R mag nun einerseits Pj verletzen, so daß das Kind gezwungen ist, R durch eine andere Regel zu ersetzen, oder Pj mag dem Kind neue Begrifflichkeiten zur Verfügung stellen, die es ihm ermöglichen, eine Regelformulierung S aufzu­ stellen, die mit den Input-Daten nun eher übereinstimmt. FELIX (1984) kann konkret nachweisen, daß bestimmte Stadienübergänge im Bereich der Negation oder der Wortstellung durch die Annahme des Einsetzens eines Prinzips der Uni­ versalgrammatik wie sie von CHOMSKY (1981) vorgeschlagen wurde, erklärbar sind. Die Grundidee ist also folgende: die Prinzipien Pi ...Pj der UG wirken nicht von Ge­ burt an sofort zusammen auf das Sprachverhalten, sondern reifen nacheinander heran. Nun sind zwischen den UG-Prinzipien logische Abhängigkeiten feststellbar. Zwar besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen z.B. der Bindungs­ theorie und der Kontrolltheorie, doch setzt die Bindungstheorie etwa die Rek­ tionstheorie voraus, da die Bindungsgesetzmäßigkeiten den Begriff der Rektion in­ volvieren. Alle UG-Prinzipien beruhen letztendlich auf dem X-bar-Schema, weil die UG-Theorien sämtlich konfigurational, also über Strukturbäume, formuliert sind. 118 Nun zeigt aber FELIX (1984) gerade, daß beim frühen Zweiwortstadium das X-barSchema noch nicht wirken kann. Fehlt aber das X-bar-Schema, dann auch die ge­ samte UG. Also muß ein anderes System die Äußerungen zu diesem Zeitpunkt steuern, eben SR, wie ich vermute. Im Wortbildungserwerb können wir weitere Stützung für diesen Ansatz erken­ nen. Wir haben oben erkannt, daß Wortbildung, insbesondere Derivation. nur einen deskriptiven Terminus abgibt. Manche Derivata wie die Ableitung auf haft, scheinen SR-gesteuert, andere, wie die er- Suffigierung, sind UG-abhängig. Wie ist damit aber nun zu vereinbaren, daß auch er-Ableitung in frühesten Spracherwerbsstadien auftritt? Einzig vorstellbar ist, daß Kinder zunächst er als normales Relatormorphem im Sinne von SR interpretieren, und erst später er-Affigierung als syntaktischen Prozeß reinterpretieren. Daraus leitet sich nun eine empirische Vorhersage ab. Bezüglich Produktionsbe­ schränkungen in der Erwachsenengrammatik, die syntaktisch-formal bedingt sind, sollten Kinder übergenerieren. Bezüglich Produktionsbeschränkungen, die seman­ tisch-konzeptueller Natur sind, also nicht vom Heranreifen der UG abhängen, sollten Kinder ceteris paribus keine Fehler machen. Wir befinden uns hier in der günstigen Situation, daß die Möglichkeiten der erDerivation sehr gut aufgearbeitet sind (KOCH 1976; BURZIO 1981; OH 1984). Aus inhaltlichen Gründen ist eine er-Ableitung bei Stativen Prädikaten in der Regel nicht möglich, wir haben keine Wörter wie *Lieber, *Wisser (vgl. OH 1984 für eine Wegerklärung von Ausnahmen wie Amerikahasser oder Pilzkenner). Andererseits sind von den sogenannten ergativen Verben keine er-Ableitungen möglich. BURZIO (1981) hatte in Anschluß an Untersuchungen von Perlmutter entdeckt, daß inner­ halb der Klasse nicht-transitiver Verben eine wichtige Zweiteilung besteht. Das Subjekt intransitiver Verben wie telefonieren, schlafen oder laufen, verhält sich in allen Aspekten wie das Subjekt eines transitiven Verbs; das Subjekt ergativer Ver­ ben wie ankommen oder aufwachen in einer Reihe von Aspekten hingegen wie ein Objekt. BURZIO setzt als Analyse an, daß das Oberflächensubjekt von ankommen z.B. ein Tiefenobjekt ist, welches vermöge der Regel „Bewege NP“ auf Grund einer Reihe von wohlmotivierten Prinzipien in die Oberflächensubjektsposition gebracht werden muß. Unter dieser Annahme lassen sich divergierende Eigenschaften wie die Frage der Perfektbildung auf haben oder sein, die Möglichkeit unpersönlicher Passivierung, Reflexivierungsfakten in Acl-Konstruktionen, die Möglichkeit der Dativergänzung, Extraktionseigenschaften, Gegebenheiten bei der Wortstellung etc. erklären (cf. BURZIO 1981; GREWENDORF 1983; FANSELOW 1984c). Ob ein Verb nun ergativ ist oder nicht, ist syntaktisch, nicht semantisch geregelt. Die For­ mulierung der Eigenschaft „ergativ“ setzt Konzepte der UG voraus. Das Ergativitätskonzept kann dem Kind in den frühen Phasen seiner er-Derivation also nicht zugänglich sein. Somit leitet sich die empirische Vorhersage ab, daß Kinder bezüglich der Ergativitätsbeschränkung Fehler machen sollten, aber nicht bezüglich der semantischen Restriktion auf nicht-stative Verben. Genau dies ist aber auch der Fall. Empirische Untersuchungen von Brigitte Asbach-Schnitker 119 (p.M.) zeigen, daß Kinder durchaus Wörter wie A nkom m er produzieren, aber nie­ mals solche wie Lieber. Also ist das frühe Stadium der er-Bildungen nur von SR gesteuert. Wie sollten Kinder jemals die Hypothese, daß Ankom m er ungramma­ tisch ist, bilden können, wenn sie dabei allein auf ihren Input angewiesen wären? Die Ungrammatikalität solcher Wörter stellt ja ein negatives Datum dar, zu dem Kinder, wie gesagt, keinen Zugang besitzen. Man muß also annehmen, daß etwas in der kognitiven Entwicklung des Kindes selbst ihm nahelegt, daß ergative Verben keine er-Derivata erlauben, was mit dem Heranreifen entsprechender syntaktischer Konzepte wie Tiefensubjekt und einer Beschränkung agentivischer Nominalisierungen auf eben diese Weise erklärt wäre. Warum sollte es aber nun so sein, daß das Kind seinen Spracherwerb nicht mit der „eigentlichen“ Grammatik beginnt, also praktisch einen „false Start“ begeht, und mit der sehr simplen Sprachfähigkeit SR zu kommunizieren beginnt? Sicher­ lich, weil alternative mentale Strukturen noch nicht herangereift sind. Aber warum ist dies so? Die Frage scheint beantwortbar, wenn wir einen Blick auf das linguisti­ sche Verhalten unserer nähesten Primatenverwandten, der Schimpansen lenken. Sicherlich kann man nicht in einfacher Weise eine Beziehung konstruieren zwi­ schen kindlichem Spracherwerb, dem Endergebnis des menschlichen Spracherwerbs auf der einen Seite, und den linguistischen Produkten von Affen. Dies wird schon dadurch offenbar, daß Affen in mühevoller Weise und mit allen möglichen Tricks Wort für Wort eingetrichtert werden muß, wohingegen der menschliche Spracherwerb ganz mühelos abläuft. Kinder können, wenn sie Sprache in ihrer Umgebung ausgesetzt sind, gar nicht verhindern, daß sie Sprache erlernen, - hier scheint ein kausaler Prozeß vorzuliegen — während Menschenaffen ihr ganzes Le­ ben von Zeichen gebenden Menschen umgeben sein können, ohne auch nur ein einziges Zeichen selbst aufzugreifen. Relativ überraschend ist aber dann doch, sieht man von den unterschiedlichen Ge­ gebenheiten beim Verlauf des Spracherwerbs bei Mensch und Schimpanse ab, daß die Systeme, die Schimpansen letztendlich erwerben, eine große formale Ähnlichkeit zu den sehr frühen, nichtsyntaktischen Erwerbsstadien von Kindern haben, wie etwa TERRACE (1983) zeigt. Der Unterschied liegt nicht im System, das sich entwickelt, sondern in der Frage der Schnelligkeit und des Aufwandes, mit dem dieses System erreicht wird. Nach FODOR (1980) können nun aber nur solche Begriffe und mentale Strukturen erworben werden, die bereits genetisch vorspezi­ fiziert sind. Man muß also sowohl beim Menschen wie beim Menschenaffen anneh­ men, daß eine genetische Disposition besteht, genau die Strukturen zu erwerben, die den ersten Zweiwortphasengegebenheiten entsprechen. Wenn man so will, dann ist der Schimpanse also mehr oder minder auf dem Weg, die mentale Repräsentation für ein Symbolisierungssystem von Denkinhalten zu besitzen. Er scheint, wie PREMACK (1983) sich ausdrückt, virtuell über einen „code zu verfügen. Ganz interessant ist zu sehen, welche Fähigkeiten bei den Affen sich verbessern, denen man versucht hat, Sprache beizubringen. Was die Leistungsfähigkeit im Bereich des Beurteilens von Ähnlichkeiten betrifft, oder 120 das natürliche Schließen, so sind die sprachtrainierten Affen nicht dümmer oder klüger als die nicht sprachtrainierten. Erstere zeigen aber ein wesentlich gestei­ gertes Leistungsvermögen, was Aufgaben betrifft, die Proportionen, Kausalitäten und Analogien betreffen. Ein mentaler Code scheint bei der Lösung von Proble­ men aus diesem Bereich eine gewichtige Rolle zu spielen. Der evolutionäre Druck auf die Entwicklung eines solchen Codes liegt also weniger in einer Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit zwischen den Tieren einer Spezies, sondern in gesteigerter Problemlösungsfähigkeit und damit der gesteigerten Möglichkeit, sich der Umwelt anzupassen und diese zu manipulieren. Was beim Schimpan­ sen natürlicherweise fehlt, mag eben die Fähigkeit sein, diesen mentalen Code für Sachverhalte auch zur Kommunikation nach außen hin zu verwenden, und ohne Stimulus (anders als beim Menschen; cf. GOLDIN-MEADOW 1982) zu entwickeln. Wie bereits gesagt, geht die Nähe des Affencodes zu SR-Systemen sogar soweit, daß primitive Korrelationen von Wortstellung und Bedeutung dem Affen zugänglich sind (PASSINGHAM 1981), daß wie in der Zweiwortphase Stellungsgesetze für Re­ latoren statistisch nachweisbar sind, daß Analysekategorien aus der Zweiwort­ phase auf Affencodes übertragbar sind, daß Entwicklungsschritte ähnlich sind (MYLES 1983), daß eben eine Scheidung zwischen Relator und Inhaltswort durch­ führbar scheint. Um es noch einmal ganz klar zu sagen: dieser mentale Code - SR - ist kein seman­ tisches System, sondern ein System von Zeichen, die Sachverhalte, Objekte oder Dinge repräsentieren. Über diesen Code können dann beim Denken, beim Lösen von Problemen, entsprechende Manipulationen vorgenommen werden. Was nun die zentrale menschliche Sprachfähigkeit betrifft, wie sie sich in der grammatischen Module realisiert, so können wir analog annehmen, daß ihre Ent­ wicklung ebenso eher bedingt war durch einen evolutionären Druck auf Problem­ lösungsfähigkeit als auf Kommunikation. Der Code, der unserer Sprache entspricht, ist in jedem Fall eindeutiger und informationsreicher als der, der dem Affencode entspricht. Es sind — über Relativsätze und andere komplexe Einbettungen —we­ sentlich reichere Strukturen abbildbar und damit der Manipulation beim Denken zugänglich. Die generelle rudimentäre Sprachfähigkeit beider Hemisphären ohne grammatische Struktur mag insofern eine evolutionäre Sackgasse sein, als sie die Lösung bestimmter Probleme prinzipiell nicht zuläßt. So kann ein evolutionärer Druck dahingehend gewirkt haben, einen neuen Weg einzuschlagen, eben den der Entwicklung des beim Menschen derzeit vorhandenen grammatischen Systems. Da für solch eine optimierte Repräsentation syntaktische Organisationsprinzipien erforderlich sind, ist die Erwartung auch nicht ganz abwegig, daß die Fortentwick­ lung sich auf ein Himareal bezog, das sequentielle Aufgaben auszufuhren hatte. Wie anatomische Studien (cf. PASSINGHAM 1981) nun zeigen, liegt beim Broca-Zentrum, (bzw. dessen Analogon in Primatenhimen) bei Affen keinerlei Steue­ rungsfunktion für kommunikatives Verhalten vor, wohl aber die Steuerung sequen­ tieller Motorik. Dabei ist wohl anzumerken, daß das menschliche Broca-Zentrum diese Funktion vermutlich nicht mehr besitzt, sondern auf Sprache konzentriert ist. 121 Evolutionäre Sackgassen wie SR finden sich im Tierreich nicht selten. Vögel sind beispielsweise intelligenter als Reptilien, von denen sie abstammen. Aber die Struk­ tur ihres Hirns unterscheidet sich nicht wesentlich von Reptilienhimen. Vogelhime sind sozusagen das Optimum, das mit einer Reptilienhirnstruktur erreicht werden kann. Diese Struktur selbst beizubehalten und zu versuchen, sie zu optimieren, ist eine evolutionäre Sackgasse, als bestimmte mentale Leistungen nun prinzipiell nicht aufgebaut werden können. Andererseits war die strukturelle Erweiterung bei den Säugern, wie der Mensch zeigt, ein voller Erfolg (bezüglich rein intellektueller Leistungsfähigkeit). Warum aber beginnen nun Kinder bei ihrem Spracherwerb mit einem Code, der letztendlich eine solche Sackgasse darstellt? Ein Wesen, das über eine menschliche Sprache verfügt, ist auf solche primitiven Codes ja nicht angewiesen, höchstens dann, wenn aus pathologischen Gründen die zentrale Sprachfähigkeit selbst aus­ fällt. Aber man kann sich kaum vorstellen, daß Pathologien wie Aphasien einen entscheidenden evolutionären Druck für solche primitiven Codes darstellen kön­ nen. Die Suche nach Gründen für die Beibehaltung des primitiven Codes ist aber selbst schon fehlgeleitet. In das genetische Programm eines Tieres kommen Eigen­ schaften nur dann, wenn sie einen Selektionsvorteil darstellen. Aus dem genetischen Programm werden nur solche Eigenschaften heraustreten, deren Fehlen eben­ falls einen Selektionsvorteil darstellte. Der menschliche Blinddarm ist ein gutes Beispiel für genetisch fixierte Eigenschaften, die einmal funktional waren, diese Funktion aber in der Evolutionsgeschichte verloren haben, ohne von größerem Nachteil für den Menschen zu sein. Insofern ist es nicht überraschend, daß auch der primitive Primatencode nicht aus dem genetischen Programm des Menschen verschwunden ist. Unter dem Schlagwort „Ontogenie rekapituliert Phylogenie“ faßt man weiter die Beobachtung zusammen, daß in der Entwicklung einer Juvenilform hin zum Er­ wachsenenstadium teilweise die Schritte wiederholt werden, die in der Evolutions­ geschichte zu den Eigenschaften der Adultform geführt haben. GOULD (1978) gibt einige gute Beispiele hierfür, allgemein bekannt ist etwa das Faktum, daß mensch­ liche Embryos in gewissen Stadien Kiemen ausbilden. Wenn nun die mentale Entwicklung eines Menschen ebenfalls nichts anderes ist als ein Reifungsprozeß von Himstrukturen, dann ist zu erwarten, daß sich in der Ent­ wicklung des Individuums ebenfalls im mentalen Bereich e v o l u t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Stadien wiederholen. Ein Kind, das Sprache erlernt, wiederholt unter dieser Sicht­ weise eben die Evolution der Sprache. Das frühe Zweiwortstadium, ebenso wie die von Komposition herangezogenen Prinzipien, sind also vielleicht ein mehr oder minder getreues Abbild des sprachähnlichen Systems, das irgendeiner unser Vor­ fahren in der Homirudenlinie einmal gesprochen haben mag. 122 Anmerkungen *) Einer der anonymen Rezensenten dieses Artiekls hat mich in diesem Zusammenhang auf franz. Beispiele wie Arc-en-ciel, contre-poison oder Rendez-vous aufmerksam gemacht; Viele dieser Beispiele erscheinen eher unproblematisch, weil, wie unten im Text aufgeflihrt, eine ganze Reihe von Präpositionen beispielsweise auch eine Inhaltswortbedeutung zu haben scheinen, etwa gegen, so auch dt. Gegengift. Für de etwa wäre zu fragen, inwie­ weit - ähnlich wie bei der deutschen Voidergliedform in Komposita bezüglich der Be­ ziehung zum Genitiv - ein rein historischer Zusammenhang zur dulde la-Konstruktion be­ steht. Es ist aber, (cf. MOODY 1980), nicht ganz einfach, entsprechende Grenzlinien zu ziehen. Ganz allgemein aber, (cf. JENSEN 1980), interagieren im Französischen Satzsyn­ tax und Wortbildung in wesentlich stärkerem Maße als im Deutschen, wenn man über N+N-Zusammensetzungen in der Analyse hinausgeht. Wie unten noch eingehender aus­ geführt, verbietet mein Vorschlag eine solche Interaktion keineswegs. Etwa erscheint mir die er-Derivation im Deutschen u.a. syntaktisch gesteuert, und weniger vom System SR des frühen Spracherwerbs. Wenn mit de oder a aber nun Funktionswortelemente in (des­ kriptiv gesehen) Wortbildungsstrukturen Eingang finden, impliziert dies nach den Vorher­ sagen meiner Theorie, daß Satzsyntax im engeren Sinne, die Universalgrammatik also, in den fraglichen Prozeß eingreift. Dann sind auch andere satzsyntaktische Phänomene wie Pronominalisierung etc. zu erwarten, und nach JENSEN (1980) scheint gerade dies der Fall zu sein. Mein Ansatz besagt nicht, daß Wortbildung als solche immer von dem primi­ tiven semantisch fundierten System gesteuert werden muß, Wortbildung ist ein deskrip­ tiver Terminus, der von ganz verschiedenen Subsystemen der Sprachfähigkeit regierte Elemente umfaßt. 2) Kein explizites Verbot für Dvandva-Bildungen kann allerdings für das Deutsche angesetzt werden, weil sie beispielsweise als Vorderglieder von Komposita auftreten können, cf. Rhein-Main-Donau-Kanal. Ganz analog ist das Veibot „keine Verknüpfung von quantifi­ zierendem Adjektiv und Nomen“ nur gültig für als selbständiges Wort verwendete Komposita (cf. *Allpartei)f aber nicht im Determinansbereich, vg. Allparteienregierung. FANSELOW (1984a) gibt eine eingehende Behandlung des Problems im Rahmen des hier vorgestellten Theorieansatzes. 3) Es mag so sein, daß eher Kategorie für Kategorie die Standardrektionsrichtung festgelegt wird (links für A und V im Deutschen, und vielleicht rechts für P). Auch unter diesen Umständen läßt sich ein Zusammenhang zwischen Kompositions- und Syntaxstellung nicht allgemein formulieren. 4) Bei Derivata wie Lastwagenfahrer mag man als semantische Erweiterung einen habituellen Aspekt erkennen wollen. Dieselbe Aspekterweiterung tritt jedoch auch bei der Verwen­ dung von fahrern in unabgeleiteter Form auf, cf. Früher war Karl Buchhalter, heute fährt er Lastwagen. Auf jeden Fall addiert er auch nicht das Merkmal ( + maskulin ), cf. Kalverkämper 1980. Man beachte weiter, daß den nomina instrumenti wie Geschirrspüler Sätze wie die Maschine spült Geschirr entsprechen, d.h. der Wechsel in den thematischen Rollen von Agens zu Instrument ist beim (unabgeleiteten) Verb selbst anzusetzen. Insofern ad­ diert er auch kein Merkmal [ + belebt ). Es gilt dann aber allgemein, daß y ein (VX) -er ist genau dann, wenn y die durch X kodierte Eigenschaft hat. 5) Dabei ist ,Universalgrammatik4 nicht im technischen Sinne als das System von CHOMSKY zu verstehen, sondern als Bezeichnung für die in der linken Hemisphäre angesiedelte gram­ matikspezifische Fähigkeit. Die oben angeführten Daten zur Tiefendyslexie, oder die unten besprochenen Fakten bei ergativer Basis zeigen klar, daß er außerhalb des grammatischen Systems nicht erklärbar ist. 123 Literatur ARBIB. M. & CAPLAN, D. & MARSHALL, J. (Hrsg.) (1982) Neural models of language processes. New York. BÄUERLE, R. (1979) Temporale Deixis, temporale Frage. Tübingen. BAYER, J. & de BLESER, R. (1984) Kasus bei Agrammatismus. Vortrag, 6. Tagung von GGS in Wien 1984. BLOOM, L. (1970) Language development: form and function in emerging grammars. Cam­ bridge, Mass. BIERWISCH, M. & HEIDOLPH, K.-E. (Hrsg.) (1970) Progress in linguistics. Den Haag. BRA1NE, M. (1971) On two types of models of the internalization of grammars. In: Slobin (1971). BREKLE, H. (1970) Generative Satzsemantik und transformationelle Syntax im System der englischen Nominalkomposition. München. BREKLE, H. (1973) Zur Stellung der Wortbildung in der Grammatik. LAUT Trier. BRESNAN, J. (Hrsg.) (1982) The mental representation of grammatical relations. Cambridge, Mass. BROWN, R. (1973) A first language: the early stage. Cambridge, Mass. BURZIO, L. (1981) Intransitive verbs and Italian auxiliaries. PhD-Diss. MIT. CARAMAZZA, A. & BERNDT, R. (1978) Semantic and syntactic processes in aphasia: a review of the literature. Psychological Bulletin 85, 898—918. CARLSON, G. (1983) Marking constituents. In: Heny/Richards 1983: 69-98. CHOMSKY, N. (1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass. CHOMSKY, N. (1972) Studies on semantics in generative grammar. Den Haag. CHOMSKY, N. (1977) Essays on form and interpretation. New York. CHOMSKY, N. (1980a) Rules and representations. New York. CHOMSKY, N. (1980b) Rules and representations. The Brain <fc Behavioural Sciences 4:80. CHOMSKY, N. (1981) Lectures on government and binding. Dordrecht. CHOMSKY, N. (1982) Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge, Mass. CHOMSKY, N. (1982a) The generative enterprise. Dordrecht. CLAHSEN, H. & MUYSKEN, P. (1984) The accessibility of ‘move a* and the acquisition of German word order by children and adults. Vortrag, GLOW-meeting 1984, Kopen­ hagen. COLTHART, M. (1979) Deep dyslexia: a right hemisphere hypothesis. In: Coltheart et al. 326-380. COLTHEART, M. & PATTERSON, K. & MARSHALL, J. (Hrsg.) (1979) Deep dyslexia. London. CURTISS, S. (1977) Genie. New York. DOWNING, P. (1977) On the creation and use of English compound nouns. Language 53, 810-842. DOWTY, D. (1979) Word meaning and Montague grammar. Dordrecht. FANSELOW, G. (1981) Zur Syntax und Semantik der Nominalkomposition. Tübingen. F ANSELOW, G. (1984a) What is a possible complex word? Erscheint in: Toman 1984. FANSELOW, G. (1984b) Aspekte einer modularen Semantik. (Arbeitstitel) Ms, Passau. FANSELOW, G. (1984c) Deutsche Verbalprojektionen und die Frage der U n iv ersa lität konfigurationaler Syntaxen. Diss. Passau. 124 FANSELOW, G. & FELIX, S. (1984) Noam Chomsky: Grammatik als System kognitiver Re­ präsentationen. Erscheint in: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. FELIX, S. (1982) Competing cognitive systems in language acquisition. Ms. Passau. FELIX, S. (1984) Das Heranreifen der Universalgrammatik im Spracherwerb. In: Linguistische Berichte FODOR, J. (1980) Fixation of belief and concept acquisition. In: Piattelli-Palmarini 1980: 142-149. FOUTS, R. (1983) Chimpanzee language and elephant tails: a theoretical synthesis. In: de Luce/Wilder 1983: 63-75. FRJEDERIQ, A. (1983) Repräsentation und Verarbeitung von lexikalischer und syntaktischer Information: psycholinguistische und neurolinguistische Evidenz. Linguistische Berichte 85, 49-63. GAZDAR, G. (1982) Phrase structure grammar. In: Jacobson/Pullum 1982. GOLDIN-MEADOW, S. (1982) The resilience of recursion: a study of a communication system developed without a conventional language model. In: Wanner/Gleitman 1982: 51-77. GOULD, S. J. (1978) Ontogeny and Phylogeny. New York. GREWENDORF, G. (1983) Reflexivierung in deutschen Acl-Konstruktionen. GAGL 23: 120-196. HALE, K. (1983) Warlpiri and the grammar of non-configurational languages. NLL T1: 5-48. HENY, F. & RICHARDS, B. (Hrsg.) (1983) Linguistic categories: auxiliaries and related puzz­ les. Vol. 1, Dordrecht. HÖHLE, T. (1982) Über Komposition und Derivation: zur Konstituentenstruktur von Wort­ bildungsprodukten im Deutschen. ZS 1 - 76:112. HORNSTEIN, N. & LIGHTFOOT, D. (1981) Explanation in linguistics. London. HOVATH, J. (1981) Aspects of Hungarian syntax and the theory of grammar. PhD-diss. UCLA. HUANG, J. T. (1983) On the distribution and reference of empty pronouns. MS. JACKENDOFF, R. (1969) Some rules of semantic inteipretation for English. PhD-Diss. MIT. JACKENDOFF, R. (1983) Semantics and cognition. Cambridge, Mass. JELINEK, E. (1984) Empty categories, case and configurâtionality. Natural Language A Lin­ guistic Theory 2:39-77. JENSEN, M. (1980) Phrasal compounds in French. Diss. University of Colorado JOHNSON-LAIRD, P. (1983) Mental models. Cambridge, Mass. KEAN, M.-L. (1982) Three perspectives for the analysis of aphasie syndroms. In: Arbib et al. 1982: 173-202. KOCH, S. (1976) Bemerkungen zu Er - Nominalisierungen. Leuvense Bi/dragen 65: 69-77. KÜRSCHNER, W. (1974) Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita. Tübingen. LEES, R. B. (1960) The grammar of English nominalization. Den Haag. LEES, R. B. (1970) Problems in the grammatical analysis of English compound nouns. In: Bierwisch/Heidolph 1970: 174-186. LIEBER, R. (1980) On the organization of the lexicon. PhD-Diss. MIT. LIEBER, R. (1981) Morphological conversion within a restrictive theory of the lexicon. In: Moortgat et al. 1981: 161-200. LIEBER, R. (1983) Argument linking and compounds in English. Linguistic Inquiry 14: 251-286. LIGHTFOOT, D. (1982) The language lottery. Cambridge, Mass. 125 MONTAGUE, R. (1973) The proper treatment of quantification in ordinary English. In: Thomason 1974: 188-221. MOODY, M. D. (1980) The interior article in de-compounds in French. Washington D. C. MOORTGAT, M. & v.d. HULST, H. & HOEKSTRA, T. (Hrsg.) (1981) The scope of lexical rules. Dordrecht. MOTSCH, W. (1970) Analyse von Komposita mit zwei nominalen Elementen. In: Bierwisch/ Heidolph 1970: 208-223. MYLES, H. L. (1983) Apes and language: the search for communicative competence. In: de Luce/Wilder 1983: 43-61. OH, YE-OK (1984) Wortsyntax und Semantik der Nominalisierung im Gegenwartsdeutsch. Diss., Konstanz. PASSINGHAM, D. (1981) The human primate. San Francisco. PIATTELLI-PALMARINI, M. (Hrsg.) (1980) Language and learning. London. PREMACK, D. (1983) The codes of man and beasts. BBS 6. REIS, M. (1983) Gegen die Kompositionstheorie der Affigierung. ZS 2: 110-131. ROHRER, C. (1967) Die Wortzusammensetzung im modernen Französisch. Diss. Tübingen. SAITO, M. & HOJI, H. (1983) Weak crossover and move a in Japanese. NLLT 1:245-260. SELKIRK, E. (1982) The syntax of words. Cambridge, Mass. SLOBIN, D. (Hrsg.) (1971) The ontogenesis of grammar. New Yoik. STOWELL, T. (1982) Origins of phrase structure. PhD-Diss, MIT. TERRACE, H. S. (1983) Apes who „talk“: language or projection of language by their tea­ chers. In: de Luce/Wilder 1983: 19-42. THIEL, G. (1973) Die semantischen Beziehungen in den Substantiv-Komposita der deutschen Gegenwartssprache. Muttersprache 83: 377-404. THOMASON, R. (Hrsg.) (1974) Formal philosophy. Selected writings of Richard Montague. New Haven. TOMAN, J. (1983) Wortsyntax. Tübingen. TOMAN, J. (Hrsg.) (1984) Studies in German grammar. Dordrecht. WANNER, E. & GLEITMAN, L. (Hrsg.) (1982) Language acquisition: the state of the art. Cambridge, Mass. WHITE, L. (1981) The responsibUity of grammatical theory to acquisitional data. In: Hornstein/Lightfoot 1981: 241-271. WHITE, L. (1982) Grammatical theory and language acquisition. Dordrecht. WILLIAMS, E. (1981) On the notions „lexically related*4 and „head of a word44. Linguistic Inquiry 12:245-274. 126