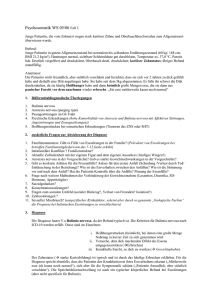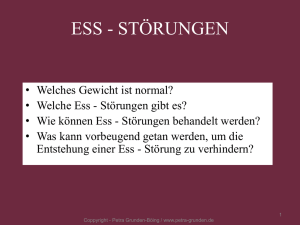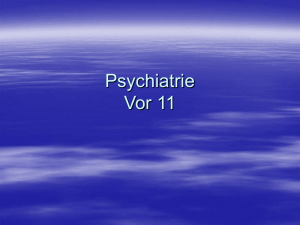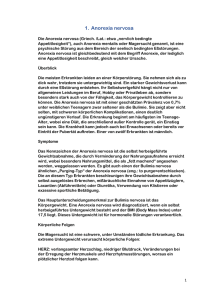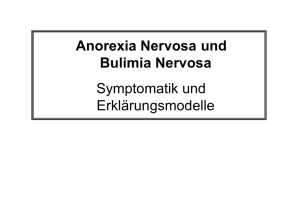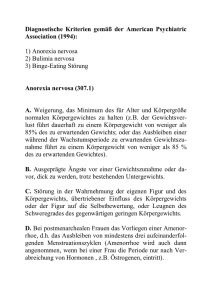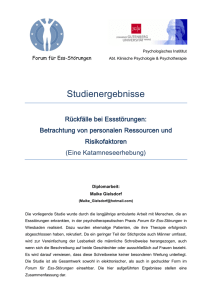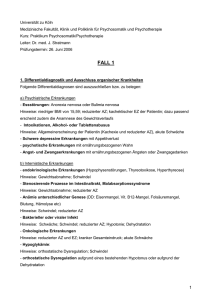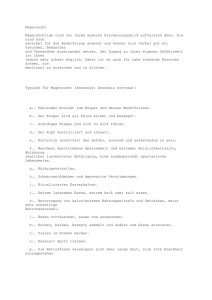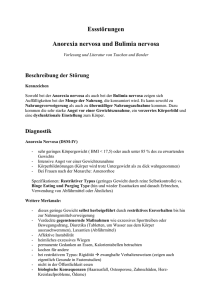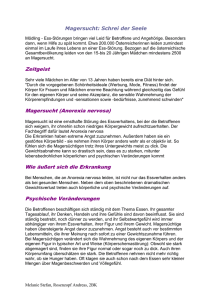Werbung

Originalarbeiten Sexuologie Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitätsstörung. Diagnostische Überlegungen anhand eines Fallberichts The Relationship between Transsexual Feelings and the Presence of a Dissociative Identity Disorder. Diagnostical Considerations Based on a Case Report H.Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Zusammenfassung Anhand einer Kasuistik, in der es zu einem unerwarteten forensischen Zwischenfall kam, soll in diesem Beitrag die Beziehung von transexuellem Empfinden und dem Krankheitsbild der Dissoziativen Identitätsstörung diskutiert werden. Der 1971 geborene Mann stellte sich aufgrund eines transsexuellen Empfindens in der Spezialsprechstunde für geschlechtsidentitätsgestörte Personen vor und wurde unter der Diagnose „narzißtische Persönlichkeit mit unsicherer Geschlechtsrollenidentität" in eine eher niederfrequente vorwiegend begleitende Psychotherapie vermittelt. Während dieser Behandlung stach er unerwartet eine als „Domina" arbeitende Prostituierte nieder. Seit diesem Ereignis erlebte er sich durchgehend als weibliche Person, die nichts mit dieser Gewalttat zu tun hat, die von seinem männlichen Persönlichkeitsanteil begangen wurde. In den stationären Einrichtungen, in denen der Patient nach der Tat zur Begutachtung und Behandlung untergebracht war, wurde neben einer schizoiden Persönlichkeitsstörung vom Tatzeitraum an die Diagnose einer paranoid-halluzinatorischen Psychose gestellt. In einer katamnestischen Aufarbeitung dieses Falles wurde dann die Verdachtsdiagnose einer DID in Erwägung gezogen, weshalb der Patient uns aus dem ihn nunmehr behandelnden forensisch-psychiatrischen Krankenhaus erneut zur diagnostischen Beurteilung vorgestellt wurde, wobei sich gewisse Hinweise für das Vorliegen einer Dissoziativen Identitätsstörung bestätigten. Die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Erörterungen über psychopathologische, diagnostische und psychodynamische Implikationen werden in dieser Arbeit präsentiert. Als wesentliches Resultat dieser Erörterungen ist herauszustellen, daß das Vorkommen Dissoziativer Störungen in der Diagnostik und Differentialdiagnostik von Störungen der Geschlechtsidentität stärker beachtet werden sollte. Schlüsselwörter: Dissoziative Identitätsstörung, Geschlechtsidentitätsstörung, Transsexualismus Abstract This contribution focuses on the relationship between transsexual feelings and the presence of a „Dissociative Identity Disorder" (DID). To illustrate this topic we present a case report with an unexpected interfering forensic problem: The male (born in 1971), diagnosed as „narcicisstic personality disorder with gender dysphoria" had been in mainly supportive orientated outpatient psychotherapy on a regular basis for about one year to deal with his Sexuologie 6 (3) 1999: 129-145 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie 130 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer transsexual desire, when he suddenly severely stabbed a domina-prostitute. Since this event he persistently imagined himself to be female, and that purely the male part of his personality was responsible for this act of violence. In the psychiatric institutions where he was admitted a „schizoid personality disorder" was identified and concerning the time of crime and the status afterwards a „schizophrenic disorder paranoid-hallucinatoric type" was diagnosed. Nevertheless in a catamnestic review the diagnosis of an underlying „Dissociative Identity Disorder" was considered. To check this hypothesis a follow-up assessment of this patient in our department was scheduled. The relevant psychopathological, diagnostical and psychodynamic implications of this investigation are discussed in this paper. According to our results the differential-diagnostic consideration of DID in patients with gender identity disorders is strongly recommended. Keywords: Dissociative Identity Disorder, Disorders of Gender Identity, Transsexualism Einleitung Der Zusammenhang zwischen traumatischen Mißbrauchserfahrungen und der Herausbildung dissoziativer psychopathologischer Phänomene konnte in der jüngeren Vergangenheit in einer Reihe von Studien belegt werden (Chu & Dill 1990). Der Terminus Dissoziation und der mit ihm beschriebene Mechanismus der Symptomentstehung hat allerdings eine lange Begriffsgeschichte und ist keineswegs eindeutig determiniert. Als Abspaltung bestimmter Erlebnis- bzw. Vorstellungsanteile oder psychischer Funktionssysteme, die sich so dem Bewußtsein entziehen, gleichwohl aber aktiv bleiben und die dissoziativen Phänomene hervorrufen, wurde das Grundkonzept der Dissoziation bereits von dem Charcot-Schüler Janet im Jahre 1907 formuliert (Spitzer & Freyberger 1997). In der Psychoanalyse erlangte der von Freud für die Erklärung hysterischer Zustandsbilder herangezogene Mechanismus der Konversion eine größere Bedeutung und der Dissoziationsbegriff geriet über Jahrzehnte in den Hintergrund. Das änderte sich erst, als mit der zunehmenden Beachtung der posttraumatischen Belastungsstörung und der psychischen Auswirkungen realer Traumatisierungen das Interesse an dem Mechanismus der Dissoziation wieder erwachte. Dieses Interesse wurde in besonderem Maße von der wachsenden Anzahl von Berichten über Multiple Persönlichkeiten verstärkt, die in den neueren diagnostischen Klassifikationssystemen als Dissoziative Identitätsstörung firmiert. Die Dissoziative Identitätsstörung (DID) gilt in Europa nach wie vor als umstrittenes Krankheitsbild, deren Stellung als abgrenzbare und eigenständige Krankheitseinheit und deren iatrogene Prägung vielfach kritisch gesehen werden (z.B. Tölle 1997). Dabei ist diese Diagnose keineswegs neu. Gegen Ende des 18. und das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurden immer wieder Fälle von „gespaltener Persönlichkeit“ bekannt. Bis 1880 war dieses Problem zu einem von Psychiatern und Philosophen am häufigsten diskutierten Thema geworden (Ellenberger 1996), geriet dann aber durch eine Gegenbewegung ab 1910 weitgehend in Vergessenheit. In den USA ist diese Störung in den letzten 10 Jahren ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die Dissoziative Identitätsstörung wird zum Formenkreis der Dissoziativen Störungen gezählt und gilt als schwerste chronische Störung dieser Art. Sie wurde inzwischen in zahlreichen Studien besonders gründlich und systematisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß die Dissoziative Identitätsstörung keineswegs selten ist. In der Allgemeinbevölkerung beträgt ihr prozentualer Anteil 1,3 % (Ross 1991; Ross et al. 1990). Bei stationären psychiatrischen Patienten fand man einen Prozentsatz von 3,3 bis 13 % (Ross et al. 1991; Saxe et al. 1993; von Brauns- Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 131 berg 1994). Europäische Studien in den Niederlanden kamen zu ähnlichen Ergebnissen (Boon & Draijer 1993 a). Diese Prävalenzzahlen legen den Verdacht nahe, daß die Dissoziative Identitätsstörung bei psychiatrischen Patienten regelhaft vorkommt, aber bislang auch regelhaft übersehen wird. Dafür dürften verschiedene Gründe verantwortlich sein: Viele Patienten versuchen, ihre Störung sowohl vor der Umwelt als auch vor den Therapeuten zu verbergen; zudem unterliegt die Dissoziative Identitätsstörung als Folge schwerer frühkindlicher, meist sexueller Traumata einer spezifischen Dynamik des gesell-schaftlichen Erkennens und Verdrängens, wie sie für alle Traumata charakteristisch ist, für diese Art der sehr tabubesetzten Traumatisierung vermutlich aber insbesondere wirksam ist. Für den deutschsprachigen Raum kommt hinzu, daß es bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Publikationen zum Thema DID gibt und daher der Kenntnisstand über die Phänomenologie der Erkrankung bislang nicht sehr gut ist. Studien in den USA weisen jedoch darauf hin, daß es bestimmte Risikodiagnosen gibt, unter denen sich eine DID besonders häufig verbergen kann. An Vordiagnosen werden hierbei in der Reihenfolge der Häufigkeit folgende angegeben: Affektive Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Schizophrenie, Substanzmißbrauch, Anpassungsstörungen, Somatisierungsstörungen oder Eßstörungen (Gleaves 1996; Ross 1997). Dissoziative Identitätsstörung und Transsexualismus Der hier interessierende Zusammenhang zwischen Dissoziativer Identitätsstörung und Transsexualismus ist bislang kaum zum Thema wissenschaftlicher Arbeiten geworden. Der Begriff „Transsexualität“ wurde bis zu seiner Berücksichtigung in der ICD 9 (Kramer et al. 1979) beziehungsweise der DSM III (American Psychiatric Association 1980) und auch darüber hinaus in sehr unterschiedlicher Definition verwendet und geht auf Hirschfeld (1923) zurück. Hiermit werden tief in ihrer Geschlechtsidentität gestörte Menschen bezeichnet, die sich dem anderen, ihrer Biologie nicht entsprechenden Geschlecht zugehörig fühlen oder ihm zuzugehören wünschen und dementsprechend eine Veränderung ihrer Anatomie anstreben. „Transsexuell“ ist in der Praxis überwiegend eine Selbstdiagnose von Menschen, die Ärzte mit dem Wunsch nach geschlechtsumwandelnden Maßnahmen hormoneller oder operativer Art konsultieren und allein diese Vorgehensweise als für sich angemessen erachten. Die Kategorie Transsexualität ist daher häufig nur eine Art „Oberflächenbegriff“ und der Name für einen gemeinsamen Wunsch, dem ganz unterschiedliche Probleme und Störungen der (Geschlechts-) Identität zugrunde liegen können (Becker & Hartmann 1994; Langer 1985; Langer & Hartmann 1997). In der 1994 erschienenen DSM IV (American Psychiatric Association 1994) wurde die Diagnose Transsexualismus aufgrund dieser Einschätzung aufgegeben und durch die Kategorie „Störungen der Geschlechtsidentität“ ersetzt. Hierdurch soll auf die Vielgestaltigkeit der Psychopathologie und Psychodynamik von transsexuellen Menschen und die hiermit verbundenen sehr unterschiedlichen therapeutischen Implikationen focussiert werden. Bei einem erheblichen Teil der Betroffenen finden sich signifikante präödipale bzw. ich-strukturelle Störungen, innerhalb derer der transsexuelle Wunsch als Abwehrbildung gegen schmerzvolle intrapsychische Auseinandersetzungen wie Identitätsdiffusion, Selbstwertprobleme, Aggressions-, Trennungs- oder Kastrationsängste aufzufassen ist, als Stabilisierungsversuch im Sinne eines eher primitiven Coping-Mechanismus. 132 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Modestin und Ebner beschrieben 1995 den Fall einer jungen Frau mit dem Wunsch nach Geschlechtswechsel, die die DSM-III-R Kriterien für die Diagnose Transsexualität erfüllte (American Psychiatric Association 1987). Bei der weiterführenden Exploration und Beobachtung ergab sich, daß bei dieser Patientin eine DID aufgedeckt wurde. Obwohl grundsätzlich die Möglichkeit einer reinen Koinzidenz beider Störungen gesehen wurde, gab es nach Ansicht der Verfasser deutliche Hinweise dafür, daß der transsexuelle Wunsch bei dieser Patientin als Symptom der zugrundeliegenden Persönlichkeitsstörung (DID) aufzufassen ist. Es konnten insgesamt vier Persönlichkeiten beobachtet werden, von diesen eine in Gestalt eines mit seinem weiblichen Körper unzufriedenen Jungen, der den Wunsch nach Geschlechtswechsel verfolgte. Coons et al. arbeiteten 1988 in ihrer systematischen Untersuchung bei 13 von 50 Individuen mit DID ebenso gegengeschlechtliche Persönlichkeiten heraus (=26%). Diese Autoren wiesen auf hohe Überschneidungen zu anderen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere der Borderline-Persönlichkeitsstörung, hin. Auch fanden sie unter den betroffenen biologischen Männern einen hohen Proporz an kriminellen Handlungen (bei 3/4)1. Als Schlußfolgerung einer Kasuistik plädierte Saks (1998) dafür, Dissoziative Störungen differentialdiagnostisch zu bedenken und entsprechende Tests und Untersuchungsverfahren bei der Abklärung von Geschlechtsidentitätsstörungen einzusetzen. An einer größeren nicht-klinischen Stichprobe von Frau-zu-Mann-Transsexuellen konnte Devor (1994) bei 60% eine oder mehrere Formen schwerer Mißbrauchserfahrungen erheben und kam zu der Schlußfolgerung, daß Transexualität in einigen Fällen „eine extreme adaptive dissoziative Reaktion auf schwere kindliche Mißbrauchserfahrungen“ sein könne und riet ebenfalls dazu, diese Möglichkeit bei diagnostischen und therapeutischen Überlegungen stärker zu berücksichtigen. Die Beziehung von Dissoziativer Identitätsstörung und Störungen der Geschlechtsidentität, die nach unseren klinischen Erfahrungen bei einer Anzahl von Patienten mit transsexuellen Wünschen diagnostisch und differentialdiagnostisch von Bedeutung ist, soll im folgenden anhand der Kasuistik eines jungen Mannes mit transsexuellem Empfinden thematisiert werden, der während der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung überraschend eine Gewalttat verübte. Um dem Leser einen möglichst dichten Eindruck von unseren Einschätzungsprozessen zu geben, beschreiben wir die Kasuistik zunächst so, wie sie sich uns vor der Straftat darstellte und ergänzen danach den weiteren Verlauf. Kasuistik Der 1971 geborene Herr B. stellte sich in der psychiatrisch/psychotherapeutischen Sprechstunde mit dem Wunsch vor, als Frau leben zu wollen. Schon seit Kindheit habe er das Gefühl, eigentlich Mädchen zu sein; er strebe nun die operative Geschlechtsumwandlung an. Eine ambulante endokrinologische Untersuchung hatte einen unauffälligen männlichen Hormonstatus und eine regelrechte männliche Physiognomie herausgestellt. Herr B. gab an, er sei ledig, wohne allein in einer Mietwohnung, habe als Paketzusteller gearbeitet, sei jedoch wegen zahlreicher Fehlzeiten aufgrund von Rückenbeschwerden gekündigt worden, nunmehr arbeitslos. Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 133 Anamnese Beide Eltern seien Alkoholiker gewesen. Der Vater (+ 25 Jahre), von Beruf Metzger, habe kein Interesse an seinen drei Kindern (ein Bruder + 5 Jahre, Herr B., eine Schwester – 2 Jahre) gezeigt und habe den Patienten - wie auch die anderen Familienangehörigen – oft geschlagen, bis er sich im Alter von 16 Jahren gewehrt habe. Die Mutter (+ 22 Jahre), Hausfrau, habe manchmal versucht, die Kinder in Schutz zu nehmen. Herr B. gab dem Vater die Schuld an ihrem frühen Tod. Die Mutter habe getrunken, um das Leben mit dem Vater auszuhalten, und sei bereits 43-jährig verstorben, vermutlich an Alkoholfolgeschäden. Aufgrund ihrer Erkrankung seien die Kinder dann sich selbst überlassen gewesen. Die Großeltern mütterlicherseits seien bis heute Zuflucht für ihn (und auch für seine Geschwister). Er besuche diese nach wie vor täglich und esse auch dort, verbringe ansonsten seine Freizeit mit Fernsehen. Zu Vater und Geschwistern bestehe kein Kontakt mehr. Als Kind habe er zumeist mit seiner Schwester und deren Puppen gespielt. In der Schule habe er nur mittelmäßige Leistungen erbracht, sei auch dort eher Außenseiter gewesen. Nach dem Hauptschulabschluß habe er den Beruf des Maurers erlernt, diesen jedoch wegen Rückenschmerzen nicht ausüben können. Anschließend habe er diverse Aushilfstätigkeiten innegehabt, sei dann zur Bundeswehr eingezogen, jedoch aufgrund seiner Geschlechts- identitätsstörung alsbald ausgemustert worden. Über Sexualität sei in seiner Familie nicht gesprochen worden, er habe nie eine systematische Aufklärung erfahren. Recht früh sei er in die Pubertät gekommen. Er lehne seinen männlichen Körper ab; sich vor anderen unbekleidet zu zeigen, sei für ihn völlig inakzeptabel. Insbesondere seine männliche Körperbehaarung verabscheue er, entferne diese regelmäßig. Er befriedige sich nicht selbst, möge seinen Penis nicht anfassen. Bereits als Kind habe er heimlich Frauenkleider angezogen, sei so auch abends in die Stadt gegangen. Als Frau zurechtgemacht sei er einmal in eine Verkehrskontrolle geraten, die Polizisten hätten damals eine herablassende Bemerkung gemacht, die ihn derart peinlich berührt habe, daß er hiernach in der Öffentlichkeit keine weibliche Kleidung mehr getragen habe. Eine fetischistische Komponente verneinte Herr B., manchmal bemerke er allerdings eine Erektion, die er aber gar nicht wolle. Das Gefühl, eigentlich Frau in einem Männerkörper zu sein, habe er seit dem 12./13. Lebensjahr. Bisher habe er, abgesehen von Ärzten, noch mit niemandem über sein Problem gesprochen. Er stelle es sich unangenehm vor, mit anderen Menschen erst als Mann und dann als Frau zu verkehren, befürchte, so nicht akzeptiert zu werden. Deshalb vermeide er bis zu einer „endgültigen Lösung“ (= Geschlechtsumwandlung) verbindliche Kontakte. Als Frau wolle er eine aktive, selbständige Rolle bekleiden, etwa als Flugbegleiterin oder in der Reiseleitung tätig sein. An somatischen Beschwerden sei zu berichten, daß er rezidivierende starke krampf- und anfallsartig auftretene Bauchschmerzen im Unterleib erleide. Durch eine Untersuchung sei eine „einseitige Darmverengung“ festgestellt worden. Drogen oder Alkohol konsumiere er nicht. Im initialen psychopathologischen Befund wurde Herr B. als wach, voll orientiert und ohne Wahrnehmungs- oder Denkstörungen beschrieben. Von der Stimmung her erschien er ernst. Er war in der ersten Begegnung außerordentlich scheu, wirkte gehemmt, auch während der folgenden Anamnesegespräche fiel es ihm schwer, Blickkontakt herzustellen. Die Gespräche verliefen stockend, bei der Schilderung seiner Biographie mußte immer wieder nachgefragt werden, seine Antworten waren meist einsilbig. Eine psychotherapeutische Behandlung wurde unter folgenden psychodynamischen 134 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Überlegungen erwogen: Hinter den ausgeprägten Schwierigkeiten im Kontaktbereich schien eine fragile Ich-Struktur auf. Herr B. verhielt sich gegenüber äußeren Einflüssen defensiv-geduckt, lebte gleichsam „getarnt“ und isoliert. Der mangelnden Fähigkeit, positive Gefühle wie Freude zu empfinden, entsprach auf der anderen Seite das weitgehende Fehlen negativer Affekte wie Wut, Trauer oder Enttäuschung. Neben einem erheblichen Defizit an elterlicher Zuwendung und Emotionalität war Herr B. in der Kindheit kontinuierlich Aggressionen und Vernachlässigung ausgesetzt, fand lediglich bei den Großeltern Zuneigung und Konstanz. Objektverlustangst und Selbst-Schutz manifestierten sich in der hochgradigen sozialen Isolation mit Rückzug aus Beziehungen und Abwertung potentieller Beziehungspartner (Objektabwertung). Die Überzeugung, eine Frau im männlichen Körper zu sein, fungierte als Erklärung für diese Defizite, die zeitweise aber dennoch erlebt wurden und zu Leidensdruck führten. Herr B. phantasierte die Idealvorstellung von „konfliktfreier Nähe“ in einen weiblichen Körper. Er identifizierte sich mehr mit der Mutter, die er als das still leidende und duldende Opfer erlebte und deren eigenes, ihn schädigendes und vernachlässigendes Handeln er ausblendete. Die durch den Vater repräsentierte „männliche“ Aggressivität lehnte er hingegen ab, gestand sich zugleich selbst aggressive Regungen diesem gegenüber nicht zu. Seine Sexualität war durch eine extreme Triebverdrängung gekennzeichnet, sexuelle Impulse wurden vollständig ausgeblendet und erschienen nicht existent. Die mangelnde Verläßlichkeit des Vaters und dessen Desinteresse hatte eine positive männliche Identifizierung verhindert und zu einer Verunsicherung in der Reifung geführt. Das Frauenbild, das Herr B. für die Zeit nach der Geschlechtsumwandlung entworfen hatte, wies genau die Eigenschaften auf, die ihm selbst versagt geblieben waren. Die Überwindung der Kontaktscheu, Selbstunsicherheit und Gehemmtheit wurde als Leitmotiv für die angestrebte Geschlechtsumwandlung angesehen und der Aufbau einer therapeutischen Beziehung mit dem Ziel einer Affektdifferenzierung angestrebt. Verlauf der Psychotherapie Herr B. wurde ambulant psychotherapeutisch behandelt, teilweise in zweiwöchentlichem Rhythmus; insgesamt fanden 31 Gespräche statt. Die Vorgehensweise orientierte sich an den Empfehlungen zur Psychotherapie Geschlechtsidentitätsgestörter, wie sie beispielsweise von Lothstein (1977) oder aktueller von Laszig, Knauss und Clement (1995) herausgearbeitet und bei den Standards für die Behandlung von Transsexuellen (Becker et al. 1997) berücksichtigt wurden. Von Anfang an bestand eine große Ungeduld bezüglich der von ihm intendierten operativen Geschlechtsumwandlung, die Herr B. für sich als alleinige Lösung seiner Probleme ansah. Dieser starke innere Druck fand auch körperlich Ausdruck in rezidivierenden starken Unterleibsbeschwerden. Herr B. hatte das Gefühl, Reste von Ovarien zu haben und suchte zur Abklärung (Ultraschall) einen Gynäkologen auf (ohne Befund). Dieses Empfinden persistierte und schien ein wichtiger somatischer „Anker“ seiner Weiblichkeit zu sein. Nach einem halben Jahr begann Herr B. einen einjährigen „Alltagstest“ (Ausprobieren eines Lebens im anderen Geschlecht). Es entwickelte sich in der Psychotherapie eine stabile und positive Beziehung, Herr B. fühlte sich „endlich“ mit seinem Problem ernst genommen. Mit großem Elan arbeitete er an seinem äußeren weiblichen Erscheinungsbild (weibliche Kleidungsstücke, künstliche Verlängerung der Kopfbehaarung, Entfernung von Bart- und Körperbehaarung, Schminken etc.). Begleitend nahm er wieder Kontakt zu seiner Schwester auf, suchte sich Aus- Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 135 hilfstätigkeiten und stand wegen einer geplanten Umschulung (Wunschberuf: Erzieherin) in regelmäßigem Kontakt mit dem Arbeitsamt. Er berichtete fast ausschließlich von positiven Erfahrungen mit seiner Frauenrolle. Kontakte zu anderen Menschen blieben dabei weiterhin flüchtig und unverbindlich. Herr B. betonte, so schnell wie möglich durch den „Alltagstest“ hindurchkommen zu wollen und stellte immer wieder Fragen zum weiteren formalen Procedere (gegengeschlechtliche Hormongaben, Gutachten nach dem Transsexuellengesetz, operative Umwandlung etc.). Er suchte sich einen Frauennamen aus und äußerte mehrfach den Wunsch, als Frau B. angesprochen zu werden bzw. seine Enttäuschung darüber, daß dies nicht erfolgte. Zu seiner Sexualität berichtete er weiterhin nur spärlich und auf explizite Nachfragen. Er sei „erotisch zu Frauen hin“ orientiert, seinem Erleben nach also lesbisch, sei auch schon mal verliebt gewesen, habe jedoch nie intime Begegnungen gehabt. „Zur Zeit“ könne er sich weder eine (sexuelle) Beziehung vorstellen noch habe er das Bedürfnis nach sexuellen Begegnungen. Jegliche engere Kontaktaufnahme mit anderen Menschen seien für ihn erst nach seiner „Verwandlung“ zur Frau möglich. Die Versuche, ihn mit der illusionären Verkennung zu konfrontieren, seine Selbstwertproblematik und Kontaktarmut durch eine Geschlechtsumwandlung abzulegen, und das Angebot, dies zu bearbeiten, nahm er zwar zur Kenntnis, ohne sich jedoch erkennbar darauf einzulassen. Es ergab sich in der Psychotherapie kein Zweifel, daß Herrn B. jederzeit bewußt war, daß er der (männliche) Herr B. ist, der sich als Frau fühlt und seinen Körper seinem inneren Empfinden anpassen möchte. Die Straftat Ungefähr ein Jahr nach Beginn der Behandlung kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, durch den die Therapie beendet wurde. Herr B. besuchte eine Domina-Prostituierte und stach mit einem Brotmesser mehrfach auf diese ein. Damit fügte er ihr sehr schwere Bauchverletzungen zu. Herr B. wurde am nächsten Tag festgenommen. Am Tag der Tat (wie sich später herausstellte, ca. eine Stunde nach der Tat) rief er seine Therapeutin an und bat um ein Gespräch noch am selben Abend. Diese hielt ein derartiges Treffen für nicht realisierbar und bot ersatzweise eine telefonische Intervention an, die Herr B. allerdings ablehnte. Im Kontext der Ermittlungen stellten sich überraschend neue Informationen heraus: Herr B. war drei Tage vor der Tat bereits einmal bei dieser Prostituierten gewesen. Ihren Angaben gemäß habe er in Frauenkleidern eine „Routinebehandlung“ erhalten, sei dabei allerdings in für sie auffälliger Weise ohne besondere innere Beteiligung gewesen. In seiner Wohnung wurden verschiedene sado-masochistische Utensilien und einschlägige Zeitungsinserate gefunden. Die Zeit nach der Tat: Begutachtung und Therapie Nach der Tat wurde Herr B. zunächst in ein umliegendes psychiatrisches Landeskrankenhaus zur Behandlung und Begutachtung aufgenommen, später in den Maßregelvollzug eines forensisch-psychiatrischen Landeskrankenhauses verlegt. Bei Eingangsuntersuchung in der erstgenannten Klinik war Herr B. hochgespannt und geängstigt und wurde als suizidal eingeschätzt. In den Gesprächen wurde deutlich, daß er sich selbst zur Zeit und auch nach der Tat ausschließlich als weibliche Person (Petra) wahrgenommen hatte, während der männliche „Oliver“ als abgespaltene Person die Tat begangen habe. „Oliver“ habe ihr (Petra) vor der Tat gesagt, er wolle jetzt „eine Frau strafen“ gehen. Für die 136 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Tat selbst bestand eine Amnesie. Als „Petra“ erlebte Herr B. „Oliver“ als unberechenbar und gefährlich. „Oliver“ gebe ständig Befehle, denen sich „Petra“ nicht entziehen könne. Auch könne „Oliver“ ihre Gedanken lesen. Zur Zeitdauer der Persönlichkeitsspaltung machte Herr B. widersprüchliche Angaben: Einerseits berichtete er, daß diese bereits seit dem 16./17. Lebensjahr bestehe, seitdem er von der Möglichkeit einer Geschlechtsumwandlung erfahren habe. Er habe täglich ca. 4 Stunden lang diese quälenden und ängstigenden Wahrnehmungsstörungen gehabt, jedoch mit niemandem darüber gesprochen aus Angst, dann sein Ziel der Geschlechtsumwandlung nicht erreichen zu können. Später gab Herr B. an, daß „Oliver“ erst vor ein paar Monaten „erschienen“ sei. Die Spaltung bestand gemäß der Aktenlage fort und erfuhr unter neuroleptischer Behandlung nur eine „leichtgradige Entaktualisierung“. Gutachterlicherseits wurde eine vorbestehende schizoide Persönlichkeitsstörung mit transsexuellem Empfinden und für den Tatzeitraum und seitdem eine paranoid-halluzinatorische Psychose diagnostiziert. Letztere wurde vor allem an inhaltlichen Denkstörungen bzw. psychotischen Wahrnehmungsverzerrungen sowie Ich-Störungen in Form von Depersonalisationserleben, etwa dem Gefühl, selbst innere weibliche Geschlechtsorgane zu haben, verankert. Etwa zweieinhalb Jahre nach der Straftat erfolgte eine telefonische Nachbefragung des Patienten. Er erläuterte, daß es ihm im forensisch-psychiatrischen Krankenhaus trotz eher widriger Umstände möglich sei, sein transsexuelles Empfinden zu artikulieren und auch in weiblicher Kleidung aufzutreten; diese habe er sich zum Teil gekauft, zum Teil von zu Hause habe mitbringen lassen. Seit einem dreiviertel Jahr würden ihm keine psychopharmakologisch wirksamen Medikamente mehr verabreicht. Er sei nunmehr dabei, den Realschulabschluß nachzuholen. Mittlerweile werde es ihm auch ermöglicht, in Begleitung eines Sozialarbeiters einmal pro Woche eine externe Selbsthilfegruppe für Transsexuelle aufzusuchen. Kürzlich habe er beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Vornamensänderung nach dem Transsexuellengesetz gestellt. Seitens der Familie, d.h. seines Bruders und seiner Großmutter, habe er guten Rückhalt, zum Vater bestehe allerdings seit Jahren kein Kontakt mehr. Bezüglich der Tat habe er keinerlei Erinnerung, wisse lediglich aus den Unterlagen, was vorgefallen sei (weitere Ausführungen hierzu siehe Diskussion). Die Erkenntnisse der katamnestischen Aufarbeitung dieses Falles werden unter Einbeziehung der Befunde, die im Kontext der anberaumten persönlichen Nachuntersuchung zur Abklärung der Verdachtsdiagnose einer Dissoziativen Identitätsstörung erhoben wurden, im Diskussionsteil angeführt. Diskussion Bei der Diskussion dieser ungewöhnlichen Kasuistik soll neben dem Versuch eines individuellen psychodynamischen Verstehens des Patienten der Schwerpunkt auf diagnostische und differentialdiagnostische Überlegungen und deren Implikationen gelegt werden. Die Psychodynamik und die zugrundeliegende Motivation der Gewalttat konnten nur ansatzweise erhellt werden. Unklar ist etwa, was Herrn B. bewegt hat, diese Domina-Prostituierte aufzusuchen und ob es ihm dort primär um die Befriedigung sexueller Bedürfnisse ging. Unmittelbar vor der Tat kam es nicht zu einer intimen oder ritualisierten Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 137 (sadomasochistischen) Begegnung, vielmehr stach Herr B. die Prostituierte schon an der Tür nieder. Wendet man die gängigen psychodynamischen Erwägungen zu Perversionen auf diesen Fall an, müßte man die Tat als den Versuch deuten, die nicht akzeptierten „männlichen“ (Partial-) Triebe zu beseitigen, um sich so zu befreien, zu reinigen, diese abgelehnten und geheimen Regungen quasi hinter sich zu lassen bzw. ungeschehen zu machen. Im Vorfeld der Tat sind der „transsexuelle Stabilisierungsversuch“ und der dem Selbstschutz dienende Rückzug aus Objektbeziehungen möglicherweise nicht mehr ausreichend gewesen, um die drohende psychische Fragmentierung abzuwenden. Die Beschäftigung mit sadomasochistischen Phantasien und Inszenierungen dürfte im Sinne der „Perversion als Plombe“ (Morgenthaler 1974) ebenfalls als Versuch der Kompensation und Strukturgebung zu werten sein, führte aber bei Herrn B. offenbar durch die Konfrontation mit der bis dahin verleugneten und abgespaltenen Trieb- und Aggressionsseite seiner Psyche zu einer weiteren Destabilisierung und veranlaßte den Rückgriff auf archaischere, „primitivere“ Abwehrmaßnahmen. Die bei Herrn B. hervorstechende Verleugnung von aggressiven und sexuellen Triebimpulsen entspricht den psychodynamischen Überlegungen von Lothstein (1979), nach denen sich die Objektbeziehungen bei Transsexuellen aufgrund struktureller Defekte und den korrespondierenden „primitiven“ Abwehrmechanismen entlang einer sadomasochistischen Linie organisieren. Volkan und Behrent (1976) haben darauf hingewiesen, daß viele Transsexuelle durch ihre aggressiven Impulse geängstigt sind und die Geschlechts- umwandlung gerade auch zum „Loswerden“ ihrer Aggressionen anstreben. Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kamen auch Sørensen und Hertoft (1982) aufgrund ihrer empirischen Untersuchungen, nach denen die Grundlage der Geschlechtsidentitätsstörung von biologischen Männern in einer profunden Angst und Unsicherheit zu sehen ist, die durch eine Suppression aggressiver und sexueller Gefühle sowie durch eine Flucht in die Phantasie und das Anstreben ästhetisch überhöhter Ich-Ideale kompensiert werden soll. Unklar bleibt allerdings bei Herrn B., ob eine mögliche paraphile Abwehrformation über einen längeren Zeitraum vorlag und strukturgebend für die Persönlichkeit war oder im Sinne der unten diskutierten dissoziativen Mechanismen als eine Art „Zerfallsprodukt“ eines inkohärenten Selbstsystems mit dissoziierenden Teilidentitäten bewertet werden muß. Noch stärker als psychodynamische Erklärungsansätze des Verlaufs interessiert hier die Frage, welche der verschiedenen Diagnosen in diesem Fall tatsächlich zutreffend ist. Daher soll es im folgenden ausführlicher um diagnostische bzw. differentialdiagnostische Überlegungen gehen. Dabei ist zunächst die in den beiden stationären Einrichtungen favorisierte Diagnose einer paranoid-halluzinatorischen Psychose zu diskutieren. Für diese sprechen Wahninhalte, Ich-Störungen sowie die als psychotisch einschätzbare Spaltung der Primärpersönlichkeit in „Oliver“ und „Petra“. Bei Annahme einer psychotischen Störung muß zugleich in Erwägung gezogen werden, ob bei Herrn B. neben der Störung der Geschlechtsidentität bereits seit längerem eine Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis vorlag, die möglicherweise erst zum Tatzeitpunkt erkennbar exacerbierte. In diesem Zusammenhang ist allerdings erwähnenswert, daß weder durch die Aufnahmeärztin einen Tag nach der Tat noch später eine mangelnde Realitätsprüfung festgestellt wurde. Der Zusammenhang zwischen psychotischen Erkrankungen und transsexuellem Empfinden ist verschiedentlich untersucht worden (Gittleson & Levine 1966; Newman & Stoller 1974; Mate-Kole et al. 1988; Commander & Dean 1990). In ihrer umfassenden Übersichtsarbeit zur Schizophrenie und Sexualität beschrieben Akthar und Thomson 138 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer (1980) das Auftreten wahnhafter sexueller Verwandlungserlebnisse und Zweifel an der eigenen Geschlechtsidentität gar als kernhafte schizophrene Erlebnisweisen. Ob umgekehrt jedoch die Inzidenz schizophrener Psychosen bei Menschen mit transsexuellem Empfinden erhöht ist – wie es die Daten von Hoenig und Kenna (1974) nahelegen – muß bis heute als umstritten gelten. Die bei vielen biologisch männlichen Personen mit Störungen der Geschlechtsidentität anzutreffende, bei Herrn B. aber besonders ausgeprägte Spaltung in gut/rein = weiblich und schlecht/gewaltsam = männlich könnte u.E. auch im Sinne einer Dissoziativen Störung aufgefaßt werden, als Dekompensation der mutmaßlich langbestehenden Aufspaltung in unterschiedliche Persönlichkeitskonfigurationen. Wenngleich bei Herrn B. einige Merkmale durchaus an das Vorliegen einer produktiv psychotischen Erkrankung denken lassen, sind wir der Ansicht, daß sowohl das Verhalten des Patienten, seine Angaben über sein inneres Erleben als auch die objektiv beschriebenen Phänomene insgesamt eher für die Diagnose einer Dissoziativen Störung mit Verdacht auf DID sprechen. Die Evidenz für diese Schlußfolgerung kann in die folgenden Kategorien unterteilt werden: a) Angaben des Patienten Nach der Tat wurde deutlich, daß sich Herr B. wie mit zwei Personen in einem Körper fühlte. Im Gespräch hatte offensichtlich wieder die Persönlichkeit Kontrolle über den Körper, die er als „Petra“ bezeichnet. Er berichtete von Dialogen zwischen diesen beiden „Persönlichkeiten“, die sehr unterschiedliche Charaktere und Wünsche haben. „Oliver“ wurde als grausam und bedrohlich beschrieben, wolle die andere Person umbringen und abstechen. „Petra“ dagegen fühle sich als Frau, möchte lange Haare haben und sich umoperieren lassen. Wenn er als „Petra“ über den Persönlichkeitsanteil von „Oliver“ sprach, benutzte er die dritte Person (z.B. „der ‘Oliver’ hat gesagt, daß er die Frau bestrafen will“). b) Amnesie als wichtiges Leitsymptom Der Patient gab an, keine Erinnerungen an die Zeit zu haben, in der der andere Persönlichkeitsanteil (Oliver) die Führung übernommen hatte. Als „Petra“ bestand für die Tatzeit eine glaubhafte Amnesie. Symptome einer dissoziativen Amnesie bestanden aber nicht nur für die Tatzeit sondern auch in anderen Situationen: So hatte Herr B. angegeben, eine ausgeprägte Amnesie für seine Kindheit zu haben. Auch wurden bei der Hausund Kfz-Durchsuchung Gegenstände gefunden (Handschellen und Notizzettel von offenbar eingeholten Angeboten zweier Prostituierter mit Telefonnummern), an deren Anschaffung bzw. Anfertigung Herr B. sich nicht erinnern konnte, obwohl sie seine Schrift zeigten. Das Finden von Gegenständen, an deren Erwerb man sich nicht erinnern kann, sowie das Entdecken von selbstverfaßten Notizen, für deren Anfertigung eine Amnesie besteht, sind spezifische Symptome, die auf eine DID hinweisen (siehe Tabellen 1-3). Zudem war während der stationären Untersuchungsgespräche eine Amnesie festzustellen: Wie bereits kurz erwähnt, schilderte Herr B. zunächst ausführlich, daß er seit dem 7. Lebensjahr den Wunsch habe, ein Mädchen zu sein und daß „Oliver“ ihm vom 16./17. Lebensjahr an erstmals gegenübergetreten sei. Zwei Tage später gab er an, daß „Oliver“ erst vor ein paar Monaten, d.h. im Alter von 25 Jahren, erschienen sei. Er äußerte Erstau- Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 139 nen über die ihm wiedergegebene andere Version und konnte sich nicht erinnern, dies ausgesagt zu haben. Hier liegt ein wichtiger Hinweis für weiterhin bestehende Amnesien vor. Tab. 1: Merkmale des Persönlichkeitssystems bei der Dissoziativen Identitätsstörung (DID) (nach Ross 1997) „Alltagspersönlichkeit“ mit typischen Alter-Persönlichkeiten: 1. Kindpersönlichkeit, 2. Schützerpersönlichkeit, 3. Täter-Verfolger-Persönlichkeit, 4. gegengeschlechtliche Persönlichkeit, 5. Dämon, 6. eine andere lebende Person, 7. ein verstorbener Verwandter Tab. 2: Spezifische Merkmale der Dissoziativen Identitätsstörung (DID) (nach Kluft 1996; Ross 1997) 1. Amnesie (Erinnerungslücken, Zeitverzerrungen, Zeitverlieren), 2. Patient spricht von „wir“ oder in der 3. Person von sich, 3. Trance-Zustände, Schlafwandeln oder imaginäre Gefährten, 4. andere erzählen von nicht-erinnerbarem Verhalten, 5. andere bemerken beobachtbare Wechsel, 6. Entdecken von Gegenständen oder Aufzeichnungen von sich, an deren Erwerb man sich nicht erinnern kann, 7. Stimmenhören (meist im Kopf), 8. unterschiedliche Handschriften, 9. parapsychologische Erfahrungen Tab. 3: Unspezifische Merkmale der Dissoziativen Identitätsstörung (DID) (nach Kluft 1996; Ross 1997) 1. traumatische Erfahrungen in der Kindheit, 2. Mißlingen vorhergehender Behandlungen, 3. drei oder mehr vorherige Diagnosen, v.a. „atypische Störungen“ (Depression, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Schizophrenie, Substanzmißbrauch, Anpassungsstörung, Somatisierungsstörung, Eßstörung), 4. selbstverletzendes Verhalten, 5. Schlafstörungen, 6. Sexualstörungen, 7. psychiatrische und somatische Störungen gleichzeitig, 8. fluktuierende Symptome und Funktionsniveau, 9. Schmerzen, insbesondere Kopfschmerzen, 10. Amnesie für die Kindheitserinnerungen zwischen 6 und 11 Jahre 140 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer c) Anamnestische Risikofaktoren Herr B. hat schwere und wiederholte körperliche Mißhandlungen durch beide Eltern erfahren. Langanhaltende Kopfschmerzen und Unterleibsbeschwerden werden von vielen Autoren als unspezifische Hinweise für das Vorliegen einer DID eingestuft (siehe auch Tabelle 1 und 2). Schwere, langanhaltende Kindheitstraumata, meist in Form von sexuellem Mißbrauch bei gleichzeitig vorliegender psychobiologischer Fähigkeit zur Dissoziation werden als Ursache für die Entstehung einer DID angesehen (Huber 1995; Gleaves 1996; Eckhardt & Hoffmann 1997; Overkamp et al. 1997). Katamnese Nach der Straftat wurde in bei einer katamnestischen Aufarbeitung des Falles aufgrund der oben dargestellten Erwägungen die Verdachtsdiagnose einer DID diskutiert, Herr B. wurde daraufhin erneut in der Psychiatrischen Poliklinik mit der Bitte um entsprechende diagnostische Abklärung vorgestellt. Es erfolgte eine Untersuchung mit dem Strukturierten Klinischen Interview für DSM-IV Dissoziative Störungen, SKID-D (Gast et al. im Druck, Originalversion: Structured Clinical Interview for DSM-V Dissociative Disorders Revised, SCID-D von Steinberg 1994), das in Anlehnung an das SKID zur operationalisierten Erfassung der verschiedenen Dissoziativen Störungen entwickelt wurde. Insbesondere erfragt das SKID-D Informationen, um den Schweregrad der fünf dissoziativen Hauptsymptome Amnesie, Depersonalisation, Derealisation, Identitätskonfusion und Identitätsänderung anhand von entsprechenden Definitionen bewerten zu können. Danach lassen sich folgende Diagnosen erfassen: Dissoziative Amnesie, Dissoziative Fugue, Depersonalisationsstörung, Dissoziative Identitätsstörung, nicht anderweitig klassifizierbare Dissoziative Störung sowie Trance-Störung. Die Anwendung des Interviews erfordert klinische Erfahrung und wurde von einer von Steinberg trainierten Autorin (U.G.) durchgeführt. Während des Interviews verneinte der Patient zunächst Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis. Auf Nachfrage stellte sich jedoch heraus, daß ausgeprägte Erinnerungslücken sowohl für die Straftat als auch für den nachfolgenden Aufenthalt im ersten LKH bestanden. Auch für die Kindheit bis zum achten Lebensjahr fand sich eine Amnesie. Entfremdungserleben wurde vor allen Dingen hinsichtlich der männlichen Geschlechtsmerkmale beschrieben, ansonsten jedoch verneint. Die schwere Identitätskonfusion äußerte sich in der vehement vertretenen Meinung, eigentlich eine Frau zu sein, während die Fragen nach Identitätswechsel verneint wurden. Auf die Frage nach der Straftat gab er an, daß er sich nicht vorstellen könne, so etwas getan zu haben. Wenn dies aber wirklich der Fall sei, sei dies „eine ganz große Gemeinheit“. Seine Aussage, das für die Straftat „der Oliver“ verantwortlich sei, wiederholte er somit im Interview nicht. Er konnte sich an diese Aussage auch nicht erinnern. Aufgrund der ausgeprägten Amnesien, der hohen Verleugnungshaltung und der sehr rigiden, fassadenhaften und tiefmißtrauischen Beziehungsgestaltung des Patienten läßt sich seine Psychopathologie hinsichtlich der Schwere der Dissoziativen Störung nicht sicher beurteilen. Die Kriterien für eine schwere Dissoziative Amnesie sind erfüllt; da die Symptomatik aber darüber hinausgeht, haben wir uns in diesem Fall für die Diagnose einer Dissoziativen Störung, nicht anderweitig spezifizierbar entschieden, wobei die Verdachtsdiagnose einer Dissoziativen Identitätsstörung bestehen bleibt. Insofern sprachen wir die Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 141 Empfehlung aus, bei der weiteren klinischen Beobachtung auf entsprechende Merkmale der Störung zu achten (siehe Tab. 2) und hinsichtlich einer Geschlechtsumwandlung sehr zurückhaltend zu sein. Als Schlußfolgerung ergibt sich für uns, daß sowohl die Angaben des Patienten als auch die in den Untersuchungsgesprächen erhobenen Befunde eher für das Vorliegen einer Dissoziativen Identitätsstörung als für eine paranoid-halluzinatorische Psychose sprechen. Sowohl die beschriebenen Amnesien als auch die Identitätsstörungen bzw. Identitätswechsel in Form von zwei verschiedenen, mit Namen benannten Persönlichkeitsanteilen weisen auf eben diese Störung hin. Im Nachhinein muß bei diesem Fall die Angemessenheit eines psychotherapeutischen Settings, das die angestrebte Geschlechtsumwandlung (bei entsprechenden Voraussetzungen) als eine der möglichen Optionen in der Behandlung von Patienten mit einer Störung der Geschlechtsidentität transsexuellen Gepräges anerkennt (Laszig et al. 1995; Becker et al. 1997), hinterfragt werden (Schwartz 1988). Auf dem Hintergrund einer DID ist sowohl das Ansprechen der Prostituierten als auch die Straftat als unbewußte Inszenierung dessen anzusehen, was der Patient in der therapeutischen Situation erlebte: Der Therapeutin gegenüber präsentierte er sich nur mit seinem weiblichen Persönlichkeitsanteil (Petra), der Identität und Akzeptanz in der Geschlechtsumwandlung sucht. Geradezu dranghaft war der Patient bemüht, die Therapeutin mit an seinem Vorhaben zu beteiligen, alle männlichen Aspekte an sich auszumerzen. Das Eingehen auf diese Wünsche schien den Patienten zunächst zu entlasten und zufrieden zu stellen. Das transsexuelle Empfinden wurde im Fall von Herrn B. offensichtlich nur von dem weiblichen Persönlichkeitsanteil im Sinne einer „alter-personality“ erlebt und die Geschlechtsumwandlung angestrebt. Mit der gewährenden therapeutischen Haltung gegenüber diesem Wunsch spitzte sich jedoch die Spannung zwischen den beiden Persönlichkeitsanteilen zu. Der männliche Persönlichkeitsanteil „Oliver“ mußte sich durch die Option einer Geschlechtsumwandlung akut bedroht gefühlt haben. Diese nicht symbolisierbare, daher nicht zur Sprache bringbare Bedrohung reinszenierte der Patient in einer realen sadomasochistischen Begegnung, in dem er eine Domina-Prostituierte aufsuchte. Darüber hinaus kann dies auch ein Reinszenierren andrängender Erinnerungen real erlebter Kindheitstraumata sein. Auf diesem Hintergrund stellt die Gewalttat eine Rachehandlung für die erlittenen oder befürchteten Traumatisierungen dar. Der Verlauf dieses Falles entspricht im übrigen den Komplikationen, die in der Literatur als typisch für die Psychotherapie bei nicht erkannten Dissoziativen Störungen hervorgehoben werden, nämlich (1) schwere psychische Krisen (suizidale Episoden, Selbstbeschädigungen, psychotische Auslenkungen) und (2) Reinszenierungen erlittener Realtraumatisierungen im therapeutischen wie nicht-therapeutischen Raum (Spitzer & Freyberger 1997). Auch diese Komplikationen verweisen nachdrücklich auf die hier wiederholt betonte Differentialdiagnostik, da die therapeutischen Maßnahmen sich zum Teil deutlich unterscheiden. 142 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Ausblick Aus dem dramatischen Verlauf dieses Falles ergibt sich für uns die Konsequenz, in unser Untersuchungsprogramm bei Patienten mit Geschlechtsidentitätsstörungen (Becker & Hartmann 1994) eine Erfassung Dissoziativer Störungen zu integrieren. Als ScreeningInstrument steht hier die deutsche Übersetzung der “Dissociative Experience Scale“ (DES) (Bernstein & Putnam 1992) in Form des „Fragebogens für Dissoziative Störungen“ (FDS) von Spitzer et. al. (1996) zur Verfügung. Zur Validierung empfiehlt sich das halbstrukturierte SCID-D-Interview (Structured Clinical Interview for Dissociative Disorders) von Steinberg (1994), die deutsche Überarbeitung befindet sich im Druck (Gast et al. voraussichtlich 1999). Mit Anwendung eines operationalisierten Meßinstruments kann man die Kernsymptomatik der DID relativ sicher erfassen und auch eine Abgrenzung zu solchen dissoziativen Symptomen vornehmen, die häufig bei Borderline-Störungen oder auch bei histrionischen Persönlichkeitsstörungen auftreten, wie dies beispielsweise von Tölle (1997) diskutiert wird. Bei Patienten mit Störungen der Geschlechtsidentität ist grundsätzlich eine Komorbidität von dissoziativen Phänomenen und anderen Störungsbildern zu berücksichtigen. Eine kompetente und sorgfältige Differentialdiagnostik ist notwendig, da die verschiedenen Störungen – zu bedenken sind v.a. Psychosen, Schizotypische, Dissoziative und Borderline-Persönlichkeitsstörungen – sehr unterschiedliche Behandlungsmaßnahmen erfordern (Fiedler 1997) und Fehldiagnosen sehr ungünstige Auswirkungen haben können. Läßt sich die Diagnose einer Dissoziativen Identitätsstörung bestätigen, hat dies wichtige Konsequenzen, da sie sich als eine in der Regel behandelbare Störung herausgestellt hat. Als Therapie der Wahl ist eine Psychotherapie nach den „Richtlinien der Internationalen Gesellschaft für Dissoziative Störungen“ (ISSD 1994) sinnvoll und durchaus erfolgversprechend. Die Behandlung zielt darauf ab, eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufzubauen, in der der Patient Zugang zu seinen abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen bekommen kann. Im nächsten Schritt wird die Rekonstruktion und Integration der traumatischen Erfahrungen angegangen, die zu den Aufspaltungen der Persönlichkeiten geführt hat. Erst nach erfolgter Integration der verschiedenen Persönlichkeitsanteile ist eine Wiedereingliederung in normale Lebensbezüge möglich. Obwohl es mittlerweile für die Dissoziative Identitätsstörung erfolgsversprechende Behandlungskonzepte gibt, muß in diesem Fall (Herr B.) die Prognose aufgrund der extrem hohen Verleugnungshaltung als eher ungünstig angesehen werden. Das Risiko eines erneuten Impulsdurchbruches durch Selbstverletzung oder Fremdgefährdung ist bei Herrn B. vermutlich weiterhin gegeben2. Anmerkungen Siehe dazu die Ausführungen von Bliss und Larson (1985), die die Möglichkeit einer Schutzbehauptung thematisieren. 2 Wir danken dem ärztlichen Direktor des Nds. Landeskrankenhauses Herrn Dr. Schott für die freundliche Überlassung der ärztlichen Berichte. 1 Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 143 Literatur Akthar, S.; Thomson, J.A.(1980): Schizophrenia and Sexuality. A Review and a Report of Twelve Unusual Cases – Part I. J Clin Psychiatry 41/4: 134–142. American Psychiatric Association (ed) (1980): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III). Washington DC, deutsch, Weinheim, Basel: Beltz Verlag, deutsche Ausgabe 1984. American Psychiatric Association (ed.) (1989): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III-R). Washington DC, deutsch Weinheim, Basel: Beltz Verlag, deutsche Ausgabe 1989. American Psychiatric Association (ed.) (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-sorders (DSM IV). Washington DC, deutsche Bearbeitung von Saß, H.; Wittchen, H.U.; Zaudig, M.; Houben, I.: Diagnostische Kriterien DSM-IV. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag, deutsche Ausgabe 1998. Becker, S.; Bosinski, H.; Clement, U; Eicher, W.; Goerlich, T.; Hartmann, U.; Kockott, G.; Langer, D; Preuss, W.; Schmidt, G; Springer, A.; Wille, R. (1997): Standards der Behandlung und Begutachtung von Transsexuellen. Sexuologie 4: 130-138. Becker, H.; Hartmann, U. (1994): Geschlechtsidentitätsstörungen und die Notwendigkeit der Klinischen Perspektive. Fortschr Neurol Psychiatrie 8: 290-395. Bernstein, C.E.M.; Putnam, F.W. (1992): Manual for the Dissociative Experience Scale. Unveröffentlichtes Manuskript, Department of Psychology, Beloit College, Beloit, WI 53511. Bliss, E.L.; Larson, E.M. (1985): Sexual Criminality and Hypnotizability. J Nerv Ment Dis 173 (9): 522-526. Boon, S.; Draijer, N. (1993): Multiple personality disorder in the Netherlands: A clinical investigation of 71 cases. Am J Psychiatry 150: 489-494. Von Braunsberg, M.J. (1994): Multiple personality disorder: An investigation of prevalence in three populations (Doctoral dissertation, Syracuse University). Dissertation Abstracts International (University Microfilms Nr. ADG94-08430). Chu, J.A.; Dill, D.L. (1990): Dissociative Symptoms in Relation to Childhood Physical and Sexual Abuse. Am J Psychiatry 147 (7): 887-892. Commmander, M.; Dean, C. (1990): Symptomatic transsexualism. Br J Psychiatry 156: 894-896. Coons, P.M.; Bowman, E.S.; Milstein, V. (1988): Multiple personality disorder. A clinical investigation of 50 cases. J Ment Dis 176: 519-527. Devor, H. (1994): Transsexualism, Dissociation, and Child Abuse: an initial Discussion based on Non-clinical Data. J Psychol Hum Sex 6: 49-72. Eckhardt, A., Hoffmann, S.O. (1997): Dissoziative Störungen. In: Egle, U.T.; Hoffmann, S.O.; Joraschky, P. (Hg) Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung. Vernachlässigung. Erkennen und Behandlung psychischer und psychosomatischer Folgen von Traumatisierungen. Stuttgart: Schattauer Verlag: 225-236. Ellenberger, H.F. (1996): Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Zürich: Diogenes Verlag. Fiedler; P. (1997): Dissoziative Identitätsstörung, multiple Persönlichkeit und sexueller Mißbrauch in der Kindheit. In: Amann G., Wipplinger R. (Hg.) Sexueller Mißbrauch. Tübingen: DGVT-Verlag Gast, U.; Zündorf, F.; Oswald, T. (im Druck, voraussichtlich 1999): Strukturiertes Klinisches Interview für Dissoziative Störungen. Übersetzung und Bearbeitung des „Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders“ (SCID-D), Revised. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1985, 1993, 1994, siehe auch Steinberg (1994), Göttingen: Hogrefe Verlag. Gittleson, N.L.; Levine, S. (1966): Subjective Ideas of Sexual Change in Male Schizophrenics. Br J Psychiatry 112: 779-782. Gleaves, D.H. (1996): The Sociocognitive Model of Dissociative Identity Disorder: A Reexamination of the Evidence. Psychol Bull: 42-59. Hirschfeld, M. (1923): Die intersexuelle Konstitution. Jahrbuch f sex Zwischenstufen 23: 3-27. 144 H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer Hoenig, J.; Kenna, J.C. (1974): The Nosological Position of Transsexualism. Arch Sex Behav 3: 273287 Huber, M. (1995): Multiple Persönlichkeiten. Überleben extremer Gewalt. Handbuch. Frankfurt a.M.: Fischer Verlag. ISSD = International Society for the Study of Dissociation (1994): ISSD Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorders (Multiple Personality Disorder) in Adults. Northbrook, IL USA: http://www.issd.org. Kluft, R. (1996): Introduction to the Diagnosis and Treatment of DID. Unveröffentlichtes Manuskript zum Workshop am 07.11.1996 anläßlich der ISSD-Fall-Konferenz in San Francisco, USA Kramer, M.; Sartorius, N.; Jablensky, A.; Guilinat, W. (1979): The ICD-9 classification of mental disorders: A review of ist development and contents. Acta Psychiat Scand 59: 241-262. Langer, D. (1985): Transsexuelle: Eine Herausforderung für Kooperation zwischen psychologischer und chirurgischer Medizin. Fortschr Neurol Psychiatrie 53: 67-84. Langer, D.; Hartmann, U. (1997): Psychiatrische Begutachtung nach dem Transsexuellengesetz: Ein erfahrungsgestütztes Plädoyer für Leitlinien und gegen Beliebigkeit. Nervenarzt 68: 862-869 Laszig, P.; Knauss, W.; Clement, U. (1995): Psychotherapeutische Begleitung einer transsexuellen Entwicklung. Z Sexualforsch 8: 24-38. Lothstein, L.M. (1977) Psychotherapy with Patients with Gender Dysphoria Syndromes. Bull Menninger Clin 41 (6): 563-582. Lothstein, L.M. (1979): Psychodynamics ans Sociodynamics of Gender-Dysphoric States. Am J Psychother 33 (2): 214-239. Mate-Kole, C.; Freschi, M. (1988): Psychiatric Aspects of Sex Reassignment Surgery. Br J Psychiatry 2: 153-155. Modestin, J., Ebner, G. (1995): Multiple Personality Disorder Manifesting itself under the Mask of Transsexualism. Psychopathology: 317-321. Morgenthaler, F. (1974): Die Stellung der Perversionen in Metapsychologie und Technik. Psyche 28: 1077-1098. Newman, L.E.; Stoller, R.J. (1974): Nontranssexual Men Who Seek Sex Reassignment. Am J Psychiatry 131/4: 437-441. Overkamp, B.; Hofmann, A.; Huber, M.; Dammann, G. (1997): Dissoziative Identitätsstörung (DIS)eine Persönlichkeitsstörung? Persönlichkeitsstörungen 2: 74-84. Ross, C.A. (1991): The Epidemiology of Multiple Personality Disorder and Dissociation. Psychiat Clin N Am 14: 503-517. Ross, C.A (1997): Dissociative Identity Disorder. Diagnosis, Clinical Features and Treatment of Multiple Personality. New York: Wiley. Ross, C.A.; Anderson, G.; Fleisher, W.P.; Norton, G.R. (1991): The frequency of multiple per-sonality disorder among psychiatric patients. Am J Psychiatry 148: 1717-1720. Ross, C.A.; Joshi, S.; Currie, R. (1990): Dissociative experiences in the general population. Am J Psychiatry 147: 1547-1552. Saks, B. (1998): Transgenderism and Dissociative Identity Disorder – a Case Study. Int J Transgenderism 2: http://www.symposium.com/ijt/ijtc0404.htm. Saxe, G.N.; Kolk, B.A.; van der Berkowitz, R.; Chinman, G.; Hall, K.; Leiberg, G.; Schwartz, J. (1993): Dissociative disorders in psychiatric inpatients. Am J Psychiatry 150: 1037-1042. Schwartz, P.G. (1988): A Case of Current Multiple Personality Disorder and Transsexualism. Dissiciation 1 (2): 48-50. Sørensen, T.; Hertoft, P. (1982): Male and Female Transsexualism: The Danish Experience with 37 Patients. Arch Sex Behav 11(2): 133-144. Spitzer, C.; Freyberger, H.J.; Kessler, C. (1996): Hysterie, Dissoziation und Konversion. Eine Übersicht zu Konzepten, Klassifikation und diagnostischen Erhebungsinstrumenten. Psychiat Prax 23: 63-68. Spitzer, C.; Freyberger, H.J. (1997): Diagnostik und Behandlung Dissoziativer Störungen. Psychotherapie 2: 83-90. Zum Zusammenhang von transsexuellem Empfinden und Dissoziativer Identitsstörung 145 Steinberg, M. (1994): Handbook for the Assessement of Dissociation. A Clinical Guide. Washington D.C.: American Psychiatric Press. Tölle, R. (1997): Persönlichkeitsvervielfältigung? Die sogenannte multiple Persönlichkeit oder Dissoziative Identitätsstörung. Deutsch Ärzteblatt 27:94. Volkan, V.D.; Berent, S. (1976): Psychiatric Aspects of Surgical Treatment for Problems of Sexual Identification (Transsexualism). In: Howells JG (ed.) Modern Perspectives in the Psychiatric Aspects of Surgery. New York: Brunner/Mazel, 447-467. Anschrift der Autoren H. Becker, U. Gast, U. Hartmann, M. Weiß-Plumeyer, Medizinische Hochschule Hannover, Abteilung Klinische Psychiatrie und Psychotherapie, OE 7180, 30623 Hannover, e-mail: [email protected] Originalarbeiten Sexuologie Partnerwahl und Sexualverhalten Partner Selection and Sexual Behavior H. Keller Zusammenfassung Ausgangspunkt der hier angestellten Überlegungen ist die Betrachtung des sexuellen Verhaltens des Menschen als Ausdruck einer Reproduktionsstrategie. Auf dem Hintergrund soziobiologischer Modellannahmen wird der Beginn der Pubertät, der Beginn des sexuellen Verhaltens sowie das Reproduktionsverhalten (Anzahl, Geschlecht und Geburtsabstände der Nachkommen) als Lebenslaufstrategie verstanden, die sich als Konsequenz der frühen Sozialisationsumwelt entwickelt und ihrerseits Konsequenzen auf die Gestaltung der Sozialisationsumwelt für die Nachkommen, insbesondere die Qualität des Elternverhaltens (elterliche Investition) ausüben. Obwohl bisher keine umfassenden empirischen Belege vorliegen, können doch verschiedene Zusammenhangsmuster innerhalb der Reproduktionsstile nachgewiesen werden. Dazu werden verschiedene Untersuchungen referiert, die insgesamt den Schluß zulassen, daß der Reproduktionsstil Ausdruck der in der Kindheit erworbenen Beziehungen sind. Schlüsselwörter: Evolution, Lebenslaufstrategie, Reproduktion, Pubertät, elterliche Investition Abstract The considerations presented here start with the assumption that the sexual behavior of humans is the expression of a reproductive strategy. Based in socio-biological theorizing the onset of puberty, the begin of sexual behavior and the reproductive behavior (number, sex, and spacing of offspring) is understood as a life history strategy which is conceptualized as a consequence of the early socialization milieu. The life history strategy exerts influence on the attempt to socialize the own offspring, especially in terms of parenting behavior (parental investment). Although comprehensive empirical data are lacking, nevertheless different patterns defining reproductive styles can be reconstructed. Data from different studies are reported which allow the conclusion that the reproductive style is the expression of the relationship patterns acquired during early childhood. Keywords: Evolution, Life History Strategy, Reproduction, Puberty, Parental Investment 1. Evolutionsbiologische Modellannahmen: Theoretische Einführung Wenn in der Öffentlichkeit von Sexualität bzw. sexuellem Verhalten die Rede ist, wird zumindest in unserer Kultur - eher selten auf die reproduktive Funktion im Lebenslauf bezug genommen. Geht es um Reproduktion, werden z. B. Probleme bei der Realisierung des Kinderwunsches thematisiert, medizin-technische Entwicklungen diskutiert oder über die „Psychologie des Sexualaktes“ philosophiert. Eine Betrachtung des sexuellen Verhaltens im Kontext von Lebenslaufstrategien ist daher eher ungewöhnlich. Genau darum geht es aber in dem hier vorgelegten Beitrag: Sexuelles Verhalten wird als Ausdruck einer Lebenslaufstrategie verstanden. Lebenslaufstrategien werden aus soziobiologischer Sicht („life history strategies“, Schmid-Hempel 1992) als der in der Phylogenese Sexuologie 6 (3) 1999: 146-157 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie Partnerwahl und Sexualverhalten 147 evolvierte Ablauf von Phasen der menschlichen (und auch tierlichen ) Biographie verstanden, die Anpassungswert aufweisen bzw. als angepaßt gelten können. Die genetische Disposition für solche Lebenslaufstrategien ist, wie alle genetischen Dispositionen, von der natürlichen Selektion auf die Maximierung des Reproduktionserfolgs modelliert worden. Diese Anpassung hat Angepaßtheit an soziale und ökologische Lebensbedingungen zur Folge (Voland 1993: 347). Die genetische Reproduktion kann in der Gesamtfitneß eines Individuums ausgedrückt werden („inclusive fitness“, Hamilton 1964), die sich aus den eigenen Nachkommen, die ihrerseits wiederum Geschlechtsreife erreicht haben, und den genetisch verwandten Deszendenten (also z.B. Nachkommen von Geschwistern) zusammensetzt. „Optimal“ bedeutet dabei „[...] best available given existing constraints not best imaginable“ (Chisholm 1996: 10; s. auch Hammer 1997). Die Personen, die als Phänotypen an bestimmte Kontextbedingungen angepaßt sind, können dabei modellhaft als Träger der Gene aufgefaßt werden (Dawkins 1976: „carrier of genes“). Auf einer allgemeinen Ebene werden kontextuelle Bedingungen durch die Mortalitätsraten, spezifiziert nach Säuglings- und Kindersterblichkeit einerseits und Erwachsenensterblichkeit andererseits, die in einem bestimmten Lebensraum auftreten, definiert. In Abhängigkeit solcher kontextueller Bedingungen, die im folgenden noch genauer spezifiziert werden, sind reproduktive Entscheidungen zu fällen, die eine optimale Balance zwischen Investitionen in eigenes Wachstum und eigene Entwicklung sowie Investitionen in Reproduktion herstellen sollen (Kosten-Nutzen-Relation zwischen gegenwärtiger und zukünftiger Reproduktion; Stearns 1992). Generell kann aus verschiedenen Untersuchungen die Schlußfolgerung gezogen werden, daß eine vergleichsweise niedrige Lebenserwartung mit einer höheren Geburtenrate kovariiert. Dies haben z. B. Wilson und Daly (1997) für verschiedene Stadtgebiete Chicagos nachgewiesen, Chisholm (1993) für amerikanische College-Student/innen oder Bereczkei (1993) für ungarische Zigeuner (s. dazu auch Hill, Ross & Low 1997). Die Notwendigkeit von Allokationsentscheidungen ist durch die in der genetischen Reproduktion begründeten Endlichkeit des menschlichen Lebenslaufs festgelegt. Die zentralen Schaltstellen werden dabei durch den Zeitpunkt des Beginns der Reproduktion sowie der Verteilung der Nachkommen auf die Lebenszeit gebildet. In der Literatur werden im wesentlichen zwei investive Entscheidungen differenziert, die den Aufwand, der in die Partnersuche eingeht, und die parentalen Investitionen in komplementäre Beziehung zueinander setzen. Die Entscheidungen basieren dabei auf impliziten Kosten-Nutzen-Abwägungen, denen intuitive Verrechnungen zugrunde liegen, in dem Sinne, als ob die Individuen ihr Verhalten an der Optimierung der Gesamtfitneß ausrichten würden. Parentale Investition bedeutet dabei die Entscheidung für die Investition von Zeit und Energie in (wenige) Nachkommen. Die Fokussierung auf den Aufwand, der für Partnerwahl(en) getrieben wird („mating effort“), soll zur Entscheidung für eine größere Anzahl von Nachkommen (vielleicht sogar mit verschiedenen Partnern) führen mit entsprechend geringerer Investition in das einzelne Kind. Im Tierreich, wofür ja die soziobiologischen Modellannahmen zunächst formuliert wurden, sind zwei Reproduktionsstrategien identifiziert worden, die dieser Differenzierung Rechnung tragen: die sog. r-Selektion für die Wachstumsrate und die K-Selektion für die Tragekapazität des Biotops (Pianka 1970). Das Mortalitätsprofil eines Kontextes konstituiert demnach verschiedene Selektionsbedingungen, die zur Ausbildung entsprechender Strategien führen, die Anpassungswert besitzen. Wir haben bereits auf den Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Gebur- 148 H. Keller tenrate verwiesen. In einer unvorhersagbaren Umgebung (r-Selektion) variiert die Sterbewahrscheinlichkeit nicht systematisch zwischen den Phänotypen (unvorhersagbare Bedingungen können sozusagen jeden treffen), so daß die optimale Weitergabe der Gene nicht durch eine Spezialisierung des Phänotyps geleistet wird, sondern durch schnelle und zahlreiche Reproduktion. In einer vorhersagbaren Umwelt (K-Selektion) spielt dagegen die Spezialisierung des Phänotyps eine entscheidende Rolle zur Vermeidung von Lebensrisiken und der Akquisition der in der Umwelt vorhandenen Ressourcen. Insofern ist der Planung der Lebenslaufstrategie und der Vorbereitung der Nachkommen auf die reproduktiven Aufgaben ein hoher Stellenwert beizumessen (vgl. Voland 1993; Chisholm 1996; Hammer 1997; Chasiotis 1998b). Mit der r-Selektion einhergehend sind eine schnelle Entwicklung, eine geringe Körpergröße, ein früher Beginn der Reproduktion, kurze Geburtenintervalle und eine insgesamt kurze Lebensspanne. Die K-Selektion bringt entsprechend größere Individuen mit langsamerer Entwicklung, mit einem späteren Beginn der Reproduktion, größeren Geburtenintervallen und einer insgesamt längeren Lebensspanne hervor. In der Anwendung dieser soziobiologischen Grundmuster auch auf das menschliche Verhalten werden eher quantitative und qualitative Reproduktionsstile unterschieden, die die intraartliche Variation des grundsätzlichen K-Strategen Homo Sapiens ausdrücken sollen. Das Konzept der Lebenslaufstrategie impliziert die für den Menschen eher ungewohnte Vorstellung, daß der gesamte biographische Ablauf in erster Linie dem reproduktiven Zweck dient. Das bedeutet, daß auch bereits während der Kindheit Weichenstellungen für reproduktive Entscheidungen getroffen werden. Es ist also nicht das erwachsene Individuum, das als Ergebnis der menschlichen Evolution aufgefaßt werden muß, sondern der gesamte Verlauf des Lebenslaufes. Entsprechend sind evolutionäre Sozialisationsmodelle formuliert worden, die unterschiedliche Entwicklungspfade konzeptionalisieren (Belsky et al. 1991; Chisholm 1993; Keller 1996; Chasiotis 1998a; Keller & Eckensberger 1998). In diesen Sozialisationsmodellen wird dem Kindheitskontext, bestehend aus der Ressourcenlage, dem sozial-emotionalen Klima in der Familie und dem entsprechenden elterlichen Investitionsverhalten in termini der Fürsorge und Anregung, die somatische Konsequenz des Zeitpunktes des Eintritts in die Pubertät zugeschrieben. Damit ist eine erste biologische (reproduktive) Markervariable definiert. Die Schaltstelle, an der die frühen Kontexterfahrungen prädiktiv für den resultierenden Pubertätsbeginn werden, ist nach dieser Auffassung die Bindungs- bzw. Beziehungsqualität, die nach orthodoxer bindungstheoretischer Auffassung mit etwa einem Jahr ausgebildet ist (vgl. Bowlby 1969; Ainsworth et al. 1978). Inzwischen liegt allerdings empirische Evidenz dafür vor, daß ein erstes Beziehungsergebnis bereits im Alter von 3 Monaten konstatiert werden kann (Zach 1997; Keller et al. 1998 im Druck). Die Erfahrung einer schlechten Ressourcenlage, gepaart mit einem kalten und unfreundlichen Familienklima, ehelichen Schwierigkeiten der Eltern und einer insensitiven bis vernachlässigenden Pflege (geringe parentale Investition), führt zur Ausbildung einer unsicheren Bindungsqualität an die primären Bezugspersonen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten und -problemen in der Kindheit erhöht, und zwar in geschlechtsspezifischer Weise: Mädchen tendieren unter diesen Bedingungen eher zur Ausbildung internalisierender Entwicklungsprobleme, Junge zu externalisierenden Entwicklungsproblemen und -störungen. Ein solcher Verlauf der Kindheit begünstigt einen frühen Eintritt in die Pubertät, an den sich eine eher quantitativ orientierte Reproduktionsstrategie anschließen Partnerwahl und Sexualverhalten 149 sollte mit entsprechend frühem Beginn sexuellen Verhaltens, instabilen Partnerschaften, früherem Erstgeburtsalter und insgesamt mehr Kindern. Das elterliche Verhalten dieser Individuen gegenüber den eigenen Nachkommen würde eine ebenfalls geringere Investition erkennen lassen und so zu einer transgenerationellen Kontinuität führen, wobei in der Filialgeneration der Reproduktionsstil übernommen werden sollte, den der gleichgeschlechtliche Elternteil aufweist. Dies gilt natürlich nur unter der Bedingung einer intergenerationellen Kontextstabilität. Der zweite angenommene Typus ist durch eine gute Ressourcenlage mit entsprechender elterlicher (und ehelicher) Harmonie und einem fürsorglichen und unterstützenden Familienklima (hohe parentale Investition) gekennzeichnet. Dieser Kindheitskontext soll dazu führen, daß sichere Bindungsbeziehungen zu den primären Bezugspersonen ausgebildet werden, die wiederum die Konsequenz eines späteren Pubertätseintritts begünstigen mit entsprechend qualitativen Stilelementen, das heißt späterem Beginn der Aufnahme sexueller Beziehungen, stabilen (und wenigen) Partnerschaften, späterem Erstgeburtsalter, weniger Kindern, die wiederum mehr elterliche Investitionen erfahren. Mit dieser Konzeptionalisierung wird die somatische Entwicklung als Konsequenz früher sozialisatorischer (psychologischer) Erfahrungen konzeptionalisiert, was zumindest in der Entwicklungspsychologie die Tatsachen sozusagen „auf den Kopf stellt“, da es dort bisher in erster Linie darum ging, psychologische Konsequenzen eines frühen oder späten Pubertätsbeginns zu untersuchen (vgl. z. B. Silbereisen & Schmitt-Rodermund 1998), unabhängig davon, wie dieser zustande kommt. Es ist evident, daß auch die Partnerwahl, und zwar eines solchen Partners, mit dem reproduktive Ziele verfolgt werden (sollen), ein kritisches Datum im lebenslaufstrategischen Ablauf darstellt. Das biologische Konzept des „mating effort“ (Voland 1993) beinhaltet die zunächst kontrafaktische Annahme, daß der Aufwand nicht primär auf die Auswahl eines geeigneten Partners gelegt wird, sondern in den Zugang zu (möglichst vielen) Sexual-/Reproduktionspartnern. In bezug auf menschliches Partnerwahlverhalten sind besonders die als kulturunspezifisch interpretierten geschlechtstypischen Partnerwahlpräferenzen untersucht worden (z. B. Kenrick & Keefe 1992; Buss 1994). Dabei wurde allerdings in methodisch sehr oberflächlichen und auch entsprechend kritisierten (s. Buss 1989 und daran folgende Kommentare), dafür gigantisch angelegten kulturvergleichenden Untersuchungen festgestellt, daß Männer in der Partnerwahl eher Wert auf solche Eigenschaften legen, die ein gutes Reproduktionspotential der Partnerin signalisieren, wie gutes Aussehen und Jugendlichkeit (besonders auch das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang - unabhängig vom Gewicht - scheint eine intuitiv erfaßte „Kenngröße“ darzustellen). Frauen dagegen legen Wert auf die Versorgungsqualitäten des potentiellen Partners, indem sie Intelligenz, Karrierepotential und eine gute ökonomische Situation hoch bewerten. Bei aller Betonung der Unterschiede in den meist mit Hilfe von Adjektivlisten erstellten Profilen ist dennoch evident, daß Ähnlichkeit das hervorstechende Merkmal der Partnerwahl ist (vgl. auch Endogamieprinzip, das auch in der Mehrzahl psychologischer Untersuchungen bestätigt wird: „gleich und gleich gesellt sich gern“). Frauen wie Männer suchen (zumeist natürlich implizit und nicht bewußt) nach Partnern, die ihnen ähnlich sind. Ähnlichkeit impliziert aus psychologischer Sicht, daß man den anderen eher verstehen kann und sein Verhalten, insbesondere seine Kooperationsbereitschaft und Verläßlichkeit einschätzen und vorhersagen kann. Nicht umsonst wird auch in arrangierten Ehen, die übrigens zahlenmäßig in der Weltbevölkerung den selbstgewählten Partnerschaften weit überlegen sind (Wickler & Seibt 1990), primär 150 H. Keller Wert auf die Passung in die Familie („matching“) gelegt (Keller & Eckensberger 1998). Entsprechend den Differenzierungen, die durch eine eher quantitative oder eher qualitative Ausrichtung der übernommenen Reproduktionsstrategie nahegelegt werden, kann entsprechend auch vermutet werden, daß mehr oder weniger Wert auf die Auswahl der Persönlichkeit des (Reproduktions-)Partners, insbesondere in bezug auf die verschiedenen Dimensionen der Ähnlichkeit und Passung, gelegt wird. Im Gegensatz zu der klassischen soziobiologischen Auslegung würde damit ein hoher Paarungsaufwand nicht Zugang zu vielen Reproduktionspartnern bedeuten, sondern sorgfältige Auswahl eines passenden Partners. Überhaupt ist, auch aufgrund der erst jungen Rezeptionsgeschichte der Soziobiologie in der Psychologie, die empirische Datenlage längst nicht so umfangreich, als daß die vorgestellten Sozialisationspfade als eindeutig nachgewiesen gelten können. Die bisher vorliegenden Ergebnisse sind vielmehr „patchwork-artig“, indem unterschiedliche Teilaspekte der Strategien untersucht wurden. Insgesamt sind sie jedoch so ermutigend, daß wir sie hier zusammenfassen möchten. 2. Empirische Zusammenhänge 2.1. Frühkindliche Erfahrungen und Bindungsmuster Ohne daß wir hier auf die notwendige Komplexität der Forschungssituation zur frühen sozial/emotionalen Entwicklung bzw. der Entwicklung von Bindungs- und Beziehungsmustern eingehen können, kann doch zusammenfassend konstatiert werden, daß die frühkindlichen Sozialisationsbedingungen einen bedeutsamen Einfluß auf die Ausbildung von Beziehungs- bzw. Bindungsqualität aufweisen. Insbesondere das elterliche, meist mütterliche Interaktionsverhalten in der Mischung seiner Komponenten der prompten Reagibilität (Kontingenz) und Wärme hat einen bedeutsamen Einfluß (Chasiotis 1998a; Völker et al. 1998 im Druck) auf die Beziehungsentwicklung bzw. auf die damit einhergehende Konstituierung eines Konzepts von sich Selbst (Keller et al. 1998 im Druck). Die prompte Reaktion auf positive und negative kindliche Interaktionssignale in einem Zeitfenster von weniger als einer Sekunde Latenzzeit (Kontingenz) wirkt sich auf die Beziehungssicherheit des Kindes aus. Es macht die Erfahrung, daß die Bezugsperson verläßlich ist und daß das eigene Verhalten Konsequenzen hat. Beides wirkt sich auf die Entwicklung einer Handlungsinstanz („agency“) aus (vgl. Keller et al. 1998 in Druck; Völker et al. 1998 in Druck). Die frühe Erfahrung von Wärme wirkt sich insbesondere auf interpersonale Bezogenheit, Empathie und soziale Konformität aus. Das Selbst des Kindes wird zunächst aus der Mischung dieser Komponenten konstituiert. Die Konstatierung dieser Zusammenhänge ist nicht zwingend mit evolutionsbiologischen Modellannahmen verknüpft, wobei jedoch die Bindungsqualität in evolutionären Sozialisationsmodellen eine wichtige Rolle spielt (vgl. Chisholm 1996; Belsky 1997). 2.2. Beziehungsqualität und Problemverhaltensweisen Neben der generellen Aussage, daß insensitives und dysfunktionales elterliches Verhalten während der ersten Lebensmonate das Auftreten von Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensproblemen in der Vorschulzeit begünstigt (Keller & Zach 1991), sind auch geschlechtsspezifische Zusammenhänge zwischen der Bindungsqualität mit 1 Jahr und spä- Partnerwahl und Sexualverhalten 151 teren Verhaltensproblemen aufgewiesen worden (s. zusammenfassend Abram 1996). Eine unsichere Bindung geht dabei einher mit externalisierenden Verhaltensproblemen bei Jungen, z. B. Aggressivität, während Mädchen mit unsicherer Bindung dazu neigen, internalisierende Verhaltensprobleme zu entwickeln, wie z. B. Depressivität. Allerdings sind die Ergebnisse nicht immer in der postulierten Ausrichtung vorgefunden worden. So sind es z. B. internalisierende Probleme bei Jungen, die mit Pubertätsmarkern in Beziehung stehen (Chasiotis 1998a). 2.3. Frühkindliche Sozialisationsbedingungen und das Einsetzen der Geschlechtsreife In verschiedenen Untersuchungen in den letzten Jahren, auch in unserer Osnabrücker Arbeitsgruppe, wird versucht, die Qualität des Kindheitskontextes mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife in Beziehung zu setzen. Zunächst ist festzustellen, daß grundsätzliche Bestätigungen mit unterschiedlichen methodischen Zugängen für verschiedene Kulturen aufgewiesen worden sind; z. B. Dominikanische Republik (Flinn & England 1995), USA (Graber et al. 1995), Ungarn (Bereczkei & Czanaky 1996), Deutschland, Griechenland, Großbritannien (Chasiotis et al. 1997; Chasiotis 1998a), Italien (Kim et al. 1997), Neuseeland (Moffit et al. 1992). Da die Menarche als Beginn der Pubertät eindeutiger feststellbar und möglicherweise auch erinnerbarer ist als die entsprechenden Parameter des männlichen Pubertätsbeginns (Wachstumsschubs, Stimmbruch und Spermarche), liegen mehr Untersuchungsergebnisse zu weiblichen als zu männlichen Sozialisationspfaden vor. Chasiotis (1998a) hat 482 Frauen aus drei Ländern (BRD: N = 340, Griechenland: N = 92 und Großbritannien: N = 50) mit einem Fragebogen untersucht, der nach den Konzepten des Sozialisationsmodells von Belsky und Mitarbeiter (1991) entwickelt worden war und an verschiedenen strukturellen sowie qualitativen Parametern validiert worden war. Als Zusammenfassung des Familienklimas in der Kindheit definierte er - wie verschiedene andere Forscher auch - Scheidung der Eltern, wobei er hier noch einmal verschiedene Zeitpunkte des Auftretens der Scheidung unterschied. Es zeigte sich, daß in allen drei kulturellen Gruppen diejenigen Frauen, deren Eltern sich während der ersten fünf Lebensjahre scheiden ließen, eine signifikant frühere Menarche aufwiesen. In einer deutschen Teilstichprobe wurde die Menarche für diese Gruppe von Scheidungskindern als 11 Monate früher angegeben als bei Nicht-Scheidungskindern. Auch an 175 Männern der genannten kulturellen Gruppen (BRD: N = 89, Griechenland: N = 41, Großbritannien: N = 45) konnte dieser Zusammenhang für den Parameter des Einsetzens des Stimmbruchs (allerdings nicht für das Spermarchealter) bestätigt werden (13 Monate früher bei Jungen, deren Eltern sich in den ersten fünf Lebensjahren hatten scheiden lassen). In einer vergleichenden Untersuchung verschiedener Generationen in den alten und neuen deutschen Bundesländern (N = 208 Osnabrücker, N = 150 Hallenser) konnten Chasiotis und Mitarbeiter (1998) für beide Geschlechter und beide Stichproben die erwarteten Zusammenhänge bestätigen. In dieser Untersuchung war es zudem möglich, die Bedeutsamkeit genetischer (d. h. der entsprechenden Zeitangaben des Pubertätsbeginns der Eltern- und Kindgeneration) und kontextueller Faktoren gegeneinander abzuwägen. Es zeigte sich, allerdings nur für die westliche Stichprobe, daß eine feste genetische Verankerung auszuschließen ist. Damit wid die Bedeutung des Kindheitskontextes für das Einsetzen reproduktiver Markervariablen bestätigt. 152 H. Keller Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, daß - modellkonform - psychosozialer Streß in früher Kindheit zu einer Akzeleration des Pubertätsbeginns führt - im Gegensatz zu ökologischem Streß wie Hunger, Krankheit, extreme physische Belastung usw., die den Beginn verzögern (Tanner 1978; Graber et al. 1995; Keller 1996; Chasiotis 1998a). 2.4. Kindheitskontext und weitere reproduktive Marker Chasiotis (1998a) hat in seiner Dissertation weibliche und männliche Entwicklungspfade an der o. a. Osnabrücker Stichprobe rekonstruiert. Der weibliche Entwicklungspfad kann demnach so beschrieben werden, daß eine schlechte finanzielle Situation in der Kindheit zu einem schlechten Familienklima beiträgt, woraufhin sich internalisierende Verhaltensprobleme einstellen, die wiederum das Menarchealter beschleunigen. Das frühe Menarchealter trägt zu einem schlechten Familienklima in der Pubertät bei, was mit einer höheren Zahl von Sexualpartnern in Beziehung steht. Eine höhere Anzahl von Sexualpartnern hängt mit einem früheren Erstgeburtsalter zusammen, was eine längere Reproduktionsspanne mit einer größeren Anzahl von Kindern bedingt (vgl. Abb. 1). Sozialisationsfaktoren (Beta-Werte) Finanzielle Situation in der Kindheit .35* Reproduktive Marker der Tochter Reproduktive Marker der Mutter Adjusted r2 der Regressionsmodelle Menarchenalter .59** Arbeitslosigkeit Internalisieren Externalisieren der Eltern in der Pubertät in der Kindheit -.50** -.50** .31(*) Erstgeburtsalter (n.s.) Menarchenalter Erstgeburtsalter .33** .44** Abb. 1: Zusammenfassende Darstellung der Regressionsanalysen intergenerationeller und sozialisatorischer Einflüsse auf die weiblichen reproduktiven Marker Menarche- und Erstgeburtsalter (In: Chasiotis 1998a: 180) Entspricht der weibliche Entwicklungspfad damit weitgehend den in den evolutionären Sozialisationsmodellen formulierten Annahmen, so ist festzustellen, daß der männliche Entwicklungspfad erhebliche Abweichungen aufweist (Chasiotis 1998a: 240f). Eine schlechte Ressourcenlage wirkt sich erwartungsgemäß negativ auf das Familienklima aus, das dann allerdings nur einen geringen Einfluß auf das Auftreten von Verhaltensproblemen aufweist. Externalisierende Verhaltensprobleme wirken auf den Zeitpunkt der Partnerwahl und Sexualverhalten 153 Spermarche, während internalisierende (erwartungswidrig) sich für das Auftreten von Wachstumsschub und Stimmbruch nachweisen lassen. Die kindliche Ressourcenlage wirkt sich allerdings direkt auf Stimmbruch- und Spermarchealter aus, die Stabilität der Elternbeziehung auf das Stimmbruchalter. Ein früher Wachstumsschub hängt mit einem früheren ersten Geschlechtsverkehr zusammen und führt zu einem früheren Erstgeburtsalter. Ein frühes Einsetzen des Stimmbruchs hängt mit einem schlechteren pubertären Familienklima zusammen, das zu einer Erhöhung der Zahl der Sexualpartner beiträgt. Das Erstgeburtsalter wirkt sich auf die Länge der reproduktiven Phase aus, ebenso wie - erwartungswidrig - ein späteres Einsetzen des Stimmbruchs. Scheidung der Eltern in der Kindheit trägt ebenfalls zu einer längeren Reproduktionsphase bei mit positiver Auswirkung auf die Anzahl der Kinder. Chasiotis (1998a) interpretiert diese Angaben so, daß beim männlichen Geschlecht von einer noch größeren Kontextsensitivität der reproduktiven Entwicklung ausgegangen werden kann als beim weiblichen. Dies kann unter anderem an dem auf die Gesamtfitneß einwirkenden Muster abgelesen werden (s. Abb. 2). Sozialisationsfaktoren (Beta-Werte) Arbeitslosigkeit der Eltern Scheidung der Eltern Geburt eines Geschwisters -.33* Verlust eines Nahestehenden Internalisieren in der Kindheit Finanzielle Situation -.50** Wachstumsschub (n.s.) Wachstumsschub .35* .70*** .34(*) -.40* Somatische Marker des Sohnes Somatische Marker des Vaters Adjusted r2 (Method backward) -.56** -. 61*** -.43* 1.2*** Stimmbruch .42* Spermarche (n.s.) Stimmbruch Spermarche .48** .59*** Abb. 2: Zusammenfassende Darstellung der Regressionsanalysen intergenerationeller und sozialisatorischer Einflüsse auf die reproduktiven Markervariablen Einsetzen des Wachstumsschubes, Alter beim Einsetzen des Stimmbruchs und Spermarchealter (N = 23)(In: Chasiotis 1998a: 183) 154 H. Keller 2.5. Bindung und Sexualverhalten Über die kontextuellen Parameter des Familienklimas hinaus ist die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Beziehungs- und Bindungsqualität und Parametern des sexuellen Verhaltens bisher kaum empirisch behandelt worden. Jürgen Hammer aus unserer Arbeitsgruppe ist dieser Fragestellung im Rahmen seiner Diplomarbeit nachgegangen (Hammer 1997). Er untersuchte 130 Personen (82 Frauen und 48 Männer) aus der Mittelschicht mit einem durchschnittlichen Alter von 33;8 Jahren (STD = 9,2 Jahre), die mehrheitlich (55 %) verheiratet waren bzw. in einer festen Partnerschaft lebten. Diese Personen beantworteten verschiedene Befragungsinstrumente. Für den uns hier interessierenden Zusammenhang handelt es sich um die Beantwortung von Fragen zur Erfassung des Bindungsmusters, allerdings in einer auf Erwachsenenbeziehungen ausgelegten Fassung („attachment style measure“; Hazan & Shaver 1987) sowie einen „Fragebogen zu Partnerschaft und Partnerwahl“, der neben der Bewertung von gewünschten Eigenschaften des Partners u. a. auch Fragen zu vorherigen Partnerschaften und Sexualpartnern enthielt (Hammer 1997). Es ergaben sich interessante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Anzahl der bisherigen Sexualpartner für die drei klassifizierten Bindungstypen (A = unsicher-vermeidend, B = sichere Bindung, C = unsicher-ambivalente Bindung). Es wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse gerechnet, in die die Faktoren Bindung und Geschlecht eingingen. Das Alter ging als Kovariate in die Berechnung ein, da davon auszugehen ist, daß es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Alter und der Anzahl des Sexualpartner gibt. Es ergaben sich signifikante Haupteffekte für das Geschlecht und die Interaktionen zwischen beiden Faktoren. Erwartungsgemäß haben Männer durchschnittlich mehr Sexualpartnerinnen als Frauen Sexualpartner (7,8 zu 4,1). Männer und Frauen weisen weiterhin interessante Differenzierungen des Zusammenhanges zwischen der Anzahl der Sexualpartner und dem Bindungstypus auf. Unsicher-vermeidend gebundene Frauen haben die wenigsten Sexualpartner und unsicher-ambivalent gebundene Frauen die meisten; sicher gebundene Frauen haben eine mittlere Anzahl von Sexualpartnern. Bei Männern dagegen haben die unsicher-vermeidend gebundenen die meisten Sexualpartnerinnen und die unsicher-ambivalent gebundenen die wenigsten. Sicher gebundene Männer berichten ebenfalls eine mittlere Zahl von Sexualpartnerinnen. Interessant ist weiterhin der große Unterschied zwischen der Anzahl der Partnerschaften und der Anzahl der Sexualpartner. Unsicher-vermeidend gebundene Frauen und Männer geben eine fast identische Anzahl von Partnerschaften an, nämlich 2,2 bzw. 2. Das heißt, die sexuellen Aktivitäten der unsicher-vermeidend gebundenen Männer finden bevorzugt außerhalb einer bestehenden Partnerschaft statt. Ähnliche Ergebnisse berichten neuerdings auch Gangstead & Thornhill (1997), daß nämlich außerpartnerschaftliche Sexualkontakte bei Männern positiv und bei Frauen negativ mit einen vermeidendem Bindungsstil in Beziehung stünden. Die vermeidende Bindung stellt für Männer kein Hindernis dar, sexuelle Kontakte zu suchen, während die gleiche motivationale Ausgangslage bei Frauen auch zu Vermeidung sexueller Kontakte führt. Eine hohe Bindungsmotivation liegt dagegen den sexuellen Aktivitäten der unsicher-ambivalent gebundenen Frauen zugrunde. Die Hoffnung, durch sexuelle Offenheit Bindungspartner zu gewinnen, führt allerdings zu häufigen Enttäuschungen (Hazan & Shaver 1987; Shaver & Hazan 1988; Buss & Schmitt 1993). Das geringe Selbstbewußtsein Partnerwahl und Sexualverhalten 155 Anzahl Sexualpartner unsicher-ambivalent gebundener Männer (Feeney & Noller 1990) und die daraus resultierende Angst vor Verlassenwerden führt auch zu Vermeidung im Sexualverhalten. Unsicher-ambivalent gebundene Männer geben die geringste Zahl von Sexualkontakten überhaupt an. Die Zahl der Partnerschaften unterscheidet sich auch hier nicht für Frauen und Männer (2 bzw. 1,7). Während die mittlere Position der bindungssicheren Frauen und Männer auf einen eher qualitativ ausgerichteten Reproduktionsstil schließen läßt (vgl. Belsky et al. 1991), ist ein eher quantitatives Reproduktionsverhalten geschlechtsspezifisch zu qualifizieren, nämlich in bezug auf unsicher-vermeidend gebundene Männer und unsicher-ambivalent gebundene Frauen. Die dem Verhalten zugrundliegende Motivation unterscheidet sich jedoch. Die in den evolutionären begründeten Sozialisationsmodellen (Belsky et al. 1991; Chisholm 1993) vorgenommene geschlechtsunspezfische Formulierung der Auswirkungen sicherer und unsicherer Bindung ist aufgrund der von Hammer (1997) berichteten Ergebnisse zu modifizieren (vgl. Abb. 3). Allerdings erweist sich ebenfalls eindrucksvoll, daß Bindungsstile und Parameter des Reproduktionsstils kovariieren. 12 10 8 Frauen 6 Männer 4 2 0 A B C Bindungstyp Abb. 3: Bindung und Sexualität (In: Hammer 1997: 107) 3. Ausblick Mit der hier vorgetragenen Zusammenstellung empirischer Befunde zur Rekonstruktion psychobiologischer Entwicklungspfade (Reproduktionsstrategien) kann sicherlich die Schlußfolgerung gewagt werden, daß die Realisierung der reproduktiven Funktion der Sexualität auch beim Menschen des 20. Jahrhunderts als Konsequenz der Erfahrungen in einem spezifischen Kindheitskontext aufgefaßt werden kann. Die Aufnahme und das Ausmaß sexueller Beziehungen sowie Beginn und Anzahl von Elternschaften sind offensichtlich keine frei gewählten persönlichen Entscheidungen, sondern können - zumindest auch - als Ausdruck eines biogenetischen Imperativs (Markl 1983) aufgefaßt werden. Damit ist impliziert, daß sich wesentliche lebenslaufstrategische Entscheidungen als kontin- 156 H. Keller gent auf den familiären Kontext auffassen lassen. Besonders das Familienklima, das hauptsächlich durch die Beziehung der Eltern konstituiert wird, sowie die Beziehungsmuster zwischen Eltern und Kindern führen zu unterschiedlichen Anpassungsmustern, wobei ein optimaler Reproduktionserfolg als Motor der vermutlich weitgehend unbewußten Handlungsregulation und Beziehungsmuster aufgefaßt werden kann. Literatur Abram, M. (1996): Mutter-Kind-Bindung und Konfliktregulation im Vorschulalter. Diplomarbeit, Universität Osnabrück, Fachgebiet Entwicklungspsychologie. Ainsworth, M.D.S.; Blehar, M. C.; Waters, E.; Wall, S. (1978): Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale: Elbaum Assocation. Belsky, J. (1997): Attachment, mating, and parenting. An evolutionary interpretation. Human Nature 8 (4): 361-381. Belsky, J.; Steinberg, L.; Draper, P. (1991): Childhood experience, interpersonal development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child Development 62: 647-670. Bereczkei, T. (1993): r-selected reproductive strategies among Hungarian Gypsies: a preliminary study. Ethology and Sociobiology 14: 71-88. Bereczkei, T.; Czanaky, A. (1996): Evolutionary pathway of child development. Human Nature 7: 257-280. Bowlby, J. (1969): Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books. Buss, D.M.; Schmitt, D.P. (1993): Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review 100: 204-232. Buss, D.M. (1994): Die Evolution des Begehrens. Hamburg: Ernst Kabel Verlag. Buss, D.M. (1989): Sex differences in human mate preferences -Evolutionary hypothesis tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12: 1-49. Chasiotis, A. (1998a): Zur intergenerationellen Bedeutung des Kindheitskontextes für die somatische, psychologische und reproduktive Individualentwicklung Untersuchungen zur evolutionären Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Dissertation, veröff. Bern: Huber-Verlag. Chasiotis, A. (1998b): Natürliche Selektion und Individualentwicklung. In: Keller, H. (Hrsg.) Lehrbuch Entwicklungspsychologie. Bern: Huber-Verlag, 117-206. Chasiotis, A., Scheffer, D., Restemeier, R., & Keller, H. (1998): Intergenerational context discontinuity affects the onset of puberty: A comparison of parent-child dyads in West and East Germany. Human Nature, 9 (3): 321-339. Chasiotis, A.; Riemenschneider, U.; Restemeier, R.; Cappenberg, M.; Völker, S.; Keller, H.; Lohaus, A. (1997): Early infancy and the evolutionary theory of socialization. In: Koops, W.; Hooksma, J.; van den Boom, D. (Hrsg.) Development of interaction and attachment: Traditional and non-traditional approaches. Amsterdam: Royal Dutch Academy of Arts and Sciences, 305-312. Chisholm, J. (1993): Death, hope, and sex: Life-history theory and the development of reproductive strategies. Current Anthropology 34 (1): 1-24. Chisholm, J. (1996): The evolutionary ecology of attachment organization. Human Nature 7(1): 1-38. Dawkins, R. (1976): The selfish gene. Oxford: Oxford University Press. Feeney, J.A.; Noller, P. (1990): Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology 58 (2): 281-291. Flinn, M.; England, B. (1995): Childhood stress and family environment. Current Anthropology 36 (5): 854-866. Gangstead, W.G. & Thornhill, R. (1997): The evolutionary psychology of Extrapair sex: The role of fluctuating asymmetry. Evolution and Human Behavior 18: 69-88. Graber, J.; Brooks-Gunn, J.; Warren, M. (1995): The antecedents of menarcheal age: Heredity, family environment, and stressful life events. Child Development 66: 346-359. Hamilton, W. (1964): The genetical evolution of social behaviour (I + II): Journal of Theoretical Biology 7: 1 - 52. Partnerwahl und Sexualverhalten 157 Hammer, J. (1997): Bindung, Sexualität und Partnerwahl. Eine Studie zur Interaktion zweier Verhaltenssysteme und ihres Einflusses auf die Entstehung sekundärer Vertrautheit. Diplomarbeit, Universität Osnabrück. Hazan, C.; Shaver, P. (1987): Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology 52 (3): 511-524. Hill, E.M.; Ross, L.T.; Low, B.S. (1997): The role of future unpredictability in human risk-taking. Human Nature 8(4): 287-325. Keller, H.; Eckensberger, L.H. (1998): Kultur und Entwicklung. In H. Keller (Hrsg.) Lehrbuch Entwicklungspsychologie. Bern: Huber, 57-96. Keller, H.; Zach, U. (1991): Entwicklungskonsequenzen frühen Blickkontaktverhaltens. Acta Paedopsychiatrica 54 (1): 1-8. Keller, H.; Lohaus, A.; Völker, S.; Cappenberg, M.; Chasiotis, A. (1998 im Druck): Intuitive contingency as a measure of interactional quality. Erscheint in: Child Development. Keller, H. (1996): Evolutionary approaches. In Berry, J.W.; Poortinga, Y.H.; Pandey, J. (Eds.) Handbook of cross-cultural psychology, Volume 1: Theory and method (2. Aufl.). Boston: Allyn & Bacon, 215-255. Kenrick, D.T.; Keefe, R.C. (1992): Age preferences in mates reflect sex difference in human reproductive strategies. Behavioral and Brain Sciences 15: 75-133. Kim, K.; Smith, P.; Palermiti, A.-L. (1997): Conflict in childhood and reproductive development. Evolution and Human Behavior 18: 109-142. Markl, H. (1983): Wie unfrei ist der Mensch? Von der Natur in der Geschichte. In: Markl, H. (Hrsg.) Natur und Geschichte. München: Oldenbourg, 11-50. Moffit, T.E.; Caspi, A.; Belsky, J.; Silva, P.A. (1992): Childhood experience and the onset of menarche: A test of a sociobiological model. Child Development 63: 47-58. Pianka, E.R. (1970): On r- and K-selection. American Naturalist 104: 592-597. Schmid-Hempel, P. (1992): Lebenslaufstrategien, Fortpflanzungsunterschiede und biologische Optimierung. In Voland, E. (Hrsg.) Fortpflanzung: Natur und Kultur im Wechselspiel. Frankfurt: Suhrkamp, 74-103. Shaver, P.R.; Hazan, C. (1988): A biased overview of the study of love. Journal of Personality and Social Psychology 5: 473-501. Silbereisen, R.; Schmitt-Rodermund, E. (1998): Entwicklung im Jugendalter: Prozesse, Kontexte und Ergebnisse. In Keller, H. (Hrsg.) Lehrbuch Entwicklungspsychologie. Bern: Huber, 377-397. Stearns, S. (1992): The role of development in the evolution of life histories. In Bonner, J. (Hrsg.) Evolution and development. New York, Berlin, London, Paris, Tokyo: Springer, 237-258. Tanner, J. (1978): Foetus into man: Physical growth from conception to maturity. London: Open Books. Voland, E. (1993): Grundriß der Soziobiologie. Stuttgart: Fischer. Völker, S.; Keller, H.; Lohaus, A.; Cappenberg, M.; Chasiotis, A. (1998 im Druck): Maternal sensitivity in early face-to-face interactions and later attachment. Erscheint in: International Journal of Behavioral Development. Wickler, W.; Seibt, U. (1990): Männlich weiblich. Ein Naturgesetz und seine Folgen (erw. Neuaufl.). München: Piper. Wilson, M.; Daly, M. (1997): Life expectancy, economic inequality, homicide, and reproductive timing in Chicago neighbourhoods. British Medical Journal 314: 1271-1274. Zach, U. (1997): Entwicklungsbedingungen von Bindungsmustern. Eine prospektive Längsschnittstudie zu ontogenetischer Kontinuität frühkindlicher Bindungsmuster und den Mechanismen des Transfers von Bindungsmustern zwischen Mutter und Kind. Inaugural Dissertation, Universität Osnabrück, Fachbereich Entwicklungspsychologie. Anschrift der Autorin Prof. Dr. Heidi Keller, Universität Osnabrück, Entwicklungspsychologie, Seminarstr. 20, 49069 Osnabrück Orginalarbeiten Sexuologie Gibt es charakteristische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten?* Are there Characteristical Gender Specific Differences in Anorexia and Bulimia Nervosa? W. Köpp, R. Grabhorn, W. Herzog, H. Ch. Deter, J. v. Wietersheim, F. Kröger Zusammenfassung Im Rahmen der deutschen Multizentrischen Eßstörungsstudie über Therapieeffekte stationärer psychodynamischer Behandlungen wurden auch Charakteristika männlicher (m) und weiblicher (w) Eßstörungspatienten erfaßt. 1183 Patienten nahmen an der Studie teil. 533 (14 Männer, 519 Frauen) litten an einer Anorexia nervosa (AN), 650 (17 Männer, 633 Frauen) an einer Bulimia nervosa (BN). Das entspricht in beiden Krankheitsgruppen einem Männeranteil von 2,6%. Im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede gab es zwei Hauptergebnisse: 1. Außer der Tatsache, daß das mittlere Alter bei Krankheitsbeginn bei anorektischen Männern höher als bei anorektischen Frauen war (m: 22,6J./ SD ±7,7; w: 18,2J./ SD ±5,1), gab es keine weiteren, wesentlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede in der AN-Gruppe. 2. Männliche wurden im Vergleich zu weiblichen Bulimikern häufiger als persönlichkeitsgestört eingeschätzt (m: N=4/ 23,5%; w: N=56/ 8,8%). Außerdem waren bulimische Männer häufiger als bulimische Frauen bi- bzw. homo-sexuell orientiert (m: N=4/ 23,5%; w: 29/ 4,6%). Allerdings korrespondierte dieser Befund statistisch nicht mit der Diagnose einer Persönlichkeitsstörung. Weitere (deskriptive) statistische, geschlechtsspezifische Unterschiede in der BN-Gruppe konnten für die folgenden drei Variablen gezeigt werden: Mittleres Alter bei Behandlungsbeginn (m: 30,5J./ SD ±9,7; w: 25,9J./ SD ±6,4), Krankheitsdauer (m: 14,5J./ SD ±12,7; w: 8,4J./ SD ±6,4) und „eine positive Einstellung zur Sexualität“ (m: N=11/ 64,7%; w: N=224/ 35,4%). Die Ergebnisse passen zu den 1994 beschriebenen Untersuchungsergebnissen von Sievers; darin konnte gezeigt werden, daß homosexuelle Männer ebenso wie heterosexuelle Frauen der körperlichen Attraktivität und der Schlankheit größeren Wert beimessen als heterosexuelle Männer und homosexuelle Frauen. Das wurzelt in dem Wunsch, auf Männer anziehend zu wirken bzw. ihnen zu gefallen. Schlüsselwörter: Anorexianervosa, Bulimianervosa, Eßstörungen, Geschlechtsidentität Abstract In connection with the German Multicenter Eating Disorder Study on the treatment effects of psychodynamic inpatient therapy, characteristics of male and female patients with eating disorders also have been assessed. 1183 patients participated in the study. 533 (14 males, 519 females) suffered from anorexia nervosa, 650 (17 males, 633 females) from bulimia nervosa, corresponding to 2,6% males in both eating disorders. There were two main results in regard to gender differences: 1. Despite the fact of the higher mean age of male (m) in comparison to female (f) anorectics at the onset of the disease (m: 22,6ys/ sd ±7,7; f: 18,2ys/ sd ±5,1), there was no other substantial gender specific difference in the AN group. 2. In Sexuologie 6 (3) 1999: 158 – 166 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie Gibt es charakteristische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten? 159 comparison with female bulimics, male bulimics more often were considered to suffer from personality disorders (m: N=4/ 23,5%; f: N=56/ 8,8%). Moreover male bulimics more often have a bisexual or homosexual orientation (m: N=4/ 23,5%; f: 29/ 4,6%). However, the latter result statistically does not correspond with the diagnosis of a personality disorder. Further (descriptive) statistical gender specific differences in BN could be found in the following three variables: mean age at admission (m: 30,5ys/ sd ±9,7; f: 25,9ys/ sd ±6,4); duration of the disease (m: 14,5ys/ sd ±12,7; f: 8,4ys/ sd ±6,4) and a positve attitude towards sexuality (m: N=11 / 64,7%; f: N=224 / 35,4%). The results coincide with findings of Sievers (1994) showing greater emphasis on physical attractiveness and thinness in gay men and heterosexual women than in heterosexual men and homosexual women which is based on a desire to attract and please men. Keywords: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Eating Disorders, Sexual Identity Einleitung Unter den 15 bis 35 jährigen Frauen der technisch entwickelten Länder leiden ca 1% an Anorexia nervosa (AN) und 4% an Bulimia nervosa (BN). Das Vorkommen dieser Krankheiten bei Männern ist die große Ausnahme: Weit weniger als 10% der AN- und BN-Kranken sind Männer. Die Frage, ob die psychische Symptomatik bei Män-nern und Frauen mit AN bzw. BN vergleichbar ist, wird seit Jahren in der Literatur kontrovers diskutiert. So gehen Tabin u. Tabin (1988), Kearny-Cooke u. Steichen-Asch (1990), Carlat u. Camargo (1991) sowie Köpp u. Jacoby (1994) davon aus, daß Männer eine andere Symptomatik aufweisen bzw. psychisch stärker gestört seien als Frauen. Deter et al. (1998) vermuten aufgrund eigener Untersuchungen, daß Anoretiker gegen psychotherapeutische Behandlung resistenter als Anoretikerinnen sind. Die meisten anderen Publikationen bestätigen dagegen eher ein Erscheinungsbild bei eßgestörten Männern, das dem der betroffenen Frauen vergleichbar ist (s.a. Tabelle 1), obgleich gelegentlich verschiedene Abweichungen beim männlichen Geschlecht eingeräumt werden. Der Frage, ob sich die in der Literatur beschriebenen Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen männlichen (m) und weiblichen (w) AN- und BN-Patienten reproduzieren lassen, sollte in der hier vorgelegten Untersuchung nachgegangen werden. Tab. 1: Vergleiche zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten im Spiegel der Literatur Hasan u. Tibbets 1977 Hay u. Leonard 1979 Ziesat u. Ferguson 1984 Burns u. Crisp 1984 Vandereycken u. van den Broucke 1984 Fichter u. Daser 1987 Anzahl untersuchter männl. Patienten u. Art der Publikation 10 AN 6 AN 3 AN 27 AN 107 AN (Metanalyse) 42 AN Symptomatik wie bei weibl. Eßgestörten ja ja ja ja ja Margo 1987 13 AN ja Autor(en) ja Besonderheiten bei männl. Eßgestörten Homosexualität häufiger, - 160 W. Köpp, R. Grabhorn, W. Herzog, H. Ch. Deter, J. v. Wietersheim, F. Kröger Fortsetzung von Tab 1: Anzahl untersuchter männl. Patienten u. Art der Publikation 17 BN Symptomatik wie bei weibl. Eßgestörten ja An u. BN (Review) BN (Review) ja Touyz et al. 1993 12 AN ja Sharp et al. 1994 24 AN ja de la Serna de Pedro 1996 14 AN ja Herpertz et al. 1997 Carlat et al. 1997 5 BN 30 AN, 62 BN kein Vergleich Männer mit AN: ja Autor(en) Fichter u. Hoffmann 1989 Steiger 1989 Carlat u. Camargo 1991 nein Besonderheiten bei männl. Eßgestörten Homosexualität häufiger, Laxanzien seltener, Krankheitsbeginn später, Adipositasneigung häufiger, Homosexualität häufiger, Asexualität häufiger exzessiver Bewegungsdrang häufiger Erkrankungszeitpunkt später, Krankheitsdauer kürzer, Lax.abusus seltener, exzessiver Bewegungsdrang häufiger, prämorbide Adipositasneigung Alkoholabusus u. Hyperaktivität häufiger, Kleptomanie seltener prämorbid Adipositas Bei BN häufiger Homo- bzw. Bisexualität sowie häufiger prämorbid Adipositas Gibt es charakteristische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten? 161 Methode Die Untersuchung erfolgte im Rahmen einer vom Bundesforschungsministerium geförderten großen multizentrischen Eßstörungsstudie. Hierbei wurden zwischen 1993 und 1996 von 45 Kliniken aus verschiedenen Regionen Deutschlands insgesamt 1183 auswertbare Patientendatensätze eingebracht Mit Ausnahme der Mitteilung über die sexuelle Orientierung wurden die Angaben jenem Fragebogen entnommen, den die Patientinnen und Patienten zum Beginn ihrer stationären Psychotherapie ausfüllten. Die Frage zur sexuellen Orientierung wurde den Patientinnen und Patienten erst bei der 2 Jahre später im Rahmen eines Katamnesegesprächs gestellt und die Antwort vom Untersucher bzw. von der Untersucherin dokumentiert. Mittelwerte wurden mit dem t-Test errechnet, sonstige Häufigkeiten mit dem ChiquadratTest oder (bei kleinen Fallzahlen) mit dem exakten Fishertest überprüft. Bei den Signifikanzangaben handelt es sich lediglich um deskriptive bzw. nominelle p-Werte, die wegen der relativ kleinen Fallzahlen männlicher Patienten nicht für Mehrfachmessungen adjustiert wurden. Ergebnisse Von den 1183 Patienten litten 533 (14 m, 519 w) an AN und 650 (17 m, 633 w) an BN. Der prozentuale Anteil männlicher Patienten liegt damit sowohl für die AN als auch für die BN bei 2,6%. Tab. 2: Basisangaben über männliche und weibliche Patienten mit AN und BN; MW: Mittelwerte; SD: Standardabweichung; BMI: Body Mass Index (kg/m2), Normwerte zwischen 20 und 25 kg/m2 ERGEBNIS männliche AN N=14 weibliche AN N=519 p männliche BN weibliche BN N=17 N=633 Alter/J. MW (±SD) 29,9 (±7,2) 24,9 (±5,6) ,08 30,5 (±9,7) 25,9 (±6,4) ,01 BMI MW (±SD) 15,8 (±1,8) 15,7 (±2,4) ,87 25,2 (±7,4) 22,8 (±5,9) ,22 Kh.dauer/J. MW (±SD) 7,6 (±7,8) 6,6 (±6,0) ,07 14,5 (±12,7) 8,4 (±6,4) ,00 Alter/J. bei Kh.beginn MW (±SD) 22,6 (±7,7) 18,2 (±5,1) ,05 15,9 (±6,4) 17,6 (±5,1) ,45 p 162 W. Köpp, R. Grabhorn, W. Herzog, H. Ch. Deter, J. v. Wietersheim, F. Kröger Tab. 3: Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten hinsichtlich einiger Symptom-Variablen. Die Variable „überdurchschnittliche Depressivität“ ergab sich aus der Depressivitätsskala des SCL-90-R (Derogatis 1977) nach T-Transformation p männliche BN N=17 weibliche BN N=633 p Depressive Belastung 13 (92,9%) 447 (86,1%) überdurchschnittl. ,47 13 (76,5%) 542 (86,6%) ,29 Abusus: Alkohol, Medikamente, illegale Drogen 1 (7,1%) 68 (13,1%) ,80 2 (11,6%) 112 (17,7%) ,75 Laxanzienbusus 6 (42,9%) 191 (36,8%) ,64 6 (35,6%) 295 (46,4%) ,36 Selbstverletzung vor stat. Aufn. 2 (14,3%) 199 (38,3%) ,07 9 (52,9%) 313 (49,4%) ,78 Suizidversuch vor stat. Aufn. 4 (28,6%) 123 (23,7%) ,67 8 (47,1%) 205 (32,4%) ,20 Oft das Gefühl zu dick zu sein 2 (14,3%) 154 (29,7%) ,21 271 (42,8%) ,73 Therapeutenurteil: Starke Körperbildstörung 4 (28,6%) 219 (42,2%) ,31 4 (23,5%) 111 (17,5%) ,52 Therapeutenurteil: Persönl.k.Störung (z.B. Borderline) 2 (14,3%) 53 (10,2%) ,62 4 (23,5%) 56 (8,8%) ,04 ERGEBNIS männliche AN N=14 weibliche AN N=519 8 (47,1%) Zwischen der Therapeuten-Einschätzung hinsichtlich des Vorliegens einer Persönlichkeitsstörung (s.a. Tabelle 3) und der sexuellen Orientierung (s.a. Tabelle 4) gab es keinerlei statistische Zusammenhänge. Dasselbe trifft für die positive Einstellung zur Sexualität zu (s.a. Tabelle 4). Eine Adipositas in der Herkunftsfamilie wurde in beiden Krankheitsgruppen jeweils nur drei mal angegeben (ohne Hinweis für statistisch relevante Unterschiede). 30%-40% der Befragten in beiden Krankheitsgruppen hatten die Hochschulreife erlangt; die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern waren nicht signifikant. Eine stabile Partnerschaft wurde von keinem männlichen, aber von 28% (N=145) der weiblichen AN-Patienten angegeben (deskriptives p=0,02). In der BN-Gruppe verfügten 41% (N=7) der Männer und 38% (N=241) der Frauen über eine stabile Partnerschaft bei Beginn der stationären Behandlung (deskriptives p=0,80). Gibt es charakteristische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten? 163 Tab. 4: Anamnestische Angaben aus der Sexualanamnese bei eßgestörten Männern und Frauen p männliche BN N=17 weibliche BN N=633 11 (2,1%) ,82 4 (23,5%) 29 (4,6%) positive Einstellung 4 (28,6%) 77 (14,8%) zur Sexualität ,16 ERGEBNIS Bi- bzw. Homosexualität sexueller Mißbrauch männliche weibliche AN N=14 AN N=519 0 (0%) 0 (0%) 49 (9,4%) ,23 p ,00 11 (64,7%) 224 (35,4%) ,01 1 (5,9%) 75 (11,8%) ,45 Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, sind die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen AN-Patienten hinsichtlich der geschlechtlichen Orientierung, der Einstellung zur Sexualität und im Hinblick auf die Angabe eines sexuellen Mißbrauchs in der Kindheit statistisch nicht auffällig. Bei den BN-Patienten findet man dagegen unter den Männern häufiger Bi- bzw. Homosexualität und eine positive Einstelllung zu Sexualität. Diskussion Die vorliegende Untersuchung wurde an stationären Patienten durchgeführt. Man muß hierbei von einer Selektion eher schwerer kranker Patienten ausgehen. Die Prävalenz von weniger als 3% männlicher Patienten liegt - verglichen mit den Angaben der Literatur im erwarteten Bereich (s. z.B. Zusammenfassung bei Herpertz et al. 1997). Die Ergebnisse dieser vergleichenden Untersuchung sind deskriptiver Art und dürfen auch wegen der geringen Zahl männlicher Patienten - nicht überbewertet werden. Ein verbessertes statistisches Design (z.B. matched pairs) ist u. U. sinnvoller und soll in einer weitergehenden Untersuchung (Grabhorn et al., in Vorbereitung) berücksichtigt werden. Dabei wird dann auch die Auswertung des weiteren Verlaufes einbezogen. Die jetzt hier dargestellten Ergebnisse zeigen immerhin zwei Sachverhalte. 1. Es gibt hinsichtlich der untersuchten Symptomvariablen keine wesentlichen Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Anorektikern. 2. Im Vergleich zu den weiblichen Patienten werden männliche Bulimiker von den Therapeuten klinisch öfter als persönlichkeitsgestört eingeschätzt. Außerdem sind männliche häufiger bi- oder homosexuell orientiert als weibliche Bulimiker - ein Befund der gut übereinstimmt mit der Literatur (s. a. Tabelle 1). Es ist wichtig zu betonen, daß zwischen der Therapeuteneinschätzung „Persönlichkeitsstörung“ und der Variable „sexuelle Orientierung“ kein statistischer Zusammenhang feststellbar war. Außerdem kann man davon ausgehen, daß die im Gespräch bei der Nachuntersuchung mitgeteilte sexuelle Orientierung die „härtere“ von beiden Variablen ist. Da für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung - außer dem klinischen Manual (DSM III- 164 W. Köpp, R. Grabhorn, W. Herzog, H. Ch. Deter, J. v. Wietersheim, F. Kröger R) - keine spezifischen psychometrischen Instrumente verwendet wurden, ist gegenüber der Validität dieser Variable Skepsis angebracht. Andererseits taucht die interessante Frage auf, ob u.U. die Entwicklung einer Frauenkrankheit in Gestalt einer psychogenen Eßstörung kausal mit der sexuellen Orientierung der betroffenen Männer verknüpft sein könnte. Siever (1994) betonte in diesem Zusammenhang, daß es mittlerweile mehrere empirische Studien gibt, die gut belegen, daß das körperliche Erscheinugnsbild bzw. die körperliche Attraktivität für homosexuelle viel wichtiger als für heterosexuelle Männer ist (Berscheid et al. 1972, 1973; Herzog et al. 1991; Sergios u. Cody 1985; Silberstein et al. 1989; Yager et al. 1988). Außerdem weisen einige Studien darauf hin, daß der gesellschaftliche Druck, schlank sein zu müssen, von homosexuellen Männern ganz ähnlich wie von (heterosexuellen) Frauen erlebt wird (Altman 1982; Clark 1977; Kleinberg 1980; Lakoff u. Scherr 1984; Millman 1980). Sievers (1994) führte eine vergleichende Untersuchung an 53 lebischen und 62 heterosexuellen Frauen sowie an 59 homosexuellen und 63 heterosexuellen Männern durch. Er konnte die o.g. Literaturbefunde nicht nur bestätigen, sondern außerdem zeigen, daß heterosexuelle Frauen ebenso wie homosexuelle Männer mehr Wert auf ihr körperliches Erscheinungsbild legen, während heterosexuelle Männer größeren Wert auf körperliche Effektivität legen. Andererseits ist den heterosexuellen Männern die körperliche Attraktivität ihrer Partnerinnen sehr wichtig. Für homosexuelle Frauen gab es in seiner Untersuchung - im Vergleich zu den heterosexuellen Frauen - nur einen statistischen Trend in die Richtung, daß Lesbierinnen (trotz höhern Gewichtes) mit ihrem Körper zufriedener als heterosexuelle Frauen waren. Diese Ergebnisse sind deswegen so wichtig, weil sie ein weiterer Hinweis für die Bedeutung kultureller Einflüsse bei der Entstehung von Eßstörungen sind. Die Sorge um körperliche Attraktivität und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen machen Frauen wie Männer offenbar empfänglich für die Entwicklung einer psychogenen Eßstörung. Die eigenen, hier vorgestellten Befunde weisen zusätzlich darauf hin, daß dies eher für das Krankheitsbild der BN zutrifft und weniger für das der AN. Die im Titel gestellte Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Eßstörungen kann bei vorsichtiger Würdigung der Befunde aus der Literatur und der eigenen Ergebnisse dialektisch folgendermaßen beantwortet werden: Es scheint solche Unterschiede zu geben; doch sind diese - insbesondere die homosexuelle Orientierung - dergestalt, daß sie die betroffenen Männer den Frauen auch wieder ähnlicher machen und somit vulnerabler gegenüber kulturellen Einflüssen. Anmerkungen * Die Untersuchung, auf der diese Arbeit basiert, wurde vom Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert. Gibt es charakteristische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eßgestörten? 165 Literatur Altman, D. (1982): The homosexualisation of America, the Americanisation of the homosexual. New York, St. Martins Press. American Psychiatric Association (1987): Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3rd ed revised. Washington D.C., American Psychiatric Association. Berscheid, E.; Walster, E.; Bohrnstedt, G. A. (1972): Psychology today questionaire: Body image. Psychology Today 6: 57-66. Berscheid, E.; Walster, E.; Bohrnstedt, G. A. (1973): Psychology today questionaire: The happy American body. A survey report. Psychology Today 7: 119-131. Burns, T.; Crisp, A.H. (1984): Outcome of anorexia nervosa in males. Br. J. Psychiatry 45: 319-325. Carlat, D.J.; Camargo, C.A. (1991): Review of bulimia nervosa in males. Am. J. Psychiatry 148: 831843. Carlat, D.J.; Camargo, C.A.; Herzog, D.B. (1997): Eating disorders in males: A report on 135 patients. Am. J. Psychiatry 154: 1127-1132. Clark, D.: Loving someone gay. Millbrae, Celstial Arts 1977 (zit. n. Siever). de la Serna, I.; Moreno O.I.; Vinas P.R. (1990): Comparative study of anorexia nervosa in a group of males and females. Actas Luso. Esp. Neurol. Psiquiatr. Cienc. Afines 18: 332-338. Derogatis, L.R. (1997): SCL-90-R, administration, scoring & procedures manual-I for the R(evised) version. Johns Hopkins University School of Medicine, Eigendruck 1977. Deutsch: Franke G. (1995) (ed.): SCL-90-R. Die Symptomcheckliste von Derogatis. Deutsche Version. Manual. Göttingen: Beltz. Deter, H.C.; Köpp, W.; Zipfel, S.; Herzog, W. (1998): Männliche Anorexia-nervosa-Patienten im Langzeitverlauf. Nervenarzt 69: 419-426. Fichter, M.M.; Daser, C. (1987): Symptomatology, psychosexual development, and gender identity in 42 anorectic males. Psychological Med 17: 409-418. Fichter, M.M.; Hoffmann, R. (1989): Bulimia beim Mann. In: Fichter MM (ed.) Bulimia nervosa. Stuttgart: Enke: 76-86. Hasan, M.K.; Tibbets, R.W. (1977): Primary anorexia nervosa (weight phobia) in males. Postgrad. Med. J. 53: 146-151. Hay, G.G.; Leonard, J.C. (1979): Anorexia nervosa in males. Lancet 2 (8142):574-575. Herpertz, S.; Kocnar, M.; Senf, W. (1997): Bulimia nervosa beim männlichen Geschlecht. Z. psychosom. Med. 43: 39-56. Herzog, D.B.; Newman, K.L.; Warshaw, M. (1991): Body image dissatisfaction in homosexual and heterosexual males. J. Nerv. Ment. Disease 179: 356-359. Jäger, B.; Köpp, W., MZS (1998): Die multizentrische Studie zur psychodynamischen Therapie von Eßstörungen. Psychotherapeutenforum – Praxis und Wissenschaft 5: 4-6. Kächele, H. u. MZS (1999): Die Multizentrische Sturdie zur psychodynamischen Therapie von Eßstörungen. Psychother. Psychosom. med. Psychol. (im Druck). Kächele, H. (1991): Multizentrische Studie „Psychodynamische Therapie von Eßstörungen“. Antrag an das BMFT. Forschungsstelle für Psychotherapie. Stuttgart: im Selbstverlag. Kächele, H.; Hettinger, R.; Munz, D.; Jäger, B.; Kröger, F.; Catina, A.; Peter, R.; Weber, R.; Bergmann, G.; Herzog, W.; Probst, B.; Köpp, W.; Gaus, E.; Ehlers, W.; Gitzinger, I.; Herzog, T.; Bernatz, M.; Engel, K.; Czogalik, D. (1992): Planungsforum „Psychodynamische Therapie von Eßstörungen“. Psychother. Psychosom. med. Psychol. 42: 33-36. Kearny-Cooke, A.; Steichen-Asch, P. (1990): Men, body image and eating disorders. In: Anderson AE (ed.) Males with eating disorders. New York: Brunner & Mazel: 54-74. Kleinberg, S. (1980): Alienated affections: Being gay in America. New York: St. Martin’s Press. Köpp, W. & MZS (1997): Multizenterstudie Eßstörungen - Entstehung, Ziele und Design. In: Willenberg H, Hoffmann SO (ed.): Handeln – Ausdrucksform psychosomatischer Krankheit und Faktor der Therapie. Frankfurt/M.: Verlag für Akademische Schriften (VAS). Köpp, W.; Jacoby, G.E. (1994): Der frühe Psychotherapieabbruch eßgestörter Männer und Frauen in der stationären Psychotherapie. Psychologie in der Medizin 5: 24-29. 166 W. Köpp, R. Grabhorn, W. Herzog, H. Ch. Deter, J. v. Wietersheim, F. Kröger Lakoff, R.T.; Scherr, R.L. (1984): Face value: The politics of beauty. Boston: Routledge and Kegan Paul. Margo, J.L. (1987): Anorexia nervosa in males. A comparison with female patients. Br. J. Psychiatry 151: 80-83. Millman, M. (1980): Such a pretty face: Being fat in America. New York: W.W. Norton (zit. n. Siever). Robinson, P.H., Holden, N.L. (1986): Bulimia nervosa in the male: a report of nine cases. Psychol. Med. 16: 795-803. Sergios, P.; Cody, J. (1985): Importance orf physical attractiveness and social assertiveness skills in male homosexual dating behavior and partner selection. J. Homosexuality 12: 71-84. Sharp, C.W.; Clark, S.A.; Dunan, J.R.; Blackwood, D.H.; Shapiro C.M. (1994): Clinical presentation of anorexia nervosa in males: 24 new cases. Int. J. Eat. Disord. 15:125-134. Siever, M.D. (1994): Sexual orientation and gender as factors in socioculturally acquired vulnerability to body dissatisfaction and eating disorders. J. Consult. Clin. Psychology 62: 252-260. Silberstein, L.R.; Mishkind, M.E.; Striegel-Moore, L.E.; Timko, C.; Rodin, J. (1989): Men and their bodies: A comparison of homosexual and heterosexual men. Psychosom. Med. 51: 337-346. Steiger, H. (1989): Anorexia nervosa and bulimia in males: lessons from a low-risk population. Can. J. Psychiatry 34: 419-424. Tabin, C.J.; Tabin, J.K. (1990): Bulimia and anorexia: Understanding their gender specifity and their complex symptoms. In: Schwartz HJ (ed) Bulimia: Psychoanalytic treatment and theory. Madison: International University Press 173-226. Touyz, S.W.; Kopec-Schrader, E.M.; Beumont, P.J. (1993): Anorexia nervosa in males: a report of 12 cases. Aust. N. Z. J. Psychiatry 27: 512-517. Vandereycken, W.; van den Broucke, S. (1984): Anorexia nervosa in males. A comparative study of 107 cases reported in the literature (1970 to 1980). Acta Psychiatr. Scand. 70: 447-454. Yager, J.; Kurtzman, F.; Landsverk, J.; Wiesmeier, E. (1988): Behaviors and attitudes related to eating disorders in homosexual male college students. Am. J. Psychiatry 145: 495-497. Ziesat, H.A.; Ferguson, J.M. (1984): Outpatient treatment of primary anorexia nervosa in adult males. J. Clin. Psychol. 40: 680-690. Arbeitsstellen der Autoren W. Köpp, H. Ch. Deter, Abt. f. Psychosomatik u. Psychotherapie, Klinikum Benjamin Franklin, Freie Universität Berlin R. Grabhorn, Klinik f. Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie, Klinikum d. Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/M. W. Herzog, Abt. Innere Medizin II, Schwerpunkt Allgemeine Klinische u. Psychosomatische Medizin, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg J. v. Wietersheim, Abt. f. Psychotherapie u. Psychosomatische Medizin, Klinikum d. Universität Ulm F. Kröger, Klinik f. Psychosomatik u. Psychotherapeutische Medizin, Universitätsklinikum d. RWTH Aachen Korrespondenzadresse Priv. Doz. Dr. med. W. Köpp, Eßstörungsambulanz der Abt. f. Psychosomatik u. Psychotherapie, Klinikum Benjamin Franklin der FU Berlin, Hindenburgdamm 30 D-12200 Berlin, e-mail: [email protected] Fortbildung Sexuologie Anorexie und Bulimie bei Männern: Zum Erscheinungsbild zweier Frauenkrankheiten beim männlichen Geschlecht. Anorexia and Bulimia Nervosa in Males: On the Phenomenology of Two Women’s Diseases in the Male Gender W. Köpp, B. Kallenbach, Zusammenfassung Anorexia und Bulimia nervosa sind typische Frauenkrankheiten. Die Publikationen über geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Symptomatik und möglicher Identitätsstörungen sind widersprüchlich. Die vorliegende Arbeit referiert die relevante Literatur über Eßstörungen bei Männern, kommentiert eine autobiografische Fallstudie von Ralph F. Wilps (1990) und präsentiert zwei eigene Fallberichte mit ungünstigem Therapieergebnis. Schlüsselwörter: Anorexianervosa, Bulimianervosa, Eßstörungen, Geschlechtsidentität Abstract Anorexia and bulimia nervosa are typical women’s diseases. The literature about gender differences in symptomatology and identity disturbances is controversial. This paper summarizes the literature about eating disorders in males, comments on the autobiografical case study of Ralph F. Wilps (1990) and presents two own case reports of eating disordered males with an unfavourable outcome. Keywords: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Eating Disorders, Sexual Identity Einleitung Der Anteil von Männern bei eßgestörten Patienten wird seit Jahren in der Literatur und den Lehrbüchern mit unter 5% angegeben. Zunehmend bemüht man sich dabei auch um die Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen Männer eine doch weitgehend für das weibliche Geschlecht spezifische Erkrankung entwickeln. Kearny-Cooke u. Steichen-Asch (1990) gingen von einer erheblichen Störung der geschlechtlichen Identität bei Männern mit Eßstörungen aus. Inwieweit diese vermutete Identitätsstörung bei Männern sich aber qualitativ und quantitativ von jener der weiblichen Patienten unterscheidet, blieb dabei unklar. Aus psychoanalytischer Sicht vertraten Tabin u. Tabin (1988) die Auffassung, daß männliche Eßgestörte - insbesondere mit Anorexia nervosa (AN) – eine sehr schlechte Prognose hätten. Dazu paßt der Bericht von Köpp u. Jacoby (1994), die zeigen konnten, daß männliche (N=5 entsprechend 27,8%) signifikant häufiger als weibliche Eßgestörte (N=55 entsprechend 7,8%) eine stationäre Psychotherapie innerhalb von zwei Wochen Sexuologie 6 (3) 1999: 167 – 178 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie 168 W. Köpp, B. Kallenbach nach Behandlungsbeginn abbrachen. Dazu paßt auch, daß Deter et al. (1998) aufgrund eigener Untersuchungen von einer größeren Resistenz gegenüber psychotherapeutischer Behandlung bei männlichen (im Vergleich zu weiblichen) Anoretikern ausgingen. Schon 1986 berichteten Robinson u. Holden über die Chronifizierung einer Bulimie bei 6 von insgesamt 9 Männern in einem Zeitraum von 6 bis 10 Jahren. Faßt man die empirische Literatur zusammen, in der männliche und weibliche Eßgestörte verglichen werden, so beschreiben die meisten Autoren die wesentliche Symptomatik und auch eine eventuell vorliegende Comorbidität für Männer und Frauen als gleich. Andererseits werden auch immer wieder Besonderheiten bei Männern herausgestellt, die die Behauptung der Symptomgleichheit zwischen den Geschlechtern relativieren (s.a. Köpp et al. 1999, in diesem Heft). Einschränkend muß man aber einräumen, daß kleine Fallzahlen, Selektionseffekte und fehlende Befundreplikation zur Zeit kaum eine Verallgemeinerung der beschriebenen Ergebnisse zulassen. Verschiedene Einzelfallstudien zeigen detailliert bestimmte Phänomene der Ätiopathogenese und des Krankheitsverlaufes in der individuellen Dimension. Obwohl diese Berichte in der Regel keine Möglichkeit zur Formulierung verallgemeinerbarer Konstrukte bieten, sind sie doch von unersetzlichem Wert zur Generierung von überprüfbaren Hypothesen. Die autobiographische Fallstudie von Wilps (1990) Mit der autobiografischen Fallstudie von Wilps (1990) liegt ein außergewöhnlicher Bericht eines Klinischen Psychologen vor. In seiner Studie versucht er die Betroffenheit eines Patienten mit der kompetenten Einschätzung eines Experten zu verbinden. Eindrucksvoll ist die Schilderung seiner Lebensgeschichte, die er ansatzweise psychodynamisch entwickelt: Demnach sei die frühe Kindheit bis zur Einschulung weitgehend unauffällig verlaufen. Dann aber habe er sich hinter seine Bücher verkrochen. Er habe sich mit mit seinem Vater und dessen Brüdern verglichen und hatte in der Kindheit das Gefühl, daß diese einen sehr muskulösen Körperbau hätten, er dagegen sehr schmächtig gebaut sei. „Es wurde schnell deutlich, daß ich nie ein Fußballspieler werden würde. Zwar entwickelte ich mich zu einem Bücherwurm, aber es gelang mir nicht, irgendetwas zu tun, was meinen Eltern sinnvoll schien“ (Wilps 1990:12; Übersetzung W.K.). Plausibel zeigt er dann auf, wie eine Hodenverletzung im 13. Lebensjahr in ihm zunehmend ein vermindertes Selbstwertgefühl entstehen ließ, das vor allem sein Körperbild betraf. In der Schule erlebte er dann, daß er von stärkeren Schülern wiederholt malträtiert wurde und bei Raufereien immer unterlag. Seine Eltern drängten ihn dennoch, sich körperlich zu wehren. Das Resultat seiner Verteidungsversuche waren mehrfache Knochenbrüche an beiden Handgelenken. In seinen weiteren Ausführungen schildert Wilps dann eine zunehmende Isolation, spärliche Peer-Kontakte, überwertiges Harmoniebedürfnis verbunden mit Unterwürfigkeit und die Suche nach „Surrogat-Eltern“. Bei Herausforderungen jeglicher Art flüchtete er ins Essen (zunehmend dann auch mit konsekutivem Erbrechen). Gegen Ende seines Psychologiestudiums nahm er dann therapeutische Hilfe in Anspruch, die ihm half, sich mit seinem Beruf zu identifizieren, selbstsicherer zu werden und zu heiraten. Kurz nach der Heirat aber entwickelte er zunehmend restriktiv-anorektiforme Verhaltensweisen. In dra- Anorexie und Bulimie bei Männern 169 matischer Weise scheiterte dann seine Ehe, als er sich in die Mutter eines von ihm psychologisch betreuten behinderten Jungen verliebte – in einer Zeit, als seine Frau schwanger war. Bis dahin war die Beziehung zu seiner Frau der erste und einzige Versuch einer Liebesbeziehung. In dieser Zeit nahmen seine Eß-Brech-Symptome beträchtlich zu. Nur mit Mühe gelang es ihm nach der Trennung von seiner Frau, seinen Tag zu strukturieren. Dabei ersetzte er die Eß-Brech-Anfälle nach und nach durch körperliche Aktivitäten (Schwimmen, Aerobic, Joggen), was er seinerzeit eine „positive Sucht“ nannte (Wilps 1990:21). Wie es ihm (1990) aktuell ergeht, beschreibt der Autor unter der Überschrift „Current Functioning“ folgendermaßen (Wilps 1990: 23; Übersetzung W.K.): „Obwohl ich seit 1983 keine Eßanfälle mehr habe, würde ich mich nicht als geheilt bezeichnen. Vielmehr erlebe ich mich in einer Art Erholungsphase. Ich sehe sehr deutlich, daß ich noch immer Eigenschaften habe, die ein Risiko für das erneute Auftreten der Bulimie darstellen. Ich bin immernoch sehr zwanghaft und bekomme fast panische Angst, wenn mein Tagesplan auf irgendeine Art gestört wird. Ich bestelle meine Patienten dicht hintereinander ein und erlaube mir nur eine minimale Zeit um ins Schwimmbad zu gehen. Dann schwimme ich meine zwei Meilen (ca. 3,2 km, W.K.) und haste zurück in die Praxis, wo ich fast zu spät zu den anberaumten Terminen eintreffe. Wenn es mir gelingt, meine regulären körperlichen Aktivitäten durchzuführen, denke ich meistens den ganzen Tag nicht an das Essen. Ich nehme ein reichhaltiges, zusätzlich mit Vitaminen angereichertes Frühstück mit Früchten und Kräutertee zu mir. Bis zum Mittagessen habe ich dann keinen Hunger. Da ich mittlerweile alleine lebe, esse ich mittags nie zuhause [...]“. Weiter ist zu erfahren, daß er im Rahmen seiner Genesung sich wieder stärker der römisch-katholischen Religion, dem Glauben seiner Eltern, zugewandt hat. Es ist auffällig, wie selten der Autor seine Sexualität erwähnt. Lediglich teilt er mit, daß er in der Zeit, als seine Symptome am heftigsten waren, sexuell nicht aktiv war. Obwohl er an anderer Stelle sehr offen über sich berichtet, findet sich nicht einmal ein allgemeiner Hinweis auf sein Sexualleben nach der Genesung. Es bleibt offen, ob der Autor, der ja in eigener Praxis „eklektisch“ vor allem auch mit Eßgestörten arbeitet, absichtlich oder unbewußt diese Thema gemieden hat. Eigene Patienten Im folgenden werden aus dem stationären Klientel der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin die Krankengeschichten eines Mannes mit Bulimia nervosa (BN) und eines Mannes mit Anorexia nervosa (AN) nach DSM III-R (American Psychiatric Association 1987) vorgestellt. Von den 1117 Männern und Frauen, die hier von November 1978 bis zur Schließung der Bettenstation im Dezember 1997 stationär psychosomatisch behandelt wurden, wiesen 132 (11,8%) eine Anorexia nervosa (AN) und 112 (10%) eine Bulimia nervosa (BN) nach DSM-III R auf. Während der Anteil von Männern unter den nicht eßgestörten Patienten 36,4% (N=318) betrug, lag er bei Patienten mit AN bei lediglich 3,8% (N=5) und bei Patienten mit BN bei 4,5% (N=5). Die beiden unten geschilderten Fallberichte betreffen zwei Patienten aus der Gruppe männlicher Eßgestörter, die in Tabelle 1 aufgelistet ist. Auswahlkriterium für die Fallbeschreibungen war die möglichst lange Nachbeobachtungszeit. 170 W. Köpp, B. Kallenbach Tab. 1: 1978-1997 stationär behandelte Männer mit Eßstörungen (BN=Bulimia nervosa; AN= Anorexia nervosa; klassifiziert n. DSM-III-R); *: Kasuistik in dieser Arbeit dargestellt; Pat.Nr. Alter/J. bei Kh.beginn 31 36 21 18 22 Persönlichk.störung ja ja ja ja nein Besonderheiten BN202 BN351* BN424 BN737 BN804 Alter/J. bei Bhdl.beginn 33 48 23 20 30 AN274 AN279 AN623 AN700* AN999 40 34 21 29 34 38 33 18 24 33 nein nein nein ja ja Leistungssport Alkoholabusus unkl. sex. Orient. regelm. illeg. Drogen Alkoholabusus; unkl. sex. Orient. Alkoholabusus 1. Fallbericht Zur Symptomatik Der 29 jährige Patient wurde hausärztlicherseits in der Psychosomatischen Poliklinik vorgestellt, nachdem sukzessive innerhalb der letzten 10 Jahre ein schleichender Gewichtsverlust aufgetreten war (von 84 kg auf mittlerweile 57 kg bei 1,79 m Körpergröße). Insbesondere während der letzten 2 Jahre vor der poliklinischen Vorstellung sei der Gewichtsverlust von 67 auf 57 kg von statten gegangen, ohne daß der Patient sich das erklären konnte und ohne daß eine körperliche Ursache nachweisbar gewesen wäre. Im ersten Gespräch wirkte der Patient zierlich. Er war sehr bemüht, sich in ein gutes Licht beim Untersucher zu rücken. Er sprach relativ leise und war freundlich zugewandt. Er berschrieb sich selber als „kleinen Perfektionisten“ und als jemanden, der „seiner Zeit voraus“ sei. Gegenüber seiner tatsächlichen Lebenssituation fiel aber eine deutliche Tendenz zur Verleugnung der Wirklichkeit auf: Er hatte einen sozialen Abstieg hinter sich (war gelernter Koch und arbeitete nun als Hilfskraft bei der Stadtreinigung), bezeichnete sich aber als „Entsorgungsspezialist“. Im Gespräch zeichnete sich auch nicht ab, daß er sich selber in irgend einer Hinsicht ändern wollte. Die letzte Phase des Gewichtsverlustes von 10 kg fiel in eine Zeit, als der Patient nach Eingehen einer neuen Partnerschaft Vater geworden war. In dieser Phase habe (nach Angaben des Patienten) seine eigene Mutter versucht, diese neue Bindung in Frage zu stellen, indem sie das Gerücht verbreitet habe, daß er bereits Kinder mit anderen Frauen habe. Er selber meinte dazu, daß ihm „nicht bewußt“ sei, daß er anderweitig Vater sei. Dieser Umstand konnte im übrigen in der 4-wöchigen stationären Behandlung nicht geklärt werden (!). Anorexie und Bulimie bei Männern 171 Für die Zeit vor der stationärern Behandlung räumte der Patient auch ein, immer weniger gegessen zu haben, ohne es recht zu merken. Zur Lebensgeschichte Patient wuchs in einem Dorf in Bayern auf mit 3 Geschwistern (Schwester +7 Jahre, Bruder +4 Jahre, eine behinderte Schwester -1 Jahr). Er sei „tot geboren“ worden und habe längere Zeit auf der pädiatrischen Intensivstation liegen müssen. Er habe aber keinen Schaden davongetragen. Er hatte die Vorstellung, daß durch seine Geburt die später geborene jüngere Schwester geistig und körperlich behindert sei. Eigentlich habe Mutter zu diesem Zeitpunkt keine Kinder mehr bekommen sollen und es sei im Grunde unverantwortlich von ihr gewesen, das Kind (seine behinderte Schwester) noch auszutragen. Die Mutter (+25 Jahre) sei materiell eingestellt gewesen, was er „auf den Tod nicht leiden“ könne. Sie habe immer nur Geld von den Kindern haben wollen und selber „nichts mehr für die Kinder übrig“ gehabt. Sie sei sehr geizig gewesen und er habe kein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Sie sei auch wenig zu Hause gewesen, sei sehr streng gewesen, habe hart gestraft, auch geschlagen und oft Hausarrest verhängt. Der Vater (+26 Jahre) sei bei einem Autounfall auf dem Weg zu seiner Zimmermannsarbeit verstorben, als der Patient 5 Jahre alt war. Er könne sich nur noch schwach an ihn erinnern, Vater sei aber „ein Pfundskerl“ gewesen - das jedenfalls habe er immer über ihn sagen hören. Der Patient habe immer auf seine behinderte Schwester aufpassen müssen, sie überall mit hinnehmen müsse. Er habe die Schwester immer als Vorwand benutzen können, das Haus zu verlassen. Auf diese Weise sei er „nicht so oft zu Hause“ gewesen. Als der Patient 10 Jahre alt war, habe die Mutter einen Freund gehabt, der mehrfach straffällig und alkoholkrank gewesen sei. Der Patient absolvierte dann einen Kochlehre, ging danach zur Bundeswehr. Mit 17 Jahren habe er zu einer gleichaltrigen Freundin eine 3 1/2-jährige Beziehung gehabt, habe sich sehr wohl in deren Familie gefühlt, die er als Ersatz für die fehlende eigene Familie erlebt habe. Von der Mutter hatte er zu diesem Zeitpunkt eine Halbwaisenrente eingeklagt. Nach dem Ende dieser Partnerschaft habe er sehr viel dem Alkohol zugesprochen, viel geraucht, und im übrigen bei einer Anstellung als Koch in Österreich eine Art „HippieLeben“ geführt. Mit 23 Jahren sei er dann nach Berlin gezogen und habe die Beziehung zu seiner jetzigen Ehefrau begonnen. Die brachte einen 6-jährigen Sohn mit in die Partnerschaft und wenig später sei sie vom Patienten schwanger geworden. Zur diagnostischen Einschätzung Bei diesem Patienten wurde von einer atypischen Anorexia nervosa ausgegangen. Das Gewichtskriterium war erfüllt, ebenso das reduzierte sexuelle Interesse im Gefolge der zunehmenden Gewichtsabnahme nach der Geburt seines Sohnes. Es fand sich auch eine deutliche Körperwahrnehmungsstörung, jedoch bestritt der Patient, daß er Angst vor dem Dickwerden habe. Zusätzlich gingen wir aber auch von dem Vorliegen einer narzißtischen Neurose aus: Die Inkonstanz bzw. die Brüchigkeit der Objektbeziehungen in der frühen Kindheit und die vom Patienten als lieblos geschilderte familiäre Atmosphäre führte dazu, daß er sein Kleinheitserleben im Rahmen einer Selbstwertproblematik immer wieder auch durch Größenphantasien zu kompensieren suchte. Daneben blieb eine große orale Bedürftig- 172 W. Köpp, B. Kallenbach keit, die in zuvor nie befriedigten Nähewünschen ihre Ursache hatte und in der hilflosen und teilweise rigide gestalteten Kontaktsuche gegenüber anderen Menschen seinen Ausdruck fand. Verlauf der 4-wöchigen, stationären Behandlung Die Indikation für diese Behandlung wurde deswegen gestellt, weil der Patient selber keinerlei Motivation für eine ambulante Therapie hatte und durch eine intensive stationäre Behandlung überprüft werden sollte, inwieweit diese Motivation überhaupt geschaffen werden kann. Während der stationären Behandlung fiel die erhebliche Kontaktstörung des Patienten auf, die hinter seiner fassadenhaften Bemühung, ein Bild von sich im Sinne der sozialen Erwünschtheit zu entwerfen, in den Vorgesprächen schon im Ansatz sichtbar geworden war. Frühe Abwehrmechanismen wie Projektion, Spaltung und Verleugnung wurden jetzt im Behandlungskontext viel deutlicher: So begrüßte er in der ersten Gruppensitzung die Mitpatienten mit einem „fröhlichen guten Morgen“ und wunderte sich über das Ausbleiben einer Reaktion. Es gelang auch nicht, eine von ihm in Anspruch genommene Tagegeldversicherung zu problematisieren und hier unterwarf er sich seiner Frau, die dieses Geld einforderte. Er spürte auch nichts von der Feindseligkeit, mit der er anderen gegenübertrat, diese zurückwies; er wunderte sich dann, daß er „so schlecht ankommt“. In den beiden Paargesprächen, die zusammen mit seiner Frau und dem jüngeren Kind geführt wurden, wurde deutlich, daß auf seiten der Ehefrau mit ein wesentlicher Grund für die Ehe darin lag, daß sich der Patient spontan gut mit ihrem damals 10-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung verstand. Im Hinblick auf den 3-jährigen gemeinsamen Sohn fiel auf, daß sich das Kind quasi zwischen die Eheleute stellte und in Anwesenheit des Kindes eine direkte Kontaktaufnahme zwischen den Eheleuten gar nicht möglich war. Die Eheleute wurden beständig durch das Kind von einer Kommunikation miteinander abgehalten. Es geschah dabei, daß wichtige Mitteilungen an den jeweiligen Partner zwar ausgesprochen wurden, nicht jedoch von dem anderen aufgenommen werden konnten. Im übrigen stand die Ehefrau des Patienten einer Psychotherapie sehr skeptisch gegenüber, war vielmehr von der körperlichen Verursachung seiner Gewichtsabnahme überzeugt. Während des stationären Aufenthaltes ist es auch zu einzelnen Alkoholexzessen des Patienten gekommen. Es gab weitere Hinweise für selbstschädigendes Verhalten in der Jugend des Patienten: Befragt nach dem Grund verschiedener Narben im Bereich seiner Arme und Bein war zu erfahren, daß zahlreiche Moped-Unfälle vor dem 20. Lj. des Patienten hierfür verantwortlich seien. Diese Unfälle waren von ihm selber verursacht worden. Wegen der vorhandenen Tagegeldversicherung und dem Umstand, daß der Patient kaum von dem Behandlungsangebot profitieren konnte, wurde die Behandlung nach 4 Wochen beendet. Ein ambulantes Betreuungsangebot bzw. eine Therapievermittlung konnte der Patient nicht annehmen. Nachuntersuchung Ein Jahr bzw. zwei Jahre nach Abschluß der stationären Behandlung wurde der Patient zu Gesprächen eingeladen. Bei dem ersten poststationären Gesprächskontakt hatte sich wenig in seinem Leben verändert, das Gewicht war bei 60 kg konstant geblieben, die Ehe- Anorexie und Bulimie bei Männern 173 schwierigkeiten hatten allerdings zugenommen. Mit seiner eigenen Mutter verstand er sich wieder gut und mittlerweile war auch ein engerer Kontakt mit deren Freund vorhanden. Beim zweiten Katamnesetermin - 2 Jahre nach Abschluß der stationären Behandlung hatte sich die Situation jedoch dramatisch verändert: Der Patient hatte sich auf Wunsch seiner Ehefrau einer sterilisierenden Vasektomie unterzogen. Die Partnerschaft hatte sich - für den Pat. ohne ersichtlichen Grund - akut verschlechtert und sexuelle Begegnungen fanden nur noch sehr selten statt. Er berichtete, daß seine Frau fast jeden Abend ohne ihn ausgehe und dann erst in den frühen Morgenstunden nach Hause komme. Sie mache sich vor dem Weggehen abends schön. Der Patient nahm alles kommentarlos hin und paßte auf die Kinder auf. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt seine Frau im 4. Monat schwanger, und der Patient trieb seine Verleugnung so weit, daß er meinte, daß seine Sterilisation u. U. operativ nicht gut gelungen sei. Bei diesem Gespräch hatte er auch mit einen deutlichen foetor alcoholicus und machte vom Gesamtbild her einen desolaten Eindruck. Beim Untersucher entstanden große Sorgen im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Patienten. Aber der erneute Versuch, ihn psychotherapeutisch in eine - mindestens stützende - Betreuung einzubinden, gelang nicht, weil der Patient den Kontakt endgültig abbrach. 2. Fallbericht Zur Symptomatik Der seinerzeit 47-jährige, etwas adipöse, Patient wurde uns von der Neurologischen Poliklinik unseres Hauses vorgestlelt, nachdem er dort über Eßattacken mit folgendem selbstinduziertem Erbrechen berichtet hatte. Die neurologische Abklärung fand statt, weil der Patient seit Jahren unter ischialgieformen Beschwerden litt, für die es aber kein ausreichendes organisches Korrelat gab. Wegen mehrerer anderer Beschwerden bzw. Leiden hatte der Patient zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf Berufsunfähigkeit eingereicht: Am linken Auge war eine Laserbehandlung wegen Netzhautablösung durchgeführt worden, außerdem bestand eine Hypertonie bei mäßiger Adipositas und eine Varikosis an beiden Beinen. Wegen rezidivierender aggressiver Durchbrüche, die gelegentlich auch mit gewalttätigen Übergriffen einhergingen, war der Patient 7 Jahre zuvor tiefenpsychologisch fundiert (einzeltherapeutisch) - im Hinblick auf die Wutausbrüche erfolgreich - behandelt worden. Ein seinerzeit bestehendes Alkoholproblem verschwand ebenfalls unter dieser Behandlung, jedoch kam es zu einem Syndrom-Shift: Noch unter der Therapie entwickelte der Patient sein bulimisches Eßverhalten, ohne darüber in der Behandlung zu sprechen. Vor Beginn dieser ambulanten Psychotherapie wurde die erste Ehe des Patienten geschieden, aus der eine gemeinsame Tochter hervorgegangen war. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung in unserer Poliklinik war der Patient seit 5 Jahren erneut verheiratet. Zuletzt hatte er zusammen mit seiner zweiten Frau einen Speiserestaurant betrieben, das er aber wegen zu geringer Einnahmen aufgeben mußte. Seither lebte er überwiegend auf Kosten seiner Ehefrau, die als Serviererin arbeitete. Da zum Zeitpunkt der Erstvorstellung der Rentenantrag noch nicht entschieden war, verabredeten wir mit dem Patienten weitere, ambulante Beratungsgespräche, um dann nach Abschluß des Rentenverfahrens zu einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Patienten 174 W. Köpp, B. Kallenbach zu kommen, ob eine Psychotherapie sinnvoll sei und von welcher Therapie er gegebenenfalls profitieren könnte. Wir verabredeten (nach seinem positiven Rentenbescheid) dann die stationäre Aufnahme für insgesamt 3 Monate. Zur Lebensgeschichte Der Patient wurde kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs in Berlin geboren. Seine Mutter (+ 28 Jahre) war wie die Großmutter mütterlicherseits Jüdin und war mit einem Deutschen Soldaten verheiratet. Die Großmutter mütterlicherseits kam im KZ um und die Eltern ließen sich unmittelbar nach der Geburt des Patienten scheiden. Sowohl dem Untersucher als auch dem Patienten war es bei der weiteren Schilderung der Lebensgeschichte unmöglich, zu entscheiden, welche Mitteilungen aus Erzählungen der Mutter stammen und was der Patient selber erlebt hat. Mutter berichtete wohl, daß sie den Vater des Patienten „zum Teufel gejagt“ habe und der Patient weinte an dieser Stelle. Er entwickelte eine Vorstellung, daß Vater wohl tot gewesen sein müsse, denn sonst hätte er seinen Sohn gesucht. 15 Jahre später - nach Abschluß verschiedener therapeutischer Maßnahmen - erfuhr der Patient von seiner Mutter erstmals, daß der leibliche Vater bis 1980 am Leben gewesen sei, was bei dem Patienten eine schwere Krise auslöste. Die Mutter des Patienten wurde als „lebenslustig, korrekt, sorgfältig, selbstbewußt und gutaussehend“ geschildert. Die Frage, ob sie ihm Nestwärme und Liebe vermittelt habe, wurde entschieden und ohne Überlegung verneint. Essen habe es immer reichlich gegeben, aber Mutter habe ihn oft sich selber überlassen. Nur wenn die Sirenen kamen (Luftangriffe) sei Mutter da gewesen. Er sei viel alleine gewesen, habe viel Angst gehabt („erst kam die Angst, dann meine Mutter“). Beim Alleinesein habe er auch häufig eingekotet. Der Patient schildert, daß Mutter verschiedene Männerbekanntschaften gehabt habe, offenbar auch zur politischen Prominenz. Dadurch sei er und seine Mutter vor Verfolgung geschützt gewesen. Nach dem Kriege habe seine Mutter einen Bäcker geheiratet und der Patient betont an dieser Stelle erneut, daß er nie Hunger und Durst haben mußte. Mutter habe ihn eher noch geschlagen, wenn er nicht alles aufgegessen habe. 3 Tage vor Kriegsende sei er noch eingeschult worden bzw. dann erneut nach einer Unterbrechung 4 Wochen später. Er schildert dann innerhalb Berlins einen häufigen Ortswechsel, was ein erster Hinweis auf eine gewisse Objektinkonstanz ist: „ Im Osten mußte ich Russisch - im Westen Englisch lernen!“. Er sei immer „sehr dumm“ gewesen und nur durch Bestechung seitens des Stiefvaters (Brot gegen gute Noten) sei er so durch die Schule „durchgezogen“ worden. In der Schule habe er sehr oft Angst gehabt, den Leistungsanforderungen nicht genügen zu können. Z.B. habe er immer sein Geburtsdatum vergessen. Andererseits sei er ein sehr aggressives Kind gewesen und habe schnell von sich aus Gewalttätigkeiten angefangen. Erst im 13. Lebensjahr sei er auf einen stärkeren Mitschüler gestoßen, danach habe die Gewalttätigkeit „plötzlich“ aufgehört. Die Entscheidung, Koch zu lernen, sei vom Stiefvater getroffen worden. Zur sexuellen Entwicklung Diese Schilderung klingt teilweise etwas infantil und bizarr: „Die Sexualität ist sehr gut! Ich onaniere, seit ich die Pubertät überwunden habe“. Im 7. Lebensjahr habe das Hausmädchen (bekleidet) rittlings über seinen Genitalien gesessen, was ihm gefallen habe. Bis Anorexie und Bulimie bei Männern 175 zum 20. Lebensjahr sei er sehr oft mit verschiedenen Frauen zusammen gewesen. Entweder sei es dabei zum frühzeitigen Erguß gekommen, oder er habe sein Glied nur am Unterleib der Frau gerieben. Seit dem ca. 20. Lebensjahr habe er dann richtigen Geschlechtsverkehr gehabt. Reifere Frauen hätten ihm nach und nach gezeigt, wie richtige Sexualität gehe. Patient meint: „Ich fing an, eine Frau richtig zu behandeln - von oben bis unten“. Und: „Heute bin ich der Perfekte“. Während der Pubertät (im 15. und 18. Lebensjahr) habe er auch homosexuelle Kontakte gehabt und seinerzeit auch (vergeblich) auf Geld von den ihn ansprechenden Männer gehofft. Seine erste Ehe, die er im 25. Lebensjahr schloß, wurde 3 Jahre später wegen seiner Alkoholproblematik und wegen der aggressiven Übergriffe geschieden. Zur diagnostischen Einschätzung Sämtliche diagnostischen Bulimie-Kriterien waren bei diesem Patienten erfüllt. Daher wurde trotz des relativ fortgeschrittenen Alters bei Beginn der Eßstörung von einer typischen Bulimia nervosa ausgegangen. Es fiel auf, daß die frühkindliche Entwicklung nur zur unvollständigen Ausbildung tragender bzw. stabilisierender innerer Objekte geführt hatte. Die Ursache konnte in einer Inkonstanz von Beziehungspersonen bzw. der Lebenssituation in der Kindheit gesehen werden, die durch staatlich organisierten Terror gekennzeichnet war. Dieser staatliche Terror brach auch in das ohnehin sehr brüchige Familienleben des Patienten ein (Ermordung der Großmutter im KZ). Nicht abweisbare Angst gehörte so gesehen zu den frühesten persistierenden Erlebnissen. Die Versorgung mit Nahrung dagegen war nie gefährdet. Zur Identifikation oder zum reifen (ich-gerechten) Konkurrieren mit männlichen Vorbildern ist es nie gekommen, da auch hier keine äußere Objektkonstanz bestand. So gesehen war auch eine aus den introjizierten äußeren Objekten enstandene Selbstrepräsentanz nur unvollständig ausgebildet und die aggressiven Durchbrüche (z.B. gegenüber der ersten Ehefrau) sind ein Hinweis darauf, daß dem Patienten eine angemessene Steuerung aggressiver Impulse nicht gelang. Die ungesteuerte, primärprozeßhafte und narzißtische Wut, die hier zum Vorschein kam, speiste sich wahrscheinlich aus einer tiefsitzenden Verlustangst, und mußte immer wieder der Stabilisierung des brüchigen Selbst dienen. Auffällig war nun die Symptomverschiebung, wobei Alkoholkonsum und Aggressivität sich besserten, dafür aber die Bulimie neu auftrat. Zum Verlauf Insgesamt läßt sich bei diesem Patienten ein Verlauf von mehr als 15 Jahren beschreiben, bei dem es intermittierend zu psychotherapeutischen Interventionen kam. Am Anfang stand die 1-jährige, analytisch fundierte Einzeltherapie, bei der es zur Symptomverschiebung von Alkoholkonsum und Aggressivität hin zur Bulimie kam. Die zweite therapeutische Maßnahme war dann sieben Jahre später unter stationären Bedingungen (tiefenpsycholigsch orientiert mit verhaltensmodifikatorischen Elementen). Von dieser Maßnahme konnte der Patient profitieren, es kam auch zur verstärkten Außensteuerung seines Eßverhaltens und der Patient konnte in angemessener Weise sein Gewicht reduzieren und stabilisieren. Er nahm ambulant im weiteren Verlauf an einer Selbsthilfegruppe teil, zu der er dann den Kontakt aber zunehmend lockerte und dann auch ein Rückfall in sein altes Eßverhalten stattfand. Bei einem zweiten stationären psychosomatischen Aufenthalt in einer anderen Klinik, 176 W. Köpp, B. Kallenbach deren therapeutische Orientierung wie in der ersten Klinik tiefenpsychologisch war, kam es wiederum zur passageren Besserung; allerdings standen hier auch nun mittlerweile aufgetretene schwere Partnerschaftskonflikte im Focus der Therapiemaßnahmen. Im weiteren Verlauf wandte sich der Patient erneut an unsere Poliklinik, wo ihm in größeren Zeitabständen Beratungsgespräche angeboten wurden. Mit zunehmender Tendenz seiner Ehefrau, sich von ihm zu trennen, wurden die buliimischen Attacken wieder heftiger und zwischenzeitlich auch abgelöst von vermehrtem Alkoholkonsum. Der Patient wurde dann in einer verhaltenstherapeutische Klinik überwiesen, in der das Alkoholproblem erfolgreich therapiert wurde, jedoch die bulimische Symptomatik wieder stärker hervortrat. Im Anschluß daran wurde erneut mit dem Patienten eine mehr als 1-jährige tiefenpsychologisch fundierte ambulante Einzeltherapie bei einem männlichen Therapeuten durchgeführt. In dieser Therapie verschwand die bulimische Symptomatik – für die Dauer der Psychotherapie! – nach zwei Monaten völlig, ohne daß das Alkoholproblem symptomatisch wieder in den Vordergrund rückte. Die wöchentlich einmal stattfindenden Therapiesitzungen vermittelten ihm Halt und Orientierung und er fühlte sich weniger alleine gelassen in den Zeiten der Abwesenheit seiner Frau. Der Patient konnte sich im weiteren Verlauf auch intensiv mit seiner Lebensgeschichte befassen. Dabei wurde noch einmal deutlich, wie brüchig seine Identität als Mann war. Erstmals tauchten Phantasien auf, Sex mit Kindern zu haben, die jedoch in keinem Fall agiert werden mußten. Sie korrelierten mit dem Auftauchen von Erinnerungen an jüdische Nachbarskinder, die dann „plötzlich verschwunden“ waren. Diese ängstigenden Verlustsituationen wurden seinerzeit vom Patienten notgedrungen - verleugnet und trugen mit dazu bei, die äußere Wirklichkeit für ihn auch im späteren Leben immer wieder als unsicher bzw. unwirklich erscheinen zu lassen. 2 Jahre nach Abschluß dieser letzten Therapiemaßnahme wurde mit dem Patienten erneut Kontakt aufgenommen. Er befand sich in einer Art Dauerkrise, war mittlerweile 62 Jahre alt und hatte sich auf sein bulimisches Verhalten eingestellt: Das Frühstück konnte er behalten, abends fand immer wieder - besonders beim Alleinesein - Erbrechen statt. Der Kontakt mit seiner Frau ist immer reduzierter geworden, Sexualität findet überhaupt nicht mehr statt. Er kümmert sich um den Hund eines Nachbarn, der so eine Art „Lebensgefährte“ für ihn geworden ist. Er hat das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wohin er gehört. So habe er sich an die Jüdische Gemeinde gewandt, um dort Mitglied zu werden, aber er sei sich auch nicht darüber im klaren, ob das für ihn stimme. Er bemüht sich um eine Art aktive Symbolisierung, wenn er sagt: „Erbrechen ist für mich ein Notbehelf gegen die Fülle von Eindrücken, die mein Bauch nicht mehr behalten kann“. Diskussion Bei den Fallgeschichten beider Patienten handelt es sich letzlich um Verläufe, bei denen die therapeutischen Interventionen nicht erfolgreich verliefen. Bei beiden Patienten haben lebensgeschichtliche Ereignisse bzw. aktuelle psychosoziale Lebensumstände in einer Weise zusammenwirkt, daß ein Bedingungsgefüge entstanden ist, das prädisponierend für einen chronischen Verlauf war. Allenfalls bei dem oben dargestellten BNPatienten wird man bei wohlwollender Beurteilung des Verlaufes sagen können, daß eine relative Stabilisierung bzw. die Verhinderung einer weiteren Verschlechterung des Krankheitsbildes erreicht wurde. Anorexie und Bulimie bei Männern 177 Das Verständnis von „Chronizität“ als „langsamer, schleichender Krankheitsverlauf“ erscheint gerade bei diesen beiden Patienten als eine starke Vereinfachung und schließt die dynamischen Aspekte der Erkrankung selber überhaupt nicht ein (im Gegensatz dazu die Primär chronische Polyarthritis in der Inneren Medizin). Auf die Problematik des Begriffes „Chronizität“ haben vor allem Potreck-Rose u. Koch (1994) hingewiesen. Nicht immer sind Therapiemaßnahmen bei eßgestörten Männern so unwirksam wie bei den hier dargestellten Patienten. So schilderte Haisch (1991) einen wirklich aufseheneregenden Erfolg bei einem 29 jährigen Landwirt, der seit dem 14. Lebensjahr unter einer AN litt. In nur sechs Monaten gelang diesem Mann eine völlige Veränderung seiner Lebensverhältnisse und seines Lebensstiles. Das schloß das sexuelle Interesse und die erfolgreiche Familiengründung mit ein. Die Schriftleitung des publizierenden Journals bemerkte in einem Kommentar zu diesem Fallbeispiel, daß der therapeutische Erfolg sich parallel zur Verbesserung der therapeutischen Beziehung eingestellt hatte. U.U. ist hier eine Schlüsselvariable für die psychotherapeutische Erfolgschance beschrieben: die Fähigkeit tragende Objektbeziehungen - innerhalb der Therapie als „helpful alliance“ im Sinne von Luborsky (1988) - herzustellen. Das gelang nämlich in dem Fall des oben geschilderten AN-Patienten gar nicht und im Falle des BN-Patienten nur zum Teil - nämlich als eine Art Inanspruchnahme des Therapeuten als äußeres, steuerndes Objekt. Beziehungsfähigkeit und Fähigkeit zur Gestaltung einer Beziehung drücken sich selbstverständlich auch in der Potenz aus, sexuelle Kontakte anzuknüpfen und aufrecht zu erhalten, was beiden Patienten nur rudimentär und zeitlich befristet gelang. Darüber hinaus wird man fragen können, inwieweit vorwiegend regressive oder vielmehr defizitär-strukturelle Momente ursächlich für die komplexe Phänomenologie des Syndromes „Eßstörung“ eine Rolle spielen. Wie eingangs erwähnt, lassen auch diese Fallbeispiele selbstverständlich keine Verallgemeinerungen hinsichltich der Einschätzung der Pathologie eßgestörter Männer (im Vergleich zur Pathologie eßgestörter Frauen) zu. Aber immerhin zeigen diese Beispiele, selbst unter Berücksichtigung der ggf. vorhandenen Selektionseffekte, womit man auch bei eßgestörten Männern rechnen muß. Ob die psychopathologische Phänomenologie eßgestörter Männer eine gänzlich andere als die eßgestörter Frauen ist, wird man bezweifeln können. So bleibt die Frage unbeantwortet, unter welchen spezifischen Bedingungen Männer an einer klassischen Frauenkrankheit zu leiden beginnen; dennoch sind die Fallbeschreibungen männlicher Eßgestörter wertvoll, weil sie ein Licht auf geschlechtsspezifische kulturelle Faktoren werfen, die prädisponierend oder protektiv im Hinblick auf die Entwicklung von Eßstörungen sein können. 178 W. Köpp, B. Kallenbach Literatur American Psychiatric Association (1987): Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3rd ed revised. Washington D.C., American Psychiatric Association. Carlat, D.J.; Camargo, C.A.; Herzog, D.B. (1997): Eating disorders in males: A report on 135 patients. Am. J. Psychiatry 154: 1127-1132. Deter, H.C.; Köpp, W.; Zipfel, S.; Herzog, W. (1998): Männliche Anorexia-nervosa-Patienten im Langzeitverlauf. Nervenarzt 69: 419-426. Haisch, I. (1991): Fallbericht einer männlichen Anorexie. Psychother.Psychosom. 36: 45-49. Herpertz, S.; Kocnar, M.; Senf, W. (1997): Bulimia nervosa beim männlichen Geschlecht. Z. psychosom. Med. 43: 39-56. Kearny-Cooke, A.; Steichen-Asch, P. (1990): Men, body image and eating disorders. In: Anderson AE (ed) Males with eating disorders. New York: Brunner & Mazel: 54-74. Köpp, W.; Jacoby, G.E. (1994): Der frühe Psychotherapieabbruch eßgestörter Männer und Frauen in der stationären Psychotherapie. Psychologie in der Medizin 5: 24-29 Luborsky, L. (1988): Einführung in die anlytische Psychotherapie. Berlin: Springer. Potreck-Rose, F.; Koch, U. (1994): Chronifizierungsprozesse bei psychosomatischen Patienten. Stuttgart: Schattauer. Robinson, P.H.; Holden, N.L. (1986): Bulimia nervosa in the male: a report of nine cases. Psychol. Med. 16: 795-803. Tabin, C.J.; Tabin, J.K. (1990): Bulimia and anorexia: Understanding their gender specifity and their complex symptoms. In: Schwartz H.J. (ed.) Bulimia: Psychoanalytic treatment and theory. Madison: International University Press: 173-226. Wilps, R.F. (1990): Male bulimia nervosa: An autobiographical case study. In: Anderson A.E. (ed.) Males with eating disorders. New York: Brunner & Mazel: 9-29. Anschrift der Autoren Priv. Doz. Dr. med. W. Köpp, B. Kallenbach, Eßstörungsambulanz der Abt. f. Psychosomatik u. Psychotherapie, Klinikum Benjamin Franklin der FU Berlin, Hindenburgdamm 30, D-12200 Berlin, e-mail: [email protected] Historia Sexuologie Träume in der Pubertät - die frühe Homoerotik August von Platens Dreams in Puberty - the early Homoeroticism of August von Platen J. Wilkes Zusammenfassung: Der Dichter August Graf von Platen (1796 - 1835) litt zeitlebens an seinen homoerotischen Neigungen. Schon früh teilt er seinen Tagebüchern seine Sehnsüchte und Enttäuschungen mit. Dort notiert er auch seine Träume, die ihn in der Pubertät beschäftigten. Diese Träume werden auf ihre homoerotischen Inhalte hin analysiert. Schlüsselwörter: August von Platen, Homosexualität, Traumdeutung. Abstract: All his life the poet August Graf von Platen suffered from his homoerotic inclination. Already in his youth he wrote in his diary about his pinings and disappointments. He also wrote ababout his dreams which were on his mind in puberty. These dreams are analysed for their homoerotic contents. Keywords: August von Platen, Homosexuality, Dream Interpretation. „Grausames Schicksal, warum kann ich nicht Von diesem süßen Himmelstraum genesen?“ (Platen 1896: Bd1, 61) Einleitung Wer war der Dichter August Graf von Platen (1796 – 1835)? Ein kalter Formalist, ein Künstler, der marmorglatten, marmorkalten Verse, dem, wie Goethe es zu bemerken schien, die Liebe fehlte oder ein Todesritter, eine Mischung aus Don Quijote und Tristan, wie Thomas Mann behauptete? Ein Leidender sicherlich, leidend an seiner homosexuellen Veranlagung, suchend nach männlicher Schönheit. Unerwidert blieben seine zahlreichen Leidenschaften, erfolglos umwarb er in München Offizierskollegen und Kommilitonen an den Universitäten zu Würzburg und Erlangen. Er war und blieb ein einsamer Mensch, dem nur sein Tagebuch blieb, seine Nöte anzuvertrauen. Hier offenbarte er in oft schonungsloser Weise seine Gefühle und dieses schon mit 15 Jahren. So entstand eine lange Reihe von Blättern, die nur von seiner Neigung im engsten Sinne handeln. In diesen Aufzeichnungen teilte uns Platen auch seine damaligen Träume mit, welche uns als Via regia zum Verständnis seiner Seelenlage dienen sollen. In der psychoanalytischen Literatur gibt es keine uns bekannte Aufarbeitung seiner Träume. Ansätze zu tiefenpsychologischen Interpretationen finden sich in literaturwissenschaftlichen Studien, vor allem bei Peter Link, der in den aufgezeichneten Träumen Platens einen Beleg für eine „Urszene“ sieht: Seine Mutter steht mit ihrem kleinen Sohn Sexuologie 6 (3) 1999: 17 9 – 185 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie 180 J. Wilkes auf dem Arm vor dem Spiegel und deutet auf „den süßen Knaben“, der sich mit ihrem Spiegelbild identifiziert, während die Mutter den Knaben, genauer sein Spiegelbild, lieben lernt (Link 1971). Detering (1994) kritisierte Link dahingehend, daß durch diese von Link frei erfundene Szene das vormals freudianische Narzismus-Modell in Richtung auf das Modell des „Spiegelstadiums“ Jacques Lacans umgedeutet werden soll, ein Einwand, den Link aufgrund des reichlichen Belegmaterials in Platens Schriften aktuell zurückweist (Link, 1998). In der vorliegenden Arbeit sollen die Träume Platens umfassender im Sinne der psychoanalytischen Traumdeutung interpretiert werden. Platens erste große Liebe Platen, der aus verarmtem Adel abstammte, wurde schon als Kind dem Elternhaus entrissen. Sein Vater, ein Ansbacher Oberforstmeister, sandte den erst 9-jährigen August auf die Münchner Kadettenanstalt, wo er ganz unter Knaben erste homoerotische Gefühle verspürte. Mit 14 Jahren wechselte Platen in die Pagerie des Königs. Der junge Platen befand sich mitten in der Pubertät, einer Entwicklungsperiode, in der die Wandlungen einsetzen, welche das infantile Sexualleben in seine letztendliche Gestaltung überführen sollen. War der Sexualtrieb bisher vorwiegend autoerotisch, so findet er nun sein Sexualobjekt. Unter dem Primat der Genitalzonen ordnen sich die erogenen Zonen unter und ein neues Sexualziel wird gesucht. Platens Ödipuskomplex, auf den Link mit seiner „Urszene“ abhebt, erfährt eine Neubelebung im Unbewußten, während sich die Sexualtriebe in ihrer vollen Intensität entwickeln. Das Aufwachen „ganz unter Knaben“ mag dabei Platens Sexualprävalenz neben seiner starken Mutterbindung wesentlich mitbeeinflußt haben. Auf die Phase des Autoerotismus folgt als nächste Stufe der Libidoentwicklung zunächst der primäre Narzismus. Auch diese Phase ist autoerotischer Natur, denn das Objekt ist der eigene Körper. In den nachfolgend aufgeführten Träumen des pubertierenden Platen wird deutlich, daß die verschiedenen Phasen seiner Libidoentwicklung (Autoerotismus Narzismus - Objektliebe) sich zeitlich nicht scharf voneinander abgrenzen lassen, sondern daß die Übergänge zu Allo-(Homo- und Hetero-)Erotismus fließend sind. Die Traumbilder changieren zwischen dem Bild des Geliebten und dem des eigenen Anblicks, welches insbesondere durch die Spiegelmotive bewirkt wird. Mit 17 Jahren verliebte sich Platen in der Pagerie das erste Mal ernsthaft. Seinem Tagebuch vertraute er an: „Auf einem Hofballe am 10. Februar (1813) sah ich zuerst den jungen Grafen (Mercy D’Argenteau), den Bruder des (französi)schen Gesandten an unserem Hofe [...]. Er war nicht schön, auch nicht sehr groß, blond und sehr schmächtig [...]. Je öfter ich ihn sah, desto lebhafter wurde meine Sehnsucht. Ich habe ihn nie gesprochen und nie etwas von seinem Charakter erfahren. Fast täglich glaubte ich ihn abgereist [...].“ (Platen 1896: Bd 1, 58). Schwärmerisch und leidenschaftlich verliebt sich der junge Platen. Seine Gefühle sind so intensiv, daß sie seine Fantasie beflügeln und er von Mercy zu träumen beginnt. „Diese Nacht streifte ich durch eine finstere, mondleere Gegend. Ich hatte eine Fackel in der Hand, und mir war’s, als müßte ich, der Ceres gleich, jeden Winkel der Erde durchsuchen, ihn aufzufinden. Da hörte ich von ferne das Rauschen eines Bachs, und vermöge seines hörbaren Getöses kam ich bis an sein Ufer. Welch einen Anblick hatte ich, als ich mit der Fackel umherleuchtete. Ein sanft hingleitendes Bächlein drängte seine silbernen Träume in der Pubertät - die frühe Homoerotik August von Platens 181 Wellen durch duftende Blumen, die mir mehr durch ihren Geruch als durch den matten Schein meines Lichtes kennbar wurden. Aber am Ufer des Baches, da lag mein schlafender M**. Seine äußersten Locken netzten sich in den Wellen und die Fackel gewährte mir den Anblick seiner holden Züge. Aber ich bemerkte an einer schnellen Bewegung, daß ihn der helle Schein beunruhigte. Ich steckte daher meine Leuchte umgekehrt in den Boden, daß sie auslöschte, und begnügte mich, vor ihm niederzuknien und ihn vor jeder falschen Wendung zu sichern, die ihn in den Wellen hätte begraben können; denn seinen Schlaf wollte ich nicht stören. Ich beugte mich über ihn hin, obgleich ihn die Nacht meinen Blicken verbarg, und so wollte ich die Morgenröte erwarten. Sie kam endlich. Herrlich entfaltete sich die Landschaft um mich her, ein Tal bildend, das rings von hohen Bergen umschlossen war. Den Samen aller Blumen, die sonst unter Gärtners Hand nur gedeihen, hatte Natur hier ausgestreut. Aber was war mir dies gegen Endymions Schlummer? Wie wünschte ich, daß er aufwachte, um alle Vergißmeinnichte durch seine Augen zu beschämen. Ich sollte zu bald erhört werden. Noch war die Gegend nur vom Dämmerscheine erhellt, der keine Strahlen von sich warf. Kaum brach der erste derselben durch die erleuchteten Wolken, als M** erwachte, und ich mit - ihm.“ (Platen 1896: Bd 1, 65) Finster und mondleer erscheint Platen die Welt ohne Mercy. Wie Ceres, die Erdgöttin der Fruchtbarkeit, ihre von Hades in die Unterwelt entführte Tochter Persephone, so sucht Platen den Geliebten. Er vergleicht ihn mit Endymion. Endymion wurde von der Mondgöttin Selene in den Schlaf gezaubert, damit sie ihn ungestört küssen konnte. Die Anleihen bei der Antike sind für Platens Fantasiewelt kennzeichnend. In der Welt des griechischen Altertums fühlt sich Platen mit seiner verbotenen homosexuellen Neigung verstanden und aufgehoben. Wir haben in dieser zeitlichen Verschiebung einen Kompensationsversuch des jungen Dichters zu sehen, der sich lange nicht klar darüber wurde, ob er seine Neigung bekämpfen oder akzeptieren soll. Platen suchte einen Mittelweg, in dem er seine Männerliebe platonisch definierte und sie jeder realen Sexualität entkleidete. Selbst in seinen Träumen funktionierte diese Zensur. In der schwärmerischen Betrachtung seines schlafenden Geliebten läßt ihn der Traum ungestört verweilen. Als Mercy jedoch aufwacht und eine intensive Begegnung droht, flieht ihn der Traum und läßt ihn erwachen. Traum ist also für Platen nicht in erster Linie die verkleidete Erfüllung eines verdrängten Wunsches, wie es Sigmund Freud als wesentliche Funktion des Traumes beschreibt (Freud 1940: 166). In Platens Traum scheinen die gleichen Mechanismen wirksam zu sein, mit denen der Dichter auch im wachen Zustand seine Gefühle beschränkt. Ängstlich bemüht er sich über viele Jahre sein sexuelles Verlangen zu bekämpfen: „Dann weiß ich, daß ein sträfliches Verhältnis zwischen Männern existieren kann, und dies erregt mir einen unbeschreiblichen Widerwillen“ (Platen 1896: Bd 2, 67). Unglücklich, ja zornig reagiert der unterbrochene Träumer: „So floh mich der neidische Traumgott gerade da, wo er mich aufs höchste gespannt hatte.“ (Platen 1896: Bd 1, 66). Die ersehnte und zugleich gefürchtete Wunscherfüllung wird ihm nicht zuteil, auf die „höchste Gespanntheit“ erfolgt nicht die erhoffte Entspannung. Noch im Traum erfolgt die Kontrolle der Triebe, vielleicht weil Platen, wie es Freud auch bei anderen Homosexuellen festzustellen meinte, sich durch besonders hohe intellektuelle Entwicklung und ethische Kultur auszeichnete (Freud 1940b: 56). So wird an diesem Traumbeispiel Freuds These belegt, daß der Traum eine Kompromißbildung zwischen 182 J. Wilkes dem Anspruch einer verdrängten Triebregung und dem Widerstand einer zensurierenden Macht im Ich sein kann (Freud 1940c: 71). Spiegelbilder Mit der träumerischen Gleichsetzung des Geliebten mit Endymion beschwört Platen alte Spiegelmythen. Das Bild des Geliebten und sein eigenes Antlitz verschwimmen. Schon bei der Beschreibung Mercys – „nicht schön, nicht sehr groß, blond und sehr schmächtig“ – sind Parallelen zur eigenen Physiognomie unverkennbar. Platen träumt einen Träumer und damit auf einer Metaebene sich selbst. Der Träumer liegt wie Narziß dicht am Ufer eines Gewässers. Wacht er auf, wen wird er erblicken? Auch hier verschwimmt das eigene Bild mit dem des Freundes. Hierzu passen auch folgende Zeilen, die um 1814, also etwa zur gleichen Zeit entstanden sein dürften: „Und glänzt mein Bild in der ruhigen Flut, Und säuseln die Wipfel der Buchen, Da erneuert sich mir die sehnende Glut Und mein vergebliches Suchen [...]“ (Platen 1910, Bd 5: 71) Das Sehnen hervorgerufen durch den Anblick des eigenen Spiegelbildes, ein schönes Bild erwachender Autoerotik. Zum Verständnis der Konflikte Platens muß daran erinnert werden, daß autoerotische Handlungen zu seiner Zeit stark verpönt waren. Und das nicht nur durch einen strengen Sittenkodex oder durch Drohungen vor möglichen Erkrankungen, sondern im Falle von Platen auch sehr konkret in der Kadettenanstalt durch Anlegung eines ledernen Muffs, um das Laster der „Selbstbefleckung“ zu verhindern. Neben dem Sehnen nach Erotik ist jedoch auch das Sehnen nach Selbsterkenntnis, symbolisiert durch den Blick in die eigenen Augen, den Spiegel der Seele, unverkennbar. Des jungen Platens zeitlos gültige Fragen lauten: „Wer bin ich? Wie bin ich? Darf ich so sein wie ich befürchte zu sein?“ Auch Platens weibliche Anteile werden in dem Traume sichtbar. Vergleicht er sich doch mit der Göttin Ceres und auch mit der Mondgöttin Selene. Solche Assoziationen waren für Platen nicht ungewöhnlich. So schreibt er in seinen Tagebüchern: „Am meisten gefiel mir die Zartheit der Weiber, aber ich sah sie nicht als etwas Auswärtiges, sondern als etwas auch meinem Wesen Inwohnendes an.“ (Platen 1896: Bd 1, 67). C. G. Jung hätte es wohl als eine Facette seiner Anima bezeichnet. Der junge Platen idealisiert in schwärmerischer Weise den Geliebten. In einem anderen Traum sieht er ihn Werke der Wohltätigkeit ausüben, indem er einem Armen aufhilft und die Gläubiger befriedigt. Dies alles beobachtend stürzt Platen auf den Geliebten zu, ergreift mit Heftigkeit seine Hand und drückt sie schluchzend an seine Lippe, ausrufend: „O Mercy, wie groß sind Sie, wie gut, zu göttlich für diese Erde!“ (Platen 1896: Bd 1, 65). Gepeinigt ständig vom Gedanken der nahen Abreise Mercys, nimmt er dieses Ereignis in seinen Träumen vorweg, in Nachtträumen und Taggesichten: „O ich bin oft mit wachenden Augen in Träume vertieft“ (Platen 1896: Bd 1, 62). Auf die Gemeinsamkeiten von Tag- und Nachtträumen hat Freud hingewiesen. Zentrales Motiv sei jeweils die Wunscherfüllung, ermöglicht durch ein Nachlassen der Zensur. Die Unterschiede bestünden vor allem darin, daß der Schläfer die Halluzination mit vollem Glauben annehme. „Dieser Träume in der Pubertät - die frühe Homoerotik August von Platens 183 Charakter scheidet den echten Schlaftraum von der Tagträumerei, die niemals mit der Realität verwechselt wird“ (Freud 1940a: 495f.). Es sei denn bei gewissen Formen der Pseudologia phantastica, auf die als erster Anton Delbrück hinwies (Delbrück 1891). Wie schwierig und mühsam ist es in der therapeutischen Arbeit mit adoleszenten männlichen Patienten oft, Träume erinnert zu bekommen. Die Widerstände hiergegen sind anders als bei vielen Mädchen meist sehr groß. Oft entspricht das Träumen nicht dem gängigen Männlichkeitskonzept der heranwachsenden Jungen. Der Kampf um Anerkennung, die Auseinandersetzungen mit der äußeren Welt, verstellen oft den Blick ins Innere, letzterer wird als Schwächung empfunden. Die gegenwärtig größte Anerkennung unter Jugendlichen und damit das größte angestrebte Ziel ist, „cool“ zu sein oder zumindest so zu erscheinen. „Cool“ bedeutet, ein starkes Selbst zu besitzen, keine Gefühle der Schwäche zu zeigen, über den Dingen zu stehen, sich nicht anrühren zu lassen, die eigenen Affekte maximal zu kontrollieren. Der Jugendliche spürt, daß gerade der letzte Punkt, die Affektkontrolle, ihm im Traum genommen wird, woraus ein großer Teil der Widerstände resultieren mag. Der junge Platen hingegen und wohl die meisten seiner Alterskameraden hatten in der Zeit der Romantik ein völlig anderes Selbstkonzept. Man wollte leidenschaftlich sein, feurige Liebe empfinden, sich begeistern für Ideen und Ideale. Man ließ sich gerne anrühren und schämte sich nicht seiner Gefühle, es sei denn, wie in der tragischen Geschichte des jungen Platen, daß diese Gefühle nicht den Konventionen der Zeit entsprachen. So konnte Platen vieles nur sich selbst eingestehen und mußte sich davor hüten, es nach außen dringen zu lassen. Insofern ist seine Seelenlage in gewisser Hinsicht durchaus auch der vieler heutiger Jugendlicher vergleichbar. Der junge Platen ringt um die Erinnerung eines jeden Traumes. Die nächtliche unbewußte Wunscherfüllung – wenn sie ihm denn zuteil wurde – reicht ihm nicht aus, er will sie am Morgen ins Bewußtsein rücken, sie nacherleben und in seinen Gedanken auskosten. Dieses gelingt ihm nicht immer und so konstatiert er traurig: „So schwach ist das Gedächtnis, daß es die Dinge vergessen kann, die uns am liebsten sind.“ (Platen 1896: Bd 1, 62). Traumsymbole Vielleicht das Merkwürdigste der Traumlehre ist die Symbolik. Symbole gestatten unter Umständen - wie auch Sigmund Freud einräumte - einen Traum zu deuten, ohne den Träumer zu befragen. „Kennt man die gebräuchlichen Traumsymbole und dazu die Person des Träumers, die Verhältnisse, unter denen er lebt, und die Eindrücke, nach welchen der Traum vorgefallen ist, so ist man oft in der Lage, einen Traum ohne weiteres zu deuten, ihn gleichsam vom Blatt weg zu übersetzen.“ (Freud 1940d: 152). Freilich relativiert Freud diese These und weist darauf hin, daß ein solches Kunststück zwar dem Traumdeuter schmeichele, die assoziative Technik jedoch nicht ersetzen kann und allenfalls eine brauchbare Ergänzung darstellt. Auch in Platens Träumen wimmelt es von Symbolen. Beruhend auf der Kenntnis seiner homophilen Neigung ist man schnell geneigt, die auftretenden Symbole auch in dieser Richtung zu deuten. In dem anfangs geschilderten Traum kann in der Fackel ein phallisches Symbol gesehen werden. Platen löscht sie, indem er sie aus Rücksicht auf den schlafenden Geliebten neben den Schläfer umgekehrt in den Boden steckt und den Ge- 184 J. Wilkes liebten nicht wie von Selene beabsichtigt küßt. Die Hemmungen sind auch hier stärker als die Triebe. Die herbeigesehnte geschlechtliche Erfüllung wird Platen nicht zuteil. Die Fackel senkt sich und erlischt. Auch die Landschaftsbeschreibungen sind voller erotischer Symbole. Die herrliche Landschaft von der Morgenröte beschienen (Eos, übrigens eine Schwester der Selene), ein Tal bildend, von hohen Bergen umschlossen. Dazu der ausgestreute Samen aller Blumen. Die Symbolisierung der homoerotischen Wünsche kann als Verschiebung aufgefaßt werden. Ein wichtiges, aber anstößiges Element wird durch ein indifferentes ersetzt, das der Zensur so harmlos erscheint, wie eine sehr entfernte Anspielung auf den latenten Inhalt (Phallus ! Fackel, Tal ! Rima ani, Blumensamen ! Ejakulation). Bemerkenswert ist, daß der Träumer sich der Symbolhaftigkeit der geträumten Bilder nicht bewußt ist. So wird verständlich, warum Platen die Traumgesichte tags drauf ohne Scheu niederschreiben kann. Er war sich des versteckten Sinnes allem Anschein nach nicht bewußt und konnte und brauchte deren Inkognito nicht zu lüften. Schlußgedanken Sicher sind Platens Träume vielschichtiger und sollen und können nicht auf ihre (homo)erotische Komponenten reduziert werden. Der komplexe Wandel von Licht und Dunkelheit, von Dämmerung und klarem Schein ist häufig leitmotivisch für Platens Träume. Sinn und Sinnsuche werden thematisiert, das Bedürfnis des pubertierenden Dichters, dem Sehnen nach einem Lebensziel ein Bild zu geben, ist augenfällig. Die Suche nach einer Anschauung im konkreten Sinne des Wortes, nach einem Ideal, zu dem er aufschauen kann und das seinem Sehnen und Suchen eine Richtung gibt. Aus den homoerotischen Träumen Platens kann noch nicht auf die schlußendliche Fixierung seiner Sexualprävalenz geschlossen werden. Die homosexuelle Objektwahl ist in der Pubertät ein regelmäßiges Zwischenstadium in der sich entwickelnden Objektliebe. Warum der nächste Schritt, die Wahl eines heterosexuellen Objekts, ausblieb und Platens Triebschicksal auf seine homoerotischen Neigungen fixierte, soll nicht auf zwar mögliche, letztlich jedoch nicht zu belegende, ödipale Konflikte reduziert werden. Will man Platen und seiner Homosexualität gerecht werden, so muß man konstatieren, daß wir nicht wissen, warum seine Sexualprävalenz stets auf das eigene Geschlecht bezogen blieb. Was wir wissen ist, daß er an dieser Fixierung und mehr noch an den gesellschaftlichen Reaktionen darauf litt, sie ihm jedoch andererseits zur Triebfeder seiner literarischen Arbeit wurden und insbesondere seine Gedichte durch eine hohe Form von Sublimierung ein bedeutendes Niveau erreichten. V. Platen blieb ein unglücklicher Mensch. Seine Wünsche konnte ihm sein Leben nicht erfüllen und auch seine Träume brachten ihm nicht zuverlässig die erwünschte Erfüllung. Im ersten Druck von Platens Tristan-Gedicht, finden sich diese Verse (Platen 1910, Bd 8: 268ff.): Was er wünscht, das ist ihm nie geworden, Und die Stunden, die das Leben spinnen, Sind nur Mörder, die gemach ihn morden: Was er will, das wird er nie gewinnen, Was er wünscht, das ist ihm nie geworden. Träume in der Pubertät - die frühe Homoerotik August von Platens 185 Literatur Delbrück, A. (1891): Die pathologische Lüge. Stuttgart: Enke. Detering, H. (1994): Das offene Geheimnis. Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winkelmann bis Thomas Mann. Göttingen: Wallstein. Freud, S. (1940a): Die Traumdeutung. In: Gesammelte Werke, Bd. 2/3. London: Imago. Freud, S. (1940b): Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. In: Gesammelte Werke, Bd. 5. London: Imago. Freud, S. (1940c): Selbstdarstellung. In: Gesammelte Werke, Bd. 14. London: Imago. Freud, S. (1940d): Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In: Gesammelte Werke, Bd. 11. London: Imago. Link, J. (1971): Artistische Form und ästhetischer Sinn in Platens Lyrik. Fink: München Link, J. (1998): Sprünge im Spiegel, Zäsuren. Ein Faszinationskomplex und Platens lyrischer Stil. In: Bobzin, H. u. Och, G. (Hrsg.): August Graf von Platen. Leben – Werk – Wirkung. Paderborn: Schöningh. Platen, A. v. (1896): Die Tagebücher. Stuttgart: Cotta. Platen, A. v. (1910): Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg.: Koch, M. u. Petzet, E. Leipzig. Anschrift des Autors Dr. med. J. Wilkes, Psychiatrische Klinik der Universität Erlangen-Nürnberg (Komm. Direktor: Prof. Dr. Demling), Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Leiter: Prof. Dr. R. Castell). Schwabachanlage 6 und 10, 91054 Erlangen Sexuologie Aktuelles Epidemiologie sexuell übertragbarer Krankheiten AIDS in der Bundesrepublik Deutschland (Quelle: AIDS-HIV Halbjahresbericht I/99 des AIDS-Zentrums im Robert-Koch-Institut Tab. 1: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei Kindern (<13 Jahre) nach Infektionsrisiko und aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand: 30. 06. 99) Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose Juli 97 –Juni. 98 Juli 98 –Juni. 99 Gesamt Hämophile 0 0,0 % 0 0,0 % 9 7,6% Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) 0 0,0 % 0 0,0 % 13 11,0% Patienten aus Pattern-II-Ländern* 5 100 % 1 100 % 94 79,7% Keine Angaben 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,7 % Gesamt 5 100 % 1 100 % 118 100 % Tab. 2: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei männlichen Jugendlichen und Erwachsenen (>12 Jahre) nach Infektionsrisiko und aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand: 30. 06. 99) Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose Juli 97 –Juni 98 Juli 98 –Juni 99 Gesamt Homo- oder bisexuelle Männer 325 61,4% 170 63,4% 11832 73,7% i. v. Drogenabhängige 53 10,0% 30 11,2% 1778 11,1% Hämophile 2 0,4% 1 0,4% 538 3,4 % Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) 2 0,4% 2 0,4% 125 0,8 % Heterosexuelle Kontakte (ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 32 6,0% 12 4,5% 483 3,0% Sexuologie 6 (3) 1999: 186 – 188 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie Epidemiologie sexuell übertragbarer Krankheiten Infektionsrisiko 187 Zeitraum der Diagnose Juli 97 –Juni 98 Juli 98 –Juni 99 Gesamt 30 5,7% 12 4,5% 253 1,6% Keine Angaben 85 16,1% 42 15,7% 1035 6,5% Gesamt 529 100 % 268 100 % 16044 100 % Patienten aus Pattern-II-Ländern Tab. 3: Verteilung der gemeldeten AIDS-Fälle bei weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen (>12 Jahre) nach Infektionsrisiko und aufgeführten Zeiträumen der Diagnose (Stand: 30. 06. 99) Infektionsrisiko Zeitraum der Diagnose Juli 97 –Juni 98 Juli 98 –Juni 99 Gesamt 25 22,7% 8 13,6% 951 45,8% 1 0,9% 0 0% 142 6,8% Heterosexuelle Kontakte (ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 48 43,6% 27 45,8% 627 30,2% Patienten aus Pattern-II-Ländern 27 24,5% 17 28,8% 208 10,0% 9 8,2% 7 11,9% 149 7,2% 110 100 % 59 100 % 2077 100 % i. v. Drogenabhängige Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) Keine Angaben Gesamt Tab. 4: HIV-Bestätigungsteste unter Ausschluß erkennbarer Mehrfachmeldungen nach Infektionsrisiko, Geschlecht und aufgeführten Zeiträumen der Einsendung der Seren (Stand: 30. 06. 99) Infektionsrisiko Homo- oder bisexuelle Männer Zeitraum der Einsendung desSerums Juli 97 –Juni 98 Juli 98 –Juni 99 Gesamt 786 37,7% 605 37,6% 4571 33,5% 188 Epidemiologie sexuell übertragbarer Krankheiten Infektionsrisiko Zeitraum der Einsendung des Serums Juli 97 –Juni 98 Juli. 98 –Juni 99 Gesamt i. v. Drogenabhängige / Geschlecht männlich 173 8,3% 114 7,1% 1021 7,5 % i. v. Drogenabhängige / Geschlecht weiblich 64 3,1% 45 2,8% 417 3,1% i. v. Drogenabhängige / Geschlecht unbekannt 10 0,5% 3 0,2% 38 0,3% Hämophile 6 0,3% 0 0,0% 9 0,1% Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) / Geschlecht männlich 2 0,1 % 1 0,1 % 54 0,4 % Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) / Geschlecht weiblich 3 0,1 % 1 0,1% 38 0,3 % Empfänger von Bluttransfusionen und Blutprodukten (außer Hämophile) / Geschlecht unbekannt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Heterosexuelle Kontakte / Geschlecht männlich (ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern 142 6,8% 116 7,2% 837 6,1% Heterosexuelle Kontakte / Geschlecht weiblich (ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern) 140 6,7% 113 7,0% 733 5,4% Heterosexuelle Kontakte / Geschlecht unbekannt (ausgenommen Patienten aus Pattern-II-Ländern 4 0,2% 3 0,2% 23 0,2% 315 15,1% 312 19,4% 1538 11,3% 26 1,2% 23 1,4% 307 2,2% Keine Angaben / Geschlecht männlich 316 15,2% 194 12,1% 2939 21,5% Keine Angaben / Geschlecht weiblich 83 4,0 % 68 4,2% 764 5,6 % Keine Angaben / Geschlecht unbekannt 14 0,7% 11 0,7% 366 2,7% 2084 100 % 1609 100 % 13655 100 % Patienten aus Pattern-II-Ländern Prä- oder perinatale Infektion Gesamt Sexuologie Aktuelles Buchbesprechungen D. Rayside: On the Fringe. Gays and Lesbians in Politics. Ithaca / London: Cornell University Press 1998, 356 Seiten, Preis: $ 50,- (Ln), $ 16,- (br.) Dies Buch handelt von der Relevanz legislativer Politik für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Es ist zum Teil dadurch motiviert, daß bisher wenige Analysen der politischen Bedeutung schwulen und lesbischen Engagements vorliegen, denn der Großteil der existierenden Literatur zum Thema „soziale Bewegungen und Politik“ beschränkt sich auf knappe Erwähnungen sexueller Vielfalt. Des weiteren will das Buch zum besseren Verständnis dessen beitragen, wie Mitglieder sexueller Minderheiten Lebensqualität ganz allgemein verbessern helfen können. Der Autor ist nicht nur Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Toronto (Kanada), sondern war selbst in der „Right to Privacy“ - Kampagne engagiert, die sich in den achtziger Jahren als Reaktion auf polizeiliche Razzien in schwulen Saunen in Toronto gebildet hatte. Er versteht sich mithin gleichzeitig als „activist and analyst“ (XIII). Die materialreiche Studie ist vergleichend angelegt. Großbritannien, Kanada und die USA haben gemeinsame Wurzeln im kulturellen und politischen Erbe, ähnliche Rechtssysteme und ähnliche Regulierungen von Geschlechtsleben und Sexualität. Dennoch fördert Rayside oft verblüffende Unterschiede zu Tage. Er beschäftigt sich nacheinander in jeweils drei Kapiteln mit dem Vereinigten Königreich, Kanada und den Vereinigten Staaten. Jeweils ein Kapitel ist einem offen schwul auftretenden Politiker gewidmet. Einleitend wird auf die unterschiedlichen Regierungssysteme verwiesen: Zentralismus in Großbritannien, Föderalismus in Kanada und Fragmentierung in den USA. Der Abschnitt über Großbritannien beginnt mit einer Skizze der „Ära Thatcher“: „Promoting Heterosexuality.“ Dem folgt ein Kapitel über die schwule Antwort darauf, der Kampf um die Herabsetzung des gesetzlichen Alters für homosexuelle Handlungen (seit 1967 straffrei) von 21 auf 16 Jahre. Dieser Kampf endete am 22. Februar 1994 mit einer Niederlage. Aber gleichzeitig folgert der Verfasser: „The debate over the age of consent illustrated that the issue of lesbian and gay equality had entered the mainstream political agenda in a way that it had never succeeded in doing before“ (45). Die positive Rolle des damaligen Labour-Abgeordneten Tony Blair wird hier gebührend gewürdigt (vgl. 50) – anders als Blairs eher taktisches Verhalten zur Homosexualität nach dem Wahlsieg von 1997. Dennoch ruht laut Rayside Ende der neunziger Jahre die kulturelle Sichtbarkeit von Schwulen und Lesben auf sichereren Fundamenten. Abgerundet wird dieser Teil des Werkes mit einem Porträt von Chris Smith, Labour-Member of Parliament für IslingtonSüd – aber auch für Schwule und Lesben in ganz London. Anders als im britischen Fall beschreibt der Abschnitt über Kanada einen klaren parlamentarischen Sieg. Seit Jahrzehnten gab es hier eine Diskussion über die Einbeziehung des Wortes „sexuelle Orientierung“ in den „Canadian Human Rights Act“, um auch Schwule und Lesben vor Diskriminierung zu schützen. Im Frühjahr 1996 wurde das entsprechende Gesetz beschlossen. Der Autor hebt die Bedeutung der Initiativgruppen wie EGALE („Equality for Gays and Lesbians Everywhere“) für diese Entscheidung hervor, aber auch Sexuologie 6 (3) 1999: 189 – 192 / © Urban & Fischer Verlag http://www.urbanfischer.de/journals/sexuologie 190 Buchbesprechungen die schwulenfreundliche Position des frankophonen „Bloc Québécois“: „Relatively liberal attitudes toward sexual diversity are part of what they see as distinguishing Quebec from the anglophone regions of Canada“ (130). Ausführlich schildert er den Kampf um die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften im Bundesland Ontario. Das Porträt gilt diesmal Svend Robinson, offen schwuler Abgeordneter der (in etwa sozialdemokratischen) „New Democratic Party“ aus der westkanadischen Großstadt Vancouver. Die Diskussion der USA beginnt mit einem Kapitel über Präsident Clintons (fast) gebrochenes Wahlversprechen, mit der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in den US-Streitkräften Schluß zu machen. „Barney Frank and the Art of the Possible“ ist sodann das Kapitel über den demokratischen Kongreßabgeordneten aus Massachusetts überschrieben. Abgeschlossen wird die Arbeit über Arbeitsteilung zwischen schwul-lesbischen Interessengruppen in Washington und Initiativen „draußen im Lande“. Zusammenfassend notiert der Verfasser über alle drei Fallstudien: „The still slender ranks of openly gay and lesbian politicians have often found themselves in an awkward position, trying to represent both a local district and a regional or national sexual minority“ (313). Hier hätte u.U. eine Einbeziehung der europäischen „Grünen“ weitere Aufschlüsse gebracht. Desungeachtet sei dies bahnbrechende Werk allen empfohlen, die an der Wechselwirkung von sexueller Vielfalt, sexuellen Minderheiten, sozialen Bewegungen und parlamentarischer legislativer Alltagspraxis interessiert sind. Volker Gransow/Gottfried Paasche (Toronto) Helmut Blazek: Männerbünde. Eine Geschichte von Faszination und Macht. Berlin: Christoph Links Verlag 1999, 264 Seiten, Preis: DM 39,50 Daß die Geschlechterverhältnisse jede Kultur ordnungsstiftend fundieren, ist ein Gemeinplatz, der wissenschaftliche Evidenz erst dann behaupten kann, wenn für konkrete historische Situationen untersucht wird, auf welche Weise die Geschlechterordnung den gesellschaftlichen Kodex prägt: Wie wird Sexualität und Fortpflanzung geregelt, wie wird der männliche und weibliche Körper konditioniert und auf welche Weise werden diese wiederum den Bedürfnissen der Gemeinschaft unterworfen? Jede Kultur entwickelt ihre eigenen Vorstellungen davon, welche Eigenschaften Männer und Frauen entwickeln sollten, doch generell gilt: Je stereotyper die Geschlechterbilder ausgeprägt sind, desto „männerbündischer“ geriert sich eine Gesellschaft. Der Männerbund, so der Münchener Publizist Helmut Blazek in seiner systematisch angelegten Abhandlung, operiert sozusagen im Windschatten zweigeschlechtlich organisierter Gesellschaftsordnungen als heimliches Machtzentrum. Ob in Kirche und Politik, im Militär, den frühen Studentenbünden oder eben auch in den Freizeitvereinen: Überall, wo sich Männer „zusammenrotten“, geht es vor allem um den Machterhalt der männlichen Spezies. Einleitend listet Blazek ein Merkmalset dieser exklusiven Männervereinigungen auf, an dem sich seine folgende Untersuchung orientiert: sie gründen auf dem freien Willen ihrer Mitglieder und berufen sich auf gemeinsame Normen und Ziele; ihnen steht ein charismatischer Führer vor, der Autorität genießt; die Aufnahme in die Bünde erfolgt über ein Initiationsritual; der jeweilige Bund stellt seine Gruppenidentität her über ein spezifisches Geheimwissen, über das nur die Auserwählten verfü- Buchbesprechungen gen; die von elitärem Sendungsbewußtsein beflügelten Männer nutzen den Bund, um sozial aufzusteigen. Und selbstverständlich haben Frauen in diesem inner circle nichts verloren, denn Männlichkeit stellt sich nur her über die Abgrenzung vom Weiblichen. Die „Dramatisierung der männlichen Rolle“ gehört nach Auffassung Blazeks zu den charakteristischen Erscheinungsformen männerbündischer Zirkel. Theoretische Fundierung erfuhr der Männerbund allerdings erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert; interessanterweise in dem Moment, als die Männerrolle unter den Druck der weiblichen Emanzipationsbestrebungen geriet. Heinrich Schurtz hob den „Männerbund“ als erster aufs wissenschaftliche Parkett, doch es war vor allem der „jugendbewegte“ Hans Blüher, der die Konjunktur des Begriffs einleitete und die politische Konnotierung des Männerbundes erweiterte durch seine (homo)sexuelle Komponente. „Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“, das zweibändige Hauptwerk des 1888 geborenen Psychoanalytikers, feiert die erotisch fundierte Freundschaft zwischen einem Jungen und einem älteren Mann und verleiht ihr politische Bedeutung dadurch, daß sie antibürgerlich, das heißt gegen die bürgerliche Familie gerichtet, erscheint. Das Blüher’sche Modell weist viele von Blazeks destillierten Kennzeichen auf: Exklusivität, (generationelle) Hierarchie, Sendungsbewußtsein und, wie angedeutet, homoerotische Orientierung. Bei Blüher wiederholt sich interessanterweise das apokalyptische Motiv, das schon die biblische Vorlage des Mosesbundes lieferte: Ein „erwählter Kreis von Standhaften“ wartet in Blühers exzessiver Theorie auf den „neuen Bund“ als „der Besiegelung des alten Bundes, der in der Jugend zerbrach.“ Blazek verfolgt die Begriffs-Karriere in mitunter seminaristischer Manier bei Max 191 Weber und Herman Schmalenbach, langweilt mit altbekannten Platitüden über Ernst Jüngers Frontkämpferkult und fördert schließlich einige vergessene psychoanalytische Befunde des Freud-Schülers Otto Gross und Siegfried Bernfelds zutage. Insbesondere Bernfeld und sein Kreis der Wiener Jugendbewegung stellt den „Generationenzusammenhang“ her, der allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg politisch gewendet und theoretisch fundiert wird. Der Anfang der zwanziger Jahre publizistisch wirksame „Aufstand der Söhne gegen die Väter“ wird 1919 etwa von Paul Federn mit seiner Theorie des sozialistisch orientierten „Bruderbundes“ forciert – eine Tradition, die Blazek leider völlig vernachlässigt. Auf Grundlage der oben genannten definitorischen Merkmale unternimmt Blazek im Hauptteil seiner Untersuchung einen ausgedehnten Streifzug durch die Geschichte der Männerbünde – und handelt sich damit theoretische und konzeptionelle Probleme ein. Denn so gesehen fallen historisch fast alle gesellschaftlich relevanten, geschlechtersegregierten Institutionen unter die Kategorie „Männerbund“: Die christlichen Ordensgemeinschaften schufen mit dem Zölibat ein Regularium, das Frauen aus der Lebenswelt der Priester verbannte. Während die Benedektiner noch eine kompensatorische Marienhuldigung betrieben, wurden die Klöster der Zisterzienser radikal von aller Sinnlichkeit gereinigt und quasimilitärisch organisiert. Die typische Verbindung von Ritter- und Mönchstum fand im aggressiven Templer-Orden schließlich ihren Höhepunkt. Mit der Profanisierung der Religion durch die Aufklärung avancierte die Kunst zur Ersatzreligion, und so überrascht es nicht, daß auch die Künstlerbünde – beispielsweise die Nazarener – exklusive „Bruderschaften“ ausbildeten. Der Kreis um Stefan George ist das bekannteste Beispiel für die 192 Buchbesprechungen hierarischische Beziehung zwischen dem Künster-Meister und seinen Jüngern. „Demokratisiert“ - im Sinne massenhafter Teilhabe – werden die Männerbünde schließlich im Militär und im Sport, von den Fußballfanclubs bis hin zu schwulen Uniformgruppen. Den „alternativen“ Männerbünden in Form der neuen Männerbewegung räumt der Autor dagegen geringe Chancen ein. Der Wunsch nach kategorialer Ordnung stiftet in Blazeks systematisch angelegter, doch kursorisch wirkender Studie mancherlei Verwirrung und historische Klitterung. Man mag die Kadettenanstalten, die deutsche Turnerbewegung und die Burschenschaften mit gutem Willen noch unter den Begriff „militärisch-politisch“ fassen; die deutsche Jugendbewegung in bruchloser Linearität zur NS-Jugend vorzuführen, vergibt sich jeder Differenzierung, selbst wenn der Autor die bündische Jugend zu retten sucht, indem er ihre „Einverleibung“ durch die Nationalsozialisten behauptet. Aufschlußreich hingegen sind seine Ausführungen über die Konjunktur der – in der DDR verbotenen – studentischen Burschenschaften in den neuen Ländern, wo heute etwa 50 Studentenverbindungen existieren. Blazek führt die „Flucht ins Corps“ auf die Verunsicherung der ostdeutschen jungen Männer zurück, die in der Verbindung Geborgenheit und Kameradschaft suchten. Bedauerlich, daß der Autor dazu neigt, die Ergebnisse seiner Recherchen einzuäschern in holzschnittartig-vulgärmarxistischen Konklusionen. Die Studentenverbindungen, resümiert er beispielsweise, seien „Zufluchtsstätten vor dem inhumenen, den Menschen auf einen Produktions- und Kostenfaktor reduzierenden kapitalistischen Systems.“ Männerbünde, daran allerdings läßt Helmut Blazek keinen Zweifel, sind immer auch Arrangements männlicher Machter- haltung, nicht nur in den Rotary- oder Lions-Clubs. Ein „Nestbeschmutzer“ ist, wer dem Männerbund den Rücken kehrt und ihn wie Blazek in seiner Funktion entlarvt. Hierfür gebührt Blazek Anerkennung. U. Baureithel (Berlin)