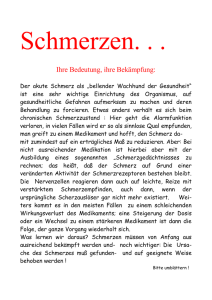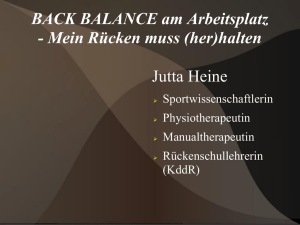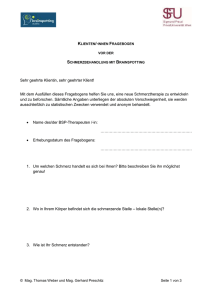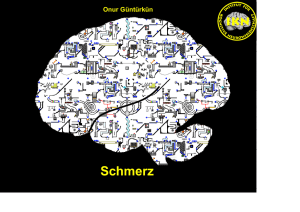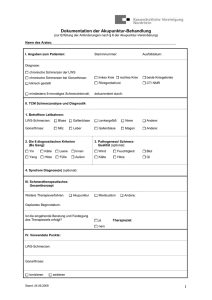BECKENBODENSCHMERZ AUS SICHT DES
Werbung
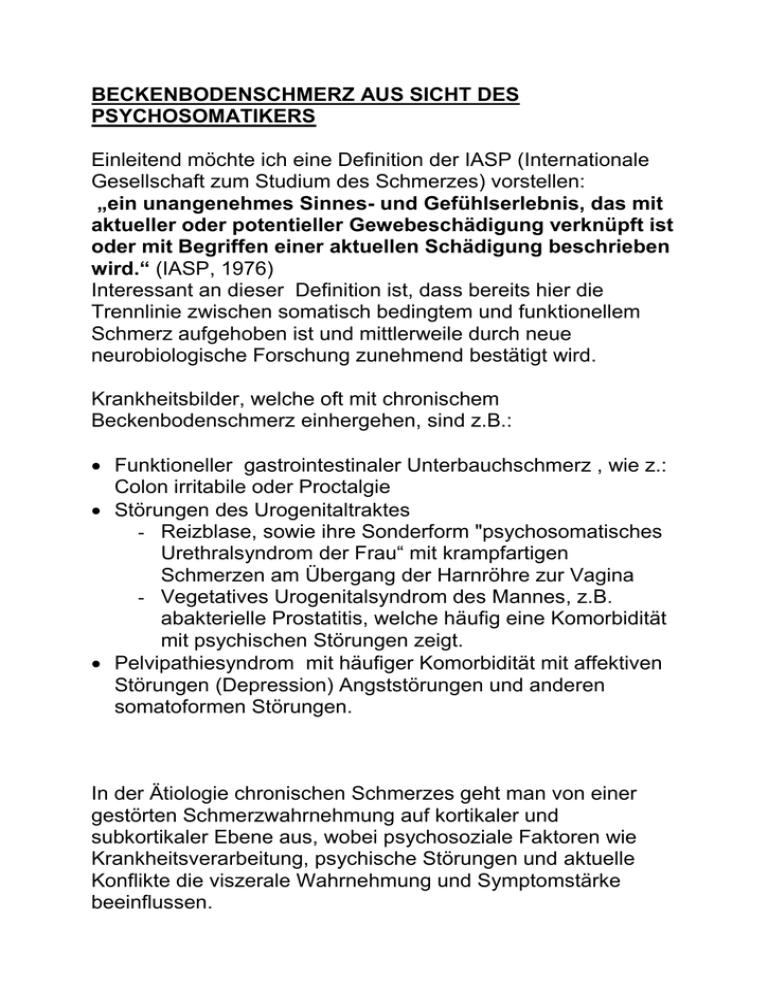
BECKENBODENSCHMERZ AUS SICHT DES PSYCHOSOMATIKERS Einleitend möchte ich eine Definition der IASP (Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes) vorstellen: „ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potentieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer aktuellen Schädigung beschrieben wird.“ (IASP, 1976) Interessant an dieser Definition ist, dass bereits hier die Trennlinie zwischen somatisch bedingtem und funktionellem Schmerz aufgehoben ist und mittlerweile durch neue neurobiologische Forschung zunehmend bestätigt wird. Krankheitsbilder, welche oft mit chronischem Beckenbodenschmerz einhergehen, sind z.B.: Funktioneller gastrointestinaler Unterbauchschmerz , wie z.: Colon irritabile oder Proctalgie Störungen des Urogenitaltraktes - Reizblase, sowie ihre Sonderform "psychosomatisches Urethralsyndrom der Frau“ mit krampfartigen Schmerzen am Übergang der Harnröhre zur Vagina - Vegetatives Urogenitalsyndrom des Mannes, z.B. abakterielle Prostatitis, welche häufig eine Komorbidität mit psychischen Störungen zeigt. Pelvipathiesyndrom mit häufiger Komorbidität mit affektiven Störungen (Depression) Angststörungen und anderen somatoformen Störungen. In der Ätiologie chronischen Schmerzes geht man von einer gestörten Schmerzwahrnehmung auf kortikaler und subkortikaler Ebene aus, wobei psychosoziale Faktoren wie Krankheitsverarbeitung, psychische Störungen und aktuelle Konflikte die viszerale Wahrnehmung und Symptomstärke beeinflussen. Neurobiologie des Schmerzes Die Intensität eines Schmerzreizes wird v.a. über den vorderen Anteil der Insula, Teile des Somatosensorischen Cortex und des kontralateralen Thalamus gesteuert. Die affektive Qualität („quälend“, „grässlich“ wird über Aktivierungen im dorsalen anterioren zingulären Cortex (ACC) und der Insula reguliert. Aktivierungen im Bereich der Insula werden auch mit der Regulation schmerzbezogener vegetativ-autonomer Vorgänge in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang intersessant ist, dass diese Areale auch als Kernbestandteile des affektgenerierenden und – verarbeitenden zentralnervösen Netzwerkes bekannt sind. Aufgrund dieser Überlappung von Schmerz- und Emotions – relevanten ZNS-Regelkreisen bezeichnet der amerikanische Neurophysiologe Craig „pain as an homoestatic emotion“, vergleichbar dem Affekt der Angst oder Depression. Klinisch ist schon lange bekannt, dass in Situationen existentieller Bedrohung auch schwere Verletzungen subjektiv schmerzfrei bleiben können, wobei durch eine Verlagerung der bewussten Aufmerksamkeit von einem Schmerzreiz zu einem anderen Stimulus eine Verringerung subjektiven Schmerzempfindens möglich ist. In funktionellen Bildgebungsstudien konnte gezeigt werden, dass es unter kognitiver Ablenkung (bei subjektiv niedrig erlebter Schmerzintensität) zu einer massiven Aktivierung des orbitofrontalen Cortex kam. Parallel dazu zeigte sich auch eine Zunahme der Aktivität im ventral-rostralen Anteil des anterioren zingulären Cortex. Demgegenüber zeigte sich eine Verminderung der Aktivierung in folgenden Hirnarealen: - Insula (Wechselwirkung mit dem autonomen Nervensystem) - mediale thalamische Kerngebiete - Hippocampus (hier korreliert das Ausmaß der Aktivierung mit der dem Schmerz entgegengebrachten bewussten Aufmerksamkeit - dorsaler „Kognitiver“ Anteil des ACC. Im Gegensatz dazu zeigte sich unter Zunahme der Schmerzintensität eine vermehrte Aktivierung im ventralen und orbitofrontalen präfrontalen Cortex, den bilateralen Inseln, dem rechten ventralen Striatum dem perigenualen ACC und medialen Thalamusanteilen. Diese Befunde sprechen für eine vermehrte Bedeutung kognitiver und emotionaler Faktoren für die individuell unterschiedliche Schmerzwahrnehmung. In einer Studie zu neuronalen Korrelaten einer interindividuell unterschiedlichen Schmerzempfindlichkeit zeigten sich auch Unterschiede im Ausmaß der Aktivierung des anterioren zingulären Cortex: Alle hoch schmerzempfindlichen (keiner der unempfindlichen Probanden) zeigten eine signifikant erhöhte Aktivierung des dorsalen „kognitiven“ Anteil das ACC bis zum rostralventralen „affektiven“ Anteil des ACC. Weiters zeigten die hochempfindlichen Personen vermehrte Aktivierung im sensomotorischen Cortex sowie zu einer verstärkten Durchblutung des rechten präfrontalen Cortex. Letzterer ist auch für die Verarbeitung von Emotionalität und Kognition wichtig. Interessanterweise zeigten sich auf thalamischen und anderen subkortikalen Ebenen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. In einer neueren fMRI- Studie wurden die neuronalen Korrelate während des subjektiven Gefühls des Ausgeschlossen-Seins aus einem sozialen Beziehungsnetzwerkes untersucht: Es zeigte sich ein neuronales Aktivierungsmuster, welches dem Aktivierungsmuster bei der Wahrnehmung eines physischen Schmerzes gleicht! Dies spricht für die Hypothese, das „körperlicher“ und „psychischer“ Schmerz eine gemeinsame neuroanatomische Basis aufweisen. Diese Hypothese bestätigt die klinisch-psychosomatischpsychotherapeutische Beobachtung, dass die Erstmanifestation sowie Exazerbation von chronischen Schmerzen oft in akut oder chronisch konflikthaften Beziehungen oder bei Beziehungsabbrüchen (enger zwischenmenschlicher Beziehungen) auftritt. Ebenso wäre die oft zu beobachtende psychosoziale Rückzugstendenz von Patienten mit chronischen Schmerzen nicht nur reaktiv, sondern würde ätiologisch zu einer verstärkten zentralnervösen Schmerzverarbeitung beitragen. Bei systemtheoretischer Betrachtungsweise können z.B. aus Konflikten entstehende Emotionen als Ausdruck einer Störung des affektreguliernden Subsystems durch Interaktion mit anderen zentralnervösen Regelkreisen zu Veränderungen physiologischer Abläufe und dadurch zu körperlichen Symptomen und sogar zu morphologischen Veränderungen in Organen führen. Psychosomatische Aspekte chronischen Schmerzes: Funktioneller Schmerz kann primär ohne somatisches Korrelat entstehen, jedoch auch sekundär bei einer primären Gewebeschädigung, wo der psychische Verarbeitungsprozess im Sinne einer neurotischen Krankheitsverarbeitung zur Entstehung einer funktionellen Schmerzstörung führt. Psychodynamisch spielen Konversionsmechanismen, psychovegetative Prozesse und narzisstische Problematik eine Rolle: Bei der Konversionsneurose ist die Funktion des Schmerzes eine Verdichtung körperlichen und psychischen Schmerzerlebens in der Kindheit; dem Patienten aktuell nicht bewusst. Beim depressiven Patienten wird psychischer Schmerz physisch erlebt. Wenn Schmerz als Affektäquivalent – meist eines negativen, ich-dystonen - Affektes dient, führt eine vermehrte psychische Anspannung zu einem erhöhten Muskeltonus, der wiederum als unspezifische Reaktion Schmerz auslöst. Bei narzisstischer Problematik dient Schmerz zur Stabilisierung des Selbstwertgefühls, z.B. bei Größenphantasien wie „so einen Schmerz hatte noch keiner“, „mein Schmerz ist stärker als dein Skalpell“ oder „keiner kann mir helfen - mein Schmerz ist stärker“. Vor allem bei narzisstisch akzentuierten Persönlichkeitsstrukturen findet man häufig das sogenannte „doctor shopping“ und „Koryphäen-Killer-Syndrom“. Bei Patienten mit chronischen Schmerzen finden sich häufig folgende Auffälligkeiten: Wechsel von Idealisierung und Entwertung in der ArztPatient- Beziehung, wobei die Gefahr eines Machtkampfes besteht Das Symptom Schmerz ist überdeterminiert und steht im Zentrum zahlreicher Aktivitäten Agieren als Angstabwehr (zwingt den Arzt zum Handeln), ständiges Reden über das Symptom als Ausdruck von Aggressivität, Macht und Kontrolle kann wiederum beim Arzt aversive Gefühle dem Patienten gegenüber auslösen! (was dieser auch hochsensibel wahrnimmt) möglicherweise weitere Intensivierung des Klagens Psychodynamisch orientierte Diagnostik bei chronischem Schmerz: biographische Anamnese psychosoziale Entwicklung klinisch signifikante psychische Komorbidität Klärung unbewusster Konflikte unter Berücksichtigung körperlicher Symptome mit oder ohne Gewebeschädigung Erhebung der aktuellen Beziehungsgestaltung, welche die Psychogenese des Schmerzes wahrscheinlich macht und zu dessen Aufrechterhaltung beiträgt. Erhebung des Schmerzverhaltens unter Berücksichtigung psychosozialer Auslöser insbesondere in Partnerschaft und Sexualität Blick auf die biographische Dimension der Krankheitsbewältigung Verluste im psychischen, physischen und sozialen Bereich (sind mit der Entwicklung und Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen eng verknüpft) Psychische Besetzung des Körpers und seiner Funktionen (entscheidend für die Symptomwahl) Indikation für klinisch-psychologische Begutachtung Fehlen adäquater somatischer Befunde Protrahierter Schmerz Zusätzliche psychopathologische Auffälligkeiten Vorliegen psychosozialer Konflikte Diskrepanz zwischen subjektivem Befinden und objektiven Befunden Therapie: Ein integratives Versorgungsmodell mit simultan und koordiniert angewandten somatischen und psychosozialen Diagnoseinstrumenten und therapeutischen Maßnahmen wäre aus meiner Sicht optimal. Ergänzende Maßnahmen sind: psychoedukative Maßnahmen physikalische Therapie Entspannungsverfahren Psychotherapie - indiziert, wenn zumindest partielle Einsicht bez. psychischen Anteilen der Pathogenese besteht. Psychopharmakologische Therapie (bei Komorbidität mit Angst und Depression