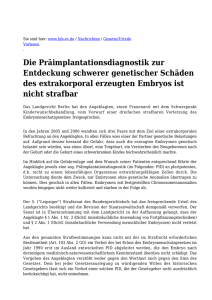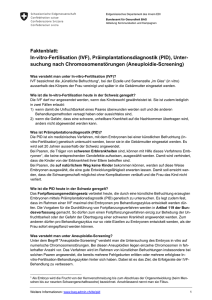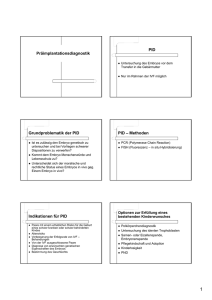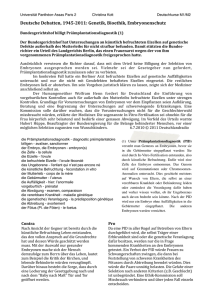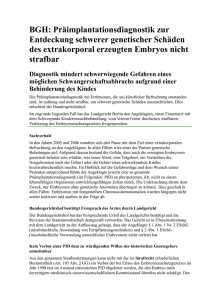- FreiDok - Albert-Ludwigs
Werbung

Aus dem Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Die Präimplantationsdiagnostik als Herausforderung für Medizin und Gesellschaft - Eine ethische Analyse Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. vorgelegt 2010 von Anneke Schmider geb. Stallmann geboren in Hildesheim Dekan: Prof. Dr. Christoph Peters 1.Gutachter: Prof. Dr. Giovanni Maio 2.Gutachter: Prof. Dr. Hans-Peter Zahradnik Jahr der Promotion: 2010 Danksagung Diese Seite enthält persönliche Daten und ist daher nicht Bestandteil der online-Publikation. Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ...................................................................................................................................4 1.1 Naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagen .................................................................4 1.2 Die ethische Diskussion ........................................................................................................6 1.3 Fragestellung und Methodik..................................................................................................8 2. Der Embryo .............................................................................................................................10 2.1 Definitionen und Totipotenz ...............................................................................................10 2.1.1 Juristische Definition....................................................................................................... 10 2.1.2 Das Problem der Totipotenz............................................................................................ 11 2.2 Der Status des Embryos ......................................................................................................13 2.2.1 Das Person-Modell.......................................................................................................... 13 2.2.2 Das Progredienz-Modell ................................................................................................. 20 2.2.3 Das Objekt-Modell .......................................................................................................... 21 3. Präimplantationsdiagnostik im Kontext der Reproduktionsmedizin ................................23 3.1 Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik im Vergleich .....................................23 3.1.1 Die Methoden der Pränataldiagnostik ............................................................................ 23 3.1.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von PND und PID ................................................. 26 3.1.3 Entwicklung und gesellschaftliche Implikationen der PND ............................................ 30 3.2 Präimplantationsdiagnostik im Vergleich zum Schwangerschaftsabbruch ........................32 3.2.1 Die gesetzliche Regelung des Umgangs mit Embryonen ................................................ 32 3.2.2 Schwangerschaftskonflikt und mögliche Konsequenzen ................................................. 34 3.2.3 Vorschläge zur Änderung der medizinischen Indikation................................................. 36 3.3 Die In-vitro-Fertilisation als unabdingbare Voraussetzung der PID...................................37 3.3.1 Der Ablauf der In-vitro-Fertilisation .............................................................................. 37 3.3.2 Die Problematik der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion.................................... 38 3.3.3 Erfolgsrate der IVF, Mehrlingsrisiko und Verbesserungsansätze .................................. 40 3.3.4 Die ethische Bewertung der IVF-Praxis mit Bezug zur PID ........................................... 43 3.3.5 Übertragung weiterer IVF-Kritikpunkte auf die PID...................................................... 46 2 Inhaltsverzeichnis 4. Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit ................................................................................ 49 4.1 Rechtslage, Definition und Voraussetzungen von Autonomie ........................................... 49 4.1.1 Das Recht auf Autonomie ................................................................................................ 49 4.1.2 Definition und Umsetzung von Autonomie...................................................................... 50 4.2 Die Bedeutung der Beratung für die Realisierung von Autonomie .................................... 53 4.2.1 Nichtdirektivität............................................................................................................... 53 4.2.2 Die Autonomie der Risikopaare ...................................................................................... 56 5. Anwendung der Präimplantationsdiagnostik....................................................................... 59 5.1 Indikationen der Präimplantationsdiagnostik...................................................................... 59 5.1.1 Anwendungsgebiete der Präimplantationsdiagnostik..................................................... 59 5.1.2 Aspekte der Indikationsstellung ...................................................................................... 61 5.1.3 Indikationsform und Slippery-Slope-Gefahr ................................................................... 64 5.1.4 PID-Aneuploidie-Screening ............................................................................................ 66 5.1.5 Social Sexing und Diminishment..................................................................................... 71 5.1.6 HLA-Matching................................................................................................................. 72 5.1.7 DNA-Arrays..................................................................................................................... 76 5.1.8 Die restriktive Zulassung der PID .................................................................................. 77 5.2 Modifikationen und Alternativen der Präimplantationsdiagnostik ..................................... 79 5.2.1 Die Blastozystenbiopsie................................................................................................... 80 5.2.2 Die Polkörperdiagnostik ................................................................................................. 82 5.2.3 Spermienselektion, Gametenspende und Embryonenadoption ....................................... 87 5.2.4 Nicht-diagnostische Alternativen .................................................................................... 91 6. Befürchtete Folgen der Präimplantationsdiagnostik........................................................... 92 6.1 Veränderungen in der Medizin ........................................................................................... 92 6.1.1 Prädiktive Medizin, Gesundheits- und Krankheitsbegriff ............................................... 92 6.1.2 Das Recht auf (Nicht-)Wissen und die Pflicht zu wissen ................................................ 94 6.1.3 Ärztliches Handeln bei der Durchführung der PID ........................................................ 97 6.1.4 Die Rechtfertigung ärztlichen Mitwirkens an der PID ................................................. 100 6.1.5 PID-Tourismus .............................................................................................................. 102 Inhaltsverzeichnis 3 6.2 Rückwirkungen auf die Forschung ...................................................................................103 6.2.1 Die medizinische Forschung am Menschen .................................................................. 103 6.2.2 Embryonenforschung..................................................................................................... 106 6.2.3 Der Zusammenhang von PID und Embryonenforschung.............................................. 110 6.2.4 PID und Keimbahntherapie........................................................................................... 111 6.3 Wandel unseres Menschenbildes ......................................................................................114 6.3.1 Würde-Menschenbild und Wandel................................................................................. 115 6.3.2 Extension und Intension der Menschenwürde ............................................................... 117 6.3.3 Auswirkungen der PID auf das Menschenwürde-Konzept ............................................ 122 6.3.4 Auswirkungen der PID auf zwischenmenschliche Beziehungen.................................... 123 6.4 Gesellschaftliche Diskriminierung....................................................................................130 6.4.1 Das Diskriminierungsverbot.......................................................................................... 130 6.4.2 Intrinsische Argumente.................................................................................................. 131 6.4.3 Folgen-Argumente ......................................................................................................... 137 6.4.4 Frühgeburtlichkeit und Behinderung ............................................................................ 141 6.4.5 Der gesellschaftliche Status quo ................................................................................... 143 6.4.6 Verständigung mit Betroffenen und Ausblick für die Zukunft ....................................... 144 6.5 Neue Eugenik ....................................................................................................................146 6.5.1 Begriff und Geschichte der Eugenik.............................................................................. 146 6.5.2 Das eugenische Potenzial der medizinischen Praxis ohne PID .................................... 149 6.5.3 Entstehung einer neuen Eugenik ................................................................................... 150 6.5.4 Das eugenische Potenzial der PID................................................................................ 154 6.5.5 Bewertung einer neuen Eugenik .................................................................................... 156 6.5.6 Die Grenzen genetischer Manipulation......................................................................... 160 6.5.7 Restriktivität angesichts einer potenziellen Eugenik ..................................................... 165 7. Abschließende Stellungnahme .............................................................................................170 7.1 Vorannahmen und heutige Reproduktionsmedizin ...........................................................170 7.2 Bedeutung und Folgen der PID für Individuen und Gesellschaft .....................................171 7.3 Forderungen im Fall einer Zulassung der PID ..................................................................172 8. Zusammenfassung.................................................................................................................174 9. Literaturverzeichnis..............................................................................................................175 4 Einleitung 1. Einleitung Die Entwicklung der In-vitro-Fertilisation zur Behandlung von Sterilität und Infertilität, die 1978 nach erfolgreichem Embryonentransfer zur Geburt des ersten Retortenbabys in Großbritannien führte,1 war der erste entscheidende Schritt in Richtung Präimplantationsdiagnostik. Die extrakorporale Verfügbarkeit menschlicher Embryonen eröffnete neue Möglichkeiten zur Erforschung der frühembryonalen Entwicklung und zur Erprobung diagnostischer Methoden an embryonalen Zellen. Ein Ergebnis dieser jahrelangen Embryonenforschung ist die Präimplantationsdiagnostik (PID)2, mit der sich die vorliegende Arbeit auseinandersetzt. Sie bietet Paaren mit einem bekannten Risiko für genetisch kranke Nachkommen die Möglichkeit, nach einer künstlichen Befruchtung die erzeugten Embryonen auf das Vorliegen des der Krankheit zugrunde liegenden genetischen Merkmals zu testen. Ein positiver Befund stellt die prospektiven Eltern und die behandelnden Ärzte vor die Option, auf die Implantation des betroffenen Embryos bzw. der betroffenen Embryonen zu verzichten und somit die Geburt eines kranken Kindes zu verhindern.3 1.1 Naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagen Entwickelt und erstmals durchgeführt wurde die PID von der Forschergruppe um Handyside am Hammersmith Hospital in London. 1990 wurden hier den Embryonen zweier Frauen mit gesicherter Trägerschaft für X-chromosomal rezessiv vererbte Krankheiten jeweils eine Zelle entnommen und auf ihr chromosomales Geschlecht hin untersucht. Je zwei auf diese Weise identifizierte weibliche Embryonen wurden übertragen und führten bei beiden Frauen zum Eintritt einer Zwillingsschwangerschaft.4 Das konventionelle Vorgehen bei Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Nach hormoneller Stimulation der Ovarien werden der Frau durch abdominale oder vaginale Follikelpunktion Eizellen entnommen, die zunächst von dem sie umgebenden Cumulus oophorus befreit werden. Anschließend wird meistens eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) durchgeführt, indem in das Ooplasma jeder Eizelle 1 vgl. Steptoe und Edwards (1978) und Krebs (2000). Die Fußnoten in dieser Arbeit beschränken sich auf die Angabe von Autor und Jahr, ausführliche Literaturangaben sind dem Literaturverzeichnis zu entnehmen. 2 In der internationalen Literatur wird die Abkürzung PGD für „preimplantation genetic diagnosis“ verwendet, da PID bereits durch „pelvic inflammatory disease“ besetzt ist. Vgl. Ludwig, Diedrich (1999) S.39. 3 Eine genaue Darstellung der Durchführung der PID, ihrer Risiken und Fehlermöglichkeiten befindet sich bei Kollek (2002), S.27- 64. 4 vgl. Handyside et al. (1990). Einleitung 5 ein immobilisiertes Spermium injiziert wird.5 Die so befruchteten Eizellen werden in Kultur gehalten, durchlaufen das Vorkernstadium, in dem sich maternale und paternale Chromosomen noch nicht vermischt haben, und beginnen, sich nach Auflösung der Kernmembranen und Komplettierung eines neuen diploiden Chromosomensatzes zu teilen. Nach drei Tagen bestehen die Embryonen aus 6 bis 10 Zellen, den sogenannten Blastomeren, von denen ihnen mittels Biopsie ein oder zwei6 zur Untersuchung auf das spezifische Merkmal entnommen werden. Handelt es sich um die Anlage einer monogen vererbten Erkrankung wie z.B. zystischer Fibrose, wird in der Regel eine Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) durchgeführt. Eine mögliche Fehlerquelle besteht in diesem Fall durch das sogenannte Allele drop out (ADO), d.h. dass eine der beiden Erbanlagen durch die PCR kaum amplifiziert wird und demzufolge nicht nachweisbar ist, obwohl sie ggf. die für die Erkrankung verantwortliche Information trägt. Für den Nachweis chromosomaler Störungen in Form numerischer Aneuploidien oder struktureller Aberrationen wird dagegen die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eingesetzt. Fehldiagnosen treten hierbei vor allem durch nicht erfasste Mosaikbildung auf. Insgesamt zeigt sich in den Datensammlungen zur PID, dass beide Verfahren jeweils die Hälfte aller bisher bemerkten Fehldiagnosen verschuldet haben, obwohl die FISH ca. 4,5 Mal häufiger angewendet wurde als die PCR. Exakte Fehldiagnoseraten sind aus den veröffentlichten Daten nicht zu ermitteln, allerdings ist eine Gruppe von Wissenschaftlern dabei, die Ursachen der Fehldiagnosen weiter zu analysieren und Kontrolluntersuchungen zur Bestätigung der Diagnosen durchzuführen.7 Im Bemühen um eine größere diagnostische Sicherheit wurden die beiden genannten Techniken seit Einführung der PID in die klinische Praxis bereits weiter entwickelt. Der Einsatz der multiplen fluoreszierenden PCR und komparativen Genomhybridisierung (CGH) ermöglicht heute ebenso wie die unabhängige Untersuchung je zweier Blastomeren eines Embryos eine größere Genauigkeit in der Diagnostik.8 5 Auf die Risiken der künstlichen Befruchtung, Motivation für die Verwendung der ICSI und ihre möglichen Spätfolgen werde ich in Kapitel 3.3 näher eingehen. 6 Untersuchungen haben gezeigt, dass einem Embryo im 8-Zell-Stadium bis zu ¼ seiner Zellen entnommen werden können, ohne dass seine weitere Entwicklung dadurch beeinträchtigt wird. Vgl. Kollek (2002) S.36 und Nawroth et al. (2000) S.72. Einer Studie von Cieslak-Janzen et al. (2006) zufolge ist die Rate biopsierter Embryonen, die sich zu Blastozysten weiter entwickeln, mit der von Embryonen nach intrazytoplasmatischer Spermieninjektion vergleichbar. 7 Lt den jüngsten von der European Society of Human Reproduction (ESHRE) übermittelten Daten (s. Goossens et al. (2008) S.2643 f.) traten bisher durch PCR und FISH je 12 Fehldiagnosen auf. Allerdings wurden von 83.530 untersuchten Embryonen aufgrund der geringen Schwangerschaftsrate gerade mal 1.475 einer prä- und 1.246 einer postnatalen Kontrolluntersuchung zugeführt. 8 Eine Beschreibung jüngerer molekulargenetischer und zytogenetischer Techniken, die bereits im Rahmen der PID eingesetzt oder noch entwickelt werden, findet sich bei Sermon, Van Steirteghem, Libaers (2004). Miny, de Geyter, Holzgreve (2006) gehen näher auf den möglichen Einsatz von DNA-Chips zur umfassenden Detektion chromosomaler Anomalien ein. 6 Einleitung Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse werden möglichst bis zu drei oder je nach nationaler Regelung auch mehr gesunde Embryonen in den Uterus übertragen. Weitere gesunde Embryonen können kryokonserviert und eventuell in einem weiteren Behandlungszyklus transferiert werden. Die Embryonen, die das untersuchte, der Erbkrankheit zugrunde liegende Merkmal aufweisen, werden nicht mehr weiter kultiviert bzw. verworfen. 1.2 Die ethische Diskussion Mittlerweile wird die Präimplantationsdiagnostik in den meisten europäischen Ländern durchgeführt, und das Spektrum der durch sie bereits diagnostizierten Krankheiten umfasst laut den neuesten Daten der European Society of Human Reproduction (ESHRE) 58 monogene Erkrankungen und eine nicht näher aufgeschlüsselte Anzahl verschiedener Aneuploidien und chromosomaler Aberrationen.9 Obwohl die Jahresberichte der ESHRE von einer wachsenden Akzeptanz der Präimplantationsdiagnostik zeugen und ihre zunehmende Anwendung in der reproduktionsmedizinischen Praxis dokumentieren, bleibt die PID ethisch sehr umstritten. Der Umgang mit ihr ist aus diesem Grund in einigen Ländern - so auch in Deutschland - nach wir vor nicht explizit rechtlich geregelt. Die Kontroverse um die PID lässt sich untergliedern in die Fragen nach 1) der grundsätzlichen ethischen Vertretbarkeit der Methode der PID, d.h. nach ihren moralischen Vorannahmen, 2) der ethischen Problematik einer praktischen Anwendung der PID und 3) den möglichen Folgen der Durchführung der PID. 1) Die ethische Vertretbarkeit der PID hängt entscheidend davon ab, welcher moralische Status menschlichen Embryonen zugeschrieben wird. Über diese Frage hinaus wird sowohl von Seiten der Gegner als auch von Seiten der Befürworter der PID auf die derzeitige Praxis der Schwangerschaftsvorsorge und Reproduktionsmedizin Bezug genommen. Diskutiert wird die Vergleichbarkeit der weit verbreiteten und größtenteils akzeptierten Pränataldiagnostik (PND) mit der PID. Wichtige Streitpunkte sind dabei die Rechtfertigung einer Bewertung und Selektion menschlichen Lebens und die Frage, ob zwischen der gesetzlichen Abtreibungsregelung mit ihrer praktischen Umsetzung und einem Verbot der PID ein Widerspruch besteht. Außerdem wird die künstliche Befruchtung als notwendige Voraussetzung der Präimplantationsdiagnostik problematisiert. Im Zusammenhang mit der heutigen Reproduktionsmedizin werden die grundrecht- 9 vgl. Goossens et al. (2008). Die aktuellen Anwendungsbereiche, einzelnen Indikationen und ihre Häufigkeitsverteilung werden unter 5.1 abgehandelt. Einleitung 7 lich garantierte Fortpflanzungsfreiheit und das Grundrecht auf freie Lebensgestaltung thematisiert. 2) Zunächst von der Zulässigkeit ihrer moralischen Vorannahmen ausgehend stellen die praktische Anwendung der PID und ihre Regelung ebenfalls Streitpunkte in der Diskussion um die PID dar. Im Hinblick auf das Autonomie-Kriterium als notwendige Voraussetzung der Durchführung einer PID ist die Verortung genetischer Beratung in der PID-Praxis zu bestimmen und ihr Ablauf und Inhalt10 zu definieren. Außerdem ist angesichts des Missbrauchspotenzials der PID zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine Präimplantationsdiagnostik für bestimmte Paare indiziert sein soll und welche Verfahrensvorschriften eine nur begrenzte Zulassung sicherstellen können. In den Augen der Kritiker deutet sich in diesem Punkt bereits die Gefahr an, die von der Einführung der PID in die Reproduktionsmedizin ausgeht. Sie ist ihrer Meinung nach gleichzusetzen mit dem Betreten einer schiefen Ebene11, d.h. dass sich restriktive Indikationen auf lange Sicht nicht aufrecht erhalten lassen, sondern es zu einer kaskadenartigen unaufhaltsamen Ausweitung der moralische legitimen Anwendung kommt, die zwangsläufig in einer unmoralischen Handlung endet. Das Designer-Baby, dessen Eltern nicht nur eine Krankheit verhindert, sondern Intelligenz, Augen- und Haarfarbe ihres Kindes gewählt haben, ist der Inbegriff dieser unmoralischen Schreckensvision im Sinne einer neuen Eugenik „von unten“. 3) Als mögliche Folgen einer Einführung der PID wird ihr Wirken im Sinne einer genetisch-prädiktiven medizinischen Praxis diskutiert. Es ist fraglich, ob es Wissenschaftlern, die sich für die PID aussprechen, nicht auch darum geht, über die bei einer PID-Behandlung anfallenden überzähligen Embryonen langsam das „Tor zur Embryonenforschung“ zu öffnen.12 Neben der Forschungsfreiheit ist in diesem Kontext auch die Entwicklung der PID durch Forschung an Embryonen kritisch zu bewerten. Als äußerste Konsequenz der Einführung der PID ist eine Veränderung unseres auf Natürlichkeit und Würde basierenden menschlichen Selbstverständnisses denkbar, indem bisher Unverfügbares verfügbar gemacht wird. Als unmittelbare gesellschaftliche Auswirkung der PID kann es zur Diskriminierung Behinderter und ihrer Familien kommen, da schließlich nicht auszuschließen ist, dass durch das Angebot der PID eine neue Erwartungshaltung in der Bevölkerung entsteht, die betroffene Paare unter Druck setzt, die Geburt kranker Kinder zu verhindern. Es kann sich eine neue Pflicht zur Rechenschaft entwickeln, denn „allein 10 Gefordert wird eine genaue und der individuellen Situation angepasste Aufklärung der prospektiven Eltern über medizinische Fakten wie das bestehende genetische Risiko und das Krankheitsbild. Unter der Prämisse der Nichtdirektivität hat der Berater die Aufgabe, das Wissen verständlich zu vermitteln und Handlungsalternativen zur Präimplantationsdiagnostik aufzuzeigen. Die Funktion der Beratung thematisieren Hartog und Wolff (1997). Zur Nichtdirektivität s. auch Lunshof (1998). 11 Das Slippery-Slope-Argument ist auch bei Schroeder-Kurth (1999) S.52 und Düwell (1998) S.45 Thema. 8 Einleitung das Wissen um die Möglichkeit des Wissens raubt uns die Unschuld des Nichtwissenkönnens“13. Diese Annahme legt die Befürchtung nahe, dass sich auch eugenische Absichten mit Hilfe der PID etablieren lassen. 1.3 Fragestellung und Methodik Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine Analyse der komplexen ethischen Problematik der Präimplantationsdiagnostik. Ausgangspunkt hierfür sind die Beiträge aus der seit fast zwei Jahrzehnten andauernden Debatte zur PID in Deutschland, deren Intensität in den letzten Jahren allerdings abnimmt - sei es angesichts der fehlenden Aussicht auf einen Konsens über eine rechtliche Regelung oder angesichts der Dominanz aktueller Themen wie das geplante Gendiagnostikgesetz. Diese Beiträge bestehen aus öffentlichen Stellungnahmen14, umfassenden Monographien zur PID15, Artikeln in Sammelwerken zur PID16 bzw. zur Medizinethik im Allgemeinen17 und Artikeln in zahlreichen Fachzeitschriften aus den Bereichen der Medizinethik, der Gesellschaftsund Rechtswissenschaften und der Medizin mit den Schwerpunkten Humangenetik und Reproduktionsmedizin.18 Einschlägige internationale Beiträge werden zur Ergänzung der Vielfalt an Aspekten und Argumentationslinien herangezogen.19 Besondere Berücksichtigung finden die Erfahrungen und Evaluationen der Länder, in denen die PID bereits fest etabliert ist,20 sowie aktuelle Veröffentlichungen zum naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand der PID, die in erster Linie über die Datenbank Medline ermittelt werden. Die Integration dieser Entwicklungen erweitert die Perspektive dieser Arbeit im Vergleich zur bisher verfügbaren Literatur. Die Anordnung der einzelnen Streitpunkte des ethischen Diskurses zur PID in verschiedene Kapitel ergibt sich aus der bereits in Abschnitt 1.2 dargestellten Differenzierung zwischen einer deontologischen (Kapitel 2 und 3), einer anwendungsbezogenen (Kapitel 4 und 5) und einer konsequentialistischen Perspektive (Kapitel 6). Zu Beginn eines jeden Abschnitts sind Begriffsdefinitionen sowie eine rechtliche Verortung des Themas mit Hilfe bestehender nationaler 12 vgl. Kollek (2002) S.172-178. s. Schöne-Seifert (2005) S.714. 14 z.B. der Enquête-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ (2002), des Nationalen Ethikrats (2003) und der Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz (2000). 15 z.B. Kollek (2002), Schmidt (2003) und Ziegler (2003). 16 z.B. Supplement 1 (1999) der Zeitschrift Ethik in der Medizin Nr.11. 17 z.B. Düwell und Steigleder (2003), Knoepffler und Haniel (2000). 18 z.B. „Ethik der in der Medizin“, „psychosozial“,„Medizinrecht“ und „Der Gynäkologe“. 19 z.B. Kuhse und Singer (1999) und Carbone (2005). 20 z.B. Hennen und Sauter (2003) über Praxis und Regulierung der PID im Ländervergleich. 13 Einleitung 9 und internationaler Gesetze oder Vereinbarungen vorzunehmen.21 Anschließend sollen die den jeweiligen Streitpunkt betreffenden Argumente für und gegen eine Einführung der PID gesammelt, zueinander in Beziehung gesetzt und auf ihre Konsistenz und Kohärenz hin geprüft werden. Schließlich geht es mit Blick auf die fehlende rechtliche Regelung in Deutschland um den Versuch, über eine umfassende Analyse und Gewichtung der Argumente eine schlüssige Position zu entwickeln und diese in eine praktikable Regelung zu übersetzen. Ziel kann aber sicherlich nicht sein, eine einzig zwingende Lösung zu präsentieren. Das wäre ein anmaßendes Vorhaben angesichts der immer noch andauernden Debatte unter Beteiligung von Experten verschiedenster Disziplinen. 21 Aus deutscher Sicht sind neben Verfassungs- und Strafrecht auch ärztliches Berufsrecht und höchstrichterliche Rechtsprechung relevant. Internationale Abkommen und Deklarationen liegen u.a. von Seiten des Europarats, des Europäischen Parlaments und der United Nations vor. 10 Der Embryo 2. Der Embryo 2.1 Definitionen und Totipotenz Die interdisziplinäre Diskussion über die ethischen Streitpunkte der Präimplantationsdiagnostik erfordert an erster Stelle eine Verständigung über die von den einzelnen Fachrichtungen verwendeten Begriffe und ihre Bedeutung. Diese stellt eine entscheidende Voraussetzung für eine intensive und produktive Auseinandersetzung dar, fördert das gegenseitige Verständnis und hilft, Missverständnissen vorzubeugen. In der Medizinethik wird u.a. im Kontext der Abtreibungsregelung, Stammzell- und Embryonenforschung sowie auch der PID die Kontroverse um den moralischen Status des Embryos geführt. Ohne Grundkenntnisse des biologischen Vorgangs der Befruchtung und der Entstehung einer Schwangerschaft sind wesentliche Argumentationslinien nicht nachvollziehbar. 2.1.1 Juristische Definition Mit der Frage, ab welchem Zeitpunkt eine befruchtete Eizelle (Oozyte) ein Embryo ist, haben sich die Verfasser des deutschen Embryonenschutzgesetzes (ESchG) befasst. Sie definierten den Embryo in §8.I als „befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an“. In einer befruchteten Eizelle liegen zunächst der haploide maternale und der haploide paternale Pronucleus nebeneinander. Die Durchmischung des darin enthaltenen Erbmaterials findet erst nach Reduplikation der Chromosomensätze und Auflösung der Vorkernmembranen statt, wenn sich die aus je zwei Chromatiden bestehenden kondensierten Chromosomen in der Metaphaseebene anordnen. Erst mit dieser mikroskopisch sichtbaren Vereinigung zu einem diploiden Chromosomensatz ist die Befruchtungskaskade abgeschlossen, und ab diesem Zustand wird die Oozyte in der Biologie auch Zygote genannt. Unter die im Embryonenschutzgesetz aufgeführten Regelungen für den Umgang mit menschlichen Embryonen fallen folglich keine befruchteten Eizellen im Pronucleusstadium. Während das ESchG u.a. die Kryokonservierung von Embryonen verbietet, dürfen Vorkernstadien, die bei der Durchführung einer künstlichen Befruchtung entstehen, eingefroren werden.1 Die Problematik dieser Differenzierung wird im Zusammenhang mit dem Individualitäts-Argument in der Statusfrage noch einmal aufgegriffen. 1 vgl. Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion der Bundesärztekammer (1998b) S.3168. Der Embryo 11 2.1.2 Das Problem der Totipotenz Im Streit um die Definition des Embryos ist das Phänomen der Totipotenz als ein wesentliches embryonales Merkmal von besonderer Bedeutung. Es besagt, dass sich eine isolierte frühembryonale Zelle in geeigneter Umgebung zu einem ganzen Organismus entwickeln kann.2 Das deutsche Embryonenschutzgesetz betrachtet laut §8.I „jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag“, als Embryo, der unter den Schutz des Gesetzes fällt. Der biologische Hintergrund der Totipotenz stellt sich dabei wie folgt dar: Während der embryonalen Entwicklung teilt sich das früheste Embryonalstadium, die Zygote, in zwei Tochterzellen, die Blastomeren genannt werden. Diese durchlaufen weitere Mitosen, und zwischen dem Vier- und Acht-Zell-Stadium beginnt ihre fortschreitende Differenzierung. Die Transkription der embryonalen Gene in mRNA und deren Translation setzen ein. So kommt es zur Expression embryonalspezifischer Proteinmuster und auch zu morphologischen Veränderungen. Fraglich ist, zu welchem Zeitpunkt dieser Entwicklung die einzelnen Zellen eines Embryos ihre Totipotenz verlieren. Hall et al. haben in Untersuchungen nachgewiesen, dass nach Entnahme aus Zwei- bis Acht-Zellern menschliche Blastomeren sich in einer künstlichen Zona pellucida bis zu fünf Mal unter In-vitro-Bedingungen teilen können.3 In einer weiteren Studie gelang es ihnen zu zeigen, dass alle menschlichen Blastomeren im Acht-Zell-Stadium sich sowohl zu Embryoblast4- als auch zu Trophoblastzellen5 differenzieren konnten.6 Diese Fähigkeit ist eine Voraussetzung für die Zuschreibung von Totipotenz. Blastomeren aus Sechs- bis Zehn-Zell-Stadien entwickelten sich jedoch während der dreitägigen Kultivierung im Rahmen eines Experiments von Geber, Winston und Handyside nur zu Trophoblastblasen, was wiederum gegen eine mögliche Totipotenz der entnommenen Blastomeren spricht.7 Die Interpretation der Ergebnisse macht deutlich, dass diese Studien keine eindeutige Antwort auf die An- oder Abwesenheit totipotenter Blastomeren zwischen dem Vier- und Zehn-Zell-Stadium liefern. Eventuell lassen sich Widersprüche 2 Beier (1999) S.24 f. unterscheidet verschiedene Arten der Totipotenz: 1) Totipotenz des Nukleus einer somatischen Zelle nach Transplantation in eine Eizelle, aus der dann ein Individuum entsteht, 2) Totipotenz eines Zellverbandes zur Organogenese nach Reduktion der Zellzahl, 3) zelluläre Totipotenz zur Entwicklung eines Individuums, um die es im Fall isolierter Blastomeren geht. 3 vgl. Hall et al. (1993). Eine In-vitro-Teilung aus Acht-Zellern isolierter Blastomeren ohne künstliche Zona pellucida beobachteten auch Geber, Winston, Handyside (1995). 4 Aus diesen entsteht später der eigentliche Embryo. 5 Aus diesen entsteht, wie bei Rager (2000) S.58 dargestellt, durch die Ausbildung von Desmosomen und Gap junctions ein epithelialer Zellverband, der weitere zelluläre Polarisierungsprozesse durchläuft und aus dem später Plazenta und Eihäute hervorgehen. 6 vgl. Mottla et al. (1995). 7 vgl. Geber, Winston, Handyside (1995). 12 Der Embryo durch die Existenz „plasmatischer Faktorenbereiche“ im Inneren eines Embryos erklären, welche die Entwicklungsfähigkeit einzelner Blastomeren beeinflussen (Segregation). Andere Untersuchungen weisen nämlich bereits im Vier- und Acht-Zell-Stadium eine veränderte ProteinVerteilung im Sinne einer Polarisierung einzelner Blastomeren nach.8 Die Totipotenz von Zweiund Vier-Zellern gilt dabei in der internationalen Embryologie weitestgehend als unbestritten.9 Bereits im Vier-Zell-Stadium setzt jedoch eine zunehmende zelluläre Differenzierung ein, die mit einer Abnahme der Totipotenz einhergeht, welche allerdings nicht synchron in allen Blastomeren voranschreitet. Hansis et al. nennen in diesem Kontext den Transkriptionsfaktor Oct-4, dessen Verteilung in Abhängigkeit vom Teilungsstadium des Embryos variiert. Mit zunehmendem Teilungsgrad sinkt die Anzahl der Blastomeren, welche aufgrund einer starken Expression von Oct-4 totipotent sind und sich letztlich meist zu Embryoblastzellen entwickeln.10 So erklärt sich, dass einige Blastomeren teilungsfähig sind und sich sowohl zu Embryo- als auch Trophoblast differenzieren können, während aus anderen lediglich Trophoblastzellen hervorgehen. Die Definition des Embryos durch seine Totipotenz als ein wesentliches Merkmal, das zu Beginn seiner Entwicklung jeder einzelnen seiner Zellen zugeschrieben werden kann, wirkt sich auf die Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik aus. Ihre Durchführung erfordert für gewöhnlich eine Embryobiopsie im Sechs- bis Zehn-Zell-Stadium. Die biopsierten Blastomeren können also noch totipotent und demzufolge unter den gleichen Schutz wie der Embryo gestellt sein. Da sie für die Untersuchung des Erbguts zerstört werden, liegt eine potenzielle Verletzung des Embryonenschutzes vor, deren Nachweisbarkeit durch das Vorgehen selbst unmöglich wird, da die Totipotenz mit Zerstörung der Zelle verloren geht. Die Frage, in welchem Entwicklungsstadium mit Sicherheit keine totipotenten Blastomeren mehr vorhanden sind, beantwortet Kollek damit, dass „davon auszugehen [ist], dass der Totipotenzverlust spätestens dann eintritt, wenn die Differenzierung in Embryoblast und Trophoblast beginnt, was etwa ab dem 16-Zell-Stadium der Fall ist.“11 Folglich ist die Blastozystenbiopsie am fünften oder sechsten Tag nach der Befruchtung eine Alternative, der nicht die Vernichtung totipotenter Zellen inhärent ist. Die Vor- und Nachteile, die mit dieser Methode verbunden sind, werden in Abschnitt 5.2.1 noch einmal aufgegriffen. 8 Bei Beier (1998) S.311-313 findet sich eine Auflistung und Interpretation diverser Untersuchungen zur Totipotenz. Lt. Denker (1999) S.300 spielen „Positionsinformationen und Zell-Zell-Interaktionen [...] im Sinne der InnenAußen-Hypothese und der Polarisationshypothese ebenfalls eine wesentliche Rolle.“ 9 vgl. Beier (1999) S.23. 10 vgl. Hansis et al. (2001). In einer neueren Publikation bezeichnen Hansis (2006) schon die Zellen eines Vier-ZellStadiums als Abstammungslinien-spezifische Stammzellen. Der Embryo 13 Außer totipotenten Zellen werden auch der Embryoblast in Abgrenzung zum Trophoblast und "die individuelle Gestalt bis zum Abschluss der Organentwicklung"12 im Sinne eines Entwicklungsabschnitts, an den sich die Fetalphase anschließt, als Embryo bezeichnet. Die Verwendung des Embryobegriffs mit diesen Bedeutungen spielt in der Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik allerdings keine Rolle und wird deswegen an dieser Stelle nicht weiter beachtet. 2.2 Der Status des Embryos Die Debatte über den Status des menschlichen Embryos nahm bereits in den 80er Jahren im Kontext der Abtreibungsregelung ihren Anfang und wird seither ohne Aussicht auf Konsens geführt. Sie ist von verschiedenen unvereinbaren Positionen und Argumentationen gekennzeichnet, die im Folgenden dargestellt werden sollen: das Person-, das Progredienz- und das ObjektModell. Dabei wird besonders die Bewertung der Präimplantationsdiagnostik ausgehend von der jeweiligen Bestimmung des Status und der Schutzansprüche des Embryos von Interesse sein. Ferner geht es darum, die Rechtfertigung der Status-Zuschreibungen auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Der Zusammenhang zwischen Status und Embryonenforschung wird hingegen nicht an dieser Stelle, sondern in Abschnitt 6.2.3 erörtert, da in der Diskussion um die PID eher deren liberalisierende Auswirkung auf die Embryonenforschung denn die Entwicklung der Methode im Rahmen der Embryonenforschung als Einwand gegen eine Zulassung angeführt wird. 2.2.1 Das Person-Modell Das Person-Modell schreibt dem Embryo ab der Befruchtung den moralischen Status einer Person zu. Wie ein bereits geborener Mensch ist er Träger unantastbarer Menschenwürde und folglich Träger unveräußerlicher Menschenrechte13. Er hat ein Recht auf Leben, und dieses ist unter einen absoluten Schutz zu stellen. Seine Menschenwürde verleiht ihm Subjektstatus und einen intrinsischen Wert. Sie verbietet jegliche Instrumentalisierung und Verwendung menschlicher Embryonen für Zwecke anderer. Der Embryo ist Selbstzweck - unabhängig von seinen empirisch nachweisbaren Fähigkeiten. Doch gerade dieser Selbstzwecklichkeit wird der Embryo bei der Durchführung der PID beraubt, weil er auf Probe gezeugt und nicht um seiner Selbst Willen und 11 s. Kollek (1999) S.121. Vgl. auch Bodden-Heidrich et al.(1998) S.157 und Schüler, Zerres (1998) S.24. s. Engels (1998) S.279. 13 Oft werden die Menschenrechte durch die Trägerschaft der Menschenwürde begründet, vgl. Junker-Kenny (1998) S.302, Baumgartner et al. (1998) S.167, doch andere Autoren halten eine Zuschreibung der Menschenrechte vor Beginn der Würdeträgerschaft für möglich, vgl. Heun (2002) S.518. Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.2. 12 14 Der Embryo bedingungslos, sondern erst nach einer „Qualitätskontrolle“ angenommen wird:14 Nur, wenn nachgewiesen ist, dass er nicht an einer bestimmten Erkrankung leidet, wird er in den Uterus transferiert. Außerdem ist die Verwerfung betroffener Embryonen mit dem Grundrecht auf Leben nicht vereinbar, denn die "moderne Ethik westlicher Prägung begründet das generelle Tötungsverbot mit dem Status des Menschen als Person."15 Die Selektion durch PID instrumentalisiert den Embryo und missachtet somit seine Menschenwürde. Vertreter des Person-Modells führen zu seiner Begründung 1) Individualität und 2) Potenzialität als Charakteristika des menschlichen Embryos sowie die 3) Kontinuität seiner Entwicklung an.16 Der Embryo entwickle sich ihrer Ansicht nach nicht zum Menschen, sondern „von Anfang an als Mensch“17, auch wenn er kein Gesicht habe und deshalb nicht als ein solcher erkennbar sei.18 Unterscheidet man aber zwischen dem deskriptiven Begriff „Mensch“ und dem normativen Begriff „Person“, ist es passender, von einer „Person im Werden“19 zu sprechen. Aus Sicht des Christentums wird der Personstatus des Embryos durch die 4) Gottebenbildlichkeit begründet. Obwohl in einer säkularen pluralistischen Gesellschaft dieser Ansatz keine große Hoffnung auf Konsensbildung hervorruft, repräsentiert er doch die Meinung einiger Diskussionsteilnehmer und soll hier darum nicht vernachlässigt werden. 1) Während der Entwicklung der befruchteten Oozyte zur Zygote entstehe durch die Vereinigung maternaler und paternaler Chromosomen ein biologisches Individuum mit einem einzigartigen Genom. Seine genetische Ausstattung sei aufgrund des Crossing-overs20 während der Meiose nicht vorhersagbar und stelle das "einzige funktionelle Diskontinuum von Bedeutung in der kontinuierlichen organismischen Entwicklung“21 [nur hier hervorgehoben, A.S.] dar. Daher wird dieser Moment als Beginn embryonaler Existenz in Form eines autonomen, dynamischen, sich selbst organisierenden Systems angesehen, das sich als dieses Individuum humanspezifisch zu einer bzw. als eine Person entwickelt. 2) Der Embryo allein verfüge in Form seiner Totipotenz über das aktive Potenzial, das diese Entwicklung ermögliche, und "Entwicklung heißt [hier] 14 vgl. Maio (2003) S.720. s. Baumgartner et al. (1998) S.161. Das Tötungsverbot kenne allerdings Ausnahmen wie z.B. die Notwehr und sei daher kein absolutes Verbot, vgl. Racké (2002) S.89. Vieth (2003) S.128 sieht bei intensionaler Anwendung des Würdebegriffs in Ausnahmen eine Vereinbarkeit der Zuschreibung von Würde mit dem Aussetzen des Lebensschutzes. 16 Engels (1998) fasst die genannten Begriffe kurzerhand zum KPI-Argument zusammen. 17 s. Junker-Kenny (1998) S.310. 18 vgl. Rager (2000) S.81. 19 s. ebd., s. auch Düwell (1998a) S.36. 20 Crossing-over bedeutet, dass nebeneinander liegende homologe Chromosomen Abschnitte ihrer Chromatiden austauschen (rekombinieren), so dass dann aus Sicht des Embryos großväterliche und großmütterliche genetische Information auf einer Chromatide zu liegen kommen. 21 s. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.34. 15 Der Embryo 15 Übergang von der Potenz in den Akt.“22 3) Kontinuierlich und ohne qualitative Sprünge entwickle sich aus der totipotenten Zygote ein Mensch, der über personale Eigenschaften wie Bewusstsein, Reflexion, Abstraktion, Kommunikation und moralisches Handeln verfügen kann. Eine Person stehe „mit [den] embryonalen Frühstadien ihrer Existenz in unauflöslichem Zusammenhang“.23 Gegen die bisher aufgezeigten Argumente zur Rechtfertigung des Personstatus des menschlichen Embryos gibt es zahlreiche Einwände, die sich zum Teil gezielt gegen eine dem Embryo zugeschriebene Eigenschaft und zum Teil eher allgemein gegen die Anwendung des Personstatus richten: Zu 1) Bezüglich des Individualitäts-Arguments bemerken Kritiker, dass der Zeitpunkt der Komplettierung eines diploiden Chromosomensatzes, der auch im ESchG als Existenzbeginn des Embryos genannt ist, willkürlich festgelegt sei. Vielmehr werde die genetische Identität des Embryos bereits mit der Ausstoßung des zweiten Polkörpers nach Eindringen des Spermiums festgelegt, und die Auflösung der Vorkernmembranen habe auf sie keinerlei Einfluss mehr.24 Von einem Individuum (Latein: das Unteilbare) könne man nach Ansicht anderer Gegner des Personstatus überhaupt erst dann sprechen, wenn die Möglichkeit der Mehrlingsbildung mit der Ausbildung des Primitivstreifens25 am ca. 14. Tag post conceptionem beendet sei. Für die ersten zwei Wochen der Embryonalentwicklung wird daher auch der Begriff „Prä-Embyro“ gebraucht,26 wenn das Erscheinen des Primitivstreifens als erste Anlage einer Körperachse als Individuation gewertet wird. Es sei darauf hingewiesen, dass im Anschluss dennoch die Entstehung siamesischer Zwillinge möglich ist, die im Besitz zweier Gehirne und zweier Selbstbewusstsein sind.27 Der Primitivstreifen stellt also keine Zäsur dar, mit der sich ein Wechsel des moralischen Status begründen ließe.28 Auch er tritt nur als eine Veränderung im Ablauf einer kontinuierlichen Entwicklung auf. Dieser Versuch, den Beginn individuellen Daseins zu definieren, kann also nicht überzeugen. Kehren wir noch einmal zurück zum frühest möglichen Beginn eines menschlichen Indi- 22 s. ebd. S.103. Schockenhoff (1993) zitiert nach Junker-Kenny (1998) S.310. 24 vgl. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.53 f.. 25 Während der Implantation entwickelt sich der Embryoblast zur zweiblättrigen Keimscheibe aus Ekto- und Entoderm. Zwischen die beiden Keimblätter wandern zu Beginn der dritten Woche entlang dem Primitivstreifen Zellen, die das dritte Keimblatt in Form des intraembryonale Mesoderms bilden. 26 In der Gesetzgebung Englands, dem Human Fertilisation Embryology Act, wird dem Prä-Embryo ein geringerer Schutzanspruch zugesprochen, so dass an ihm Forschung erlaubt werden kann. Der Prä-Embryo ist dem Embryo (nach dem 14. Tag) moralisch nicht gleichgestellt. S. Ziegler (2004) S.22 und S.81 f.. 27 vgl. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.92. 28 Auch Engels (1998) S.281 sieht hier keine „moralisch relevante Kluft“ und rät von der Verwendung des PräEmbryo-Begriffs ab. 23 16 Der Embryo viduums: Die Befruchtung der Eizelle führt zu einem einzigartigen Genom, das die Zughörigkeit des Keims zur menschlichen Gattung festlegt. Vor diesem Hintergrund postulieren Baumgartner et al.: "Dass jemandem der Schutz der Würde der Person zukommt, soll mithin von nichts anderem abhängig sein als dem Umstand, Individuum der Spezies zu sein“29 [Markierung übernommen, A.S.], weil der Menschenrechtsgedanke Person- und Naturprinzip als Einheit sieht. Spaemann teilt diese Ansicht, indem er die „biologische Zugehörigkeit“ als Begründung der „Minimalwürde [...], welche wir Menschenwürde nennen“ anführt, wohingegen Habermas hier zwischen der intrinsischen „Würde des menschlichen Lebens“ und der rechtlich gesicherten, personalen Menschenwürde differenziert.30 Letztlich kann die Gattungszugehörigkeit nicht allein konstitutiv für die Zuschreibung der Menschenwürde und somit Rechtfertigung einer Sonderrolle der menschlichen Spezies sein:31 Sie stellt lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dar, denn das Potenzial zur Entwicklung eines ganzen Organismus und personaler Eigenschaften, welche die Besonderheit des Menschen ausmachen, ist in die Betrachtung zu integrieren. Hucklenbroichs Ansicht nach bleibt das Kriterium biologischer Individualität immer ein willkürliches - und insofern angreifbares. Individuation bestehe in dem Dasein eines Menschen als „sozio-psycho-somatisches Wesen“ auf der Basis von Zellen in einer historischen, d.h. unwiederholbaren Umgebung. Während ein singuläres Genom wiederholbar sei, sei die Umwelt die einmalige, individuelle Welt eines Menschen, und erst durch Wechselwirkungen zwischen einem Menschen und seiner Umwelt entwickle sich menschliche Individualität.32 Auch im Zusammenhang mit dem Potenzialitäts-Argument wird die Bedeutung der Umgebung für die Überführung des Potenzials in Aktualität genannt. So sei die Entwicklung eines menschlichen Individuums nur in Wechselwirkung mit dem mütterlichen Organismus möglich.33 Schon früh in der Schwangerschaft beginnt der embryo-maternale Dialog: Der Embryo gibt den Early Pregnancy Factor (EPF) ab, um eine Immuntoleranz des Endometriums für die Implantation zu induzieren, und der Trophoblast bildet das Humane Gonadotropin (ß-HCG), das die Aufrechterhaltung der Corpus luteum und der Schwangerschaft bewirkt. Während der Schwangerschaft sind mütterlicher und kindlicher Organismus eine „Schicksalsgemeinschaft“, und doch sind, wie Bodden-Heidrich et al. feststellen, auch "die Umgebungsbedingungen [...] zwar not- 29 s. Baumgartner et al. (1998) S.167. s. Spaemann (1987) zitiert nach Schott (2002) S.173 und Habermas (2005) S.67. 31 vgl. Düwell (1998a) S.34. Singer kritisiere die moralische Sonderbehandlung einer biologischen Gattung als „Spezieszismus“, aber „[e]in biologisches Faktum begründet kein moralisches Sollen.“ So dargestellt bei Düwell (2003a) S.66-68. 32 vgl. Hucklenbroich (2003) S.49-56. Vgl. Abschnitt 6.3.2 zur Beziehungsaufnahme als Grundlage des personalen Würdeträgerstatus. 33 vgl. Racké (2002) S.91. 30 Der Embryo 17 wendig für die Entwicklung, aber nicht hinreichend für das Selbstsein des Embryos."34 Es ist schließlich fraglich, ob die moralische Bewertung des Embryos von der Situation abhängig gemacht werden darf, in der sich der Embryo befindet. Wie kann eine Diskriminierung zwischen Embryonen in vivo und in vitro gerechtfertigt werden? Maio stellt hier die Abhängigkeit des moralischen Urteils zur Schutzwürdigkeit des Embryos von der Bewertungsbegründung heraus. Zu unterscheiden seien eine ideengeleitete Begründung, die vom Selbstzweck des Embryos ausgehe, und eine empiriegeleitete Begründung, die sich an nachweisbaren Fähigkeiten orientiere.35 Zu 2) Nachdem sich das Individualitäts-Argument zur Status-Begründung als inkonsistent herausgestellt hat, wenden wir uns dem Potenzialitäts-Argument zu. Der Embryo verfügt über ein aktives (Entwicklungs-) Potenzial36. Angesichts der wachsenden Erkenntnisse über zelluläre Differenzierungs- und Redifferenzierungs-Mechanismen stellt sich jedoch die Frage, ob nicht bald die Reprogrammierung somatischer Zellen möglich wird.37 Ein verändertes Verständnis von Potenzial wäre die Folge: Anstelle der bisher wahrgenommenen Gerichtetheit der Entwicklung im Sinne fortschreitender Differenzierung wäre auch ihre Umkehr denkbar, der zufolge alle Zellen über dasselbe Potenzial wie Embryonen verfügten.38 Totipotenz ist heute zumindest in der wissenschaftlichen Theorie kein ausschließlich embryonales Merkmal mehr. Dennoch bleibt zwischen potenziellen und aktuellen Entitäten ein Unterschied, der u.a. in der Menge ihres bereits umgesetzten Potenzials39 und in der Kenntnis ihrer Interessen besteht. Die Wesenszuschreibung „Etwas ist, was es sein kann“40 [Hervorhebung übernommen, A.S.] bedarf also in jedem Fall einer Rechtfertigung. Nach dem Person-Modell hat der Embryo ein Recht auf Leben. Dieses setzt wiederum ein Interesse an seinem Inhalt, nämlich am Leben, voraus,41 das im Fall eines Embryos lediglich antizipiert werden kann. Beim Vergleich mit einem bewusstlosen Unfallopfer hält Schmidt es für „unplausibel, solchen voluntativ amorphen Entitäten [wie Embryonen] gleichrangige positive Interessen [am Leben] zuzuschreiben.“42 Im Fall der Präimplantationsdiagnostik geht es um „alles oder nichts“, Existenz oder Nicht-Existenz. Die Frage, ob ein Embryo, der Träger einer schweren genetischen Erkrankung ist, lieber geboren oder verworfen wer- 34 s. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.117 und S.77. vgl. Maio (2002) S.163. 36 „Aktiv“ ist hier im Gegensatz zum passiven Potenzial der Gameten zu verstehen, das erst durch ihre Vereinigung „aktiviert“ wird. 37 vgl. Hansis (2006). 38 vgl. Hucklenbroich (2003) S.52-54 und Kreß (2002a) S.178. 39 An dieser Stelle sei daran erinnert, dass genetische Information nicht allein den Phänotyp eines Menschen determiniert. Genexpression wird ebenso wie die Entwicklung personaler Fähigkeiten durch ihren Kontext beeinflusst. 40 Honnefelder zitiert nach Ruppel und Mieth (1998) S.368. Der Nationale Ethikrat (2003) S.69 formuliert ebenfalls die Frage, warum einem Status quo der Status ad quem verliehen werden soll. 41 vgl. Schöne-Seifert (1999) S.726 und Düwell (1999) S.11. 42 s. Schmidt (2003) S.182. 35 18 Der Embryo den würde, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Sie wird jedoch im Zusammenhang mit der Konfliktlage bei medizinisch indiziertem Schwangerschaftsabbruch erneut thematisiert. Kehren wir an dieser Stelle zurück zum embryonalen Entwicklungs-Potenzial und beachten die Tatsache, das dieses unter bestimmten Umständen eingeschränkt sein kann. So haben Untersuchungen gezeigt, dass ca. 50 % aller Konzeptionen und 15 % aller klinischen Schwangerschaften mit einem natürlichen Abort enden. In ungefähr der Hälfte aller Fehlgeburten liegen Chromosomenstörungen vor. Im Gegensatz dazu sind solche aber nur bei 0,6 % der Neugeborenen nachweisbar.43 Diese Zahlen zeigen deutlich, dass chromosomale Aneuploidien das embryonale Potenzial vermindern. Nach Meinung Fords liegt bei von Beginn an fehlender Entwicklungskapazität gar kein Embryo vor.44 Folglich wäre einem solchen „Zellhaufen“ auch kein Personstatus zuzuschreiben. Allerdings muss an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden, dass neben der chromosomalen Ausstattung weitere, noch unbekannte genetische und UmweltFaktoren wirken und darüber entscheiden, ob z.B. ein gonosomale Monosomie (45, X0) oder eine Trisomie 21 zur Geburt eines Kindes führen oder in einem Abort enden. Hieraus ist zu schlussfolgern, dass Potenzialität also keine Eigenschaft aller Embryonen und ihr Vorhandensein nicht ohne weiteres erkennbar ist. Als alleiniges Kriterium der Statuszuschreibung ist sie deshalb ungeeignet. Der Status der Embryonen mit eingeschränktem Potenzial bleibt hier ungeklärt. Zu 3) Es wird deutlich, dass bestimmte Ereignisse im Ablauf der embryonalen Entwick- lung von besonderer Bedeutung sind und somit ihre Kontinuität in Frage stellen: Die Implantation ist Voraussetzung einer weiteren Umsetzung der Potenzialität menschlicher Embryonen, sie stellt also ihre „natürliche Grenze“45 dar. Wie die oben genannten Zahlen belegen, sinkt nach der Nidation die Abort-Wahrscheinlichkeit. Außerdem ist das Erscheinen des Primitivstreifens zumindest als sehr wahrscheinliche Individuation anzusehen (s.o.), und auch die Geburt gilt es angesichts der medizinischen Indikation der Abtreibungsregelung als Zäsur zu beurteilen: Intrauterines fetales Leben steht unter einem geringeren Schutz als das Leben eines Neugeborenen. Juristische Regelungen und moralische Bewertungen sind zwar prinzipiell voneinander zu unterscheiden, dennoch besteht zwischen ihnen ein unbestreitbarer Zusammenhang. Die angewandte Ethik hat es sich zu Aufgabe gemacht, auch den praktischen Kontext einer moralischen Fragestellung in ihre Überlegungen zu integrieren, die wiederum als Grundlage konkreter Handlungsanweisungen dienen sollen.46 Im Bezug auf die Statusfrage bedeutet dies, besonders die Freigabe 43 vgl. Wolff (2002) S.365 f.. vgl. Ford (2000) S.106 f.: “Chiaramente, non è un embrione […] che sin dall’inizio è intrinsecamente incapace di sviluppo umano.” 45 s. Junker-Kenny (1998) S.309. 46 vgl. Düwell (1999) S.7. 44 Der Embryo 19 nidationshemmender Verhütungsmittel und die Durchführung von Spätabbrüchen zu überdenken, denn "im moralischen Sinne ist es mehr als fraglich, einem Menschen im Mutterleib die moralischen Rechte abzusprechen, die er außerhalb desselben hätte."47 Eine detailliertere Betrachtung des Widerspruchs zwischen Embryonenschutz in vitro und Abtreibungspraxis ist jedoch dem Abschnitt 3.2 vorbehalten. Hier geht es weiter um das Person-Modell, das die Ausdehnung des Geltungsbereichs der Menschenwürde48, die wiederum auf der Annahme einer grundsätzlichen Unverfügbarkeit des Menschen basiert, auf das ungeborene Leben zum Ausdruck bringt. Zu 4) Ein weiterer, jedoch selten angeführter Begründungsansatz des Person-Modells wird durch die christliche Lehre der Gottebenbildlichkeit (Gen 1, 26-28) bereit gestellt. Die Gottebenbildlichkeit sei Voraussetzung einer Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, der als Haushalter Gottes eine besondere Rolle in der göttlichen Schöpfung einnehme.49 Dieser Schöpfungsbund drücke einen Anspruch Gottes an den Menschen aus und führe ihn in ein Verantwortungsverhältnis gegenüber Gott. Durch diese Rechenschaftspflicht erlange der Mensch seine Würde. Eibach beschreibt die Extension menschlicher Würde wie folgt: „Nach christlicher Sicht sind die Person und ihre Würde keine empirischen Qualitäten, sondern ‚transzendente Größen’, die von Gott her dem ganzen menschlichen organismischen Leben [...] von der Zeugung [...] bis zum Tod unverlierbar zugesprochen und zugeordnet sind, die also mit dem physischen Dasein zugleich gegeben sind und die alle Menschen in allen Stadien des Lebens anzuerkennen und [...] zu achten haben [...]. Personsein und die Würde gründen - wie alles Leben überhaupt - im Handeln Gottes für den Menschen.“50 Ein Blick in die Geschichte christlicher Traditionen verrät, dass noch bis 1869 die Theorie der Sukzessivbeseelung nach Thomas von Aquin galt, die eine graduell ansteigende Schutzwürdigkeit des Embryos postulierte. Abgelöst wurde sie durch die dann von Papst Pius IX eingeführte Lehre der Simultanbeseelung, die ab der Befruchtung von einem absoluten Schutzanspruch ausgeht. Wie bereits angedeutet liegt heute das wesentliche Problem der christlichen Rechtfertigung des embryonalen Personstatus darin, dass sie in einer säkularen pluralistischen Gesellschaft keinen Konsens schaffen oder gar als Rechtsgrundlage herbeigezogen werden kann. Dennoch weisen sowohl der thomasische Ansatz als auch der Generalvorwurf der Kontraintuitivität, den Kritiker dem Person-Modell unabhängig von seiner Begründung machen, in Richtung eines wachsenden embryonalen Schutzanspruchs. Auch die menschliche Intuition 47 s. Haker (1998) S.264. Der Begriff der Menschenwürde wird in Zusammenhang mit unserem heutigen Menschenbild in Abschnitt 6.3.2 noch ausführlich behandelt. 49 vgl. Käßmann (2003). 50 s. Eibach (2000) S.115 f.. 48 20 Der Embryo erkennt nämlich erst mit zunehmender Gestaltwerdung den Embryo bzw. Fetus als Mitglied der eigenen Spezies und hält ihn daraufhin für schützenwert. 2.2.2 Das Progredienz-Modell Einen wachsenden Schutzanspruch des Embryos beschreibt das Progredienz-Modell. Es geht davon aus, dass der Embryo bereits ab der Befruchtung ein schützenswerter Träger subjektiver Rechte ist. Diese Rechte sind aber zunächst schwache Rechte und gegen andere Rechtsgüter abwägbar. Folglich ist eine Tötung des Embryos mit seinem Rechtsträgerstatus nicht von vornherein unvereinbar.51 Mit voranschreitender Entwicklung nehmen auch die Rechte an Stärke zu, wobei das Erreichen des vollwertigen moralischen Status, wie noch zu zeigen ist, an verschiedene Eigenschaften oder Entwicklungsstufen geknüpft sein kann.52 Aus Perspektive dieses Modells ist der Verzicht auf die Implantation eines erst wenige Tage alten Embryos nach PID aufgrund des geringeren Schutzanspruches moralisch eher zu rechtfertigen als ein Abbruch nach Pränataldiagnostik zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft. Eine Einführung der Präimplantationsdiagnostik und ihre restriktive Anwendung sind also unter dieser Voraussetzung denkbar. Ihr Verbot scheint dagegen angesichts der rechtlichen Legitimation von Spätabbrüchen und deren Durchführung wenig plausibel. Unter den Befürwortern des Progredienz-Modells herrscht keine einheitliche Meinung darüber, welche empirisch nachweisbaren Ereignisse zur Begründung des Status heranzuziehen sind. Zwei mögliche Zäsuren sind die Momente der Implantation und der Ausbildung des Primitivsteifens, deren Bedeutung schon im Kontext des Potenzialitäts- und IndividualitätsArguments erläutert wurde. Auch der Entwicklung des Nervensystems wird besonders im Hinblick auf den Beginn der Hirntätigkeit als Äquivalent zur Hirntoddefinition und im Hinblick auf den Beginn des Schmerzempfindens53 Bedeutung beigemessen. Allerdings lassen Hinweise auf die anhaltende Kontinuität der Entstehung des Nervensystems vom 16. Tag p.c. und auf seine Plastizität bis ins hohe Lebensalter an dem einschneidenden Charakter dieser Veränderungen zweifeln. Auch der Ansatz von Alan Gewirth zur Begründung einer normativen Ethik wird im Bemühen um die Rechtfertigung eines graduell ansteigenden Schutzanspruchs herangezogen. 51 vgl. Maio (2002) S.160 f., der als Vertreter des Person-Modells auch das Progredienz-Modell darstellt und dabei auf die Bedeutung der Haltung hinter einer Tötungshandlung hinweist. Das leichtfertige Wegwerfen eines Embryos sei anders zu bewerten als eine Tötung aus Not (in einem Schwangerschaftskonflikt) heraus. 52 Schmidt (2003) S.113-120 differenziert hier die Modelle gradueller und phasischer Personalität. Ersteres sehe den Embryo stets als Träger wachsender subjektiver Rechte, während zweiteres ihm zunächst nur Schutz durch objektive und ab einer bestimmten Entwicklungsstufe auch durch subjektive Rechte zuspreche. 53 Die cortico-thalamo-corticale Schleife stellt das morphologische Substrat des Schmerzempfindens dar. Sie ist ab der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) nachweisbar. Vgl. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.96. Der Embryo 21 Hiernach bestimmt der Grad, in dem für ein Handeln konstitutive Fähigkeiten ausgebildet sind, die Höhe des Schutzanspruchs und die Stärke der Rechte eines Embryos.54 Gewirth verknüpft dabei Gradualität und Potenzialität, indem er zwischen potenziell Handlungsfähigen und aktuell Handlungsfähigen unterscheidet und nur letzteren Würde und die konstitutiven Rechte auf die für ihr Handeln notwendigen Güter zuspricht. Embryonen besäßen demzufolge zwar einen moralisch relevanten Status, der grundsätzlich ihre Erhaltung und ihren Schutz gebietet, aber keine Würde.55 Mieth, Graumann und Haker kritisieren, dass mit dem Rekurs auf Gewirth, „formale, schwache anthropologische Voraussetzungen [...] geltend gemacht“ würden, da „Menschsein [...] nicht allein durch Handlung oder Handlungsfähigkeit konstituiert [werde].“56 Häufig wird gegen das Progredienz-Modell das Argument der Willkürlichkeit bei der Etablierung von Zäsuren und Stufen im Ablauf der frühen menschlichen Entwicklung vorgebracht. Ruppel und Mieth verurteilen diesen Dezisionismus in einer Zeit, in welcher der Embryo unter keinem oder nur einem schwachen Schutz stehe, als einen "Verlust des Verantwortungsbewusstseins“, der zu einer unangebrachten „Indifferenz“ gegenüber Menschenleben führe. Diese wiederum minimiere Bedenken gegenüber Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik.57 Dem graduell anwachsenden Embryonenschutz wird außerdem das KontinuitätsArgument entgegen gehalten: Kontinuierliche Leiblichkeit sei die Grundlage des Sich-Erkennens im menschlichen Embryo und der Statuszuschreibung.58 2.2.3 Das Objekt-Modell Eine extreme Position hinsichtlich der Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen nimmt Singer ein, indem er aktuelles Ich-Bewusstsein und Rationalität als Voraussetzungen des Personstatus bezeichnet. Eigenschaften wie u.a. Autonomie, Selbstbewusstsein und Schmerzempfinden, denen man moralische Relevanz zuschreibe, seien bei Tieren ausgeprägter als beim menschlichen Fetus.59 Von Singers Standpunkt aus gesehen sind also Embryonen, schwerstbehinderte und komatöse Menschen keine Personen. Ihnen allen werden weder Menschenwürde noch Menschenrechte zugesprochen. Ein Mensch ist erst ab dem 2. Lebensjahr, wenn er sich seiner selbst be- 54 Bei Hübenthal (2003) ist der Ansatz von Gewirth in ausführlicherer Form beschrieben. vgl. Steigleder (1998) S.98. 56 s. Mieth, Graumann, Haker (1999a) S.138 und Ruppel, Mieth (1998) S.370. 57 vgl. Ruppel, Mieth (1998), S.372. 58 vgl. Junker-Kenny (1998) S.318. Zur medialen Funktion des Leibes in Hinblick auf Selbsterfassung und Gattungsgedächtnis s. auch Wils (2003) S.19 59 vgl. FN zu Singer (1989) und Hoerster (1989) bei Bodden-Heidrich et al. (1998) S.104 55 22 Der Embryo wusst wird,60 eine Person mit einem absoluten, aber verlierbaren Schutzanspruch. Die Begründung dieser Position besteht darin, dass nur selbstbewusste und rationale Wesen in der Lage sind, Zukunft zu antizipieren. In dieser Fähigkeit sieht Singer nämlich den Unterschied zwischen Mensch und Tier, der ein Tötungsverbot für Personen rechtfertigt. Da der menschliche Embryo dieser Kompetenz entbehrt, nimmt er einen reinen Objekt-Status ein. Er ist nichts weiter als ein Zellhaufen mit keinerlei Schutzanspruch. Seiner Instrumentalisierung im Rahmen von Embryonenforschung oder Präimplantationsdiagnostik steht folglich nichts entgegen. Ebenso sind Schwangerschaftsabbrüche zu jedem Zeitpunkt moralisch gerechtfertigt, da der Embryo bzw. der Fetus nicht mehr wert ist als jeder andere Zellverband. Folgt man der Annahme Singers ist in letzter Konsequenz auch die Tötung eines Neugeborenen nicht gravierender als das Verwerfen eines Zwei-Zellers. Im Gegensatz zu Person- und Progredienz-Modell wird das Objekt-Modell in der Literatur wenig diskutiert. Dies ist nicht etwa auf seine breite Akzeptanz, sondern eher auf einen Konsens darüber zurück zu führen, dass der menschliche Embryo einen Wert besitzt, der ihn von anderen Zellansammlungen unterscheidet. Die Kenntnis seines Entwicklungspotenzials und das Wissen, dass jeder Mensch einst selbst ein Embryo war (Identität und Kontinuität) führen in ihrer Vergegenwärtigung dazu, dass wir dem Embryo nicht gleichgültig gegenüber stehen. Auf einzelne Kritikpunkte an der Position Singers kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da diese im Kontext des von Singer vertretenen Präferenz-Utilitarismus zu betrachten sind. Es sei lediglich noch darauf hingewiesen, dass Singers Voraussetzung aktuellen Bewusstseins auch Schlafenden den Personstatus abspricht und sie schutzlos macht. Diese Implikation zeigt bereits weitere Schwierigkeiten hinsichtlich der Anwendung des Singerschen Personbegriffs auf. Die Auseinandersetzung mit der Diskussion über den Status des Embryos macht deutlich, dass keine Aussicht auf Konsens besteht. Auch der Rekurs auf objektivierbare biologische Vorgänge der frühen menschlichen Entwicklung liefert keine eindeutige Antwort, sondern Fakten, die einer subjektiven Interpretation unterliegen. In bezug auf die Bedeutung des moralischen Status für die ethische Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik bleibt schließlich festzuhalten, dass das Person-Modell als Ausgangspunkt nur ein Verbot der PID fordern kann, während Vertreter sowohl des Progredienz- als auch des Objekt-Modells weitere Aspekte einer Zulassung berücksichtigen müssen, um eine Entscheidung für oder gegen die PID zu treffen. 60 In Abhängigkeit von der Entwicklung neuronaler Strukturen bildet „sich gegen Ende des 2. Lebensjahres [...] [die] Fähigkeit des Kindes [heraus], sich eigener Gefühle, Absichten und Handlungsweisen bewusst zu werden. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins geht einher mit der Fähigkeit für ‚richtiges’ oder ‚falsches’ Verhalten.“ S. Eggers (2004a) S.13. PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 23 3. Präimplantationsdiagnostik im Kontext der Reproduktionsmedizin 3.1 Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik im Vergleich Die ethische Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik findet unter Einbeziehung der heute gängigen fortpflanzungsmedizinischen Praxis statt. Von Bedeutung sind hierbei pränataldiagnostische Methoden und der medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbruch, die als Vergleichspunkt oder Alternative in der Debatte angeführt werden. Auch die Durchführung der In-vitroFertilisation, die der PID notwendiger Weise vorangeht, nimmt auf ihre Bewertung Einfluss. 3.1.1 Die Methoden der Pränataldiagnostik Die pränatale Diagnostik hat durch die Einführung der Sonographie in den 60ern, die Etablierung der Amniozentese (AC) in den 70er und der Chorionzottenbiopsie (Chorionic villus sampling = CVS) in den 80er Jahren eine ständige Erweiterung ihrer Techniken erfahren. Auch Fetoskopie, Nabelschnurpunktion und Hautbiopsie sind Methoden, die in der Pränatalmedizin zum Einsatz kommen. Da sie jedoch vergleichsweise selten angewandt werden und bei positivem Befund oft eine weitere Abklärung durch Amniozentese nach sich ziehen, sind sie im Hinblick auf die PID-Problematik zu vernachlässigen. Es besteht die Hoffnung, dass in Zukunft Untersuchungen an fetalen Zellen, die schon ab der 8.-9. SSW aus dem mütterlichen Blut isolierbar sind, nach deren Anreicherung durchgeführt und so invasive Methoden wie AC und CVS überflüssig werden könnten.1 Während Ultraschalluntersuchungen inzwischen fester Bestandteil der Schwangerschaftsvorsorge sind, erfolgen Chorionzottenbiopsie und Amniozentese aufgrund ihrer Invasivität und der eingriffsbedingten Risiken nur nach vorheriger Indikationsstellung2. Der größte Anteil (ca. 80 %) entfällt hierbei auf die sogenannte Altersindikation. Schwangere, die älter als 35 Jahre sind, haben ein erhöhtes Risiko, Kinder mit chromosomalen Störungen zur Welt zu bringen.3 Die vorangegangene Geburt eines von einer genetischen Erkrankung betroffenen Kindes, der nachgewiesene Trägerstatus der Eltern und auffällige Screening-Befunde4 stellen 1 Eine ausführliche Darstellung der einzelnen diagnostischen Techniken findet sich bei Stengel-Rutkowski (1997) S.49-61. Hildt (1998) S.203 f. sieht in der Entwicklung nicht-invasiver Methoden die Gefahr, dass sich genetische Pränataldiagnostik in Zukunft zu einem Schwangerschafts-Screening entwickelt. 2 Die Richtlinien der Bundesärztekammer (1998) S.3238 f. unterscheiden hier zwischen ungezielter und gezielter pränataler Diagnostik und führen Indikationen für letztere tabellarisch auf. 3 vgl. Stengel-Rutkowski (1997) S.69. Hildt (1998) S.204 verweist hier auf Schmidtke (1995), der die Willkür dieser scheinbar objektiven Grenzziehung kritisiert, da das Anomalie-Risiko kontinuierlich mit dem Alter zunehme und die Risiko-Nutzen-Abwägung von der jeweiligen Lebenssituation abhängig sei. 4 In der Sonographie deutet z.B. eine verdickte Nackenfalte in der 10.-14. SSW auf eine eventuelle Chromosomenstörung hin. Seit 1992 kann auf Wunsch der Schwangeren in der 14.-18. SSW ein Triple-Test zur RisikoAbschätzung durchgeführt werden. Anhand der Werte für α-Fetoprotein, β-HCG und unkonjugiertes Östriol im 24 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin weitere Indikationen der PND dar. Deutsche Ärzte sind seit einem Bundesgerichtshof-Urteil von 1983 dazu verpflichtet, Risikopaare auf die Möglichkeit der PND hinzuweisen,5 andernfalls können sie für die Geburt eines behinderten oder kranken Kindes haftbar gemacht werden. Seit Beginn der 80er Jahre existiert die psychologische Indikation, die im Fall besonderer Besorgnis der werdenden Mutter gestellt werden kann.6 In der 10. bis 12. SSW können durch transvaginale oder -abdominale Saug- oder Zangenbiopsie Trophoblast- und Stromazellen der Chorionzotten der Plazenta gewonnen werden. Nur erstere sind wegen ihrer hohen Spontanmitoserate ohne längere Kultivierung genetisch und chromosomal analysierbar, so dass ein frühes Untersuchungsergebnis erwartet werden kann. Allerdings ist dabei mit Fehldiagnosen durch Mosaikbildung zu rechnen. In ca. 1 % der Biopsien weisen die extraembryonalen Trophoblastzellen Mutationen auf, die aber nur in 20 % auch in embryonalen Zellen zu finden sind. Auch der umgekehrte Fall ist denkbar.7 Das eingriffsbedingte Abortrisiko liegt für die transvaginale Durchführung bei 2-3 % und für die transabdominale bei 1 %. Häufige Ursachen sind Infektionen und Verletzungen des Muttermundes. Wegen der Spontanaborte aneuploider Embryonen liegt jedoch das gesamte Verlustrisiko je nach Methode bei 5,9 bzw. 3,6 %. Besonders nach einer frühen CVS wurden außerdem vermehrt Finger- und Zehen-Reduktionsfehlbildungen beobachtet. Die Durchführung einer Standard-Amniozentese erfolgt in der 15. bis 16. SSW. Unter sonographischer Kontrolle wird die Fruchthöhle punktiert und ca. 12 ml Fruchtwasser entnommen. Nach einer mehrwöchigen Kultur der darin enthaltenen fetalen Zellen werden diese auf chromosomale oder genetische Störungen untersucht, so dass ein medizinisch indizierter Abbruch nach AC erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft stattfinden kann. In 0,5-1 % kommt es zu punktionsbedingten und in 2 % der Amniozentesen insgesamt zu Fehlgeburten. Sowohl Fruchtwasserabgang, Blutungen und Infektionen als auch postnatale kindliche Probleme in Form von Atemstörungen, Fehlhaltungen etc. können die Folgen einer Amniozentese sein.8 Blut der Schwangeren wird unter Berücksichtigung ihres Alters, Gewichts und der Schwangerschaftsdauer das individuelle Risiko für Trisomie 21 berechnet. 5 vgl. Nippert (1997) S.108 und Bundesgerichtshof (1984). Im Jahr 1993 bestätigte der Bundesgerichthof (1994) in einem Urteil die Haftbarkeit des Arztes im Fall unzureichender Beratung einer Schwangeren. 6 vgl. ebd. S.107. 7 s. Stengel-Rutkowski (1997) S.63. Lt. Schroeder-Kurth (1999) S.51 bestehe der Verdacht, dass es zu einer Abwanderung aneuploider Zellen in den Trophoblast komme. Die Entwicklung der Plazenta scheine durch sie nicht beeinträchtigt zu sein, während die Bedeutung von Mosaizismen für die Entwicklung des Embryos unklar bleibe. 8 Stengel-Rutkowski (1997) S.49-57 beschreibt die „klassische“ Pränataldiagnostik, die sich in erster Linie um die Diagnostik chromosomaler Anomalien durch Präparation (Karyogramm) bemüht. Vgl. auch Bundesärztekammer (1998). Miny, de Geyter und Holzgreve (2006) S.703-706 analysieren hingegen die Einführung molekularer Methoden wie FISH und PCR in die PND und weisen auf die Entwicklung von DNA-Arrays hin. PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 25 Neben den möglichen physischen Folgen sind schwangere Frauen, die eine PND durchführen lassen, schweren psychischen Belastungen ausgesetzt.9 Propping beschreibt die Schwierigkeit, sich für oder gegen die Untersuchung zu entscheiden, folgendermaßen: "Die Pränataldiagnostik betrifft eine existentielle Extremsituation. Die Schwangere muss vor einer invasiven Diagnostik zwischen dem Risiko einer Krankheit ihres Kindes, der Aussagekraft der angewandten Methode, dem Risiko des Eingriffs und den eventuellen Konsequenzen nach Vorliegen eines pathologischen Befundes abwägen können.“10 Lehnt eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch von vornherein ab, beläuft sich der Vorteil der PND allein auf die Möglichkeit, dass sich Kreißsaal-Team und Eltern schon früh auf die Geburt eines kranken Kindes vorbereiten oder dass, wie es in 97 % der PND der Fall ist, der negative Befund auf die Schwangere beruhigend wirkt. Eine intrauterine Therapie ist bisher nur sehr selten möglich. Hildt und andere Autoren beschreiben in diesem Zusammenhang, dass die Pränataldiagnostik Risikopaare dazu ermutige, (noch) ein Kind zu zeugen. Durch sie werde in einem solchen Fall also Handlungsfreiraum geschaffen.11 Allerdings ist auch eine so gewählte „Schwangerschaft auf Probe“ für die Frauen psychisch sehr belastend. Zunächst erleben viele von ihnen eine emotionale Distanz zu dem heranwachsenden Kind, das erst bei Vorliegen des negativen PND-Befundes angenommen wird. Stellt sich jedoch heraus, dass der Fetus von einer Erkrankung oder Behinderung betroffen ist, befindet sich das Paar in einem Entscheidungskonflikt12 zwischen einem Leben mit diesem Kind und einem Schwangerschaftsabbruch. Das Ergebnis der Fruchtwasser-Diagnostik liegt in der Regel nach zwei bis drei Wochen vor. In dieser Zeit wächst der Fetus weiter heran, und bereits ab der 17. SSW kann die Frau die ersten Kindsbewegungen spüren. Die Indikation eines Spätabbruchs (nach der 12. SSW) liegt dann vor, wenn die physische oder psychische Gesundheit der Mutter durch die Geburt des Kindes gefährdet ist. Ausschlaggebend ist demnach nicht der gesundheitliche Zustand des Kindes.13 In der Praxis werden mit Hilfe von Prostaglandinen Wehen eingeleitet, die zur Austreibung des Feten führen, der in diesem Stadium der Schwangerschaft bereits über Schmerzempfinden verfügt. Da das Kind ab der 22. SSW lebensfähig sein kann, wird bei sehr späten Abbrüchen ein 9 Nippert (1997) S.109-114 stellt die psychosozialen Folgen der PND dar. s. Propping (1998) S.1303. Mit dem Entscheidungsprozess vor der Durchführung einer PND und den darin wirkenden Variablen setzt sich Wiedebusch (1997) auseinander. 11 vgl. Hildt (1998) S.203 und Wiedebusch (1997) S.130. 12 Die Notlage dieser Paare wird im Vergleich von PID und PND noch weiter analysiert. 13 1995 wurde in Deutschland der §218 novelliert. Da Behindertenverbände in der embryopathischen Indikation die Unwerteklärung schwerstbehinderten Lebens sahen, wurde die medizinische Indikation neu formuliert. Daraufhin verfassten Kritiker auf der 5. medizinisch-ethischen Klausur- und Arbeitstagung (1998) das sog. Schwarzenfelder Manifest, das lt. Richter (1998) unterschiedlich bewertet wurde. Mehr dazu und zu den jüngsten Bemühungen einer erneuten Überarbeitung des §218 schreibt Hoppe (2006). Vgl. auch Engels (1998) S.289 f.. 10 26 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin intrauteriner Fetozid durchgeführt, denn im Fall einer Lebendgeburt muss bei Aussicht auf Erfolg eine Therapie eingeleitet werden.14 3.1.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von PND und PID Die Präimplantationsdiagnostik ist eine Technik, die Risikopaaren ebenfalls zu einem gesunden Kind verhelfen kann. Unter der Annahme eines graduell ansteigenden Schutzanspruchs des Embryos erscheint sie im Vergleich zur PND als das „geringere Übel“. Statt einer „Schwangerschaft auf Probe“ sieht sie eine „Zeugung auf Probe“ vor, und statt eines belastenden Spätabbruchs erfolgt die Verwerfung positiv getesteter Embryonen im Labor. Dennoch ist es nicht richtig, die PID lediglich als „vorgezogene Pränataldiagnostik“ zu betrachten. Im Folgenden sollen Analogien und Unterschiede der beiden Methoden aufgezeigt und auf ihre Bedeutung für eine ethische Bewertung untersucht werden. Einen Streitpunkt stellen die Belastungen dar, die für die Paare mit der Anwendung von PID und PND - vgl. Abschnitt 3.1.1 - verbunden sind. Im Fall der Präimplantationsdiagnostik hängen diese in erster Linie mit der künstlichen Befruchtung zusammen. Jeder einzelne Schritt birgt Risiken in sich15 und ist mit Sorge auf Seiten der prospektiven Eltern behaftet. Auch die anschließenden Maßnahmen wie Embryobiopsie und molekulargenetische Diagnostik bieten Fehlermöglichkeiten und werden begleitet vom Bangen um ihr Gelingen und der Hoffnung auf eine möglichst große Zahl gesunder Embryonen für den Transfer in den Uterus. In nur 26 % aller Embryotransfers tritt eine klinische Schwangerschaft ein.16 Trotzdem liegt die Bewertung der Zumutbarkeit beider Methoden bei den betroffenen Frauen selbst und ist im Kontext der individuellen Lebenssituation zu sehen. Sie kann nicht pauschal und paternalistisch von Außenstehenden vorgenommen und als Argument für oder gegen die Präimplantationsdiagnostik verwendet werden. Letztlich ist auch mit Eintritt einer Schwangerschaft nach PID noch keine Sicherheit erreicht, denn aufgrund möglicher diagnostischer Fehler der FISH oder PCR wird in der Regel noch eine Kontroll-Amniozentese durchgeführt. Das bedeutet, dass eine Einführung der PID die PND nicht überflüssig macht und dass sie Spätabbrüche nicht vollkommen verhindern, sondern 14 Die Bundesärztekammer (1998a) S.3015 erklärt die Vermeidung durch den Abbruch hervorgerufenen Leidens für das Kind zum Ziel des Fetozids. Auf die Abtreibungsproblematik im Besonderen geht der Abschnitt 3.2 weiter ein. 15 Dazu Näheres in Kapitel 3.3. 16 Vgl. Goossenes et al. (2008) S.2632. "Klinische Schwangerschaft" meint im Gegensatz zur sogenannten „chemischen Schwangerschaft“, dass nicht nur β-HCG im Schwangerschaftstest, sondern auch der kindliche Herzschlag nachweisbar ist. PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 27 nur in ihrer Anzahl reduzieren kann.17 Auch die Vermeidung von Spätabbrüchen kann folglich nicht zur Rechtfertigung der PID herangezogen werden. Eine wichtige Frage im Hinblick auf die Analogisierbarkeit von PID und PND richtet sich an die Bewertung der Konfliktlage, in die Paare geraten, wenn bei ihrem ungeborenen Kind mittels Amniozentese eine genetische oder chromosomale Veränderung festgestellt wurde. In dieser Notsituation müssen sie sich für oder gegen dieses eine Kind entscheiden. Einen anderen Ausweg aus dem Dilemma gibt es nicht. Dabei sind mütterliche Autonomie bzw. das mütterliche Recht auf Unversehrtheit und das Lebensrecht des ungeborenen Kindes die Güter, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Die Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruchs liegt darin, dass dem Schutz der mütterlichen Integrität Vorrang vor dem Schutz des pränatalen Lebens eingeräumt wird. Bei Anwendung der PID stellt sich die Situation insofern anders dar, als sich die untersuchten Embryonen nicht im Mutterleib, sondern in der Petrischale befinden. Schließlich betraut das Risikopaar durch seine Entscheidung für die PID zugleich Ärzte mit der Durchführung einer künstlichen Befruchtung. Schockenhoff spricht davon, dass zwischen dem Paar und den erzeugten Embryonen ein „emotionales Vakuum“ herrsche.18 Obwohl anzunehmen ist, dass allein das Wissen um die Abstammung der Embryonen und die Hoffnung auf ein eigenes gesundes Kind keine völlige Beziehungslosigkeit zulassen, ist das Verwerfen kranker In-vitroEmbryonen nicht wie ein Spätabbruch durch offensichtlich konfligierende Personenrechte zu rechtfertigen. Als ein weiterer Unterschied ist anzuführen, dass bei einer „Schwangerschaft auf Probe“ erst das Ergebnis der PND den Konflikt hervorruft,19 welcher der werdenden Mutter ein Abwehrrecht im Sinne einer negativen Selektion einräumt. Dagegen handelt es sich bei Anwendung der PID immer um eine „Zeugung auf Probe“, die womöglich ohne das Vorliegen eines aktuellen Konflikts die Auswahl nicht-betroffener Embryonen und darüber hinaus eine positive Selektion ermöglicht. Eine Rechtfertigung dieser Auswahl ohne jede Not wäre dann nur durch das positive Recht der Eltern auf ein gesundes Kind denkbar. Vor einer genaueren Untersuchung des selektiven Charakters beider Techniken ist daher zu klären, ob im Fall der Präimplantationsdiagnostik nicht von einem antizipierten Konflikt auszugehen ist. Risikopaare können unabhängig davon, ob eine Schwangerschaft besteht oder nicht, das Leben mit einem (weiteren) kranken oder behinderten Kind antizipieren. Sie können einschätzen, ob damit eine Überlastung der Kapazitäten und eine Gefährdung der psychischen In17 Schroeder-Kurth (2000) S.129 f. benennt in diesem Zusammenhang, ausgehend von einer Fehldiagnoserate von 10 % (die jedoch in den neuesten Datensammlungen deutlich unterschritten wird), den Vorteil der PID für autosomal-rezessive Erkrankungen mit einer Wahrscheinlichkeitsreduktion von 25 auf 10%. 18 s. Schockenhoff (2000) S.97. 19 Zur Herbeiführung der Konfliktlage durch PND vgl. Schmidt (2003) S.68. 28 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin tegrität der Mutter oder beider Elternteile verbunden ist.20 Letztlich bleibt die Bewertung der künftigen Lebenssituation immer subjektiv, und es gibt keine plausible Erklärung, warum ihr nach der Etablierung einer Schwangerschaft ein größeres Gewicht beigemessen werden sollte als vorher. Die sich hier andeutende allgemeine Problematik des Krankheitsverständnisses sowie die Frage nach einer Definition des Krankheitswerts bestimmter genetischer Prädispositionen21 und der mit ihr einhergehenden Pathologisierung ihrer Träger sollen an dieser Stelle vernachlässigt werden. Ausgangspunkt sei zunächst eine Anwendung der PID, die sich auf die Vermeidung schwerer genetischer Krankheiten beschränkt, die sich bei Vorliegen bekannter genetischer Anlagen immer manifestieren. Ein Einsatz der Präimplantationsdiagnostik in einem darüber hinausgehenden Indikationsspektrum wird im Abschnitt 5.1 und seine befürchteten Folgen werden unter Kapitel 6 behandelt. Sowohl PND als auch PID bieten Risikopaaren die Möglichkeit, auszuschließen, dass ihr Nachwuchs an einer bestimmten Erkrankung leidet. Ein bereits genannter Unterschied besteht darin, dass Paare, die bewusst den Weg einer „Schwangerschaft auf Probe“ wählen, erst nach Bekanntgabe eines positiven PND-Ergebnisses selbst zwischen Fortsetzung und Abbruch der Schwangerschaft abwägen, während die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik von vornherein auf Selektion ausgerichtet ist. Die Paare entscheiden sich hier schon vor der Diagnostik mit „distanzierende[r] Rationalität“22 für die Auswahl gesunder Embryonen für den Transfer, die dann im konkreten Fall aber von Reproduktionsmedizinern getroffen wird. Die Entscheidung für eine Selektion wird unabhängig von der Diagnose gefällt, sie ist der Methode immanent.23 Darüber hinaus ist die Entscheidung für oder gegen einen Fetus, welche die PND verlangt, abzugrenzen von der Wahl zwischen mehreren Embryonen, welche die PID ermöglicht und dabei Embryonen als „Ware“ oder „Rohstoff für die 'Produktion' eines gesunden Kindes durch Selektion“24 zu instrumentalisieren scheint. Besonders die schutzlose Verfügbarkeit der In-vitroEmbryonen verstärkt den Eindruck, dass die Schwelle zur Selektion hier niedriger anzusiedeln ist als bei einer „Schwangerschaft auf Probe“, deren Vorsätzlichkeit und selektiver Charakter nicht offensichtlich sind. Es ist aber nicht auszuschließen, dass betroffene Paare ihren Wunsch nach einem gesunden eigenen Kind durch wiederholte Pränataldiagnostik mit anschließender Abtreibung zu verwirklichen versuchen. Trotz bestehender Alternativen in Form von Adoption, 20 vgl. Maio (2003) S.721. vgl. Düwell (1998a) S.31. 22 s. Ruppel und Mieth (1998) S.373. Allerdings hat eine geringere emotionale Bindung keinerlei Bedeutung hinsichtlich der Legitimität einer Selektion. Vgl. Nationaler Ethikrat (2003) S.71. 23 Ob Selektion und Vernichtung das Ziel der PID sind oder ob dieses in der Herbeiführung einer Schwangerschaft besteht, wird im Folgenden noch näher erörtert. 21 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 29 heterologer Insemination usw. nehmen sie bewusst die Belastungen durch Schwangerschaft, PND und Abbruch in Kauf, denn erst der existenzielle Schwangerschaftskonflikt rechtfertigt gemäß §218a die Selektion. Ebenso wie im Fall der PID ist die Annahme des Kindes bei der geschilderten Anwendung der PND an Bedingungen geknüpft. Angesichts der Provokation des Dilemmas könnte der Einwand, dass es kein Recht auf ein gesundes Kind gibt, geltend gemacht werden. Er scheitert jedoch zwangsläufig am schwierigen Nachweis der Vorsätzlichkeit, zumal im Gegensatz zur PID nicht jede PND selektiv ist. Gemeinsames Ziel beider Untersuchungen bleibt der Ausschluss einer schweren genetischen Erkrankung des leiblichen Kindes, um den prospektiven Eltern Leid25 und Belastungen zu ersparen, denen sie nach eigener Einschätzung nicht gewachsen sind. Dennoch sehen Ruppel und Mieth in der hypothetisch verminderten Lebensqualität des erkrankten oder behinderten Kindes die implizite Voraussetzung für eine Selektion. Kein gesunder Mensch sei aber dazu berechtigt, über die Lebensqualität Betroffener zu urteilen oder gar ein geringeres Lebensrecht aus ihr abzuleiten.26 Auch Honnefelder beschreibt die PID als "einen Vorgang der Selektion, in dem der jeweilige Embryo als lebenswert oder nicht beurteilt wird.“27 An dieser Stelle kann nur ein Mal mehr darauf hingewiesen werden, dass Risikopaare, die eventuell die PID in Anspruch nehmen, dies ebenso aus einem antizipierten Konflikt und einer Not heraus tun wie Paare, die sich aufgrund eines positiven PND-Befundes für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Die Argumentation zur Begründung der moralischen Zulässigkeit geht von der Perspektive der prospektiven Eltern aus und nicht von „eine[r] objektive[n]“ Wertzuschreibung bezüglich der Lebenssituation von Menschen mit bestimmten Behinderungen.“28 Meistens ermöglicht die PID zum heutigen Zeitpunkt weder eine effektive Therapie der betroffenen Embryonen, noch versucht sie, deren Leid zu verringern.29 Aus diesem Grund kann aus kindlicher Perspektive keine Indikation gestellt werden.30 Allerdings darf die Rechtfertigung der Selektion auch nicht allein in der elterlichen Autonomie, d.h. in dem Recht auf selbstbestimmte Lebensführung bestehen. Neuer-Miebach, Neidert und Statz weisen zurecht daraufhin, 24 vgl. Graumann (1998) S.405. Schockenhoff (2000) S.92 f. sieht im Leid einen Verstoß gegen die Menschenwürde. Leid zu mindern, ist hingegen Teil des ärztlichen Berufsethos. Vgl. Abschnitt 6.1.3. 26 vgl. Ruppel und Mieth (1998) S.376. 27 s. Honnefelder (1999) S.120. Vgl. auch Eibach (2000) S.110 mit Hinweis auf die fehlende Notlage: "Erst bei der PGD wird daraus [aus dem Verwerfen] ein eindeutiges Urteil über den 'Wert' des Lebens eines Kindes" 28 s. Düwell (1999) S.12 f.. 29 Die Frage, ob und wann die Nicht-Existenz einem Leben mit schwersten Einschränkungen vorzuziehen sein könnte, geht in den folgenden Abschnitt zur Abtreibung ein. 30 vgl. Nationaler Ethikrat (2003) S.35. Graumann (1998) S.408 f. verweist darauf, dass Risikopaare sich nicht im Sinne eines proxy consent für eine PID entscheiden dürften. 25 30 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin dass dadurch eine unbegrenzte Anzahl an Selektionswünschen legitimiert würde.31 Erst eine Eingrenzung des Anwendungsbereichs der PID durch Indikationen und eine Sicherstellung ihrer Regulierbarkeit entscheiden über die moralische Legitimität. Ein Verbot jeglicher Selektion bedeutete hingegen, dass Schwangere behinderte Feten austragen müssten, während die Fristenlösung ihnen ermöglicht, gesunde Embryonen abzutreiben.32 Auch im Streit um die Zielsetzung der Präimplantationsdiagnostik wird die Selektion mit der ihr folgenden Vernichtung von Embryonen thematisiert. Sie ist der wesentliche Schritt auf dem Weg zu einer Schwangerschaft mit einem gesunden Kind, aber nicht alleiniger Zweck der PID. Ob diese Selektion nur als Mittel zum Erreichen einer an Bedingungen geknüpften Schwangerschaft oder neben dieser als zweites Ziel der PID anzusehen ist, ist vor allem im Hinblick auf die aktuelle Rechtslage von Bedeutung, zumal §1.I.2 und §1.II des deutschen Embryonenschutzgesetzes explizit wie auch die (Muster-)Berufsordnung der Bundesärztekammer implizit33 eine medizinisch assistierte Reproduktion ausschließlich zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erlauben. Eine genauere Bestimmung und Bewertung der Zielsetzung der PID ist an dieser Stelle nicht zu leisten. In dieser Abhandlung sollte vielmehr deutlich geworden sein, dass die Selektion von Embryonen bzw. Feten in jedem Fall für sich genommen ethisch nach einer Rechtfertigung verlangt. 3.1.3 Entwicklung und gesellschaftliche Implikationen der PND Die Entwicklung der Pränataldiagnostik zeigt seit ihrer Aufnahme in die reproduktionsmedizinische Praxis Anfang der 70er eine Ausweitung ihres Anwendungsbereichs. Anfangs nur bei Auffälligkeiten im Einzelfall indiziert wird sie heute flächendeckend in der Schwangerschaftsvorsorge eingesetzt. Einhergehend mit der zunehmenden Verfügbarkeit und gesellschaftlichen Akzeptanz der PND hat sich ein sozialer Wandel vollzogen: Schwangere werden verantwortlich gemacht für die genetische Konstellation ihrer Kinder. Sie stehen unter Rechtfertigungszwang, wenn sie sich gegen pränatale Diagnostik oder für die Geburt eines behinderten Kindes entscheiden. Der gesellschaftliche Appell an ihre Verantwortung setzt Frauen unter Druck, das Angebot der PND in Anspruch zu nehmen. Durch ihre weite Verbreitung engt diese Methode, die eigentlich einen Zuwachs an Autonomie verspricht, den Entscheidungsfreiraum werdender Mütter ein. 31 vgl. Neuer-Miebach (1999) S.128, Neidert und Statz (1999) S.135. vgl. Nationaler Ethikrat (2003) S.78. 33 §13.I der MBO der Bundesärztekammer (2006a) S.14 verpflichtet Ärzte, bei der Durchführung ethisch problematischer Maßnahmen, zu denen wie unter Verhaltensregel Nr.15 derselben Ordnung vermerkt auch die IVF zählt, die Empfehlungen der Ärztekammer zu beachten. Regelung 1 der Richtlinie zur Durchführung der assistierten 32 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 31 Sowohl hinsichtlich der Nutzung der Pränataldiagnostik als auch hinsichtlich der Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch scheint das sorgfältige Abwägen in einer individuellen Situation, durch einen von der Gesellschaft diktierten Automatismus gefährdet zu sein.34 Die ursprüngliche Zielgruppe ist dabei angesichts der Indikationsausweitung und Einklagbarkeit der PND durch jede Schwangere in den Hintergrund getreten. Hildt zeigt auf, dass im Fall der Präimplantationsdiagnostik, die Eltern weniger Verantwortung zu tragen scheinen, weil sie nicht aktiv über Schwangerschaft und Abbruch entscheiden, sondern Fachleuten der Reproduktionsmedizin die Verantwortung übertragen. So sei „für das betreffende Paar [...] keinerlei Entscheidungsfreiheit, aber auch keinerlei Entscheidungsdruck mehr gegeben.“35 Schüler und Zerres bemerken, dass „parallel zu diesem raschen Anstieg [der Inanspruchnahme pränataler Diagnostik] [...] jedoch auch eine zunehmende Abkopplung der pränatalen Diagnostik von einer kompetenten umfassenden genetische Beratung und Nachsorge zu beobachten [ist]."36 Primäre Ursache hierfür ist, dass sie Beratungskapazitäten dem routinemäßigen Einsatz der PND nicht gewachsen sind. Als eine Reaktion auf den dargestellten sozialen Druck ist heute die Forderung nach konsequenter Einhaltung der Trias Beratung - Diagnostik - Beratung zu verstehen, die Paaren zu einer reflektierten autonomen Entscheidungsfindung verhelfen soll. Mit den Anforderungen an Durchführung und Inhalt dieser Beratungsgespräche beschäftigt sich Abschnitt 4.2. Weitere soziale Auswirkungen der Entwicklung der PND wie eine „neue Eugenik“, Diskriminierung oder eine geringere Toleranz gegenüber Behinderten seien laut Nippert in Untersuchungen zwar nicht eindeutig nachweisbar,37 aber bisher auch nicht widerlegt. Ihr Auftreten gefährdete ebenfalls die elterliche Autonomie, indem es das Leben mit einem behinderten Kind erschwerte. Finanzielle Unterstützung, Förderung von Solidarität und Integration sind nur einige Maßnahmen, um derartigen gesellschaftlichen Veränderungen entgegen zu wirken. Schon in der dargestellten Ausweitung der PND sehen Kritiker der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik eine unkontrollierbare Eigendynamik. Eine Beschränkung der PID-Anwendung scheint ihnen in einem Analogieschluss nicht realisierbar. Darum würden mit der PID nach ihrer Einschätzung unerwünschte Folgen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene umso wahrscheinlicher. Neuer-Miebachs Ansicht nach sei die sogenannte Schiefe Ebene mit der PND bereits betreten, Reproduktion zufolge ist die IVF „ärztliche Hilfe zur Erfüllung des Kinderwunsches“. Vgl. Bundesärztekammer (2006) S.1393. 34 vgl. Hildt (1998) S.209-217. 35 s. ebd. S.212. 36 s. Schüler und Zerres (1998) S.15 37 vgl. Nippert (1997) S.114. 32 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin allerdings rechtfertige dies nicht ein weiteres „Herabgleiten“ in Form einer Einführung der PID.38 Auch Schockenhoff wertet die Bereitschaft zur Anwendung der PID mit der Verwerfung mehrerer Embryonen „als Indiz dafür [...], dass der anlässlich der Einführung der Pränataldiagnostik vorhergesagte Dammbrucheffekt tatsächlich eingetreten ist.“39 Neben den herausgearbeiteten Gemeinsamkeiten einer Zeugung und einer Schwangerschaft „auf Probe“ in Form vorhandener Alternativen, Belastungen, bedingter Annahme eines Kindes und Konfliktantizipation bleibt ein Unterschied in der Selektion bestehen, der verbietet, die PID als vorgezogene PND anzusehen: Die Pränataldiagnostik setzt den Entritt einer Schwangerschaft voraus, die als „natürliche Begrenzung“ einer missbräuchlichen „Trial-and-error-Selektion“ angesehen werden kann. Bei der PID ermöglichen hingegen die größere Anzahl und die Verfügbarkeit der In-vitro-Embryonen eine Auswahl, die über das Erkennen genetischer Erkrankungen hinaus geht. Eine Rechtfertigung der Einführung der Präimplantationsdiagnostik lässt sich daher nicht logisch aus der Pränataldiagnostik ableiten, deren derzeitiger Einsatz ethisch ebenfalls nicht unbedenklich ist, insbesondere da seine gesetzliche Regelung Risikopaaren wiederholte Spätabbrüche von „Schwangerschaften auf Probe“ ermöglicht.40 Im Fortbestehen dieser Möglichkeit bei gleichzeitigem Verbot der PID liegt jedoch ein nicht tragbarer Widerspruch. Die sich anbietenden Änderungen sind ein restriktiverer Umgang mit der PND oder eine streng kontrollierte Zulassung der PID. 3.2 Präimplantationsdiagnostik im Vergleich zum Schwangerschaftsabbruch 3.2.1 Die gesetzliche Regelung des Umgangs mit Embryonen Zusätzlich zur Inkonsistenz in der Akzeptanz von Spätabbrüchen bei bestehendem PID-Verbot weisen PID-Befürworter auf einen weiteren Wertungswiderspruch hin. Sowohl der Einsatz von Nidationshemmern als auch der Einsatz der sogenannten „Pille danach“ sind legal und nicht durch das Vorhandensein einer Konfliktlage, sondern vielmehr durch deren Vermeidung zu rechtfertigen. Die rechtliche Regelung der Abtreibung klammert also Embryonen vor der Implantation aus der Strafvorschrift aus. Obwohl die Präimplantationsdiagnostik ebenfalls dazu dient, den Eintritt existenzieller Schwangerschaftskonflikte und der ihnen folgenden Schwanger- 38 vgl. Neuer-Miebach (1999) S.131. Das Argument der Schiefen Ebene ist Thema in Abschnitt 5.1.8. s. Schockenhoff (2000) S.95. 40 Eibach (2000) S.115 spricht in diesem Zusammenhang von der „problematischen ethischen Billigung einer Schwangerschaft auf Probe“. 39 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 33 schaftsabbrüche zu verhindern, ist das Verwerfen drei Tage alter In-vitro-Embryonen hingegen verboten.41 Während Nidationshemmer und „Pille danach“ präventiv gegen potenzielle Embryonen Anwendung finden, deren Existenz unbekannt bleibt, handelt es sich im Fall der PID um reale, sogar in ihrer genetischen Beschaffenheit bekannte Embryonen. Doch die Fristenlösung, der zufolge Abbrüche innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen bei Vorlage einer Bescheinigung über eine erfolgte Beratung zwar rechtswidrig, jedoch straffrei sind,42 beweist, dass selbst nachgewiesene, bereits implantierte und wahrscheinlich gesunde Embryonen nur über ein relatives Lebensrecht verfügen. Ein Abwägen dieses Rechts erfolgt hier nicht unbedingt gegen eine Gefährdung der Integrität des Lebens der Schwangeren. Allein die Entscheidung der werdenden Mutter gegen ihr Kind und die Befolgung des gesetzlich festgelegten Ablaufs sind ausschlaggebend für die Straffreiheit. Diese Regelung dient in erster Linie einer pragmatischen Schadensbegrenzung, indem sie illegale Abtreibungen verhindert und durch Beratung Einfluss zu nehmen hofft. Sie geht dennoch von Mutter und Embryo als zwei Rechtsträgern aus, was in der unveränderten Rechtswidrigkeit der Abbrüche zum Ausdruck kommt. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Rechtslage und Praxis hier das Konzept eines graduell zunehmenden Embryonenschutzes widerspiegeln. Auf diesem nämlich gründet die Abwägbarkeit eines relativen embryonalen Lebensrechts43 gegen das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Frau. Ungeklärt bleibt also, warum Gesetze das Leben extrakorporaler Embryonen stärker schützen, wenn es doch mit dem Eintritt einer Schwangerschaft relativierbar wird. Der rechtliche Schutzanspruch menschlicher Embryonen wird offensichtlich von den Umständen abhängig gemacht, obwohl die Differenzierung zwischen „im Mutterleib“ und „außerhalb“ laut Haker „[i]m moralischen Sinne [...] mehr als fraglich“ ist.44 Als Grund hierfür wird die besondere Schutzlosigkeit, in der sich In-vitro-Embryonen befinden, angeführt, denn „da keine Frau eine Schwangerschaft aus nichtigen Gründen abtreiben wird, ist eine bestehende Schwangerschaft immer 41 Das Verbot der PID in Deutschland: Wie bereits aufgezeigt verstößt die Anwendung der künstlichen Befruchtung bei fruchtbaren Paaren gegen §1 des ESchG. Sind die im Rahmen der PID entnommenen Blastomeren totipotent, handelt es sich bei ihnen nach §8 ESchG um Embryonen. Die Biopsie verstößt folglich gegen das Klonverbot in §6 und die Zerstörung der Blastomeren für die Untersuchung ebenso wie die Verwerfung der betroffenen Embryonen gegen §2 ESchG, da sie nicht dem Zweck der Erhaltung der Embryonen dienen. 42 lt. Engels (1998) S.288 sind mehr als 90 % aller Schwangerschaftsabbrüche dieser Gruppe zuzuordnen. Schmidt (2003) S.97 spricht von 97 %. 43 vgl. Eibach (2000) S.114. 44 s. Haker (1998) S.264. Im Zusammenhang mit der Problematik der Spätabbrüche sieht sie „Parallelen zur aktiven Euthanasie“. 34 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin auch ein Schutz des Fötus.“45 Noch einen Schritt weiter geht die Annahme, dass es sich beim Schwangerschaftskonflikt nicht um einen inter-personellen Konflikt zwischen der Schwangeren und dem Ungeborenen, sondern um einen intra-personellen Konflikt handelt.46 Ihr sind jedoch Studien entgegen zu halten, die von bis zu einem entwarnenden PND-Befund distanziert erlebten Risikoschwangerschaften zeugen.47 Weisen Untersuchungen nach, dass das Ungeborene von einer schweren Krankheit oder Behinderung betroffen ist, bleibt nach §218a.II StGB sein Lebensrecht in utero unabhängig von seiner Lebensfähigkeit bis zur Geburt dem Recht auf Autonomie und Gesundheit der werdenden Mutter nachgeordnet. Nicht alle Frauen wollen jedoch ihre priorisierten Rechte in Anspruch nehmen. Obwohl es, wie Nippert schreibt, „zwischen [...] Schwangeren, die die PND in Anspruch nehmen, und Schwangeren, die die PND nicht in Anspruch nehmen, keinen signifikanten Unterschied in der persönlichen Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch bei vorgeburtlich diagnostizierbaren Fehlbildungen [gibt]“48, soll besonders den Frauen, die eine Abtreibung grundsätzlich ablehnen und folglich auf eine PND oder gar eine Schwangerschaft verzichten, die PID als Alternative angeboten werden. Neben der Möglichkeit, durch eine Einführung der PID Spätabbrüche zu verhindern, tritt hier der Zuwachs an Autonomie für die Frauen hervor.49 Die bereits im Kontext der PND genannten Faktoren, die eine autonome Entscheidungsfindung gefährden,50 sind natürlich auch hinsichtlich einer Inanspruchnahme der PID zu beachten. 3.2.2 Schwangerschaftskonflikt und mögliche Konsequenzen Kehren wir noch einmal zur Konfliktlage der Schwangeren zurück, von deren Antizipation bei der PID auszugehen ist. Maier schreibt: "Für gewöhnlich koinzidieren die Interessen der beiden Betroffenen [Frau und Fetus].“51 Diese Ansicht geht von einem Interesse des Fetus an seiner Existenz oder Nicht-Existenz aus, das wiederum mit einem Anspruchsrecht auf Leben oder Tötung bzw. Unterlassung der Zeugung zum Schutz dieses Interesses einhergeht. Steigleder sieht in dem möglichen Kind aber noch keinen realen Rechtsträger und stellt daraus folgernd die Frage, ob "jemand auch durch seine Existenz in seinen Rechten verletzt werden kann“52 [auch im Ori- 45 s. Kollek (1999) S.122. Gleichzeitig wird die enge Bindung zwischen der Schwangeren und dem Ungeborenen als Grund für die Abtreibung als Ausnahme vom Tötungsverbot angeführt. Vgl. Bundesärztekammer (1998a) S.3013. 46 vgl. Schmidt (2003) S.70. 47 s. Nippert (1997) S.112. 48 s. ebd. S.119. 49 Auch Sermon, Van Steirteghem, Libaers (2004) S.1637 erwähnen, dass die Einführung der PID meint “giving the family an increased autonomy without conflicts.” 50 s. Abschnitt 3.1.3 dieser Arbeit. 51 s. Maier (1998) S.156. 52 s. Steigleder (1998) S.100. PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 35 ginal hervorgehoben, A.S.]. Eine Bevorzugung der Nicht-Existenz als alleiniges Interesse sei dann denkbar, wenn ein Leben nur aus Leid bestünde. Die Kenntnis der Erbanlagen allein reiche allerdings nicht aus, um Krankheitsausprägung und Leidensausmaß daraus abzuleiten.53 Auch eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Nicht-Existenz vorzuziehen ist, hilft im Einzelfall nicht weiter, da das Interesse des spezifischen Embryos unbekannt bleibt. Wiesing weist außerdem darauf hin, dass die Selbstinterpretation einer Krankheit durch Betroffene nicht immer mit der Genkonstellation korreliert.54 Pränatal kann ohnehin nur eine Fremdinterpretation im Sinne einer paternalistischen Lebensbewertung stattfinden, die einem Dritten nicht zusteht,55 weil sie den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Steigleder zeigt die postnatalen Optionen der Schmerzlinderung und Tötung als Alternativen zu Schwangerschaftsverzicht und Abtreibung auf. Der Extremfall, dass ein Leben nur aus nicht linderbarem Leid bestehe, sei demnach unrealistisch. Gegenüber dem Fetus bestehe daher für die prospektiven Eltern keine Pflicht, im Vorfeld einer geplanten Schwangerschaft ihre eigene genetische Konstellation zu prüfen, eine PND oder Abtreibung durchführen zu lassen oder auf Nachkommen zu verzichten.56 Auch gegenüber Dritten „besteht keine Pflicht, im Sinne der thematisierten Handlungsoptionen schwere nicht-therapierbare genetisch bedingte Krankheiten zu vermeiden"57 [Hervorhebung übernommen, A.S.]. Auf der einen Seite sind Frauen, wenn sie sich bewusst für die Geburt eines kranken Kindes entscheiden, im Besitz eines Vorwissens über dessen weitere Entwicklung, das vielleicht vom Kind selbst nicht gewollt wäre. Die mütterliche, aber im Fall einer Weitergabe dieses Wissens auch die kindliche Handlungsfreiheit kann durch die mittels PND erworbene belastende Information eine Einschränkung erfahren.58 Auf der anderen Seite kann der Entschluss der Frauen, die Schwangerschaft mit einem Wunschkind zu beenden, psychische Folgen nach sich ziehen. Schuldgefühle und Trauer über den Verlust werden in Beratungsgesprächen zum Ausdruck gebracht.59 Wie bereits erwähnt scheint trotz Abschaffung der embryopathischen Indikation im Schluss von einem pathologischen PND-Befund auf einen Spätabbruch ein Automatismus zu 53 vgl. ebd. S.101 ff.. vgl. Wiesing (1998) S.83. 55 Hierauf berief sich auch der Bundesgerichtshof (1983) S.252, als er am 18.01.1983 die „wrongful life“- Klage eines Betroffenen abwies. 56 So entschied der BGH: „Eine unmittelbare deliktsrechtliche Pflicht, die Geburt einer Leibesfrucht deshalb zu verhindern, weil das Kind voraussichtlich mit Gebrechen behaftet sein wird, die sein Leben aus Sicht der Gesellschaft oder aus seiner unterstellten eigenen Sicht [...] ‚unwert’ erscheinen lässt [...] Es gibt sie nicht“ [Hervorhebung übernommen, A.S.]. S. ebd. S.251 f.. 57 s. Steigleder (1998) S.115. 58 Mit dem Recht auf Wissen und dem Recht auf Nichtwissen im Kontext der prädiktiven Medizin beschäftigt sich Abschnitt 6.1.2 noch ausführlicher. 59 vgl. Stengel-Rutkowski (1997) S.77. 54 36 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin liegen. Seine Übertragung auf die Präimplantationsdiagnostik lässt am ehesten ihre automatische, durch sozialen Druck bedingte Inanspruchnahme befürchten, mit der bereits die Verwerfung betroffener Embryonen entschieden wäre.60 3.2.3 Vorschläge zur Änderung der medizinischen Indikation Angesichts der steigenden Anzahl an Spätabbrüchen61 werden Vorschläge ausgearbeitet, wie einem befundgesteuerten Automatismus und einem weiteren Anstieg entgegengewirkt werden kann: Die Verfasser der Schwarzenfelder Manifests, CDU und Bundesärztekammer fordern u.a. eine Änderung der medizinischen Indikation in Form der Wiedereinführung einer an der kindlichen Entwicklung ausgerichteten Befristung62, einer Pflichtberatung und einer sich anschließenden dreitägigen Bedenkzeit bis zum Abbruch. Das Ziel sei dabei, der Tötung bereits lebensfähiger Feten und der übereilten Durchführung einer Abtreibung vorzubeugen.63 Laut Braun, Leiterin einer Beratungsstelle, sei zu verhindern, dass Ärzte Schwangere insbesondere bei Vorliegen eines unklaren Befundes zum Abbruch aufforderten oder auf die durch ein betroffenes Kind entstehenden Kosten für das Gesundheitswesen hinwiesen. Stattdessen sei es wünschenswert, bereits vor Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchungen eine unabhängige, qualifizierte Beratung in die Mutterschaftsrichtlinien, d.h. als Kassenleistung zu integrieren. Auf diese Weise würden autonome Entscheidungen gefördert. Ärzte hätten dann zuerst lediglich die Pflicht, auf das Beratungsangebot hinzuweisen und später ggf. die Patientinnen über Anwendung und Ziel der PND aufzuklären. Sie sollten dabei aber die Option eines Abbruchs nicht aufführen, denn bei Vorliegen eines pathologischen PND-Befundes könnte die Gefährdung der Schwangeren und somit die eng auszulegende Indikation für einen Abbruch nur im Rahmen der Beratung (fest-)gestellt werden. Durch diese Entkopplung von PND und Indikationsstellung würde ein Automatismus verhindert, und Ärzte, die keine Indikation stellten, könnten nicht länger für ein „Kind als Schaden“64 haftbar gemacht werden. Einige dieser Anregungen sind auch im Hinblick auf eine Einführung der PID zu überdenken. Es ist zu klären, inwiefern eine humangenetische und psychosoziale Beratung in Richt- 60 Nur wenn Embryonen gesunde Träger einer balancierten Translokation, einer autosomal-rezessiv oder Xchromosomal vererbten Erkrankung sind, ist die Entscheidung, ob sie implantiert oder verworfen werden, offen und möglicherweise von der Anzahl übertragbarer Embryonen abhängig. Eine Nicht-Implantation ist in diesem Fall als Schritt in Richtung positive Eugenik zu werten. 61 1996 wurden 1949 Abbrüche zwischen der 13. und 22. SSW vorgenommen, 2005 waren es 2049. Nach der 22. SSW wurden 1996 159 weitere Schwangerschaften beendet, 2005 waren es 171. Vgl. Kautz (2005) und statistisches Bundesamt (2007). 62 Die embryopathische Indikation vor 1995 erlaubte Spätabbrüche nur bis zur 22. SSW p.c.. 63 s. 5. medizinisch-ethischen Klausur- und Arbeitstagung (1998), Kautz (2005) und Hoppe (2006) S.2188. 64 vgl. Bundesgerichtshof (2002). PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 37 linien zu verankern wären und ob sie von Mitarbeitern des Gesundheitswesens oder unabhängigen Beratern durchgeführt werden sollten, um die Risikopaare so wenig wie möglich zu beeinflussen. Andere Überlegungen gelten den Fragen, ob die PID angeboten oder nur auf Eigeninitiative der Paare in Erwägung gezogen werden und wer letztlich über die Indikation entscheiden sollte. 3.3 Die In-vitro-Fertilisation als unabdingbare Voraussetzung der PID Die Durchführbarkeit der Präimplantationsdiagnostik setzt eine künstliche Befruchtung unter Verwendung der Keimzellen des Risikopaares voraus. Eine Beurteilung der PID erfordert also auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Anwendung der In-vitro-Fertilisation, ihren Methoden, Risiken und Erfolgen in der Reproduktionsmedizin. Von besonderem Interesse sind darüber hinaus der umstrittene Einsatz der IVF im Rahmen der PID, mögliche Wechselwirkungen beider Techniken und die Hoffnung, dass die PID eine Steigerung der Schwangerschaftsrate nach IVF bewirken kann. 3.3.1 Der Ablauf der In-vitro-Fertilisation Ziel der Entwicklung der medizinisch assistierten Reproduktion und ihrer Einführung in die klinische Praxis in den 80er Jahren war es, Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu helfen. Alleinige Indikation für ihre Anwendung sind bis heute bestimmte Formen von Sterilität. Die Reproduktionsmedizin spricht Sterilität einen Krankheitswert zu65 und versteht ihr Angebot, bestehend aus Insemination, intratubarem Gametentransfer (GIFT) und extrakorporaler Befruchtung, als Therapie zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. Für eine Anwendung der PID ist ausschließlich die In-vitro-Befruchtung von Bedeutung. Hierfür erfolgt zunächst eine kontrollierte hormonelle Hyperstimulation der Ovarien (COH), damit eine Gruppe von Eizellen heranreift. Während für eine Kinderwunschbehandlung im Durchschnitt 9,02 Eizellen gewonnen werden,66 ist für die PID zum Zweck einer größeren Auswahl die Entnahme von mehr als 12 Eizellen anzustreben.67 Dazu bedarf es einer stärkeren Stimulation, die wiederum das Eintreten eines ovariellen Überstimulationssyndroms (OHSS) wahrscheinlicher macht. Beim schweren OHSS kommt es zu einer Flüssigkeitsverschiebung in den extravasalen Raum. So entstehen eine polyzystische Ver65 Dies zeigt sich in der Aufnahme der Sterilität in den Katalog der ICD-10 und in der Aufnahme ihrer Behandlung in den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenkassen. Die Richtlinie der Bundesärztekammer (2006) nennt einzelne Sterilitätsformen als Indikationen für verschiedene reproduktionsmedizinische Maßnahmen. 66 s. DIR (2008) S.18. 38 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin größerung der Ovarien, Aszites und Hydrothorax. Die Folge ist eine in einigen Fällen lebensbedrohliche Hämokonzentration mit Elektrolytverschiebungen, verschlechterter Nierenperfusion und Thrombosegefahr. Die durchschnittliche Inzidenz des OHSS wird für IVF- Sterilitätsbehandlungen mit 0,33 % und für In-vitro-Fertilisationen als Voraussetzung der PID mit 0,5-2 % angegeben.68 Die Follikelpunktion wird heutzutage meist transvaginal unter sonographischer Kontrolle durchgeführt. Als Komplikationen können mit abnehmender Häufigkeit vaginale und intraabdominelle Blutungen, Peritonitiden und Darmverletzungen auftreten. Ihre Inzidenz liegt laut dem neuesten Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für In-vitro-Fertilisation bei 0,73 % aller Eizellentnahmen.69 Um die aspirierten Oozyten extrakorporal zu befruchten, stehen je nach Sterilitätsursache zwei Methoden zur Verfügung: Bei tubarer Sterilität durch Verschluss oder Insuffizienz wird in der Regel die „klassische“ IVF angewandt. Eizellen und Spermien werden in denselben Behälter verbracht und die Befruchtung findet ohne weiteres Zutun statt. Liegt hingegen eine schwere Minderung der Samenqualität vor, werden die Spermien mit einer Glaskapillare in das Zytoplasma der Eizelle injiziert (ICSI). 3.3.2 Die Problematik der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion Im Zusammenhang mit der ICSI werden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes diskutiert, die durch die Invasivität der Methode oder ein erhöhtes genetisches Risiko verursacht sein sollen. Darüber hinaus existiert auch grundsätzliche Kritik an der Durchführung der ICSI. So lasse sich Mieth zufolge angesichts der beim Mann liegenden Infertilitätsursache eine Instrumentalisierung der Frau trotz des Vorliegens ihrer informierten Zustimmung nicht ausschließen.70 Dem ist allerdings zu entgegnen, dass auch das Vorliegen eines Tubenverschlusses keine Garantie dafür liefert, dass eine Frau einer IVF-Behandlung frei und ohne Zwänge zustimmt, das heißt, dass eine Instrumentalisierung nie völlig ausgeschlossen ist. Gute Aufklärung und Beratung sowie Ergründung des Kinderwunsches der Patientin können ihr dagegen vorbeugen. Untersuchungen haben gezeigt, dass männliche Infertilität genetisch bedingt sein kann. Dem angeborenen beidseitigen Verschluss der ableitenden Samenwege („congenital bilateral 67 vgl. Kollek (2002) S.59. Der Bericht der ESHRE von Sermon et al. (2006) nennt für die PID chromosomaler Anomalien einen Durchschnitt von 14,0 und für die PID monogener Erkrankungen von 13,8 Eizellen/Punktion. 68 s. DIR (2008) S.28 und Griesinger et al. (2003) S.326. Diedrich et al.(2005) S.588 weisen auf das GnRHAntagonisten-Protokoll hin, bei dessen Anwendung die Inzidenz des OHSS abnimmt. 69 s. DIR (2008) ebd.. 70 vgl. Mieth (1999) S.81. PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 39 absence of the vas deferens“, CBAVD) kann eine Mutation des Gens der Cystischen Fibrose („cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“, CFTR) zugrunde liegen, während nichtobstruktive Azoospermien und schwere Oligozoospermien (< 5 Mio. Spermien/ml) häufiger mit chromosomalen Aneuploidien und Aberrationen einhergehen.71 Vor einer Anwendung der ICSI sind darum immer eine genaue Anamnese und Stammbaumanalyse beider Partner durchzuführen. Bei obstruktiver Infertilität und bei Hinweisen auf chromosomale oder genetische Störungen wird dem Paar eine humangenetische Beratung angeboten. Wenn keine Obstruktion vorliegt, erfolgt außerdem eine Analyse der Chromosomen beider Partner und beim Mann ggf. eine molekulargenetische Untersuchung des Azoospermiefaktors (AZF)72 auf dem Y-Chromosom. Bisher weder bewiesen noch widerlegt ist die Vermutung, dass die invasive Manipulation der Eizelle selbst epigenetische Veränderungen auslöst.73 In Gameten und frühen Embryonen findet nämlich das sogenannte Imprinting74 statt. Es verändert die Genexpression einer Zelle. Untersuchungen an Säugetierembryonen konnten dabei den Einfluss externer Faktoren nachweisen, weswegen auch eine Interferenz zwischen der Injektion des Spermiums und dem mütterlichen Imprinting denkbar ist.75 In Anlehnung an diese Annahme ist fraglich, ob auch die im Rahmen der PID durchgeführte Embryobiopsie epigenetische Effekte auslösen kann. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass bei Schwangerschaften nach ICSI vermehrt Komplikationen auftreten und dass nach ICSI geborene Kinder im Vergleich zu Kindern nach IVF oder spontaner Konzeption eine leicht höhere Inzidenz schwerer Malformationen aufweisen. Für Einlingsschwangerschaften besteht außerdem ein größeres Risiko für Frühgeburtlichkeit und ein geringes Geburtsgewicht.76 Selbstverständlich sind Paare vor einer ICSI über alle Risiken aufzuklären und Schwangerschaften nach ICSI genau zu beobachten. Erst weiterführende Studien können jedoch auf die Frage, ob männliche Infertilität, methodische Invasivität, uterine oder andere Hintergrundfaktoren ursächlich für die hier aufgezeigten Probleme sind, eine Antwort liefern. Nichtsdestotrotz empfiehlt das ESHRE PGD Consortium in seinen Richtlinien vor allem für die Untersuchung der Blastomer-DNA mittels PCR auf monogene Erkrankungen die Be- 71 vgl. Levron et al. (2001). In dieser Studie wird auch auf ein erhöhtes Risiko für de-novo-Chromosomenaberrationen nach ICSI bei schwerer männlicher Infertilität hingewiesen. Davon seien besonders die Gonosomen betroffen. 72 Unter dem AZF sind drei verschiedene Regionen des Y-Chromosoms zusammengefasst, deren Gene die Spermatogenese regeln. Entsprechend verursachen Mikrodeletionen im AZF Sub- oder Infertilität. 73 vgl. Nikolettos, Asimakopoulos, Papastefanou (2006). 74 Imprinting meint in der Regel eine Methylierung bestimmter DNA-Sequenzen, deren Expression dadurch an- oder abgeschaltet wird. Abhängig von maternaler oder paternaler Abstammung werden Gene so aktiv oder inaktiv vererbt. 75 vgl. Georgiou et al. (2006) und Cox et al. (2002) mit einem Bericht über zwei Kinder nach ICSI mit AngelmanSyndrom, das durch Deletion eines Abschnitts des Chromosoms 15 maternalen Ursprungs hervorgerufen wird. 76 vgl. Katalinic, Rösch und Diedrich (2004). 40 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin fruchtung der gewonnenen Eizellen durch ICSI.77 Hauptargument hierfür ist, dass bei der konventionellen In-vitro-Fertilisation eine Kontamination durch die DNA weiterer an der Oozytenoberfläche haftender Spermien auftreten kann. Sie ist neben dem Allelic drop out und der nie in 100 % erfolgreichen Amplifizierung78 wesentliche Ursache für Fehldiagnosen an Präimplantationsembryonen. Zwischen der empfohlenen Anwendung der ICSI im Vorfeld einer PID, die möglicherweise eine Gefährdung des Kindswohls bedeutet, und der eigentlichen Zielsetzung, die Geburt eines kranken Kindes zu verhindern, besteht ein Widerspruch. Allerdings sind Wahrscheinlichkeit und Schweregrad einer kindlichen Erkrankung nach ICSI niedriger anzusiedeln als das genetische Risiko, das eine PID indiziert. 3.3.3 Erfolgsrate der IVF, Mehrlingsrisiko und Verbesserungsansätze Die Erfolgsaussichten einer künstlichen Befruchtung sollen hier anhand einiger Zahlen aus dem Jahr 2007 verdeutlicht werden:79 Die Fertilisationsrate der Eizellen betrug 93,19 % für IVF und 96,37 % für ICSI. In 89,65 % aller IVF- und in 92,81 % aller ICSI- Behandlungen erfolgte am zweiten Tag ein Transfer der Embryonen im Zwei- bis Vier-Zellstadium in den Uterus der Mutter. In 30,44 % bzw. 28,80 % führte dieser eine klinische Schwangerschaft herbei. 42,47 % der Schwangerschaften nach IVF und 45,63 % der Schwangerschaften nach ICSI endeten mit einer Geburt. In einem Drittel blieb der Ausgang unbekannt, während in ca. 20 % ein Abort und in 2,23 % bzw. 1,61 % eine Extrauteringravidität gemeldet wurde. Zu beachten ist, dass jede Frau sich im Durchschnitt 1,6 Zyklen unterzog. Die Baby-take-home-Rate, d.h. die Anzahl der Geburten pro Anzahl der Behandlungen, lag im Jahr 2006 für IVF bei 17,47 % und ICSI bei 17,70 %. Bei fruchtbaren Paaren führt die Anwendung einer künstlichen Befruchtung entgegen aller Vermutungen zu keinem besseren Ergebnis. So konnte in 2005 in nur 75 % aller durchgeführten Präimplantationsdiagnostiken ein Embryotransfer vorgenommen werden, dem in 28 % eine Schwangerschaft folgte.80 Trotz der größeren Anzahl gewonnener und befruchteter Eizellen standen nach der genetischen Diagnostik also nicht immer Embryonen für einen Transfer zu Verfügung. Zur durchschnittlichen Baby-take-home-Rate für die PID finden sich keine eindeutigen Angaben: Laut einer Studie von Feyereisen et al. liegt sie nach fünfjähriger Erfahrung in einem Pariser Zentrum bei 27 % pro Paar. Dass 441 Zyklen an 171 Paaren durchgeführt wurden, bedeu- 77 s. Goossens et al. (2008) S.2631 mit Verweis auf Thornhill et al. (2005). Griesinger et al. (2003) S.331 zufolge liegt die Amplifizierungsrate zwischen 80-95 %. In jüngeren Untersuchungen wird sie mit > 90 % angegeben. Vgl. Spits et al. (2006) S.316. 79 vgl. DIR (2008). 80 vgl. Goossens et al. (2008) S.2632. Im Jahr 2005 erfolgte in 1089 Behandlungszyklen eine PID, nach deren Durchführung noch 816 Frauen Embryonen übertragen wurden. 78 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 41 tet, dass ein Paar im Durchschnitt 2,58 Zyklen durchlaufen hat. Daraus ergibt sich eine Babytake-home-Rate von 10,47 % pro Zyklus.81 Die Daten der drei erfahrensten PID-Zentren lassen bei 754 im Anschluss an 4748 PID-Zyklen gebornen Kindern darauf schließen, dass bis zu 15,8 % aller Zyklen zur Geburt eines Kindes führten.82 Da unklar bleibt, wie hoch die Anzahl der Zwillingsgeburten war, kann die genaue Baby-take-home-Rate hier nicht errechnet werden. Paare, die auf ein Kind durch IVF hoffen, müssen rein rechnerisch bis zu sechs Behandlungszyklen durchlaufen, um ihren Wunsch zu verwirklichen. Trotzdem erreicht auch die kumulative Erfolgsrate bei maximal drei transferierten Embryonen nur Werte um 50 %,83 wobei ein nicht zu vernachlässigendes Risiko von der hohen Zahl an Mehrlingsschwangerschaften infolge des Transfers mehrerer Embryonen ausgeht. In mehr als 20 % der Geburten kommen Zwillinge, in ungefähr 1 % Drillinge zur Welt.84 Im Verlauf dieser Schwangerschaften treten mit größerer Wahrscheinlichkeit hypertensive und thromboembolische Komplikationen sowie Anämien und Atemnot bei Zwerchfellhochstand auf. Die Mehrlinge sind durch Wachstumsretardierung, fetofetales Transfusionssyndrom bei Monozygotie und in 30-60 % aufgrund von Frühgeburtlichkeit mit einhergehender erhöhter perinataler Morbidität und Mortalität85 gefährdet. In einigen Fällen kann nur ein selektiver Fetozid helfen, die Gefahr für Mutter und Kind abzuwenden. Diese Risiken und eventuelle psychosoziale Probleme in Familien mit Mehrlingen lassen Forderungen nach einer Beschränkung des Transfers auf eine geringe Zahl entwicklungsfähiger Embryonen bei gleicher oder verbesserter Erfolgsrate laut werden. Untersuchungen menschlicher Embryonen zeigen, dass mit zunehmendem Alter der Mutter die Häufigkeit chromosomaler Anomalien ansteigt.86 Aneuploide Embryonen sind häufig nicht entwicklungsfähig87 und daher bei älteren Frauen für eine niedrige Schwangerschaftsrate nach IVF verantwortlich. Aus dieser Feststellung lassen sich drei Handlungsmöglichkeiten ableiten: Erstens ist es möglich die Anzahl der zu transferierenden Embryonen unter Abwägung von durchschnittlicher Schwangerschaftsrate, Anzahl der IVF-Versuche und Mehrlingsrisiko dem maternalen Alter anzupassen.88 Zweitens kann bei älteren Patientinnen das PID-Aneuploidie- 81 vgl. Feyereisen et al. (2007) S.63. s. Verlinsky (2004) S.293. 83 vgl. Felberbaum, Küpker, Diedrich (2004) S.100. 84 Nach spontaner Konzeption liegt gemäß der Hellin-Regel die Wahrscheinlichkeit einer Zwillingsgeburt bei 1,18 % und die Wahrscheinlichkeit einer Drillingsgeburt bei 0,014 %. 85 Mit den Risiken der Frühgeburtlichkeit befasst sich auch Abschnitt 6.4.4. 86 vgl. Wolff (2002) S.364. 87 Laut Griesinger et al. (2003) S.334 weisen 21 % aller Spontanaborte Aneuploidien auf. Sie nennen unter Berufung auf eine Veröffentlichung von Warburton et al. (1986) eine Abortrate klinischer Schwangerschaften mit Trisomie 21 von 84-93 %. 88 Die aktuellen Richtlinien zur assistierten Reproduktion der Bundesärztekammer (2006) S.1397 empfehlen bei Frauen unter 38 Jahren im ersten und zweiten Zyklus nur einen oder zwei Embryonen zu transferieren. 82 42 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin Screening (auch PID-AS bzw. international PGS) helfen, aneuploide In-vitro-Embryonen zu identifizieren. Durch selektiven Embryotransfer lässt sich dann eventuell eine Steigerung der Erfolgsrate und eine Senkung der Abort- und Mehrlingsrate bewirken.89 Drittens bemühen sich Wissenschaftler um Erfolge bei der Kryokonservierung reifer und bei der In-vitro-Maturation unreifer Oozyten. Durch diese Methoden könnten in Zukunft OHSS vermieden und für ältere Frauen mit Hilfe ihrer eigenen jungen Eizellen die Chancen auf eine Schwangerschaft verbessert werden.90 Die Erkenntnis, dass zwischen bestimmten Chromosomenstörungen und Charakteristika der embryonalen Entwicklung und Gestalt ein eindeutiger Zusammenhang besteht,91 sowie die Verbesserung der Kulturmedien ermöglichen außerdem eine morphologische Selektion entwicklungsstarker Embryonen. Diese werden hierfür genau beobachtet und je nach Stadium nach verschiedenen morphologischen Gesichtspunkten für den Transfer ausgewählt.92 Vor allem in den skandinavischen Ländern hat sich mittels dieser Methode der sogenannte Single-EmbryoTransfer (SET) zum Standardverfahren entwickelt.93 In Deutschland ist ein solches Vorgehen aufgrund des gesetzlichen Embryonenschutzes nicht möglich, da dieser, wie in Abschnitt 3.2.2 gesehen, die Verwendung aller künstlich gezeugten Embryonen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft vorschreibt,. De Wert berichtet noch von einer früher in Italien praktizierten Methode der selektiven Reduktion einer Mehrlingsschwangerschaft bei elterlicher Infertilität und Anlageträgerschaft für β-Thalassämie. In der Annahme eines besseren Behandlungsergebnisses erfolgte eine hormonelle Stimulation mit anschließendem intratubarem Gametentransfer (GIFT). Danach diente eine Chorionzottenbiopsie der genetischen Untersuchung der so erzeugten Mehrlinge, deren Anzahl im Anschluss um die betroffenen Feten und auch nicht betroffene reduziert wurde.94 Angesichts der starken Belastungen für die Schwangere durch die absichtlich induzierte hochgradige Mehrlingsschwangerschaft, angesichts des fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums zum Zeitpunkt der Tötung und angesichts der methodischen Unsicherheit hinsichtlich einer eindeutigen Identifizie- 89 Das Aneuploidie-Screening und Untersuchungen zu seiner Effizienz sind noch einmal Thema des Abschnitts 5.1.4. 90 vgl. Diedrich et al. (2005). Mit der Problematik einer Altersgrenze für IVF-Patientinnen befasst sich Spiewak (2003). 91 vgl. Wolff (2002) S.364 f.. 92 Zu den möglichen Auswahlkriterien und ihrer Anwendung s. Giorgetti et al. (2007), Sjöblom et al. (2006) und Neuber et al. (2006). 93 Einen signifikanten Abfall der Zwillingsrate nach selektivem SET beschreiben Criniti et al. (2005). Einen positiven Einfluss des SET auf Schwangerschaftsverlauf und Zustand des Neugeborenen konnten Poikkeus et al. (2007) jedoch nicht nachweisen. Maio (2009) S.92 kritisiert den Embryonenverbrauch durch SET. 94 vgl. de Wert (1998) S.334 mit Hinweis auf den Fallbericht von Brambati et al. (1990). PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 43 rung und Lokalisierung der Feten in utero ist diese Art, eine „genetisch kontrollierte“ Schwangerschaft herbei zu führen, ethisch nicht akzeptabel. 3.3.4 Die ethische Bewertung der IVF-Praxis mit Bezug zur PID Die hier dargestellten Techniken der künstlichen Befruchtung sind mit erheblichen psychischen und physischen Belastungen für die Paare verbunden. Ihre geringe Erfolgsrate ist mit dem Ergebnis spontaner Konzeption vergleichbar.95 Dies wird von Fortpflanzungsmedizinern oft zur Erklärung des ausbleibenden Fortschritts in Richtung einer Steigerung der Geburtenzahl pro Behandlungszyklus herangezogen. Aus ethischer Sicht bedarf die In-vitro-Fertilisation auch wegen des Missbrauchspotenzials, das in der Verfügbarkeit extrakorporaler Embryonen liegt, einer Rechtfertigung. Die IVF ist nicht nur wesentlicher Wegbereiter der Embryonenforschung, als deren Ergebnis die Präimplantationsdiagnostik anzusehen ist, durch sie rücken sogar positive Embryonenselektion und Keimbahntherapie in den Bereich des Machbaren. Mit diesen Techniken scheint sich schließlich, das Wiederaufleben eines „genetischen Reduktionismus“ anzukündigen. Wiesing schreibt hierzu von der pessimistischen Ansicht, dass „mit dem Einstieg in die Reproduktionsmedizin [...] eine schiefe Ebene betreten worden [sei].“96 Die Frage nach der moralischen Legitimation der IVF im allgemeinen und speziell im Hinblick auf die PID soll an dieser Stelle kurz nachgegangen werden. Sterile Paare entscheiden sich idealerweise frei für oder gegen die Inanspruchnahme reproduktionsmedizinischer Hilfe. Von ihrem Grundrecht auf Fortpflanzungsfreiheit und selbstbestimmte Lebensführung lässt sich allerdings kein positives Recht auf ein Kind ableiten. Zu bedenken ist außerdem, dass der geäußerte Kinderwunsch unbewusst ambivalenten Charakters sein kann: Manchmal werden z.B. schwerwiegende Probleme in der Partnerschaft nicht reflektiert, sondern ausschließlich auf die Unfruchtbarkeit zurückgeführt. Die Paare versteifen sich folglich auf den Kinderwunsch und richten überhöhte Erwartungen an das erhoffte Kind.97 Da Fortpflanzungsmediziner in besonderer Weise für das Wohl der erzeugten Kinder verantwortlich sind, müssen sie im Fall einer wie auch immer gearteten Gefährdung desselben, den Paaren eine IVF verwehren. Erst nachdem die Indikation zur medizinisch assistierten Fortpflanzung sorgfältig gestellt ist, entscheiden sich die Paare im Sinne eines „informed consent“ für oder gegen die Be- 95 Die geschätzte physiologische Implantationsrate liegt bei 25-30 %, und nur zwei Drittel aller biochemisch nachweisbaren Schwangerschaften treten in die klinische Phase. Maternale Abortursachen können immunologischer, endokriner und anatomischer Natur sein. Vgl. Diedrich et al. (1998) S.305. 96 s. Wiesing (1999) S.99. 97 vgl. Schuth, Neulen, Breckwoldt (1989). 44 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin handlung. Dass „der Wunsch nach einem eigenen Kind legitim und nachvollziehbar“98 ist und, wenn er unerfüllt bleibt, großes Leid hervorrufen kann, rechtfertigt, dass Ärzte nach Versagen aller anderen Sterilitätsbehandlungen Paaren eine In-vitro-Befruchtung anbieten. Sie ist dann die einzige Maßnahme, die von Seiten der Medizin gemäß dem „bonum facere“ noch Hilfe verspricht. Die Möglichkeit des Missbrauchs dieser Technik verbietet ethisch nicht ihren rechten Gebrauch. Da es sich bei PID-Risikopaaren selten um Paare mit Fruchtbarkeitsproblemen handelt, wird im Fall einer Zulassung der PID eine Erweiterung der aktuellen IVF-Indikationen erforderlich.99 Wesentliches Problem ist dabei die veränderte Zielsetzung: Bisher konnte die IVF Schwangerschaft und Geburt eines genetisch eigenen Kindes ermöglichen, hier aber wird sie zu einer notwendigen Maßnahme für Gendiagnostik an Embryonen. Mieth spricht in diesem Kontext von einer Entwicklung der Fruchtbarkeits- zur Genmedizin.100 Statt in einer Schwangerschaft liegt nun der Zweck der IVF zusätzlich in der Vermeidung erblicher Erkrankungen. Ruppel und Mieth führen vor Augen, dass „[h]inter der PID zwar die Absicht [steht] Erbkrankheiten zu bekämpfen, jedoch [...] für dieses Ziel nur deshalb menschliches Leben hergestellt wird, um es anschließend als abgeleitetes Derivat (unter Umständen aber auch als Embryo) wieder zu vernichten.“101 Daher pervertiert die PID in gewisser Weise die eigentliche Intention der künstlichen Befruchtung. Es geht nicht mehr um den Wunsch nach einem leiblichen Kind steriler Paare, sondern um den Wunsch nach einem leiblichen gesunden Kind fruchtbarer Paare. Mit Blick auf diesen Wandel bezeichnet Eibach die IVF selbst als Ursache der sinkenden Bereitschaft, ein krankes Kind als Schicksal anzunehmen.102 Doch schon bei der herkömmlichen Anwendung der In-vitro-Fertilisation kann es zur Vernichtung von Embryonen oder Feten kommen. Denkbar ist nämlich, dass überzählige Embryonen entstehen, wenn eine Frau ihrem Transfer nicht mehr zustimmt, oder dass hochgradige Mehrlingsschwangerschaften nur mit Hilfe eines selektiven Fetozids risikoärmer fortbestehen können. Die rechtliche Regelung der IVF räumt in derartigen Konfliktfällen dem Elternwunsch gegenüber dem kindlichen Lebensrecht Priorität ein.103 Außerdem ist die Auswahl der befruchte- 98 s. Bundesärztekammer (2006) S.1393. Neidert (2002) S.34 interpretiert den „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer (2000) bereits als einen Schritt zur standesrechtlichen Legalisierung einer Indikationsausweitung der IVF mittels einer Änderung der Musterberufsordnung. 100 vgl. Mieth (1997) S.192. 101 s. Ruppel und Mieth (1998) S.361 f.. 102 vgl. Eibach (2000) S.109. Die Themen „Leid“ und „Leidensfähigkeit“ werden u.a. in Abschnitt 6.5.6 noch einmal aufgegriffen. 103 vgl. Neidert und Statz (1999) S.132. 99 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 45 ten Oozyten für eine weitere Kultivierung und einen späteren Embryotransfer keineswegs beliebig: Laut de Wert gehört eine Prüfung der Anzahl der Pronuclei zur Routine der künstlichen Befruchtung.104 Durch sie lässt sich die Befruchtung einer Eizelle durch zwei Spermien ausschließen. Liegen mehr als zwei Vorkerne vor, wird die betroffene Eizelle verworfen, denn, solange mütterliches und väterliches Erbmaterial noch getrennt vorliegen, stehen befruchtete Eizellen zumindest rechtlich noch nicht unter Embryonenschutz. Darüber hinaus instrumentalisiert der Mehrfachtransfer mit dem Ziel eines „helping effects“ zur Verbesserung der Schwangerschaftsrate die übertragenen Embryonen. Seine Durchführung basiert schließlich auf der Hoffnung, dass der bestentwickelte Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut einnistet, während die anderen zugrunde gehen. Anhand dieser Darstellung kann also aufgezeigt werden, dass die derzeitige Praxis der Invitro-Fertilisation von einem relativen embryonalen Lebensrecht ausgeht, dass sie Embryonen selektiert und somit instrumentalisiert. Unter der Vorannahme, dass der Embryo Träger personaler Würde und Rechte ist, ist sie somit nicht legitimierbar. Mieth erklärt, dass ihr Verstoß gegen die Menschenwürde von der Gesetzgebung hingenommen werde, da er selten sei und da man den „Pluralismus der elterlichen Überzeugungen“ respektiere.105 Doch welche Bedeutung hat dieser Umgang mit embryonalem Leben für die Diskussion zur PID? Berechtigt er dazu, von einem Wertungswiderspruch zwischen der Legitimierung der künstlichen Befruchtung und einem PIDVerbot zu sprechen? Tötung und Selektion früher Embryonen werden im Rahmen der IVF in Kauf genommen, um den Erfolg zu steigern, der in der Geburt eines Wunschkindes besteht. Sie können jedoch theoretisch ausbleiben, indem nur drei Eizellen befruchtet werden und es zur Implantation aller drei transferierten Embryonen und einer Drillingsgeburt kommt.106 Im Gegensatz dazu ist es im Fall der Präimplantationsdiagnostik einerseits unwahrscheinlich, dass alle der in der Regel mehr als zehn erzeugten Embryonen genetisch gesund sind, und andererseits unverantwortlich, einen Embryotransfer in dieser Größenordnung vorzunehmen. Embryonale Selektion nach abgeschlossener Befruchtung und Verwerfung ohne akute gesundheitliche Gefahr für Mutter oder Embryo sind fester Bestandteil dieser Methode, unabhängig davon, ob man sie zu ihrem Ziel oder zum unerwünschten Nebeneffekt auf dem Weg zum Ziel erklärt. Eine Begrenzung auf maximal drei erzeugte Embryonen, wie sie für die IVF gilt, schmälert jedoch angesichts 104 vgl. de Wert (1998) S.327. Diese Prüfung sei auch „eine Form des genetischen Präimplantations-Screenings“. s. Mieth (1999) S.81. 106 Für das Jahr 2007 gibt das DIR (2008) S.11 die Zahl der Drillinge mit 0,69 % von 5104 Geburten an. Es findet sich keine Angabe zur Anzahl der fetalen Reduktionen. In 2006 lag diese aber bei 0,85 % für Schwangerschaften nach IVF und 1,14 % für Schwangerschaften nach ICSI. S. ebd. S.14. 105 46 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin des genetischen Risikos und der geringen Schwangerschaftsrate nach künstlicher Befruchtung die Erfolgschance auf ein nicht tolerierbares Maß. Entscheidend für die unterschiedliche Bewertung der Verwerfung bzw. Tötung sind sowohl das Entwicklungsstadium (Pronucleus vs. Embryo) und die Situation (akute Gefahr in vivo vs. drohende Belastung in vitro) als auch das Kriterium (fehlende Entwicklungsfähigkeit vs. genetische Erkrankung) und das Verhältnis zum Ziel der Technik (Erfolgssteigerung vs. Notwendigkeit). Die Anzahl der getöteten Embryonen ist aus ethischer Sicht hingegen kein akzeptables Argument. Ebenso wie der Wunsch steriler Paare nach einem leiblichen Kind ist auch der Wunsch der Risikopaare nach einem gesunden leiblichen Kind legitim. Seine Verfolgung muss allerdings, wie in den beiden vorangehenden Kapiteln herausgearbeitet, durch die Vermeidung einer antizipierten Belastung begründet sein. 3.3.5 Übertragung weiterer IVF-Kritikpunkte auf die PID Die Entwicklung der IVF zum Routine-Angebot der Reproduktionsmedizin in den 90er Jahren hat nicht nur in der Wissenschaft den Weg zur PID eröffnet, sondern auch auf die Wahrnehmung der PID in der Gesellschaft verändernd eingewirkt. Hennen und Sauter zufolge sei durch die Verwerfung und Kryokonservierung von befruchteten Eizellen bzw. Embryonen "eine Art von Gewöhnungseffekt und sukzessiver Entproblematisierung“ hinsichtlich ihrer Instrumentalisierung eingetreten.107 Die Selektion durch Präimplantationsdiagnostik und die Verwendung überzähliger Embryonen in der Forschung würden in Folge dessen nicht als Schritte einer moralisch anderen Qualität erkannt. Gebhardt fordert aus diesem Grund sogar ein Verbot der IVF.108 Dieser negativen Wahrnehmung widerspricht allerdings die anhaltende Debatte um Statusfrage und Embryonenschutz. Angesichts der infolge der PID vermehrt anfallenden überzähligen Embryonen behaupten ihre Gegner, dass einige Wissenschaftler darauf spekulierten, diese für Forschungszwecke zu nutzen, anstatt sie zu verwerfen oder trotz ihres Verwaistseins jahrelang zu kryokonservieren.109 In diesem Vorwurf zeigt sich unabhängig von der Frage nach seiner Berechtigung, dass von einer unreflektierten, breiten Akzeptanz embryonenverbrauchender Techniken keine Rede sein kann. Neuer-Miebach stellt heraus, dass nicht einmal hinsichtlich der Einführung reproduktionsmedizinischer Verfahren und ihrer Notwendigkeit ein gesellschaftlicher Kon- 107 s. Hennen und Sauter (2004) S.145. vgl. Gebhardt (1999) S.118. 109 Mit dem Verhältnis von PID und Embryonenforschung beschäftigt sich u.a. Abschnitt 6.2.3. 108 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin 47 sens hergestellt worden sei und dass bezüglich ihrer Anwendung nach wie vor Uneinigkeit herrsche.110 Ein Kritikpunkt besteht in der „Unnatürlichkeit“ reproduktionsmedizinischer Maßnahmen, da sie eine Trennung von Sexualität und Fortpflanzung ermöglichen und so die Zeugung menschlichen Lebens rationalisieren. Die Präimplantationsdiagnostik ist dieser Kritik umso mehr ausgesetzt, als sie den künstlich gezeugten Nachwuchs auch noch „unnatürlich“ auswählt.111 Dem ist entgegen zu halten, dass jede medizinische Therapie den natürlichen Verlauf einer Erkrankung zu beeinflussen versucht und gerade darin ihre Rechtfertigung findet. Auch Antikonzeptiva fallen in den Bereich des „Unnatürlichen“. Natürlichkeit ist nach Ansicht von Flamigni et al. kein Kriterium, um die moralische Rechtmäßigkeit einer Handlung zu bewerten. Auch der Mensch sei Teil und nicht Gegner der Natur. Von seinen Werten und Entscheidungen werde letztlich der Verlauf der Grenze zwischen natürlich und unnatürlich bestimmt.112 Auch dem Nationale Ethikrat zufolge ist die Orientierung an der Natur lediglich eine „kulturelle Option“, aber kein „moralisches Gebot“.113 Des weiteren gibt es im Zusammenhang mit der IVF die Befürchtung, dass sie die ElternKind-Beziehung gefährde, indem sie eine bleibende Distanz zwischen Eltern und Kindern schaffe. Im Anschluss an eine PID laste möglicherweise zusätzlich ein starker Erwartungsdruck auf den Kindern, der ein gespanntes Verhältnis zwischen ihnen und ihren Eltern verursache. Bisherige Beobachtungen haben allerdings gezeigt, dass Kinder nach IVF eine normale psychosoziale Entwicklung durchlaufen.114 Wenn die Anwendung PID sich auf den Ausschluss bestimmter schwerer genetischer Erkrankungen begrenzt, können Eltern lediglich erwarten, dass ihre Kinder diesbezüglich nicht Anlageträger sind. Jede weitere Eigenschaft ihres Nachwuchses - auch das Auftreten einer anderen Erkrankung oder Behinderung - bleibt unvorhersehbar. Erst eine darüber hinausgehende positive Merkmalsauswahl, um Phänotyp, Intelligenz und Wesen der Kinder zu beeinflussen, machte diese zum Gegenstand elterlicher Erwartungen und nähme auf ihre Entwicklung Einfluss.115 Doch einerseits ist diese Art der Selektion nach heutigem Wissensstand (noch) nicht möglich, und andererseits läge sie außerhalb des moralisch zulässigen Indikationsbereichs der PID, mit dessen Begrenzung sich Abschnitt 5.1 noch eingehender beschäftigt. 110 vgl. Neuer-Miebach (1999) S.126. Der Begriff der Natürlichkeit findet auch in der Kontroverse um die befürchteten Auswirkungen der PID auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen unter 6.3.4 Verwendung. 112 vgl. Flamigni et al. (1996). 113 s. Nationaler Ethikrat (2003) S.73. 114 vgl. Ludwig et al. (2006). 115 Ausführlicher zu den Auswirkungen der PID auf das Eltern-Kind-Verhältnis s. Abschnitt 6.3.4. 111 48 PID im Kontext der Reproduktionsmedizin Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, die nach Meinung der Frauenbewegung durch die medizinisch assistierte Fortpflanzung zur „Gebärmaschine“ degradiert und einem „gesellschaftlichen Druck zur Mutterschaft“ ausgesetzt würden,116 war in den 80er Jahren ein Streitpunkt, der in der Diskussion zur PID in abgewandelter Form wieder auflebt: Die PID ermöglicht Frauen, sich trotz eines genetischen Risikos für eine Mutterschaft zu entscheiden, auf die sie sonst aus Angst vor Überforderung durch ein krankes Kind vielleicht verzichtet hätten. Sie vermehrt so die Autonomie der Frauen in eine neue Richtung. Ein gesellschaftlicher Druck, behindertes Leben zu vermeiden, ist schließlich dem befürchteten „Mutterzwang“ entgegengesetzt und erschwert die Entscheidung für ein behindertes Kind als autonome Entscheidung für die Mutterrolle. Trotzdem bleibt an dieser Stelle abschließend festzuhalten, dass sich aus der Akzeptanz einer ethisch problematischen und nach wie vor umstrittenen IVF-Praxis nicht das Recht auf eine Ausweitung dieser Praxis folgern lässt. Andere Streitpunkte der IVF wie die Anwendungsbeschränkung auf prämenopausale Frauen, heterosexuelle Ehen und feste Partnerschaften und die Ausnahmeregelung für die Verwendung von Spendersamen sind für die Evaluation der Präimplantationsdiagnostik von untergeordneter Relevanz und werden hier daher nicht weiter behandelt. Die heterologe Insemination wird allerdings in der Debatte zur PID als deren Alternative angeführt und unter 5.2.4 noch einmal aufgegriffen. 116 vgl. Gebhardt (1999) S.115. Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 49 4. Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 4.1 Rechtslage, Definition und Voraussetzungen von Autonomie Im Kontext von Pränataldiagnostik, Schwangerschaftsabbruch und künstlicher Befruchtung wird auf die Frage nach einer ethischen Rechtfertigung der jeweiligen Methode u.a. das Autonomieprinzip angeführt. Wie bereits aufgezeigt rekurrieren auch die Befürworter der Präimplantationsdiagnostik auf das Recht der Risikopaare, ihr Leben selbstbestimmt und frei zu gestalten. Die nähere Auseinandersetzung mit dem Autonomie-Argument verlangt zunächst eine Begriffsdefinition und allgemeine Überlegungen, unter welchen Bedingungen Autonomie realisiert sein kann und wo ihre Grenzen liegen. In einem weiteren Schritt soll speziell die Situation der PID mit ihren möglichen Autonomie behindernden und fördernden Faktoren durchdacht werden. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der Funktion des Beratungsgesprächs, seinen Inhalten und den Anforderungen, die es erfüllen sollte. 4.1.1 Das Recht auf Autonomie Das Prinzip der Autonomie liegt dem weitgehend anerkannten1 Recht auf freie Fortpflanzung zugrunde. Dieses kommt u.a. im Art.16.I der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10.12.1948 zum Ausdruck, in dem es heißt: „(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.”2 [Markierung nur hier, A.S.] Auch das deutsche Grundgesetz von 1949 führt in Art.2 das Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit auf.3 Das Recht auf Reproduktionsfreiheit wird von juristischer Seite als darin enthalten angesehen.4 Die Betonung liegt hier auf „frei“ bzw. „Freiheit“, denn dieses Recht ist als Abwehrrecht zum Schutz der Intimsphäre gegen staatliche Einmischung und Bevormundung und nicht als ein Recht auf Fortpflanzung oder ein Kind zu verstehen. Besonders in Deutschland legt die historische Gesetzesauslegung angesichts der massenhaften Zwangssterilisationen im 1 Benatar (2006) erklärt, dass unter bestimmten Umständen, wenn bei einem Paar z.B. eine HIV-Infektion oder die Anlageträgerschaft für eine monogene Erkrankung bekannt sei, seine Nachkommen durch ihre Geburt geschädigt werden könnten. Er fordert daher eine Aufhebung der rechtlichen Unterscheidung zwischen nicht-reproduktiver und reproduktiver Schädigung einer anderen Person und eine entsprechende Beschränkung der Fortpflanzungsfreiheit. 2 vgl. United Nations (1948). 3 Im Art.2.I des Grundgesetzes heißt es: “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“ [Hervorhebung nur hier, A.S.]. 4 vgl. Neidert und Statz (1999) S.132. 50 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit Nationalsozialismus infolge der 1933 erlassenen Erbgesundheitsgesetze5 dieses Rechtsverständnis nahe. Viafora erklärt in diesem Zusammenhang, dass diese „totale Enteignung des Gewissens“ im „Namen des Schutzes höherer Interessen“ deutlich gemacht habe, dass Grenzen der staatlichen Einflussnahme notwendig seien. Dennoch habe die Rechtsgebung ihre Aufgaben zu erfüllen, die darin lägen, “a) die Ausweitung der Freiheit unter Garantie der Grundrechte aller Beteiligten, insbesondere der Schwächeren zu sichern; b) eine angemessene kulturelle Aufnahme der neuen prokreativen Möglichkeiten in Verbindung zur Tradition zu gewährleisten, so dass Kontinuität und Kohärenz mit unserem Zusammenleben gesichert seien [und] c) im Inneren einer zunehmend pluralen Gesellschaft eine für alle gültige ethische Grenze festzulegen.“6 Gesetzliche Regelungen ersetzen jedoch weder moralische Verpflichtungen, noch befreien sie den Handelnden von seiner Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen. Vielmehr ist der moralische Anspruch an Justiz und Politik, für alle geltende Rahmenbedingungen zu schaffen und auf diese Weise dauerhaft den Freiraum zu sichern, in dem der Einzelne seine moralischen Rechte wahrnehmen und autonom und eigenverantwortlich handeln kann. Alle „Binnenmoralen“ stehen in diesem rechtlichen Rahmen gleichberechtigt nebeneinander. Wertekonflikte treten daher nicht auf staatlicher, sondern auf individueller Ebene auf.7 4.1.2 Definition und Umsetzung von Autonomie Der Autonomiebegriff per se hat einen binären Charakter, der wiederum seine Verwendung bestimmt: Auf der einen Seite beschreibt Autonomie die unverlierbare Fähigkeit des Menschen zur freien Willensbildung. Aus diesem Autonomieverständnis heraus schreibt Kant dem zur Sittlichkeit fähigen Homo noumenon Selbstzweck und Menschenwürde zu. Auch ein bewusstloser oder dementer Mensch bleibt demnach Autonomie-Träger. Letztlich basiert auf dieser Auffassung von Autonomie die ärztliche Pflicht, jeden Patienten nach seinem (mutmaßlichen) Willen zu behandeln. Auf der anderen Seite meint Autonomie das Ideal einer selbstbestimmten Lebensführung (persönliche Autonomie) und Übernahme moralischer Prinzipien (moralische Autonomie). Angesichts unseres heutigen Menschenbildes, das in erster Linie die Vorstellung vom vernunftbegabten, unabhängigen Individuum prägt, hat die sogenannte Entscheidungs-Autonomie, Vor5 6 Näheres hierzu auch in Abschnitt 6.5.1. s. Viafora (2000) S.93 im Original: “a) di assicurare ch l’ampliamento della libertá si eserciti nella garanzia dei diritti fondamentali di tutti i sogetti coinvolti, dei piú deboli in particolare; b) di favorire una adeguata assimilazione culturale delle nuove potenzialitá procreative, tessendo quei legami con la tradizione in grado di assicurare continuitá e coerenza alla nostra convivenza; c) di definire, all’interno di una societá sempre piú ‘al plurale’, un limite etico valido per tutti” [Übersetzung A.S.]. Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 51 aussetzung persönlicher und moralischer Autonomie, Einzug in die biomedizinische Prinzipienethik gehalten. Beauchamp und Childress nehmen den Respekt vor der Autonomie neben den traditionellen Prinzipien des „bonum facere“, „nil nocere“ und der Gerechtigkeit als zentrales Prinzip in ihre „Principles of Medical Ethics“ auf. In einer Gesellschaft, in welcher der Wertepluralismus das Erreichen eines normativen Konsenses unmöglich erscheinen lässt, wird Autonomie zu einem positiv konnotierten „medizinethischen Leitmotiv“.8 Im Bereich der Medizin ist die Tradition des fürsorglichen ärztlichen Paternalismus dem Ideal des Respekts vor der Lebensvorstellung der Patienten gewichen. Aus dem „salus aegroti suprema lex“ wurde „voluntas aegroti suprema lex“. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten nimmt heute also Priorität vor der Fürsorgepflicht des Arztes ein.9 Jeder Arzt ist daher verpflichtet, seinen Patienten vor einer Behandlung aufzuklären und sich dessen Zustimmung zu vergewissern, denn ohne „informed consent“10 verletzt er auch durch eine medizinisch indizierte Therapie die Autonomie und mit dieser die Integrität seines Patienten. Selbst nach dem Einholen eines „informed consent“ stellt sich immer, aber besonders dann, wenn Patientenautonomie und ärztliche Fürsorge miteinander konfligieren, die Frage, ob der geäußerte Wunsch in ausreichendem Maß autonom ist, da Entscheidungs-Autonomie keine absolute, sondern eine graduell realisierbare und verlierbare Fähigkeit darstellt. Der erreichte Grad ihrer Umsetzung ist in Relation zu der jeweiligen Entscheidungssituation zu beurteilen. Schöne-Seifert fordert hierfür „Schwellen, die da bestimmt werden müssen, wo hinreichende von nicht-hinreichender Autonomie abzugrenzen ist.“11 Zu klären ist aber, an welchen Kriterien sich der Verlauf einer solchen Grenze orientieren soll. In Anlehnung an Faden und Beauchamp sind fünf Voraussetzungen zu nennen, die eine Entscheidung erfüllen muss, um autonom genannt zu werden und folglich gemäß der Prinzipienethik von moralischer Relevanz zu sein: 1) In bezug auf die zu treffende Entscheidung muss die entscheidende Person kompetent sein. Sie muss in der Lage sein, Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, um dann verschiedene Aspekte gegeneinander abzuwägen. 2) Die der Entscheidung folgende Handlung muss intendiert sein, und alle sich aus ihr ergebenden Konsequenzen sollten in Kauf genommen werden. 3) Die Person muss ihren Entschluss freiwillig und aktiv, d.h. 7 vgl. Liening (1998) S.174-179. vgl. Beauchamp und Childress (2001). Auch eine Gruppe von sog. Laizisten in Italien erklärte 1996 in ihrem „Manifesto di Bioetica laica“ Autonomie zu einem ihrer leitenden Prinzipien. Vgl. Flamigni et al. (1996). 9 vgl. Haker (1999) S.111 zum „Paradigma der Autonomieförderung“ mit Hinweis auf den nicht ausreichenden begründungstheoretischen Status des Autonomie-Arguments. 10 Das Prinzip des „informed consent“ wurde ursprünglich im Kontext des Humanexperiments entwickelt. Durch Aufklärung der Probanden und ihre Zustimmung sollte sicher gestellt werden, dass ihre individuellen Interessen gegenüber den Interessen der Gesellschaft gewahrt wurden. 8 52 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit nicht fremdbestimmt oder reaktiv fassen. 4) Dies soll sie in Kenntnis aller für sie relevanten Informationen tun. 5) Zuletzt ist erforderlich, dass der Entschluss unter Einbeziehung anderer Wertvorstellungen des Entscheidenden authentisch erscheint.12 Hinsichtlich der Anwendung des Autonomie-Arguments für eine Einführung der PID ist zunächst zu klären, ob die hier angeführten Kriterien in der Entscheidungssituation der PID überhaupt erfüllt sein, ob also Risikopaare, die sich zur Präimplantationsdiagnostik entschließen, hierdurch ihre reproduktive Autonomie verwirklichen können. Grundsätzlich ist wohl davon auszugehen, dass sie über die kognitive Kompetenz verfügen, Informationen in ihrer Bedeutung zu begreifen und durch sie zu einem (zustimmenden) Urteil zu gelangen, dessen Folgen, nämlich die Schwangerschaft mit einem gesunden Kind und die Verwerfung kranker Embryonen, sie mehr oder weniger beabsichtigen. Die Freiwilligkeit ihrer Entscheidung kann hingegen durch äußere Einflüsse gefährdet sein, die den Entscheidungsprozess anders ausgehen lassen, als es ohne sie der Fall wäre. Fremdbestimmend wirken Zwänge aller Art, aber auch einige manipulierende Faktoren, die bereits aus dem Kontext der Pränataldiagnostik bekannt sind. Zu ihnen zählt ein gesellschaftlicher Druck, die Geburt kranken und behinderten Nachwuchses zu verhindern, der insbesondere durch die Erstellung von Indikationslisten, doch nach Meinung einiger Kritiker bereits durch das bloße Angebot der PID entstünde bzw. verschärft würde. Auch Diskriminierung und Benachteiligung Kranker und Behinderter führen dazu, dass die Alternative des PID-Verzichts und der möglichen Annahme eines betroffenen Kindes abgewertet erscheint. Schockenhoff schreibt von einer generell fehlenden Akzeptanz der Alternativen zur Präimplantationsdiagnostik und sieht gerade in den Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin die Ursache für den dringenden, aber nicht autonomen Wunsch der Paare nach einem eigenen gesunden Kind.13 Diesem Gedanken weiter folgend gefährdet die PID selbst, während sie die reproduktive Autonomie der Paare fördert, zugleich die Voraussetzungen derselben. Das Kriterium der Freiwilligkeit fordert nämlich eine Wahl zwischen Optionen, die weder durch Zwang oder Manipulation auf- oder abgewertet, noch mit prospektiven Sanktionen wie z.B. Solidaritätsverlust versehen sind.14 Ausreichende Ressourcen zur Versorgung Behinderter, Versicherungen ohne genetische Risikoselektion und soziale Integration helfen ebenso wie die Förderung personaler Identität, das Fremdbestimmungsrisiko zu minimieren. Eine exakte Bestimmung der Grenze zwischen autonomiekompatiblen und autonomieverletzenden Einflüssen sowie der Möglichkeiten, ihr Wirken auf eine Ent11 s. Schöne-Seifert (1999) S.91. vgl. ebd. und Faden und Beauchamp (1986). 13 vgl. Schockenhoff (2003) S.101. Auf die einzelnen Alternativen, die Risikopaaren neben der PID zur Wahl stehen, geht Abschnitt 5.2.4 noch näher ein. 14 vgl. Schöne-Seifert (1999) S.93. 12 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 53 scheidung nachzuweisen, kann hier nicht geleistet werden. Sie wäre ohnehin nur mit Hilfe eines konkreten Fallbeispiels durchführbar. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Existenz fremdbestimmender Einflüsse allein nicht ausreicht, um die Realisierbarkeit autonomer Entscheidungen im Kontext der PID für unmöglich und somit das Autonomie-Argument für untauglich zu erklären. Hierfür wäre der Nachweis erforderlich, dass sich niemand besagter Einflüsse entziehen kann. 4.2 Die Bedeutung der Beratung für die Realisierung von Autonomie Um die vierte Autonomie-Voraussetzung zu erfüllen, müssen PID-Paare in den Besitz aller für ihre Entscheidung relevanten Kenntnisse kommen. Im Bereich der Humangenetik stellt in der Regel eine Beratung, die „zwischen dem medizinisch-direktiven Beratungskonzept und der psychosozialen-nichtdirektiven Konfliktberatung [steht]"15, den Rahmen für die Vermittlung und das Verstehen der erforderlichen Informationen durch Arzt und Paar dar. Zusätzlich zur Aufklärung über Vererbungsrisiko, Ätiologie und Verlauf der jeweiligen Erkrankung müssen Zweck, Ablauf, Risiken, Fehldiagnoseraten und mögliche Konsequenzen der PID sowie die zur Auswahl stehenden Alternativen thematisiert werden. Im Zentrum steht dabei heutzutage das Individuum bzw. das Paar,16 denn „eine psychologisch fundierte Beratung berücksichtigt die Motive, den Kenntnisstand, die subjektiven Krankheitskonzepte sowie die Ziele der Klienten.“17 Folglich sollte der beratende Arzt als „Informationsverwalter“ Wortwahl, Gesprächsführung und -inhalt individuell und situativ anpassen, um eine gute Kommunikation zu ermöglichen. 4.2.1 Nichtdirektivität Das Bemühen um die postulierte Nichtdirektivität behindert eine offene Auseinandersetzung mit konfligierenden ethischen Prinzipien und den verschiedenen Werthaltungen auf Seiten des Arztes und der Ratsuchenden. Haker wertet daher Nichtdirektivität nicht als Maßnahme zur Sicherung der Freiwilligkeit, sondern als „Problemindikator“, der auf Bewertungsunsicherheit und die Verleugnung eines Wertekonflikts hinweise. Sie fordert, ethische Fragen als konstitutiven Bestandteil in das Beratungsgespräch aufzunehmen, weil sie davon ausgeht, 15 s. Haker (1998) S.239. Der Paradigmenwechsel in der Humangenetik von einer eugenisch-direktiven über eine präventiv-direktive hin zu einer nicht-direktiven individuum-zentrierten Beratung und der parallele Wandel eines paternalistischen in ein eher partnerschaftliches Arzt-Patienten-Verhältnis wird sowohl bei Haker (1998) S.242 f. als auch bei Hartog und Wolff (1997) S.56 beschrieben. 17 s. Petermann, Wiedebusch, Quante (1997) S.17. 16 54 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit „daß die individuellen Überzeugungen und Lebenskonzepte keineswegs als gegeben anzusehen sind, sondern einer eigenen ethischen Reflexion - und Explikation in Entscheidungssituationen bedürfen.“ Eine moralische Entscheidung enthalte zwei Ebenen: Auf der ethisch-existenziellen Ebene sei sie eine Wertentscheidung, die eine Handlung entsprechend „der persönlichen, lebensgeschichtlichkontinuierlichen Identität“ für gut oder schlecht befinde. Auf der moralisch-normativen Ebene beziehe sie die zu respektierenden Rechte anderer Personen in ihre Betrachtung ein. „Ethische Beratung [...] versucht daher, die unterschiedlichen Ebenen des Moralischen zu vermitteln, bei der Explikation und Artikulation der eigenen Wertvorstellungen Hilfestellungen zu leisten und die Perspektive derer einzubeziehen, die von einer Handlung betroffen sind."18 Außer der Wissensvermittlung kommt folglich auch dem Hinweis auf die Interessen und Ansprüche anderer von der Entscheidung der Paare direkt oder indirekt Betroffener Bedeutung zu. Eine Weitung ihres Blickwinkels auf die Rechte der Embryonen, der Behinderten bzw. Kranken und der Gesellschaft kann den Beratenen helfen, die moralischen Dimensionen der einzelnen Handlungsoptionen zu verstehen und zu reflektieren. Entscheidend ist hier, dass die angeführten Fakten und Überlegungen relevant sind und in die Lebenssituation der Paare integriert werden, um so „die bestmögliche Einstellung zu gewinnen.“19 Auch eine Überprüfung des fünften Autonomie-Kriteriums, der Authentizität einer Entscheidung, scheint erst durch die Auseinandersetzung mit deren moralischen Implikationen möglich. Sie kann dazu beitragen, Unüberlegtheit, Unbegründetheit und subjektive Wertungswidersprüche aufzudecken. Lunshof ergänzt hierzu: „Ziel eines moralischen Diskurses wäre es - an erster Stelle für den Ratsuchenden-, eine moralische Rechtfertigung für die Entscheidung hinsichtlich der einen oder anderen Option aufzuzeigen.“20 [Hervorhebung übernommen, A.S.] Doch ist eine Offenlegung impliziter Wertvorstellungen mit dem wesentlichen Ziel der Beratung, nämlich dem Paar Hilfe bei der Entscheidungsfindung in einem ethisch-existenziellen Konflikt anzubieten, es dabei aber wegen des Respekts vor seiner Autonomie nicht direktiv zu beeinflussen, vereinbar? Die Befürchtung, dass aus einem unterstellten moralischen Konsens heraus bereits das PID-Angebot eine Entscheidung impliziere, verlangt geradezu danach, Wertvorstellungen zur Sprache zu bringen, um einen möglichen Dissens auszumachen. Im Hinblick auf weitere, eventuell direktive Elemente in einem Beratungsgespräch weisen Hartog und Wolff auf den 18 vgl. Haker (1998) S.251. s. Hartog und Wolff (1997) S.158. Hier findet sich auch eine allgemeine Gliederung von Beratungsgesprächen in die Abschnitte Problemvortrag, Familienanamnese, Wissensvermittlung, Risikovermittlung und Rat gefolgt von näheren Erläuterungen. 20 s. Lunshof (1998) S.233. 19 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 55 „Handlungscharakter der Sprache“ und eine notwendige Sprachanalyse hin. Bereits in der selektiven Wissensvermittlung und in der wertenden Interpretation von Wahrscheinlichkeiten, die dem Bedürfnis der Paare, individuell in einem Tendenznetz verortet zu werden nachkomme,21 liege eine Bias der Darstellung. Ebenso besitze allein die Wortwahl bei der Übersetzung der Fach- in die Alltagssprache ein manipulatives Potenzial.22 Lunshof versteht das Konzept der Nichtdirektivität als „Garantie für die Wahrung der Interessen der Ratsuchenden" und bemerkt, dass nicht die Gesprächstechniken, „sondern die Motive, diese direktiv oder nichtdirektiv einzusetzen, [...] moralisch relevant [sind]."23 Entscheidend ist die Zielsetzung, mit der ein beratender Arzt aus seiner Erfahrung heraus eine Gewichtung der Informationen vornimmt, und dass er diese explizit kennzeichnet. Auch Hartog und Wolff sehen in dieser Art des Bewertens keine Direktivität, sondern „eine Hilfe zur Einübung von Bewertungen des Wissens, welche nötig sind um aus einem Handlungsdilemma herauszufinden.“24 Risikopaare sollten also im Lauf eines Beratungsgesprächs Informationen aufnehmen, unter Berücksichtigung der moralischen Implikationen aller Handlungsoptionen und orientiert am Beispiel des Beraters eine Bewertung vornehmen, um letztendlich eine autonome Entscheidung zu fällen und die Verantwortung für diese zu übernehmen. Wenn die getroffene Entscheidung alle Autonomie-Kriterien erfüllt - was per se nicht ausgeschlossen ist -, die Paare sich also frei für oder gegen eine PID aussprechen konnten, tragen sie die Verantwortung für die Konsequenzen. Doch auch die mit der Durchführung der PID beauftragten Ärzte entscheiden über einzelne Handlungsschritte und sind für diese verantwortlich. Das Angebot der Präimplantationsdiagnostik kann folglich zweifelsfrei als Gewinn an reproduktiver Autonomie bezeichnet werden, weil es das Handlungsspektrum für Risikopaare erweitert. Ihre Anwendung hingegen bedeute nach Ansicht ihrer Kritiker, dass "die direkte moralische Verantwortung [...] an die Ärztinnen und Ärzte weiter gegeben"25 und Heteronomie zugelassen werde. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass es die prospektiven Eltern sind, die durch ihren „informed consent“ einen Behandlungsvertrag abschließen, ohne den eine PID keinesfalls durchgeführt würde. Sie sind hier die Handelnden, auf die äußere Faktoren wirken müssten, um eine PID zu verhindern oder zu provozieren. Folglich sind auch sie die Träger der moralischen 21 vgl. Rehmann-Sutter (1998) S.426 zur unbefriedigenden Diskrepanz zwischen individuellem Wissensbedürfnis und der für eine Population errechneten Wahrscheinlichkeiten. 22 vgl. Hartog und Wolff (1997) S.161-170. 23 vgl. Lunshof (1998) S.229 ff.. 24 s. Hartog und Wolff (1997) S.172. 25 s. Ruppel und Mieth (1998) S.375. 56 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit Verantwortung.26 Inwiefern diese Verantwortung auch den Angriffspunkt eines möglichen gesellschaftlichen Zwangs darstellt und inwiefern sie Paare einem Rechtfertigungsdruck aussetzt, wurde bereits im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik herausgearbeitet. 4.2.2 Die Autonomie der Risikopaare Ausgehend vom Ideal einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Arzt und Patient stellt sich die grundsätzliche Frage, ob ein autonomer Patient als Subjekt nach Information und Beratung (zur PID) suchen, der Arzt sie ihm anbieten oder das Recht sie vorschreiben soll. Eine Pflichtberatung ist dabei kaum mit dem Autonomie-Prinzip zu vereinbaren und nur durch eine „Sozialpflicht zu wissen“ zu rechtfertigen.27 Der bloße Hinweis auf die Beratungsoption, die in einer autonomen Entscheidung gewählt oder abgelehnt werden kann,28 erfüllt die Funktion einer „Autonomie-Starthilfe“. Eine Beschränkung des Angebots auf die Paare, die aus Eigeninitiative eine Beratung suchen, impliziert hingegen ein Autonomie-Verständnis im Sinne eines positiven Rechts: Das autonome Individuum sucht und gestaltet seine Möglichkeiten zu handeln ausschließlich selbst. In Analogie hierzu ginge dann auch die Verwirklichung reproduktiver Autonomie mittels Präimplantationsdiagnostik von einem Recht auf diese reproduktionsmedizinische Hilfe aus. Ob ein solches Recht aus dem Grundverständnis von Autonomie abzuleiten ist, ist hier noch zu klären. In seiner moralischen Bedeutung setzt sich das Autonomie-Prinzip nämlich aus zwei Komponenten zusammen: einem Abwehrrecht29 gegen bestimmte (therapeutische) Maßnahmen, das Ärzte kategorisch dazu verpflichtet, diese zu unterlassen, und einem positiven Recht auf Behandlung. Letzteres berechtigt jedoch niemandem, medizinische Hilfe willkürlich einzufordern. Erst in Abhängigkeit vom Vorliegen anderer Faktoren erlangt es Legitimation. Ärzte verstehen sich nicht als Dienstleister, die jeden autonom geäußerten Patientenwunsch erfüllen. Dem traditionellen Selbstverständnis nach sehen sie sich als Helfer und nur dort, wo sie als solche gebraucht werden, um Leid zu verhindern oder zu mindern, kann ein positives Recht auf Autonomie geltend gemacht werden. Entscheidend ist also, dass die vom Paar gewünschte 26 vgl. hierzu Hildt (1998) S.217 f., die hier den Ansatz Schlicks (1984) widergibt. Mit der Frage, ob eine moralische Pflicht zu wissen existiert, beschäftigt sich Abschnitt 6.1.2 noch eingehender. Hier soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass nur dann von einer autonomen Entscheidung auszugehen ist, wenn diese im Besitz ausreichender Kenntnisse gefällt wird. Autonomie verpflichtet zu wissen, und das Interesse einer Person an der Verwirklichung ihrer Autonomie verpflichtet andere, ein Verfolgen dieses Interesses zu ermöglichen, indem sie z.B. Wissen vermitteln. 28 vgl. Quante (1997) S.223, der einen “informed consent” zum informiert Werden für wünschenswert hält. Auch Liening (1998) S.196 schreibt über das Verhältnis von Autonomie und Information, dass Autonomie bedeute, selbst über die Information zu bestimmen, anhand derer man eine Entscheidung fällt. 29 vgl. Liening (1998) S.175. 27 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit 57 (Be-)Handlung - sei es eine humangenetische Beratung oder eine PID - mit den grundsätzlichen Absichten der Medizin in Einklang steht. Sie muss „medizinethisch“ indiziert sein. Hier liegt die Grenze der Patientenautonomie, deren Festlegung in die Verantwortung der Ärzte bzw. im Fall der PID wahrscheinlich in die Verantwortung einer weiteren Kontrollinstanz fällt. Auch Gesundheitserziehung, Aufklärung und Beratung fallen wegen ihrer krankheitspräventiven Funktion in den Aufgabenbereich der Medizin.30 Da sich zumindest erstere meist nicht an die Gruppe der Betroffenen, die unmittelbar vor einer Entscheidung stehen, sondern an die breite Bevölkerung, d.h. an die potenziell Betroffenen, richtet, ist davon auszugehen, dass erst ihr Angebot eine Nachfrage erzeugt, diese also teilgeneriert. Paare, die sich mit einem persönlichen Anliegen im Bereich der Fortpflanzung an die Medizin wenden, treten vor diesem Hintergrund stets als autonome informations- und hilfesuchende Subjekte auf. Wenn sie nun durch humangenetische Diagnostik von ihrem erhöhten Risiko, schwerkranken oder behinderten Nachwuchs zu zeugen, erfahren, haben sie zunächst das Recht, über alle Handlungsoptionen und ihre Konsequenzen informiert zu werden, um eine autonome Entscheidung zu treffen. In einem solchen Fall greift, ausgehend von der Antizipation möglicher Überforderung und Gefährdung des Elternwohls durch ein betroffenes Kind, das Fürsorge-Prinzip, das den Arzt als „Informationsverwalter“ zum Helfer macht. Offen bleibt die Frage, inwiefern nicht nur die Wahrung des Respekts vor der Autonomie, sondern auch ihre Förderung (durch ein um die PID erweitertes Handlungsspektrum) eine Aufgabe der Medizin ist, ob also ein PID-Verbot eine moralisch unzulässige Einschränkung der reproduktiven Autonomie darstellt. Für den Fall einer PID-Zulassung hat jedenfalls der Arzt oder ein unabhängiger Berater31 im Rahmen eines institutionalisierten Beratungsgesprächs wie bei der PND zu prüfen, ob die Integrität der Mutter bzw. des Paares tatsächlich gefährdet ist und somit der Präimplantationsdiagnostik eine präventive Bedeutung zukommt. Nur wenn sich die PID als fachlich angezeigt erweist und der „informed consent“ des Paares vorliegt, also Präventions- und Autonomiekriterium erfüllt sind, ist die Durchführung der PID gerechtfertigt. Anhand der medizinethischen Prinzipien lässt sich keine moralische Pflicht herleiten, die Präimplantationsdiagnostik anzubieten, sie liefern aber eine Rechtfertigung für ihre Einführung.32 Graumann weist zurecht darauf hin, 30 Erinnert sei an die rechtlich fixierte, ärztliche Aufklärungspflicht über die Möglichkeit einer Pränataldiagnostik. Vgl. Abschnitt 3.1.1. Im Übrigen führt Liening (1998) S.194 „public education“ als eine notwendige Ergänzung zur individuellen Beratung an. Sie stelle einen Schutz vor Fehlinformationen dar. 31 vgl. Braun (2006). 32 Allerdings erklärt die Kommission für Grundpositionen und ethische Fragen der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (GfH) (2007) S.8 in Ihrem Positionspapier, dass ihr Selbstverständnis die „Förderung der individuellen Entscheidungsfreiheit sowohl im Hinblick auf die Inanspruchnahme humangenetischer Leistungen als auch im Hinblick auf die Konsequenzen [...] einschließt.“ 58 Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit dass Autonomie auch dort eine Grenze habe, wo durch ihre Verwirklichung Dritte geschädigt würden.33 Im Fall der PID ist an das Wohl des Kindes und an gesellschaftliche Auswirkungen zu denken, die allerdings nicht hier, sondern erst im sechsten Kapitel dieser Arbeit Thema sind. Auch das Prinzip des „Nil nocere“ der Medizin, das sich in erster Linie auf den Umgang mit Patienten bezieht, wäre infolge seiner Erweiterung auf möglicherweise negative soziale Implikationen einer Therapie gegen Autonomie- und Fürsorge-Prinzip abzuwägen. Angesichts der wachsenden elterlichen Verantwortung auf der Kehrseite vermehrter Autonomie spricht Liening von einer „Überdehnung“ des Autonomie-Prinzips.34 Auch Rehmann-Sutter meint, dass genetische Tests die Paare überforderten und von Fachleuten abhängig machten, wodurch sie ihre Autonomie „verspielten“.35 Beide verkennen jedoch die auf Vertrauen basierende Beziehung zwischen dem Arzt als Helfer und den Paaren in einer psycho-existenziell belastenden Situation. Ihr Angewiesensein auf Hilfe ist hier nicht von der Hand zu weisen, und darüber hinaus kann Beratung sie, wie in diesem Abschnitt gezeigt, zu einer autonomen und moralischen Entscheidung befähigen. 33 vgl. Graumann (1998) S.408 sowie Art.2.I des deutschen Grundgesetzes. s. Liening (1997) S.187. 35 s. Rehmann-Sutter (1998) S.436. 34 Anwendung der PID 59 5. Anwendung der Präimplantationsdiagnostik 5.1 Indikationen der Präimplantationsdiagnostik In der Kontroverse um die Präimplantationsdiagnostik besteht ein bedeutender Schritt darin zu klären, innerhalb welcher Grenzen ihre Zulassung gerechtfertigt sein und wie die praktische Umsetzung dieser Begrenzung aussehen kann. Eine kritische Auseinandersetzung mit den derzeit, aber auch mit den in Zukunft möglicherweise realisierbaren Anwendungen der PID ist hierfür unabdingbar. 5.1.1 Anwendungsgebiete der Präimplantationsdiagnostik Ausgangspunkt für die Entwicklung und Anwendung der PID waren zunächst monogen vererbte Erkrankungen, deren ursächliche Mutationen mittels PCR nachweisbar sind. Ihre Anlagen können auf den Autosomen oder Gonosomen liegen und rezessiv oder dominant vererbt werden. Wenn im Fall autosomal-rezessiver Erbgänge beide Eltern gesunde Träger eines veränderten Allels sind, beträgt das Erkrankungsrisiko für ihren Nachwuchs 25 %. Auf dieser Weise werden u.a. Mukoviszidose, β-Thalassämie und Sichelzellanämie vererbt. Myotone Dystrophie, adenomatöse Polyposis coli und Chorea Huntington zählen hingegen zur Gruppe der autosomaldominant vererbten Erkrankungen. Das merkmaltragende Elternteil ist selbst von der Krankheit betroffen und gibt sie in 50 % an seine Nachkommen weiter. Zu den geschlechtsgebunden rezessiv vererbten Krankheiten gehören die Muskeldystrophie Duchenne, die Hämophilien und das fragile X-Syndrom. Männer sind immer von der Krankheit betroffen, wenn das jeweilige Allel auf ihrem X-Chromosom mutiert ist. Alle Söhne, die sie mit einer homozygot gesunden Partnerin zeugen, sind gesund, und alle Töchter tragen die mutierte Anlage. Frauen erkranken nur dann, wenn sie homozygote Trägerinnen sind, da sie über ein zweites X-Chromosom verfügen. Sind sie hingegen heterozygote Konduktorinnen, erkranken 50 % ihrer Söhne, und 50 % ihrer Töchter sind ebenfalls Merkmalsträgerinnen. Wenn die Mutation molekulargenetisch unbekannt ist, kann eine Erkrankung durch den Transfer ausschließlich weiblicher Embryonen verhindert werden. Allerdings trägt dann die Hälfte aller verworfenen männlichen Embryonen gar nicht die Mutation, und die Hälfte der übertragenen weiblichen Embryonen trägt sie doch und kann sie an ihre Nachkommen weiter geben. Bei Kenntnis des molekulargenetischen Status erübrigt sich ein präventives Verwerfen, während Konduktorinnen-Embryos eventuelle erst als „zweite Wahl“ für einen Transfer in Frage kommen. 60 Anwendung der PID Auf die Anlageträgerschaft der hier aufgelisteten und weiterer monogener Erkrankungen werden Embryonen in verschiedenen Zentren mit Hilfe der PID untersucht.1 Auch Xchromosomal dominant erbliche Erkrankungen wie der Ornithin-Transcarbamylase-Defekt (OTC) oder die Incontinentia pigmenti, die 50 % aller Nachkommen eines selbst erkrankten Elternteils betreffen, sind diagnostizierbar,2 während bei mitochondrialen Erkrankungen, die nur über die Mutter vererbt werden können, meiotische Segregation und Heteroplasmie der mitochondrialen DNA Schwierigkeiten bereiten.3 Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass das Spektrum der durch PID erkennbaren monogenen Erkrankungen mit der Anzahl molekulargenetisch entschlüsselter Krankheitsursachen stetig wächst. Nach wie vor davon ausgehend, dass die Präimplantationsdiagnostik ein Angebot für Paare mit einem humangenetisch diagnostizierbaren Risiko darstellt, sind an dieser Stelle auch chromosomale Translokationen und Strukturaberrationen in die Betrachtung zu integrieren. Als balancierte Translokationen werden diejenigen Bruchereignisse mit anschließender Umlagerung eines Chromosomensegments bezeichnet, bei denen kein Genmaterial verloren geht. Träger balancierte Translokationen sind in der Regel phänotypisch gesund, doch bei der Meiose in ihren Keimbahnen entstehen oft Gameten mit unbalancierten Chromosomenkonstellationen. In den aus ihnen hervorgehenden Embryonen liegen dann partielle Trisomien bzw. Monosomien des betroffenen Segments vor. Diese fehlerhaften Chromosomensätze können Fertilitätsprobleme, rezidivierende Aborte oder die Geburt von Kindern mit Malformationen und geistiger Behinderung verursachen. Ähnliches gilt im Fall einer Inversion, d.h. nach Bruch und Wiedereinbau eines um 180° gedrehten Chromomenabschnitts. Hier kommt es während der Meiose durch ungleiches Crossing-over zu Duplikation oder Deletion chromosomaler Segmente, so dass Gameten mit unbalancierten Strukturaberrationen entstehen. Die häufigsten Indikationen zur Durchführung einer PID bei elterlichen Chromosomenschäden sind reziproke und Robertson-Translokationen.4 Bei ersteren kommt es zwischen zwei Chromosomen zu einem Austausch terminaler Chromosomenabschnitte, der prinzipiell zwischen allen Chromosomen stattfinden kann. Das empirische Risiko, dass es zur Lebendgeburt eines Kindes mit unbalanciertem Karyotyp kommt, liegt in Abhängigkeit von den beteiligten Chromo- 1 vgl. Goossens et al. (2008) mit genauen Angaben zu Anzahl, Verlauf und Ergebnis der Zyklen, die 2005 wegen monogener Erkrankungen durchgeführt wurden. 2 vgl. Publikationen von Ray et al. (2000) und Gigarel et al. (2004). 3 Als meiotische Segregation wird die Aufteilung mitochondrialer DNA-Moleküle während der Oogenese bezeichnet. Heteroplasmie meint das Vorhandensein normaler und mutierter Mitochondrien-DNA in derselben Zelle, wobei die Zusammensetzung von Zelle zu Zelle und Gewebe zu Gewebe variiert, da sie sich mit dem Ablauf von Zellteilungen ändert. Zur PID bei mitochondrialen Erkrankungen vgl. Steffann et al. (2006). 4 vgl. Goossens et al. (2008). Anwendung der PID 61 somen und der Bruchlokalisation zwischen 0 und 60 %. Bei Robertson-Translokationen kommt es zur zentrischen Fusion der langen Arme zweier akrozentrischer Chromosomen und zu dadurch bedingtem Verlust der kurzen Arme. Die Chromosomenzahl ist anschließend auf 45 reduziert, die individuelle Entwicklung aber in der Regel unbeeinträchtigt, so dass der Zustand als balanciert angesehen wird. Besonders häufig fusionieren Chromosom 13 und 14 und Chromosom 14 und 21. In letzterem Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Translokationstrisomie 215 zur Welt zu bringen, 1-2 %, wenn der Vater und 10 %, wenn die Mutter die Translokation trägt. Die meisten lebend geborenen Kinder werden also gesund sein. Miny et al. weisen darauf hin, dass außerdem „bei der Mehrzahl der strukturellen Chromosomenanomalien [...] die Wahrscheinlichkeit einer intakten Schwangerschaft nach einer natürlichen Konzeption höher einzustufen [ist] als durch eine Intervention mit PID“ und dass „sich [diese] [...] und das Risiko einer kindlichen Behinderung im Vergleich von denen einer Kontrollgruppe ohne strukturelle Chromosomenanomalien kaum unterscheidet.“6 Otani et al. schließen hingegen aus den Ergebnissen ihrer Studie, dass wenigstens bei Tranlokationsträgern mit mindestens zwei Fehlgeburten und ohne bisherige Lebendgeburt durch PID schneller als auf natürlichem Wege eine andauernde Schwangerschaft eintritt.7 5.1.2 Aspekte der Indikationsstellung Trotz der bis hierher angenommenen Grundvoraussetzung der Nachweisbarkeit eines Risikos durch Untersuchung der elterlichen Gene bzw. Chromosomen sind hinsichtlich der Indikationen für die PID nach wie vor viele Fragen unbeantwortet. Unabhängig davon, ob eine Generalklausel auf die spezifische Situation eines Paares angewandt oder ein Indikationskatalog erstellt werden soll, bleibt zu klären, ob die PID eventuell nur denjenigen Paaren als Handlungsoption eröffnet werden soll, bei denen nach der Geburt eines erbkranken Kindes von einem „Wiederholungsrisiko“ gesprochen werden kann. Diese Forderung hat ihren Ursprung in dem Wissen, dass viele Paare sich erst nach der Geburt eines betroffenen Kindes oder nach einer PND mit anschließendem Schwangerschaftsabbruch humangenetisch untersuchen lassen. Zugleich ist sie jedoch Ausdruck der Befürchtung, dass andernfalls die Nachfrage präkonzeptioneller Risikodiagnostik und mit ihr die Anzahl der an PID interessierten Paare ansteigt. Schroeder-Kurth bemerkt, dass die Entwicklung eines kommerziellen Angebots „preiswerte[r] Multiparameter-Screeningverfahren“ 5 Translokationstrisomien machen ca. 3 % aller Trisomien aus. Ihr klinisches Bild unterscheidet sich nicht von dem einer Trisomie 21 nach meiotischer Nondisjunction, die zu 90 % während der Oogenese stattfindet. 6 s. Miny, de Geyter, Holzgreve (2006) S.707 unter Berufung auf eine Veröffentlichung von Franssen et al. (2006). 7 vgl. Otani et al. (2006). 62 Anwendung der PID zur Diagnostik genetischer Risiken nicht ignoriert werden dürfe.8 Grundsätzlich gilt, dass die zusätzliche Bedingung bereits erfahrenen Leids für eine Bewahrung vor weiterem Leid nicht zu rechtfertigen ist, weil von ihr ein „reproduktiver Zwang“ ausgeht und sie Unterschiede in der individuellen Belastbarkeit übersieht. Die Auseinandersetzung der Paare mit den Belastungen durch eine krankes bzw. behindertes Kind und den eigenen Grenzen ist u.a. Ziel der Anregung, Begegnungen derselben mit Betroffenen und deren Beteiligung an der Aufklärung über genetisches Wissen zu fördern.9 Hierdurch kann insbesondere den Merkmalsträgern, in deren Familienkreis niemand von der Erbkrankheit betroffen ist, geholfen werden, eine autonome Entscheidung zu fällen. Doch wenden wir uns noch einmal den Charakteristika der genetischen Krankheiten zu, die aus medizinischer Sicht eine PID indiziert erscheinen lassen. Zu diskutieren ist, ob eine Art „Mindestwahrscheinlichkeit“ von 25-50 % für die Geburt eines betroffenen Kindes festgelegt werden sollte, ab der Paaren eine PID angeboten werden darf. Infolge einer solchen Begrenzung wäre eine PID bei einigen chromosomalen Störungen (s.o.), aber auch als Aneuploidie-Screening bei IVF, auf das später noch näher einzugehen sein wird, ausgeschlossen. Zusätzlich verlangt auch die Penetranz eines vererbten Merkmals Beachtung. Eine Penetranz von 100 % besagt, dass alle Träger einer bestimmten Information das darin kodierte Merkmal ausbilden. Sie beschreibt also die Umsetzungsrate des Genotyps in den Phänotyp. Bei reduzierter Penetranz kann es vorkommen, dass Träger eines autosomal-dominanten Gens, nicht zu erkennen sind, es aber weiter vererben können. Im Fall so vererbter Krankheiten verringert sich das Erkrankungsrisiko unter 50 %. Daher ist die Penetranz ein weiterer Faktor, den es bei der Indikationsstellung zu berücksichtigen gilt. Auch das Alter, in dem eine Krankheit ausbricht, ist von Bedeutung. Zu den diagnostizierbaren spätmanifesten Erkrankungen zählen u.a. Chorea Huntington und familiärer Alzheimer. Merkmalsträger sind bis zur Manifestation der Erkrankung ab dem 40. Lebensjahr diesbezüglich gesundheitlich nicht beeinträchtigt. Allerdings kann das Wissen um die eigene Trägerschaft sehr belastend sein, zumal der Krankheitsverlauf bei betroffenen Verwandten oft miterlebt wird. Im Fall der Chorea Huntington wurde deswegen eine sogenannte non-disclosure-PID entwickelt.10 Sie ermöglicht, Embryonen auf das Vorliegen der genetischen Anlage zu testen, ohne dass das Elternteil von dem Ergebnis unterrichtet wird und daraus Rückschlüsse auf seinen eigenen genetischen Status ziehen kann. Ziel ist die Wahrung des Rechts auf Nichtwissen - unter 8 vgl. Schroeder-Kurth (2000) S.129. vgl. Schöne-Seifert (1999) S.95. 10 vgl. Sermon, Van Steirteghem, Libaers (2004) S.1636. 9 Anwendung der PID 63 Einsatz fragwürdiger Mittel. Denn, auch wenn keine elterliche Trägerschaft vorliegt, wird eine PID durchgeführt, und auch wenn keine gesunden Embryonen gezeugt wurden, ein PseudoEmbryo-Transfer vorgenommen. Doch das wesentliche Argument gegen eine Durchführung der PID zur Verhinderung spätmanifester Krankheiten ist, dass von ihnen keine unmittelbare Gefährdung der mütterlichen Integrität ausgeht. Es gehe, so Bodden-Heidrich et al., nicht mehr um Zumutbarkeit, sondern „um eine Entscheidung gegen den Kranken [...], der besser nicht erleben sollte, was ihm sein genetisches Programm befiehlt.“11 Dieser Entscheidung liegt eine Bewertung des Lebens eines anderen zugrunde, die nicht zulässig ist. Aus demselben Grund ist auch eine PID zum Ausschluss der Mutationen abzulehnen, die zu Krebserkrankungen im Erwachsenenalter prädisponieren.12 Zu ihnen zählen beispielsweise der BRCA1-Gendefekt, der in ca. 80 % zum Auftreten eines Early-onset-Mamma- und in ca. 60 % zum Auftreten eines Ovarialkarzinoms führt, und der APC-Gendefekt, der in ungefähr 95 % mit dem Vorkommen zahlreicher adenomatöser Polypen im Kolon einhergeht, die sich ab der Pubertät bilden und meist bis zum 40. Lebensjahr maligne entarten.13 Hier stellt sich ein weiterer Aspekt der genetischen Erkrankungen, die eine PID indizieren könnten, heraus: ihre Therapierbarkeit. Vorsorgeuntersuchungen in Form regelmäßiger Mammographien und Brustuntersuchungen ermöglichen das frühzeitige Erkennen eines Mamakarzinoms und die Einleitung einer entsprechenden Therapie. Im Fall der Polypose bieten sich koloskopische Kontrollen oder eine prophylaktische Resektion von Kolon und Rektum an. Doch auch für frühmanifeste Erkrankungen wie die Hämophilien gibt es heute mit Hilfe der Substitution gentechnisch hergestellter Gerinnungsfaktoren eine effektive Behandlungsmöglichkeit. Verfügbare Therapien14 und zu erwartender Verlauf und Schweregrad einer Erkrankung sind Parameter, die sich nicht durch Zahlen objektivieren lassen, anhand derer eine Indikationsgrenze festgelegt werden könnte. Sie sind für jede einzelne Erkrankung abzuwägen und zur Belastbarkeit der prospektiven Eltern in Beziehung zu setzen. Die Möglichkeit, nach postnataler Diagnostik durch präventive Maßnahmen den Ausbruch einer Krankheit effektiv zu verzögern oder ganz zu verhindern, stellt darüber hinaus die 11 s. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.132 f.. Mit dem PID-Angebot für onkologische Patienten setzen sich Offit et al. (2006) auseinander. Zum Ausschluss einer BRCA-1-Trägerschaft mittels PID in Großbritannien s. Striegler (2009). 13 Zum Einsatz der PID bei familiärer adenomatöser Polyposis vgl. Moutou et al. (2007). 14 Der Einwand, dass ein Zustand, in dem keinerlei Linderung von Leid möglich sei, nicht existiere, da immer noch Schmerzbekämpfung, Beatmung und Ernährung als lindernde Maßnahmen blieben, basiert auf der Annahme, dass die PID ihre Rechtfertigung aus der Vermeidung leidvollen Lebens Kranker bezieht. Ausgehend von einer Legitimation der PID durch Abwendung einer Gesundheitsgefährdung und Verwirklichung elterlicher Autonomie verliert er seine Wirkkraft. 12 64 Anwendung der PID Legitimation einer PID zum Ausschluss genetischer Dispositionen für komplexe Erkrankungen15 in Frage. Generell spricht gegen eine Verwerfung von Embryonen, die z.B. eine Disposition für atopische Erkrankungen16, Adipositas, rheumatische oder psychische Erkrankungen aufweisen, dass erst ein Zusammentreffen vieler Faktoren darüber entscheidet, ob sie erkranken. Die Entwicklung dieser Krankheiten ist angesichts der Veränderbarkeit (bekannter) externer Einflüsse keinesfalls unaufhaltsam. Es existiert hier keine eindeutige Korrelation zwischen Geno- und Phänotyp. Auch die genetische Information bei mitochondrialer Vererbung17 lässt nur begrenzt Rückschüsse auf ihre Umsetzung in einem Individuum zu, weshalb ein Einsatz der PID für mitochondriale Erkrankungen ebenfalls kritisch gesehen werden muss. Es sei noch einmal daran erinnert, dass die Belastungen der Träger genetischer Prädispositionen - seien sie durch Wissen um die eigene genetische Veranlagung oder durch therapeutische oder präventive Maßnahmen hervorgerufen18 - ebenso wenig wie die Belastungen genetisch Kranker oder Behinderter selbst eine Rechtfertigung für eine Anwendung der PID liefern. 5.1.3 Indikationsform und Slippery-Slope-Gefahr Neben den zahlreichen aufgezeigten Aspekten genetisch bedingter Erkrankungen, die bei einer Indikationsstellung zu berücksichtigen sind und über deren Gewichtung zu diskutieren ist, stellt die formale Gestaltung einen weiteren Streitpunkt dar. Sollten PID-Indikationen in einem Katalog aufgelistet werden, oder ist die allgemeine Formulierung der „schweren genetischen Erkrankung“, die mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ vererbt wird, ausreichend? Die Erstellung eines Indikationskatalogs verspricht vor allem die notwendige Restriktivität im Einsatz der Präimplantationsdiagnostik, um unkontrollierte Ausweitung und Missbrauch zu verhindern. Allerdings geht von einer Indikationsliste auch eine deutlichere Diskriminierung genetisch Kranker aus, da sie scheinbar festlegt, welche Merkmale und welche Merkmalsträger erwünscht und welche unerwünscht sind. Dieses „Lebensunwerturteil“ stehe, wie Eibach bemerkt, im „Widerspruch zum ethisch und rechtlichen Ansatz bei der Subjektivität der [b]etroffenen [Paare], der Zumutbarkeit für sie und ihrer Entscheidungsbefugnis.“19 Ein Katalog erweckt den falschen Eindruck, dass die Anwendung der PID allein genetisch begründbar ist, und verhindert außerdem die Berücksichtigung individueller Unterschiede in der Krankheitsausprägung. Von ihm geht daher die Gefahr 15 Der Übergang zwischen nach Mendelschen Gesetzen vererbten Erkrankungen abnehmender Penetranz und multifaktoriellen Erkrankungen ist fließend. 16 Unter „atopische Erkrankungen“ werden atopische Dermatitis, Rhinitis allergica und Asthma zusammengefasst. 17 Mitochondriale Vererbungen sind mittels PID aufgrund der bereits erwähnten Phänomene Segregation, Heteroplasmie und auch aufgrund der hohen Variabilität mitochondrialer DNA besonders schwer vorhersagbar. 18 vgl. Sermon, Van Steirteghem, Libaers (2004) S.1637. Anwendung der PID 65 eines Automatismus aus. Rehmann-Sutter gibt zu bedenken, dass eine Indikationsliste eine „Umkehr der moralischen Beweislast“ impliziere, denn „[n]ichts sagen hieße dann, der Behandlung zuzustimmen“20 [Hervorhebungen übernommen, A.S.]. Rechtfertigend für eine PID kann aber erst die Risikolage der Mutter und nicht allein das aufgelistete genetische Risiko für ihre Nachkommen sein. Einer allgemeinen Richtlinie wird hingegen ungenügende Verbindlichkeit vorgeworfen. Ihre Auslegung hängt schließlich vom subjektiven Urteil der Ärzte oder der Mitglieder eines Kontrollgremiums ab, in dessen Zuständigkeit die Prüfung der Anträge auf PID fällt. Einer schleichenden Ausweitung des Indikationsbereichs steht hier weniger entgegen, als wenn der Gesetzgeber über die Aufnahme weiterer Erkrankungen in einen Katalog entscheiden muss. Dennoch bietet eine Indikationsrichtlinie den Vorteil, dass bei ihrer Anwendung auf das an der PID interessierte Paar eingegangen und die individuellen Umstände berücksichtigt werden können. Insofern kann sie einer Indikationsstellung mit der Zielsetzung, Leid von den prospektiven Eltern abzuwenden, eher gerecht werden. Seitdem die Entschlüsselung des gesamten menschlichen Genoms im Juni 2000 abgeschlossen wurde, schreitet die Identifizierung genetischer Krankheitsursachen auf molekularer Ebene schnell voran21 und eröffnet der Präimplantationsdiagnostik immer neue Indikationsbereiche. Im sogenannten Slippery-Slope-Argument kommt die Befürchtung zum Ausdruck, dass sich eine restriktive Zulassung der PID auf Dauer nicht aufrecht erhalten lasse und es über eine fortschreitende Ausweitung des Indikationsbereichs irgendwann zu einem moralisch illegitimen Einsatz der Methode komme. Als Beweis für eine derartig unaufhaltsame Entwicklung gilt die Pränataldiagnostik, deren Indikation so weit aufgeweicht ist, dass sie heute als RoutineUntersuchung gelten kann. Schroeder-Kurth weist auf die geringen Unterschiede zwischen den einzelnen „Stufen“ der schiefen Ebene hin. Sie vertritt die Ansicht, dass „die erträglichen Risiken [...] für die PID genauso wie für die PND von den Frauen beschrieben [werden] und [...] sich nach der Machbarkeit [richten] [...].“22 Auch der Schritt, die PID als Indikation für eine künstliche Befruchtung hinzuzufügen, passt in das Bild einer Schiefen Ebene. Mit Blick in die Zukunft fragt Mieth daher, ob im Anschluss an die Gendiagnostik die Keimbahntherapie komme.23 Vor einer eingehenden Auseinandersetzung mit der Begrenzbarkeit der PID sollen im Folgenden die 19 s. Eibach (2000) S.119. s. Rehmann-Sutter (1998) S.430. Zwar erwähnt Rehmann-Sutter diesen Umstand im Zusammenhang mit einer Indikationsliste für pränatale Diagnostik, doch im Fall der PID ist eine analoge Auswirkung denkbar. 21 Zur Entwicklung seit Entschlüsselung des Genoms, dem Umgang mit den neuen Daten und ihren gesellschaftlichen Implikationen vgl. Van Ommen (2002) und Cullen, Marshall (2006). 22 s. Schroeder-Kurth (1999) S.53. 23 vgl. Mieth (1997) S.188. 20 66 Anwendung der PID heute zum Teil schon angewandten Indikationen der PID dargestellt werden, deren moralische Legitimität jedoch fraglich ist. 5.1.4 PID-Aneuploidie-Screening Das Aneuploidie-Screening von In-vitro-Embryonen, die im Verlauf einer Sterilitätstherapie gezeugt werden, ist wahrscheinlich der weltweit häufigste Anlass für eine Präimplantationsdiagnostik.24 Als Indikationen gelten gemeinhin ein hohes Alter der Mutter, als dessen untere Begrenzung uneinheitlich das 35. bis 38. Lebensjahr angegeben wird, wiederholtes Implantationsversagen (mindestens drei erfolglose IVF-Zyklen), habituelle Aborte (mindestes drei aufeinander folgende Spontanaborte) und eine schwere Fertilitätsstörung des Vaters (nicht-obstruktive Azoospermie und schwere Oligozoospermie). Es ist bekannt, dass sowohl ein erhöhtes maternales Lebensalter als auch paternale Fertilitätsstörungen mit einem Anstieg der Aneuploidie-Rate der Gameten korrelieren. Numerische Aneuploidien der Embryonen können wiederum ein Ausbleiben der Nidation oder einen Verlust der Schwangerschaft verursachen. Im Gegensatz zu den partiellen Aneuploidien infolge elterlicher Translokationen handelt es sich hier in der Regel um de-novo-Aneuploidien. Daher kommen in der zytogenetischen Diagnostik der Blastomeren nicht spezifische DNA-Sonden, sondern Sonden-Sets zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe sind je nach Sondenauswahl unterschiedlich viele der fixierten Chromosomen darstellbar. Werden Monosomien oder Trisomien nachgewiesen, unterbleibt der Embryotransfer in der Hoffnung, auf diese Weise die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtung zu steigern. Weitere Ziele des Screenings bestehen darin, weniger Embryonen zu transferieren und demzufolge weniger Mehrlingsschwangerschaften zu induzieren, sowie die Abortrate und die Anzahl aneuploider Lebendgeburten zu verringern. Obwohl bereits 1993 von Munné und Mitarbeitern das erste Aneuploidie-Screening (AS) durchgeführt wurde,25 steht bis heute der Beweis seiner Effektivität noch aus. Die Ergebnisse zahlreicher Studien führen zu diametral entgegengesetzten Schlussfolgerungen.26 So melden Gianaroli et al. erst einen Anstieg der Implantations- und später sogar der Schwangerschaftsrate für das AS bei Altersindikation,27 während Munné et al. keine signifikant erhöhte Implantations- 24 Die Datensammlung der ESHRE aus dem Jahr 2005 berichtet von einem weiteren Anstieg auf inzwischen 2275 Behandlungszyklen für PGS im Vergleich zu 1128 für PGD und 85 für social sexing (PGD-SS). Vgl. Gloossens et al. (2008) S.2632. 25 vgl. Munné et al. (1993). Sie untersuchten eine einzelne Blastomere auf die Chromosomen 13, 18, 21, X und Y, die besonders häufig an Trisomien beteiligt sind. 26 vgl. Harper et al. (2008). 27 vgl. Gianaroli et al. (1997) und Gianaroli et al. (1999). Anwendung der PID 67 rate, aber immerhin eine Abnahme der Spontanaborte feststellen.28 Twisk et al. kommen in ihrer Metaanalyse zweier randomisierter Studien zu dem Ergebnis, dass zwischen AS- und Kontrollgruppen bei älteren IVF-Patientinnen kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Lebendgeburten pro Frau besteht.29 Für den Einsatz der PID bei wiederholt ausbleibender Implantation nach IVF sind die Ergebnisse, wie Caglar et al. in ihrer Review aufführen, ähnlich widersprüchlich.30 Implantationsversagen kann nämlich außer auf embryonale Aneuploidien auch auf mütterliche endometriale, uterine oder immunologische Faktoren zurückzuführen sein. Ein Aneuploidie-Screening ist dementsprechend nicht in allen Fällen hilfreich. Bei der Hälfte aller habituellen Aborte bleibt die Ursache ungeklärt. Dennoch kommt es in 70 % der betroffenen Paare auch ohne Behandlung zur Geburt eines lebenden Kindes. Bisher existiert auch hier kein eindeutiger Beweis, dass diese Paare von einem Aneuploidie-Screening profitieren.31 Cohen, Wells und Munné sind allerdings der Meinung, dass alle Studien, die an dem erfolgreichen Einsatz des Aneuploidie-Screenings zweifeln lassen, einen der folgenden drei Faktoren aufwiesen, die zu abweichenden Ergebnissen führten: 1) die Entnahme zweier Blastomeren, welche die Entwicklung der Embryonen beeinträchtige und ihr Implantationspotenzial mindere. 2) eine inadäquate Auswahl und eine zu geringe Anzahl an Sonden, welche die Chance, eine Aneuploidie zu diagnostizieren, verringerten. 3) die Wahl einer Fixierungstechnik für Blastomeren, welche wegen kleiner nuklearer Durchmesser eine höhere Wahrscheinlichkeit für Signalüberlappungen besitze, die wiederum als Monosomien fehlgedeutet würden. Ein vierter Faktor in Form einer suboptimalen embryologischen Technik, durch die vermehrt Mosaike aufträten und die Embryonen weniger lebensfähig würden, sei noch nicht bewiesen.32 Dieser scheinbar augenfälligen Darstellung sind, wie sich im Folgenden zeigt, andere Erkenntnisse entgegen zu halten: Zu 1) Chromosomale Mosaike sind eine wesentliche Ursache der Fehldiagnosen von Karyotypen, die besonders dann auftreten, wenn das Untersuchungsmaterial aus nur einer Zelle besteht. Die Wahrscheinlichkeit, falsch negativ getestete Embryonen zu transferieren, könne deshalb gerade durch die Untersuchung zweier Blastomeren gesenkt werden, die, wie Reanalysen am 5. Tag zeigten, mit einer besseren Reliabilität einhergehe.33 Da das Ergebnis der Diagnos- 28 vgl. Munné et al. (1999). Die Multicenter-Studie von Munné et al. (2006) beschreibt vor allem für Frauen >40 J. nach AS signifikant weniger Spontanaborte. 29 vgl. Twisk et al. (2006). 30 vgl. Caglar et al. (2005). 31 vgl. Donoso et al. (2007). In dieser umfangreichen Review werden die gegensätzlichen Ergebnisse zahlreicher AS-Studien herausgearbeitet, von denen hier nur wenige genannt werden können. 32 vgl. Cohen, Wells, Munné (2006). 33 vgl. Baart et al. (2006), Wilton et al. (2003) und Munné et al. (2006). 68 Anwendung der PID tik nicht immer für den Chromosomenstatus aller embryonalen Zellen repräsentativ ist, werden bei bleibendem Restrisiko nur Embryonen mit ausschließlich euploider Blastomeranalyse transferiert. Für den Embryotransfer stehen daher nach einem AS oft wenige oder auch gar keine Embryonen zur Verfügung, was sich negativ auf die Geburtenrate nach IVF auswirken kann. Ein positiver Effekt des AS hängt folglich auch von der Anzahl der erzeugten Embryonen ab.34 Unter den aufgrund eines Mosaiks verworfenen Embryonen können durchaus lebensfähige sein, die als gesunde Kinder geboren worden wären. Dadurch jedoch, dass eine Untersuchung aller Blastomeren immer eine Zerstörung des Embryos bedeutet, lässt sich eine Grenze zwischen lebensfähigen und nicht lebensfähigen Mosaiken durch die derzeit verfügbaren Techniken nicht ausmachen. Das natürliche Schicksal der Embryonen, die chromosomale Mosaike aufweisen, bleibt also zunächst ungeklärt. Daraus, dass in nur 5 % aller Spontanaborte und 2 % aller vitalen Schwangerschaften Mosaizismen nachweisbar sind, schließen Los, Van Opstal und van den Berg, dass der Großteil von ihnen frühzeitig abstirbt.35 Durch die Biopsie selbst kann das Verhältnis euploider zu aneuploiden Blastomeren eines Embryos in zwei Richtungen verschoben werden: Die Entnahme aneuploider Zellen steigert vermutlich die Lebensfähigkeit des Embryos, die Entnahme euploider Zellen senkt sie. Zugleich könnten allerdings die Eröffnung der Zona pellucida und die Unterbrechung der Inkubation die embryonale Entwicklung stören und eventuell iatrogene Fehlbildungen provozieren.36 Zu 2) und 3) Die Verwendung einer größeren Sondenzahl bei der Fluoreszenz-in-situHybridisierung erhöhe Baart et al. zufolge in erster Linie die Detektion mosaiker Embryonen.37 Die komparative Genomhybridisierung (CGH) des ganzen Chromosomensatzes verringere hingegen die Anzahl der nach Kernfragmentation mittels FISH falsch diagnostizierten Monosomien.38 Allerdings schadet, wie verschiedene Studien belegen, die hierfür erforderliche Kryokonservierung auch den euploiden biopsierten Embryonen, so dass nicht mehr alle lebensfähig sind und eine Zunahme der zum Transfer geeigneten Embryonen ungewiss bleibt.39 Die Schlussfolgerung aus diesem nach wie vor unklaren wissenschaftlichen Sachstand ist, dass eine weitere Evaluation des Aneuploidie-Screenings hinsichtlich seines Erfolgs unter Berücksichtigung von Fehldiagnosen und Schädigungen des Embryos bzw. des späteren Kindes 34 vgl. Munné et al. (2003). vgl. Los, Van Opstal, van den Berg (2004). 36 vgl. Miny, de Geyter, Holzgreve (2006) S.707. 37 vgl. Baart et al. (2007). 38 Hierbei können Chromosomen verloren gehen. 39 vgl. Wilton et al. (2003). Das Überleben biopsierter und nicht biopsierter Embryonen nach Kryokonservierung beschreiben Magli et al. (1999). Von einer schnelleren Durchführbarkeit eines CGH-Arrays berichten Le Caignec et al. (2006). 35 Anwendung der PID 69 notwendig ist. Zu diesem Zweck fordern Harper et al. „well-designed and well-executed randomized clinical trials.“40 Allan und Mitarbeiter kritisieren das bisher schlechte Verhältnis von Aufwand und Erfolg und verweisen auf die ethischen Dilemmata, die sich durch den Einsatz des Aneuploidie-Screenings ergeben. Diese sollten im Voraus durchdacht und gegenüber den Paaren angesprochen werden.41 Heng mahnt zum vernünftigen Einsatz des AS nur bei Altersindikation und nach professioneller Beratung. In dieser sei darauf hinzuweisen, dass die Diagnostik keine Garantie für ein gesundes Kind bedeute. Außerdem seien günstigere und sicherere Alternativen wie die Pränataldiagnostik zuerst in Erwägung zu ziehen.42 An dieser Stelle muss aufgezeigt werden, dass der Aspekt der Verhinderung aneuploider Lebendgeburten im Hinblick auf die Zielsetzung des Aneuploidie-Screenings verschieden gewertet wird: Indem Gianaroli, Magli und Ferraretti wegen diagnostischer Unsicherheiten nach einem AS noch eine PND empfehlen und deutlich auf die Risikoreduktion für eine trisomale Schwangerschaft um 50 % hinweisen,43 wecken sie wie Heng den Eindruck, dass es sich dabei um ein entscheidendes Ziel und nicht nur um eine Folge des AS handle. Im Gegensatz dazu steht die Behauptung von Cohen, Wells und Munné, [that] „it should be remembered that most patients who request PGD do so to improve their probability of a successful IVF cycle; their primary concern usually is not the avoidance of aneuploid syndromes such as Downs (although this is perceived as an added benefit of the procedure).” 44 Ferraretti et al. treten angesichts des noch ausstehenden Beweises einer tatsächlichen Verbesserung des IVF-Erfolgs durch PID-AS hinter diese Forderung zurück und weisen auf den rein prognostischen Wert der Diagnostik für den Eintritt einer Schwangerschaft nach künstlicher Befruchtung hin.45 Auch die ethische Bewertung des Aneuploidie-Screenings divergiert entsprechend der vorherrschenden Zielsetzung: 1) Ausgehend von einer angestrebten Reduktion der Aneuploidierate unter den geborenen Kindern erscheint die Methode als Qualitätskontrolle. Diese sei nach Ansicht einiger Diskussionsteilnehmer implizit durch die „IVF-Produktion“ von Embryonen gefordert, ja sogar moralisch geboten.46 Hierzu passt Kolleks Vergleich der „Annäherung an den Embryo in vitro“ mit der Annäherung „an ein Konsumobjekt, dessen Qualität geprüft und gewährleistet werden muss, 40 s Harper et al. (2008) S.479. vgl. Allan et al. (2004). 42 vgl. Heng (2006). 43 vgl. Gianaroli, Magli, Ferraretti (2001). 44 s. Cohen, Wells, Munné (2006) S.4. 45 vgl. Ferraretti et al. (2004). 46 vgl. hierzu Eibach (2000) S.111 und Schmidt (2003) S.175. 41 70 Anwendung der PID bevor es für die Etablierung einer Schwangerschaft als geeignet angesehen wird“47 [Hervorhebung übernommen, A.S.]. Da für alle Paare ein gewisses Risiko besteht, dass ihr Kind krank oder behindert zur Welt kommt, erübrige sich in Zukunft vielleicht die bisher übliche Indikationsstellung für diese genetische Prüfung. Alle IV-Embryonen würden dann automatisch gescreent. Die IVF-Paare, um die es beim PID-AS bisher geht, haben in der Regel nur ein leicht erhöhtes und nicht erbliches Risiko. Ihr primäres Motiv, sich an die Medizin zu wenden, ist ihr unerfüllter Kinderwunsch. Dass sie durch die Sterilitätstherapie ohnehin Belastungen ausgesetzt sind, die Risikopaare erst für eine PID in Kauf nehmen müssten, führt zu dem Vorschlag, ihnen am ehesten den Zugang zur PID zu ermöglichen. Doch Sterilität als Voraussetzung einer PID festzulegen, ist insofern problematisch, als damit die Diskriminierung fertiler Risikopaare einhergeht. Für die ethische Bewertung des AS mit genannter Zielsetzung ist vielmehr entscheidend, dass angesichts des geringen und unspezifischen Aneuploidie-Risikos die Selektion der Embryonen schwer durch Konfliktantizipation und Verhinderung einer Beeinträchtigung der elterlichen Integrität begründet werden kann. Allein die Verfügbarkeit der Embryonen verleitet dazu, eine Diagnostik durchzuführen, die ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Auf der anderen Seite erscheint dennoch die Vorstellung paradox, dass Paare nach erfolgreicher Sterilitätsbehandlung und PND die eingetretene Schwangerschaft wieder abbrechen, weil das Kind krank oder behindert ist. 2) Die Situation ist eine andere, wenn es primär darum geht, den Paaren Belastungen durch wiederholte Misserfolge und Mehrlingsschwangerschaften bei IVF zu ersparen, also eine Therapie zu verbessern. Es stellt sich die Frage, ob eine ethisch problematische Technik wie die PID hierfür verwendet,48 und weiter, ob einer Entlastung der Eltern Priorität vor dem Lebensrecht der Embryonen eingeräumt werden darf. Zweifellos sind Ärzte moralisch verpflichtet, ihre Patienten bestmöglich zu behandeln. Doch kann hierin die Rechtfertigung der Zeugung vieler Embryonen, ihrer systematischen Untersuchung und der Verwerfung der für lebensunfähig befundenen liegen, deren Lebensunfähigkeit nicht einmal immer bewiesen ist? Beziehen wir die wie aufgezeigt unklare Datenlage in diese Überlegungen ein, ist die Durchführung eines Aneuploidie-Screenings, aus dessen Ergebnis bestenfalls eine prognostische Aussage ableitbar ist, zum gegebenen Zeitpunkt abzulehnen. Im Kontext der AS-Problematik beschreiben sowohl Hennen und Sauter als auch Schroeder-Kurth bereits das befürchtete Herabgleiten auf einer Schiefen Ebene: von der PID für erbliche Chromosomenanomalien bei deutlich erhöhtem Risiko über ein Aneuploidie-Screening bei Altersindikation zu einer moralisch inakzeptablen Routine- 47 48 s. Kollek (2002) S.15. vgl. ebd. S.223. Kollek zeigt hier auf, dass die Bemühungen, die IVF effizienter zu machen, auch Embryonen verbrauchende Forschungsprojekte ins Leben rufen. Anwendung der PID 71 Diagnostik aller Embryonen nach IVF.49 Vor allem aus diesem Grund sei ihrer Meinung nach das PID-AS von vornherein zu verbieten. 5.1.5 Social Sexing und Diminishment Eine weitere umstrittene Indikation der Präimplantationsdiagnostik ist das sogenannte social sexing. Nach Identifikation der Geschlechtschromosomen werden Frauen auf Wunsch nur weibliche oder nur männliche Embryonen übertragen. Ziel ist dabei nicht, eine geschlechtsgebunden erbliche Erkrankung zu verhindern, sondern der Geschlechtspräferenz der Eltern nachzukommen. Diese kann im Sinne eines family balancing den Ausgleich des Geschlechterverhältnisses in einer Familie verfolgen, doch auch in Abhängigkeit verschiedenster Faktoren schon bei Geburt des ersten Kindes ein bestimmtes Geschlecht betreffen.50 Im Jahr 2005 wurden in den ESHRE-Zentren 85 PID-Zyklen mit dieser Indikation durchgeführt. In 65 % sollten ausschließlich männliche Embryonen, in 35 % weibliche transferiert werden.51 Befürworter des social sexings berufen sich in erster Linie auf das Recht der Paare auf Fortpflanzungsfreiheit und Autonomie.52 Außerdem führen sie an, dass die Geburt eines Kindes des „falschen“ Geschlechts die familiären Beziehungen und somit auch das Wohl des Kindes selbst gefährde, das sein Leben lang nicht den elterlichen Hoffnungen entspreche. In den Augen der Gegner stellen jedoch gerade die Erwartungen, die an das Kind des ausgewählten Geschlechts gerichtet sind, eine Gefahr dar. Eltern üben schließlich durch social sexing Kontrolle auf ihre Nachkommen aus, ohne sich dadurch vor Leid zu bewahren. Sie schreiben ihnen eine Rolle zu, durch welche die kindlichen Handlungs- und Entwicklungsoptionen begrenzt werden. Die Verbindung bestimmter psychologischer Eigenschaften mit einem Geschlecht, die darin zum Ausdruck komme, sei, so Levy, eine Folge von Sexismus, den es zu bekämpfen gelte.53 Befürchtete soziale Auswirkungen des social sexings sind die Diskriminierung des anderen Geschlechts und demographische Veränderungen. Gemäß der verbreiteten Idee „guter Elternschaft“ werden Kinder jedoch eher als Geschenk denn als Ware angesehen. Annahme des Kindes und Kontrollverzicht stellen ihr zufolge konstitutive Merkmale des Eltern Werdens und Eltern Seins dar, die 49 vgl. Hennen, Sauter (2004) S.160 f. und Schroeder-Kurth (2000) S.53. Lt. Goossens et al. (2008) S.2640 lag bereits im Jahr 2005 bei 45 von 2275 AS-Zyklen keine Indikation vor. 50 Levy (2007) erwähnt in diesem Kontext Indien und China, zwei Ländern, in denen das Verhältnis der Geschlechter durch Selektion eindeutig zugunsten des männlichen Geschlechts verschoben ist. 51 s. Goossens et al. (2008) S.2633 f.. 52 vgl. hierzu Dahl (2004). 53 vgl. Levy (2007) S.108. 72 Anwendung der PID durch freiwillige Einschränkungen der elterlichen Autonomie zu bewahren sind. Nur innerhalb dieses Beziehungsrahmens können Eltern ihre Autonomie wahrnehmen.54 Social sexing ist insofern PID-Indikation einer neuen Qualität, als es positive Selektion bedeutet.55 Es geht nicht darum, die Geburt eines kranken oder behinderten Kindes zu verhindern, dessen Existenz das Paar überforderte, sondern darum, den Eltern einen vermeintlich autonomen Wunsch zu erfüllen. Es findet sich daher keine ethische Rechtfertigung einer Instrumentalisierung von Embryonen eigens zu diesem Zweck. Auch im Zusammenhang mit einer PID für erbliche chromosomale Störungen, deren Durchführung zwingend das genetische Geschlecht der Embryonen als „Begleitbefund“ verrät,56 ist social sexing abzulehnen. Auf diese Weise lässt sich einer Diskriminierung der Risikopaare vorbeugen, bei deren Embryonen das Geschlecht nach PID unbekannt bleibt, sofern diese nur auf das erbliche Krankheitsmerkmal hin untersucht werden. Durch Akzeptanz des social sexings entstünde die Gefahr eines Analogieschlusses zwischen der Auswahl des Geschlechts und der Auswahl anderer genetisch eindeutig determinierter Merkmale von Nachkommen, die infolge dessen tatsächlich zu Designer-Babys würden. Als Sonderfall positiver Selektion ist die Auswahl von Embryonen mit einer üblicherweise als Behinderung angesehenen Eigenschaft, das „Diminishment“, zu nennen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Wunsch tauber Eltern nach einem tauben Kind. Gegen seine Erfüllung spricht nicht, dass eine solche Auswahl den Embryo bzw. das Kind schädigte, da ein alternatives Leben ohne diese Krankheitsanlage für dieses Individuum nicht existierte. Vielmehr ist keine Gefährdung der mütterlichen Gesundheit durch die Geburt und das Leben mit einem hörenden Kind ersichtlich, deren Vermeidung gegenüber dem Lebensrecht der Embryonen Vorrang einzuräumen wäre. Ein Einsatz der Präimplantationsdiagnostik wäre folglich ethisch nicht akzeptabel. 5.1.6 HLA-Matching Zum heutigen Zeitpunkt ist außerdem das sogenannte HLA-Matching57 eine PID-Indikation im Sinne positiver Embryonenselektion. Hierbei geht es darum, für ein bereits geborenes krankes Kind ein geeignetes, HLA-identisches Geschwisterkind zu zeugen bzw. zu „designen“, damit es mit Hilfe dessen Stammzellen aus Nabelschnurblut, peripherem Blut oder Knochenmark geheilt 54 vgl. Scully, Banks, Shakespeare (2006) mit Ergebnissen einer Laien-Befragung zur PID für social sexing und Schockenhoff (2003) S.381 zur verantwortlichen Elternschaft, der er die konditionierte Elternschaft gegenüber stellt, mit der sich Abschnitt 6.3.4 ausführlicher beschäftigt. 55 Da es sich um eine Auswahl zwischen zwei Merkmalen handelt, kann social sexing auch als negative Selektion dargestellt werden, wobei die Ablehnung des einen zugleich die Präferenz des anderen Geschlechts ausdrückt. 56 Die ESHRE berichtet von 22 erfolglosen PID-Zyklen, die im Jahr 2002 unter Doppel-Indikation sowohl eines AS als auch eines social sexings begonnen wurden. Vgl. Harper et al. (2006). Anwendung der PID 73 werden kann. Dies ist möglich im Fall angeborener Erkrankungen, welche die Erythrozyten betreffen wie β-Thalassämie, Fanconi- und Blackfan-Diamond-Anämie oder mit Immundefekten einhergehen wie das X-chromosomal vererbte Hyper-IgM- und das Wiskott-Aldrich-Syndrom, aber auch im Fall sporadischer Erkrankungen wie u.a. Leukämien oder Lymphomen, die mit hämatopoietischen Stammzellen behandelbar sind. Die natürliche Wahrscheinlichkeit für eine HLA-Übereinstimmung zwischen Geschwistern liegt bei 25 %. Soll gleichzeitig die Vererbung einer autosomal-rezessiven Erkrankung an den Embryo ausgeschlossen sein, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 18 % und mit ihr die Baby-take-home-Rate pro PID-Zyklus, wenn folglich nur wenige Embryonen für einen Transfer zur Verfügung stehen.58 De Wert bezeichnet die HLATypisierung wegen ihres Bezugs zu intrafamiliären gesundheitlichen Problemen als eine Indikationskategorie zwischen dem medizinischen und dem Autonomie- bzw. Designer-Modell.59 Gehen wir zunächst davon aus, dass unter der Voraussetzung einer natürlichen Hilfsbereitschaft zwischen den Mitgliedern einer Familie und insbesondere aus der Antizipation der postnatalen Einstellung der Eltern gegenüber einer Stammzelltransplantation heraus genetisch gesunde Embryonen des gewünschten HLA-Typs selektiert und transferiert werden sollen. Eine moralische Beurteilung dieser Anwendung der PID erfordert hier über die bereits bekannten Faktoren hinaus die Integration des mit der Stammzellentnahme verbundenen Risikos für das Neugeborene. Es gilt: Je invasiver und risikoreicher der Eingriff, desto positiver und enger sollte die emotionale Bindung zwischen Spender und Empfänger sein, um einen psychologischen Nutzen für den Spender zu ermöglichen.60 Aus Sicht des durch PID gezeugten Spenders lässt sich nämlich nicht anführen, dass er ja selbst vor Leid bewahrt worden sei, also der PID seine Gesundheit verdanke, denn seine individuelle Existenz ist untrennbar an seinen „gesunden“ Genotyp gekoppelt. Devolder verweist in Zuspitzung dieser Tatsache darauf, dass er wie jedes andere nach PID geborene Kind der Präimplantationsdiagnostik sein Leben verdanke und folglich auch keinen Grund habe, über eventuelle Schädigungen infolge Embryobiopsie und Diagnostik zu klagen.61 Dieses Argument scheint ebenso wie der alleinige Rekurs auf die elterliche Autonomie, jede Selektion durch PID zu rechtfertigen. Es vernachlässigt jedoch den Aspekt des über die bloße Existenz hinausreichenden kindlichen Wohlergehens und den Aspekt der Verhinderung von 57 HLA meint das Humane Leukozyten Antigen, das in der Membran aller Zellen verankert ist und anhand dessen das Immunsystem körpereigene von körperfremden Zellen unterscheiden kann. 58 vgl. de Wert (2005) S.3262. Dennoch wurden 2005 zwölf Behandlungszyklen zum Ausschluss einer monogenen Erkrankung in Kombination mit einer HLA-Typisierung durchgeführt. Vgl. Goossens et al. (2008) S.2632. 59 vgl. de Wert (2005). S.3261. 60 vgl. ebd. S.3262 unter Berufung auf Wolf, Kahn, Wagner (2003). 61 vgl. Devolder (2005) S.583. 74 Anwendung der PID Leid, der für eine Indikationsstellung aus medizinischer Sicht neben der Autonomie-Bedingung erfüllt sein muss. Besonders problematisch am Vorgehen des HLA-Matchings ist die Instrumentalisierung des gezeugten Kindes in Form einer fremdnützigen Therapie. Devolder bezeichnet die Rettung des Geschwisterkindes als „person affecting reason“ [Markierung übernommen, A.S.] und zusätzlichen Grund, aus dem eine PID angezeigt sei, da hier im Vergleich zum bloßen Ausschluss erblicher Erkrankungen noch eine weitere Person davon profitiere.62 Kritiker des HLAMatchings sprechen hingegen von „Sklavengeschwistern“, die nicht um ihrer selbst willen von den Eltern geliebt und angenommen, sondern als Mittel zum Zweck benutzt würden. Um eine ausschließliche Instrumentalisierung des Kindes zu widerlegen, fordern sie daher den schwierigen Nachweis eines vom Nutzen der HLA-Typisierung unabhängigen Kinderwunsches und der Voraussetzungen für eine Übernahme verantwortlicher Elternschaft. Dem wird entgegen gehalten, dass Prokreativität Kinder auch in anderer Hinsicht z.B. für die Stabilisierung einer Partnerschaft oder für die Versorgung der Eltern im Alter instrumentalisiere - eine Instrumentalisierung, die sich ebenso schwer nachweisen wie verhindern lässt - und dass die Intention zum Zeitpunkt der Zeugung nicht die Einstellung gegenüber dem geborenen Kind determiniere. Devolder erklärt hierzu: “The fact that these parents make so much effort to try to save their first child suggests they are caring and loving parents and makes it very unlikely that they will treat the new baby as a ‘bred to order child’. What is most important in a parent child relationship is the love and care inherent in this relationship. We judge people on their attitudes toward children, rather than on their motives.”63 Ist aber angesichts der Tatsache, dass ein nach seinem HLA-Merkmal ausgewähltes Kind trotzdem gewollt und geliebt sein kann - was laut bisheriger Untersuchungen in der Regel der Fall ist - und angesichts der Tatsache, dass nie auszuschließen ist, dass Eltern z.B. ihr Kind zur Adoption freigeben, die intendierte Instrumentalisierung eines Kindes legitimierbar? Sie führt immerhin auch zur Verwerfung vieler genetisch gesunder Embryonen, die wegen ihres „falschen“ HLA-Typs nicht als Spender für das kranke Kind in Frage kommen. Die betroffenen Eltern finden sich in einem moralischen Dilemma zwischen der Hilfe für ihr krankes Kind und der Vernichtung dieser Embryonen.64 Bei erlaubtem HLA-Typing bestünde darüber hinaus das Risiko, dass Eltern sich zu einem HLA-Matching gezwungen fühlten, um ihrem Kind zu helfen, obwohl vielleicht weder gute finanzielle noch psychosoziale Voraussetzungen für ein weiteres 62 63 vgl. Devolder (2005) S.583. s. ebd. (2005) S.584. Anwendung der PID 75 Kind gegeben sind. Nicht zuletzt ist auch an das Selbstwertgefühl des Kindes zu denken, dass sich angesichts seines ausgewählt Seins und seines Beitrags zur Genesung seines Geschwisterkindes sowohl abgewertet als auch stolz fühlen kann. Ihm kann Dankbarkeit entgegen gebracht werden, und es kann durch eine Stressminderung in der Familie indirekt von der Stammzellspende profitieren. De Wert betont diesbezüglich den Einfluss innerfamiliärer Beziehungen auf das kindliche Gefühl, gewollt zu sein.65 Eine grundsätzliche Akzeptanz oder Ablehnung des HLA-Matchings ist an dieser Stelle nicht zu begründen. Eine Entscheidung erfordert in jedem Fall die differenzierte Betrachtung all seiner Einsatzmöglichkeiten wie auch der folgenden: Bereits zu Beginn wurde die Anwendung des HLA-Matchings im Fall sporadisch erkrankter Geschwisterkinder erwähnt. Dabei ist die Suche nach einem kompatiblen Spender im Gegensatz zum Einsatz bei erblichen Erkrankungen alleinige Indikation zur PID. In beiden Fällen ist zur vermeintlichen Erfolgssteigerung die Kombination mit einem anschließenden Aneuploidie-Screening möglich, welche die Rate übertragbarer Embryonen auf nur 15 % senkt.66 Denkbar sind außerdem eine Ausweitung des Empfängerkreises der Stammzellen auf andere Familienmitglieder oder sogar nicht verwandte, dem Paar nahestehende Personen67 sowie der präventive Einsatz des HLA-Matchings. Bei letzterem, der sogenannten „intentioned PGD“, geht es den Eltern darum, dass ihre Kinder sich bei Bedarf untereinander Stammzellen spenden können. Ungeachtet einer Verletzung der Rechte der Beteiligten stehen bei dieser „Versicherungsmaßnahme“ bereits Kosten und Belastungen infolge der PID sowie die Wahrscheinlichkeit ihres Nutzens in einem nicht tragbaren Verhältnis zueinander.68 Devolder schlägt daher als Alternative die Einrichtung von Banken HLA-typisierter, kryokonservierter Embryonen vor, die adoptiert und ausgetragen werden können, um anschließend die Stammzellen der geborenen Kinder therapeutisch einzusetzen.69 Noch einen Schritt weiter geht de Wert, für den die ausschließliche Verwendung embryonaler Stammzellen ohne Austragung der Embryonen im Sinne einer „conception for donation“ anstelle einer „parity for donation“ eine Umgehung der Instrumentalisie- 64 vgl. Hennen und Sauter (2004) S.161. vgl. de Wert (2005) S.3262. 66 vgl. Rechitsky et al. (2006) und Kuliev et al. (2005). 67 De Wert (2005) S.3262 f. erwähnt die Entscheidung der britischen Human Fertilisation and Embryology Authority, die ein HLA-Matching zur Behandlung eines Elternteils ablehnte, da sie eine autonome Entscheidung durch dessen eigene Interessen gefährdet sah. Ganz anders Devolder (2005) S.585: Unter Berufung auf den verbreiteten postnatalen Consent über Knochenmarkstransplantationen von Kindern auf ihre erkrankten Eltern hält sie ein HLA-Matching, um den Eltern und - ausgehend von einer fürsorglichen und liebenden Haltung der Eltern - sogar anderen diesen nahestehenden Menschen zu helfen, für gerechtfertigt. 68 vgl. Simon und Schenker (2005) S.322. 69 vgl. Devolder (2005) S.585. 65 76 Anwendung der PID rungsproblematik und eines Zwangs zur Zeugung eines HLA-gematchten weiteren Kindes darstellt.70 Die hier aufgeführten Anwendungsbereiche des HLA-Matchings machen deutlich, welches Ausmaß die Instrumentalisierung von Embryonen und Kindern im Fall seiner uneingeschränkten Zulassung annehmen kann. Jeder denkbare Gebrauch verlangt für sich genommen eine eigene ethische Bewertung, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden kann. Anhand der angeführten Beispielen sollte dennoch erneut deutlich geworden sein, dass die Slippery-Slope-Warnungen und Forderungen nach Restriktivität und effektiver Praxiskontrolle in der Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik berechtigt sind. 5.1.7 DNA-Arrays Zuletzt sei auf die Entwicklung sogenannter DNA-Arrays hingewiesen, durch deren Einsatz sich in Zukunft weitere diagnostische Möglichkeiten auch im Bereich der PID eröffnen werden. Eine entscheidende Voraussetzung für umfassende Untersuchungen des Genoms einer einzelnen Zelle ist die Vervielfältigung des Untersuchungsmaterials durch Amplifikation (WGA = whole genome amplification). Hierfür zeigt sich in jüngeren Studien die Multiple Displacement Amplification (MDA) gegenüber PCR-basierten Methoden als besonders geeignet.71 Nach ihrer Durchführung kann die gesamte amplifizierte DNA mit Hilfe eines hochauflösenden CGH-Arrays innerhalb eines Tages auf Aneuploidien, segmentale Deletionen und Duplikationen untersucht werden. Erwartungen einer bestimmten Störung und eine individuelle Anpassung der verwendeten Proben sind hierfür nicht länger erforderlich.72 Außerdem bietet sich für die Diagnostik monogener Erkrankungen die Haplotypisierung (PGH = preimplantation genetic haplotyping) an, die ebenfalls die Entwicklung mutationsspezifischer Marker überflüssig macht.73 Eine zusätzliche PCR-Analyse polymorpher Short-Tandem-Repeats, welche eng mit der untersuchten Genregion verbunden sind, ermöglicht dabei u.a. die Detektion von Allele Drop Out, kontaminierender DNA, Aneuploidien und Rekombinationen.74 All diese Fortschritte in der Chip-Diagnostik führen letztlich in die Richtung eines kompletten Genom-Screenings, dessen Interpretation sich jedoch aufgrund der natürlichen genetischen Variabilität schwierig gestaltete. Die Ableitung von Konsequenzen für den Umgang mit 70 vgl. de Wert (2005) S.3265 f.. zur MDA vgl. Studie von Hellani et al. (2005) und Review von Coskun und Alsmadi (2007). 72 vgl. hierzu Le Caignac et al. (2006). Miny, de Geyter, Holzgreve (2006) S.705 beschreiben die methodischen Unterschiede zwischen konventioneller und Array-Genomhybridisierung. 73 Haplotypisierung meint die Analyse der Verteilung einzelner Nukleotidpolymorphismen (SNP = single nucleotide polymorphism). Vgl. Renwick et al. (2006). 71 Anwendung der PID 77 gescreenten In-vitro-Embryonen aus dem Ergebnis machte die Definition genetischer Normalität und die Abgrenzung prädisponierender von determinierenden genetischen Anlagen erforderlich. Aus dem derzeit unsicheren Wissensstand hierzu folgert Liening, dass „ein präventiver Perfektionismus, der schon alle Krankheits-Dispositionen vermeiden wollte, [...] das Ende des Phänomens Fortpflanzung [wäre].“75 Fraglich ist nämlich, ob nach einem sicheren Ausschluss pathologischer Veranlagungen überhaupt noch Embryonen als transferierbar gälten. Angesichts der steigenden diagnostischen Komplexität würde auch eine qualifizierte Beratung als Grundlage einer autonomen elterlichen Entscheidung unmöglich. Eine Anwendung der DNA-Arrays in der PID ginge nicht länger von einem bekannten Risiko für eine erbliche Erkrankung aus. Sie übernähme vielmehr die Funktion einer unspezifischen Qualitätskontrolle von Embryonen, die nicht durch die Verhinderung antizipierten Leids der Eltern gerechtfertigt werden könnte. Daher wäre sie nicht mit einem wie auch immer gearteten embryonalen Schutzanspruch vereinbar. Die sich hier abzeichnende Tendenz zur genetischen Optimierung („Enhancement“) der Nachkommen könnte noch einmal verstärkt werden, wenn in Zukunft vermehrt polygen vererbte Merkmale wie Augenfarbe, Intelligenz und Größe molekulargenetisch entschlüsselt und in Kenntnis des Zusammenhangs von Geno- und Phänotyp vorhersagbar würden. Hiermit wäre der letzte rein selektive Schritt in Richtung eines Designer-Babys vollzogen. 5.1.8 Die restriktive Zulassung der PID Das Wissen um die Möglichkeit allein erlaubt noch keine Aussage über die Unausweichlichkeit einer Entwicklung, wie sie das Slippery-Slope-Argument unterstellt. Vielmehr erschließt sich aus ihm die Notwendigkeit einer rechtzeitigen präventiven Verantwortungsethik sowie einer effektiven Überwachung und Beschränkung der PID-Praxis auf die für zulässig erachteten Indikationen und Anwendungen. Mit dem Verweis auf die fehlende Nachweisbarkeit eines Kausalzusammenhangs zwischen der moralisch unbedenklichen auslösenden Handlung - der Zulassung der PID - und der moralisch illegitimen Handlung - der Zeugung von Designer-Babys oder gar der Keimbahntherapie - entkräftet Düwell das Argument der Schiefen Ebene. Seiner Meinung nach „gibt es bei komplexen Entwicklungen nicht den präzise bestimmbaren ‚point of no return’“, der ein Verbot der auslösenden Handlung verlangt76 Die Regulierbarkeit der Anwendung der Präimplantationsdiagnostik entscheidet langfristig dennoch über ihre moralische Legitimität. Wie aber kann sie praktisch gesichert werden? 74 vgl. Fiorentino et al. (2005). s. Liening (1998) S.187. 76 s. Düwell (1998a) S.45. 75 78 Anwendung der PID Neben dem erwähnten unzulänglichen Wissensstand hinsichtlich komplex vererbter Merkmale kommt bereits der belastenden In-vitro-Fertilisation, die jeder PID vorangeht, eine begrenzende Funktion zu.77 Folgende rechtlich zu fixierende Regelungen des Ablaufs sind darüber hinaus vorstellbar: Eine institutionalisierte Beratung bietet denjenigen Paaren, für deren Nachwuchs gemäß einer allgemeinen Richtlinie nachweislich das Risiko einer schweren erblichen Erkrankung besteht, die Möglichkeit umfassender humangenetischer Aufklärung hinsichtlich der individuellen Wahrscheinlichkeit und Ausprägung dieser Erkrankung. Auf der Basis medizinischer Informationen, in Kenntnis aller sich bietenden Handlungsoptionen und unter Berücksichtigung der moralischen Dimension ihrer Entscheidung können Paare ihre informierte Zustimmung zur PID geben. Ein (unabhängiger?) Berater begleitet den Entscheidungsprozess und überprüft dessen Ergebnis hinsichtlich der Autonomie-Kriterien, bevor bei einer übergeordneten Kommission ein Antrag auf Durchführung der PID gestellt wird. Für diese gelten wiederum die Bedingungen, die Testart und Sèle stellen, nämlich dass „[t]he committee must include others beside professionals of genetic screening, biomedical acts without the committee’s authorization must be considered as illegal, and the committee would have to produce a full public report annually.“78 Die eigentliche Diagnostik darf im Fall einer Genehmigung ausschließlich in dafür lizenzierten Einrichtungen unter genau geregelten Voraussetzungen vorgenommen werden. Sie ist auf das genetische Korrelat der erblichen Erkrankung zu beschränken. An die Diagnostik kann sich ein Beratungsgespräch anschließen, in dem Eltern und Ärzte gemeinsam über das weitere Vorgehen wie z.B. die Anzahl der zu übertragenden Embryonen entscheiden. Die gesetzliche Regelung der PID sollte Aussagen zur Kryokonservierung von Embryonen und zur weiteren Verwendung positiv getesteter Embryonen beinhalten. Außerdem sollte sie die Bereiche festlegen, die nicht legaler Gegenstand der PID sind, und die staatlichen Institutionen inklusive ihrer jeweiligen Besetzung benennen, in deren Aufgabenbereich die PID-Zulassung und die Kontrolle reproduktionsmedizinischer Einrichtungen, die Registrierung und Auswertung der PID-Daten sowie eventuelle Modifikationen des Verfahrens fallen. Anhand der aufgestellten Statistiken erfolgen eine Entwicklungsanalyse und Evaluation der PID-Praxis, auf die im Fall einer sich abzeichnenden, nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Indikationsbereichs mit restriktiven Vorschriften oder sogar einem Verbot der PID reagiert werden kann. Auch eine zeitlich zunächst befristete Zulassung ist denkbar, nach deren Ablauf eine erneute ethische Reflexion der PID und ggf. eine legislative Novellierung garantiert sind. 77 78 vgl. de Wert (2005) S.3263. s. Testart und Sèle (1995) S.3090. Anwendung der PID 79 Allerdings sei, so Kollek, die Elimination einer einmal etablierten Methode, die sich als ethisch nicht vertretbar herausstelle, aufgrund der dadurch entstehenden finanziellen Einbußen nur schwer durchzusetzen.79 Doch der Erlass der Legge 40 in Italien zeigt, wozu gesetzgeberische Maßnahmen in einem Rechtsstaat in der Lage sind: Trotz jahrelanger Durchführung der PID im privaten Sektor des Gesundheitssystems verbietet dieses Gesetz seit dem 19. Februar 2004 eine Fortsetzung eben dieser Praxis.80 Nach einer Untersuchung der PID-Anwendung und -Regelung in mehreren Länder äußert sich der abschließende Bericht des Büros für technische Folgenabschätzung zur Umsetzung eines effektiv kontrollierten Einsatzes der PID wie folgt: „Im Fall einer begrenzten Zulassung der PID bietet eine soweit möglich genaue gesetzliche Festlegung des zulässigen Indikationsspektrums gestützt durch ein System der Lizenzierung - nicht nur von PID-Zentren, sondern auch der spezifischen genetischen Tests - durch eine Zulassungsstelle mit transparenten Entscheidungsstrukturen und Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen eine gewisse Gewähr dafür, dass Ansprüche auf eine Erweiterung des Indikationsspektrums sich nicht stillschweigend durchsetzen, sondern gesellschaftlich diskutiert werden müssen."81 Als Land, in dem die PID bisher nur sehr kontrolliert zum Einsatz komme, wird Frankreich aufgeführt. Hier sei die Gesetzeslage, innerhalb derer die Agence de la procreation, de l’embryologie et de la genetique humaine (APEGH) als staatliche Behörde agiere, sehr eng. Außerdem bestünden in Form obligatorischer Berichterstattung durch die PID-Zentren und deren Zulassungsbeschränkung auf drei Jahre zusätzliche Hindernisse für eine Ausdehnung der PIDAnwendung. Diese mache schließlich immer eine Gesetzesänderung erforderlich, die von einer erneuten Diskussion in der Öffentlichkeit begleitet werde. Klare gesetzliche Vorgaben und das gesellschaftliche Potenzial zur ethisch-moralischen Differenzierung sind die Grundsäulen dieses Ansatzes. Es scheint so, als ob der in Frankreich eingeschlagene Weg als Beispiel für einen restriktiven und darüber hinaus transparenten Umgang mit den Möglichkeiten der PID steht, welcher ihrer befürchteten Eigendynamik unüberwindbare Barrieren entgegen setzen kann. Er stellt eine gangbare Alternative zu einer präventiven Verbotspolitik dar. 5.2 Modifikationen und Alternativen der Präimplantationsdiagnostik In diesem Abschnitt sollen andere, ethisch möglicherweise weniger problematische Methoden präimplantativer Diagnostik diskutiert werden. Außerdem soll es darum gehen, möglichst vollzählig diejenigen nicht-diagnostischen Handlungsoptionen darzustellen, die Risikopaaren im 79 vgl. Kollek (2002) S.182. vgl. Graumann (2004) S.95-97. 81 s. Hennen und Sauter (2004) S.164. 80 80 Anwendung der PID Rahmen von Beratungsgesprächen genannt und in einem Entscheidungsprozess berücksichtigt werden sollten. 5.2.1 Die Blastozystenbiopsie Bereits im Zusammenhang mit der Totipotenzfrage in Abschnitt 2.1.2 wurde die Möglichkeit der Blastozystenbiopsie82 erwähnt. Ihre Durchführung erfordert zunächst die Fortsetzung der Invitro-Kultivierung der drei Tage alten Embryonen in einem ihren Bedürfnissen angepassten Medium.83 In den meisten Fällen erreichen von ihnen nur maximal 50 % das Blastozystenstadium, werden dann untersucht und ggf. transferiert. Studien an Blastozysten haben gezeigt, dass diese weniger letale Monosomien und Mosaizismen aufweisen als frühe embryonale Teilungsstadien, da die andauernde In-vitro-Kultur, während der u.a. die Transkription des embryonalen Genoms einsetzt, zusätzlich als Selektionsmechanismus fungiert.84 Außerdem ist die Morphologie fünf Tage alter Embryonen ein Parameter, der Rückschlüsse auf ihr Implantationspotenzial erlaubt.85 Auf diesen Feststellungen gründet teilweise die Hoffnung auf eine verbesserte Implantationsrate nach Blastozystentransfer. Ob die lange Kultur dabei negative Effekte auf die weitere Entwicklung des Kindes hat, ist allerdings noch unklar. Der Biopsie geht am dritten Tag die mechanische, chemische oder mit Hilfe eines Lasers durchgeführte Eröffnung der Zona pellucida voraus, durch die nach 6-24 Stunden die Herniation trophektodermaler Zellen erfolgt. Am fünften Tag werden fünf bis sechs dieser Zellen entnommen und der Diagnostik zugeführt. Dadurch, dass der Embryoblast von der Biopsie zumindest nicht direkt betroffen ist und dem Embryo bei weitem kein Viertel seiner Gesamtzellzahl entnommen wird, ist eine Beeinträchtigung seiner Entwicklung durch die Biopsie eher unwahrscheinlich.86 Bei der sich anschließenden Trennung der gewonnenen Trophektodermzellen bereiten allerdings enge Zell-Zell-Kontakte Schwierigkeiten.87 Im allgemeinen können durch die größere Menge an Untersuchungsmaterial 1) Mosaike eher entdeckt, 2) Fehldiagnosen verhindert und 3) mehr Merkmale eines Embryos untersucht werden: 82 Die Blastozyste besteht aus ca. 32 Zellen, aus äußeren Blastomeren, die den Trophoblast bilden, aus dem später die Plazenta und die Eihäute hervorgehen, aus der flüssigkeitsgefüllten Blastozystenhöhle und aus inneren Blastomeren, die an einem Pol den Embryoblast bilden, aus dem sich später der eigentliche Embryo entwickelt. 83 vgl. hierzu Diedrich et al. (2005) S.590. 84 Sandalinas et al. (2001) weisen darauf hin, dass diese Selektion das Auftreten klinisch relevanter ChromosomenAnomalien nicht zuverlässig verhindert, zumal - so stellen Clouston et al. (2002) fest - sich zwar weniger Haploidien, Mono- und Trisomien finden lassen, die Inzidenz konstitutioneller Anomalien im Blastozystenstadium aber der Inzidenz im ersten Trimenon entspricht. 85 vgl. della Ragione et al. (2007). Vgl. Abschnitt 3.3.3 zum SET. 86 In einer Studie von McArthur et al. (2005) überlebten alle Blastozysten die Zellentnahme. 87 vgl. Kokkali et al. (2005) S.1857. Anwendung der PID 81 Zu 1) Evsikov und Verlinsky zufolge spiegelten die Mosaizismen des Trophoblasts die durchschnittliche Aneuploidierate der inneren Zellmasse, d.h. des Embryoblasts, wider,88 während sich jedoch laut Griesinger et al. in 2 % der Untersuchungen die pathologischen Befunde nur auf die Plazenta beschränkten (Confined placental mosaicism).89 In ihrer jüngsten Publikation zum PID-AS sehen Donoso et al. diese Repräsentationsfrage als noch immer ungeklärt an.90 Tetraploide Trophektodermzellen scheinen aber weniger eine pathologische Entwicklung des Embryos anzuzeigen als vielmehr physiologische Vorgänger des Synzytiotrophoblasts zu sein. Zu 2) Die PCR-Diagnostik der DNA mehrerer Zellen eines Embryos verringert das Risiko eines Allelic drop out bei erhöhter Sensitivität und Reliabilität.91 Mit Hilfe einer Multiplex PCR erreichen McArthur et al. nach Blastozystenbiopsie eine Diagnosesicherheit von 95 % für monogene Erkrankungen.92 Zu 3) Der Möglichkeit, mehrere Tests gleichzeitig anzuwenden, kommt unter der Vorannahme eines restriktiven Umgangs mit der PID eine untergeordnete Bedeutung zu. Der Embryotransfer am fünften oder sechsten Tag entspricht zeitlich der Ankunft einer natürlich gezeugten Blastozyste im Uterus. Dieser Zeitpunkt verspricht aufgrund der besseren Synchronisation des endometrialen und embryonalen Stadiums und aufgrund der verringerten uterinen Kontraktiliät in Kombination mit der Selektion entwicklungsstarker und zudem getesteter Embryonen eine Zunahme der Implantationsrate.93 Hierdurch scheint sogar der Transfer einzelner Embryonen möglich, mit Hilfe dessen bei unverändertem oder sogar verbessertem Therapieerfolg Mehrlingsschwangerschaften verhindert werden können. Problematisch bleibt dennoch der auf 24 Stunden begrenzte Zeitraum, in dem die Diagnostik abgeschlossen sein muss, damit die Embryonen zum richtigen Zeitpunkt übertragen werden können.94 Abhilfe schaffen hier vielleicht neu entwickelte schnellere Untersuchungsverfahren und ein Zeitgewinn durch Kryokonservierung. Die Angaben zur Überlebensrate kryokonservierter Blastozysten schwanken zwischen 53 % und >90 %, wobei der Unterschied eventuell durch verschiedene Biopsiezeitpunkte zu erklären ist.95 Auch Studien zur Effizienz der Blastozystenbiopsie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen: Während de Boer et al. beim Vergleich von SET nach Blastozystenbiopsie 88 vgl. Eviskov und Verlinsky (1998). Das Ergebnis ihrer Untersuchungen kann die Annahme, dass aneuploide Blastomeren vor allem an der Plazentabildung, euploide hingegen an der Embryogenese beteiligt sind, nicht bestätigen. 89 vgl. Griesinger et al. (2003) S.329. 90 vgl. Donoso et al. (2007) S.22. 91 vgl. Kokkali et al. (2007) S.2. 92 vgl. McArthur et al. (2005). Neben der krankheitsauslösenden Mutation erfasst die PCR hier weitere, mit dieser verbundene Marker (Short-Tandem-Repeats) und sichert so die Diagnose zusätzlich ab. 93 vgl. della Ragione et al. (2007) und Zech et al. (2007). 94 vgl. Sermon, Van Steirteghem, Libaers (2004) S.1634. 95 In der Studie von Magli et al. (2006) überlebten 53 % aller Blastozysten, bei McArthur et al. (2005) sogar mehr als 90 %, wobei erstere bereits am dritten Tag biopsiert worden waren und letztere erst am fünften Tag. 82 Anwendung der PID mit SET nach konventioneller PID keine veränderte Schwangerschaftsrate, wohl aber eine geringere Rate monozygoter Mehrlinge feststellen,96 gelangen Blake, Proctor und Johnson in einer Cochrane-Review zu dem Schluss, dass weder ein signifikanter Unterschied in der Schwangerschafts- oder Lebendgeburts- noch in der Mehrlingsschwangerschaftsrate zu verzeichnen sei.97 Die Gruppe um Papanikolaou kritisiert allerdings, dass diese Review auch Studien beachte, in denen der Transfer mehrerer drei Tage alter Embryonen möglicherweise den Transfer nur einer Blastozyste kompensiere.98 Sie selbst kommt ebenso wie die neueren Veröffentlichungen von McArthur und Kokkali et al. zu dem Ergebnis, dass die Blastozystenbiopsie ein besseres Outcome gegenüber der herkömmlichen PID verspreche.99 Für eine ethische und rechtliche Bewertung der Blastozystenbiopsie besteht ihr wesentlicher Vorteil darin, dass die biopsierten Zellen kein Teil des Embryoblasts und nicht mehr totipotent sind, das heißt, dass sich aus ihnen kein menschliches Individuum mehr entwickeln kann. Ihre Entnahme konfligiert folglich weder mit dem Verbot des Embryosplittings noch mit dem embryonalen Lebensschutz, solange sie das Überleben der Blastozyste nicht vorsätzlich gefährdet. Verwendung und Vernichtung trophektodermaler Zellen im Rahmen der Diagnostik sind ethisch eher akzeptabel als die Vernichtung noch totipotenter Blastomeren. Allerdings bleiben trotz dieses Vorteils die bereits bekannten Streitpunkte wie die erforderliche Erweiterung der IVF-Indikation, die Frage nach der Zielsetzung der PID und die Problematik der missbräuchlichen Verwendung, Selektion und Verwerfung menschlicher Embryonen bestehen. 5.2.2 Die Polkörperdiagnostik Die Verlegung der Diagnostik auf einen Zeitpunkt, zu dem die Entstehung eines Embryos noch nicht abgeschlossen ist, vermeidet Konflikte hinsichtlich des Umgangs mit Embryonen. Eine Form der präkonzeptionellen Diagnostik findet an den von der Oozyte nacheinander ausgestoßenen Polkörpern statt (PKD bzw. Polar body diagnosis = PBD).100 Nach Eröffnung der Zona pel- 96 vgl. de Boer et al. (2004). vgl. Blake, Protctor, Johnson (2004). 98 vgl. Papanikolaou et al. (2005) zum Vergleich von SET von Blastozysten und frühen Teilungsstadien nach IVF bei unter 36-jährigen Frauen. 99 McArthur et al. (2005) erreichten nach ET frischer Blastozysten eine Implantationsrate von 41 % mit mehr als 40 % Lebendgeburten nach erstem SET. In 26 % erfolgte selbst nach Kryokonservierung eine Implantation. Beim Vergleich von an Tag drei bzw. fünf biopsierten, auf monogene Erkrankungen untersuchten und an Tag fünf bzw. sechs transferierten Embryonen fanden Kokkali et al. (2007) Implantationsraten von 26,7 % für früh biopsierte und 47,6 % für spät biopsierte Blastozysten. 100 Wenn im weiblichen Organismus die erste Reifeteilung vor der Ovulation ihre Fortsetzung findet, wird von der Oozyte eine wesentlich kleinere Tochterzelle abgetrennt, die den ersten Polkörper bildet. Das spätere Eindringen des Spermiums (die Imprägnation) reaktiviert die arretierte zweite Reifeteilung der Meiose, die dann mit der Ausstoßung des zweiten Polkörpers ihren Abschluss findet. 97 Anwendung der PID 83 lucida erfolgt die sequentielle oder simultane Entfernung der Polkörper aus dem perivitellinen Raum zwischen Eizelle und Zona pellucida. Die sequentielle Biopsie bedeutet ein zeit- und arbeitsintensiveres Vorgehen, im Rahmen dessen die Oozyte zweimal ihr Kulturmedium verlassen muss, während im Fall der gemeinsamen Entfernung beider Polkörper der erste bereits durch degenerative Prozesse für die genetische Untersuchung untauglich wird. Nach 48 Stunden Invitro-Kultivierung der Eizelle finden sich von ihm nur noch Reste, an denen keinerlei Diagnostik mehr durchführbar ist.101 Eine sehr frühe Biopsie des zweiten Polkörpers läuft wiederum Gefahr, die Eizelle durch noch bestehende Zytoplasmabrücken zu schädigen oder über die Mikrotubuli des restlichen Spindelapparates eine iatrogene Aneuploidie zu provozieren. In der Regel kann das zweite Polkörperchen 16-18 Stunden nach Eindringen des Spermiums in die Eizelle entnommen werden.102 Generell beeinträchtigt die Entfernung der Polkörper weder die Fertilisation der Eizelle noch die Lebensfähigkeit des aus ihr entstehenden Embryos.103 Die Auslösung epigenetischer Effekte durch die Manipulationen des Embryos ist aber nicht ausgeschlossen.104 Der erste Polkörper enthält einen Satz maternaler Chromosomen und stellt eine Negativkopie des in der Oozyte verbliebenen Erbmaterials dar. Mit dem zweiten Polkörper wird jeweils eine Chromatide aller oozytären Chromosomen ausgestoßen. Nach dem Crossing-over zur meiotischen Rekombination des mütterlichen Erbguts entsprechen diese aber nicht mehr exakten Kopien der Chromatiden, die letztlich an der Bildung des neuen embryonalen Chromosomensatzes beteiligt sind. Infolge des Austauschs von Chromatidenabschnitten kann das zu untersuchende Gen in Polkörper und Eizelle vorliegen. Das Crossing-over erschwert somit Rückschlüsse auf das Vorhandensein monogen vererbter Krankheitsanlagen in der Eizelle. Ist der erste Polkörper homozygot für das gesuchte Merkmal, fungiert eine Untersuchung des zweiten lediglich als Kontrolle. Beim Nachweis einer Heterozygotie des ersten, muss der zweite Polkörper ebenfalls das mutierte Allel aufweisen, um vom Vorliegen des gesunden Allels in der Oozyte ausgehen zu können.105 Ist eine PCR-Diagnostik des zweiten Polkörpers vor Abschluss des Befruchtungsvorgangs nicht durchführbar, müssen in Deutschland alle bis dahin heterozygot getesteten Eizellen von der Befruchtung ausgeschlossen106 oder während der PCR kryokonserviert werden, um eine Auflösung der Vorkernmembranen zu verhindern. Die Bundesärztekammer bemerkt hierzu, dass aber 101 vgl. Verlinsky und Kuliev (1996) S.14. vgl. Verlinsky et al. (2002) S.39. 103 Bei Verlinsky und Kuliev (1996) S.14 zufolge entwickelten sich ca. 60 % aller PKD-Embryonen zu Blastozysten. 104 vgl. Kollek (2002) S.56 f.. 105 Laut Verlinsky et al. (2002) S.40 liege die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis der Untersuchung beider Polkörper auf X-chromosomal vererbte Erkrankungen zu erhalten, bei 80 %. 102 84 Anwendung der PID “nach Transfer von vorher kryokonservierten Eizellen [...] die Schwangerschaftsrate deutlich niedriger [ist], sodass ein Gewinn an diagnostischer Sicherheit durch Untersuchung auch des zweiten Polkörpers möglicherweise aufgehoben wird.“107 In Ländern, in denen die PID an Embryonen zugelassen ist, stellt diese eine weitere Möglichkeit dar, das anhand der PKD gewonnene Ergebnis vor dem Eintritt einer Schwangerschaft zu überprüfen.108 Für Magli et al. liegen die Vorteile einer Kombination von PKD und PID in der Verfügbarkeit einer größeren Menge zu untersuchender DNA, ohne dass sich die zusätzliche Biopsie auf die weitere Entwicklung und Implantationsrate der Embryonen negativ auswirke. Sie sehen hier die Chance, die Diagnostik auf Aneuploidien und auf monogene Erkrankungen zu kombinieren, sowie die Möglichkeit, Aneuploidieursachen zu erforschen.109 Aufgrund eines Risikos von 9,6 % für Allelic drop out bei PKD110 empfiehlt sich wieder die Verwendung einer Multiplex-PCR, die außer der Mutation noch mehrere Short-Tandem-Repeats erfasst und so Fehldiagnosen zu erkennen hilft. Die Diagnosesicherheit liegt dann nach Untersuchung beider Polkörper auf monogene Erkrankungen bei ca. 97 %.111 Wesentlicher Kritikpunkt an der Polkörperdiagnostik ist die der Methode inhärente Limitierung auf maternal vererbte Krankheitsursachen. Ausgehend von Risikopaaren verlangt die PKD daher die Verwerfung aller Oozyten, die ein autosomal- oder X-chromosomal-rezessives Merkmal tragen, obwohl das befruchtende Spermium zu jeweils 50 % ein gesundes Allel oder XChromosom enthält. Im Fall paternal vererbter autosomal- oder X-chromosomal-dominanter Erkrankungen hilft die PKD nicht weiter. Gleiches gilt für unbalancierte chromosomale Aberrationen, die bei väterlichem Translokationsstatus in der Spermatogenese entstehen. Sie bleiben unentdeckt und können weiterhin Ursache einer niedrigen Implantationsrate sein. Auf die Gesamtheit aller erblichen Defekte bezogen stellen die durch PKD nicht erfassbaren Erkrankungen allerdings einen geringen Anteil dar. So liegen Aneuploidien in den meisten Fällen Fehler während der Oogenese zugrunde. Diese sind vor allem auf das Phänomen der Nondisjunction der Chromosomen bei der ersten bzw. der Schwesterchromatiden bei der zweiten Reifeteilung und auf das Phänomen der Predivision, d.h. einer vorzeitigen Trennung der Chromatiden, bei der ersten Teilung zurück zu führen.112 Um eine chromosomale Fehlverteilung zwischen Oozyte und 106 Dies war bei der PKD zum Ausschluss einer Mukopolysaccharidose Typ I durch Tomi et al. (2006) der Fall. s. Bundesärztekammer (2006) S.1399. 108 So geschehen bei Kuliev et al. (2006) zum Ausschluss der Sandhoff-Erkrankung. 109 vgl. Magli et al. (2004). 110 vgl. Untersuchung von Rechitsky et al. (1998) zum Vergleich von ADO-Raten bei molekulargenetischen Untersuchungen an Fibroblasten, Blastomeren und Polkörpern. 111 vgl. Rechitsky et al. (1999) und Verlinksy et al. (1999a). 112 Verlinsky und Kuliev (1996) S.14 zufolge verursache eine Malsegregation bei der ersten Teilung 77,1 % aller maternalen Trisomien. Die übrigen 22,9 % entstünden durch Nondisjunction bei der zweiten Teilung. Auch in 107 Anwendung der PID 85 Polkörpern vollkommen ausschließen zu können, ist also eine Untersuchung beider Polkörper unabdinglich. Die Anwendung der FISH zur Darstellung der Chromosomen des ersten Polkörperchens wird allerdings durch deren schlechte Qualität erschwert.113 Aufgrund ihres verkürzten Zustands lassen sie sich kaum per Farbsonden auf terminale Translokationen untersuchen.114 Weil sich der Nukleus des zweiten Polkörpers in der Interphase befindet, ist zunächst seine Aktivierung durch Elektrofusion erforderlich, infolge derer die Chromosomen kondensieren und ihre Untersuchung möglich wird.115 Trotz einer geringeren Affinität der Sonden zur Polkörper- als zur Blastomer-DNA116 ist prinzipiell die Darstellung aller Chromosomen möglich. Dennoch konnten bisherige Versuche eines PKD-Aneuploidie-Screenings noch keine Effizienzsteigerung der künstlichen Befruchtung herbeiführen.117 Die Ursache dafür sind weder fehlende Genauigkeit noch fehlende Reliabilität, sondern möglicherweise chromosomale Aberrationen, die während der ersten postzygotischen Teilungen entstehen,118 und daher von der Polkörperdiagnostik nicht erfasst werden. Ebenso bleiben Mosaike unentdeckt und können folglich keine Fehldiagnosen hervorrufen. Die sonst aufkommende Repräsentativitätsfrage und die problematische Einschätzung des Entwicklungspotenzials mosaiker In-vitro-Embryonen sind also durch PKD vermeidbar. Insgesamt werden in drei Viertel aller PKD-Zyklen am dritten Tag Embryonen transferiert. Die Angaben zur Schwangerschaftsrate pro Behandlungszyklus schwanken zwischen 19,9 und 36,6 %.119 Ist die PID verboten, kann das PKD-Ergebnis nur mittels pränataler Diagnostik nach Eintritt einer Schwangerschaft bestätigt werden. Die hohen Anforderungen der Polkörperdiagnostik an Personal und Technik ergeben sich vor allem aus ihrer Durchführung am Erbgut einzelner Zellen und der Indirektheit ihrer Aussage über das Erbgut der Oozyte. Wenn darüber hinaus der gesetzliche Embryonenschutz die Verwendung jedes künstlich erzeugten, entwicklungsfähigen Embryos zur Herbeiführung einer Schwangerschaft vorschreibt, schränkt der kurze Zeitraum zwischen Ausstoßung der Polkörper und Auflösung der Vorkernmembranen, in dem ein Ergebnis vorliegen muss, die diagnostischen Möglichkeiten weiter ein. Wenn man davon ausgeht, dass die Existenz eines Embryos mit der Durchmischung der Chromosomen väterlicher einer Folgestudie fand sich eine höhere Anomalierate in den ersten Polkörpern. Vgl. Verlinsky et al. (1999) S.166. 113 vgl. Rosenbusch (2006) S.2741. 114 vgl. Munné et al. (2005) S.306. 115 Verlinsky und Evsikov (1999b) transplantierten hierfür den Nukleus in eine entkernte Eizelle, die dann elektrisch aktiviert wurde und einen haploiden metaphasischen Pronucleus formte. 116 vgl. Griesinger et al. (2003) S.335. 117 vgl. Diedrich et al.(2005) S.590 mit dem Hinweis auf eine „multizentrische prospektive Studie in Planung sowie begleitenden retrospektive Auswertungen“ zur Bewertung der PKD. 118 Der Nationale Ethikrat (2003) S.30 gibt die Häufigkeit dieser Veränderungen mit < 5 % an. 86 Anwendung der PID und mütterlicher Herkunft, also dem Abschluss der Befruchtung, beginnt,120 erscheint die Polkörperdiagnostik ethisch weniger problematisch als die PID. Ihre Durchführung verlangt weder die Vernichtung totipotenter Blastomeren, noch die inakzeptable Erzeugung von Embryonen, die selektiert und anschließend wieder verworfen werden. Die Verfolgung „der Entwicklung unterschiedlicher Formen wirklich präkonzeptioneller Diagnostik“ sei daher laut Schockenhoff „aus ethischer Sicht“ ein „dringliches Desiderat“. Die Verbesserung der Polkörperdiagnostik sei eine Forschungsrichtung „ohne Tendenz zur moralischen Grenzüberschreitung“ und ohne Vorwerfbarkeit einer „moralischen Schieflage“.121 Nach Kolleks Auffassung könne das PKDAneuploidie-Screening sogar als Teil der Therapie weiblicher Sterilität angesehen werden. Da hier die Unfruchtbarkeitsursache bei den Frauen liege, bedeute die Entnahme und Untersuchung der Eizellen keine Instrumentalisierung derselben.122 Ob die Polkörperdiagnostik uneingeschränkt positiv zu bewerten ist, soll im Folgenden näher untersucht werden. Es sei zunächst daran erinnert, dass ihr die Verwerfung aller mutationstragenden Oozyten aus Unkenntnis des spermatozytären Allels heraus folgt. Dadurch steigt die Anzahl der benötigten Eizellen pro Behandlung, deren Gewinnung eine stärkere oder wiederholte Stimulation der Ovarien mit den bekannten gesundheitlichen Risiken erfordert. Auch mit der Selektion befruchteter Eizellen sind schließlich psychische Belastungen für das Paar bzw. die Frau verbunden. Generell sind unerwünschte gesellschaftliche Auswirkungen, auf die noch näher einzugehen sein wird, und eine unmoralische Ausweitung der Anwendung im Fall der PKD ebenso wie im Fall der PID denkbar und lassen die Polkörperdiagnostik ethisch problematisch erscheinen.123 Schmidt bezeichnet als Ziel der PKD, "zu einem Zeitpunkt, an dem durch diese Entscheidung niemand geschädigt wird, zu vermeiden, dass bei der Möglichkeit der Geburt entweder (a) eines Menschen mit Behinderung oder (b) eines Menschen ohne Behinderung, die Geburt des Menschen mit Behinderung unterbleibt."124 [Kursivschrift übernommen, A.S.] Es wird deutlich, dass die ethischen Streitpunkte Selektion, Diskriminierung und Eugenik auch die Pokörperdiagnostik betreffen, obwohl hier „niemand“, das heißt, der oben genannten Auffassung folgend, kein Embryo, geschädigt wird. Die unterschiedliche Bewertung von PID und PKD ist also vor allem auf das Stadium des Fertilisationsprozesses und die damit verbundene Status- 119 vgl. Verlinsky und Kuliev (1996) und Rechitsky et al. (1999). Diese Definition liefert §8 Abs.1 des deutschen ESchG. 121 s. Schockenhoff (2000) S.100-104. 122 vgl. Kollek (2002) S.203. Zur Instrumentalisierungsproblematik im Fall männlicher Fertilitätsstörungen s. Abschnitt 3.3.2 dieser Arbeit. 123 vgl. Nationaler Ethikrat (2004). 124 s. Schmidt (2003) S.162. 120 Anwendung der PID 87 zuschreibung zum Zeitpunkt der Selektion zurückzuführen. Genau genommen findet nämlich die Untersuchung des zweiten Polkörpers schon intra- und nicht mehr präkonzeptionell statt. Die moralische Unterscheidung der dabei vorliegenden befruchteten Eizelle im Pronucleusstadium von einer Zygote rekurriert auf den diploiden Chromosomensatz als Beginn genetischer Individualität.125 Allerdings können sowohl das Ausstoßen des zweiten Polkörpers als auch die Vereinigung der Chromosomen in den Nuklei des Zwei-Zell-Stadiums ebenfalls als Zeitpunkte der Individualitätsbegründung plausibel gemacht werden. Auch eine Fokussierung der Potenzialität ließe keinen Unterschied zwischen einem Pronukleusstadium und einer Zygote erkennen. Folglich wäre u.a. die prophylaktische Verwerfung befruchteter Eizellen, die das mutierte Allel einer rezessiven Erkrankung enthalten, in 50 % gleichzusetzen mit der Verwerfung gesunder Embryonen. Gegen eine gesetzliche Festlegung des Embryonenschutzes, welche die Zulässigkeit der PKD, aber Unzulässigkeit der PID bedingt, lässt sich der Einwand der Willkür vorbringen. Darüber hinaus stellt sich angesichts der breiten Akzeptanz der Polkörperdiagnostik die Frage, inwiefern nicht nur „die Moral einen normativen Anspruch an das Recht dar[stellt]“126, sondern auch ein Einfluss der teilweise willkürlich erscheinenden Gesetzgebung auf die Wahrnehmung und moralische Bewertung durch den Einzelnen und die Gesellschaft besteht. Die rechtliche Beurteilung der Polkörperdiagnostik ist dabei keineswegs so eindeutig wie vielleicht anzunehmen: Zwar verstößt sie nicht gegen das Verbot des Klonens oder einer Verwendung von Embryonen zu einem nicht ihrer Erhaltung dienenden Zweck, doch ist insbesondere im Kontext der PKD unter Verwendung beider Polkörper zu klären, ob das Ziel der künstlichen Befruchtung die Etablierung einer Schwangerschaft oder die Selektion der Pronukleusstadien ist. Grundsätzlich sollten für die Polkörperdiagnostik dieselben Indikationen und Zulassungsbedingungen wie für die PID gelten. Besonders mit Blick auf ihre möglichen Folgen ist eine gesetzliche Regelung zur Standardisierung ihrer Durchführung und Qualitätskontrolle sowie zur Sicherung der Transparenz erforderlich. 5.2.3 Spermienselektion, Gametenspende und Embryonenadoption Auch die Auswahl der zur Befruchtung verwendeten Spermien gehört in den Bereich präkonzeptioneller Diagnostik, der von einem restriktiven Embryonenschutz nicht erfasst wird. Da eine Untersuchung der Chromosomen oder Gene die Zerstörung der Keimzellen voraussetzt, ist bis- 125 vgl. Abschnitt 2.2.1 zu den Argumenten der Individualität, Potenzialität und Kontinuität in der Diskussion um den Status des Embryos. 126 s. Düwell (1999) S.9. 88 Anwendung der PID her nur die Trennung in X- und Y-Chromosom-tragende Spermien für eine geschlechtsgebundene Fertilisation möglich. Ein physikalisches Trennverfahren nutzt den Masse- und DichteUnterschied der beiden Spermienarten und reichert mittels Zentrifugation durch einen Albumingradienten zu 85 % Y-Spermien an. Dass X-Chromosomen 2,8 bis 3 % mehr DNA enthalten und folglich ein anderes Fluoreszenzmuster aufweisen, macht sich die Flusszytometrie zunutze.127 Von dem hierfür benötigten Fluorochrom-Reagens und dem Laser könnte ein mutagenes Risiko für die Nachkommen ausgehen. Bisherige Daten sprechen allerdings nicht für ein vermehrtes Auftreten schwerer kindlicher Fehlbildungen.128 Mit Hilfe dieses Verfahrens gelingt die Anreicherung von X-Spermien auf bis zu 90 % und von Y-Spermien auf mehr als 70 %.129 Neben dem social sexing sind X-chromosomal vererbte Erkrankungen eine denkbare Indikation zur Spermien-Selektion. Wenn die Mutter Konduktorin ist, erfolgt eine IVF unter ausschließlicher Verwendung von X-Spermien. Auf diese Weise reduziert sich ausgehend von einer 10 %igen Fehldiagnoserate das Erkrankungsrisiko für ihre Nachkommen von 25 auf 5 %. Alle Y-Spermien werden verworfen, auch wenn in der Hälfte aller In-vitro-Fertilisationen ein gesunder männlicher Embryo entstanden wäre. Auf die Schwangerschaftsrate nach IVF hat die Spermien-Selektion keine Auswirkungen. Der Überprüfung des embryonalen Geschlechts dient eine anschließende FISH-Diagnostik an Blastomeren (PID) oder an fetalen Zellen (PND). Eventuell lässt sich die Spermien-Selektion auch zur Reduktion der Aneuploidien väterlicher Herkunft einsetzen. Dann stellten u.a. balancierte Translokationen eine Indikation zur Flusszytometrie dar. Des Weiteren zeichnet sich die Möglichkeit ab, das Spermiengenom mittels Kerntransfer in kernlose Oozyten zu duplizieren, anschließend eine der Kopien zu untersuchen und nach Ausschluss einer Anlageträgerschaft die andere für die künstliche Befruchtung zu verwenden. Angaben zur Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit dieser Technik lassen sich jedoch erst anhand zukünftiger Studien machen.130 Die Spermien-Selektion ist im Vergleich zur Polkörperdiagnostik insofern ethisch weniger problematisch, als zur Gewinnung der Spermien keine hormonelle Stimulation und keine invasive Follikelpunktion erforderlich sind und ihre Auftrennung ausschließlich präkonzeptionell erfolgt. Da der gesetzlich zugelassene Indikationsbereich zu gegebenem Zeitpunkt auf die wenigen X-chromosomalen Erkrankungen begrenzt ist, werden im Kontext der Spermienselektion auch kaum Befürchtungen bezüglich negativer gesellschaftlicher Auswirkungen artikuliert. 127 Zur Beschreibung der verschiedenen Methoden s. auch Nawroth et al. (2000) S.67. vgl. Sills et al. (1998) S.111 f.. 129 vgl. Schulman und Karabinus (2005) S.113. Das Angebot dieser Methode erkläre lt. Harper et al. (2008a) S.746 auch, warum die PID weniger zur Selektion weiblicher als männlicher Nachkommen eingesetzt werde. 130 vgl. Kuliev et al. (2006) S.332 unter Berufung auf eine Untersuchung von Willadsen et al. (2003). 128 Anwendung der PID 89 Mit der Abtreibung nach Pränataldiagnostik als gesellschaftlich akzeptierter, ethisch dennoch umstrittener Methode, um die Geburt eines kranken Kindes bzw. kranker Kinder zu verhindern und die eines genetisch eigenen und gesunden Kindes zu verfolgen, setzen sich Abschnitt 3.1 und 3.2 ausführlich auseinander. Im Fall autosomal-rezessiver und paternal dominant vererbter Erkrankungen bietet sich Risikopaaren außerdem die Möglichkeit der Insemination oder IVF unter Verwendung heterologer Spermien, bei deren Spender das mutierte Gen ausgeschlossen wurde. Dabei bringt das Auseinanderfallen genetischer und sozialer Vaterschaft rechtliche und ethische Probleme mit sich. Infolge der Einwilligung des prospektiven Vaters in die Verwendung von Spendersamen zur Behandlung seiner Partnerin muss dieser die Vaterschaft nach deutschem Recht auch außerhalb einer Ehe anerkennen. Sie ist dann nur noch durch das Kind anfechtbar, das aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts Anspruch auf Kenntnis seiner Abstammung hat. Hieraus ergibt sich für Ärzte die Pflicht, Eltern und Spender über mögliche rechtliche Konsequenzen vor Einholung ihres informed consent aufzuklären, sowie die Pflicht, alle Spenderdaten sorgfältig zu dokumentieren und aufzubewahren. Nach einer erfolgreichen Anfechtung kann der Samenspender mit Hilfe eines gerichtlichen Vaterschaftsnachweises identifiziert und rechtlicher Vater des Kindes werden.131 Der Darstellung der Bundesärztekammer zufolge gelte das Angebot der heterologen Befruchtung in Deutschland aufgrund der aufgezeigten Schwierigkeiten hauptsächlich für verheiratete Paare, um „dem so gezeugten Kind eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen zu sichern.“132 In anderen Ländern wie z.B. Italien besteht ein grundsätzliches Verbot des heterologen Systems.133 Als Begründung führt Carbone an, dass das Zusammenfallen genetischer und sozialer Elternschaft dem Schutz des Kindes diene, da die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, die ihre Eltern nicht kennen, gefährdet sei. Die heterologe Befruchtung verursache dem Paar Beziehungsprobleme und dem Kind Probleme hinsichtlich seiner Herkunft und Identität insbesondere wegen unbekannter genetischer Risiken im Spendergenom. Ihre langfristige Folge sei die Auflösung des Familienkonzepts.134 Auch D’Agostino spricht von einer „Verflüchtigung der Elternschaft“ und einer Beeinträchtigung der personalen Identität des Kindes durch die Konfrontation mit multiplen primären Bezugspersonen.135 Der Hinweis, dass ohnehin neue Formen des Zusammenlebens in Beziehungen und Partnerschaften das traditionelle Familienmodell zu verdrängen drohen, also viele Kinder nicht mehr bei beiden leiblichen Eltern aufwachsen, ist zwar 131 vgl. Bundesärztekammer (2006). s. ebd. S.1400. 133 vgl. bei La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (2004) Art.4.III der Legge 40. 134 vgl. Carbone (2005). 135 vgl. Graumann (2003) mit Übersetzung der Äußerung D’Agostinos. 132 90 Anwendung der PID berechtigt, legitimiert aber noch nicht die willkürliche Herbeiführung einer für das Kind schwierigen Situation. Ferner rührt er nicht an der moralischen Verpflichtung, problematische Aspekte der Kindes- und Partnerschaftsentwicklung vor dem Einsatz von Spendersamen zu reflektieren und der Tragfähigkeit der elterlichen Beziehung Beachtung zu schenken. Neben der Samen- stellt theoretisch auch die Eizellspende eine Möglichkeit dar, die Übertragung autosomal-rezessiver und maternal X-chromosomal und dominant vererbter Erkrankungen zu verhindern. Sie ist allerdings in Deutschland verboten, da die gespaltene Mutterschaft mit einer nachhaltigen Prägung des Kindes sowohl durch sein Erbgut als auch durch die enge Bindung zur Mutter während der Schwangerschaft negative Auswirkungen auf die Identitätsfindung und psychische Entwicklung vermuten lässt.136 Außerdem ist die Gewinnung frischer Eizellen mit einem Risiko für die Spenderin verbunden, während ihre Kryokonservierung nach wie vor wenig erfolgreich ist. Noch einen Schritt weiter als die Gametenspende geht die Adoption verwaister, kryokonservierter Embryonen durch Risikopaare. Sie führt zu einer kompletten Spaltung genetischer und sozialer Elternschaft. Dabei verspricht sie einerseits die Rettung der Embryonen vor der Vernichtung im Labor. Andererseits ist sie ebenso wie die Gametenspende mit rechtlichen und ethischen Probleme behaftet. Besonders die Abstammungsfrage mit ihren möglichen psychischen und rechtlichen Konsequenzen für alle Beteiligten ist in ihrer Komplexität schwer zu erfassen und zu bewerten. Räumt z.B. ihre Anteilnahme am Schicksal ihrer Embryonen den genetischen Eltern ein Mitspracherecht im Fall eines Schwangerschaftskonflikts nach einer PND ein? Prinzipiell wäre vor einer Zulassung der Embryonenadoption auch zu klären, welche Anforderungen an die Empfängerpaare zu stellen und welche Informationen über Herkunft, Spenderpaare und genetische Beschaffenheit der Embryonen notwendig und ethisch vertretbar sind. Dabei darf die Gefahr einer Kommerzialisierung, d.h. einer maximalen Instrumentalisierung menschlicher Embryonen, nicht verkannt werden. Ihre Zeugung zum Zweck der Adoption stünde im Konflikt mit dem graduellen und personalen Statusmodell und wäre daher nicht akzeptabel. Einem Embryonenhandel wäre durch eine gesetzliche Begrenzung der Adoption auf nach einer IVF verwaiste Embryonen vorzubeugen. In der klinischen Praxis wird die Etablierung einer Schwangerschaft durch die „genetische Differenz“ zwischen Mutter und adoptiertem Embryo erschwert.137 Die Implantationsrate ist deshalb schlechter als bei Verwendung eigener Embryonen. Außerdem ist, wie angedeutet, auch nach einer Embryonenspende von einer komplizierten Identitätsfindung der geborenen Kinder auszugehen, die ihr Wohl gefährdet und ihre Position schwächt. Nach wie vor 136 vgl. Bundesärztekammer (1998b) S.3171. Anwendung der PID 91 sollte also die Vermeidung überzähliger Embryonen das vorherrschende Anliegen der Reproduktionsmedizin sein.138 5.2.4 Nicht-diagnostische Alternativen Die Adoption eines Kindes stellt eine weitere Handlungsoption für Risikopaare dar. Ihr wesentliches Ziel ist die Sicherung des Wohls elternloser und vernachlässigter Kinder. Allerdings hat sich ihre ursprüngliche Funktion als Kinder- und Jungendhilfe, bei der vor allem die Schwäche und die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund standen, im Laufe der Zeit gewandelt. Heute wird sie zunehmend zum Hilfsangebot für unfruchtbare und Risiko-Paare, auf die der Fokus des Verfahrens gerichtet ist. Häufig entscheiden diese sich erst nach mehreren erfolglosen Zyklen künstlicher Befruchtung für die Annahme eines fremden Kindes, dem sie ihre Liebe und Fürsorge schenken können. Der Weg der Adoption erscheint gleichsam als „ultima ratio“. Reich und Nagel nennen indes den „Verzicht auf Elternschaft“ aus „Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben“ als den ihrerseits bevorzugten Entschluss betroffener Paare.139 In der Realität findet die Möglichkeit, Entscheidungskonflikte z.B. nach PND durch Adoption oder den bewussten Verzicht auf Kinder zu vermeiden, angesichts der Realisierbarkeit des Wunsches nach einem genetisch eigenen gesunden Kind wenig Akzeptanz.140 Es bleibt zu prüfen, inwiefern eine umfassende Beratung der Paare daran etwas ändern kann. 137 s. Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz (2006) S.112. Mit den im Rahmen der PID anfallenden überzähligen Embryonen beschäftigt sich Abschnitt 6.2.3. 139 s. Nationaler Ethikrat (2003) S.108. 140 vgl. hierzu Schuth, Neulen,Breckwoldt (1989) S.210 f. und Maio (2001) S.895. 138 92 Befürchtete Folgen der PID 6. Befürchtete Folgen der Präimplantationsdiagnostik 6.1 Veränderungen in der Medizin Die molekulargenetische Forschung hat durch stetig zunehmende Kenntnisse über die Zusammensetzung und Funktionsweise des menschlichen Genoms bereits große Veränderungen in der Medizin und im Krankheits- und Gesundheitsverständnis herbeigeführt. Vor diesem Hintergrund sind die Rollen von Arzt und Patient einschließlich ihrer moralischen Rechte und Pflichten im allgemeinen und insbesondere in der Situation der Präimplantationsdiagnostik zu betrachten. Außerdem soll in diesem Zusammenhang der Einfluss der Kommerzialisierung auf die Handlungsabläufe innerhalb des Gesundheitswesens angedacht werden. 6.1.1 Prädiktive Medizin, Gesundheits- und Krankheitsbegriff Grundlage der sogenannten prädiktiven1 Medizin ist die genetische Information der Patienten, der jedoch keine eindeutige Korrelation mit deren Phänotyp im Sinne eines genetischen Determinismus zugeschrieben werden kann. Vielmehr sind die Gene als nur einer von unzähligen Kausalfaktoren anzusehen, deren Zusammenspiel den Phänotyp festlegt oder die notwendige Bedingung für den Ausbruch einer Krankheit darstellt. Die Komplexität dieses Zusammenspiels und seiner Auswirkungen sowie der unbekannte oder unvorhersehbare Einfluss externer Faktoren erschweren die Interpretation genetischer Befunde und machen exakte Vorhersagen unmöglich. Dies gilt für multifaktorielle Erkrankungen in stärkerem Maß als für monogene und betrifft selbstverständlich auch die Ergebnisse der PID.2 Doch Rehmann-Sutter zufolge könne „der Zugang der Medizin [...] durch und durch pragmatisch sein und sich am Status des empirisch feststellbaren Korrelationsverhältnisses orientieren.“3 [Hervorhebung übernommen, A.S.]. Dementsprechend erfolgt eine Einteilung getesteter Patienten bzw. Embryonen in Risikoklassen anhand bekannter, in ihrem Genom identifizierter Faktoren, die sie für die Entwicklung bestimmte Eigenschaften prädisponieren.4 Der einzelne Patient bzw. das Risikopaar erfährt dabei stets nur von Wahrscheinlichkeiten, mit denen er bzw. sein Nachwuchs an Krankheit X oder Y erkranken wird. 1 Wiesing (1999) S.99 differenziert folgendermaßen: ‚prädiktiv’ meine die „Ausrichtung [der Medizin] zu einem bestimmten Zeitpunkt“, ‚präventiv’ „ihre Ausrichtung zu einem späteren Zeitpunkt.“ 2 vgl. hierzu Graumann (1998) S.404. 3 s. Rehmann-Sutter (1998) S.419. 4 Rehmann-Sutter sieht bereits in dem Begriff der Prädisposition die Annahme, dass die DNA vorherrschender Kausalfaktor sei. Es sei darauf hingewiesen, dass hier seine Verwendung ohne jegliche Gewichtung erfolgt. Befürchtete Folgen der PID 93 Es ist zum Teil umstritten, ob und wann bestimmten Prädispositionen ein Krankheitswert zugeschrieben werden kann, der die Betroffenen zu Prä-Patienten oder Risiko-Kranken macht. Die genetischen Merkmale, die im Zusammenhang mit einer restriktiven Zulassung der PID diskutiert werden, sind von diesen Unsicherheiten allerdings weniger betroffen. Trotzdem ist es notwendig, klar zu stellen, dass die Variabilität des menschlichen Genoms eine Beschreibung genetischer Normalität unmöglich macht. Folglich ist auch die Definition eines daran orientierten genetischen Gesundheitsbegriffs, der zum Selektionskriterium für Embryonen werden könnte, ungeeignet. Krankheit lässt sich demnach nicht als eine Abweichung von der genetischen Norm beschreiben. Selbst der empirische Nachweis einer körperlichen Dysfunktion gibt nur einen Aspekt des Krankseins wieder. Durch die molekulare Medizin besteht heute die Möglichkeit, pathologische Vorgänge im Körper vorherzusagen oder zu erkennen, bevor sie klinisch bemerkbar werden. Hierdurch wächst der Abstand zwischen der naturwissenschaftlichen Komponente und dem subjektiven Erleben von Kranksein. Doch gerade letzteres ist für unser heutiges Krankheitsverständnis co-konstitutiv. Die Wahrnehmung von Kranksein unterliegt dabei dem Einfluss des gesellschaftlichen Krankheitsbildes und der Fremdwahrnehmung. Mit der „‚Selbsteinschätzung als hilfsbedürftig’“ konkretisiert Wiesing dieses Kriterium, dem er angesichts der moralischen Konsequenzen einer Anwendung des Krankheitsbegriffs und der darin implizierten Bezeichnung eines Zustands als „veränderungswürdig“ besondere Bedeutung beimisst. „’Krankheit’ [ist] nicht nur ein deskriptiver Begriff, sondern ein bewertender, mit dem weitere Handlungen initiiert und legitimiert werden sollen.“5 Lanzerath und Honnefelder ergänzen die Generation dieses „praktischen Krankheitsbegriffs“ um die Arzt-Patienten-Beziehung und verkünden: "Ein an [...] [diesen] gebundenes ärztliches Handeln bleibt ein Handeln am kranken Menschen und wird nicht ausschließlich durch gesellschaftliche Normvorstellungen oder individuelle Bedürfnisse zur Lebensqualitätsverbesserung geleitet und damit zur beliebigen Serviceleistung ausgeweitet."6 [Hervorhebung auch im Original, A.S.] Kehren wir aber zurück zur Problematik der prädiktiven Medizin: Ausgehend vom Screening des gesamten Genoms z.B. mittels DNA-Chips könnte in Zukunft für jedes Individuum, auch das ungeborene, ein Prädispositionsprofil erstellt werden, in dessen Kenntnis seine Entwicklung mit bestimmten Fokussen medizinisch verfolgt und bei Bedarf präventive oder frühe therapeutische Maßnahmen eingeleitet werden könnten.7 Prädiktives Wissen nützt der Gesundheitserhaltung und Krankheitsverhütung und bietet dem Einzelnen die Möglichkeit, sein 5 s. Wiesing (1998) S.81 f.. So basiert die Legitimation der IVF auf der Anerkennung der Sterilität als Krankheit. Vgl. Abschnitt 3.3. 6 s. Lanzerath und Honnefelder (1998) S.71 und 74. 94 Befürchtete Folgen der PID Leben im eigenen Interesse danach auszurichten. In dieser Hinsicht kann es als Hilfeleistung aufgefasst werden, solange der Entscheidungsspielraum des Betroffenen unangetastet bleibt. Es besteht jedoch auch ein gesellschaftlich-ökonomisches Interesse an individuellem präventiven Verhalten. In diesem steckt die Gefahr, dass aus dem vom Autonomierecht abgeleiteten Recht auf Prävention ein sozialer Zwang zur Inanspruchnahme genetischer Tests und zu einem an das Ergebnis angepassten Lebensstil entsteht. Diese unfreiwillige Einschränkung der Handlungsoptionen bedeutete aber Heteronomie. Genom-Screening-Untersuchungen der Bevölkerung institutionalisierten schließlich diesen Zwang, da ihre Teilnehmer nicht primär autonom motiviert wären,8 sondern durch die bloße Zuordnung zu einer Risikogruppe zu einer Entscheidung gedrängt würden. Unabhängig davon ist zu bedenken, dass nicht jedem Menschen ein positiver Umgang mit dem eigenen genetischen Risiko gelingt und dass sich aus diesem längst nicht immer Handlungskonsequenzen ableiten lassen. Das Wissen z.B. um die Trägerschaft einer autosomaldominant vererbten Erkrankung wie der Chorea Huntington kann die Betroffenen in eine psychisch-existenzielle Krise stürzen. Außerdem könne prädiktives Wissen, so Rehmann-Sutter, zu einer Entfremdung des Leibs führen und dessen Wahrnehmung als „Summe von Risikofaktoren“ bedingen, mit der wir umgehen und die wir in unsere Lebensgestaltung integrieren müssten.9 Wegen seiner schweren Interpretierbarkeit und der unkalkulierbaren Ambivalenz seines Ergebnisses ist ein komplettes Genom-Screening daher kaum zu befürworten. Beschränken sich genetische Tests hingegen auf Merkmale, deren Nachweis dem Untersuchten eindeutige Vorteile bringt, und beruht ihre Durchführung auf dessen autonomer Entscheidung, scheinen sie moralisch akzeptabel. Zu klären bleibt dennoch, welcher Umgang mit den gewonnenen Daten moralisch zulässig ist, deren Weitergabe zu einer genetischen Diskriminierung z.B. durch Versicherer und Arbeitgeber auch im Bezug auf die Familienplanung des Untersuchten führen könnte. 6.1.2 Das Recht auf (Nicht-)Wissen und die Pflicht zu wissen Innerhalb des Systems der prädiktiven Medizin stellt sich die Frage, ob und wann Patienten bzw. Ratsuchenden ein Recht auf Wissen bzw. Nichtwissen haben und inwiefern sie sogar moralisch verpflichtet sind zu wissen. Grundsätzlich ist das Recht auf informationelle Autonomie direkt betroffenen Handlungssubjekten vorbehalten. Im medizinischen Kontext findet es ebenso wie 7 vgl. Recchia (2000), der vor allem auf die Pharmakogenetik eingeht, die es ermögliche, medikamentöse Therapien anhand genetischer Informationen auf den Organismus des einzelnen Patienten abzustimmen. 8 vgl. Henn und Schroeder-Kurth (1999) S.1555. Mit dem Einsatz von Screening-Programmen infolge der Einführung der PID beschäftigt sich auch Haker (1999). 9 vgl. Rehmann-Sutter (1998) S.434. Er spricht hier von der neuen Tugend der genetischen Souveränität. Befürchtete Folgen der PID 95 das Recht auf reproduktive Autonomie seine Begrenzung in der Teleologie ärztlichen Handelns. Für die genetische Diagnostik sollte daher das Prinzip des „bonum facere“ durch Gesundheitsförderung oder Verhinderung von Leid erfüllt sein. Ferner ist ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis zu prüfen, das nicht mit einer gerechten Verteilung der Güter im Gesundheitswesen konfligieren darf. Unter diesen Voraussetzungen existiert das Recht, die eigene genetische Veranlagung zu kennen oder aber darauf zu verzichten.10 Das Recht auf Nichtwissen steht dabei im Widerspruch zum Ideal der Autonomie, mit dem eine moralische Verpflichtung zu wissen einhergeht. Dieser Konflikt löse sich jedoch nach Ansicht Quantes auf, wenn man von der Kompetenzzuschreibung des Autonomiebegriffs ausgehe.11 Schließlich bleibt die Fähigkeit zur Autonomie durch das Nichtwissen unberührt. Die Erkenntnis, dass besonders im Fall der Genetik mehr Wissen nicht unbedingt mehr Handlungsfreiheit bedeute, fordere Liening zufolge „eine grundsätzliche Reflexion der Relation von Autonomie und Information“. Er führt hierzu den "Gedanken einer sich selbst begrenzenden, und dadurch erst verwirklichenden Autonomie"12 an. Weitere Begründungsansätze für ein Recht auf Nichtwissen sind der schon beschriebene „hermeneutische Hintergrund des Krankheitsbegriffs“13, die „prinzipielle Begrenztheit des menschlichen Wissens“ mit der daraus folgerbaren Sinnlosigkeit einer Wissenspflicht, die Provokation von Leid und Ausgrenzung sowie die Gefährdung der Privatsphäre bzw. der Integrität des Selbstbildes durch Wissen.14 Nur das Interesse Dritter am Zugang zur genetischen Information einer Person stellt in einigen Fällen das Recht auf Vertraulichkeit und Nichtwissen in Frage. Aus diesem Grund hält Kreß die Anwendung prädiktiver Tests eher für entwürdigend als die PID.15 Eine bewusste Verletzung des Datenschutzes ist z.B. dann denkbar, wenn eine Information Bedeutung für die reproduktive Autonomie anderer hat und in diesem Sinne auch Voraussetzung der Erfüllung ärztlicher Hilfspflicht ist. In jedem Fall bedarf sie einer Rechtfertigung nach sorgfältiger Abwägung der Autonomieansprüche aller Beteiligten unter Einbeziehung der potenziellen Folgen von Wahrung oder Bruch der Vertraulichkeit. Ein Beispiel ist die Geburt eines schwerkranken Kindes, dessen Eltern sich angesichts der großen Belastungen gegen eigene Kinder oder für eine PID entschieden hätten, wenn das Vererbungsrisiko durch die Weitergabe fremder Daten oder durch 10 Die Informationsverweigerung durch den Arzt unter Berufung auf das "therapeutische Privileg" ist dagegen rechtswidrig, wenn nicht schützenswerte Interessen des Patienten, des Arztes oder Dritter geltend gemacht werden können. Vgl. Bundesgerichtshof (1983a) und Bundesgerichtshof (1983b). 11 vgl. Quante (1997) S.221. Vgl. Hierzu Abschnitt 4.1.2. 12 s. Liening (1998) S.196, der hier eine Darstellung Sieps (1993) aufgreift. 13 s. Mieth (1997) S.193. 14 vgl. Chadwick (1997) S.201-205 mit einer detaillierten Aufzählung utilitaristischer und weiterer konsequentialistischer Argumente für ein Recht auf Nichtwissen. 96 Befürchtete Folgen der PID eine eigene Untersuchung bekannt geworden wäre. Hieran wird deutlich, dass „sich für Nichtwissen zu entscheiden, [...] fragwürdig [ist], wenn das fragliche Wissen Konsequenzen für dritte hat.“16 Ein moralischer Anspruch auf dieses Wissen kann die Wissenden zur Information verpflichten. Einige Autoren gehen mit Blick auf eine verantwortliche Fortpflanzung sogar von der Pflicht der Eltern aus, die eigene genetische Konstellation zu kennen. Dass diese allerdings nicht von einem kindlichen Recht auf Nichtexistenz ableitbar ist, wurde bereits im Zusammenhang der Abtreibungsfrage herausgearbeitet.17 Nach Ansicht anderer Diskussionsteilnehmer liege einer solchen Wissenspflicht das gesundheitliche Interesse der kommenden Generation und das ökonomische Interesse der Gesellschaft zugrunde.18 Dieser kommunitaristische Ansatz stellt die Verantwortung des Individuums gegenüber der Gemeinschaft und seine Solidaritätspflicht vor das Recht auf Nichtwissen. Kein sozialer Zwang zur Durchführung genetischer Tests, sondern eine Veränderung des Solidaritätsbewusstseins sei laut Widmer Ausgangspunkt einer gesellschaftlichen Entwicklung in diese Richtung.19 Gemeint ist wohl die Sensibilisierung für genetische Risiken gepaart mit der Haltung, dass eine leichtfertige Inanspruchnahme von Solidarleistungen u.a. durch ein behindertes Kind unmoralisch sei. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass ein solcher Wandel der individuellen Wahrnehmung ohne ein Wirken externer Faktoren, welche die gesellschaftlichen Interessen hervorheben, vonstatten geht. Die Grenze zwischen einem sozialen Zwang und diesen Faktoren ist daher unscharf. Schließlich stellt sich die Frage, ob ein bekanntes genetisches Risiko angesichts bekannter Interessen Dritter nicht implizit eine Handlungskonsequenz fordert. Dass allein die Bewusstmachung der Inkaufnahme eines Vererbungsrisikos mit ihren Folgen für die Gemeinschaft Ziel des Wissens aus einem genetischen Test sein soll, scheint unwahrscheinlich. In jedem Fall ist eine Beeinträchtigung autonomer Entscheidungen durch internalisierte gesellschaftliche Werte dieser Art schwer aufzuspüren.20 In Abschnitt 6.4.3 erfolgt eine weitere Vertiefung des hier schon angerissenen Solidaritätsgedankens. Derzeit ist der erwartete Bewusstseinswandel nur zu vermuten, während sich die Einführung genetischer Tests durch Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen schon ankündigt. Sie wird begleitet von der Angst vor Diskriminierung sowohl derjenigen, deren Untersuchungsergebnis Prädispositionen für bestimmte Erkrankungen aufzeigt, als auch derjenigen, die ihr Recht 15 vgl. Kreß (2002a) S.185 f.. s. Chadwick (1997) S.205. 17 vgl. Abschnitt 3.2.2 dieser Arbeit. 18 vgl. Chadwick (1997) S.199 als mögliche Begründung für den Standpunkt von Kieselstein und Sass (1992). 19 ebd. S.206 mit einem Zitat von Widmer. 16 Befürchtete Folgen der PID 97 auf Nichtwissen wahrnehmen. Möglichkeiten, dieser Tendenz zur „Test-Pflicht“ entgegenzuwirken, stellen Information und Aufklärung der Öffentlichkeit sowie entsprechende gesetzliche Verbote dar. Die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme genetischer Diagnostik bleibt weiterhin im Rahmen einer sie begleitenden Beratung zu überprüfen. Einzige Ausnahme hiervon ist das Neugeborenen-Screening auf früh behandelbare genetische Erkrankungen.21 Paaren wird folglich kein generelles Recht zugesprochen, die genetische Konstellation ihrer Nachkommen zu erfahren, solange es nicht um Anlagen geht, welche in ihrem Lebenskontext die Durchführung eines Abbruchs oder einer PID indizieren könnten. Nur diese genetische Information eröffnet nämlich den prospektiven Eltern die Möglichkeit zu einem Handeln, das „nicht durch die Rechte möglicher Personen, sondern durch die moralische Integrität, die Selbstachtung und somit einen Aspekt der normativen Würde der Eltern gefordert“ [wird], zu einem Handeln, „das die Eltern sich schulden“22 [Hervorhebung übernommen, A.S.]. 6.1.3 Ärztliches Handeln bei der Durchführung der PID Zu den Auswirkungen prädiktiver Informationen auf die ärztliche Tätigkeit23 bemerkt Wiesing: „Wissen wird in der Medizin nicht einfach nur genutzt, sondern Wissen präformiert ärztliches Denken und Handeln, es eröffnet Optionen und verschließt sie.“ Durch eine Konzentration des medizinischen Interesses auf genetische Konstellationen drohe eine „Verengung des Sichtfeldes“ und damit einhergehend eine Reduktion der (Be-)Handlungsoptionen.24 Dieser Aspekt kann vor allem im Hinblick auf die „klassische“ Situation der Medizin geltend gemacht werden, in der ein Arzt auf einen Kranken trifft, dessen Leid er gemäß seinem Auftrag zu lindern versucht. Eine Fixierung auf den genetischen Befund wird dabei der interindividuellen Diversität u.a. hinsichtlich Biographie, Umwelt- und psychischer Faktoren nicht gerecht. Diese aber sollte in einem therapeutischen Ansatz Berücksichtigung finden. Ausgehend von einem Gesundheitsmodell, das außer auf der Abwesenheit physischer Gebrechen auch auf funktioneller Kapazität und Wohlbefinden basiert, fördert die prädiktive Medizin die Arztrolle des „Gesundheitspromotors“.25 Im Unterschied zur bisherigen Präventivmedizin, die zwecks primärer Prävention nur auf allgemeine, an der Krankengeschichte und Familienanamnese ausgerichtete Ratschläge zurückgreifen 20 Woopen (2000) S.120 prophezeit nach Testart und Sèle (1995) eine Orientierung der einzelnen „an den Vorgaben eines ‚social engineering’ zwischen biomedizinischer Macht und sozialer Planung“. Vgl. Abschnitt 6.5.4. 21 vgl. Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik e.V. (2001) S.49. 22 s. Steigleder (1998) S.113 f.. 23 Unter ärztlicher Tätigkeit werden hier auch Aufgaben verstanden, die andere Mitarbeiter des medizinischen Apparats im Auftrag eines Arztes übernehmen. 24 s. Wiesing (1998) S.80. 98 Befürchtete Folgen der PID konnte, bietet sich durch die Kenntnis der genetischen Dispositionen die Möglichkeit einer detaillierten individuellen Gesundheitsberatung und -erziehung. Auch im Kontext der Präimplantationsdiagnostik tritt der Arzt nicht als Heiler, sondern als Informationsgarant und Berater meist körperlich gesunder, aber dennoch hilfsbedürftiger Risikopaare auf. Weder eine aktuelle Krankheit, noch ein Präventionsbedarf der Patienten selbst liefert hier einen offensichtlichen Anlass zu ärztlichem Handeln. Vielmehr geht es um das Erkrankungsrisiko einer möglichen dritten Person, das vermindert bzw. ausgeschaltet werden soll. Mieth beobachtet, dass "gerade der Bereich sog. prädiktiver und daraus abgeleiteter präventiver Medizin [...] ja keinen therapeutischen sondern einen selektiven Zug [enthält].“26 So ist auch die PID zum heutigen Zeitpunkt keine Diagnostik mit anschließender Therapie der betroffenen Embryonen. Sie übernimmt vielmehr eine präventive Funktion, indem sie eine Gefährdung der elterlichen Gesundheit durch genetische Selektion abzuwenden hilft. Kehren wir aber nochmals zur oben geschilderten Ausgangssituation zurück: Zunächst ist der Arzt nur dem Paar gegenüber verantwortlich, dem er bei einer autonomen Entscheidungsfindung hilft. Ob er anschließend für eine fehlerhafte oder unvollständige Beratung haftbar gemacht werden kann, ist derzeit unklar, aber mit Blick auf die Rechtsprechung im Bereich der PND durchaus denkbar.27 Angesichts des fehlenden aktuellen Konflikts entsteht der Eindruck, dass ein Arzt, der mit einem Paar einen Behandlungsvertrag über eine PID abschließt, die Rolle eines Dienstleisters ohne Arztvorbehalt übernimmt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man den Eltern mit Bezug auf ihren Wunsch, mittels IVF zu einem eigenen gesunden Kind zu kommen, eine „‚Produktmentalität’“28 unterstellt. Während ein Schwangerschaftskonflikt nach Pränataldiagnostik von ärztlicher Seite eine Reaktion auf eine vorgefundene Situation fordert, verlangt die PID eine Aktion. Trotz gegebener Alternativen und in Kenntnis des Vererbungsrisikos zeugt der Arzt In-vitro-Embryonen unter Vorbehalt. Dabei trägt er als Anordnender bzw. Durchführender allein die moralische Verantwortung für das gesamte Prozedere und dessen Ergebnis. Er schafft so aktiv eine Konfliktlage, in der er, immer noch durch den therapeutischen Auftrag des Paares gebunden, jetzt auch für die gezeugten Embryonen verantwortlich ist. Dabei ist von vornherein klar, dass seine Arztpflicht, Leben zu erhalten, seiner vermeintlichen „Service-Verpflichtung“, Leid abzuwenden, nachgeordnet ist. Ein Arzt, der Embryonen Person- 25 vgl. Recchia (2000) S.115. s. Mieth (1999) S.79. 27 vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs (1984) und Urteil des Bundesgerichtshofs (1994). 28 vgl. Rösler (2000). 26 Befürchtete Folgen der PID 99 status zuschreibt, muss daher die Durchführung einer PID unter Berufung auf seine moralische Autonomie ebenso wie eine Abtreibung verweigern können. An der Präimplantationsdiagnostik, so beschreibt Mieth die Situation, in die sich der Arzt durch sein eigenes Handeln bringt, sei „neu [...], dass ein diagnostischer Sachverhalt ohne oder nur mit begrenzten Möglichkeiten des Helfens und Heilens zu einer Aktivität führt, die mit dem Medizinberuf eigentlich ausgeschlossen sein sollte: zum Töten.“29 Die Vernichtung kranker Embryonen bestimmt bereits die Anzahl der entnommenen und befruchteten Eizellen. Sie ist methodisch von Beginn an eingeplant, denn ein Transfer von bis zu zwölf Embryonen bedeutete ein nicht verantwortbares Mehrlingsrisiko. Ob die Vernichtung durch aktives Verwerfen oder passives Liegenlassen geschieht, ändert nichts daran, dass sie von ärztlicher Seite zu verantworten ist. Die Embryonen werden in vitro gezeugt, d.h. an einem ungastlichen Ort, an dem sie ohne weitere Hilfe nicht überleben können. Die besondere Verantwortung, die der Arzt für die Existenz der Embryonen trägt und derer er sich bewusst sein muss, setzt das passive Vernichten dem aktiven gleich, da es vor diesem Hintergrund eine gezielte Handlung darstellt. Niemand in einem demokratischen Rechtstaat habe jedoch, so Schockenhoff, das Recht, zu erzeugen, um zu töten. Hierin bestehe eine Grenzüberschreitung, die unsere Einstellung zum Leben entscheidend verändere.30 Doch, obwohl der Staat Embryonen per Gesetz unter einen besonderen Schutz stellt, übt gerade die Rechtsprechung Druck auf Ärzte aus.31 Wenn diese dann aufgrund ihrer Haftbarkeit für „Familienplanungsschäden“ eine defensive Haltung einnehmen, führen auch unsichere Diagnosen und Prognosen zu Schwangerschaftsabbrüchen bzw. zur Verwerfung von Embryonen. Bei der PID stellt sich dem Arzt außerdem die Frage, ob im Fall einer großen Anzahl gesund diagnostizierter Embryonen sekundäre, nicht im Behandlungsauftrag enthaltene Selektionskriterien wie Heterozygotie, balancierte Translokationen und Geschlecht Beachtung finden sollten. Dieses Vorgehen entspräche allerdings schon einem Überschreiten der Grenze zwischen negativer und positiver Selektion und senkte die Schwelle zu genetischem Enhancement.32 Woopen warnt hier vor einer „technological stigmatization“ und schlägt als Gegenmaßnahme vor, die Zahl der gezeugten Embryonen sowie die Information auf das fragliche Merkmal zu begrenzen.33 Für den entgegengesetzten Fall, dass nämlich alle Embryonen positiv getestet werden und Eltern den29 s. Mieth (1997) S.191. vgl. Schockenhoff (2003) S.387 und 393. Die Auswirkungen der PID auf unser Menschenbild sind Thema in Abschnitt 6.3. 31 vgl. FN 27. 32 vgl. Habermas (2005) S.41 f.. 30 100 Befürchtete Folgen der PID noch einen Transfer wünschen, ist fraglich, ob der Arzt wider seinen eigentlichen Auftrag, Leid zu verhindern, handeln darf. Es geht wohlgemerkt nicht um das Leid des betroffenen Embryos, für den es zum heutigen Zeitpunkt kein alternatives, leidfreies Leben gibt, sondern um das antizipierte Leid der Eltern. Diese ändern in der beschriebenen Situation ihre Haltung bezüglich ihrer Belastbarkeit und entziehen somit der Durchführung der PID nachträglich ihre Legitimation. Ausgehend von einer autonomen elterlichen Entscheidung für diesen Transfer erfolgt auch die Aufhebung des Konflikts: Embryonales Lebensrecht und das Recht des Paares auf gesundheitliche Integrität konfligieren nicht länger miteinander. Außer in Notlagen verpflichtet ersteres den Arzt ohnehin, Embryonen trotz deren gesicherter Anlageträgerschaft zu übertragen. Ein abschließender Embryotransfer kann in jedem Fall nur mit dem informed consent der Mutter, aber niemals gegen ihren Willen erfolgen. 6.1.4 Die Rechtfertigung ärztlichen Mitwirkens an der PID Das ärztliche Handeln bei einer PID ist in vielerlei Hinsicht rechtfertigungsbedürftig: Es gilt den Vorwurf einer reinen Dienstleistung auszuräumen und einen Legitimationsansatz für die Embryonenvernichtung sowie gesondert für das Herbeiführen der Konfliktlage zu nennen. Zunächst besteht der ärztliche Auftrag darin, antizipiertes Leid abzuwenden. Dabei liegt der Unterschied zu einem Dienstleister im Leitbild des Arztes als Helfer, der die Autonomie des Patientenwunsches respektiert, aber auch hinterfragt und gewissenhaft die Indikation für eine medizinische Maßnahme stellt. Letztere bildet die größte Barriere gegen eine „Beliebigkeitsmedizin“. Durch sie bleibt die PID schließlich eine ärztliche Hilfe, die nur entsprechend hilfsbedürftigen Paaren zuteil wird. Hintergrund dieses Hilfsangebots ist, wie schon erwähnt, die Vorannahme eines graduell ansteigenden Embryonenschutzes. Diese führt nicht etwa zur Ausblendung des Untergangs von Embryonen34, sondern zu einer Bewertung, die dem Arzt die PID im Vergleich zu PND und Tötung eines möglicherweise schon lebensfähigen Fetus als „geringeres Übel“ erscheinen lässt. Es existiert die Meinung, dass die Risiken und Belastungen der PID für die Gesundheit der Frau und womöglich auch die des Kindes größer seien als ihr Nutzen und dass diese Methode folglich gegen das Prinzip der Schadensvermeidung verstoße.35 Ohnehin gebe es für die Frauen schonendere Alternativen wie z.B. die heterologe Insemination, so dass die PID nicht das Kriterium der besten Behandlungsmethode erfülle.36 Dem ist entgegen zu halten, dass diese schonenden Alter33 s. Woopen (2000) S.129 f.. vgl. Schockenhoff (2003) S.389, der die PID ein „Spiel auf Leben und Tod“ nennt, „dessen Gesamtbilanz nur positiv erscheint, weil die zerstörten Lebensperspektiven auf der Verliererseite ausgeblendet bleiben.“ 35 vgl. auch Woopen (2000) S.124. 36 vgl. Schroeder-Kurth (2000) S.128. 34 Befürchtete Folgen der PID 101 nativen nach wie vor nicht ausreichend akzeptiert sind, um Schwangerschaften auf Probe zu verhindern. Das Abwägen zwischen zwei sehr belastenden Verfahren - einem möglichen Spätabbruch und einer PID - und ihre Bewertung obliegt jedoch allein den Frauen, zumal es bisher keine Beweise für Schädigungen der Mütter oder Kinder durch eine PID gibt. Hinsichtlich der Wahl des „geringeren Übels“ stellt Schroeder-Kurth die Frage, ob sich die Proponenten der PID nicht erpressbar zeigten, wenn sie ihre Anwendung anhand der sonst drohenden Alternative begründeten.37 Dieser Anmerkung soll hier mit Blick auf eine mögliche Erpressbarkeit der Ärzte bei Zulassung der PID nachgegangen werden: Tatsache ist, dass auch die medizinische Indikation als Voraussetzung eines Spätabbruchs von Ärzten gestellt wird und dass ihr Rechtfertigungsansatz mit dem der PID identisch ist. Für den Einzelfall einer genetisch verursachten, erblichen Erkrankung ist daher schwer einzusehen, warum PND- und PIDIndikationen voneinander abweichen, warum Ärzte also die medizinische Indikation zur PND großzügiger handhaben sollten.38 Die Einschaltung einer staatlichen Behörde als oberstes Kontrollorgan, das über die Durchführung einer PID entscheidet, hilft prinzipiell, Ärzte vor Erpressung durch einzelne Risikopaare zu schützen. Aus ärztlicher Sicht ist außerdem darauf zu bestehen, dass weder im Fall einer PID noch im Fall eines Abbruchs die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme von einem Arzt erzwungen werden kann. Idealer Weise erklärt sich nur der Arzt, der aus der Antizipation der anschließenden Güterabwägung heraus eine PID als indiziert und angesichts der sonst vom Paar herbeigeführten Schwangerschaft auf Probe als kleineres Übel ansieht, bereit, die Verantwortung für Zeugung, Selektion und Verwerfung menschlicher Embryonen zu tragen. Gefährdet wird die ärztliche moralische Autonomie weniger durch Drohungen von Seiten der Patienten als vielmehr durch die bereits erwähnte Rechtsprechung und den zunehmenden Wettbewerb im Gesundheitswesen. Durch letzteren rückt der ökonomischen Aspekt ärztlicher Entscheidungen zusehends in den Vordergrund, obwohl eine Kommerzialisierung des Arztberufs dem ärztlichen Selbstverständnis eigentlich entgegen steht.39 Es geht nicht mehr nur darum, medizinisch indizierte und ethisch gerechtfertigte, sondern auch wirtschaftlich rentable Maßnahmen durchzuführen. Besonders den an die Ärzteschaft gerichteten Forderungen aus Wissenschaft, Politik, Pharma- und Medizintechnik-Industrie kommt in diesem Kontext Bedeutung zu. Die notwendige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit einer Praxis oder Klinik setzt den einzelnen Arzt unter Druck, Machbares anzubieten, wenn es sich am Ende für ihn direkt oder indirekt be- 37 vgl. ebd. S.129. Zum Vergleich von PID und PND auch Kapitel 3.1 dieser Arbeit. 39 vgl. Bundesärztekammer (2006a) S.27. 38 102 Befürchtete Folgen der PID zahlt macht. Er gerät so in Dilemmata, in denen er zwischen einer seiner Ansicht nach unmoralischen Behandlung und eigenen beruflichen Nachteilen entscheiden muss. Solange diese Entscheidung bei ihm liegt, ist er für sie und ihre Konsequenzen moralisch verantwortlich. Daran ändern auch wirtschaftliche oder soziale Zwänge nichts. Der Patient gewinnt im Zuge der Kommerzialisierung an Einfluss und kann über seine Nachfrage das Angebot der Medizin und insbesondere das Angebot privat zu vergütender Leistungen steuern. Ob die PID zu letzteren zählen oder ihre Kosten von den Krankenkassen übernommen werden sollten, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass sich ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis aufgrund des hohen technischen Aufwands bei geringer Fallzahl und der dennoch geringen Baby-take-home-Rate eher ungünstig darstellt. Die hier aufgezeigten Faktoren, die auf Ärzte einwirken können, machen deutlich, dass eine wie auch immer gearteten Sicherung des ärztlichen Entscheidungsspielraums anzustreben ist. 6.1.5 PID-Tourismus Abschließend sei noch auf eine Überlegung hingewiesen, die sich aus einem (fort)bestehenden PID-Verbot ergibt: Risikopaare reisen als PID-Touristen in die Länder, in denen die Anwendung der PID legal ist.40 Auf dieser Feststellung beruht das Argument, dass das PID-Verbot keinen Sinn mache und sogar soziale Ungerechtigkeit fördere, indem es finanziell besser gestellten Paaren einen Vorteil verschaffe. Entkräftigend wirkt hier allerdings schon der Einwand, dass sich die nationale Gesetzgebung dann der weltweit liberalsten Regelung anpassen müsste41 - und dies könnte in zahlreichen anderen Bereichen ebenso gefordert werden. Dennoch ist ein Bemühen um international möglichst einheitliche Regelungen positiv zu bewerten. Das Bestehen unterschiedlicher Gesetzeslagen macht auch in den Verbots-Ländern eine Auseinandersetzung und eine Einigung über den Umgang mit einem möglichen PID-Tourismus notwendig. Mit dem Hinweis auf fehlende oder qualitativ mangelhafte Beratungsangebote im Ausland setzt sich die Arbeitsgruppe „Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz“ dafür ein, dass auch Paare, die eine PID in Erwägung ziehen, in Deutschland betreut und beraten werden dürften. Ärzte sollten also, wenn sie über die PID informieren, weder für Anstiftung oder Beihilfe im Inland42 bestraft noch im Fall ihres Unterlassens haftbar gemacht werden können. Die Intention dieses Ansatzes ist, Risikopaare besonders mit Blick auf „ethische Probleme und alternative Handlungsoptionen zur PID“ zu 40 In einer Studie von Richter et al. (2004) S.327 gaben 16,8 % der Risikopaare an, auf diese Weise ihren Kinderwunsch verwirklichen zu wollen. 41 vgl. Nationaler Ethikrat (2003) S.88. 42 Ausgehend von einem Verbot der PID durch das ESchG kommt gemäß §9 StGB jeder Ort als Handlungs- und Erfolgsort der Straftat in Frage. Daher sind auch Anstiftung und Beihilfe zur PID in Deutschland strafbar. Befürchtete Folgen der PID 103 beraten43 und hiermit einen Beitrag zu ihrem autonomen Entscheidungsprozess zu leisten. Eine geänderte Gesetzgebung, die dieses möglich machte, setzte sich allerdings dem Vorwurf der Doppelmoral aus. 6.2 Rückwirkungen auf die Forschung Die Bedeutung medizinischer Forschung für die Entwicklung neuer diagnostischer, präventiver und therapeutischer Möglichkeiten ist unumstritten. Dennoch ist sie nicht immer ohne weiteres zu befürworten. Insbesondere, wenn es um Experimente am Menschen geht, sind verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen. Einen Sonderfall stellt die verbrauchende Embryonenforschung dar. Dieser Abschnitt setzt sich mit den Verflechtungen von Präimplantationsdiagnostik und Embryonenforschung und den damit verbundenen und daraus resultierenden ethischen Bedenken auseinander. 6.2.1 Die medizinische Forschung am Menschen Das Grundrecht auf freie Forschung ist ebenso wie das Recht auf Autonomie ein Freiheitsrecht. Es findet sich verankert in Art.5.III des deutschen Grundgesetzes. Auch in internationalen Dokumenten wie Art.12 der „Allgemeine[n] Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte“ der UNESCO und Art.15 der Europaratskonvention über Menschenrechte und Biomedizin ist es festgehalten.44 Das Recht auf Forschungsfreiheit ist ein relatives Recht, das Wissenschaftlern erlaubt, staatliche Beschränkungen ihrer Forschung abzuwehren. Eingeschränkt werden kann es - zumindest in Deutschland - nur durch andere Verfassungsgüter, nicht aber durch einfache Gesetze. Der fehlende Gesetzesvorbehalt unterstreicht den hohen Stellenwert der Forschungsfreiheit als Grundrecht aller Bürger, die unter Voraussetzung der entsprechenden Qualifikation eine wissenschaftliche Tätigkeit ausüben wollen. „[D]ie Unterdrückung geistiger Freiheit und Fähigkeit“ könne nämlich, so Sewing, als „Eingriff in die Würde des Menschen“ angesehen werden.45 Zugleich darf ihre Umsetzung insbesondere im Humanexperiment die Würde und personalen Rechte anderer nicht verletzen. Um dies zu gewährleisten wurde mit der Deklaration von Helsinki im Jahr 1964 durch den Weltärztebund die Einrichtung unabhängiger Ethikkommissionen beschlossen. Diesen obliegt die Aufgabe, zu den ihnen vorzulegenden Versuchsprotokollen Stellung zu nehmen, die verantwortlichen Wissenschaftler ethisch zu bera- 43 vgl. Arbeitsgruppe „Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz“ der Akademie für Ethik in der Medizin (2001) S.2089. 44 s. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (1997) und Europarat (1997). 45 vgl. Sewing (2002) S.138. 104 Befürchtete Folgen der PID ten und in bestimmten Fällen ihre Zustimmung zur Versuchsdurchführung zu erteilen. Ebenso steht es ihnen frei, die Ausführung und den Verlauf der Experimente selbst zu überwachen.46 Ziel ihres Einsatzes ist, sowohl Probanden- bzw. Patienteninteressen als auch Wissenschaftler vor Fehlentscheidungen und möglichen Schadensersatzforderungen zu schützen. Außerdem geht es darum, dem Charakter der „eigenen ‚Welten’“, aufgrund dessen medizinische Forschungsinstitutionen zu einer Gefahr für die Menschenwürde werden könnten,47 durch vermehrte Transparenz entgegen zu wirken. Die moralische Beurteilung des angestrebten und erreichten wissenschaftlichen Fortschritts unterliegt einem historisch-gesellschaftlichen Wertewandel.48 Immer wieder stellen neue technische Möglichkeiten des Umgangs mit menschlichem Leben die Frage danach, was (noch) gut für den Menschen bzw. die Menschheit ist. Sie fordern auch innerhalb wertepluralistischer Gesellschaften Wertentscheidungen und eine gründliche Reflexion ihrer Folgen, zumal es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, sich auf klare Rahmenbedingungen für die Forschung zu einigen. Dem „Imperativ des Fortschritts“ werde dabei mit dem „Imperativ der moralischen Vernunft“ begegnet,49 so dass die Akzeptanz von Begrenzungen als Produkt „aufgeklärten Denkens und Handelns“ gelten könne.50 Doch kennzeichnend für die Gegenwart ist auch das Auftreten der Forschung als Wirtschaftsfaktor, als der sie Informationen vermarktet und sich in einem internationalen Wettbewerb bewähren muss. In der medizinischen Wissenschaft tritt so neben die humanitäre eine kommerzielle Ausrichtung. Diese gefährde nach Ansicht der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Freiheit der „Entstehung neuen Wissens“ als Teil der Kultur und löse einen „Entwertungsprozess“ aus.51 Dabei ist Forschung heute weniger denn je eine nationale Angelegenheit. Internationaler Austausch und Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg setzen Politik, Gesetzgebung und die von ihnen abhängigen Wissenschaftler eines Landes unter Anpassungsdruck, um die Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Forschungsstandorts zu sichern. Mieth kritisiert „die Tendenz der Biopolitik zur Forschungsförderung“ und die Aufgabenbeschränkung der dazugehörigen „Bioethik“ auf Missbrauchsvermeidung. Länderübergreifende Regelungen 46 vgl. Weltärztebund (2002) Satz 13. vgl. Höver und Baranzke (2002) S.141. 48 Ein Beispiel hierfür sind Leichenpräparationen, die sich u.a. aufgrund vorherrschender religiöser Weltanschauungen erst in der Renaissance etablierten und heute einen gesellschaftlich akzeptierter Teil der Arztausbildung darstellen. Näheres dazu bei Prüll (1998). 49 Frühwald (2002), zitiert nach Sewing (2002) S.138. 50 s. hierzu Rau (2001) S.17. 51 s. Deutsche Forschungsgemeinschaft (1996) S.VI. Kamp (2004) beschäftigt sich aus verfassungsrechtlicher Perspektive mit der Wissenschaftsfreiheit wirtschaftlich ausgerichteter Forschung in der Arzneimittelindustrie. 47 Befürchtete Folgen der PID 105 griffen mangels einer „Einigung auf Ebene ethischer Theorienbildung“ „auf eine systematische und begriffliche Pragmatik“ zurück.52 Aus dem ärztlichen Auftrag, „der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung“ zu dienen,53 lässt sich eine Rechtfertigung wissenschaftlicher Untersuchungen zum Zweck der Verbesserung der medizinischen Versorgung und der Linderung von Leid herleiten. Diese sind sogar moralisch geboten, wenn sie ihren Teilnehmern unmittelbar therapeutische Hilfe versprechen und sich keine Alternativen bieten. Für Ärzte bedeutet die Aufnahme wissenschaftlicher Tätigkeit die Übernahme einer zusätzlichen Verantwortung, die in Spannung zu ihrer ärztlichen Verantwortung stehen kann.54 Ihr Erfolg kann dabei aus zwei Perspektiven gemessen werden: hinsichtlich ihres Dienstes am einzelnen Probanden und ihres Dienstes an der Gesellschaft mit ihren künftigen Patienten. Aus der moralischen und rechtlichen Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte erklärt sich allerdings, dass grundsätzlich „in der medizinischen Forschung am Menschen [...] Überlegungen, die das Wohlergehen der Versuchsperson (die von der Forschung betroffene Person) betreffen, Vorrang vor den Interessen der Wissenschaft und der Gesellschaft [haben].“55 Doch gerade in den an sie gerichteten Ansprüchen in Form eines allgemeinen theoretischen Erkenntnisgewinns einerseits und der daran geknüpften Hoffnung auf praktische Hilfe andererseits liegt ein der medizinischen Forschung immanentes Problem. Da Experimente stets von einer Hypothese ausgehen, die es zu verifizieren oder falsifizieren gilt, kann auch bei einer Studie zur Erprobung eines neuen Therapieansatzes, die den teilnehmenden Patienten zunächst Nutzen verspricht, dieser erst retrospektiv beurteilt werden.56 Projekte der Grundlagenforschung, deren Ergebnisse niemandem einen unmittelbaren Nutzen in Aussicht stellen, bedürfen von vornherein umso mehr einer Rechtfertigung, als sie Probanden für fremde Zwecke instrumentalisieren, d.h. ihre in der Menschenwürde begründete Unverfügbarkeit missachten. Angesichts der wirtschaftlichen Einflussnahme auf die Konzeption von Humanexperimenten verschärft sich die Problematik ihres Objektstatus weiter. Erst das Einholen des informed consent der Probanden hebt diesen Widerspruch auf. Weitere Bedingungen, die von Humanexperimenten zu erfüllen sind, stellen das Fehlen gleichwertiger Alternativen, eine Risiko-Nutzen-Analyse zugunsten der Probanden und eine unabhängige Bestätigung ihres wissenschaftlichen Wertes und ihrer ethischen Vertret- 52 s. Mieth (1999) S.80. s. §1 Bundesärztekammer (2006a) S.7. 54 vgl. Jachertz (2005) S.548 im Interview mit Fuchs, Geschäftsführer der BÄK. 55 s. Weltärztebund (2002) Satz 5. Ebenso in Art.2 des Übereinkommens des Europarats (1997). 56 vgl. ebd.. Ein Sonderfall stellen Placebo-kontrollierte Studien dar, zu denen sich Satz 29 der Helsinki-Deklaration äußert, der in einem Nachsatz von 2002 noch näher erläutert wird. 53 106 Befürchtete Folgen der PID barkeit dar.57 Für den Fall, dass Probanden von Rechts wegen nicht selbst einwilligen können, ist der informed consent ihrer gesetzlichen Vertreter einzuholen. Außerdem müssen dann „die erwarteten Forschungsergebnisse [...] für die Gesundheit der betroffenen Person von tatsächlichem und unmittelbarem Nutzen [sein]“.58 Die Deklaration von Helsinki fügt dem hinzu, dass „diese Personengruppen [..] nicht in die Forschung einbezogen werden [sollten], es sei denn, die Forschung ist für die Förderung der Gesundheit der Population, der sie angehören, erforderlich und kann nicht mit voll geschäftsfähigen Personen durchgeführt werden.“59 6.2.2 Embryonenforschung Vor diesem Hintergrund kann die verbrauchende Embryonenforschung als Grundlagenforschung an Einwilligungsunfähigen angesehen werden. Es ist anzunehmen, dass sie im Hinblick auf humanspezifische Fragestellungen alternativlos ist. Dennoch fordert ihre noch näher zu erläuternde ethische Problematik, dass ihr die erschöpfende Forschung an anderen Primatenembryonen vorausgeht. Zur Zeit stellen ihre Ergebnisse weder den verwendeten Embryonen noch ihrer Gruppe einen direkten Nutzen in Aussicht, der für eine Legitimierung der Embryonenforschung spräche. Vielmehr instrumentalisiere selbige menschliche Embryonen fremdnützig und verstoße somit, wie ihre Gegner anführen, gegen die Menschenwürde, um neue Erkenntnisse über die frühe menschliche Entwicklung zu gewinnen. Von besonderem Interesse sind dabei Differenzierungsprozesse in Zellen sowie die Ursachen fehlerhafter Differenzierung und Zellteilung, aus deren Kenntnis vielleicht eines Tages neue Therapien entwickelt werden.60 Vor seinem Erwerb ist die Anwendbarkeit dieses Grundlagenwissens in der Praxis jedoch ungewiss. Mieth meint daher, dass angesichts der unzureichenden medizinischen Versorgung der Weltbevölkerung die Durchführung von Embryonenforschung grundsätzlich zu hinterfragen sei.61 In jedem Fall müssen ihre Vorannahmen und Folgen sowohl im Guten als auch im Schlechten, z.B. für den Fall eines Missbrauchs, bereits im Vorfeld verantwortungsvoller Entscheidungen über geplante Forschungsprojekte Berücksichtigung finden. Die Verfolgung „hochrangiger wissenschaftlicher Ziele“ ist in den Augen der Proponenten ein starkes Argument für die Zulassung der Embryonenforschung, ohne die einige Patienten ihrer Chance auf Heilung beraubt wür- 57 vgl. Europarat (1997) Art.16. vgl. ebd. Art.17.II. 59 s. Weltärztebund (2002) Satz 24. 60 Eine besondere Stellung nimmt hier die Gewinnung von und Forschung an embryonalen Stammzellen aus Blastozysten ein. Von ihnen verspricht man sich bahnbrechende Behandlungserfolge vieler Erkrankungen mit irreversiblem Zelluntergang wie z.B. Parkinson, Diabetes und Herzinfarkt. Einen Einblick in die ethische Problematik liefern die Stellungnahme der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz (2006) und eine Studie des Europäischen Parlaments (2000) S.29-37. 61 vgl. Mieth (1997) S.181. 58 Befürchtete Folgen der PID 107 den. Sie zu verhindern, bedeutete, gegen den „therapeutischen Imperativ“ zu verstoßen und sich schuldig zu machen.62 Zunächst ist allerdings die definitorische Unsicherheit der „Hochwertigkeit“ angreifbar, umso mehr, als die therapeutische Relevanz einzelner Studien nur schwer zu beurteilen ist. Ohnehin lasse sich, so die Gegner, aus den „zu erwartenden Erfolge[n] [...] kein ethisches Postulat ableiten“63, denn auch die Methode und nicht nur ihr Ziel verlange eine ethische Rechtfertigung - andernfalls setzte sich dieser teleologische Ansatz dem Vorwurf des reinen Utilitarismus aus. Im allgemeinen Streben nach der Realisierung einer leidfreien Welt sieht Eibach u.a. die Gefahr eines „Zwang[s] zur Gesundheit, der [...] zunehmend zur Bedrohung des Lebensrechts unheilbarer Menschen führen kann und insofern in sich unmoralisch, inhuman ist.“ Hierin zeige sich die „Krise der Ziele medizinischen Fortschritts“.64 Unabhängig von ihrem Nutzen zweifelt Maio bereits die Pflicht zu forschen und Wissen zu erweitern als grundsätzliche Vorannahme einer Forschung an, die infolge einer reinen „Machbarkeitsideologie“ den Verbrauch menschlicher Embryonen in Erwägung ziehe.65 In der Tat ist die Embryonenforschung angesichts ihrer Fremdnützigkeit keinesfalls geboten, sondern lediglich eine Option, die sich, wenn man dem Embryo einen Selbstzweck zuschreibt, wahrzunehmen verbietet. Ausschlaggebend für eine deontolgische Bewertung der Forschung an Embryonen ist der moralische Status, den man diesen zuschreibt. Während das Objekt-Modell die Befürwortung und das Person-Modell die Ablehnung der Embryonenforschung nahe legen, stellt sich bei Annahme des Progredienz-Modells erneut die Frage nach den auf dem Spiel stehenden Gütern. Wissenschaftliches Interesse und Schutz bzw. Förderung der gesamtgesellschaftlichen Gesundheit sind auf der Basis der „Idee der Menschenwürde“ gegen das embryonale Lebensrecht abzuwägen.66 Letzteres steht im Gegensatz zur Situation nach einer PND oder vor einer PID bei hohem genetischen Risiko nicht mit dem Recht auf Unversehrtheit einer Mutter bzw. prospektiver Eltern in Konflikt. Bodden-Heidrich et al. erinnern daran, dass der Straffreiheit von Abtreibungen jedoch allein die subjektive Notlage zugrunde liege. Auch die hohe Prozentzahl natürlich absterbender Embryonen sei nicht mit einem von Menschen zu verantwortenden Handeln vergleichbar - daher könne sie auch nicht dessen Legitimation dienen. Obwohl die Forschung an menschlichen Embryonen für sinnvoller gehalten werde als Schwangerschaftsabbrüche, sei "von etwas objektiv ethisch Verwerflichem - das Gesetz billigt nur Straffreiheit zu - [...] niemals die 62 s. Schott (2002) S.173. s. Bodden-Heidrich et al. (1998) S.145. 64 s. Eibach (2000) S.119. 65 vgl. Maio (2009) S.90. 63 108 Befürchtete Folgen der PID Rechtfertigung für ein Handeln abzuleiten.“67 Der Respekt vor Menschenwürde und Lebensschutz der Schwächsten habe Vorrang vor der Entwicklung neuer Therapien. Darin zeige sich die wahre Humanität einer Gesellschaft.68 Diese Erklärung des Verzichts auf Embryonenforschung zur „sittlichen Pflicht“ ist in den Augen der Gegenpartei nur vorgeschoben. Die eigentliche Ursache des Stillstands in der Wissenschaft und der fehlenden Konkurrenzfähigkeit sieht sie in dem „mangelnden Mut, Neues zu wagen“.69 Angesichts dieser Position ist fraglich, ob die aufgezeigten ethischen Bedenken stärker sind und bleiben als wirtschaftlich attraktive Entwicklungen der Forschung im Ausland. Noch (?) spiegelt die Gesetzgebung zum Embryonenschutz in Deutschland eine ablehnende Haltung wider. §2.I des ESchG verbietet implizit Experimente an menschlichen Embryonen, während die supranationale Regelung in Art.18 des Übereinkommens des Europarats diesbezüglich liberaler ausfällt. Sie besagt lediglich, dass im Fall einer Erlaubnis der Embryonenforschung die nationalen Rechtsordnungen für einen „angemessenen Schutz des Embryos“ zu sorgen haben. Unklar bleibt allerdings auch in den Erläuterungen zu dieser Konvention, welchen Schutzumfang die Verfasser sich unter einer Umsetzung dieses Auftrags vorstellten. Offensichtlich konnte über die Beschaffenheit des embryonalen Schutzanspruchs ebenso wenig wie über ein generelles Verbot oder eine generelle Zulassung der Embryonenforschung ein Konsens erreicht werden. Geeinigt hat man sich nur darauf, dass der menschliche Embryo vor einer unbeschränkten Instrumentalisierung durch die Forschung gesetzlich zu schützen ist. Das hierzu angekündigte erläuternde Embryonenschutzprotokoll steht jedoch nach wie vor aus. Obwohl Art.27 den Vertragsparteien das grundsätzliche Recht zusichert, restriktivere als die nach Inkrafttreten der Konvention geltenden Regelungen umzusetzen, haben Deutschland Österreich und Irland, Länder, in denen Embryonenforschung verboten ist, bis zum heutigen Zeitpunkt die Konvention nicht ratifiziert. Gleiches trifft natürlich auch auf Länder wie Schweden, Belgien und Großbritannien zu, die mittlerweile sogar Klontechniken zur Herstellung von Forschungsembryonen zugelassen haben, eine Maßnahme, auf die im Folgenden noch näher einzugehen ist. Für eine umfassende ethische Bewertung der Embryonenforschung ist letztlich auch die Herkunft der verwendeten Embryonen von Bedeutung. Es sind hier zwei Gruppen zu unterscheiden: eigens dafür erzeugte Forschungsembryonen und überzählige, verwaiste Embryonen nach 66 s. Kreß (2002a) S.190. An anderer Stelle schreibt Kreß unter der Vorannahme eines Menschenrechts auf Gesundheit, dass „Embryonenschutz einerseits und die Gesundheitsförderung andererseits [...] als vitale, das Leben betreffende Güter in innerem Bezug zueinander [stehen].“ S. Kreß (2001) S.3274. 67 s. Bodden-Heidrich S.139-147. 68 vgl. Eibach (2000) S.120. 69 s. Markl (2002), zitiert nach Sewing (2002) S.139. Befürchtete Folgen der PID 109 IVF- oder PID-Anwendung. Die Produktion menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken betrachtet diese als reines Mittel zum Zweck. Ihr weiteres Schicksal ist nicht abhängig von ihrem Entwicklungspotenzial oder ihrer genetischen bzw. chromosomalen Ausstattung, sondern es ist von vornherein festgelegt, dass sie im Labor „nach Gebrauch“ verworfen werden. Ein solches Vorgehen ist mit einem respektvollen Umgang, den die Annahme selbst eines minimalen Schutzanspruchs implizit fordert, nicht vereinbar. Auch die Befürchtungen einer Kommerzialisierung der Zeugung von oder gar eines Handels mit menschlichen Embryonen werden gegen eine derartige Praxis vorgebracht. Über ein rechtliches Verbot der Herstellung von Forschungsembryonen herrscht in Kongruenz zur Formulierung des Art.18 der Europaratskonvention ein weitreichender Konsens.70 Hinsichtlich dessen Auslegung bemängelt Mieth allerdings eine ungenügende inhaltliche Klärung der „Forschungszwecke“, an die das Verbot geknüpft sei. Zu diesen seien auch „Therapieforschung und klinischer Versuch“ zu zählen.71 Stark umstritten bleibt, ob Elternpaare mittels informed consent ihre überzähligen Invitro-Embryonen für eine Verwendung in wissenschaftlichen Untersuchungen freigeben können sollten. Im Sinne des Person- und des Progredienz-Modells scheint es wünschenswert, durch eine gesetzliche Beschränkung der Anzahl künstlich gezeugter Embryonen die Entstehung überzähliger von vornherein zu vermeiden. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass bei einer IVF die Mutter schwer erkrankt, verstirbt oder ihre Zustimmung zum Embryotransfer zurückzieht. Ausgehend von einem graduell ansteigenden Schutzanspruch argumentieren Befürworter der Embryonenforschung, dass überzählige Embryonen dann ohnehin verworfen würden, doch auf diese Weise noch dem Wohl der Menschheit dienten. An diesem Ansatz ist zu kritisieren, dass er den embryonalen Status von äußeren Umständen abhängig macht, indem er eine Instrumentalisierung im Zustand des Verlassenseins für zulässig erklärt. Menschenwürde und Lebensrecht eines Embryos sollten aber weder von seinem Aufenthaltsort (in vitro vs. in vivo)72 noch von den Plänen dritter (Transfer vs. Verwerfen) bestimmt werden.73 Die Möglichkeit, an überzähligen Embryonen zu forschen, könnte außerdem einen Anreiz darstellen, mehr Embryonen als für eine IVF nötig zu zeugen, wenn ihre Höchstzahl nicht gesetzlich festgelegt ist. 70 Ein explizites Verbot der Erzeugung von Forschungsembryonen sehen Art.18.II der Europaratskonvention (1997) sowie Satz Nr.14 der MBO der Bundesärztekammer (2006a) S.36 vor. Ein implizites Verbot ist in §2.II des ESchG (1991) verankert. Frühwald (2001) zufolge gefährde die spärliche Ratifikation der Europaratskonvention ihre „internationale Modellfunktion“. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Herstellung von Forschungsembryonen in den USA. 71 s. Mieth (1999) S.78 f.. 72 Hier sei noch mal auf das Kapitel 3.2.1 zur Abtreibung verwiesen, in dem diese Problematik bereits behandelt wurde. 110 Befürchtete Folgen der PID 6.2.3 Der Zusammenhang von PID und Embryonenforschung Einer der Verknüpfungspunkte der Präimplantationsdiagnostik mit der Forschung an Embryonen besteht darin, dass ihre Anwendung immer eine gewisse Zahl an nicht-transferierten Embryonen hervorbringt: einerseits selektierte, zu verwerfende und andererseits überschüssige, gesunde Embryonen. Sie alle könnten theoretisch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus übernehme die PID auch insofern die Funktion eines „Türöffners zur Embryonenforschung“, als sie ein Tabu breche, indem sie Embryonen instrumentalisiere.74 Einmal ihrer Selbstzwecklichkeit beraubt sei der Schritt zur Forschung an Embryonen nicht mehr groß und in der Annahme einer Slippery Slope gar nicht mehr aufhaltbar. Allerdings wird häufig vergessen, dass Embryonen auch durch einen Mehrfachtransfer bei künstlicher Befruchtung oder eine Schwangerschaft auf Probe bzw. sogar durch eine natürliche Schwangerschaft im Hinblick auf die elterliche Beziehung instrumentalisiert werden (können). Dies geschieht jedoch eher im Verborgenen, nicht offensichtlich wie bei der PID, und wird daher weniger als wegbereitend für die Embryonenforschung wahrgenommen. Eine Zulassung der PID erleichtert nicht nur über eine Lockerung des Embryonenschutzes die verbrauchende Embryonenforschung. Sie mache sie sogar „unvermeidlich“ und liefere ihr zudem einen notwendigen Anwendungsbezug75 im Sinne eines „hochrangigen Forschungsziels“. Doch nicht nur die Verbesserung der technischen Qualität und des Erfolgs der PID, sondern schon das Erlernen ihrer Methode fordere Embryonenopfer. Dieser Behauptung stellt sich der Vorschlag entgegen, die Blastomerbiopsie an Tierembryonen - dabei sei Erfahrung mit der ICSI hilfreich - und die Einzelzelldiagnostik an ausdifferenzierten Zellen zu erlernen. Grundsätzlich stellt sich doch die Frage, ob nicht die In-vitro-Fertilisation viel eher als die PID den Einstieg in die Forschung an Embryonen möglich und nicht auf vergleichbare Art und Weise auch unabdinglich macht. Schließlich ist sie technische Voraussetzung und Anwendungsfeld der Forschung zugleich. Man denke hier nur an die Entwicklung neuer Kulturmedien oder Kriterien der morphologischen Selektion mit der Zielsetzung, die schlechte Erfolgsrate zu verbessern. Den PID-Befürwortern wird im gesellschaftlichen Diskurs oft unter Berufung auf die Forschungsfreiheit ein Interesse an Embryonenforschung unterstellt, wenn auch selten von ihnen selbst geäußert. Für Vertreter anderer Disziplinen scheint es Wissenschaftlern u.a. oder sogar vor allem darum zu gehen, am internationalen Wettbewerb teilzunehmen und ihren eigenen sozio73 Der Vergleich des Verbrauchs überzähliger Embryonen mit dem unehelichen Infantizid, für dessen Straffreiheit Kant plädierte - hierzu Vieth (2003) S.124 und Schmidt (2003) S.107 - ist angesichts der heutigen Wertvorstellungen ein vollkommen untaugliches, ja ungeheuerliches Argument. 74 vgl. Kollek (2002) S.185. 75 vgl. Eibach (2000) S.117 und Schroeder-Kurth (1999) S.51. Befürchtete Folgen der PID 111 ökonomischen Status zu sichern. Eibach folgert aus diesem mutmaßlichen Motiv forschender Mediziner: „Standesethische und standesrechtliche Regelungen vermögen solche Absichten und Entwicklungen längerfristig nicht wirksam zu verhindern. Es bedarf klarer staatlich-rechtlicher Regelungen."76 Die Verteidiger der Embryonenforschung sprechen dagegen von einem forschungsethischen Dilemma, wenn eine Nation „zum Nutznießer zukünftiger Forschungserfolge“77 werde, zu denen sie selbst aufgrund ethischer Bedenken keinen Beitrag leisten wolle. Ärzte und Wissenschaftler würden so zu „Lizenznehmern“,78 und gegen ihren Gesetzgeber sei der Vorwurf der Doppelmoral zu erheben. Trotzdem, so das Gegenargument, dürfe sich eine Regierung hier ebenso wenig wie angesichts des schon erwähnten PID-Tourismus zwingen lassen, die liberalste und forschungsfreundlichste Regelung zu übernehmen. Erst durch die Einführung der Präimplantationsdiagnostik bei Fortbestehen eines restriktiven Embryonenschutzes gerate ein Land tatsächlich in ein Glaubwürdigkeitsdilemma. Um eine solche „moralische Schieflage“ zu vermeiden, dürfe man daher die PID nicht zulassen, sondern müsse stattdessen auf moralisch unproblematische Forschungsergebnisse wie die PKD zurückgreifen.79 Diese durchweg positive Bewertung der Polkörperdiagnostik scheint in erster Linie von der klinischen Anwendung und weniger von der vorhergehenden wissenschaftlichen Erarbeitung und der anhaltenden Überprüfung und Erweiterung der Methode auszugehen. Die methodische Entwicklung der PKD und auch der IVF ist schließlich ebenso wie die der PID nicht ohne Embryonenverbrauch abgelaufen.80 Inwiefern ihre Durchführung zwar legal, aber dennoch aus ethischer Sicht hinsichtlich des Schutzes menschlicher Embryonen nicht unangreifbar ist, zeigen die Abschnitte 3.3.4 und 5.2.2. 6.2.4 PID und Keimbahntherapie Die bisher aufgezeigten Verknüpfungen zwischen PID und Embryonenforschung reichen von ihrer eigenen Entwicklung über die Entstehung überzähliger Embryonen bis zur wahrscheinlichen Etablierung des Embryonenverbrauchs in der Wissenschaft. Eine weitere Verbindung stellt die Möglichkeit dar, mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik in Zukunft die Resultate geneti76 s. Eibach (2000) S.118 mit Bezug auf den Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie der Präimplantationsdiganostik der Bundesärztekammer (2000). 77 s. Schockenhoff (2000) S.94 mit Darstellung der Gegenposition. 78 s. Deutsche Forschungsgemeinschaft (1996) S.36. 79 s. Schockenhoff (2000) S.104. Vgl. hierzu Abschnitt 5.2.2. 80 In einigen Studien zur PKD erfolgte z.B. mittels Blastomerbiopsie eine Follow-up Analyse der betroffenen, vom Transfer ausgeschlossenen Embryonen. Zur Ermittlung des positiven Vorhersagewerts der Diagnostik wurden also Embryonen verbraucht. Vgl. Rechitsky et al. (1998, 1999), Verlinsky et al. (1996, 1999a, 2001). In anderen 112 Befürchtete Folgen der PID scher Veränderungen an Embryonen oder Gameten zu überprüfen. Dabei ist an Eingriffe wie Klonierungen, Zytoplasma- oder Gentransfer in unbefruchtete oder befruchtete Eizellen zu denken. Die PID ermöglicht technisch eine Ausweitung des experimentellen Spektrums und fördert womöglich ihre moralische Akzeptanz. Folglich sei sie bereits ein „Schritt zur Keimbahnmanipulation“81 an Embryonen. Keimbahntherapie meint zunächst einmal die Übertragung eines intakten Gens bei Vorliegen eines für eine monogen erbliche Erkrankung verantwortlichen Gendefekts. Dieses Gen kann in einen der Pronuclei mikroinjiziert oder über retrovirale Vektoren in Vier- bis Acht-ZellStadien eingeschleust werden. Idealer Weise, doch in der Regel sehr selten, integriert es sich dort an einer Stelle in das Ziel-Genom, die vorher nicht sicher zu bestimmen ist. Der behandelte Embryo und alle seine Nachkommen sind dann Träger des sogenannten Transgens, das wiederum durch PID, PND oder postnatale Diagnostik nachweisbar ist. Diesem Vorgehen kommt eine krankheitspräventive Bedeutung zu. Es eliminiert die genetische Krankheitsursache und heilt Embryonen, bevor ihr mutiertes Gen exprimiert werden kann. Seine Nachteile sind die variable Effizienz und die mit der Insertion verbundene Gefahr der Mutagenese, die u.a. die Entstehung eines Tumoren provozieren kann. Eine andere Methode tauscht in kultivierten embryonalen Stammzellen ein gesundes Gen zusammen mit Selektionsmarkern durch homologe DNARekombination gegen das mutierte Gen aus. Gelingen dieser Gentransfer und sein Nachweis, werden die Stammzellen in eine Blastozyste übertragen, die dadurch chimär wird.82 Nur wenn die Gameten eines chimären Lebewesens das übertragene Gen enthalten, sind seine Nachkommen rein transgen und genetisch gesund. Der therapeutische Effekt dieser Intervention kommt also, wenn überhaupt, erst in der zweiten Generation zum Tragen, während die Auswirkungen des gemischten genetischen Status auf den Phänotyp des chimären Organismus nicht vorhersagbar sind. Aus wissenschaftlich-technischer Sicht ist gegenwärtig der experimentelle Charakter der Keimbahntherapie problematisch. Da der Wahrheitsgehalt der ihr zugrunde liegenden Hypothesen sich erst durch eine menschliche Existenz zeigt und da Studien bestätigte eine zusätzliche PID das negative Ergebnis der PKD vor dem Embryotransfer. Bei einem positiven Befund wären die Embryonen wohl verworfen worden. Vgl. Magli et al. (2004), Kuliev et al. (2006). 81 s. Kollek (2002) S.110. 82 „Chimär“ bezeichnet den Aufbau eines Organismus aus genetisch unterschiedlichen Zellen, die aus verschiedenen befruchteten Eizellen stammen. Die verschiedenen Methoden der Keimbahntherapie und ihre Risiken werden bei Wivel und Walters (1993) S.533 f. beschrieben. Befürchtete Folgen der PID 113 „[d]ie Ergebnisse dieses Experimentes unabhängig davon, ob sie fehlerhaft sind oder nicht, in allen nachfolgenden Generationen reproduziert werden, muß die Schadensgröße unabhängig von ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Schaden als potentiell unbegrenzt angesehen werden.“83 Voraussetzungen der Durchführung einer Keimbahntherapie am Menschen wären daher 1) die tierexperimentelle Sicherstellung einer normalen Funktion und Regulation des transferierten Gens, und 2) der Ausschluss a) mutagener Effekte, b) anhaltender Wirkungen des Gendefekts nach der Intervention und c) genetischer Nebenwirkungen infolge der Insertion. Die Therapie von Embryonen dürfte außerdem keine hohe Letalität zur Folge haben, da diese ihren Schutzanspruch verletzte. Stattdessen müssten ein guter Erfolg des Gentransfers sowie eine kontrollierte Integration des Transgens in die DNA gewährleistet sein.84 Die Forschung zur Weiterentwicklung der Keimbahntherapie mit dem Ziel, diese Vorgaben in Zukunft erfüllen zu können, sei nach Meinung ihrer Kritiker in Relation zu ihrem kleinen Anwendungsgebiet zu kostspielig Eine Vererbungswahrscheinlichkeit von 100 %, wenn beide Elternteile an derselben autosomalrezessiven Erkrankung leiden, besteht schließlich sehr selten. In der Regel sind trotz eines Risikos erblicher Erkrankungen mindestens 50 % der Embryonen nicht betroffen. Ansonsten stünden immer noch Pränatal- bzw. auch Präimplantationsdiagnostik als Alternativen zur Verfügung, um schwere genetische Krankheiten zu verhindern.85 Angesichts knapper Ressourcen und des relativ geringen embryonalen Status würde die Keimbahntherapie mit der Einführung der PID daher eher überflüssig.86 Andere Autoren sehen dagegen aufgrund der Zuschreibung eines höheren Status und der Unkenntnis der Talente aussortierter und abgetriebener Embryonen durchaus die Notwendigkeit, therapeutische Ansätze zu entwickeln. Das gesundheitliche Wohl des Kindes zu sichern, sei Ziel der „Preimplantation Genetics“, d.h. der Kombination aus Präimplantationsdiagnostik und Keimbahntherapie. Die zukünftigen Eltern hätten das Recht, stellvertretend für den Embryo über eine Anwendung dieser Techniken zu entscheiden (proxy consent). Dieses basiere auf der natürlichen Fürsorge-Beziehung zwischen Eltern und Kindern und verpflichte sie dazu, im besten Interesse des Embryos zu entscheiden und diesem das ihrige unterzuordnen.87 Einige Befürworter führen dennoch das Autonomierecht auf Seiten der Eltern und das Recht auf Forschungsfreiheit sowie die Verpflichtung zur Anwendung der besten Therapie auf Seiten der Wissenschaftler und 83 s. Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik (2001) S.54. vgl. Wivel und Walters (1993) S.534. 85 s. ebd. S.536. Darauf, dass die Rechtfertigung der PID nicht von der Verhinderung einer Krankheit, sondern der Verhinderung des damit verbundenen Leidens der Eltern ausgeht, soll an dieser Stelle nicht noch einmal eingegangen werden. Vgl. aber Abschnitt 3.1.2 dieser Arbeit. 86 vgl. hierzu Woopen (2000) S.123 mit einem Zitat von Botkin (1998) und Schöne-Seifert (1999) S.89 mit Verweis auf Schroeder-Kurth (1997). 84 114 Befürchtete Folgen der PID Ärzte an, um ihre Position zu stärken. Auch vom ökonomischen Standpunkt aus betrachtet erscheint die Keimbahntherapie vor allem im Vergleich zur somatischen Gentherapie effizienter und kostengünstiger - insbesondere, wenn man sie auch bei heterozygoten ÜberträgerEmbryonen anwendete. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Methode allerdings noch unsicher und mit einer Gefahr für das therapierte Kind und seine Nachkommen verbunden. Dementsprechend ist ihre Anwendung in nationalen und internationalen rechtlichen Regelungen weitestgehend verboten.88 Das soll sie ihren Gegnern zufolge auch bleiben, da ihrer Entwicklung sonst viele Embryonen geopfert würden, obwohl Risiken nicht völlig auszuschalten und Fehler irreversibel seien. Zugleich weise die Keimbahnmanipulation ein Missbrauchspotenzial auf: Sie könne schließlich, wenn sie einmal etabliert sei, in Abhängigkeit von einem genetischen Krankheits- und Gesundheitsverständnis auch zu Zwecken des genetischen Enhancements angewendet werden. Im ethischen Diskurs um die Präimplantationsdiagnostik werden die hier nur angdeuteten Entscheidungsdilemmata bezüglich Embryonenforschung und Keimbahntherapie als Einwände gegen ihre Zulassung vorgebracht. Da die PID, wie ihre Gegner antizipieren, unweigerlich zu ihnen führe, widerspreche schon ihre Zulassung einem moralisch verantwortlichen Handeln. Proponenten der PID schlagen hingegen ihre Einführung unter Aufrechterhaltung des bestehenden Klonierungs- und Keimbahntherapie-Verbots vor.89 6.3 Wandel unseres Menschenbildes Wie in der bisherigen Darstellung der ethischen Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik deutlich geworden ist, stellen diverse Argumente die Frage nach dem moralischen Status von und dem richtigen Umgang mit menschlichen Embryonen. Zwischen dieser Frage und unserem menschlichen Selbstverständnis existiert ein unbestreitbarer Zusammenhang. Der Embryo ist ontogenetischer Ursprung individueller Existenz und verkörpert das „absolut Unbewusste“ in uns.90 Da jeder Mensch einmal ein Embryo war und auch alle zukünftigen Menschen einmal Embryonen gewesen sein werden, betreffen neue reproduktionsmedizinische Möglichkeiten wie die PID und ihre Folgen unser Menschenbild und mit ihm unsere Mitmenschlichkeit. Die Aus- 87 vgl. Graumann (1998) S.383 und 408 f.. Ein Verbot jeglicher Interventionen am Genom menschlicher Keimbahnzellen enthalten Art.13 der Konvention des Europarats (1997), §5.I des ESchG und Satz Nr.14 der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer (2006a). 89 vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (1996) S.37. 90 s. Schott (2002) S.172 mit einem Zitat von Carus (1941). 88 Befürchtete Folgen der PID 115 wirkungen auf letztere sollen in diesem Abschnitt exemplarisch am Verhältnis zwischen Eltern und Kindern dargestellt werden.91 6.3.1 Würde-Menschenbild und Wandel In den pluralistischen, liberalen Gesellschaften der Gegenwart findet sich kein einheitliches, sondern ein offenes, heterogenes Menschenbild. Jeder Kulturkreis entwickelt aus seinen Traditionen und Überlieferungen heraus eine eigene Idee davon, was den Menschen ausmacht, und legt für sich fest, welche Eingriffe in die menschliche Natur moralisch zulässig sind. Menschsein erscheint eher als „kulturbezogener Zuschreibungsbegriff“ denn als „biologische Tatsache“, und Kultur wird wiederum ein emergentes Verhältnis zur Natur zugeschrieben.92 Auf der Suche nach dem einen Menschenbild kann schließlich „nur aus dem Dialog der Kulturen [...] ein gemeinsamer Begriff dessen entstehen, was der Mensch ist und was seine Bestimmung ist.“93 Als schriftlich fixierter Konsens und vielleicht sogar Kern aller Auffassungen über die Beschaffenheit des Menschen gilt die Menschenwürde. Sie fand am 10.12.1948 Eingang in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die historisch als eine Reaktion auf die Gräueltaten während des Nationalsozialismus anzusehen ist. Seither habe sie sich, so Quante, mit ihren Charakteristika der Unantastbarkeit und des Objektivierungsverbots als Bestandteil unserer ethischen und rechtlichen Kultur bewährt und ihren Geltungsanspruch somit legitimiert.94 Mit Hilfe der weltweit vereinbarten Grundrechte des Individuums lässt sich daher ein im Würdekonzept wurzelndes „Menschenbild des Rechts“95 zeichnen. Allerdings bleibt, obwohl die Achtung der Menschenwürde im Interesse aller Menschen liegt, ihr inhaltliches Verständnis ebenso wie die Auslegung der sie konkretisierenden Menschenrechte kulturellen und historischen Faktoren unterworfen. Der Universalität des Menschenrechtsethos stehen schließlich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft variierende Normen gegenüber. Diese erschweren ihrerseits die Kompromissfindung zur konkreten Gestaltung nationaler Rechtsordnungen oder weiterführender internationaler Vereinbarungen zum Schutz des Individuums. Frühwald zufolge ist die Menschenwürde ein „vorgegebenes Konstitutivum des Staates und seiner Ordnung“.96 Dies wird nicht zuletzt durch ihre hervorgehobene Position in den Ver- 91 Mit den Auswirkungen auf indirekt von der PID betroffene Personen innerhalb des gesellschaftlichen Kontexts beschäftigt sich das anschließende Kapitel zur Diskriminierung 6.4. 92 Hierzu Vieth (2003) S.116 mit den Worten Markls (2001). 93 s. Frühwald (2001). 94 vgl. Quante (2003) S.137. Das Objektivierungsverbot wird auch als Dürigsche Formel bezeichnet. 95 s. Schreiber (2003) S.367. Er begründet die Darstellung eines „Homo iuridicus“ damit, dass Recht „eine notwendige Basis für Menschliches Leben“ sei. Vgl. ebd. S.372. 96 s. ebd. mit einem Gedanken von Frühwald (2001). 116 Befürchtete Folgen der PID fassungen verschiedener Nationen deutlich.97 Sie und die Menschenrechte fungieren in Gesetzgebung und Rechtsprechung als Leitlinien. Für den Einzelnen sind sie Grundlage seiner personalen Rechte und Freiheiten, die durch niemanden, auch nicht den Staat, einzuschränken sind. In ethischen Diskussionen bleiben sie verbindlicher Konsensrahmen und praktische Determinante, deren Begriffsinterpretation jedoch letztlich, wie schon erwähnt, dem Einfluss nicht-juristischer Kriterien aus Theologie, Philosophie, Politik usw. unterliegt.98 Folglich wohnt dem Würde-Ideal unseres Selbstverständnisses und seiner Auslegung eine natürliche Dynamik inne. Vor dem Hintergrund des noch jungen Zeitalters der Genetik ist nun aber von einem „Kulturkampf“ die Rede, der sich zwischen einem „christliche[n], zumindest kantianische[n]“ und einem „szientistisch-sozialdarwinistische[n] Menschenbild“ abspiele.99 Dabei sei das Wiederauftreten des (Sozial-)Darwinismus nicht allein auf den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch auf den „wirtschaftlichen Neoliberalismus“ zurückzuführen.100 Das Denken eines „homo oeconomicus“ sei mit dem Prinzip der Menschenwürde allerdings nicht vereinbar.101 Die tiefgreifenden Neuerungen auf Seiten der Wissenschaft nehmen ihren Ausgang in Humangenetik und Biomedizin, die mit Hilfe neuer Techniken wie der PID menschliches Leben planbar zu machen scheinen. Kreß sieht die durch sie vergrößerten menschlichen Entscheidungsspielräume als Auslöser „kulturelle[r] Destabilisierung und existenzielle[r] Orientierungslosigkeit“ an und bezeichnet daher Biomedizin und auch Embryonenschutz als "Symbol derzeitiger kultureller Verunsicherungen“.102 Diesen Veränderungen korrespondiert die zunehmende Subjektstellung und Vorrangigkeit des autonomen Individuums in unserer Gesellschaft, als deren Folge der Abwehrcharakter der Freiheitsrechte von einer durch diese vermeintlich gerechtfertigten Anspruchshaltung überschrieben zu werden droht.103 Durch den Trend der „Subjektorientierung“ in den Hintergrund gedrängt werde die Idee „einer nichtbiologischen universalen Gattungswürde als Wertorientierung im menschlichen Selbstverständnis.“104 Der Annahme Rehmann-Sutters, „dass die für die Legitimität genetischer Technologie nötigen Veränderungen im 97 Beispiele hierfür sind Art.1.I des deutschen Grundgesetzes, Abs.1.II der finnischen Verfassung, Art.1 der portugiesischen Verfassung, Art.2.I der schwedischen Verfassung, Art.2.I der griechischen Verfassung, Art.7 der Schweizer Verfassung und Abs.10 der südafrikanischen Verfassung. 98 Zur Rolle des Verfassungsrechts in ethischen Debatten vgl. auch Schreiber (2003) S.369 und Neidert (1999) S.34. 99 s. Frühwald (2001). 100 s. Schott (2002) S.174 zu den Worten Frühwalds (2001). 101 Zur Gefährdung des Würdekonzepts durch Priorisierung der Ökonomie s. Schreiber (2003) S.368. 102 s. Kreß (2002a) S.174. 103 vgl. Abschnitt 4 zu Autonomie und Fortpflanzungsfreiheit. Haker (2003) S.363 schildert diese Entwicklung. Aus der Perspektive elterlicher Verantwortung sei Autonomie Abwehrrecht und nicht „permissiver Begriff elterlicher All-Macht“. 104 s. Höver und Baranzke(1998) S.164 über Kants Vorstellung des einzelnen moralischen Subjekts als Träger der Idee der Menschheit. Vgl. Habermas (2005) S.121 zur Orientierung am „gattungsethischen Selbstverständnis“, dessen Bedeutung in Kapitel 6.5 erläutert wird. Befürchtete Folgen der PID 117 Verständnis unseres Selbsts im Diskurs stattfinden und der Technologie vorausgehen"105, folgt die Feststellung, dass zumindest das Autonomie-Argument der PID-Befürworter in diesem Sinne wirksam ist. Es bleibt abzuwarten, ob in der Diskussion um die Vereinbarkeit von PID und Menschenwürde und um den Inhalt unseres Menschenbildes selbiges sich so darstellt oder schließlich so verändert daraus hervorgeht, dass eine Zulassung der PID rechtmäßig erscheint. Generell sei laut Frühwald zu befürchten, dass die neuen Möglichkeiten, das Genom eines Individuums vor- und umzuprogrammieren, seine „leibhaftige Identität“ störten106 und die daraus resultierende Verfügbarkeit zu einschneidenden Veränderungen im menschlichen Selbstverständnis führe. Die Grenze zwischen dem Natürlichem, auf dessen Bedeutung im Folgenden noch näher einzugehen ist, und dem Gemachtem werde unscharf.107 Künftig würden vielleicht genetische Daten, die derzeit nur einen Bestandteil des Kerns menschlicher Persönlichkeit darstellen, zu einem genetisch reduzierten Menschenbild hochstilisiert und damit einhergehend die Bewertung von Leben provoziert. Mit der Verletzung der Integrität unseres Menschenbildes durch Bilanzierung, mit dem Paradigmenwechsel vom Humanismus zur Perfektionierung des Menschen und der Utopie einer leidfreien Welt befassen sich die anschließenden Abschnitte 6.4 und 6.5.. An dieser Stelle soll es in Anknüpfung an die zu Beginn dieser Arbeit dargestellte Status-Debatte um „[d]ie Bestimmung von Personenwürde“ gehen, „in der wir unser Selbstverständnis als Menschen ausdrücken.“108 In Anlehnung an den Begriff des homo iuridicus ist dafür auch nach dem Menschenbild der Verfassung zu fragen. Außerdem sollen mögliche Auswirkungen der Präimplantationsdiagnostik auf die Auslegung der Menschenwürde und unser Selbstverständnis aufgezeigt werden. 6.3.2 Extension und Intension der Menschenwürde Der Streit um die Trägerschaft bzw. Teilhabe menschlicher Embryonen an der Menschenwürde lässt sich untergliedern in einen Streit um Extension und Intension menschlicher Würde. 1) Der Diskussion um die Ausdehnung des Würdebereichs liegen voneinander abweichende Vorannahmen darüber zugrunde, wann und warum Menschen personale Würde zuzuschreiben ist. Durch embryologische Forschung ist es heute möglich, einige dieser Ideen mit einem verifizierbaren Substrat zu verknüpfen. Bereits im Kontext des embryonalen Personstatus wurden die ab der Befruchtung erfüllbaren Kriterien der Spezieszugehörigkeit, der Individualität, 105 s. Rehmann-Sutter (1998) S.435. vgl. Sewing (2002) S.136 mit einem Zitat von Frühwald (2002). 107 Hierzu auch Habermas (2005) S.45, der Natürlichkeit mit dem „gattungsethischen Selbstverständnis“ des Menschen verknüpft sieht. 108 s. Junker-Kenny (1998) S.308. 106 118 Befürchtete Folgen der PID Potenzialität und Kontinuität diskutiert. Als weitere Konstitutiva der Menschenwürde gelten Eigenschaften wie Schmerzempfinden und Handlungsfähigkeit sowie die personalen Qualitäten (Selbst-)Bewusstsein, Reflexion, Kommunikation, Autonomiefähigkeit, Vernunft usw.. Sie werden von ihren Befürwortern oft zwecks Willkür vorbeugender Empirie an Ereignisse der Embryonalentwicklung wie u.a. die Entstehung neuronaler Synapsen rückgebunden. Vor der Ausbildung solcher spezifischen Strukturen gilt ein Embryo nur als potenzieller Besitzer dieser Fähigkeiten, über dessen Würdeträgerstatus sich ebenso wenig wie über ein oder mehrere der Würde vorgeordnete Kriterien Konsens erzielen lässt. Selbst wenn metaphysische Potenzialität allein nicht dazu verpflichtet, dem Embryo von Beginn an Menschenwürde zuzuschreiben, er bzw. der Fetus also erst zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Schutz der Menschenwürde steht, so ist er vorher dennoch nicht notwendigerweise schutzlos. Zur Begründung einer wie auch immer gearteten Schutzpflicht gegenüber frühesten Embryonalstadien existieren verschieden Ansätze: a) In dem der Würdeträgerschaft vorangehenden Zeitraum greifen wie gegenüber jedem Angehörigen unserer Gattung die unserem Menschenbild entsprechenden Solidaritätspflichten. Der durch sie gewährleistete Schutz des Embryos fällt im Vergleich zum Schutz rechtstragender Subjekte schwächer aus und ist gegen andere Rechtsgüter abwägbar. Eine Grundlage dieser Solidarität liefert das kantische Würdeverständnis, dem zufolge ein moralisches Subjekt menschlich handeln und sein Handeln vor dem Selbstverständnis der Menschheit verantworten muss, „und zwar unabhängig davon, ob ein menschliches Gegenüber seine Würde verwirklicht hat oder nicht.“109 Dass der Embryo menschlich ist und bereits seine (Er-)Zeugung einen zu verantwortenden Akt darstellt, ist unumstritten. Klärungsbedarf besteht allerdings hinsichtlich der Beschaffenheit eines menschenbildlichen Maßstabs, anhand dessen die moralische Bewertung einer Handlung am Embryo erfolgt, die aber den Würdestatus der von dieser Handlung direkt Betroffenen unberücksichtigt lässt. Dass in eine solche Beurteilung auch Verletzungen des individuellen Selbstverständnisses Dritter zu integrieren sind, ist ein Aspekt, der dem folgenden Kapitel vorbehalten bleibt. b) Auch „zwischenmenschliche Beziehungsaufnahme“110 stelle nach Ansicht einiger Autoren eine Grundlage personaler Würde dar, die theoretisch embryonale Schutzansprüche oder Würdeträgerschaft ab dem Zeitpunkt der Befruchtung - auch einer extrakorporalen - begründen 109 110 s. Höver und Baranzke (1998) S.164. Hierunter werden verschiedene Qualitäten der Beziehungsaufnahme subsumiert: „Bundesschluss“ (Maguire (1988) bei Junker-Kenny (1998) S.306), „soziale Anerkennung“ (Haker (1997) bei Junker-Kenny (1998) S.319), „soziale Vollzüge“ (Quante (2003) S.147) und „Akt der Aufnahme in den öffentlichen Interaktionszusammenhang einer intersubjektiv geteilten Lebenswelt“ (Habermas (2005) S.64 f.). Befürchtete Folgen der PID 119 kann. Widerspruch gegen diesen Ansatz der Zuschreibung von Personsein regt sich insbesondere aufgrund seiner Willkürlichkeit: Die einen entscheiden über den Status des anderen, üben also Macht über ihn aus. Allein auf den Bundesschluss zwischen Mutter und Kind könne sich nach Meinung Junker-Kennys Personsein nicht gründen, da dies die transzendentale Ebene potenzieller Reflexivität des Embryos vernachlässige.111 Haker erweitert das Kriterium der sozialen Anerkennung um Leiblichkeit und Kontinuität und bezeichnet die drei als „integral parts of personhood“ vor dem Hintergrund, dass "the normative grounds of the concept of human dignity [are] [...] the constitutive elements of personhood itself."112 Die Zuschreibung von Menschenwürde sei durch die Verwirklichung wenigstens eines dieser Elemente begründet. Sie erscheint jedoch im Fall des frühen Embryos angesichts der bereits zu Beginn dieser Arbeit aufzeigten Gegenargumente keineswegs zwingend.113 Quante verweist darauf, dass Menschenwürde durch das Kriterium der Anerkennung auch auf Menschen, „die aktual nicht zu einer autonomen Lebensführung fähig sind“, erweiterbar werde. Unvermeidbare Implikation dieses sozialen Ansatzes sei allerdings die Akzeptanz einer intersubjektiv-rationalen Lebensqualitätsbewertung im Fall nicht verwirklichter Autonomie, d.h. auch bei Embryonen. Er betont diesbezüglich die Rolle des vernunftgemäßen Werturteils, das über Anerkennung und Nicht-Anerkennung oder - übertragen auf die PID - über Embryotransfer und Verwerfen entscheide und als solches nicht in Widerspruch zur Menschenwürde stehe.114 2) Da der Streit um den Geltungsbereich der Menschenwürde im Hinblick auf eine Einigung wenig aussichtsreich scheint, suchen einige Autoren, in der Regel Vertreter einer gegenüber der PID permissiven Grundhaltung, einen intensionalen Zugang zur embryonalen Menschenwürde. Ihnen geht es nicht darum zu begründen, warum dem Embryo keine Würde zuzuschreiben ist, sondern warum der Zweck einer bestimmten Handlung aus ethischer Sicht als mit dem Menschenwürdeprinzip verträglich anzusehen ist. Greifen wir an dieser Stelle Quantes Gedankengang noch einmal auf: Das auf Autonomie und Anerkennung beruhende Würdeverständnis erlaube, zwischen abschätzbarem künftigen Leid und Lebensrecht abzuwägen, wodurch die Würde des beurteilten Lebens nicht verletzt werde. Auch Kreß hält einem Absolutheitsanspruch des Lebensschutzes, der keine Berücksichtigung eines Handlungskontexts zulasse, entgegen, dass Ausnahmen wie Notwehr und Verteidigungskrieg ethisch legitimiert seien. Er plädiert aus 111 vgl. Junker-Kenny (1998) S.305 ff. zum Ansatz Maguires (1988). Gegen die Infragestellung embryonalen Lebensrechts aufgrund der Abhängigkeit vom mütterlichen Organismus spreche die Entstehung einer Schwangerschaft als eine zu verantwortende Handlung. 112 ebd. S.318 f.. Vgl. zur Normativität des Person-Begriffs auch Abschnitt 2.2.1 dieser Arbeit. 113 Zu den Einwänden gegen die einzelnen von Haker vorgeschlagenen Kriterien vgl. Abschnitt 2.2.1. 114 vgl. Quante (2003) S.147 f.. 120 Befürchtete Folgen der PID diesem Grund dafür, den frühen Embryo ohne Abstufungen unter bedingungslosen Würdeschutz zu stellen, von diesem jedoch mehr Ausnahmen zuzulassen.115 Die Behauptung, dass embryonale Würde ein Abwägen nicht grundsätzlich verbiete, Lebensrecht daher relativierbar sei, liefert allerdings noch keine Antwort auf die Frage, wann eine Ausnahme, also eine Indikation zur PID, besteht bzw. rational fundiert erscheint. Potenzielle Kriterien nennt Abschnitt 5.1 - allerdings unter der Annahme, dass jede Lebensbewertung illegitim und die von den Risikopaaren antizipierte Überlastung für eine Rechtfertigung der PID ausschlaggebend ist. Einen weiteren nicht in dem Schema extensionaler und intensionaler Herangehensweise zu verortenden Ansatz liefert Heun, indem er eine Entkopplung von Menschenwürde und Lebensrecht, den beiden verfassungsrechtlichen Grundlagen des Embryonenschutzes, vornimmt. Sie stelle einen Ausweg aus dem aus der Verknüpfung hervorgehenden rechtlichen Dilemma zwischen unantastbarer Würde und unter einfachem Gesetzesvorbehalt116 stehendem Recht auf Leben dar. Diese Verknüpfung bedeute in der Konsequenz nämlich einerseits ein Verbot jeglicher Eingriffe in das Lebensrecht, darunter Abtreibung und Notwehr, und andererseits eine Ausweitung der staatlichen Schutzpflicht bis in persönliche Beziehungen hinein.117 Ihre Auflösung hat zur Folge, dass nicht jede Tötung per se schon die Menschenwürde verletzt. Erst wenn eine Handlung einen Menschen willkürlich gering achte, ihn demütige und grundsätzlich zum Objekt degradiere, liege ein Verstoß gegen die Menschenwürde vor.118 Der Menschenwürdeartikel der Verfassung spricht der menschlichen Existenz einen intrinsischen Wert zu, den zu schützen der Staat sich verpflichtet sieht. Die „Intention der Verfassung“ sei dabei, „konkrete Schutzgarantien für konkrete Subjekte zu begründen“. Deswegen könne ausschließlich für ein in sich identisch bleibendes Individuum Potenzialität als Grund seiner Menschenwürdeträgerschaft angeführt werden. Unabhängig von der Entstehung seiner personalen Identität sei hingegen der Beginn seines Lebensrechts.119 Demzufolge könne der Embryo bereits mit der biologischen Individuation, nicht aber später als mit Erreichen des Würdestatus Träger des Rechts auf Leben werden.120 Für die Präimplantationsdiagnostik heißt dies, dass sie weder das Lebensrecht noch die Würde menschlicher Embryonen verletzt. Gleiches gilt, wenn man vom Wortlaut der Menschen115 vgl. Kreß (2001) S.3274. Hier verweist Heun (2002) S.518 auf die Vorrangigkeit und Gewichtigkeit des Lebensrechts, da es „Voraussetzung jeglicher Inanspruchnahme anderer Grundrechte“ und seine Verletzung immer „der vollständige Entzug dieser Rechtsposition“ sei. 117 vgl. ebd.. 118 vgl. hierzu auch Schreiber (2003) S.370. 119 s. Heun (2002) S.521. Ein genetisches Identitätsverständnis sei aufgrund möglicher genetischer Veränderungen und Zwillingsbildung unzulänglich und beschreibe nur einen Teil des menschlichen Wesens. Die Anwendung eines auf psychischer und physischer Kontinuität gründenden Identitätsbegriffs setze die Gehirnentwicklung voraus, so dass der Würdestatus dem Embryo erst zu einem späten Zeitpunkt zuerkannt werde. 116 Befürchtete Folgen der PID 121 rechtserklärung der Vereinten Nationen ausgeht. Sie spricht in ihrem ersten Artikel dem geborenen Menschen Freiheit und Würde zu, äußert sich aber nicht weiter zu rechtlichem Status und Lebensrecht des ungeborenen Menschen. Aus der historischen Auslegung der Würdezuweisung als Schutz vor Erniedrigung schlussfolgert Neidert sogar, dass nur derjenige Träger der Menschenwürde sein könne, der grundsätzlich über die Fähigkeit verfüge, Entwürdigung zu empfinden. Das Grundrecht auf Leben stehe dem Embryo schon ab der Befruchtung zu, sei jedoch ins Verhältnis zu anderen Grundrechten zu setzen.121 Auch nach diesem Ansatz verstößt die PID nicht gegen die Menschenwürde, möglicherweise aber gegen das Lebensrecht der Embryonen. Anhand dieses kurzen Einblicks in das Spektrum juristischer Interpretationen des Würdeprinzips wird deutlich, dass bezüglich seiner Anwendung und Konkretisierung in Form des Grundrechts auf Leben keine Einigung erreicht ist. Einstimmigkeit herrscht eher in der Kritik an der stark zunehmenden Berufung auf die Menschenwürde in Diskussionen um Probleme des menschlichen Miteinanders. Es zeigt sich, dass nicht nur Gegner der PID sie zur Untermauerung ihrer Argumente nutzen. Von PID-Befürwortern wird z.B. die menschliche Fähigkeit, auf die molekulare Ebene des Genoms vorzudringen, als Teil und Ausdruck menschlicher Würde122 bezeichnet, oder die Verantwortung jeglicher Entscheidung vor dem eigenen Gewissen als „Kern des Würdebegriffs“123 angesehen und entsprechend gewichtet. Im Würdeethos seien laut Kreß auch die moralischen Grundeinstellungen der Toleranz und intellektuellen Wahrhaftigkeit begründet. Sie bildeten die Rahmenbedingungen für Güterabwägungen im Sinne des Gebots ethischer Rationalität. Dem Umkehrschluss zufolge verletze Unredlichkeit die Würde des Gegenübers, da sie u.a. eine erfolgreiche Kommunikation mit ihm unmöglich mache.124 Die Kritik am häufigen Einsatz des Menschenwürde-Arguments lautet: Dieser habe auf den sachlichen Diskurs die destruktive Wirkung eines Konversationsstoppers, zumal er ein (weiteres) Abwägen der Güter verbiete.125 Dabei werde die Menschenwürde zum Teil wie ein Naturrecht gebraucht und dort angeführt und ausgelegt, wo es an konkreten Begründungen mangele.126 Folge dieser inflationären Anwendung sei die Entwertung der Würde durch Relativierung gegenüber anderen Grundrechten, also der Verlust ihres besonderen Gewichts. Die übermäßige 120 vgl. ebd. 521 f.. s. Neidert (2002) S.38. Eine Definition des Zeitpunkts, ab dem die Wahrnehmung einer Entwürdigung möglich ist, dürfte schwer fallen, zumal von interindividuellen Unterschieden auszugehen ist. 122 vgl. Sewing (2002) S.138. 123 s. Vieth (2003) S.115 zum Inhalt der Rede Markls (2001). 124 vgl. Kreß (2002a) S.181, 191. Die Möglichkeit eines Urteil infolge rationaler Abwägungen zu Status und PID wurde bereits dargestellt. S. FN 114. 125 vgl. Schmidt (2003) S.14. 126 vgl. Schreiber (2003) S.368. 121 122 Befürchtete Folgen der PID Berufung auf die Menschenwürde müsse daher vermieden werden.127 Einige Autoren bewerten sie dennoch positiv, zumal „der Verweis auf die Menschenwürde“ die Notwendigkeit aufzeige, “nach relevanten Normen und ihren Anwendungsbedingungen [zu] suchen“ und sich bei jedem Handeln auf Gegenmeinungen einzustellen.128 Des Weiteren wird der Rekurs auf die Würde als ein Festhalten am tradierten Menschenbild gedeutet. In der Rechtsordnung sieht Schreiber eine Begrenzung des Würdeschutzes auf „elementare[] Rechte und Ansprüche des Menschen.“ Nicht an das gesamte Recht dürften sich ihre „maximale Forderungen“ richten. Die Ableitung konkreter Lösungsansätze für Probleme des menschlichen Lebens in Gemeinschaft sei daher eine zu hohe Erwartung an das „A priori der Menschenwürde“. Dieses sei generell schwer „in konkrete Entscheidungen über das Leben“ zu übersetzen, sichere aber den „Kernbereich[] materialer Rechte“.129 6.3.3 Auswirkungen der PID auf das Menschenwürde-Konzept Offen ist nach wie vor, welchen Beitrag zur Veränderung unseres Menschenbildes die Präimplantationsdiagnostik leisten und inwiefern dieser für eine Veränderung ausschlaggebend sein kann.130 Nach Meinung ihrer Gegner wirke sich die PID schon ohne das Eintreten einer SlipperySlope-Entwicklung auf unser Menschenbild aus. Sie verletze schließlich die Menschenwürde in verschiedenerlei Hinsicht: 1) durch Missachtung der Selbstzwecklichkeit, Instrumentalisierung und Selektion von Embryonen - vorausgesetzt, diesen wird Würde und Lebensrecht zugeschrieben -, 2) durch implizite oder explizite Beurteilung des Lebenswerts der Menschen mit genetisch verursachten Erkrankungen - ausgehend davon, dass die PID ihr Leid verhindern soll - und 3) durch die Beschränkung der kindlichen Autonomie - sei es mittels genetischer Prädiktion oder elterlicher Erwartungen, die im Folgenden noch genauer zu beurteilen sind. Allein dadurch, dass die PID implizit dem Embryonenverbrauch zustimme und so die embryonale Würdeträgerschaft in Zweifel ziehe, schwäche sie das vorrangige Tötungsverbot und die Schutzgarantie der unantastbaren Menschenwürde.131 Aufgrund der Kontinuität zwischen werdendem Leben und Personen werde auf diese Weise auch das Schutzniveau letzterer herabgesetzt, der gesamte Würdeschutz sei also in Gefahr.132 In der Konsequenz werde dem Menschenwürdeprinzip ein neuer Inhalt zugeschrieben und den menschlichen Embryonen ein neuer Status. Mit der auf „geneti127 vgl. hierzu Neidert (2002) S.38, Heun (2002) S.521. s. Vieth (2003) S.128. 129 s. Schreiber (2003) S.368 mit einem Zitat von Starck (1999) und S. 371. 130 Hier sei noch einmal an Rehmann-Sutter erinnert, der in dem Menschenbildwandel nicht eine Konsequenz, sondern eine Voraussetzung der Akzeptanz neuer Techniken sieht. Vgl. FN 105. 131 vgl. Eibach (2000) S.116. 128 Befürchtete Folgen der PID 123 scher Güte“ basierenden Abwägbarkeit von Leben bahne sich schließlich „ein grundlegender Wandel in der kulturellen Wahrnehmung menschlichen Lebens an“133, der die bisherige WürdeKultur entwerte und mit der Anerkennung des Progredienz-Modells einen Epochenbruch auslöse. Deutlich wird, dass der hier skizzierte Menschenbildwandel nur unter der Voraussetzung eines embryonalen Personstatus prophezeit werden kann bzw. befürchtet werden muss. Mit dem Person-Modell in sensu stricto sind weder IVF noch PND und Abtreibung vereinbar, da sie eventuell sogar nach Vornahme einer Lebensbewertung - die Instrumentalisierung menschlicher Embryonen zulassen. Von diesen Techniken geht also theoretisch dieselbe Gefahr für unser Selbstverständnis aus wie von der PID. Einwände gegen das Kontinuitätsargument und somit gegen die Begründung eines Rückschlusses vom Umgang mit frühen Embryonen auf den Umgang mit Personen sind in 2.2.1 dargestellt. In den Augen der Befürworter tastet die PID den „personale[n] Kern eines Menschen“ ebenso wenig an wie die PND.134 Kreß sieht auch in der Abwägung frühen menschlichen Lebens keine Gefahr für Menschenwürde oder Lebensschutz, die eine „Aushöhlung“ des Würdeprinzips bedingen könne, räumt aber ein, dass das Abwägen zwischen einem Schutz- und einem Anspruchsrecht eine bisher unbekannte Qualität darstelle. Grundsätzlich betont er die Notwendigkeit permanenter Revidierbarkeit und Überprüfung ethischer und rechtlicher Urteile als eine Implikation „intellektueller Redlichkeit“.135 6.3.4 Auswirkungen der PID auf zwischenmenschliche Beziehungen Der Auseinandersetzung mit den langfristigen Folgen der Präimplantationsdiagnostik für unser Menschenbild schließen sich, wie angekündigt, Überlegungen hinsichtlich ihrer direkten Auswirkungen auf das Verhältnis der Menschen zueinander und insbesondere auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern an. Unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie das Verhalten zu uns selbst und zum Anderen sind entscheidend geprägt durch eine Vorstellung von Unberechenbarkeit, Unverfügbarkeit und Verschiedenheit der menschlichen Natur.136 Mit ihr ist jeder von uns unveränderlich identisch, denn in unseren Genen liegt der nicht selbst bestimmte Anfang unserer Existenz. Er ist dem natürlichen Zufall unterworfen, den wir, so Mieth, 132 vgl. Netzer (1998) S.141, Holznagel (2003) S.84, Käßmann (2003). s. Kollek (2002) S.186. 134 s. Nationaler Ethikrat (2003) S.135 f.. 135 vgl. Kreß (2001) S.3274 f.. Gemeint ist der Konflikt zwischen embryonalem Schutzrecht und dem Anspruch auf körperliche Unversehrtheit der Eltern bzw. dem Anspruch „ein erreichbares Höchstmaß an Gesundheit“ der Kranken, denen die Embryonenforschung Hilfe verspricht. Vgl. auch Kreß (2002a) S.177 zur Revisionspflicht normativer Aussagen. 136 vgl. Petermann, Wiedebusch, Quante (1997) S.11. 133 124 Befürchtete Folgen der PID „durch eine geschichtlich gewachsene Anerkennung in die Grundlagen unserer Lebenswelt und unserer wechselseitigen Anerkennung vor aller Qualitätszumessung aufgenommen haben.“ [Hervorhebung übernommen, A.S.] Hierin bestehe die „Voraussetzung eines vom jeweiligen Sosein der Individuen unabhängigen, gegenseitigen Respekts.“137 Die Kontingenz des Befruchtungsvorgangs, auf der unser Selbstverständnis sowie Gleichheit und Symmetrie unserer interpersonalen Beziehungen beruhen, wurde bereits mit Einführung der In-vitro-Fertilisation beherrschbar. Diese war der erste Schritt zur Abschaffung der Natürlichkeit, insbesondere des natürlichen Generationszusammenhangs, wenn man an die Etablierung der Gametenspende denkt.138 Durch ihren prädiktiven und selektiven Charakter löst die PID den natürlichen Zufall noch weiter auf. Damit verändere sie nach Einschätzung ihrer Kritiker die Grundlage unseres Zusammenlebens. Es drohe eine Neugestaltung unserer Zwischenmenschlichkeit im Zeichen des genetischen Reduktionismus. Unser Gegenüber sei nicht länger „von Natur aus“ so, wie es uns begegnet, sondern von seinen Eltern so vorherbestimmt. Nicht mehr Naturgesetze, sondern Eltern und Ärzte legten die genetische Vielfalt fest. Durch die Verfügbarkeit und Planbarkeit genetischer Ausstattung verschwimme die Grenze zwischen Personen und Sachen. Das Selbstverständnis der Menschen als Freie, Gleiche und Ebenbürtige löse sich auf.139 Diese Veränderungen sind aus elterlicher und kindlicher Sicht unter Fokussierung des Eltern-Kind-Verhältnisses als der ersten natürlichen Beziehung fast jedes Menschen, genauer zu untersuchen. In ihr schließlich „erwirbt der Mensch durch die umfassende Anerkennung seiner Bedürftigkeit Selbstvertrauen [im Original hervorgehoben, A.S.]“, das „grundlegend für das Gelingen anderer Anerkennungsverhältnisse ist.“140 In der folgenden Darstellung soll, soweit möglich, zwischen den Folgen eines restriktiven und eines erweiterten PIDEinsatzes (Slippery-Slope-Effekt) differenziert werden. Die Verwirklichung ihrer Autonomie in der Entscheidung über die Durchführung einer PID bedeutet für Eltern zunächst Übernahme einer neuen Verantwortung gegenüber ihren Nachkommen. Bei der Bewertung dieser Möglichkeit, durch den Eingriff in das Leben anderer das eigene zu gestalten, herrscht eine Ambivalenz zwischen Freiheitsgewinn einerseits und Belastung bzw. Überforderung andererseits. Allerdings geben Paare mit der Anwendung der PID auch einen Teil der Verantwortung für ihre Kinder an die Ärzte ab. Haker spricht hier von einer „komplexen Urheberschaft“, die von der einfachen Urheberschaft abweiche, deren Anerkennung 137 s. Mieth (1999) S.83. Zur Kritik der Unnatürlichkeit vgl. Abschnitt 3.3.5 dieser Arbeit. 139 vgl. Habermas (2005) S.30 f.. Im Sprachgebrauch zeichnen Vergleiche von Kindern mit Konsumobjekten, von Ärzten mit Dienstleistern und der Verweis auf eine elterliche Produktmentalität diese Verdinglichung nach. Vgl. Beck-Gernsheim (1998) S.65 f.. 138 Befürchtete Folgen der PID 125 Inhalt der asymmetrischen „Totalverantwortung“ der Eltern für ihre Nachkommen sei. Die allmähliche Transformation dieser Asymmetrie in Symmetrie und damit das Ende der „Totalverantwortung“ seien dabei schon zum Zeitpunkt der Beziehungsaufnahme vorgesehen.141 Angesichts der fehlenden Revidierbarkeit erscheint der Entschluss für oder gegen eine PID besonders schwerwiegend, zumal er in "die in die somatischen Grundlagen des spontanen Selbstverständnisses und der ethischen Freiheit einer anderen Person eingreift"142. Dadurch erfolge gewissermaßen eine Fixierung der Asymmetrie im Eltern-Kind-Verhältnis. Die Verantwortung für die genetische Manipulation lasse sich nämlich im Gegensatz zur Verantwortung für die elterliche Erziehung nicht rückwirkend mit Hilfe der im Laufe des Erwachsenwerdens herausgebildeten Reflexivität ausgleichen.143 Nach PID geborene Kinder seien nicht länger nur durch die Abstammung an ihre Eltern gebunden, sondern könnten sich auch aufgrund ihres genetischen Designs nicht von ihnen befreien.144 Dieses Design bedeute über die intendierte Determination des Seins hinaus lebenslange Abhängigkeit, die Habermas in ihrem größten Ausmaß Versklavung nenne.145 Bereits angesichts dieser Vorhersagen, die eventuell auftretende Schwierigkeiten in der lebendigen Beziehung zwischen Eltern und Kindern noch nicht berücksichtigen, scheint es notwendig, das prädiktive Vermögen der Präimplantationsdiagnostik in Erinnerung zu rufen: Der Einsatz der PID bei enger Indikationslage verhindert nur, dass das anschließend geborene Kind an einer spezifischen genetischen Erkrankung leidet. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens anderer Fehlbildungen oder des Auftretens von Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt bleibt unverändert. Ebenso wenig lassen sich Aussagen zur phänotypischen Entwicklung machen. Vereinfacht bedeute dies, dass "[l]ediglich die Existenz des Kindes [...] das Resultat einer menschlichen Wahlentscheidung“146 sei, und das trifft heutzutage wahrscheinlich in den meisten Fällen zu. Letztlich unterscheidet sich ein nach PID ebenso wie ein nach PND geborenes Kind dadurch von anderen Kindern, dass ein bestimmtes Merkmal an ihm pränatal ausgeschlossen wurde. Ob dieser Ausschluss tatsächlich das Lebensgefühl, „designed“ und damit auf eine bestimmte Entwicklung festgelegt zu sein, hervorrufen kann, ist äußerst fraglich, scheint jedoch unwahrscheinlich. Dass die besagten Mutmaßungen an Spekulativität verlören, wenn sich die Indikationen zur PID weiteten und es auf der befürchteten Slippery Slope in Richtung Enhance140 s. Graumann (2003a) S.165 und S.167 über Thesen zur Anerkennung von Honneth (1998). vgl. Haker (2003) S.366 f.. ”Totalverantwortung“ sei „Wahrnehmung der totalen Hilfsbedürftigkeit des Kindes, das allmählich in den Zustand der Selbständigkeit überführt werden solle [...].“ Im Fall einer schweren Behinderung ist aber genau hiermit nicht zu rechnen. 142 s. Habermas (2005) S.30. 143 s. ebd. S.31. 144 vgl. Schockenhoff (2003) S.382. 145 vgl. Höver und Baranzke (2002) zur genetischen Fremdbestimmung durch Klonen unter Berufung auf Habermas. 141 126 Befürchtete Folgen der PID ment abwärts ginge, liegt dagegen nahe. Die begründete Überzeugung, dass rechtliche Regelungen und staatliche Kontrollorgane eine solche Entwicklung wirksam verhindern,147 entkräftigt daher die Warnung vor einem tiefgreifenden Wandel im Eltern-Kind-Verhältnis. Dass die Präimplantationsdiagnostik die biologische Beziehung zwischen den Generationen manipuliere, wirke sich auch auf den Umgang der Eltern mit ihren Kindern aus. Aus einer „Wunschkindmentalität“ heraus nähmen Paare die PID in Anspruch und träten dann ihren Nachkommen mit einer unnatürlichen Erwartungshaltung gegenüber.148 Statt des vorbehaltlosen „Aufnehmen[s] einer Beziehung zu einem unverfügten Du“149, werde die Annahme der Kinder infolge der PID an Bedingungen geknüpft. Im Rahmen des „einseitigen Herrschaftsverhältnisses“ dieser “konditionierten Elternschaft“, welche das Erreichen der Reziprozität gleich starker moralischer Subjekte beeinträchtige,150 laste somit ein Druck auf den PID-Kindern. Die elterlichen Erwartungen behinderten sie in der Ausübung ihrer Autonomie insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung ihrer eigenen Biographie. Auf der anderen Seite könnten Nachkommen ihre Erzeuger, zu denen gemäß der komplexen Urheberschaft sowohl Eltern als auch Reproduktionsmediziner zählten, für deren Handeln zur Rechenschaft ziehen. Dies rufe eine weitere Störung und Belastung der Eltern-Kind-Beziehung hervor. Zu verantworten sei dabei von Seiten der Eltern vermutlich eher der Verzicht auf die PID - ähnlich wie bei der Schadensersatzklage eines Behinderten infolge eines vermeintlichen Rechts auf Nichtexistenz gegen seine Eltern, die auf eine PND oder Abtreibung verzichtet hatten. Kaum denkbar sei allerdings laut Liening, dass jemand nach rationalen Erwägungen das Leben mit einer Behinderung dem Leben in Gesundheit vorziehe,151 zumal es im Fall der PID - im Gegensatz zur Keimbahntherapie - für dasselbe genetisch gesunde Kind eines Risikopaares gar kein alternatives Leben mit der erblichen Erkrankung gäbe. Die Auseinandersetzung mit möglichen Rechtfertigungsforderungen gegenüber den Eltern führt vor Augen, dass der Hinweis auf diesen negativen Effekt der PID unter der Voraussetzung ihres restriktiven Einsatzes wenig überzeugend ist. Gleiches gilt für die elterlichen Erwartungen mit einer daraus folgenden Beschränkung kindlicher Freiheiten, zumal diese sich lediglich an den Gesundheitszustand richten können. Einer Ablehnung trotz PID erkrankter oder behinderter Nachkommen ist wie bei der PND durch umfangreiche Aufklärung bezüglich der diag146 s. Hildt (1998) S.211 mit einem Zitat von Birnbacher (1989). vgl. hierzu Abschnitt 5.1.8 dieser Arbeit. 148 vgl. Liening (1998) S.187 f.. Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.3.5 dieser Arbeit. 149 s. Rehmann-Sutter (1998) S.438. 150 vgl. Schockenhoff (2003) S.382. Der Begriff der konditionierten Elternschaft wird im Folgenden noch näher ausgeführt. 147 Befürchtete Folgen der PID 127 nostischen Aussagekraft entgegen zu wirken. Auch, dass das Kind nur dann geliebt werde, wenn es gesund sei und die von den Eltern ausgewählten Eigenschaften aufweise - d.h., wenn sich Kosten und Aufwand für seine Zeugung bezahlt machten - sei laut Netzer reine Spekulation und könne daher ein Verbot der PID nicht begründen.152 Tatsache ist, dass Eltern ihren Kindern gegenüber niemals frei sind von Erwartungen und dass kaum eine Möglichkeit besteht, gegen pädagogische Versuche, Kinder nach den eigenen Vorstellungen zu formen, vorzugehen. Das Vorliegen dieses Sachverhalts allein lässt zwar noch keinen Rückschluss auf seine Rechtmäßigkeit zu,153 es stellt aber die Frage nach unserem Elternschaftsideal und nach den darin verankerten Rechten und Pflichten. Das Fundament elterlicher Verantwortung stellt von Natur aus die biologische Verwandtschaft zwischen Eltern und Kindern dar, deren Zeugung bereits in den elterlichen Verantwortungsbereich fällt. Diese Verantwortung ist „von keiner Zustimmung abhängig, unwiderrufbar und unkündbar; und sie ist global.“154 Mit ihr gehen natürlicher Weise Versorgungspflichten einher, die den kindlichen Grundrechten entsprechen und deren ausschließliche Erfüllung Haker als „minimale Elternschaft“ bezeichnet.155 Obwohl sowohl Eltern als auch Kinder Träger derselben personalen Würde und Rechte sind, sind in ihrer Beziehung zueinander Verantwortung und Handlungsmacht ungleich verteilt. In dieser Asymmetrie der Elternschaft und anderer Beziehungen liege die Begründung der Moral. Aus der Kombination von Macht und emotionaler Bindung - Gefühle lassen sich jedoch nicht erzwingen! - gehe die elterliche Sorge um die Kinder hervor, die mit ihrem strebensethischen und normativen Gehalt wiederum die natürliche Verantwortung ergänze.156 Beide zusammen verlangten, so Schockenhoff, dass Eltern der Fürsorge für ihr Kind vor den eigenen Bedürfnisse Priorität einräumten, und darin liege „keine unzulässige Einschränkung[] elterlicher Autonomie". Zur Begründung dieser Forderung verweist er im Kontext des Modells verantwortlicher Elternschaft auf den Grundgedanken der bedingungslosen Annahme eines Kindes um seiner Selbst willen.157 Übergeordnete Idee ist dabei die Unverfügbarkeit 151 vgl. Liening (1998) S.182 führt ein kindliches Interesse am Schutz vor Leid an, denn "es scheint jedoch abwegig, einem Menschen ein Interesse zu unterstellen, mit einer vermeidbaren Krankheit oder Behinderung geboren zu werden." 152 vgl. Netzer (1998) S.148. 153 vgl. Schmidt (2003) S.122. Auch Habermas (2005) S.36 erinnert an die fehlende Normativität des Faktischen. Eine Auseinandersetzung mit dem Vergleich von Genmanipulation und Erziehung folgt in Kapitel 6.5. 154 s. Haker (2003) S.368 mit einem Zitat von Jonas (1979). 155 s. ebd. S.367. 156 vgl. ebd. S.367 f.. Haker beschreibt hier die Ohnmachtserfahrung als Schlüssel zum Anderen und Auslöser des Sorgeempfindens, das sich durch „Streben nach dem Guten“, „Wohl-Wollen[]“ und nicht geschuldete „Rücksichtnahme“ gegenüber diesem Anderen auszeichne und einem Versprechen gleich komme. Vertiefend zur Sorge als selektive, „soziale Tugendpflicht“ bei O’Neill (1996) und zur feministischen Care-Ethik im allgemeinen s. Graumann (2003a) S.167 f.. 157 vgl. hierzu Schockenhoff (2003) S.381. Auch Haker (2003) S.365 äußert sich zum Stellwert der Sorge. 128 Befürchtete Folgen der PID menschlichen Lebens, während eine explizite Rückbindung der Selbstzwecklichkeit an die Menschenwürde ausbleibt. Den Hintergrund der Kontroverse zur PID und ihren Konsequenzen für das Eltern-KindVerhältnis bildet ein bereits erodiertes Elternschaftskonzept. Es zeichnet sich im wesentlichen durch vermehrte Reflexivität und Elektivität bezüglich innerfamiliärer Beziehungen sowie durch kulturell und medizinisch-technisch bedingte Veränderungen im reproduktiven Kontext aus.158 Letztere und die parallel dazu schwindende Bereitschaft der Menschen, Belastungen in Kauf zu nehmen,159 sollen die Ursachen eines bedingten Kinderwunsches sein. Die PID ermögliche seine Erfüllung und bereite so einem Konzept konditionierter Elternschaft den Weg, das im Widerspruch zur Bedingungslosigkeit, dem Kennzeichen der „modernen, reflexiven Elternschaft“, stehe.160 Schon die Etablierung der künstlichen, also unnatürlichen Befruchtung rief Bedenken hervor, dass in ihrem Fall die Übernahme elterlicher Verantwortung nicht länger als gegeben hingenommen, sondern gleich einem Amt partiell und aktiv wähl- bzw. aufkündbar würde. Die Erfahrung zeige aber, dass IVF-Eltern wie andere Eltern „ihre Kinder selbstverständlich als Personen an[nehmen], die ihrer Verantwortung überstellt sind.“161 O’Neills Meinung nach gebe es keinen Grund, ab dem Eintritt einer Schwangerschaft nach Präimplantationsdiagnostik nicht auch eine unkonditionierte Annahme des Kindes zu erwarten. Vor diesem Zeitpunkt jedoch, also in der Prospektive, sei die PID-Elternschaft aufgrund der Embryonenselektion konditioniert. Die Wahl dieses Blickwinkels antizipierter Elternschaft geht von einer grundsätzlich über ein Besitzverhältnis hinaus reichenden Verbindung zwischen Eltern und Embryonen aus. Für eine PID treten Eltern die gesamte Verfügungsmacht über und Verantwortung für ihre potenziellen Kinder, die sie gemäß einer projizierten Schwangerschaft besitzen, an Dritte ab. Zu klären ist, ob dieses Handeln aus einer Haltung der Verfügung heraus vom Standpunkt einer - hier prospektiven verantwortlichen Elternschaft aus moralisch zulässig ist.162 Im Streit um die Existenz eines moralischen Rechts der Eltern, über ihre Kinder zu verfügen, verweisen Gegner der PID darauf, dass das Recht auf reproduktive Autonomie als reines Abwehrrecht zu verstehen sei. Demnach sei, solange man menschlichen Embryonen nicht einen minimalen Schutzanspruch abspreche, eine elterliche Verfügungsmacht über diese nicht legitimierbar.163 In den Augen der Proponenten fungiert das Autonomierecht der Eltern innerhalb des 158 Eine detailliertere Darstellung des Erosionsprozesses liefert Haker (2003) S.363 f.. vgl. Schockenhoff (2003) S.393. 160 s. Haker (2003) S.372 161 s. ebd. S.368 unter Berufung auf eine empirische Untersuchung von McMahon und Ungerer (1995). 162 vgl. ebd. S.368 f. u.a. mit O’Neills (1988) Ansatz zur Bedingtheit der Elternschaft bei PID. 163 vgl. Schockenhoff (2003) S.385. 159 Befürchtete Folgen der PID 129 Rahmens medizinischer Indiziertheit als positives Recht und rechtfertigt daher den Einsatz der PID zur Verhinderung antizipierten Leids.164 Nun ist vor allem die Beziehung zwischen Eltern und Kindern von Interesse, die sich natürlicher Weise in einem Spannungsfeld zwischen dem Verlangen, die eigene Nachkommenschaft zu kontrollieren, und dem Bemühen derselben um Eigenständigkeit abspielt. Auch hier geht es um Verwirklichung von Autonomie, allerdings aus kindlicher Sicht. Dem elterlichen Wunsch, die Entwicklung ihrer Kinder zu lenken, steht ihre moralische Pflicht entgegen, diesen Kindern eine „offene Zukunft“ zu schenken165 und ihre Autonomie zu respektieren. Aus prospektivem Verantwortungsbewusstsein und positiver Hoffnung für ihren Nachwuchs heraus können Eltern sich auch deshalb für eine PID entscheiden, weil sie das beste Eltern-Kind-Verhältnis für sich und ihre Kinder wollen. Neben ihrer Ansicht, selbst mit einem betroffenen Kind überfordert zu sein, geht es ihnen vielleicht gerade darum, ihren Nachkommen gute Eltern zu sein, ihnen eine offene Zukunft mit der Möglichkeit zu bieten, selbständig zu leben und die Asymmetrie im Eltern-Kind-Verhältnis in Symmetrie zu überführen. Ausgehend von einer genetischen Krankheit oder Behinderung, die das Erreichen eines Lebens in Unabhängigkeit von vornherein ausschließt, ist dieses elterliche „Co-Motiv“, die genetische Ausstattung eines Kindes hinsichtlich eines konkreten Merkmals zu bestimmen, nicht per se illegitim166. Allerdings scheint das Bemühen um die vermeintlich beste und offenste Zukunft für ein Kind, auch genetisches Enhancement zu rechtfertigen. Dem gegenüber existiert jedoch schon deshalb ein Vorbehalt, da sich in einer positiven Merkmalsauswahl zugleich elterliche Anmaßung hinsichtlich der Autonomie und Freiheit eines Kindes verbergen kann. Auch negative Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung in Form bleibender Abhängigkeit durch genetisches Design sind vorstellbar. Gehen wir weiterhin von einer begrenzten Zulassung der PID aus, ist bereits aufgrund des Fehlens einer medizinischen Indikation, d.h. der notwendigen Bedingung für ein autonomes Anspruchsrecht, ihre Durchführung zur positiven Selektion ausgeschlossen, diente sie doch nicht der Verhinderung elterlichen Leids. Die alleinige Absicht der Eltern, die Freiheitsgrade ihres Nachwuchses zu vermehren, ist für eine PID nicht hinreichend. Aus der dargestellten Auseinandersetzung mit der elterlichen Verfügungsgewalt lässt sich schlussfolgern, dass von einem moralisch akzeptablen Merkmalsausschluss mittels PID keine negativen Folgen für das Verhältnis zwischen Eltern und ihren geborenen Kindern ausgehen und dass darüber hin- 164 Mit dem Autonomie-Argument setzt sich auch Kapitel 2.3 dieser Arbeit ausführlich auseinander. vgl. Haker (2003) S.367 mit einem Gedanken von Hans Jonas (1979). 166 Schmidt (2003) S.176 sieht dieses Motiv durch das „Abstellen [der Rechtfertigung] auf die Lebensqualität der Frau [...] als fraglos illegitimes Begehren [ge]brandmarkt." 165 130 Befürchtete Folgen der PID aus elterliche Bedürfnisse und Fürsorglichkeit einander nicht ausschließen, sondern konform zueinander sein können. 6.4 Gesellschaftliche Diskriminierung Der Einwand, dass die Präimplantationsdiagnostik diejenigen geborenen Menschen diskriminiere und somit indirekt in ihrer Würde verletze, die von einer durch sie abwendbaren angeborenen Behinderung oder Erkrankung betroffen sind, wurde in dieser Arbeit schon mehrfach genannt.167 Er wendet sich nicht ausschließlich gegen eine Zulassung der PID, sondern ist bereits aus der Kontroverse zur Pränataldiagnostik bekannt und ließe sich ebenso gegen eine Anwendung der Polkörperdiagnostik vorbringen. In diesem Abschnitt soll es darum gehen, die bisherigen Ausführungen in einem gemeinsamen rechtlichen und sozialen Kontext zu verorten und anhand der Darstellung weiterer Aspekte zu vertiefen. Es gilt außerdem zu klären, ob und wenn ja, warum der Vorwurf der Diskriminierung im Fall der PID im Vergleich zur PND verändert und eventuell gewichtiger erscheint. 6.4.1 Das Diskriminierungsverbot Sowohl im internationalen als auch im nationalen Recht ist der Gleichheitsgrundsatz verankert.168 Er sichert allen Menschen Gleichheit vor dem Gesetz und in der Trägerschaft aller darin festgelegten Grundrechte und Freiheiten zu und impliziert daher ein Verbot jeglicher Form von Diskriminierung. Diskriminierung meint dabei nicht Ungleichbehandlung per se, sondern die gemäß der angeführten Begründung „ungerechtfertigte Ungleichbehandlung“ menschlicher Individuen oder einzelner Gemeinschaften.169 Nur diejenige Benachteiligung also, die im Fall der PID durch eine hereditäre Behinderung oder Erkrankung selbst motiviert ist, ist diskriminierend. Die Warnungen vor einer Diskriminierung Betroffener lassen sich hinsichtlich ihrer Begründung untergliedern in 1) „intrinsische“ und 2) „folgenorientierte“ Argumente. Erstere beziehen sich auf die in einer konkreten selektiven Handlung zum Ausdruck kommende, ablehnende Grundhaltung gegenüber Kranken und Behinderten. Letztere nehmen dagegen die langfristigen Auswirkungen 167 U.a. beim Vergleich von PID und PND hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Folgen in 3.1.3, im Zusammenhang mit der Freiwilligkeitsbedingung autonomer Entscheidungen in Kapitel 4.1.2 sowie im Zusammenhang mit der Problematik der Aufstellung einer Indikationsliste in 5.1.3. 168 vgl. Art.3 des deutschen Grundgesetzes, Art.2 und 7 der UN-Menschenrechtserklärung (1948) und Art.1 der Bioethikkonvention des Europarats (1997). Ein explizites Diskriminierungsverbot beinhalten Art.14 der Menschenrechtskonvention des Europarats (1950), Art.21 der Grundrechtscharta der Europäischen Union (2000) und Art.11 der UNESCO - Erklärung über Bioethik und Menschenrechte (2005). 169 vgl. Lübbe (2003) S.204. Befürchtete Folgen der PID 131 der Summe selektiver Handlungen auf die Behindertenfreundlichkeit einer Gesellschaft in den Blick.170 6.4.2 Intrinsische Argumente Kritiker der PID sehen in ihrer Inanspruchnahme und Anwendung eine implizite, moralisch unzulässige Bewertung des Lebens derer, die Träger des jeweils fraglichen Merkmals sind. Indem sie den Lebenswert anhand von Fähigkeiten171 bemesse bzw. genetische Gesundheit als prognostischen Maßstab für Lebensqualität und Lebenserwartung anlege, verstoße eine solche Beurteilung gegen die Menschenwürde geborener Merkmalsträger. Dem widerspricht Quante, dessen Ansicht nach Lebensqualitätsbewertung entsprechend vier verschiedenen Standards erfolge, unter denen der intersubjektiv-rationale und der subjektive, doch rational nachvollziehbare Standard maßgebend seien. Wertender Umgang mit dem eigenen Leben sei ein „essenzieller Bestandteil unseres Verständnisses von Personalität“. Daher liege nahe, dass Werturteile und Menschenwürde nicht grundsätzlich unvereinbar seien. Nur mit ihrer Hilfe könnten wir überhaupt unser Gegenüber achten und seine Bedürftigkeit erkennen.172 Schmidt versucht, den Vergleich von Lebensqualitäten, deren Sicherung auch sonst z.B. durch Poliomyelitis-Impfung akzeptiert sei, von einer Beurteilung des Lebenswerts zu trennen.173 Dieser Ansatz wirkt allerdings konstruiert und unpassend, zumal die Anwendung des Qualitätsbegriffs eigentlich immer eine Wertung impliziert. Außerdem sind die Vernichtung eines von Geburt an behinderten Lebens und die medizinische Prophylaxe einer Erkrankung mit eventueller Behinderungsfolge aus ethischer Sicht unterschiedlich zu beurteilen. Problematisch ist ohnehin, dass - wie empirische Studien belegen - Wahrnehmung und Bewertung einer Krankheit oder Behinderung aus der Perspektive Außenstehender nicht mit dem Urteil Betroffener übereinstimmen,174 d.h., dass das Kriterium der Nachvollziehbarkeit des subjektiven Standards nach Quante nicht erfüllt ist. Die Grenze zwischen akzeptabler und nicht akzeptabler Lebensqualität scheint nicht rational ermittelbar zu sein. Bevor die Unterschiede in der Perzeption eines Lebens mit Behinderung herausgearbeitet werden, soll zur Erleichterung des weiteren Verständnisses eine kurze Auseinandersetzung mit 170 vgl. ebd. mit einem Ansatz von Birnbacher (2000). Schramme (2003) S.339 zufolge habe Scully heraus gearbeitet, dass die mit dem „expressivist argument“ kritisierte Botschaft der Handlung weder eindeutig noch im Einzellfall erkennbar sei, sondern dass es auf ihren politischen Bezugsrahmen ankomme. 171 z.B. die „Fähigkeit, ein gutes Leben zu haben“ als Maßstab für den Schweregrad einer Behinderung. Vgl. Woopen (2000) S.128 mit diesem Vorschlag von Holm (1998). 172 vgl. Quante (2003) S.144-148. Vgl. hierzu auch Abschnitt 6.3.2 dieser Arbeit. 173 vgl. Schmidt (2003) S.21 und 154. Die Beachtung „impersonelle[r] interpersonelle[r] Interessen“ [im Original hervorgehoben, A.S.] an der kindlichen Lebensqualität wertet er als einen Akt besonderer elterlicher Verantwortung. Vgl. hierzu ebd. S.161. 174 vgl. Schramme (2005) S.338. 132 Befürchtete Folgen der PID dem Begriff der Behinderung erfolgen. Der deutschen Rechtsliteratur zufolge sind Menschen behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“.175 In dieser Definition klingen bereits zwei Dimensionen von Behindertsein an: die medizinisch nachweisbare Deviation vom „Normalzustand“ und die dadurch bedingte Störung der sozialen Partizipation. Als dritte Dimension ist die Selbstinterpretation der Behinderung durch die Betroffenen zu ergänzen. Ihr und dem Umgang mit der eigenen Situation kommt sowohl im Fall einer Behinderung als auch im Fall chronischer Erkrankung wesentliche Bedeutung zu. Diese beiden Zustände gehen, vor allem wenn sie genetisch verursacht sind und das Leben der Merkmalsträger von Beginn an prägen, fließend ineinander über. Ein Vergleich des „Ist- mit einem SollZustand“ entfällt dann dadurch, dass letzterer, wenigstens aus eigener Erfahrung, nicht bekannt ist - im Gegensatz zur Situation bei einem später eingetretenen Funktionsverlust durch Krankheit oder Unfall.176 Einige von Geburt an behinderte und erkrankte Menschen sähen ihren Zustand anhaltender und nicht ursächlich behandelbarer physischer oder mentaler Beeinträchtigung als „besondere Form der Gesundheit“ an.177 Behinderung stelle sich für sie als nichts weiter als eines der Extreme eines Kontinuums von Fähigkeiten verschiedener Abstufungen dar.178 Dies kommt auch in der Feststellung „Es ist normal, verschieden zu sein“ von Richard von Weizsäcker zum Ausdruck, auf die die Leitgedanken verschiedener Initiativen der Behindertenbewegung rekurrieren.179 Vor diesem Hintergrund akzeptierten die Betroffenen ihr Schicksal als naturgegeben und nähmen ihre Zukunft trotz objektiv reduzierter Möglichkeiten als „gefestigt und offen konstituiert“ wahr.180 Nicht im Verhältnis zu sich selbst, sondern erst im Verhältnis zum und im Vergleich mit dem Anderen werde Behinderung bewusst gemacht. Lanzerath präzisiert diesen Punkt wie folgt: 175 vgl. neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) §2 und Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) §3. vgl. Lanzerath (2000) S.327 zur Selbstinterpretation bei Behinderung in Abgrenzung zur Selbstinterpretation bei Krankheit. Auch Reindal (2000) S.92 hebt die Bedeutung der Wahrnehmung von Behinderung durch die Betroffenen hervor und fordert ihre Beachtung in der medizinethische Diskussion zur Gentherapie. 177 s. Lanzerath und Honnefelder (1998) S.62 unter Berufung auf den Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte (1990). 178 Diese Beschreibung benutzen Plomin und DeFries (1998) S.66. Sie zeigen die Problematik eines rein qualitativen Behinderungsbegriffs auf, der eine analytische Kluft zu quantitativ beschriebenen Merkmalen schaffe. Untermauert wird dieser Standpunkt durch ihre Untersuchung zur Dyslexie, die auf eine mit der Lesefähigkeit gemeinsame genetische Grundlage hindeutet. 179 So u.a. das Diakonische Werk der EKD, der Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter e.V., das deutsche Down-Syndrom InfoCenter usw.. 180 s. Lanzerath (2000) S.327 mit Hinweis auf Rawlinson (1982).. 176 Befürchtete Folgen der PID 133 „Die Erfahrung für den Betroffenen, behindert zu sein, erschließt sich primär durch die Abweisung, Distanzierung, Missachtung und soziale Ausgliederung, d.h. in der Erfahrung, dass die eigene Entfaltung und Eingliederung in die Gesellschaft behindert wird.“181 [Hervorhebungen übernommen, A.S.] In Kombination mit der Meinung, dass das physische oder mentale Attribut der Behinderung nur eine Variante eines Gesundheitszustands benenne, entsteht die Überzeugung, dass Behinderung letztlich ein rein soziales Konstrukt sei. Die gesellschaftlichen, auf die Bedürfnisse vermeintlich gesunder Menschen abgestimmten Verhältnisse seien Ursache der Behinderung und der mit ihr einhergehender Belastung. Logische Schlussfolgerung dieses Gedankens scheint die Notwendigkeit zu sein, diese behindernde Lebenswelt umzugestalten.182 Von Ferber fasst alle Ansätze, die Gesundheit Betroffener zu sichern und ihnen die „Bewältigung des handicap[s]“ zu erleichtern, unter „Salutogenese“ zusammen.183 Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Behinderung sich aus einer sozialen und einer medizinischen Komponente zusammensetzt, bleibt die Frage nach der Gestaltung einer behindertenfreundlichen Gesellschaft als Ansatz zur Vermeidung von Diskriminierung von Bedeutung. In den Augen Gesunder steht meistens die „Pathogenese“, d.h. das „Normabweichende“ und „Defizitäre“ eines Lebens mit Behinderung und chronischer Erkrankung im Vordergrund. Sie wird in erster Linie mit Leiden analogisiert, da die Ansicht weit verbreitet ist, dass nur uneingeschränktes Leben gelingen kann. Doch "[a]uch mit besonderem Leid verbunden, kann dies kein Grund sein, dem Menschsein unter solchen Bedingungen Lebensqualität, geschweige denn Lebenswert abzusprechen.“184 Eine Lebensbewertung, so ein Einwand von Seiten Netzers gegen diesen Vorwurf, fände im Fall der PID allerdings nur statt, wenn ihre Rechtfertigung aus kindlicher Perspektive das Abwägen embryonaler Interessen am Leben gegeneinander erforderte.185 Die Begründung der Anwendung einer PID vom elterlichen Standpunkt in einem antizipierten Konflikt aus beinhalte kein Lebenswerturteil und konfligiere daher weder mit dem Würdeprinzip noch mit dem Benachteiligungsverbot.186 Trotzdem lässt sich der Diskriminierungsvorwurf allein durch das Abstellen auf die Subjektivität der Entscheidung, wie mit der Reform des §218 intendiert,187 nicht ausräumen, sondern nur vordergründig entkräftigen. Die Überforderung, welche die Paare durch Selektion abzuwenden versuchen, bleibt schließlich an die Bewertung eines geneti- 181 s. ebd. S.328. vgl. hierzu Lübbe (2003) S.206 f.. 183 s. Ferber, von (2000) S.322. 184 s. Lanzerath und Honnefelder (1998) S.64. 185 vgl. Netzer (1998) S.150. Zur Negation eines Rechts auf Nicht-Existenz vgl. Abschnitt 3.2.2. 186 Diese Ansicht ist bereits aus dem Abschnitt 3.1 bekannt. 187 vgl. FN 13 in Abschnitt 3.1.1. 182 134 Befürchtete Folgen der PID schen Risikos und seiner Folgen geknüpft, in die auch ein Lebensqualitätsurteil einfließen kann. "Letztlich geht es [möglicherweise] auch um eine Wertbestimmung des Menschen durch den Menschen"188 [Hervorhebung im Original, A.S.], anhand derer die prospektiven Eltern zu dem Schluss kommen könnten, dass sie, auch dem ungeborenen Kind Gutes täten, wenn sie ihm eine leidvolle Existenz ersparten.189 Darüber, dass zumindest ein so motiviertes social sexing, wie es in anderen Kulturen mit Hilfe der PID stattfindet, sexistisch und diskriminierend ist, herrscht ein breiter Konsens, dessen Ausweitung auf die Vermeidung behinderten Lebens naheliegend scheint, aber nicht erfolgt. Die einzige Möglichkeit, solch ein diskriminierendes Motiv endgültig auszuschließen, bestünde in der Entkopplung des Unzumutbarkeitsurteils bei PND oder PID von Behinderung und Krankheit. Dies erforderte den totalen Verzicht auf Diagnostik oder wenigstens auf eine Ergebnisbekanntgabe nach PND,190 infolge dessen sich die Unterteilung der Abbruchsregelung in Fristenlösung und medizinische Indikation erübrigte - letzterer wird ohnehin eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vorgeworfen, da Rechtmäßigkeit, Unbefristetheit und fehlende Beratungspflicht behindertes Leben benachteiligten. Im Anschluss an ein Diagnostik- oder Auskunftsverbot beschränkte sich die medizinische Indikation auf eine Gefährdung der mütterlichen Gesundheit während der Schwangerschaft. Eltern müssten demnach Belastungen infolge einer kindlichen Behinderung hinnehmen, wenn sie andernfalls ein gesundes Kind angenommen hätten.191 Hieraufhin stellte sich aber die Frage, ob nicht die Verweigerung von Informationen, die für die mütterliche Gesundheit relevant sind, das Grundrecht der Mutter auf körperliche Unversehrtheit verletzte.192 Das Vermögen, Schwierigkeiten im Familienleben mit einem betroffenen Kind anzunehmen und zu bewältigen, korreliere Schockenhoff zufolge mit der Haltung der prospektiven Eltern gegenüber Krankheit und Behinderung.193 Im allgemeinen sind Stimmen, die Belastungen durch Behinderung oder das Leben mit einem behinderten Kind vollkommen abstreiten oder stattdessen ihre bereichernde Wirkung hervorheben, selten. Ebenso wünscht kaum jemand sich oder seinem Nachwuchs eine Behinderung. Eine Studie von Richter et al. beschreibt dennoch bei gegenüber der PID aufgeschlossenen Risikopaaren eine positivere Einstellung gegenüber Behin- 188 s. Hepp (2003) S.344 zur Lebensqualitätsfrage in der Pränatalmedizin. vgl. Beck-Gernsheim (1998) S.64 „ein Akt der ‚Fürsorge fürs ungeborene Kind’“. 190 Lübbe (2003) S.216 stellt weiterführend die Frage nach einem „Recht des Embryos auf sein genetisches Inkognito“, das gegen ein elterliches Recht auf Wissen abzuwägen wäre. 191 vgl. ebd. S.211. 192 vgl. Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht e.V. (2005) S.118. 193 vgl. Schockenhoff (2003) S.392. 189 Befürchtete Folgen der PID 135 derten als bei Mitgliedern der Kontrollgruppe.194 Eine Erklärung hierfür mag darin liegen, dass einige PID-Paare bereits Eltern eines betroffenen Kindes sind und daher eher entschlossen sind, Behinderte zu unterstützen - auch wenn sie sich selbst mit einem zweiten betroffenen Kind überfordert sehen. Eine genetische Erkrankung bzw. Behinderung sei, so Lübbe, im Gegensatz zu einem relativen Konkurrenznachteil, den der Verzicht auf den Ausschluss sozial unerwünschter oder auf die Auswahl erwünschter Merkmale provoziere, für Eltern und Kinder eine absolute Belastung. Ein Zwang, diese anzunehmen, dürfe daher nicht Inhalt des Benachteiligungsverbots sein.195 Ihre Absolutheit rechtfertige die Abwehr der Belastung. Lübbe bemerkt in diesem Kontext, dass Grundrechte wie das Diskriminierungsverbot zwar eine Schutzpflicht des Staates gegenüber dem einzelnen Bürger begründeten, jedoch nicht seinen Eingriff in die Gestaltung persönlicher Beziehungen verlangten, zumal sich "in solchen privaten Wahlakten Freiheit realisiert die Möglichkeit, dem nachzugehen, was [...] der eigenen Vorstellung vom guten Leben entspricht." Auch die PID gestalte den „Nahbereich“ der Risikopaare, in dem sonst teilweise diskriminierende Selektion ungestraft stattfinde, weil eine staatliche Einflussnahme eben das Wesen frei gewählter Beziehungen veränderte.196 Da aber die autonome Entscheidung über eine PID das Grundrecht auf Leben der Embryonen berührt, die in ihrem Rahmen eigens gezeugt werden, ist sie an das Vorhandensein einer objektiven Indikation zu binden.197 Vereinbarungen zu Form und Inhalt dieser Indikation fallen wiederum in den öffentlich-rechtlichen Bereich. Die Indikationskriterien, besonders in Form eines Katalogs, können ebenfalls als Ausdruck impliziter Geringschätzung betroffenen Lebens gedeutet werden. Das heißt, dass der Staat aufgrund seiner Beteiligung an ihrer Gestaltung ebenso wie bei der Zulassungsfrage den potenziell diskriminierenden Ausdruck der PID bedenken muss, dessen Entstehung ggf. unmittelbar ihm selbst anzulasten wäre. Die rechtlich festgelegten Voraussetzungen selektiver Entscheidungen bezeichnet Maio als verletzend und die nachfolgende Vernichtung kranker Embryonen insofern als wertend, als sie deren Leben gegen das Leben gesunder relativiere.198 Aufgrund des hier hergestellten Zusammenhangs zwischen Lebenswerturteil und Recht auf Leben stelle die PID auch das Lebensrecht geborener Behinderter infrage. Allerdings setzt diese Behauptung die Annahme eines embryonalen Personstatus voraus, auf 194 vgl. Richter et al. (2004). vgl. Lübbe (2003) S.212-219. 196 s. ebd. S.215. Lübbe unterscheidet hier zwischen Iustitia und Caritas. Der Gedankengang Lübbes wird im Folgenden nur ausschnittsweise widergegeben. 197 Dazu, dass die PID - entgegen Lübbes Annahme - durchaus einen Tötungsakt darstellt s. Abschnitt 6.1.3, zur Verknüpfung von Autonomie und medizinischer Indikation vgl. Abschnitt 4.2.2 dieser Arbeit. 198 vgl. hierzu Maio (2001) S.893. 195 136 Befürchtete Folgen der PID dessen Kontinuität die Übertragbarkeit der Lebensrechtsrelativierung auf Geborene gründet.199 Ausgehend vom Progredienz-Modell könnte Spätabtreibungen derselbe Effekt unterstellt werden, auch wenn der Vergleich mit einem gesunden Fetus dabei imaginär bleibt. Mit dem Verweis auf den prä- und postnatal unterschiedlichen rechtlichen Lebensschutz und die diesbezüglich inkonsistente Gesetzeslage200 versuchen Proponenten von PND bzw. PID im Gegenzug, der Angst vor einer Schwächung des Lebensrechts Behinderter die Grundlage zu entziehen. Doch nicht allein die Statusfrage ist im Streit um das Vorliegen einer Diskriminierung von Bedeutung. Auch die direkten Auswirkungen der Vernichtung genetisch kranker Embryonen auf bereits geborene Betroffene sind in die Beurteilung der Problematik einzubeziehen. Die Tatsache nämlich, dass die Nichtexistenz genetisch Kranker und Behinderter angestrebt oder zumindest hingenommen werde, bedeute eine Demütigung der Betroffenen. Sie verletze, so gestehen auch einige PID-Befürworter ein, ihr subjektives Empfinden, nicht jedoch ihre Rechte, deren Schutz wiederum für die ethische Beurteilung ausschlaggebend sei. Daher sei das Kriterium der Diskriminierung nicht erfüllt.201 Andere Befürworter zweifeln selbst eine demütigende Wirkung auf die Betroffenen an: In modernen Gesellschaften bringe das allgemeine Streben nach Gesundheit selbstverständlich Ablehnung von und Angst vor Krankheit und Behinderung mit sich, ohne dass die Merkmalsträger deswegen abgelehnt oder weniger wertgeschätzt würden.202 Sie übersehen jedoch die prägende oder gar konstitutive Bedeutung von Behinderung für die personale Identität Behinderter. Quante konkretisiert hierzu, dass Konstitutivität erst durch Selbstevaluation eines Merkmals und nicht durch sein bloßes Vorhandensein entstehe und daher „die evaluative Identifikation mit einer Eigenschaft [...] zur Grundlage der [personalen] Menschenwürde“ werde. Er differenziert weiter, dass die stark negative Bewertung bestimmter Behinderungen nur diejenigen tatsächlich kränke, „die genau auf diesen Merkmalen ihrer Existenz ihre Selbstachtung aufbauen. Eine Würdeverletzung besteht jedoch erst dann, wenn es für diese positive Bewertung der so Betroffenen intersubjektiv-rationale Gründe gibt."203 Unter positive Bewertung falle bei enger Auslegung angesichts der Folgenschwere der Selektion menschlicher Embryonen und Feten bereits die nachvollziehbare Beurteilung einer Existenz mit der jeweiligen Behinderung als nicht lebensunwert.204 199 Dieser Aspekt ist schon aus der Würdeschutz-Diskussion bekannt. Vgl. Abschnitt 6.3.2. Vertiefend hierzu Hepp (2003) aus medizinischer und Kutzer (2002) aus juristischer Sicht. 201 vgl. Graumann (2003) S.164. Auf die daraus hervorgehenden Verständigungsprobleme zwischen Ethikern und Vertretern der Behindertenbewegung wird im Folgenden Bezug genommen. 202 vgl. Netzer (1998) S.149 und Schramme (2003) S.337. 203 s. Quante (2003) S.150. 204 ebd. S.151. 200 Befürchtete Folgen der PID 137 Berücksichtigt man, dass die Identitätsentwicklung menschlicher Individuen zu einem Großteil im Sozialisationsprozess stattfindet, rückt ihre Beeinflussung durch gesellschaftliche Werte und Normen ins Blickfeld. Wie bereits dargestellt wirkt die Fremdwahrnehmung von Behinderung und Behinderten als „aus der Norm fallend“ unmittelbar auf die Selbstwahrnehmung und -interpretation. Dass die Anwendung von PND und PID ihr Dasein verhinderbar werden lasse, erschwere daher neben der gesellschaftlichen Akzeptanz ebenso die Selbstakzeptanz der Betroffenen, die ihre Existenzberechtigung infrage gestellt sähen.205 Graumann unterscheidet in Anlehnung an Honneth drei Arten der sozialen Anerkennung: 1) emotionale Anerkennung in persönlichen Beziehungen, 2) rechtliche Anerkennung in der Gesellschaft und 3) Anerkennung gemeinsamer Werte innerhalb einer Kultur. Auf ihnen basiere jeweils das Erlangen von 1) Selbstvertrauen, 2) Selbstachtung und 3) Selbstwertgefühl, die für das Gelingen einer Identitätsbildung grundlegend seien. Umgekehrt gefährde jede Beeinträchtigung einer der Anerkennungsarten die „psychische[] Integrität von Menschen“ - die durch das Grundrecht auf Unversehrtheit geschützt ist. Daher sei naheliegend, „dass es berechtigte Ansprüche in allen drei Formen von Anerkennungsverhältnissen gibt.“206 Einen weiteren auf die Selbstinterpretation wirkenden Faktor stellt die mögliche bzw. tatsächliche Aufhebung der Kontingenz der physischen oder mentalen Konstitution dar. Sie kann besonders für die Identitätsfindung der nach der Etablierung selektiver Diagnostik geborenen Merkmalsträger problematisch sein. Die Nahbeziehung zu ihren Eltern können Zweifel belasten, ob diese sich bewusst, entgegen einem wachsenden sozialen Druck, für ihr behindertes Kind entschieden haben oder ob die Behinderung lediglich bei Kontrollen unerkannt geblieben ist. Auch hinsichtlich der gesellschaftlich-kulturellen Anerkennung Behinderter und ihrer Familien sind infolge pränataler Selektion Veränderungen denkbar, auf die noch näher einzugehen ist. 6.4.3 Folgen-Argumente Andere Abschnitte dieser Arbeit behandeln die Bedeutung gesellschaftlicher Folgen für Risikopaare, die mit der Entscheidung über eine Selektion ihrer behinderten Nachkommen konfrontiert werden. Die Kenntnis der diagnostischen Angebote207 überträgt ihnen eine neue Verantwortung vor sich, ihrem zukünftigen Kind, ihren Familien und der Gesellschaft. U.a. die kränkende Asso- 205 vgl. Schockenhoff (2003) S.391. s. Graumann (2003) S.165. Der Versuch einer moraltheoretischen Begründung dieser Ansprüche führe über deren Reziprozität zur Verallgemeinerbarkeit der Ansprüche auf Gleichheit und Differenz, die Voraussetzung einer ethischen Rechtfertigung sei. 207 In Abschnitt 5.1.3 wird diesbezüglich der verpflichtende Charakter eines Indikationskatalogs diskutiert, als dessen Alternative sich eine allgemeine Indikationsformel anbietet. 206 138 Befürchtete Folgen der PID ziation von Behinderung mit Leiden und der inakzeptable Hinweis auf die Unkosten, die Betreuung und Behandlung Betroffener verursachten und von der Solidargemeinschaft zu tragen seien, setzten prospektive Eltern zusätzlich unter Druck und bedrohten sie in ihrer Autonomie.208 Diese Aspekte werden in der Auseinandersetzung mit dem Eugenik-Argument im folgenden Kapitel vertieft. An dieser Stelle geht es vor allem um die Auswirkungen der PND und PID auf die Solidarität einer Gesellschaft mit chronisch Kranken und Behinderten, die wiederum auf die elterliche Entscheidung rückwirken können. Grundlage des Solidaritätsprinzips ist das Menschenwürde-Ideal, auf dem, wie zuvor dargestellt, unser Menschenbild gründet. Die Orientierung einer Gesellschaft an den Menschenrechten fordert von ihr, Voraussetzungen für ein gelingendes Leben aller zu schaffen.209 Spezielle Schutzansprüche und -rechte Schwächerer erklären sich also durch ihre Menschenrechts- und Würdeträgerschaft. Unsere Bereitschaft zur Realisierung von Solidarität, d.h. unsere Bereitschaft, Schwächeren zu helfen, beruht außerdem auf Kontingenzerfahrungen bezüglich der Ursachen von Hilfsbedürftigkeit. Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik lösen nun die Unvorhersehbarkeit genetisch bedingter Erkrankungen und Behinderungen auf und gefährden daher die soziale Akzeptanz von Solidarleistungen. Dabei, so Schockenhoff, zähle gerade „das Recht, in Grenzen und mit Behinderungen zu leben“ zur menschlichen Würde, denn alles Leben sei endlich und der Mensch in seinen Möglichkeiten begrenzt. „[D]as Ertragen von unabwendbarem Leid“ sei mit der Menschenwürde vereinbar und ein Teil des Lebens. Leidfreiheit aber bedeutete das Ende von Solidarität und Mitmenschlichkeit, da diese in der Begrenztheit menschlicher Existenz und der mit ihr verbundenen Last wurzelten.210 Gegen diese Ausführung ist vorzubringen, dass es sich gerade bei der Belastung der Eltern genetisch schwerkranker Kinder um abwendbares Leid handelt, das im direkten Umkehrschluss zu Schockenhoffs Gedankengang nicht ohne Weiteres mit ihrer Menschenwürde zu vereinbaren wäre. Liening warnt vor einer Instrumentalisierung Behinderter und Kranker aus der Intention heraus, unser Menschenbild zu erhalten, das sonst durch die Bewertung von Lebensqualität Schaden nähme211 - obwohl letztere andernorts, wie aufgezeigt, sogar als Voraussetzung des Erkennens von Bedürftigkeit bezeichnet, also gar nicht im Konflikt mit unserem Menschenbild gesehen wird212. Auch wenn mit dem Wissen aus genetischer Diagnostik das Motiv für ge- 208 vgl. Darstellungen zur PND in 3.1 und Autonomie in Kapitel 4. Ähnlich bei Lanzerath und Honnefelder (1998) S.63. 210 vgl. Schockenhoff (2003) S.393 f.. 211 vgl. Liening (1998) S.185. 212 s.o. zur Lebensbewertung bei Quante. Vgl. FN 172 in diesem Abschnitt. 209 Befürchtete Folgen der PID 139 sellschaftliche Solidarität verloren gehe, sei dies in einer individuumszentrierten Gesellschaft laut Quante kein Anlass, den Betroffenen die Solidarität zu kündigen, denn "Solidarität hört nicht dort auf, wo das Risiko, selbst von einem individuellen Leiden getroffen zu werden, nicht besteht. Gerade umgekehrt kann man sagen, daß sie dort im eigentlichen Sinne allererst entsteht" Das Interesse an einer Gesellschaft, die maximale Selbstbestimmung und Freiheit des einzelnen möglich zu machen versuche, sei ein guter Grund, sich um dieses Verständnis und diese Praxis von Solidarität zu bemühen.213 Quante bleibt in seiner Argumentation beim Wissen um ein Risiko stehen und weitet den Blick nicht auf die Abwendbarkeit einer Belastung von der Solidargemeinschaft, die aus diesem Wissen folgt. Erst diese bedingt aber die Zuspitzung auf einen Konflikt zwischen Individual- und Sozialethik, den Streit um das „Verhältnis der Option für den Respekt vor der individuellen Autonomie zur Option für gesellschaftliche Solidarität“.214 Denn nur angesichts einer Möglichkeit zu handeln kann es zu einem gesellschaftlichen Appell an die individuelle Verantwortung und zu Spannungen zwischen den Interessen des einzelnen und der Gesellschaft kommen. Das Anliegen, die Verwirklichung des größtmöglichen Freiheitsgrads aller in einer Gesellschaft zu unterstützen, das sich aus dem individuellen Bedürfnis nach Autonomie erklärt, ist nachvollziehbar. Doch scheint es im Fall präimplantativer und pränataler Diagnostik nahe zu liegen, von Risikopaaren ein Handeln zu fordern, das die Inanspruchnahme solidarischer Hilfe verhindert, anstatt diese ungeachtet der möglichen Selektion und eventuell um den Preis persönlicher Einschränkungen z.B. finanzieller Art zu garantieren. Aus diesem Grund existiert die Befürchtung einer zukünftigen Gefährdung der Solidarität mit und der Versorgung von allen von einer schweren, genetisch diagnostizierbaren Krankheit Betroffenen. Während die Meinungen über das der PID intrinsische Kränkungspotenzial vor dem Hintergrund der dominanten negativen Perzeption von Behinderung in der Gesellschaft auseinander gehen, besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Entsolidarisierung infolge der PID die Würde behinderter Menschen verletzte und sie demütigte.215 Über soziale Isolierung und nachlassende Unterstützung Behinderter würde die Anwendung der PID schließlich zum Zwang. Denkt man diese Entwicklung im Sinne des Slippery-Slope-Arguments zuende, zöge die Legalisierung der PID, verstanden als Legalisierung indirekt bekundeter negativer Lebenswerturteile, nach 213 s. Quante (1997) S.226 f.. s. Mieth, Graumann, Haker (1999a) S.138. 215 vgl. Quante (2003) S.151 Durch Solidarität würde die Entscheidung für das Leben favorisiert. Selektion behinderten Lebens bedeute daher nicht, dass die PID, sondern dass der Mangel an Solidarität die Menschenwürde verletze. Hier sei anzusetzen, um die neuen Techniken „in ethisch akzeptabler Weise“ anwenden zu können. 214 140 Befürchtete Folgen der PID ihrer Ausweitung die direkte Bewertung des Lebens älterer oder nicht genetisch bedingt Behinderter nach sich.216 Als äußerstes Ausmaß des Unmoralischen folgte am Ende die Tötung Behinderter aller Altersstufen. Innerhalb der Gesellschaft käme es zu einer „Desensibilisierung gegenüber behindertem und eingeschränktem Leben“ und einer allgemeinen „Schwellenerniedrigung gegenüber der Tötung auf Verlangen“.217 Menschenwürdeprinzip und die Menschenrechte würden mit dem Voranschreiten dieser Entwicklung immer weiter ausgehöhlt. Abgesehen von dem verbreiteten Gegenargument, dass das tatsächliche Eintreten des beschriebenen Szenarios zum heutigen Zeitpunkt nicht beweisbar sei und somit auch als Einwand gegen die Einführung technischer Neuerungen wenig Gewicht habe, verweisen Proponenten im Kontext der PND und PID gern auf die Verteilung der Behinderungsursachen. Nur 5-10 % aller Behinderungen und Erkrankungen seien auf hereditäre bzw. pränatale Ursachen, der Rest sei hingegen auf postnatale Ätiologien zurückführbar.218 Durch pränatale Selektion könne daher nur ein relativ geringer Anteil aller Behinderungen verhindert werden, und der Normalverteilung zufolge würden trotz ihrer Zulassung auch weiterhin 5 % aller Menschen von der „Norm“ abweichen.219 Die Gesamtzahl Behinderter verändere sich durch selektive Schwangerschaftsabbrüche und die Anwendung der PID jedenfalls kaum. Es sei also nicht davon auszugehen, dass in Zukunft behinderte Menschen in unserer Gesellschaft weniger oder schlechter vertreten seien und ihre Stimme in der Öffentlichkeit an Gewicht verliere. Außerdem sei die Annahme falsch, dass gesellschaftliche Diskriminierung mit einer steigenden Anzahl Behinderter abnehme.220 Viele Behinderte seien schließlich nicht automatisch gleichzusetzen mit einer vermehrten Förderung ihrer Integration und politischen Partizipation. Der geringe Anteil genetisch bedingter Behinderungen ist auch hinsichtlich der Allokationsfrage in einem immer teureren Gesundheitswesen von Bedeutung. Seinetwegen verbietet sich aus ökonomischer Sicht die Verwendung großer Ressourcen für die Entwicklung und Etablierung neuer „präventiver“ Methoden, insbesondere solange ihr Nutzen ungewiss ist. Das dennoch vorhandene gesundheitspolitische Interesse an der Bekämpfung bzw. Eliminierung erblicher Erkrankungen macht ein Abwägen erforderlich: zwischen dem dafür nötigen Aufwand und seinem versprochenen Nutzen auf der einen und den Kosten, die in staatlichen Fördereinrichtun- 216 vgl. Eibach (2000) S.119. s. Mieth (1997) S.159. 218 vgl. Schmidt (2003) S.157, Haker (2003) S.372. 219 vgl. Hildt (1998) S.217 mit einem Zitat von Steel (1994). 220 vgl. Liening (1998) S.184. 217 Befürchtete Folgen der PID 141 gen, durch die Therapien chronischer Erkrankungen usw. anfallen, auf der anderen Seite.221 Grundsätzlich und unabhängig vom Ergebnis einer solchen Kosten-Nutzen-Analyse mahnt Mieth, dass sich „[a]uf diese Argumentation [...] die Gesellschaft keinesfalls einlassen [sollte], denn das Leben eines Menschen kann nicht an den Kosten gemessen werden, die für seine Erhaltung aufgebracht werden müssen."222 In der Tat sind diese objektiven Überlegungen und Wertungen äußerst herabwürdigend. Geht es doch eigentlich um die Frage, wie viel Geld die Solidargemeinschaft aufbringen will, um Benachteiligte zu unterstützen, oder ob sie stattdessen sparen sollte, indem sie die Möglichkeit schafft, das Geborenwerden dieser Benachteiligten zu verhindern. Es wird deutlich, dass wir uns hier immer mehr eugenischen Gedanken nähern, deren Darstellung dem folgenden Abschnitt vorbehalten ist. 6.4.4 Frühgeburtlichkeit und Behinderung Ein weiterer in der Debatte wenig berücksichtigter Aspekt im Kontext der Behindertenanzahl geht auf die verbesserte medizinische Versorgung Frühgeborener zurück. In den letzten 30 Jahren seit Beginn der neonatalen Intensivmedizin ist es gelungen, das Überleben immer kleinerer Frühgeborener zu sichern. Parallel hierzu ist in den Industrienationen eine Zunahme an Frühgeburten zu beobachten, die u.a. auf Interventionen in der Geburtshilfe wie Kaiserschnitt und Weheninduktion sowie IVF-Schwangerschaften zurückgeführt wird.223 Auch fetale Anomalien können Frühgeburtlichkeit zugrunde liegen.224 Aufgrund ihrer zum Teil extremen Unreife sind Frühgeborene einem erhöhten Morbiditätsrisiko ausgesetzt, von dem vor allem ihre neuro-sensorische und -motorische Entwicklung betroffen sind.225 Außerdem besteht ein höheres Risiko für postnatale Komplikationen wie cerebrale Hämorrhagien oder Ischämien, periventrikuläre Leukomalazie und Infektionen, die zum Auftreten einer infantilen Cerebralparese führen können. Angaben zum Auftreten schwerer Behinderungen reichen von 23 % der Frühgeborenen zwischen 20 und 25 vollendeten SSW226 bis mehr als 50 % der Neugeborenen unter 1500g Geburtsgewicht 221 Haker (1998) S.260 regt hier gemäß einer Übertragung der Rawlsschen Gerechtigkeitstheorie die Anwendung des Maximinprinzips als Solidaritätsprinzip auf die Kosten-Nutzen-Abwägung an. 222 s. Mieth (1999) S.85. 223 vgl. Cano, Fons, Brines (2001) S.487 f.. 224 vgl. Allen (2002). 225 Frühgeborene leiden vermehrt unter Retinopathie, Hörverlust sowie Störungen im kognitiven und kommunikativen Bereich. Zur Häufigkeitsverteilung der einzelnen Schädigungen s. Colvin, McGuire, Fowlie (2004). Msall und Tremont (2002) stellen auch die weitere Entwicklung Frühgeborener bis ins Erwachsenenalter dar. 226 vgl. Cano, Fons, Brines (2001) S.490. Colvin, McGuire, Fowlie (2004) S.1390 geben an, dass 50 % der Kinder <26 SSW behindert seien, die Hälfte davon schwer, was bedeute, dass sie Hilfe im Alltag brauchten. 142 Befürchtete Folgen der PID (VLBW = Very Low Birth Weight)227. Im Alter von fünfeinhalb Jahren seien laut van Baar et al. 61 % aller vor 30 SSW geborenen Kinder ein- oder mehrfachbehindert.228 Aufgrund des uneinheitlichen Aufbaus und der Anwendung jeweils anderer Kriterien gestaltet sich ein Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien schwierig. Uneindeutig sind auch die Angaben hinsichtlich der Frage, ob die verbesserte Überlebensrate Frühgeborener möglicherweise den Anteil behinderter Menschen in der Gesamtbevölkerung erhöht. So beschreibt eine Studie eine über 20 Jahre stabile Inzidenz schwerer Behinderungen bei Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1000g (ELBW = Extremely Low Birth Weight)229, deren Überlebensrate deutlich angestiegen ist. Eine andere weist nach, dass dennoch die Anzahl überlebender cerebralparetischer Frühgeborener nicht ausreiche, um das bisherige Ausbleiben einer allgemeinen Abnahme an Cerebralparesen zu maskieren. Vielmehr mache deren unveränderte Prävalenz den fehlenden Effekt pränataler Überwachung und Maßnahmen deutlich.230 Bracewell und Marlow weisen auf sich widersprechende Aussagen zur Entwicklung der Cerebralpareserate zwischen Untersuchungen einer Geburtsgewichts- und einer Krankenhaus-basierten Frühgeborenenpopulation hin und arbeiten im Zusammenhang mit ersterer die parallele Entwicklung von Überlebensrate und Prävalenz von Cerebralparesen heraus.231 In einer jüngeren Publikation greift Marlow diese Beobachtung wieder auf und äußert sich zur Diskussion um eine Zunahme der Behindertenzahl wie folgt: „This is a difficult line to travel down, as the arguments are extremely tenuous and to a large extent depend on the balance between non-disabled and disabled survivors; this in turn depends on the ethical framework of the society in which we practice.”232 Tatsächlich hängt, wie hier angesprochen, die Überlebensrate behinderter Früh- und Neugeborenen und somit auch ihre Bedeutung hinsichtlich der Gesamtbehindertenzahl nicht nur vom medizinisch Machbaren ab. Der Umgang mit diesen Kindern wirft vor allem an den Grenzen der Lebensfähigkeit Fragen nach dem Einsatz limitierter Ressourcen zur Lebensverlängerung und nach der moralischen Zulässigkeit von Früheuthanasie auf. Eine genauere Auseinandersetzung mit der sich hier abzeichnenden Problematik führte an dieser Stelle zu weit. Es bleibt abschließend festzuhalten, dass der medizinische Fortschritt auf der einen Seite die vorgeburtliche Selektion Behinderter, auf der anderen Seite das Überleben zum Teil schwerstgeschädigter Neugeborener 227 vgl. Allen (2002a) S.222. vgl. van Baar et al. (2005) S.252. Eine weitere Follow-up Studie extrem Frühgeborener (<26 SSW) bis zum 6. Lebensjahr mit Fokus auf einer möglichen Vorhersagbarkeit führten Marlow et al. (2005) durch. 229 vgl. Cano, Fons, Brines (2002) S.490. 230 vgl. Clark und Hankins (2003). 231 vgl. Bracewell und Marlow (2002) S.242 f.. 232 s. Marlow (2004) S.F 225. 228 Befürchtete Folgen der PID 143 möglich und in jedem Fall eine ethische Reflexion dieser neuen Handlungsoptionen dringend erforderlich macht. 6.4.5 Der gesellschaftliche Status quo Die Berechnung finanzieller Vorteile und einer möglichen Reduktion des Bevölkerungsanteils der Menschen mit Behinderung bleiben theoretische Überlegungen und somit in ihrer Aussagekraft hinsichtlich darüber hinausgehender, diskriminierender Effekte begrenzt. Anhand einer Beschreibung des Status quo der Gesellschaften, in denen pränatale Diagnostik seit mehreren Jahrzehnten die Geburt behinderter und kranker Kinder zu vermeiden hilft, lässt sich dagegen das tatsächliche Eintreten sozialer Implikationen prüfen. Außerdem bleibt der Frage nachzugehen, ob von der PID eine spezifische Diskriminierungsgefahr ausgeht. Hierbei sind die Erfahrungen der Länder von Interesse, in denen die Präimplantationsdiagnostik bereits seit Längerem durchgeführt wird. Seit Einführung selektiver Schwangerschaftsabbrüche sei keine stärkere Ausgrenzung behinderter und chronisch kranker Menschen zu beobachten. Vielmehr hätten sich die Lebensbedingungen für sie in diesem Zeitraum deutlich verbessert. Dieser sozialpolitische Wandel sei allerdings weniger auf eine Initiative der nicht-behinderten Bevölkerung, als vor allem auf die zunehmende Organisation und Präsenz diverser Behinderten- und Interessensverbände in der Öffentlichkeit zurück zu führen.233 Empirischen Studien zufolge zeichneten sich die Haltungen verschiedener Personengruppen gegenüber selektiven Diagnosemethoden sowie gegenüber Behinderten durch Heterogenität aus. Dennoch habe sich insgesamt - entgegen der erwarteten Akzeptanzabnahme - die Einstellung Gesunder zu Behinderten zum Positiven verändert.234 Das Wachstum der gesellschaftlichen Anerkennung Behinderter korreliere dabei positiv mit der Anmeldung „ihre[r] Ansprüche im Selbsthilfegedanken in organisierter Art und Weise“.235 Der Zugang zu Behinderung sei heute nicht länger ein rein caritativer oder medizinischer, sondern ein zunehmend integrativer.236 Trotz dieser objektiven Veränderungen bestehen auf Seiten werdender Eltern die Angst vor einem behinderten Kind und der Wunsch nach Risikominimierung mittels PND sowie auf Seiten der Betroffenen die Angst vor Entsolidarisierung und das Gefühl gesellschaftlicher Geringschätzung infolge der sich verbreitenden Diagnostik fort. 233 vgl. Ferber (2000) S.322 zur Entwicklung in Europa und Kaplan (1999) S.130 zur Entwicklung in den USA. vgl. Schramme (2005) S.338. 235 s. Lanzerath (2000) S.329 mit einem Verweis auf Dörner (1997). 236 Ähnlich bei Kaplan (1999) S.130. 234 144 Befürchtete Folgen der PID Weder Gerichtsurteile, die betroffene Kinder zum Schadensfall erklären, noch die Diskussion um eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik sind wohl die richtigen Mittel, um die Befürchtungen der Behinderten zu entkräftigen, zumal die PID als eine verschärfte Selektionstechnik anzusehen ist: Sie erzeugt bewusst einen Konflikt, stellt dabei genetisch gesunde und kranke Embryonen einander direkt gegenüber, ermöglicht sogar die Auswahl erwünschter Merkmale und kalkuliert in jedem Fall die Verwerfung unerwünschter Merkmalsträger mit ein. Mit ihrer Zulassung werde die schon durch die PND entstandene „Vollkaskomentalität“237 prospektiver Eltern vorangetrieben und ihrem Streben nach einem gesunden Kind scheinbar Legitimation erteilt. Die PID fördere außerdem negative Auffassungen von Behinderung, und der selektive Embryonentransfer untermauere die negative Beurteilung der Lebensqualität Behinderter. Folglich wird der PID ein beträchtliches Diskriminierungspotenzial zugeschrieben. Doch der restriktive Einsatz der PID dient ausschließlich dem Ausschluss genetischer Behinderungen, während die Pränataldiagnostik auch postkonzeptionell entstandene, z.B. infektiös, toxisch oder Mangel-bedingte Malformationen erkennt und somit ein breiteres Spektrum an Behinderungen vermeidbar macht. Dieser Aspekt ist allerdings bedeutungslos, solange jeder PID noch eine Kontroll-PND folgt. Bisher, so berichtet das Minderheiten-Votum der EnquêteKommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des deutschen Bundestags, „gibt [es] keinerlei Nachweise dafür, dass Menschen mit Behinderungen in den Ländern, in denen PID angeboten wird, mehr unter Diskriminierungen zu leiden haben als andernorts.“238 Diese Beobachtung veranlasst die Befürworter der PID dazu, hervorzuheben, dass die PID nicht zwangsläufig zu gesellschaftlicher Entsolidarisierung von Behinderten und ihren Familien führe. Unter der Annahme, dass die Beweislast bei denjenigen liege, deren Verbotsforderungen auf negativen sozialen Folgen gründen, betrachten sie daher selbige als unberechtigt. Gegner der PID räumen ein, dass Folgen-Argumente zwar nicht hinreichend für die Forderung eines PID-Verbots seien, sie aber dennoch stützten.239 6.4.6 Verständigung mit Betroffenen und Ausblick für die Zukunft Graumann analysiert den Streit um eine mögliche Diskriminierung auf der Metaebene. Sie nimmt sich dazu der Perspektive der Behindertenbewegung an und differenziert zwischen Vorwürfen bezüglich des medizinischen Fortschritts und Kritik an der bioethischen Auseinanderset237 vgl. Schramme (2005) S.338. s. Enquête-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ (2002) S.109. Quante (2003) S.149 führt in diesem Kontext die „in vielem vorbildliche Integration behinderter Menschen in den Niederlanden“ an, in denen die PID durchgeführt wird. 239 vgl. Schockenhoff (2003) S.390. 238 Befürchtete Folgen der PID 145 zung mit dessen Auswirkungen. Die Kommunikation im Rahmen der ethischen Debatte sei dadurch behindert, dass aus moraltheoretischer Sicht keine Verletzung individueller Rechte durch die PID erkennbar sei, die für ein Verbot geltend gemacht werden könnte, dass es den Betroffenen selbst aber um die Gefährdung der Verwirklichung ihres Anspruchs auf kulturelle Anerkennung gehe. Ziel der Menschen mit Behinderung sei vor allem die soziale Achtung und Gleichwertung ihres Lebens in seinem Anderssein. Die von ihnen subjektiv empfundenen Kränkungen würden ebenso wie die „Verletzlichkeit des Menschen, seine[] Abhängigkeit von sozialen Beziehungen sowie seine[] individuell unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten“240 allgemein in der medizinethischen Debatte zu wenig beachtet.241 Graumann begründet den Anspruch aller Menschen auf kulturelle Anerkennung und fordert von der Ethik seine Berücksichtigung und Abwägung gegen andere Ansprüche.242 Wenn die Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen der Betroffenen schon nicht zu einem endgültigen PID-Verbot führt, so kann sie wenigstens sensibilisieren und praktische Ansätze zur Verringerung des Diskriminierungspotenzials anregen, die über eine restriktive Zulassung hinausgehen: Unmittelbar auf medizinisch-organisatorischer Ebene ist an eine verbesserte Gesundheitsaufklärung über genetische Erkrankungen und die Aussagekraft genetischer Informationen sowie an eine standardisierte Beratung vor und nach jeglicher Diagnostik zur Autonomieförderung zu denken. Ihr Ziel ist, den Umgang mit Krankheit und Behinderung zu üben und über „realistische, den Lebenserfahrungen der Betroffenen tatsächlich entsprechende Sichtweisen“ zu informieren243. Hilfsangebote auf gesellschaftlicher Ebene ermutigen Familien, die Verantwortung für ein betroffenes Kind zu übernehmen. Durch die eventuell erforderliche Pflege dürfen ihnen dabei keine Nachteile entstehen.244 Hierin und in der Achtung vor den Paaren, die sich für ihr behindertes Kind entscheiden, zeigt sich die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Das „Bedürfnis“ nach und damit die Bereitschaft zur Solidarität lässt sich möglicherweise über die Erzeugung eines „öffentlichen Problembewußtsein[s]“ sichern.245 Von Seiten der Sozialpolitik ist der bereits eingeschlagene Kurs der Gleichberechtigung mit Förderung von Integration, Partizipation und Selbstbestimmung beizubehalten. Dieser sollte auch vor dem Bereich der Medizinethik nicht Halt machen. Die vermehrte Einbindung Behinderter in die Schul- und Arbeitswelt - 240 s. Graumann (2003a) S.164. Diese Ignoranz gegenüber der Sichtweise Betroffener in der gesellschaftlichen Diskussion beschreibt auch Kaplan (1999) S.131, bezieht dies jedoch in erster Linie auf die Lebensqualitätsbewertung, mit der im englischen Sprachraum offener umgegangen wird. Vgl. hierzu auch Kuhse und Singer (1993) u.a. S.161. 242 vgl. Graumann (2003a) S.165-169. Vgl. auch Abschnitt 6.4.2 dieser Arbeit. 243 s. ebd. S.165. 244 Kollek (2002) S.224 fordert, die Pflege der Kinder ausreichend in die Rentenversicherung einzuberechnen. 245 s. Chadwick (1997) S.207 [Hervorhebung übernommen, A.S.]. 241 146 Befürchtete Folgen der PID ohne dabei zwangsläufig die Orientierung an Leistung und Wirtschaftlichkeit aufzugeben - ermöglicht einigen Betroffenen, sich selbst zu versorgen. Wahrscheinlich erleichtert sie zugleich den Abbau von Vorurteilen und fördert soziale Toleranz. Eine Veränderung der Umgebung der Menschen mit Behinderung verringert das Maß ihres Behindertseins und wirkt sich auch auf die Fremdwahrnehmung aus. Langfristiges Ziel auf der Ebene kultureller Anerkennung ist die „Dissoziation“ von Behinderung und Leiden mit gleichzeitiger Etablierung einer positiven Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung und verbreitetem Verständnis für die Besonderheiten ihres Lebens. 6.5 Neue Eugenik Über den Vorwurf der Diskriminierung hinaus reicht das Argument, dass die Präimplantationsdiagnostik das Eintreten einer neuen Eugenik ermögliche oder vorantreibe. Nach einer kurzen Einführung in die Systematik der Begriffe, die hinsichtlich verschiedener Arten der Eugenik Verwendung finden, sowie einem Blick in die Geschichte der Eugenik geht es in diesem Abschnitt darum, das potenzielle Einsetzen einer neuen Eugenik zu beschreiben und zu bewerten. Hierbei sind vor allem der gesellschaftliche Hintergrund und die medizinischen Maßnahmen, die einer eugenischen Bewegung Vorschub leisten können, zu beachten. Der Beitrag der PID zur Umsetzung eugenischer Absichten und die Mittel, einer Verfolgung eugenischer Prinzipien im allgemeinen und speziell im Fall der PID entgegen zu wirken bzw. sie gänzlich zu verhindern, sollen dabei Schwerpunkt der folgenden Ausführungen sein. 6.5.1 Begriff und Geschichte der Eugenik Der Begriff Eugenik meint „von guter Geburt“ und geht in seiner heutigen Verwendung auf Francis Galton, einen Cousin Charles Darwins, zurück. Dieser bezeichnete so 1883 die Wissenschaft, die sich mit der Verbesserung der Herkunft beschäftigte und das Ziel verfolgte, dass geeignete Rassen gegenüber weniger geeigneten vorherrschten.246 Schon damals wurde eine weitere Differenzierung in positive und negative Eugenik vorgenommen. Erstere meint Handlungen, die auf die Verbesserung des Genpools einer Bevölkerung abzielen, während letztere die Verhinderung der Weitergabe negativ bewerteter Merkmale bezeichnet. Historisch wird heutzutage zwischen der alten bzw. klassischen und der neuen Eugenik unterschieden. Synonym werden Ausdrücke wie staatliche oder autoritäre Eugenik „von oben“ und private oder liberale Eugenik „von 246 vgl. Wiesing (2006) S.329 mit einem Zitat von Galton (1973). Befürchtete Folgen der PID 147 unten“ verwendet. Darüber hinausreichende Unterteilungen sind hier für die weitere Auseinandersetzung mit Inhalt, Unterschieden und Gemeinsamkeiten klassischer und neuer liberaler Eugenik - die ausschließliche Verwendung dieser Begriffe möge im Folgenden das Verständnis erleichtern - entbehrlich.247 Erst die neuzeitliche Entwicklung eines wissenschaftlichen Zugangs zur Natur veränderte das menschliche Selbstverständnis derart, dass ein kreativer Umgang mit der Natur der eigenen Spezies denkbar wurde. Einem technisch-mechanistischen Menschenbild folgte die Evolutionstheorie mit der Erkenntnis, dass der Mensch ein durchaus mangelhaftes „Zufallsprodukt der Evolution“ ist.248 Sich daran anschließende sozialdarwinistische Überlegungen und zeitgleiche Entdeckungen im Bereich der Humangenetik waren Ausgangspunkte der Entstehung erster eugenischer Initiativen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es verbreitete sich die Überzeugung, dass medizinische Versorgung und soziale Fürsorge die natürliche evolutionäre Selektion überlebensschwacher Individuen behinderten. Degeneration und soziale Dekadenz infolge anhaltender oder gar vermehrter Fortpflanzung „entarteter“, gemäß der „Volksgesundheit“249 minderwertiger Individuen bedrohten die Bevölkerung.250 Da aus der Perspektive des genetischen Determinismus jede phänotypische „Entartung“ allein auf hereditäre Anlagen zurückführbar war, sah man den eigenen Handlungsspielraum auf eugenische Maßnahmen begrenzt. Um der beschriebenen Gefahr Einhalt zu gebieten, zunächst die Allgemeinheit von „Ballastexistenzen“ zu entlasten und langfristig die Reinheit der Rasse zu retten bzw. eine Idealrasse zu züchten, plädierten Eugeniker für eine aktive Gegenselektion. Der Erlass spezifischer Eugenikgesetze legalisierte ab 1907 in vielen Nationen negativ-eugenische Zwangsmaßnahmen wie Sterilisationen, Kastrationen, Abtreibungen und Asylierungen, die bei für „erbuntüchtig“ befundenen Personen wie u.a. Behinderten, psychisch Kranken, aber auch sozial Schwachen angewendet wurden.251 Züchtungsprogramme in Form staatlicher Anreize zur Fortpflanzung für „erbtüchtige“ Paare standen demgegenüber im Hintergrund. Ihren traurigen Höhepunkt fand die klas- 247 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Sorgner (2006a) aus Perspektive des eugenisch veränderten Individuums zwischen autonomer und heteronomer, hinsichtlich der Wirkung auf den Genpool zwischen direkter und indirekter, bezüglich der Art des Eingriffs in das Genom zwischen aktiver und passiver und seine Tragweite betreffend zwischen radikaler und moderater Eugenik unterscheidet. Während er im Fall liberaler Eugenik mit Blick auf das Verhalten des Staates marktliberale von sozialdemokratischer Eugenik abgrenzt, trennt Schmidt (2003) S.137 die klassische Eugenik in freiwillige, kooperationsbasierte und unfreiwillige, erzwungene auf. 248 vgl. Wiesing (2006) S.326-329. Hier geht es um den Wandel menschlicher Vorstellungen von Gesundheit und Fortpflanzung und ihre normative Bedeutungen von der Antike bis zur Gegenwart. 249 „Volksgesundheit“ ist ein abstrakter Begriff, der eher mit traditionellen Vorurteilen als mit dem physischen Zustand der Bevölkerung in Verbindung gebracht werden muss. 250 Kröner (2000) S.695 spricht hier vom „Problem der ‚differentiellen Geburtenrate’“. 251 Die eugenische Bewegung wurde so zuerst in den USA, in den skandinavischen Ländern und in der Schweiz politisch umgesetzt. 148 Befürchtete Folgen der PID sische Eugenik im nationalsozialistischen Deutschland, in dem sie gepaart mit Rassismus zur systematischen Durchführung unzähliger Sterilisationen und zur systematischen Vernichtung für lebensunwert befundenen Lebens führte. Auch die Holocaust-Tragödie wird im Zusammenhang mit den Auswüchsen des rassenhygienischen Wahns der Nationalsozialisten gesehen.252 Bereits von Anfang an begleiteten auch kritische Stimmen die Eugenik und ihre biologisch begründeten sozialwissenschaftlichen Theorien. Ihre Opponenten zweifelten den Verfall des Genpools an. Sie hinterfragten die Rechtmäßigkeit moralischer Entscheidungen über humangenetische Ziele von Seiten der Wissenschaft und verurteilten die Verletzung personaler Rechte im Rahmen deren Verfolgung.253 Damit fanden sie jedoch kaum Gehör. Retrospektiv herrscht Entsetzen darüber, dass das gesellschaftliche und politische Streben nach der Realisierung einer Utopie zu solch gravierenden Verletzungen der Menschenwürde und Freiheitsrechte führte. Dies verstärkt sich durch die Erkenntnis, dass die Anhänger der klassischen Eugenik von naiven, falschen Voraussetzungen ausgingen, weil sie Ereignisse wie Meiose und Spontanmutationen und vor allem die Bedeutung externer Faktoren für die individuelle Entwicklung verkannten. Es liegt heute nahe, die verbreitete Angst vor einer erneuten „Genetifizierung“ der Gesellschaft und dem Einsetzen einer neuen Eugenik historisch zu erklären. In der Nachkriegszeit standen eugenische Bemühungen in Verruf. Die Humangenetik distanzierte sich von ihrer darwinistisch-populationsgenetischen Vergangenheit und konnte sich im Zuge der einsetzenden Medikalisierung weiter etablieren.254 Entsprechend der sozialen und rechtlichen Stärkung von Freiheit und Autonomie des Individuums gegenüber den Interessen der Gemeinschaft255 verfolgte sie von nun an das Ziel, individuelle genetische Risiken zu identifizieren und so Einzelpersonen oder Familien vor Leid zu bewahren. Dabei wurde „[v]on betroffenen Patienten und Familien [...] erwartet, daß sie im Sinne der Leidensminderung und im Eigeninteresse sogenanntes vernunftgeleitetes Verhalten zeigten, welches durch entsprechende ärztliche Maßnahmen zu fördern war.“256 - Inwiefern und wie genau dieser autonome Entscheidungsspielraum normativ zu begrenzen ist, wird im Folgenden noch Thema sein. - Ein Meilenstein in der humangenetischen Entwicklung war die Entdeckung der molekularen Grundlagen der Genetik in den 1960er Jahren. Sie leitete 252 Schmuhl (2005) S.299-312 u.a. über öffentliche und private Äußerungen Fischers und Verschuers, Direktoren des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, zur „Judenfrage“. Ebd. S.444-452 über ihr Verhalten hinsichtlich der „Endlösung“. Vgl. auch Kröner (2000) S.696-698 mit einem Überblick zu Eugenik und Rassenhygiene in D. 253 vgl. Wiesing (2006) S.330 mit Hinweis auf Äußerungen von Pearl (1928), Weber (1911) und Hertz (1916,1925). 254 vgl. Kröner (1997) S.31 f.. 255 Erinnert sei hier an die UN-Menschenrechtskonvention von 1948 und das deutsche Grundgesetz von 1949, in denen sich die Bedeutung personaler Rechte widerspiegelt. Befürchtete Folgen der PID 149 eine neue Epoche ein, in der unablässige Forschung zur nach wie vor anhaltenden Vergrößerung des gendiagnostischen Spektrums und zur Durchführung erster Eingriffe in das menschliche Genom führte.257 Während anderen Errungenschaften der Medizin wie der zunehmenden Lebenserwartung und der assistierten Reproduktion, welche die Fortpflanzung genetisch Kranker zum Teil erst ermöglicht, ein dysgenetischer Effekt nachgesagt wird,258 schaffen diese Fortschritte insbesondere seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms Voraussetzungen für ein Wiederaufblühen eugenischer Prinzipien. 6.5.2 Das eugenische Potenzial der medizinischen Praxis ohne PID Bereits unter der Prämisse eines PID-Verbots können social sexing durch Spermienselektion, heterologe IVF, Polkörperdiagnostik, Pränataldiagnostik mit anschließender Abbruchsoption, Behandlungsverzicht im Fall schwerstgeschädigter Neugeborener und postnatale prädiktive Tests als Instrumente einer neuen Eugenik gewertet werden. Das eugenische Potenzial rein sozialer Geschlechtswahl liegt in der mit ihr implizierten Einführung und Akzeptanz positivselektiver Motive.259 Im Fall heterologer IVF entspricht das Screening des Spendergenoms auf Chromosomenstörungen und genetische Abweichungen zur Sicherung der Spermienqualität einer negativ-eugenischen Maßnahme.260 Mittels Polkörperdiagnostik können theoretisch X-chromosomal erbliche Krankheiten aus dem menschlichen Genpool verbannt werden. In allen drei Fällen hängt der eugenische Effekt ebenso wie derjenige der im Wesentlichen ebenfalls negativselektiven PND von der Anwendungshäufigkeit der Methode ab. Angenommen, dass in Zukunft bei jeder Schwangerschaft ein Screening des fetalen Erbguts auf alle zu dem Zeitpunkt diagnostizierbaren Erkrankungen stattfände, dessen Ergebnis dann womöglich ohne jede Beratung über die Durchführung eines Abbruchs bestimmte, würde die eugenische Wirkung der PND auf den Genpool deutlich gesteigert.261 Die individuelle Belastbarkeit der Schwangeren bliebe bei einer solchen Standarduntersuchung unberücksichtigt und ihre moralische Legitimation daher zweifelhaft. Orientiert sich der Umgang mit schwerstgeschädigten Neugeborenen an der jüngsten Fassung der Einbecker Empfehlungen, kommt ein Behandlungsverzicht bzw. eine Behandlungsbeschränkung nur im Fall eines unaufhaltsamen Todes des 256 s. Kommission für Grundpositionen und ethische Fragen der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (2007) S.6. 257 vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft (2007) zur Einführung der Gentherapie. 258 vgl. Kollek (2002) S.152. 259 Daher ist sie gemäß dem ESchG §3 in Deutschland verboten. Vgl. Lübbe (2003) S.217 mit Hinweis auf den Gesetzeskommentar von Keller, Günther, Kaiser (1992). 260 Sèle und Testart (1999) S.170 f. zeichnen die Entwicklung der heterologen Reproduktionsmedizin von der Insemination bis zur „policy of genetic pairing“ bei rezessiven und polygenen Merkmalen nach. 150 Befürchtete Folgen der PID Neugeborenen infrage und hätte daher keinerlei eugenischen Effekt.262 Sobald für das Kind jedoch eine minimale Überlebenschance besteht, können passive und natürlich aktive Früheuthanasie263, die in Deutschland gesetzlich verboten ist, als direkte negativ-eugenische Maßnahmen gewertet werden. Der flächendeckende Einsatz prädiktiver Tests in einer Gesellschaft kann schließlich die Rückkehr eines genetisch-reduktionistischen Menschenbildes begünstigen und so einer neuen Eugenik fruchtbaren Boden bereiten. Welche allgemeinen ethischen Schwierigkeiten vom Einsatz komplexer Diagnostik als Bevölkerungsscreening ausgehen, wurde bereits an anderer Stelle diskutiert.264 6.5.3 Entstehung einer neuen Eugenik Schon die hier aufgezählten medizinischen Maßnahmen werden wegen ihrer biologischen und sozialen Implikationen von einigen Diskussionsteilnehmern als in den Dienst einer neuen Eugenik gestellt angesehen. So spricht Auner mit Blick auf einen gesellschaftlichen Zwang, sie in Anspruch zu nehmen, vom Wiederaufleben der „Leitgedanken einer Eugenik, wie sie aus der NS-Zeit bekannt sind“.265 Gegen ein kontinuierliches Verhältnis zwischen einer neuen und der klassischen Eugenik ist aber einzuwenden, dass das genetizistische Menschenbild der Vergangenheit angehört, heute also andere biologische Voraussetzungen gelten. Nicht ein starrer Genfatalismus, der die Betroffenen zugleich von jeglicher Verantwortung entbinde, sondern die ständige Interaktion von Genen und Umwelt sei laut Lemke Grundlage einer heutigen „Eugenik des Risikos“. Indem das Risiko des Einzelnen auf die Erwartungen der Gesellschaft rückbezogen würde, verpflichtete es ihn als autonomes Wesen moralisch, mit seinen Dispositionen verantwortungsvoll umzugehen.266 Genetische Information diente somit aus sozialer Perspektive als Grundlage einer auf Prävention ausgerichteten Verhaltensmodifikation.267 Individual- und Kollektivethik griffen dabei ineinander. Hierin sieht Lemke die Voraussetzung für eine Ausweitung eugenischer Methoden auf alle menschlichen Individuen ohne jegliches Eingreifen einer Staatsmacht.268 Auf die Beobachtung, dass ohnehin permanente Mutationen eine Perfektionierung des Genpools behinderten und dass Entscheidungen über den Umgang mit genetischen Tests und ihren Ergebnissen heute individuell und nicht kollektiv motiviert seien, rekurriere die “Diskonti261 Zur bisherigen Entwicklung pränataldiagnostischer Methoden s. Kapitel 3.1. s. Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht (1992) Paragraph IV-VI. Paragraph II.1 unterstreicht die Rechtswidrigkeit aktiver Tötung. 263 vgl. zahlreiche Fallbeispiele bei Kuhse und Singer (1993). 264 vgl. Abschnitt 6.1.1 dieser Arbeit. 265 Auner (1996) zitiert bei Netzer (1998) S.148. 266 vgl. Lemke (2001) S.37-42. 267 vgl. Abriss über die prädiktive Medizin in Abschnitt 6.1.1 dieser Arbeit. 262 Befürchtete Folgen der PID 151 nuitätsthese“. Sie sehe keinerlei Verbindung zwischen klassischer Eugenik und heutiger Humangenetik und keinen Anlass, letztere als neue Eugenik zu bezeichnen.269 Für die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die aktuelle medizinische Praxis bereits eugenisch zu nennen ist oder nicht, sei das Verständnis von Eugenik als „Gesamtheit der Ideen und Aktivitäten, die darauf abzielen, die Qualität der menschlichen Rasse durch Manipulation des biologischen Erbguts zu verbessern“270 Ausgangspunkt. Diese Definition lässt offen, ob auch die Umsetzung individueller Präferenzen oder nur die Umsetzung staatlicher Vorhaben als Eugenik zu bezeichnen ist. Gegenwärtig ist die Inanspruchnahme der unter 6.5.2 angeführten negativ-selektiven Techniken vor allem den Paaren vorbehalten, die ihre reproduktiven Entscheidungen im Wissen um spezifische, teilweise familiär diagnostizierte, genetische Risiken fällen. Einige von ihnen lehnen potenziell eugenische Maßnahmen ab: So verzichteten laut Nippert 25 % aller Risikoschwangeren auf eine PND.271 Die Paare, die sich für eine der Techniken entscheiden, beabsichtigen damit augenscheinlich, persönliches Leid abzuwenden und nicht mittels genetischer Prävention den Genpool der Menschheit zu verbessern, wie es einst die nationalsozialistische Geisteshaltung verlangte. Hier kann weder ein notwendiger Weise eugenisches Motiv nachgewiesen, noch kann es vollkommen ausgeschlossen werden.272 Mit großer Wahrscheinlichkeit besteht bei den meisten dieser Paare gleichzeitig der Wunsch nach einem gesunden Kind mit den bestmöglichen Zukunftsaussichten. Anhand dieses Wunsches und unter Berücksichtigung der Effekte genetischer Selektion lässt sich das reziproke Verhältnis zwischen autonomen und freien Personen und der Gesellschaft, in der sie leben, nachzeichnen. Diese Reziprozität könnte eine Grundvoraussetzung für das Wirksamwerden neuer eugenischer Leitgedanken innerhalb einer Bevölkerung sein. Unabhängig von den rechtlich garantierten Freiheiten des Individuums sind heute in liberalen Staaten Gesundheit und Normalität hohe Güter, denen menschliches Streben gilt. Die inhaltliche Füllung dieser Begriffe ist dabei abhängig vom gesellschaftlichen Kontext, in dem sie verwendet werden. Ebenso verhält sich die Bewertung genetischer und phänotypischer Merkmale eines Individuums als vorteilhaft oder wenig erstrebenswert relativ zu tradierten Wertesystemen einer Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund sind auch die Hoffnungen und Handlungen pro- 268 vgl. Lemke (2001) S.44. vgl. ebd. S.42 f.. Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden klassischer Eugenik und heutiger medizinischer Praxis s. auch Kröner (2000) S.698 f.. 270 Diese Definition von Kevles (1985) zitiert Lemke (2001) S.41. 271 vgl. Nippert (1997) S.115. 272 Es stellt sich erneut die Frage nach der Beweislast: Die Gegner der verschiedenen medizinischen Maßnahmen verlangen den Ausschluss, ihre Befürworter den Nachweis eugenischer Motive. 269 152 Befürchtete Folgen der PID spektiver Eltern hinsichtlich ihres Nachwuchses zu beurteilen.273 Die Verknüpfung genetischer Diagnostik mit Maßnahmen der Reproduktionsmedizin und Schwangerschaftsvorsorge verspricht Vorhersagbarkeit, Planbarkeit und Selbstverwirklichung und scheint daher, das Gelingen individuellen Lebens zu erleichtern. Die Entwicklung manipulativer statt der bisher selektiven Techniken rückt mehr denn je die Durchführbarkeit optimierender Eingriffe in den Vordergrund. Diese sollen jedoch erst im Zusammenhang mit der PID näher erörtert werden. Die „Reprogenetik“ gilt als Teilbereich der sogenannten Life Sciences, die ihre Aufgabe darin sehen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse für menschliche Gesundheit und Autarkie nutzbar zu machen. Ihr geht es um die „Verbesserung der inneren Konstitution des Menschen“274 und seiner Lebensqualität. Im Rahmen dieser Zielsetzung stellt sich die Verantwortung der Medizin als eine globale Verantwortung dar, die über das Handeln am einzelnen Patienten hinausreicht.275 Das Erreichen eines Zustands vollkommener Leidfreiheit und Gesundheit durch die menschliche Beherrschung der Natur bleibt dennoch eine Utopie:276 Aufdeckung und Kontrolle aller wirksamen genetischen Faktoren, die ohnehin nur einen geringen Anteil aller Leiderfahrungen erklären, sowie Aufdekkung und Kontrolle aller Umgebungsfaktoren, wie sie die sogenannte „Euphenik“277 vorsieht, scheinen unerreichbar. Aus Sicht des Einzelnen besteht zunächst das Angebot, in die eigene Fortpflanzung zu intervenieren, dessen Inanspruchnahme zu erwägen, ihm allein obliegt. Kraft einer Steigerung von Nachfrage und Durchführung bewirkt die Menge aller Abnehmer eine Etablierung und anschließende Ausweitung des medizinischen Angebots. In der Folge kumulieren die sozialen Auswirkungen selektiver Diagnostik in einem zunehmend restriktiven Gesundheits- und Normalitätsverständnis und in der Ausgrenzung von Krankheit und Tod. Die Gemeinschaft verlangt im Fall genetischer und verhaltensbedingter Gesundheitsrisiken von den betroffenen Individuen explizit oder implizit Verantwortungsübernahme und Rechtfertigung für ihre Lebensführung. Ein erstelltes „Risikodispositiv“ allein wirkt noch nicht eugenisch. Erst in einem Bezugsrahmen gesellschaftlicher Ideale wie Autonomie und Verantwortung - vor sich selbst und vor anderen entfaltet es seine eugenische Wirkung.278 Die Orientierung des Arbeits- und Versicherungsmarkts 273 Die Interferenz gesellschaftlicher und persönlicher Wertesysteme wurde bereits im Zusammenhang mit dem Freiwilligkeitskriterium der Autonomie in Abschnitt 4.1.2 genannt. Lübbe (2003) S.219 charakterisiert elterliche Enhancement-Absichten als relativ, räumt aber die schlechte Abgrenzbarkeit einer ausbleibenden Umsetzung derselben von absoluten Belastungen - vgl. Abschnitt 6.4.2 - ein. 274 s. Kröner (1997) S.31. 275 vgl. hierzu Rösler (2000). 276 vgl. Kreß (2002a) S.191 und Schockenhoff (2003) S.392 f.. 277 s. Fuchs und Lanzerath (2000) S.701. 278 vgl. Lemke (2001) S.44 beachtet in diesem Zusammenhang den stark repressiven Charakter eines gesellschaftlichen Appells an die individuelle Autonomie und seine Bedeutung für eine „Eugenik des Risikos“ nicht weiter. Befürchtete Folgen der PID 153 an Leistungsfähigkeit und Gesundheit sowie die Einschränkung von Solidarleistungen wirken als Repressalien. Der Kontrollapparat innerhalb sogenannter Normalisierungsgesellschaften übt sozialen und ökonomischen Konformitätsdruck aus, der auf Anbieter und Abnehmer selektiver Leistungen im Medizinwesen wirkt. Hildt urteilt, dass „[d]ie Korrelation zwischen den privaten Wünschen der Paare und dem gesellschaftlichen, insbesondere finanziellen Interesse [...] hier auf direkte Weise dazu ausgenutzt zu werden [scheint], die Verantwortung für das [eugenische] Eingreifen auf unzulässige Weise zu individualisieren.“279 Der Staat aber regelt das Ausmaß des Wettbewerbs in einem öffentlichen Gesundheitswesen280 sowie die Distribution von Hilfsmitteln im Sozialwesen und nimmt dadurch indirekt Einfluss auf individuelle Fortpflanzungsentscheidungen. Er kann daher wie im Fall politischer Maßnahmen gegen Behindertendiskriminierung durch eine Begrenzung des Wettbewerbs aktiv dem Aufkommen eines eugenischen Trends vorbeugen. Nicht zu vergessen ist, dass auch die rechtliche Regelung der Zugangsvoraussetzungen für bestimmte medizinische Leistungen in seinen Aufgabenbereich fällt. Auf der anderen Seite ist dem Staat durch diese Kompetenzen ebenso wie durch Rechtsprechung281 oder Aufstellung eines Indikationskatalogs - RehmannSutter beschreibt eine „indirekt über Indikationslisten staatlich geplante[] und über die Entscheidungsautonomie der Betroffenen abgefederte[] Eugenik“282 - die Möglichkeit gegeben, selbst eugenischen Strömungen aufkommen zu lassen und zu verstärken. Scheinbar autonome Einzelentscheidungen im Kontext der Reproduktionsmedizin fungierten dann als Tarnung und erschwerten die Identifikation eugenischer Absichten im Sinne einer staatlichen Programmatik. Neue Eugenik und Demokratie stünden in vermeintlichem Einklang. Dass jeder Staat selbst wiederum wirtschaftlichen und internationalen Zwängen unterliegt, erhöht die Komplexität der verschiedenen auf die politische Gestaltung einer Gesellschaft einwirkenden Interessen.283 Denkbar ist, dass ihr Zusammenspiel eine neue Eugenik auslöst, ohne dass je einer der Interessenverbände dezidiert eugenischen Absichten geäußert hat, so dass kein konkreter Ursprung einer eugenischen Bewegung ausgemacht werden kann. Lübbes Ermahnung, Veränderungen in der rechtsstaatlichen Trennung von privatem, wirtschaftlichem und politischem Bereich infolge neuer me- 279 s. Hildt (1998) S.223. Fiddler und Pergament (1996) S.708 sehen in den offenen Fragen innerhalb eines öffentlichen Gesundheitswesens den Grund für eine anhaltende Eugenik-Diskussion. 281 Gemeint sind z.B. die ärztliche Haftbarkeit und die Anerkennung eines Rechts auf Nichtexistenz, d.h. eines Schuldigwerdens der Mutter durch die Geburt im Fall nicht durchgeführter PND oder eines nicht durchgeführten Schwangerschaftsabbruchs, die eine Verbreitung negativer Selektion fördern. 282 s. Rehmann-Sutter (1998) S.431. Vgl. zum Erstellung von Indikationslisten durch den Staat Abschnitt 6.4.2 dieser Arbeit. 283 Zu den verschiedenen Interessen an einer neuen Eugenik vgl. Speck (2005) S.49-56. 280 154 Befürchtete Folgen der PID dizinischer Methoden Aufmerksamkeit zu schenken,284 scheint in Anbetracht der hier dargestellten Zusammenhänge berechtigt. Dabei ist von vorrangigem Interesse, ob ein Aufweichen dieser Trennung die praktische Gewährleistung von und den Respekt vor freien Entscheidungen selbstbestimmter Individuen hinsichtlich ihrer Fortpflanzung gefährdet. 6.5.4 Das eugenische Potenzial der PID Bevor wir uns mit den Argumenten der Befürworter einer neuen liberalen Eugenik auseinander setzen, bleibt zu klären, welche Rolle der Präimplantationsdiagnostik bei deren Verwirklichung zukommt. Ihr eugenisches Potenzial liegt in der Auswahl zwischen mehreren Embryonen. Die Entscheidung für Transfer und Weiterentwicklung der einen und die Verwerfung der anderen hat zugleich einen positiv- und einen negativ-eugenischen Effekt. Dabei erhöht die Möglichkeit, mehrere PID-Zyklen pro Jahr durchzuführen, die Wahrscheinlichkeit, einen Embryo mit dem erhofften Genstatus für einen Embryotransfer zu identifizieren.285 Nach Ausschluss der Anlageträgerschaft für eine bzw. mittels DNA-Chip sogar für mehrere schwere genetische Erkrankungen lässt die PID unter Umständen noch die Berücksichtigung sekundärer Kriterien wie z.B. Heterozygotie zu und dringt damit in den Bereich positiver Selektion vor. “It is this element of choice that makes this approach an innovation in eugenic policy”,286 denn auf diese Weise kann die PID Elternwünsche in Richtung genetisches Enhancement vorantreiben. Auch der vornehmliche Einsatz der PID als Aneuploidie-Screening ist wie jede genetische Screeninguntersuchung leicht als eugenische Maßnahme zu begreifen, zumal der Versuch, eine kindliche Behinderung auszuschießen, über die Behandlung zur Erfüllung eines Kinderwunsches hinausreicht287 und sich nicht an der Überlebensfähigkeit, sondern an der Entwicklungswahrscheinlichkeit der Embryonen orientiert. Schon die Zuordnung der Paare zu einer Screening-Zielgruppe beeinträchtigt ihre Entscheidungsfreiheit288 und kann daher der Verfolgung eugenischer Ziele nutzen. Schließlich kann die PID noch zur Implementierung genmanipulativer Methoden an Embryonen beitragen, indem sie die Überprüfbarkeit ihrer Ergebnisse gewährleistet. Keimbahntherapie veränderte im Gegensatz zu somatischen Gentherapie das Erbgut aller folgenden Generationen und insofern den menschlichen Genpool insgesamt. Eingriffe zur Elimination oder Insertion spezifischer DNA-Abschnitte repräsentieren daher ein großes negativ- und 284 s. Lübbe (2003) S.217. Testart und Sèle (1995) S.3087 sehen hier einen wichtigen Unterschied zur PND, die nach Eintritt einer Schwangerschaft nur ein Mal pro Jahr an je einem Fetus angewendet werden kann. 286 s. ebd. S.3087 f.. 287 vgl. Sèle und Testart (1999) S.171 und Abschnitt 5.1.4 dieser Arbeit. 288 vgl. Haker (1999) S.105 zur Risikogruppendefinition bei PND. 285 Befürchtete Folgen der PID 155 positiv-eugenisches Potenzial, dem unter der Prämisse methodischer Effizienz die Angst vor Menschenzüchtung anhaftet. Abschließend bleibt festzuhalten, dass allein die Methode der Präimplantationsdiagnostik der Umsetzung einer über individuelle Entscheidungen gesteuerten Eugenik zahlreiche neue Mittel bereit stellt. Aus diesem Grund bezeichnen Testart und Sèle sie auch als „original tool for eugenics“.289 Bereits im Fall einer äußerst restriktiven Zulassung sind die Auswirkungen der PID auf den Genpool aus naturwissenschaftlicher Perspektive negativ-eugenisch. Gleiches gilt für die angeführten Untersuchungen wie PKD, PND und prädiktive Tests, sofern letztere einen Schwangerschaftsabbruch oder eine Veränderung des Reproduktionsverhaltens nach sich ziehen. Doch erst mit dem Vorhandensein einer eugenisch ausgerichteten gesellschaftspolitischen Zielsetzung ist die oben genannte Ausgangsdefinition von Eugenik erfüllt, also die Rede vom Einsetzen einer neuen Eugenik gerechtfertigt. Während Risikopaare hoffen, individuelles Leid abzuwenden, sind gesundheitspolitische Interessen an einer Elimination autosomal-dominanter Krankheitsauslöser aus dem Genpool einer Population sowie an einer davon erhofften Kostenreduktion nicht ausgeschlossen. Prominentestes Beispiel in der Literatur ist die Aussicht, mit Hilfe der PID die Chorea Huntington „aus der Welt zu schaffen“.290 Dass es sich dabei um eine eugenische Absicht handelt, bleibt unerwähnt - vielleicht, um keine Assoziationen mit und Ängste vor einer staatlichen Programmatik zu entfachen? Obwohl, wie in Abschnitt 5.1.2 dargestellt, im gegebenen Fall die Indikationslage umstritten ist, wird daran klar, dass bereits der rein negativ-selektive Einsatz der PID einer angestrebten neuen Eugenik zugute kommen könnte. Mit der Ausweitung der PID-Indikationen auf genetische Prädispositionen und eine positive Merkmalsauswahl würde Paaren erlaubt, ihren Nachwuchs entsprechend eigenen Vorstellungen zu optimieren, um so seine Lebensqualität zu sichern. Intendiert würde dabei nicht zuletzt eine phänotypische Anpassung an die Herausforderungen einer konkreten Lebenswelt. Gesamtgesellschaftliche Interessen bestünden z.B. in der Förderung der allgemeinen Gesundheit, Steigerung menschlicher Leistungsfähigkeit und Vermehrung der Anlagen positiv bewerteter Eigenschaften im menschlichen Genom.291 Testart und Sèle halten diese ausschließlich auf Selektion beruhende Eugenik für „beneficial and normal, painless and efficient."292 Es bestehe darum kein 289 s. Testart und Sèle (1995) S.3087. vgl. Kollek (2002) S.86, Schroeder-Kurth (1999) S.50 und de Wert (1998) S.339. 291 In Abhängigkeit von Fortschritten der Verhaltensgenetik ist denkbar, dass z.B. neurokognitives Enhancement durch positive Selektion oder Genmanipulation erreichbar wird. Vgl. hierzu Plomin und De Fries (1998) und Oliver und Plomin (2007). Die ethische Problematik des Enhancements kognitiver Leistungen behandeln Farah et al. (2004) im Kontext der heute noch überwiegend pharmakologischen Eingriffe. Vgl. auch Schäfer und Groß (2008). 292 s. Testart und Sèle (1995) S.3086. 290 156 Befürchtete Folgen der PID Anlass zur Entwicklung einer embryonalen Gentherapie, denn eher etabliere sich aufgrund ökonomischer Interessen ein flächendeckendes Embryonenscreening zur Umsetzung eines „social engineering[s], between biomedical power and social planning“.293 Gehen wir dennoch davon aus, dass der Einsatz der Gentechnik auch vor dem embryonalen Genom nicht Halt macht, so eröffneten sich damit weitere Möglichkeiten, therapeutisch-leidreduzierende und auch verbessernde Ziele zu verfolgen, auf deren unterschiedliche ethische Bewertung noch einzugehen ist. Auf individueller Ebene bliebe das Kindswohl vorrangiges Interesse, lediglich die Mittel seiner Verfolgung besäßen eine neue Qualität. Auf gesellschaftlicher Ebene rückten durch die gezielte genetische Manipulierbarkeit Konformitätsabsichten hinsichtlich eines „Idealmenschen“ in den Bereich des Machbaren. Wiesing bezeichnet daher die Anwendung der Gentherapie als „Perfektionierung der Perfektibilität“.294 6.5.5 Bewertung einer neuen Eugenik Das Spektrum einer neuen Eugenik bewegt sich zwischen einer humangenetisch-klinischen, an Erbkrankheiten orientierten und einer unbegrenzt optimierenden, durch den Markt gestalteten Form. Allen Bedenken zum Trotz betont Agar, Vertreter der liberalen Eugenik, in Abgrenzung zur klassischen Form das neutrale Verhalten des Staates und die Eröffnung individueller Freiheiten.295 Zwischen erzieherischen Maßnahmen und dem Eingreifen in das Genom bestehe kein moralischer Unterschied, da es in beiden Fällen darum gehe, in der Annahme einer Gen-UmweltInteraktion die kindliche Entwicklung zu modifizieren. Therapeutische und optimierende Maßnahmen seien ebenfalls gleich zu bewerten, zumal weder der sozial konstruierte noch der biologisch-objektive Krankheitsbegriff in moraltheoretischer Hinsicht bedeutsam sei: Ersterer richte sich an führenden Vorurteilen aus, während die Wirkung des zweiteren für das menschliche Leben oft keine Relevanz besitze. "Any interest in reducing suffering involves us in [...] 'inescapable eugenics’."296 Gentherapie sollte daher wie Erziehung nicht nur auf Krankheitsvermeidung, sondern auch auf Kindswohl und Lebensqualität abzielen. An dieser Stelle sei den liberalen Eugenikern zufolge weiter zu differenzieren, denn 293 vgl. Testart und Sèle (1995) S.3089. Näheres hierzu folgt mit der Beurteilung der sozialen Implikationen einer neuen Eugenik. 294 s. Wiesing (2006) S.334. 295 vgl. Agar (1999) S.171. 296 s. ebd. S.173 f., wobei Agar bei der Bewertung der Genmanipulation auf Robertson (1994) und bei der Gleichsetzung negativer und positiver Selektion als Eugenik auf Kitcher (1996) rekurriert. Auch McGee (1997) negiert, wie bei Haker (2003) S.372 kritisiert, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen genmanipulativen und allgemein gebilligten elterlicher Absichten hinsichtlich ihres Nachwuchses. Befürchtete Folgen der PID 157 "[g]enetic engineers threaten to separate individuals from life plans."297 Den Einwänden, dass sich a) auf gesellschaftlicher Ebene durch ein dominantes Wertesystem die Diversität an Lebensentwürfen reduziere, auf welcher die Rechtfertigung des Liberalismus aufbaue, und b) die Marktorientierung der neuen Eugenik die ungerechte Güterverteilung zwischen Arm und Reich aufrechterhalte oder verstärke,298 begegnet Agar wie folgt: Zu a) Einem sozialen Trend stünde die Vielfalt an Vorstellungen von einem guten Leben entgegen. Während Kitcher einem solchen Trend das Gewicht abspreche, über Lebensqualität zu entscheiden, hielten Singer und Wells eine Kontrollinstanz, die ihm aktiv entgegensteuere, für ratsam.299 Zu b) Um Ungleichheit vorzubeugen, sei bedürftigen Paaren die Inanspruchnahme eugenischer Angebote zu erleichtern. Auf individueller Ebene bestimmten Eltern mit dieser Hilfe gewisse Grundkapazitäten ihrer Nachkommen wie Intelligenz und Kraft, die sich durch geringe Umweltsensitivität und -spezifität auszeichneten, sich aber gegenüber einem Lebensentwurf neutral verhielten. Daraus sei zu schließen, dass "internally justified neutrality will translate into a neutrality in respect of the social distribution of goods of genetic engineering."300 Auch wenn bestimmte Fähigkeiten die Realisierung eines Lebensplans erleichterten und andere sie behinderten, bleibe die Korrelation von Genen und selbigem unvorhersehbar und seine Entstehung äußerst umweltabhängig.301 Aus der Anerkennung dieser Grenze heraus folgert Agar die Anwendung der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie auf konfligierende Lebensentwürfe und die Allokationsfrage im Bereich der Gentherapie. "The aim is to equip the person-to-be no matter what life she opts for.“302 Die Erweiterung sonst eingeschränkter kindlicher Lebensplanung durch therapeutische werde daher im Vergleich zu optimierenden Maßnahmen als vorrangig empfunden. Im Einklang mit dem Maximinprinzip verheiße Enhancement allerdings einen wahren Zuwachs an Wahlfreiheit.303 Die hier zur Legitimierung der liberalen Eugenik angeführten moraltheoretischen Vorannahmen sind ebenso wie die vermeintliche Widerlegung ihrer Folgen zu hinterfragen. Außerdem bleiben weitere Einwände wider eine liberale eugenische Praxis zu ergänzen. Spezifischen pädagogischen und eugenischen Maßnahmen ist gemeinsam, dass sie sich irreversibel auf das Leben eines Kindes auswirken und wegen dessen fehlender Zustimmung von Seiten der Eltern zu verantworten sind. Aufgrund dieses geteilten Kritikpunkts sei es, so Habermas, nicht möglich, die 297 s. ebd. S.174. vgl. ebd. S.172-175. 299 ebd. S.175 f. mit Verweis auf diese beiden Autoren (vgl. FN 296). Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass jede Art der Restriktion im Widerspruch zum Liberalismus steht. 300 s. Agar (1999) S.176. 301 Habermas (2005) S.107 führt die Angreifbarkeit elterlicher Hoffnungen hinsichtlich des kindlichen Charakters auf die Personstellung des Kindes in interaktiven Entwicklungsschritten zurück. 302 vgl. Agar (1999) S.178 f.. 298 158 Befürchtete Folgen der PID Akzeptanz von Genmanipulation durch ihren Vergleich mit Erziehung zu erhöhen.304 Gegen eine grundsätzliche moralische Gleichwertigkeit spricht auch, dass Gentechnik tiefer in die kindliche Entwicklung einzugreifen hofft305 und dass sie im Fall nicht-therapeutischer Funktion eine Bedrohung der kindlichen Autonomie und der Symmetrie im Eltern-Kind-Verhältnis darstellt306. Diese Gefahr ist nicht nur für ein ethisches Urteil an sich, sondern auch aus Sicht der Proponenten einer neuen Eugenik relevant, zumal sie das Substrat des Liberalismus angreift. Während, wie Habermas herausstellt, bei einer therapeutischen Intervention ein Konsens zwischen Eltern und ihrem noch entscheidungsunfähigen ungeborenen Kind anzunehmen sei, könne sich genetisches Enhancement auf der Suche nach seiner Legitimation keineswegs auf das kommunikative Moment einer antizipierten Einwilligung berufen. Es beruhe allein auf den Wünschen Dritter, die das Kind zum Objekt degradierten.307 Negative Selektion mittels PID ist durch das Abwenden absoluten Leids von den Eltern zu rechtfertigen, positive setzt hingegen eine zum Lebenskontext relative Lebensbewertung voraus. Dass die Bewertung des Lebens Dritter ethisch problematisch ist, wird von liberalen Eugenikern nicht thematisiert, obwohl ihre moralische Akzeptanz wesentliche Voraussetzung der Zulässigkeit positiv-selektiver Maßnahmen, aus ethischer Sicht jedoch mehr als fraglich ist.308 Unbestreitbar ist dagegen, dass individuelle Fähigkeiten Selbst- und Umwelterfahrung beeinflussen und diese wiederum auf den Lebensentwurf desselben Individuums einwirken, auch wenn diese Zusammenhänge sich jeder Vorhersehbarkeit entziehen. Es liegt nahe, dass alles elterliche Bemühen um gute Ausgangsbedingungen für den eigenen Nachwuchs in einer Gesellschaft ähnlich ausfällt und zu einer Reduktion der Vielfalt an genetischen Informationen und indirekt auch an Lebensplänen führt. Daher verbietet sich der befremdlich anmutende Rückschluss vom Fehlen „innerer“ auf das Ausbleiben gesellschaftlicher Auswirkungen der Gentherapie hinsichtlich der Güterverteilung. Das Vorhaben, allen Paaren den Zugang zu eugenischen Eingriffen staatlicherseits zu sichern, fragt nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen. Eine politische Förderung gentechnologischer Veränderungen an Embryonen weckt den Verdacht, dass soziale Probleme nicht länger sozial-, sondern wie zu Zeiten klassischer Eugenik gesundheitspolitisch zu lösen sind. Sie impliziert einen Zwang zur Inanspruchnahme, der besonders in Verbindung mit dem Einsatz gesellschaftlicher oder ökonomischer Druckmittel eine Verringe303 vgl. Agar (1999) S.179 f.. vgl. Habermas (2005) S.138-141. 305 vgl. Haker (2003) S.372. 306 vgl. ausführliche Darstellung in Abschnitt 6.3.4 dieser Arbeit. 307 vgl. Habermas (2005) S.91-93. Außerdem sei der Haltung des Arztes gegenüber dem Embryo als potenzieller Person besondere Bedeutung beizumessen. 304 Befürchtete Folgen der PID 159 rung personaler Autonomie bewirkt - sowohl im Fall der Eltern als auch der Kinder: Paare seien, so Testarts und Sèles Blick in die Zukunft, angesichts der reproduktiven Wahlfreiheit bei zunehmendem zwischenmenschlichen Wettbewerb überfordert. Sie begäben sich daher in die Abhängigkeit von einem Fachmann, einem „social engineer“, der sie als Mediator zwischen technisch Machbarem, biomedizinischen und gesellschaftlichen Ziele berate.309 Die beeinträchtigte Autonomie ihrer genmanipulierten Kinder erklärt sich durch deren Existenz als "escapees and obligatory servants of an ideology of performance and exclusion"310 mit bleibender Asymmetrie zwischen dem Designer und dem um Selbstzweck und alleinige Autorschaft des eigenen Lebens gebrachten Designtem. Weiterhin davon ausgehend, dass einer liberalen Zulassung der PID tatsächlich die Anwendung der Gentechnik an menschlichen Embryonen folgt, dass also das gesamte eugenische Potenzial der PID ausgeschöpft wird, sind weitere, tiefgreifende soziale Implikationen eugenischer Einzelentscheidungen in Betracht zu ziehen. Diese vervollständigen schließlich das Bild einer reziproken Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft als Grundlage einer neuen Eugenik: Das Vorhaben, die eigenen Nachkommen und somit zumindest indirekt die menschliche Spezies zu optimieren, kann bei voneinander abweichendenden Zielvorstellungen zur Entwicklung verschiedener „Menschenarten“ führen, die dann auf einen gemeinsamen Vorläufer zurückblicken.311 Denkbar ist also, dass es zu einer durch den Menschen selbst herbeigeführten biologischen Aufspaltung seiner Art kommt. Die Lebensbewertung, die dabei elterlichen Entscheidungen für jeden verbessernden Eingriff in das embryonale Genom zugrunde liegt, entbehrt nicht nur eines mutmaßlichen Konsenses mit ihrem ungeborenen Kind, sondern begünstigt durch Gewöhnungseffekte auch die gesellschaftliche Diskriminierung geno- und phänotypisch andersartiger, von der „Norm“ abweichender Menschen. Zugleich bringe „[d]ie genetische Manipulierbarkeit [...] die Reiche der Freiheit und der Notwendigkeit durcheinander.“ Sie verändere das Verhältnis von Biologie und Gesellschaft, hebe die Grenze zwischen Natur und Kultur vollständig auf und mache sogar „Natürlichkeit“ zum Ergebnis einer Entscheidung, die variabel sei.312 Gerade die Differenz zwischen Kontingenz und zu verantwortendem Entschluss stelle jedoch Habermas zufolge die normative Basis menschlichen Zusammenlebens bereit.313 Moralisches Verhalten sei eine Antwort auf die natürli- 308 Mit dieser Frage beschäftigen sich u.a. die Abschnitte 3.2.2, 5.1.2 und 6.4.2. vgl. Testart und Sèle (1995) S.3089. 310 s. ebd.. 311 Diese Voraussage von Buchanan et al. (2000) greift Habermas (2005) S.77 auf. 312 vgl. Lemke (2001) S.43 mit einem Gedanken Nassehis. 313 vgl. Habermas (2005) S.54 nach einem Verweis auf Dworkin (1999). 309 160 Befürchtete Folgen der PID che Imperfektheit menschlichen Lebens und diene seinem äußeren und inneren Schutz.314 Dadurch, dass die Gentherapie mit dem Ziel der Perfektionierung dem biologischen Zufall ein Ende bereite und dem Menschen endgültig die Macht zur Transformation seiner selbst verleihe, wandle sich die "Gesamtstruktur unserer moralischen Erfahrung".315 Der Verlust der Autorschaft befreie die Generation der Transformierten von der Rechenschaftspflicht und unterminiere so die Normativität eines Zusammenlebens gleichwertiger Personen.316 Ausgehend von einem progredienten Embryonenschutz verletze genetische Fremdbestimmung nicht direkt die Rechte, sondern verändere die "naturale Voraussetzung für das [Status-]Bewusstsein der betroffenen Person". Dadurch gefährde sie die Mitgliedschaft dieser Person in einer Rechtsgemeinschaft, die mit der Trägerschaft „bestimmte[r] Rechte“ verbunden sei317. Die Folge elterlicher Teilautorschaft sei für die Kinder eine pränatal „induzierte Selbstentwertung, eine Beeinträchtigung ihres moralischen Selbstverständnisses“ [Hervorhebungen übernommen, A.S.].318 Habermas Ansicht nach gehe aus gentechnischen Eingriffen schließlich ein neues „gattungsethisches Selbstverständnis“ hervor, das seinerseits nicht länger die menschliche Moral stärke.319 6.5.6 Die Grenzen genetischer Manipulation Aus der dargestellten Problematik einer liberalen Eugenik ergeben sich entscheidende Beobachtungen. So verlangt die Umsetzung eugenischer Prinzipien eine Aufstellung von Kriterien zur Lebensbewertung320 sowie eine Beschreibung des anzustrebenden Optimums als richtungsweisende Maßnahme321. Dringlicher als eine Auseinandersetzung mit diesen Gesichtspunkten scheint allerdings eine allgemeine ethische Bewertung von Eingriffen des Menschen in seine eigene Natur. Diese wirft Fragen nach der Beschaffenheit menschlicher Natur und nach der Existenz moralischer Grenzen ihrer Manipulierbarkeit sowie deren Begründung auf. Die Einstellung des Menschen gegenüber der Option, natürliches Geschehen zu verändern und die eigene Spezies zu per- 314 vgl. Habermas (2005) S.62 f.. s. ebd. S.53. 316 vgl. ebd. S.115 f.. 317 s. ebd. S.131-133. Im „moralischen Sprachspiel“ werde von autonomen Teilnehmern die „Statusordnung“ ihrer Gemeinschaft festgelegt. Vgl. ebd. S.135. 318 s. ebd. S.136. 319 vgl. ebd. S.76. Hiermit ist das menschliche Selbstverständnis als „ethisch freie und moralisch gleiche, an Normen und Gründen orientiert Lebewesen“ gemeint. Vgl. ebd. S.74. 320 vgl. ebd. S.79. 321 vgl. Clausen (2006) S.396 f. über die Aufgabe des Menschen, seine Lebensweise selbst zu gestalten, und Wiesing (2006) S.333 über die diesbezüglich unterschiedlichen Ansichten und die dadurch bedingte Mehrzahl an Optima. Auch Frühwald (2001) stellt die Frage nach dem Bild des perfekten Menschen. 315 Befürchtete Folgen der PID 161 fektionieren, unterliegt, wie eine historische Abhandlung Wiesings anschaulich macht, im wesentlichen dem Einfluss vorherrschender religiöser und anderer metaphysischer Lehren:322 Unter der Annahme, dass alles Natürliche als Teil der Schöpfung gottgegeben sei, bedeutete jede Selbsttransformation des Menschen inakzeptable Hybris und gleichsam Überschreitung göttlicher Gesetze durch den Menschen. Der Mensch hätte nach diesem Selbstverständnis sein Verhalten gegenüber der göttlichen Allmacht zu rechtfertigen. Obwohl mit voranschreitender Säkularisierung und Aufklärung die Vernunftmoral die Religion in ihrer normativen Funktion abgelöst habe323 und sich zugleich ein allgemeiner Fortschrittsoptimismus ausgebreitet hat, versehen Werke der jüngeren weltlichen Literatur den menschlichen Traum vom Schöpfersein mit einem unheilvollen Beigeschmack.324 Auch heute noch rufen, wie geschildert, potenzielle Entwicklungen neuer, optimierender Gentechniken Skepsis und Angst vor Menschenzüchtung und Schädigungen des menschlichen Selbstverständnisses hervor. Der Darstellung Schotts zufolge erkläre das unbewusste Fortwirken alter Mythen in uns die Emotionalität und Erbittertheit der Diskussion um Errungenschaften der Biomedizin. Heute meine Hybris nicht länger die Erhebung des Menschen über das Göttliche, sondern das Ausbleiben einer „kritische[n] Analyse unserer geistigen Situation, [d.h.] unseres Aufenthaltsortes in der Natur- und Menschheitsgeschichte," bzw. die Ignoranz gegenüber der „Geschichte der Menschheit“ bei gleichzeitiger Verklärung einer möglichen Selbsttransformation.325 Vom Diskurs um den richtigen Umgang mit den neuen Möglichkeiten, Menschen biologisch zu verändern, sei daher „kritische Selbstreflexion“, die [...] ‚Dekonstruktion’ und Demut zusammenbringt“ zu verlangen.326 In den „großen Versuche[n] der Zusammenführung unterschiedlichster Wissenskulturen“ erkennt Frühwald bereits Ansätze, „die Denktraditionen der Menschheit, die kulturellen Überschreibungen des Buches der Natur“, in moderne Lehrsätze zu integrieren. Hinsichtlich unseres Menschenbildes, das die drohende neue Eugenik ins Wanken gebracht habe, sei ein Festhalten am gegenwärtigen Konsens über Menschenwürde und -rechte unabdingbar.327 Der Begriff der Menschenwürde ist schließlich Ausdruck eines über die Leiblichkeit hinausreichenden Selbstverständnisses als vernünftige, autonome und gleiche Wesen. Dass eine liberal-eugenische Praxis mit den heutigen Menschenrechten unvereinbar ist, zeigte 322 vgl. Wiesing (2006). vgl. Höver und Baranzke (2002) S.151-154 zu Bonitas-Tradition und neuem Autarkie-Ideal. 324 Zu denken ist hier z.B. an Mary Shelleys „Frankenstein“ und Aldous Huxleys „Brave New World“. 325 vgl. Schott (2002) S.174 f. mit einem Zitat von Wetzstein (2001). Vgl. Clausen (2006) S.393 zur Notwendigkeit theologischer Vorannahmen für die Verurteilung menschlichen Handelns als Hybris. 326 s. Schott (2002) S.175. Einen kulturgeschichtlichen Ansatz verfolgt auch Kreß (2001) S.3272 bei der Auseinandersetzung mit der Statusfrage. 327 s. Frühwald (2001). 323 162 Befürchtete Folgen der PID sich u.a. im beschriebenen Autonomieverlust der Eltern und Kinder, in der Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes durch Bewertung und Diskriminierung fremden Lebens sowie in einer Instrumentalisierung der Nachkommenschaft, die sich nicht durch die Berufung auf eine Steigerung des Kindswohls rechtfertigen lässt. Ob nämlich eine solche herbeigeführt wird oder nicht, ist zum Zeitpunkt der Genmanipulation gänzlich ungewiss.328 Auch wenn sich, wie Fiddler und Pergament anführen, ein persönlicher Nutzen (für das Kind?) viel früher als Änderungen des Genpools und deren soziale Folgen einstellte,329 rechtfertigt dies keinesfalls ein Ausblenden dieser Aspekte in der aktuellen Debatte um liberale Eugenik. Deutlicher als die Warnung vor Würdeverlust und dem Ende eines normativen Selbstverständnisses stellte sich ein universelles moralisches Verbot eugenischen Vorhaben entgegen. Ein absolutes embryonales Lebensrecht und Tötungsverbot sind jedoch nicht ausreichend anerkannt, um beispielsweise PND, PID und weitere Embryonenforschung gänzlich zu verhindern. Ebenso wenig herrscht Einigkeit hinsichtlich einer Ablehnung jeglicher Lebensbewertung330 oder hinsichtlich des objektivierenden Charakters optimierender Eingriffe in das embryonale Genom. Auf die Kohärenz zwischen unserem Menschenbild und der Zufälligkeit menschlicher Natur rekurriert der Versuch, infolge ihrer Manipulation eben diese Natur des Menschen zu moralisieren und sie so wieder in den Bereich des Unverfügbaren zu heben.331 Ziel dieses Vorhabens ist, trotz des Fehlens einer einheitlichen Moraltheorie ein weltanschaulich neutrales Normativum im menschlichen Sein selbst zu begründen, dessen Bedeutung für den einzelnen rational nachvollziehbar ist und daher seine Akzeptanz stärkt. Doch die Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern die Natur des Menschen normative Aussagen liefert, führt vor Augen, dass individuelle und Gattungsidentität selbst unter den Einflüssen von Biologie und Sozialisation entstehen, also Natur im engeren Sinne und Kultur in sich vereinen.332 „Kulturschaffen“ wiederum, verstanden als menschliches Eingreifen in die gewordene Natur, sei laut Clausen eine „anthropologische Konstante“, die, wie die „Kulturtechnik“ Medizin anschaulich mache, der Sicherung des Überlebens diene.333 Die Veränderung seiner Selbst sei konstitutiv für das Wesen des Menschen, und seit Entwicklung der Evolutionstheorie habe sie insbesondere hinsichtlich seiner biologischen Grundlage an Dringlichkeit gewonnen. Das Erkennen der eigenen, kontingenzbedingten Fehler328 vgl. Habermas (2005) S.141. Die Entscheidung über einen gentherapeutischen Eingriff sei „besserwisserisch“ und seine Beurteilung hinsichtlich des Kindswohls eine Überforderung. Vgl. ebd. S.148. 329 vgl. Fiddler und Pergament (1996) S.708. 330 vgl. Abschnitt 6.4.2. 331 vgl. Habermas (2005) S.46 mit einem Verweis auf Van den Daele (2000). 332 vgl. ebd. S.103 in Anknüpfung an den Begriff der Natalität bei Arendt (1959). Befürchtete Folgen der PID 163 haftigkeit und Schwäche schaffe einerseits die Möglichkeit der Verbesserung und andererseits die Notwendigkeit, selbst zu diesem Zweck in die Natur einzugreifen334 - zumal, so Agar, die Natur selbst in erster Linie nach dem Kriterium der Funktionalität selektiere, anstatt zu optimieren.335 Aufgrund der beschriebenen Dualität der Natur des Menschen führen sowohl Gegner als auch Befürworter genetischen Enhancements sie zur Begründung ihrer Position an. Erstere vertreten die Ansicht, dass Leben ein Geschenk sei und daher einen natürlichen Wert besitze, der jede Manipulation verbiete. Letztere stellen dagegen die menschliche Kreativität im Umgang mit dem Gegebenen als natürlichen Auftrag dar, in den sich letztlich ein Enhancement einfügen lasse.336 Dass totale Schicksalsergebenheit und totale Technisierung jeweils das Ende der Menschheit bedeuteten, belege die grundlegende Vereinigung beider Perspektiven in der menschlichen Natur. In der Konsequenz der Anerkennung dieser Wandelbarkeit menschlicher Natur durch die für sie gleichzeitig konstitutive Kontingenz und Neigung zu Selbsttransformation erscheine es allerdings unmöglich, in dieser Natur ein unmittelbares Normativum zu finden.337 Auf der Suche nach moralischen Grenzen weise diese Auffassung von der Natur des Menschen den Weg zur Frage nach ihren einzelnen, eventuell normativ wirksamen Bestandteilen, deren Existenz das Wesen des Menschen ausmache. Clausen beleuchtet in diesem Kontext den Aspekt der Vulnerabilität und die mechanistische Sichtweise des Menschseins. Davon ausgehend, dass entgegen allen natürlichen Veränderungen Verletzlichkeit ein wesentliches Merkmal des Menschen sei, seien Maßnahmen genetischen Enhancements als Versuche, diese Verletzlichkeit zu beenden, und somit als Bedrohung unseres Selbstbildes zu werten.338 Auf dem Weg der Optimierung ginge etwas eigentlich Menschliches verloren. Daher sollte der Mensch, statt Leidfreiheit und Unsterblichkeit die Annahme seiner Vulnerabilität und Endlichkeit zu erreichen versuchen.339 Der Hinweis, dass die Beseitigung aller pathogenen Gene aufgrund von Spontanmutationen bereits aus technischer Sicht utopisch sei,340 wird einerseits gegen die Zulassung selektiver oder gentechnischer Methoden vorgebracht, um die Aussichtslosigkeit eines Perfektionierungsversuchs hervorzukehren. Andererseits wird die genetische Komplexität angeführt, 333 s. Clausen (2006) S.391. vgl. Wiesing (2006) S.329. 335 vgl. Agar (1999) S.175. 336 vgl. Clausen (2006) S.392 in Anlehnung an Parens (2005) Differenzierung zwischen „gratitude framework“ und „creativity framework“. 337 vgl. ebd. S.395-397. 338 vgl. ebd. S.398 Medizinische Maßnahmen, die sich gegen Verletzungen und Leid als Folgen menschlicher Verletzlichkeit richten, seien legitim, da sie die Vulnerabilität an sich akzeptierten. Folgt man hingegen der Einstellung Eibachs (2000) S.109, dass "die Leidensfähigkeit [...], wenn Leben ‚glücken’ soll, ein notwendiger Gegenpol zur Glücksfähigkeit [ist]“, entsteht der Eindruck, dass auch hier Restriktionen wünschenswert seien. 339 vgl. ebd. S.398 mit einem Zitat von Van den Daele (1985). 340 vgl. Testart und Sèle (1995) S.3089. 334 164 Befürchtete Folgen der PID um die geringen Auswirkungen solcher Methoden auf die Fragilität und Unvollkommenheit des Menschen zu begründen und ein Streben nach schöpferischer Allmacht, Leidfreiheit oder Eugenik zu negieren.341 Vor diesem Hintergrund seien, so Clausens Schlussfolgerung, erst Maßnahmen, die tatsächlich den Menschen unverletzlich, d.h. unsterblich machten, gemäß einem auf Vulnerabilität konstituierten Menschenbild illegitim.342 Die Begrenzung des Menschenseins auf seine chemischen und physikalischen Eigenschaften sei im Bereich der Medizin als praktischer Blickwinkel weitestgehend anerkannt. Seine Verabsolutierung werde allerdings negativ bewertet. Sie drohe im Fall eines liberalen Umgangs mit gentechnischen Eingriffen in das menschliche Genom einzutreten, die alles im Menschen dechiffriert und kontrollierbar erscheinen ließen. Der „metaphysische[] Reduktionismus“ sehe den Menschen ausschließlich als Maschine und beraube ihn seines Subjekt- und Würdestatus, der Grundlage eines rücksichtsvollen Miteinanders sei.343 Die beiden hier nachgezeichneten Ansätze Clausens lassen sich mit der von Habermas geäußerten Befürchtung eines Verlusts des moralischen Bewusstseins des Menschen344, dem analog eine konstitutive Bedeutung im Hinblick auf die menschliche Natur zugeschrieben werden kann, zusammen führen. So machten ein Desavourieren jeglicher Vulnerabilität sowie die Objektivierung des Menschen die Entwicklung einer Moral innerhalb von Gemeinschaften überflüssig, weil sie das Ende menschlicher Schutzbedürftigkeit und Verantwortlichkeit bedeuteten. Es stellt sich die Frage, wie das Leben eines Menschen unter Menschen aussähe, wenn ihr Umgang miteinander nicht länger durch Moral bestimmt würde. Darüber hinaus bleibt zu klären, worin ein Interesse, normative Wesen zu sein, begründet sein könnte, denn "[w]enn [...] die eugenische Fremdbestimmung die Regeln des Sprachspiels [des moralischen Gemeinwesens] selbst verändert, lässt sie sich nicht anhand der Regeln selbst kritisieren. Stattdessen fordert die liberale Eugenik eine Bewertung der Moral im ganzen heraus.“345 Eine solche „Bewertung der Moral im Ganzen ist nicht selbst ein moralisches, sondern ein ethisches, ein gattungsethisches Urteil.“346 Kollektive Moral sichere die Autorschaft und das Selbstseinkönnen jedes Individuums, indem sie seinen Freiheitsanspruch verallgemeinere und diesem den Respekt einräume, der schließlich die moralische (Be-)Handlung des einen durch den ande- 341 vgl. hierzu Kreß (2002a) S.176, Schott (2002) S.175, Frühwald (2001) und Liening (1998) S.186 f.. vgl. Clausen (2006) S.398. 343 vgl. ebd. S.399. Winter und Fuchs (2000) S.302 fragen, ob nicht das Potenzial der Biomedizin im Sinne „menschlicher Hybris“ überbewertet werde, wenn man ihm derartige Auswirkungen zutraue. 344 vgl. Abschnitt 6.5.5 dieser Arbeit. 345 s. Habermas (2005) S.151. 346 s. ebd. S.124. 342 Befürchtete Folgen der PID 165 ren Menschen kennzeichne.347 Ohne diesen Respekt, ohne die „moralischen Gefühle der Verpflichtung und der Schuld, des Vorwurfs und der Verzeihung“ und ohne Solidarität wäre das Leben laut Habermas „unerträglich“ und „nicht lebenswert“. Aus diesem Grund stelle der Konsens über Vernunftmoral und Menschenrechte das Ergebnis eines trotz Pluralismus fortbestehenden moralisch-sein-Wollens dar. Dieser grundlegende Wille könne auch die emotionale Abwehr gegenüber einer Selbstinstrumentalisierung der Gattung und dem damit einhergehenden Würdeverlust durch liberale Eugenik begründen.348 Habermas empfiehlt daher im Hinblick auf den notwendigen öffentlichen Diskurs über Entwicklungen, die unser moralisches Selbstverständnis gefährdeten: "Wo uns zwingende moralische Gründe fehlen, müssen wir uns an den gattungsethischen Wegweiser halten."349 6.5.7 Restriktivität angesichts einer potenziellen Eugenik Der Entschluss, dem eher intuitiven als bewussten moralisch-sein-Wollen zu folgen, kann die konkrete Forderung nach einem Recht auf ein unberührtes Genom begründen, das Symmetrie der Beziehungen und Autorschaft des eigenen Lebens bewahren soll. Angesichts der Option kontraintuitiven Verhaltens entsteht jedoch erst infolge der Bewusstmachung des menschlichen Bedürfnisses, einer moralischen Gemeinschaft anzugehören, das rationale Gebot, ein solches Recht anzuerkennen. Dieses entspricht dem Konsens über ein gattungsethisches Selbstverständnis, das eine liberale Eugenik verbietet. Einen solchen gelte es Habermas zufolge in der Kontroverse zur moralischen Beurteilung potenziell eugenischer Methoden zu suchen, die ihrerseits einer undemokratischen Auto-Autorisierung der Wissenschaft vorbeuge. Wie dargestellt ist dabei vor dem Hintergrund der Menschenrechte die Integration von und Reflexion über Natur und Geschichte des Menschen von Bedeutung. Außer dem moralischen Selbstverständnis wird auch die genetische Vielfalt der menschlichen Gattung als schützenswert angesehen und gegen genmanipulative Eingriffe angeführt.350 Auf nationaler Ebene müsste in einem Rechtsstaat den autonomen Bürgern Menschenzüchtung mittels gezielter Veränderung des Genoms gesetzlich verboten werden,351 zumal, wie Habermas darlegt, 347 vgl. Habermas. (2005) S.97-100. vgl. ebd. S.124 f.. 349 vgl. ebd. S.121. 350 vgl. Graumann (2003a) S.162 mit einem Zitat von „Disabled Peoples’ International Europe“ (2000) und Mieth (1997) S.185 mit dem Hinweis, dass die Bioethik-Kommission der UNESCO (1997) die Gesamtheit des menschlichen Genoms in einem Entwurf als „’Patrimonium’ der Menschheit“ bezeichnet habe. 351 Eine Prävention durch den Gesetzgeber fordern auch Hepp (2003) S.356 und der Nationale Ethikrat (2003) S.130. 348 166 Befürchtete Folgen der PID „[a]us der Sicht der Verfassung eines demokratischen Gemeinwesens [...] die vertikale Beziehung des Bürgers zum Staat gegenüber dem horizontalen Netz der Beziehungen der Bürger untereinander nicht länger privilegiert [ist].“352 Da es letztlich um die Bewahrung des „praktischen Selbstverständnisses der Moderne“ gehe, handle es sich um einen „politische[n] Akt selbstbezüglichen moralischen Handelns.“353 Nur durch restriktives Eingreifen in den autonomen Entscheidungsspielraum des einzelnen ist von Seiten der staatlichen Legislative sicherzustellen, dass Gerechtigkeit und personale Freiheit nicht durch potenziell eugenische Techniken gefährdet werden. Darüber hinaus sind auf supranationaler Ebene Regelungen zu treffen, denn „such regulation of eugenics could only be effective if all countries abide the same rules”, because "[w]hat is in the making is a veritable revolution in ethics transcending the frontiers of any given country."354 Als Vorstöße in diese Richtung können u.a. Art.12 der Europaratskonvention zur Biomedizin, der die Kopplung genetischer Tests an eine Beratung vorschreibt - diese darf allerdings nicht direktiv sein355 -, und Art.3 der EU-Grundrechtscharta, der eugenische Praktiken zur Selektion von Personen verbietet, gewertet werden.356 Sie stellen sich in Abhängigkeit von ihrer Umsetzung in den einzelnen Nationen dem Einsetzen einer liberalen Eugenik zumindest in Europa entgegen. Zu erörtern bleibt, in welchem Maß die Gesetzgebung eine Anwendung derjenigen medizinischen Maßnahmen einschränken soll, von denen aus biologischer Perspektive ein eugenischer Effekt und aus gesellschaftlicher Perspektive die Gefahr einer neuen Eugenik ausgeht. Dass dies auf etliche etablierte Maßnahmen und in besonderer Weise auf die Präimplantationsdiagnostik zutrifft, haben wir bereits gesehen. Doch ist die einzige Möglichkeit, die Gefahr zu bannen, der Verzicht auf die Errungenschaften der modernen Medizin oder gibt es Kriterien, nach denen ihr Einsatz als akzeptabel oder nichtakzeptabel gewertet werden kann? Es ist zu beachten, dass die Angst vor der Entstehung einer neuen Eugenik wesentlich an die Erwartung einer Slippery-Slope-Entwicklung in quantitativer und qualitativer Hinsicht geknüpft ist: hin zu einer sozial-eugenischen statt individualtherapeutischen Indikation sowie hin zu positiver Selektion und embryonaler Gentherapie bzw. -manipulation.357 Diese qualitative Erweiterung instrumentalisiert Embryonen und die aus ihnen hervorgehenden Personen entsprechend spezifischen, auf sie gerichteten Hoffnungen ihrer „Autoren“. Sie greift daher stärker in die Entwicklung des 352 s. Habermas (2005) S.130. s. ebd. S.49. 354 s. Testart und Sèle (1995) S.3090. Vgl. auch Wiesing (2006) S.335 zur Globalisierungsproblematik. 355 Das Vorhandensein des Kriteriums der Nichtdirektivität in verschiedenen nationalen und internationalen Richtlinien zur genetischen Beratung lässt sich bei Borry et al. (2007) nachprüfen. 356 vgl. Übereinkommen des Europarats (1997) und Europäische Union (2000) S.9. 353 Befürchtete Folgen der PID 167 Statusbewusstseins ein als der Ausschluss einer Krankheit oder Behinderung, dessen negativer Effekt sich schon bei nach PND geborenen Kindern zeigen müsste. Auch die genomische und genetische „identity-over-time“ [im Original kursiv, A.S.] einer Person, verstanden als Ebenen eines mehrschichtigen Identitätskonzepts, erführen, wie Zeiler darstellt, erst durch Eingriffe in das embryonale Genom eine Veränderung mit unbekannten Auswirkungen auf die personale Gesamtidentität.358 Wenn sich also eine restriktive Zulassung der PID, wie in Abschnitt 5.1.8 beschrieben, als umsetzbar und wirksam erwiese, verlöre das Eugenik-Argument ihrer Gegner an Gewicht. Die PID wäre unter diesen Umständen nicht mehr und nicht weniger Schrittmacher einer neuen Eugenik als z.B. PKD und medizinisch indizierte Abtreibungen, bei deren Durchführung Lebensbewertung und Instrumentalisierung eines Menschenlebens ebenso wenig wie eine eugenische Intention sicher auszuschließen sind. Welche Voraussetzung ist aber entscheidend für die Abwehr einer solchen Intention und damit für die Rechtmäßigkeit dieser Methoden? Der Gebrauch des von Habermas als „regulative Idee“ vorgeschlagenen KonsensKriteriums, der im Hinblick auf eine negativ-eugenische Gentherapie von Embryonen sinnvoll erscheint,359 hilft im Fall aller drei o.g. Maßnahmen nicht weiter, zumal diese nicht zwischen einem Leben mit oder ohne eine Krankheit, sondern über Existenz oder Nicht-Existenz entscheiden. Die Präferenz des noch nicht entscheidungsfähigen Betroffenen - als solcher mag bei Durchführung der Polkörperdiagnostik auch eine befruchtete Einzelle im Pronucleusstadium gelten - kann und darf hier nicht antizipiert werden. Ohnehin bezieht die negative Selektion durch PID, PKD und Spätabbruch ihre Rechtfertigung nicht aus einem kindlichen Interesse an Nicht-Existenz, sondern aus dem Interesse der Eltern an ihrer eigenen Gesundheit, die wiederum durch die Geburt eines schwerkranken Kindes gefährdet ist. Auch die Differenzierung der Zielsetzung eugenischer Maßnahmen in „Integrum“ und „Optimum“ ist wenig hilfreich, denn es besteht bisher nicht die Option, die untersuchten Individuen pränatal zu therapieren oder genetisch zu verbessern. Perfektioniert werden kann nur die menschliche Spezies als solche, indem PID, PKD und Abtreibungen die Weitergabe hereditärer Krankheiten und Behinderungen unterbinden bzw. sogar die Weitergabe wünschenswerter Gene fördern. Da die Verwendung des Krankheitsbegriffs von kulturellen Faktoren und subjektiver Beurteilung abhängt360, ist die Grenze zwischen negativer und positiver Eugenik unscharf. Sie kann daher nur willkürlich mit Hilfe konkreter 357 vgl. Habermas (2005) S.156, der den Eugenik-Einwänden gegen die PID den „Charakter von ‚Dammbruchargumenten’ zuschreibt. 358 vgl. Zeiler (2007) S.30-32. 359 s. Habermas (2005) S.149 f.. Im Fall medizinisch indizierter negativ-eugenischer Genmanipulation sei aufgrund eines mutmaßlichen Einverständnisses der zukünftigen Person eine Einschränkung ihres Rechts auf ein unverändertes Genom denkbar. 168 Befürchtete Folgen der PID Regelungen festgelegt werden. Anstatt wie liberale Eugeniker aus diesem Umstand und der ihrer Ansicht nach fehlenden moraltheoretischen Bedeutung des Krankheitsbegriffs auf die Gleichwertigkeit von Therapie und Enhancement zu schließen, verlangt die Prävention einer neuen Eugenik das Verbot genetischen Enhancements361: Unter Enhancement ist in diesem Kontext nicht die biologische, sondern die von Eltern, Ärzten und Gestaltern der Sozial- und Gesundheitspolitik intendierte Auswirkung medizinischer Techniken auf das Leben der Nachkommen zu verstehen, die diesen Vorteile gegenüber anderen verschaffen soll und eine relative Bewertung bestimmter Merkmale voraussetzt. Um hinsichtlich einer Anwendung der PID zwischen „eugenische[r] Orientierung“ und den „’natürlichen’ Zukunftshoffnungen der Eltern“ zu differenzieren, seien nach Meinung McGees einige Fehler zu vermeiden: 1) Fehler der Kalkulierbarkeit und 2) Fehler der Anmaßung: Eltern hofften, mit Hilfe genetischer Veränderungen das Leben ihres Kindes zu entwerfen, anstatt die kindliche Autonomie zu respektieren. 3) Fehler der Kurzsichtigkeit: Die Entwicklung einer Krankheit und der Möglichkeiten, sie zu therapieren, seien ebenso wenig wie der Effekt eines Optimierungsversuchs vorhersehbar. 4) Fehler des vorschnellen Urteils: Die Gesundheit des bedingt angenommenen Kindes könne durch die Biopsie, während der Schwangerschaft oder nach der Geburt geschädigt werden. 5) Fehler des Pessimismus: Die PID werde als Mittel einer neuen Eugenik angesehen.362 Die hier aufgezählten Irrtümer müssen Inhalt der Beratungsgespräche mit Risikopaaren sein. Aufgrund polygener und komplex vererbter Merkmale kann die PID allein niemandem zu einem „perfekten“ Kind verhelfen,363 zumal das Erbgut jedes Menschen und mithin eines Embryos nach PID unzählige Gene enthält, die mit Krankheiten in Verbindung gebracht werden und von denen einige auf Spontanmutationen zurückzuführen sind. Die Begrenztheit ihrer Aussagekraft gilt es den prospektiven Eltern zu vermitteln, denen mit Zulassung der PID weder ein absolutes Recht auf ein gesundes, geschweige denn auf ein „perfektes“ Kind zugesprochen wird noch zugesprochen werden kann. Gleiches gilt für Polkörper- und Pränataldiagnostik. Um einem Optimierungswunsch oder einer eugenischen Absicht weiter vorzubeugen, sollten Risikopaare die möglichen sozialen Implikationen ihrer Entscheidung kennen364 und in ihre Überlegungen einbeziehen. Schließlich muss sich die grundsätzlich individualtherapeutische Zielsetzung der PID, 360 vgl. Kröner (2000) S.699, Fuchs und Lanzerath (2000) S.702 und Abschnitt 6.1.1 dieser Arbeit. vgl. Reiss und Straughan (2001) S.223 nennen dieses Verbot angesichts drohender Uneinigkeit hinsichtlich der Durchführung optimierender Eingriffe „the side of caution“. 362 vgl. McGee (1997) gemäß einer Zusammenfassung bei Haker (2003) S.370-372. 363 vgl. Nationaler Ethikrat (2003) S.130 f.. 361 Befürchtete Folgen der PID 169 PKD oder Abtreibung in dem elterlichen Motiv für ihre Inanspruchnahme bestätigen.365 Von Seiten der Ärzteschaft ist zu erwarten, dass in verschiedenen Stellungnahmen zur Pränatal- und Fertilitätsmedizin eugenischen Prinzipien klar abgelehnt366 und im Gegenzug die Absicht, Leid von den betroffenen Paaren abzuwenden, betont werden. Ziel der Politik muss sein, das gesellschaftliche Klima anti-eugenisch zu gestalten. Zusätzlich zu den bereits beschriebenen juristischen Maßnahmen in Form eines Verbots genetischen Enhancements, der restriktiven Zulassung und exakten Regelung ausschließlich negativselektiver Techniken367 sind sozial- und bildungspolitische Maßnahmen zu ergreifen. Denkbar sind neben der in Abschnitt 6.4.6 dargestellten Förderung Betroffener und ihrer Familien sowie der Verhinderung ihrer Diskriminierung Initiativen zur Information und Aufklärung der Öffentlichkeit über die naturwissenschaftlichen, sozialen und ethischen Aspekte pränataler Diagnostik. Reiss hebt nachdrücklich die Rolle ergebnisoffener Erziehung in Ausbildungsstätten und durch Medien hervor und konkretisiert: „Nor is education merely about acquiring ‚facts’, even when what the facts are can be agreed upon. To become more educated is, in a very real sense, to become more human.” Über Wissensvermittlung hinausreichende Erziehung zu ermöglichen, sei Aufgabe des Staates.368 Dieser muss im Privaten und in der Öffentlichkeit Raum und Gelegenheiten schaffen, damit Menschen miteinander in einen interaktiven und kommunikativen Erziehungsprozess treten können. Die Debatte über das Selbstverständnis des Menschen, seine Möglichkeiten, sich selbst genetisch zu verändern, und den Umgang damit darf und wird auch im Fall einer vorläufigen Zulassung der PID nicht abebben. Sie ist und bleibt ein fester Bestandteil menschlichen Lebens in Gemeinschaft. 364 Diese Korrelation zwischen Information und „eugenische[r] Bereitschaft/Forderung“ postuliert u.a. Nippert (1997) S.125. 365 vgl. ebd.. 366 So erklärt die Bundesärztekammer (1998) S.3238: „Keine Maßnahme der pränatalen Diagnostik hat eine eugenische Zielsetzung." Die assistierte Reproduktion werde nicht zu eugenischen Zwecken eingesetzt (vgl. Bundesärztekammer (2006) S.1393). Auch im Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur PID erteilt die Bundesärztekammer (2000) S.526 „eine deutliche Absage an jede Art eugenischer Selektion und Zielsetzung.“ 367 Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik verlange u.a. „die Begrenzung von Indikationen zur genetischen Pränataldiagnostik auf gesundheitsrelevante Merkmale sowie die Festschreibung einer humangenetischen Beratungspflicht im Kontext einer medizinischen Indikationsstellung zum Schwangerschaftsabbruch [...].“ S. Propping (2007) S.379. 368 s. Reiss und Straughan (2001) S.243 f.. 170 Abschließende Stellungnahme 7. Abschließende Stellungnahme Die ethische Analyse der Präimplantationsdiagnostik in der vorliegenden Arbeit setzt sich auf der einen Seite mit den moralischen Vorannahmen sowie der aktuellen redproduktionsmedizinischen Praxis und auf der anderen Seite mit der Bedeutung und den Folgen der PID für Individuen und Gesellschaft auseinander. Sie kommt dabei zu folgendem Resultat: 7.1 Vorannahmen und heutige Reproduktionsmedizin Im ersten Kapitel kann herausgestellt werden, dass die Bewertung der Präimplantationsdiagnostik wesentlich davon abhängt, welcher Status dem menschlichen Embryo zugeschrieben wird. Weder hinsichtlich der Statusfrage noch hinsichtlich der Auslegung der Menschenwürdeträgerschaft und ihres Zusammenhangs mit dem Recht auf Leben besteht jedoch ein Konsens, der im Hinblick auf eine Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik wegweisend sein könnte.1 Ein embryonaler Personstatus in sensu stricto, von dem auch das deutsche Embryonenschutzgesetz ausgeht, verbietet die Durchführung der PID insofern, als es bei ihr immer zu einer Verwerfung von Embryonen käme, die deren Recht auf Leben und Menschenwürde missachtete. Außerdem widerspräche eine Zeugung auf Probe dem Selbstzweck und der daraus hervorgehenden unbedingten Annahme des Embryos. Wird der Embryo hingegen als Objekt angesehen, hat er keinerlei Schutzanspruch, der sich einer PID entgegenstellte. Das Progredienz-Modell sieht den frühen Embryo zwar als schützenswert, aber noch nicht als Person an. Es schreibt ihm je nach Auslegung noch kein oder ein relatives Recht auf Leben zu. Der Respekt vor dem menschlichen Embryo als aktuellem oder künftigem Grundrechtsträger verlangt ein sorgfältiges Abwägen seines Schutzanspruchs gegen andere personale Grundrechte. Angesichts der ungeklärten Totipotenzfrage erscheint daher im Hinblick auf die Methode der PID die Blastozystenbiopsie gegenüber der Blastomerentnahme vorteilhaft. Versuche, sich über die Herstellung eines Zusammenhangs oder über einen Vergleich der PID mit anderen bereits zugelassenen Methoden der Reproduktionsmedizin einem Urteil anzunähern, führen im zweiten Kapitel zu folgenden Ergebnissen: Die Anwendung der In-vitroFertilisation ist weiterhin moralisch umstritten, zumal sie Embryonen für eine höhere Schwangerschaftsrate instrumentalisiert und daher die Annahme eines Progredienz- oder Objektstatus voraussetzt. Bei der individuellen Entscheidung für oder gegen eine PID fallen außerdem ihre 1 vgl. Kapitel 2.2 und Abschnitt 6.3.2. Abschließende Stellungnahme 171 Invasivität und ihre geringen Erfolgsaussichten ins Gewicht. Insgesamt lässt sich aus der IVF weder ein Recht auf ihre Ausweitung noch ein Verbot der PID folgern.2 Auch die verbreitete Praxis der PND und Spätabbrüche ist ethisch bedenklich und kann trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten mit der PID nicht zu deren Rechtfertigung herangezogen werden. Allerdings sollte der in ihrem Kontext hervortretende Wertungswiderspruch zwischen Embryonenschutzgesetz und §218 StGB, der die Instrumentalisierung menschlicher Feten durch die Selektion gemäß ihrer genound phänotypischen Eigenschaften ermöglicht, aufgelöst werden - sei es durch eine strengere Regelung des medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs oder sei es durch eine Lockerung des Embryonenschutzes.3 Die aktuell verbreitete, gesetzlich verankerte Wertung der Durchmischung maternaler und paternaler Chromosomen als Abschluss des Befruchtungsvorgangs und somit Beginn embryonaler Existenz ist ohnehin alles andere als ein eindeutiges Kriterium. Es verbietet die PID, während es zugleich zumindest die Methode der Polkörperdiagnostik ethisch unproblematisch erscheinen lässt.4 Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage in Deutschland sind schließlich nicht nur eine Zulassung der PID, sondern auch die Legitimierung der IVF und PKD ob ihrer Entwicklung im Rahmen der Embryonenforschung dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. 7.2 Bedeutung und Folgen der PID für Individuen und Gesellschaft Grundsätzlich bleibt die Präimplantationsdiagnostik als problematisch anzusehen, da ihr selektives Potenzial im Gegensatz zu PND und PKD nicht durch eine bestehende Schwangerschaft oder bestimmte Vererbungsmodi begrenzt wird. Sie ist daher auf besondere Weise mit der Gefahr einer positiven Selektion assoziiert. Allerdings bietet auch schon ihr ausschließlich negativ selektiver Einsatz die Aussicht, hereditäre Erkrankungen langfristig auszuschalten.5 Nicht zuletzt macht sie auf bisher einzigartige Weise die Ergebnisse einer zukünftigen Keimbahntherapie kontrollierbar. Diese durch die PID eröffneten Möglichkeiten lassen Warnungen vor negativen Auswirkungen auf unser Menschenbild und negativen gesellschaftlichen Implikationen wie Diskriminierung und Eugenik laut werden: Menschliches Leben - sei es in Form eines Embryos oder wie im Fall der PKD eines Pronucleus-Stadiums - wird eigens extrakorporal erzeugt, um es einer Selektion zugänglich zu machen. Hierin komme eine Geringschätzung früher und insbesondere genetisch „defizitärer“ Lebensformen zum Ausdruck. Ausgehend von einem embryonalen Per2 vgl. Kapitel 3.3. vgl. Kapitel 3.1 und 3.2. 4 vgl. Abschnitt 5.2.2. 3 172 Abschließende Stellungnahme sonstatus wird die bedingte Annahme eines Embryos auf andere Personen übertragbar. Menschliches Leben in allen Stadien würde nicht mehr um seiner selbst willen, sondern unter Vorbehalt angenommen. Dieser Wandel verändere unser auf Würde basierendes Menschenbild und führe schließlich über einen gesellschaftlichen Druck zur vermehrten Inanspruchnahme selektiver medizinischer Techniken am Lebensanfang und auch am Lebensende. Den hier aufgezeigten Warnungen ist in der ethischen Kontroverse zur PID, aber ebenso in der Erörterung von PND und PKD unbedingt Beachtung zu schenken. Im Umgang mit diesen Warnungen hilft die Auseinandersetzung mit der einzig akzeptablen Rechtfertigung einer Einführung der PID weiter: Diese begründet sich in dem Recht der prospektiven Eltern auf körperliche Unversehrtheit und in ihrem Recht auf reproduktive Autonomie innerhalb der Grenzen medizinischer Indiziertheit. Alleiniger Ausgangpunkt ist die absolute Belastung, die eine konkrete Krankheit oder Behinderung eines betroffenen Kindes für dessen Eltern bedeutet, nicht die Bewertung seines Lebens oder ein ihm unterstelltes Interesse an Nicht-Existenz.6 Das heißt, dass ein wertender Vergleich genetisch verschiedenen „Lebens“ nicht Grund einer PID und die von den prospektiven Eltern verfolgte Absicht persönlicher und nicht populationsgenetischer Natur ist. Im Allgemeinen ist eine Existenz abweichender Motive und Ziele jedoch ebenso wenig wie bei Schwangerschaftsabbruch oder PKD nachweisbar und somit niemals völlig auszuschließen. Die Gefahr der Diskriminierung und des Auftretens eugenischer Tendenzen, die unser Selbstverständnis als moralische Wesen gefährden, korreliert daher negativ mit dem Maß an Restriktivität, in dem wir die PID zulassen. 7.3 Forderungen im Fall einer Zulassung der PID Von einer Legitimität der PID ist also nur dann auszugehen, wenn ihre Regulierbarkeit insbesondere im Hinblick auf die Indikationsstellung sowie die Realisierbarkeit ihrer notwendigen Voraussetzungen wie die elterliche Autonomie in der Praxis gesichert sind. Aus dieser Feststellung ergeben sich diverse Forderungen an 1) die rechtliche Regelung und 2) die Gesellschaft, in der die PID zum Einsatz kommt: Zu 1) Die rechtlich fixierte medizinische Indikation steckt unter der Berücksichtigung verschiedener Aspekte hereditärer Erkrankungen den Rahmen informationeller und reproduktiver Autonomie der Paare ab. Gleichzeitig darf von Seiten der Gesetzgebung und Rechtsprechung keine Bedrohung der Autonomie der ratsuchenden Paare, ihrer Berater sowie der mit der PID 5 vgl. Abschnitt 6.5.4. Abschließende Stellungnahme 173 beauftragten Ärzte entstehen. Vielmehr sind Form und Inhalt der einzelnen Schritte von der Beratung bis zur Durchführung der PID genauestens zu regeln.7 Dabei ist internationale Einheitlichkeit hinsichtlich der Legalisierung eines restriktiven Einsatzes der PID und des Verbots ihres Missbrauchs zum Zweck genetischen Designs oder zum Zweck der Keimbahntherapie anzustreben. Gesellschaftsstudien zu den Auswirkungen der PID sowie anderer selektiver Techniken sind angesichts der oben angeführten Bedenken unerlässlich. Ihnen kommt bei der regelmäßig erforderlichen Revision rechtlicher Regelungen neben den Datensammlungen reproduktionsmedizinischer Zentren ein besonderes Gewicht zu. Zu 2) Unabhängig von der Zulassung der PID müssen wir unsere Gesellschaft aktiv gestalten, um ihre Humanität zu sichern. Auf der einen Seite soll die Integration von Menschen mit genetischen Erkrankungen ihrer Diskriminierung vorbeugen und ihre soziale Anerkennung stärken. Auf der anderen Seite ist umfassende Gesundheitserziehung und insbesondere Aufklärung der Bevölkerung hinsichtlich der komplexen Bedeutung der Gene für die individuelle Entwicklung sowie hinsichtlich gendiagnostischer Möglichkeiten und ihrer Aussagekraft vonnöten.8 Ziel dieser Maßnahmen ist, langfristig Akzeptanz und Wertschätzung der Vielfalt menschlichen Seins zu erreichen und kurzfristig die Bedingungen für autonome Entscheidungen in genetischmedizinischen Belangen zu schaffen sowie die Aussichts- und somit Sinnlosigkeit eugenischer Bestrebungen klarzustellen. Trotz aller Zeichen der Solidarität und Unterstützung kann eine Gesellschaft im Einzelfall die Entscheidung darüber, ob ein Paar der Belastung durch ein hereditär schwerstkrankes Kind gewachsen ist, nicht fällen. Sie kann ihm aber einen Handlungsfreiraum schaffen, indem sie nicht-diagnostische Optionen wie Adoptionen leicht zugänglich und den Verzicht auf Elternschaft allgemein verständlich macht und vielleicht diagnostische Möglichkeiten wie die PID als individuelle Hilfe legitimiert. Dabei wird und darf in der Prüfung der Zulässigkeit neuer Errungenschaften der Medizin die Diskussion darüber, wer wir sind und wer wir sein wollen, nicht abreißen. 6 vgl. Abschnitt 6.4.2. vgl. Abschnitt 5.1.7. 8 Eine gute Aufklärung hilft die von McGee (1997) aufgezeigten Fehler - vgl. Abschnitt 6.5.7. - zu vermeiden. 7 174 Zusammenfassung 8. Zusammenfassung Die ethische Analyse der Präimplantationsdiagnostik erfolgt anhand einer Konsistenz- und Kohärenz-Prüfung der Argumente aus der Debatte in Deutschland und aus einschlägigen internationalen Beiträgen. Dabei werden besonders die Evaluation der bisherigen Anwendung der PID und der aktuelle wissenschaftliche Sachstand berücksichtigt. Aus deontologischer Sicht ist die PID nur unter Annahme eines Progredienz- oder Objekt-Status des Embryos ethisch akzeptabel. Schreibt man dem Embryo Menschenwürde, d.h. Selbstzweck und ein Recht auf Leben zu, können die Vorwürfe inakzeptabler Bewertung, Selektion und Instrumentalisierung menschlichen Lebens gegenüber der PID, aber auch gegenüber Spätabtreibungen - im Sinne eines Wertungswiderspruchs zwischen ESchG und §218 -, IVF und Polkörperdiagnostik erhoben werden. Ebenso wie die PID ist die Zulassung von IVF und PKD aufgrund ihrer Entwicklung durch Embryonenforschung dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. Im Fall des Progredienz-Modells sind Beginn und Begründung der Trägerschaft des Rechts auf Leben und der Menschenwürde zu diskutieren sowie der embryonale Schutzanspruch gegen das Recht der prospektiven Eltern auf Autonomie und körperliche Unversehrtheit, das auf der medizinischen Indiziertheit der PID gründet, abzuwägen. Hinsichtlich der praktischen Anwendung der PID sind die Beratung der Paare zur Sicherung ihrer Autonomie sowie die gesetzliche Fixierung der Indikationen und Verfahrensvorschriften zur Verhinderung einer Slippery-Slope-Entwicklung relevant, um von einer ethischen Zulässigkeit der PID ausgehen zu können. Aus konsequentialistischer Perspektive weckt im Zeitalter der prädiktiven Medizin das scheinbar unbegrenzte selektive Potenzial der PID die Assoziation mit der Gefahr positiver Selektion und negativen gesellschaftlichen Implikationen wie Diskriminierung und Eugenik. Die Übertragbarkeit der bedingten Annahme eines Embryos auf andere Personen und die Warnung vor negativen Auswirkungen auf unser Würde-Menschenbild basieren jedoch auf dessen Personstatus. Die PID ist individuelle Hilfe zur Abwendung einer absoluten Belastung der Paare und nicht Folge einer relativen, womöglich populationsgenetisch ausgerichteten, Lebensbewertung oder eines embryonalen Interesses an Nicht-Existenz. Durch die aktive Gestaltung unserer Gesellschaft zur Sicherung ihrer Humanität und durch ein hohes Maß an Restriktivität bei der Zulassung der PID ist die Gefahr negativer Implikationen auf unser moralisches Selbstverständnis und unsere Gesellschaft minimierbar. Die Legitimität der PID hängt somit von der Kontrollierbarkeit ihrer Praxis ab, die einer ständigen Revision bedarf. Literaturverzeichnis 175 9. Literaturverzeichnis Agar, Nicholas (1999), Liberal Eugenics. In: Kuhse, Helga; Singer, Peter (Hrsg.), Bioethics: an anthology, Oxford-Malden: Blackwell, S.171-181. Allan, James; Edirisinghe, Rohini; Anderson, Jasen et al. (2004), Dilemmas encountered with preimplantation diagnosis of aneuploidy in human embryos. Australian and New Zealand Journal of Obstretrics and Gynaecology, Jg.44, Nr.2, S.117-123. Allen, Marilee C. (2002), Overview: Prematurity. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Jg.8, Nr.4, S.213-214. Allen, Marilee C. (2002a), Preterm outcomes research: a critical component of neonatal intensive care. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Jg.8, Nr.4, S.221-233. Arbeitsgruppe "Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz" der Akademie für Ethik in der Medizin (2001), Keine Entscheidung ohne qualifizierte Beratung. Deutsches Ärzteblatt, Jg.98, Nr.33, S.A 2088-2089. Arendt, Hannah (1959), The human condition. New York: Doubleday. Auner, Notburga (1996), Gentechnik in der Humanmedizin: Ethische Aspekte. Imago hominis, Jg.3, Nr.1, S.37-50. Baart, Esther B.; Martini, Elena; van den Berg, Ilse et al. (2006), Preimplantation genetic screening reveals a high incidence of aneuploidy and mosaicism in embryos from young women undergoing IVF. Human Reproduction, Jg.21, Nr.1, S.223-233. Baart, Esther B.; van den Berg, Ilse; Martini, Elena et al. (2007), FISH analysis of 15 chromosomes in human day 4 and 5 preimplantation embryos: the added value of extended aneuploidy detection. Prenatal diagnosis, Jg.27, Nr.1, Januar, S.55-63. 176 Literaturverzeichnis Baumgartner, Hans M.; Honnefelder, Ludger; Wickler, Wolfgang et al. (1998), Menschenwürde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte. In: Rager, Günter (Hrsg.), Beginn, Personalität und Würde des Menschen, Freiburg-München: Alber, S.161-242. Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (2001), Principles of biomedical ethics. 5.Auflage, Oxford: Oxford University Press. Beck-Gernsheim, Elisabeth (1998), Vom Kinderwunsch zum Wunschkind. psychosozial, Jg.21, Nr.71, S.59-69. Beier, Henning M. (1998), Entwicklung und Differenzierung des Embryos: Von der Fertilisation zur Implantation. Der Gynäkologe, Jg.31, Nr.4, S.307-315. Beier, Henning M. (1999), Definition und Grenze der Totipotenz: Aspekte der Präimplantationsdiagnostik. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.23-37. Benatar, David (2006), Reproductive freedom and risk. Human Reproduction, Jg.21, Nr.10, S.2491-2493. Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz (2000), Präimplantationsdiagnostik. Thesen zu den medizinischen, rechtlichen und ethischen Problemstellungen. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.152-160. Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2006), Fortpflanzungsmedizin und Embryonenschutz: medizinische, ethische und rechtliche Gesichtspunkte zum Revisionsbedarf von Embryonenschutz- und Stammzellgesetz. Bericht der BioethikKommission des Landes Rheinland-Pfalz vom 12. Dezember 2005. Mainz: Ministerium der Justiz. Birnbacher, Dieter (1989), Genomanalyse und Gentherapie. In: Sass, Hans-Martin (Hrsg.), Medizin und Ethik, Stuttgart: Reclam, S.212-232. Literaturverzeichnis 177 Birnbacher, Dieter (2000), Selektion von Nachkommen. Ethische Aspekte. In: Mittelstraß, Jürgen (Hrsg.), Die Zukunft des Wissens. XVIII. Deutscher Kongress für Philosophie vom 4.-8. Oktober 1999 in Konstanz, Berlin: Akademie-Verlag, S.457-471. Blake, Debbie A.; Proctor, Michelle; Johnson, Neil P. (2004), The merits of blastocyst stage versus cleavage stage embryo: a Cochrane Review. Human Reproduction, Jg.19, Nr.4, S.795-807. Bodden-Heidrich, Ruth; Cremer, Thomas; Decker, Karl et al. (1998), Beginn und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und ärztlich-klinische Aspekte. In: Rager, Günter (Hrsg.), Beginn, Personalität und Würde des Menschen, FreiburgMünchen: Alber, S.15-159. Borry, Pascal; Goffin, Tom; Nys, Herman et al. (2007), Genetic Testing and Counselling. European Guidance. European Ethical-Legal papers: Leuven. Botkin, Jeffrey R. (1998), Ethical Issues and Practical problems in Preimplantation Genetic Diagnosis. The Journal of Law, Medicine and Ethics, Jg.26, Nr.1, S.17-28. Bracewell, Melanie; Marlow, Neil (2002), Patterns of motor disability in very preterm children. Mental Retardation and Develpomental Disabilities Research Reviews, Jg.8, Nr.4, S.241-248. Brambati, Bruno; Formigli Leonardo; Tului, Lucia et al. (1990), Selective reduction of quadruplet pregnancy at risk of ß-thalassaemia. The Lancet, Jg.336, November 24th, S.1325-1326. Braun, Annegret (2006), Der Wunsch nach dem perfekten Kind. Deutsches Ärzteblatt, Jg.103, Nr.40, S.C 2184-2186. Buchanan, Allen; Brock, Dan W.; Daniels, Norman; Wikler, Daniel (2000), From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge University Press. 178 Literaturverzeichnis Bundesgerichtshof (1983), Urteil vom 18. Januar 1983. In: ders. (Hrsg.), Entscheidungen des Bundsgerichtshofes in Zivilsachen, Köln-Berlin: Carl Heymanns (Bd.86), S.240-255. Bundesgerichtshof (1983), Urteil vom 23. November 1982. In: ders. (Hrsg.), Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Köln-Berlin: Carl Heymanns (Bd.85), S.327-339. Bundesgerichtshof (1983), Urteil vom 23. November 1982. In: ders. (Hrsg.), Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Köln-Berlin: Carl Heymanns (Bd.85), S.339-346. Bundesgerichtshof (1984), Urteil vom 22. November 1983. In: ders. (Hrsg.), Entscheidungen des Bundsgerichtshofes in Zivilsachen, Köln-Berlin: Carl Heymanns (Bd.89), S.95-107. Bundesgerichtshof (1994), Urteil vom 16. November 1993. In: ders. (Hrsg.), Entscheidungen des Bundsgerichtshofes in Zivilsachen, Köln-Berlin: Carl Heymanns (Bd.124), S.128-146. Bundesgerichtshof (2002), Ersatz des Unterhaltsaufwands wegen Vereitelung eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs. Neue juristische Wochenschrift, Nr.36, S.2636-2639. Bundesärztekammer (1998), Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen. Deutsches Ärzteblatt, Jg.95, Nr.50, S.A 3236-3242. Bundesärztekammer (1998a), Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik. Deutsches Ärzteblatt, Jg.95, Nr.47, S.A 3013-3016. Bundesärztekammer (1998b), Richtlinien zur Durchführung der assistierten Reproduktion. Deutsches Ärzteblatt, Jg.95, Nr.49, S.A 3166-3171. Bundesärztekammer (2000), Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 97, Nr. 9, März, S. A 525-528. Bundesärztekammer (2006), (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. Deutsches Ärzteblatt, Jg.103, Nr.20, S.A 1392-1403. Literaturverzeichnis 179 Bundesärztekammer (2006a), (Muster-)Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte. www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, www.bundesaerztekammer.de, 29.03.2007, 09.05.2009. Caglar, Gamze S.; Asimakopoulos, Byron; Nikolettos, Nikos et al. (2005), Preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy screening in repeated implantation failure. Reproductive BioMedicine online, Jg.10, Nr.3, S.381-388. Cano, Antonio; Fons, Jaime; Brines, Juan (2001), The effects on offspring of premature parturition. Human Reproduction Update, Jg.7, Nr.5, S.487-494. Carbone, Giorgio M. (2005), Eterologa- Figli senza radici, orfani per legge. E vi pare giusto?. Avvenire, 5. Juni. Carus, Carl Gustav (1941), Psyche: zur Entwicklungsgeschichte der Seele. Mit einer Einführung von Rudolf Marx (Hrsg.), Stuttgart: Kröner (Kröners Taschenausgabe, Bd.98). Chadwick, Ruth (1997), Das Recht auf Wissen und das Recht auf Nichtwissen aus philosophischer Sicht. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.195-208. Cieslak-Janzen, Jeanine; Tur-Kaspa, Ilan; Ilkevitch Yuri et al. (2006), Multiple micromanipulations for preimplantation genetic diagnosis do not affect embryo development to the blastocyst stage. Fertility and Sterility, Jg.85, Nr.6, S.1826-1829. Clark, Steven L.; Hankins, Gary D. V. (2003), Temporal and demographich trends in cerebral palsy - Fact and fiction. American Journal of Obstetrics and Gynecology, Jg.188, Nr.3, S.628-633. Clausen, Jens (2006), Die "Natur des Menschen": Geworden und gemacht. Anthropologischethische Überlegungen zum Enhancement. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.52, Nr.4, S.391-401. 180 Literaturverzeichnis Clouston, Hazel J.; Herbert Mary; Fenwick, Jeanette et al. (2002), Cytogenetic analysis of human blastocysts. Prenatal Diagnosis, Jg.22, Nr.12, S.1143-1152. Cohen, Jacques; Wells, Dagan; Munné, Santiago (2006), Removal of 2 cells from cleavage stage embryos is likely to reduce the efficacy of chromosomal tests that are used to enhance implantation rates. Fertility Sterility, Epub. December 4th. Colvin, Michael; McGuire, Wiliam; Fowlie, Peter W. (2004), Neurodevelopmental outcomes after preterm birth. British Medical Journal, Jg.329, December 11th, S.1390-1393. Coskun, Serdar; Alsmadi, Osama (2007), Whole genome amplification from a single cell: a new era for preimplantation genetic diagnosis. Prenatal Diagnosis, Jg.27, Nr.4, S.297-302. Cox, Gerald F.; Bürger, Joachim; Lip, Va et al. (2002), Intracytoplasmic sperm injection may increase the risk of imprinting defects. American Journal of Human Genetics, Jg.71, Nr.1, S.162-164. Criniti, Amy; Thyer, Angela; Chow, Gregory et al. (2005), Elective single blastocyst transfer reduces twin rates without compromising pregnancy rates. Fertility and Sterility, Jg.84, Nr.6, S.1613-1619. Cullen, Rowena; Marshall, Stephen (2006), Genetic research and genetic information: a health information professional`s perspective on the benefits and risks. Health Information and libraries journal, Jg.23, Nr.4, S.275-282. Dahl, Edgar (2004), The presumption in favour of liberty: a comment on the HFEA's public consultation on sex selection. Reproductive Biomedicine online, Jg.8, Nr.3, S.266-267. De Boer, Kylie A.; Catt, James W.; Jansen Robert P. et al. (2004), Moving to blastocyst biopsy for preimplantation genetic diagnosis and single embryo transfer at Sydney IVF. Fertility and Sterility, Jg.82, Nr.2, S.295-298. Literaturverzeichnis 181 Della Ragione, Tiziana; Verheyen, Greta; Papanikolaou, Evangelos G. et al. (2007), Developmental stage of day-5 and fragmentation rate on day-3 can influence the implantation potantial of top-quality blastocysts in IVF cycles with single embryo transfer. Reproductive Biology and Endocrinology, Epub. January 26th. Denker, Hans-Werner (1999), Embryonale Stammzellen und ihre ethische Wertigkeit: Aspekte des Totipotenzproblems. Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Jg.5, S.291-304. Deutsche Forschungsgemeinschaft (1996), Forschungsfreiheit: ein Plädoyer für bessere Rahmenbedingungen der Forschung in Deutschland. Weinheim: VCH. Deutsche Forschungsgemeinschaft (2007), Entwicklung der Gentherapie: Stellungnahme der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung. Weinheim: Wiley-VCH (Mitteilung der Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung, Bd.5). Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht (DGMR) (1992), Einbecker Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht (DGMR) zu den Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen (1986/1992). Medizinrecht, S.206 ff.. Deutsches IVF-Register (2008), D.I.R.-Jahrbuch 2007. www.meb.uni-bonn.de/frauen/DIR_downloads/dirjahrbuch2007.pdf, www.deutsches-ivf-register.de, 22.03.2008, 09.05.2009. Devolder, Katrien (2005), Preimplantation HLA typing: having children to save our loved ones. The Journal of Medical Ethics, Jg.31, Nr.10, S.582-586. De Wert, Guido (1998), Dynamik und Ethik der genetischen Präimplantationsdiagnostik - Eine Erkundung. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.327-357. De Wert, Guido (2005), Preimplantation genetic diagnosis: the ethics of intermediate cases. Human Reproduction, Jg.20, Nr.12, S.3261-3266. 182 Literaturverzeichnis Diedrich, Klaus; Ludwig Michael; Küpker, Wolfgang et al. (1998), Präimplantation und Implantation. Der Gynäkologe, Jg.31, Nr.4, S.305-306. Diedrich, Klaus; Griesinger, Georg; Behre, Hermann M. et al. (2005), Neue Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin. Deutsches Ärzteblatt, Jg.102, Nr.9, S.A 587-591. Disabled Peoples’ International Europe (2000), The right to live and be different. Deklaration vom 12./13. Februar, www.independentliving.org/docs1/dpi022000.html, www.independentliving.org/indexen.html, 10.10.2007, 09.05.2009. Donoso, Patricio; Staessen, Catherine; Fauser Bart C. et al. (2007), Current value of preimplantation genetic aneuploidy screening in IVF. Human Reproduction Update, Jg.13, Nr.1, S.15-25. Dworkin, Ronald (1999), Die falsche Angst, Gott zu spielen. ZEIT-Dokument vom 16.09., S.38. Dörner, Klaus (1997), Die sozialkritisch-kulturelle Auseinandersetzung mit Behinderung im Wandel der Zeit. In: Kleinert, Stefan; Beck, Rainer; Höglinger, Günter et al. (Hrsg.), Der medizinische Blick auf Behinderung. Ethische Fragen zwischen Linderung und Minderung, Würzburg: Königshausen & Neumann (Würzburger medizinhistorische Forschungen, Bd.4). Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.) (1998), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke. Düwell, Marcus (1998a), Ethik der genetischen Frühdiagnostik- eine Problemskizze. In: ders.; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.26-48. Düwell, Marcus (1999), Präimplantationsdiagnostik - eine Möglichkeit genetischer Frühdiagnostik aus ethischer Perspektive. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.4-15. Düwell, Marcus; Steigleder, Klaus (Hrsg.) (2003), Bioethik - Eine Einführung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Literaturverzeichnis 183 Düwell, Marcus (2003a), Utilitarismus und Bioethik: Das Beispiel von Peter Singers Praktischer Ethik. In: Düwell, Marcus; Steigleder, Klaus (Hrsg.), Bioethik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S.57-71. Eggers, Christian; Fegert, Jörg M.; Resch, Franz (Hrsg.) (2004), Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Berlin-Heidelberg: Springer. Eggers, Christian (2004a), Die somatische Entwicklung und ihre Varianten. In: ders.; Fegert, Jörg M.; Resch, Franz (Hrsg.), Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Berlin-Heidelberg: Springer, S.3-26. Eibach, Ulrich (2000), Zeugung auf Probe? - Selektion vor der Schwangerschaft? Ethische Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik aus christlicher Sicht. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.107-121. Engels, Eve-Marie (1998), Der moralische Status von Embryonen und Feten - Forschung, Diagnose, Schwangerschaftsabbruch. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.271-301. Enquête-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" (Hrsg.) (2002), Schlussbericht. Drucksache 14/9020: Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode. Europarat (1950), Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung des Protokolls Nr. 11. Rom/Rome, 4.XI.1950. http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/005.htm, www.coe.int/DEFAULTDE.ASP?, 10.07.2007, 09.05.2009. Europarat (1997), Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin vom 4. April 1997. http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/164.htm, www.coe.int, 05.04.2007, 09.05.2009. 184 Literaturverzeichnis Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaft, Direktion A, STOA-Programm (2000), Ethische Aspekte der Forschung an menschlichen Embryonen. www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/1999_indu_02_de.pdf, www.europarl.europa.eu, 10.04.2007, 10.05.2009. Europäische Union (Hrsg.) (2000), Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Bd.2000/C, Nr.364/01, 18.12.2000, S.1-22. Evsikov, Sergei; Verlinsky, Yury (1998), Mosaicism in the inner cell mass of human blastocysts. Human Reproduction, Jg.13, Nr.11, S.3151-3155. Faden, Ruth, R.; Beauchamp, Tom L. (1986), A history and theory of informed consent. 1.Auflage, Oxford: Oxford University Press. Farah, Martha J.; Illes, Judy; Cook-Deegan Robert et al. (2004), Neurocognitive enhancement: what can we do and what should we do?. Nature Reviews Neuroscience, Jg.5, S.421-425. Felberbaum, Ricardo E.; Küpker, Wolfgang; Diedrich, Klaus (2004), Methoden der assistierten Reproduktion werden sicherer. Deutsches Ärzteblatt, Jg.101, Nr.3, S.A 95-100. Ferber, Christian von (2000), Behinderung/Behinderte: Zum Problemstand. In: Korff, Wilhelm et al. (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, S.321-323. Ferraretti, Anna P.; Magli, Maria C.; Kopcow, Laura et al. (2004), Prognostic role of preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy in assisted reproductive technology outcome. Human Reproduction, Jg.19, Nr.3, S.694-699. Feyereisen, Estelle; Steffann, Julie; Romana, Serge et al. (2007), Five years’ experience of preimplantation genetic diagnosis in the Parisian Center: outcome of the first 441 started cycles. Fertility Sterility, Jg.87, Nr.1, S.60-73. Literaturverzeichnis 185 Fiddler, Morris; Pergament, Eugene (1996), Medically-assisted procreation: a maturing technology or a premature fear? Response to Testart and Sèle. Human Reproduction, Jg.11, Nr.4, S.708-709. Fiorentino, Francesco; Kahraman, Semra; Karadayi, Hüseyin et al. (2005), Short tandem repeats haplotyping of the HLA region in preimplantation HLA matching. European Journal of Human Genetics, Jg.13, Nr.8, S.953-958. Flamigni, Carlo; Massarenti, Armando; Mori, Maurizio; Petroni, Angelo (1996), Manifesto di Bioetica Laica. Il Sole24Ore, 9. Juni. Ford, Norman (2000), Tutte le cellule embrionali isolate sono embrioni?. Bioetica, Nr.1, S.105-111. Franssen, Maureen; Korevaar, Johanna C.; van der Veen, Fulco T.M. et al. (2006), Reproductive outcome after chromosome analysis in couples with two or more miscarriages: case-control study. British Medical Journal, Nr.332, S.759-763. Frühwald, Wolfgang (2001), Der "optimierte" Mensch - Über Gentechnik, Forschungsfreiheit, Menschenbild und die Zukunft der Wissenschaft. www.forschung-und-lehre.de/archiv/08-01/fruehwald.html, www.forschung-und-lehre.de, 18.04.2007, 10.05.2009. Frühwald, Wolfgang (2002), Die Bedrohung der Gattung „Mensch“. Deutsches Ärzteblatt, Jg.99, Nr.19, S.A 1281-1286. Fuchs, Michael; Lanzerath, Dirk (2000), Eugenik: Ethisch. In: Korff, Wilhelm et al. (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. Galton, Francis (1973), Inquiries into human faculty and its development. Wiederauflage von 1907, New York: AMS Press. 186 Literaturverzeichnis Geber, Selmo; Winston, Robert M.L.; Handyside, Alan H. (1995), Proliferation of blatomeres from biopsied cleavage stage human embryos in vitro: an alternative to blastocyst biopsy for preimplantation diagnosis. Human Reproduction, Jg.10, Nr.6, S.1492-1496. Gebhardt, Evelyne (1999), Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.115-118. Georgiou, Ioannis; Syrrou, Maria; Pardalidis, Nicolaos et al. (2006), Genetic and epigenetic risks of intracytoplasmic sperm injection method. Asian Journal of Andrology, Jg.8, Nr.6, S.643-673. Gianaroli, Luca; Magli, Maria C.; Munné, Santiago et al. (1997), Will preimplantation genetic diagnosis assist patients with a poor prognosis to achieve pregnancy?. Human Reproduction, Jg.12, Nr.8, S.1762-1767. Gianaroli, Luca; Magli, Maria C.; Ferraretti, Anna P. et al. (1999), Preimplantation diagnosis for aneuploidies in patients undergoing in vitro fertilization with poor prognosis: identification of the categories for which it should be proposed. Fertility Sterility, Jg.72, Nr.5, S.837-844. Gianaroli, Luca; Magli, Maria C., Ferraretti, Anna P. (2001), The in vivo and in vitro efficiency and efficacy of PGD for aneuploidy. Molecular and Cellular Endocrinology, Jg.183, Supplement 1, Oktober, S.13-18. Gigarel, Nadine; Frydman, Nelly; Burlet Philippe et al. (2004), Single cell co-amplification of polymorphic markers for the indirect preimplantation genetic diagnosis of hemophilia A, X-linked adrenoleukodystrophy, X-linked hydrocephalus and incontinentia pigmenti loci on Xq28. Human Genetics, Jg.114, Nr.3, S.298-305. Giorgetti, Claude; Hans, E.; Terriou, Philippe et al. (2007), Early cleavage: an additional predictor of high implatation rate following elective single embryo transfer. Reproductive BioMedicine Online, Jg.14, Nr.1, S.85-91. Literaturverzeichnis 187 Goossens, Veerle; Harton, Gary; Moutou, Celine et al. (2008), ESHRE PGD Consortium data collection VIII: cycles from January to December 2005 with pregnancy follow-up to October 2006. Human Reproduction, Jg.23, Nr.12, S.2629-2645. Graumann, Sigrid (1998), 'Präimplantationsgenetik'- ein wünschenswertes und moralisch legitimes Ziel des Fortschritts in der vorgeburtlichen Medizin?. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.383-414. Graumann, Sigrid (Hrsg.) (2001), Die Genkontroverse. Freiburg im Breisgau: Herder. Graumann, Sigrid (2003), Praxis, rechtliche Regulierung und ethische Diskussion der Präimplantationsdiagnostik in Italien. www.imew.de/index.php?id=240&id=240&type=1, www.imew.de, 17.08.2006, 10.05.2009. Graumann, Sigrid (2003a), Sind "Biomedizin" und "Bioethik" behindertenfeindlich? Ein Versuch, die Anliegen der Behindertenbewegung für die ethische Debatte fruchtbar zu machen. Ethik in der Medizin, Jg.15, Nr.3, S.161-170. Graumann, Sigrid (2004), Italien. In: Hennen, Leonhard; Sauter, Arnold (Hrsg.), Präimplantationsdiagnostik: Praxis und rechtliche Regulierung im Ländervergleich, Berlin: Büro für technische Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, S.92-110. Griesinger, Georg; Schultze-Mosgau, Askan; Finas, Dominique et al. (2003), Präimplantationsdiagnostik: Methode und Anwendung aus reproduktionsmedizinischer Sicht. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.49, Nr.4, S.325-342. Habermas, Jürgen (2005), Die Zukunft der menschlichen Natur - Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?. 5. erweiterte Auflage, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Haker, Hille (1997), Ethical responsibility in prenatal genetic diagnosis. Biomedical Ethics Jg.2, Nr.3, S.78-85. 188 Literaturverzeichnis Haker, Hille (1998), Genetische Beratung und moralische Entscheidungsfindung. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.238-268. Haker, Hille (1999), Präimplantationsdiagnostik als Vorbereitung von Screening-Programmen?. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.104-114. Haker, Hille (2003), Präimplantationsdiagnostik und die Veränderung der Elternschaft. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.49, Nr.4, S.361-378. Hall, Jerry L.; Engel, Don; Gindoff, Paul R. et al. (1993), Experimental cloning of human polyploid embryos using an artificial zona pellucida. Fertility and Sterility, Supplement, 60, S.1. Handyside, Alan H.; Kontogianni, Elena H.; Hardy, Kate et al. (1990), Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA amplification. Nature, Nr.344, April, S.768-770. Hansis, Christoph; Tang, YaXu; Grifo, James A. et al.(2001), Analysis of Oct-4 expression and ploidy in individual human blastomeres, Molecular Human Reproduction, Jg.7, Nr.2, S.155-161. Hansis, Christoph (2006), Totipotency, cell differentiation and reprogramming in humans. Reproductive BioMedicine Online, Jg.13, Nr.4, S.551-557. Harper, Joyce C.; Bolaert, Kristel; Geraedts, Joep et al. (2006), ESHRE PGD Consortium data collection V: Cycles from January to December 2002 with pregnancy follow-up to October 2003. Human Reproduction, Jg.21, Nr.1, S.3-21. Harper, Joyce C.; Sermon, Karen; Geraedts, Joep et al. (2008), What next for preimplantation genetic screening?. Human Reproduction, Jg.23, Nr.3, S.478-480. Literaturverzeichnis 189 Harper, Joyce C.; de Die-Smulders, Christine; Goossens, Veerle et al. (2008a), ESHRE PGD Consortium data collection VII: Cycles from January to December 2004 with pregnancy follow-up to October 2005. Human Reproduction, Jg.23, Nr.4, S.741-755. Hartog, Jennifer; Wolff, Gerhard (1997), Das genetische Beratungsgespräch. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.153-174. Hellani, Ali; Coskun, Serdar; Tbakhi, Abdelghani et al. (2005), Clinical application of multiple displacement amplification in preimplantation genetic diagnosis. Reproductive BioMedicine Online, Jg.10, Nr.3, S.376-380. Heng, Boon Chin (2006), Advanced maternal age as an indication for premplantation genetic diagnosis (PGD) - the need for more judicious application in clinically assisted reproduction. Prenatal Diagnosis, Jg.26, Nr.11, S.1051-1053. Henn, Wolfram; Schroeder-Kurth, Traute (1999), Die Macht des Machbaren - Gerät die deutsche Zurückhaltung gegenüber dem genetischen Bevölkerungsscreening unter Druck?. Deutsches Ärzteblatt, Jg.96, Nr.23, S.A 1555-1556. Hennen, Leonhard; Sauter, Arnold (2004), Präimplantationsdiagnostik: Praxis und rechtliche Regulierung im Ländervergleich. Berlin: Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB-Arbeitsbericht, Bd.94). Hepp, Hermann (2003), Pränatalmedizin und Embryonenschutz - ein Widerspruch der Werte. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.49, Nr.4, S.343-359. Hertz, Friedrich (1916), Rasse und Kultur. Eine Erwiderung und Klarstellung. In: Plötz, Alfred, Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Leipzig-Berlin: Teubner, S.168-472. Hertz, Friedrich (1925), Rasse und Kultur. Eine kritische Untersuchung der Rassentheorien. 3. neu bearbeitete Auflage, Leipzig: Kröner. 190 Literaturverzeichnis Heun, Werner (2002), Embryonenforschung und Verfassung - Lebensrecht und Menschenwürde des Embryos. Juristenzeitung, Jg.57, Nr.11, S.517-524. Hildt, Elisabeth (1998), Über die Möglichkeit freier Entscheidungsfindung im Umfeld vorgeburtlicher Diagnostik. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.202-224. Hoerster, Norbert (1989), Ein Lebensrecht für die menschliche Leibesfrucht?. Juristische Schulung, Jg.29, Nr.9, S.172 ff.. Holm, Søren (1998), Ethical issues in pre-implantation diagnosis. In: Harris, John; ders. (Hrsg.), The future of human reproduction: ethics, choice, and regulation, Oxford: Clarendon Press, S.176-190. Holznagel, Bernd (2003), Perspektiven der Stammzellforschung und der Präimplantationsdiagnostik: Rechtliche Grenzen und Normen. In: Siep, Ludwig; Quante, Michael (Hrsg.), Der Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben, Münster-HamburgLondon: LIT, S.76-86. Honnefelder, Ludger (1999), Zur ethischen Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik. Ethik in der Medizin, Jg. 11, Supplement 1, März, S.119-120. Honneth, Axel (1998), Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. 2.Auflage, Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft Bd.1129). Hoppe, Jörg-Dietrich (2006), Die Beratung muss an erster Stelle stehen - Interview mit Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe. Deutsches Ärzteblatt, Jg.103, Nr.40, S.C 2187-2188. Hucklenbroich, Peter (2003), Individuation, Kontinuität und Potenzial- zum Paradigmastreit in der Theorie der Reproduktion. In: Siep, Ludwig; Quante, Michael (Hrsg.), Der Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben, Münster-Hamburg-London: LIT, S.37-57. Literaturverzeichnis 191 Höver, Gerhard; Baranzke, Heike (2002), Bedrohen Genomforschung und Zellbiologie die Menschenwürde? Wege der ethischen Urteilsbildung. In: Kreß, Hartmut; Racké, Kurt (Hrsg.), Medizin an den Grenzen des Lebens, Münster-Hamburg-London: LIT, S.141-171. Hübenthal, Christoph (2003), Die ethische Theorie von Alan Gewirth und ihre Bedeutung für die Bioethik. In: Düwell, Marcus; Steigleder, Klaus (Hrsg.), Bioethik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S.120-134. Jachertz, Norbert (2005), Forschung an Einwilligungsunfähigen: Sorgfältiges Abwägen von Nutzen und Schaden - Interview mit Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer über Patienten- und Probandenschutz und die Deklaration von Helsinki. Deutsches Ärzteblatt, Jg.102, Nr.9, S.A 548-550. Jonas, Hans (1979), Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. 1.Auflage, Frankfurt a. M.: Insel Verlag. Junker-Kenny, Maureen (1998), Der moralische Status des Embryos im Kontext der Reproduktionsmedizin. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.302-324. Kamp, Manuel (2004), Forschungsfreiheit und Kommerz - Der grundrechtliche Schutz mit wirtschaftlicher Zielsetzung betriebener Forschung und ihrer Verwertung, beispielhaft anhand der Arzneimittelzulassung. Berlin: Duncker & Humblot. Kaplan, Deborah (1999), Prenatal Screening and its Impact on Persons with Disabilities. In: Kuhse, Helga; Singer, Peter (Hrsg.), Bioethics: an anthology, Oxford-Malden: Blackwell, S.130-136. Katalinic, Alexander; Rösch, Christine; Ludwig, Michael (2004), Pregnancy course and outcome after intracytoplasmic sperm injection: a controlled, prospective cohort study. Fertlity and Sterility, Jg.81, Nr.6, S.1604-1616. 192 Literaturverzeichnis Kautz, Hanno (2005), Medizinische Indikation auf dem Prüfstand - Behinderung sollte kein Abtreibungsgrund sein. Ärzte Zeitung vom 17.02.2005. Keller, Rolf; Günther, Hans-Ludwig; Kaiser, Peter (1992), Embryonenschutzgesetz. Kommentar zum Embryonenschutzgesetz. Stuttgart-Berlin-Köln: Kohlhammer. Kevles, Daniel (1985), In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. New York: Knopf. Kieselstein, Rita; Sass, Hans-Martin (1992), Right not to know or duty to know? Prenatal screening for polycystic renal disease. Journal of Medicine and Philosophy, Jg.17, Nr.4, S.395-405. Kitcher, Philip (1996), The Lives to Come: The Genetic Revolution and Human Possibilities. New York: Simon and Schuster. Knoepffler, Nikolaus; Haniel, Anja (Hrsg.) (2000), Menschenwürde und medizinethische Konfliktfälle. Stuttgart-Leipzig: S. Hirzel. Kokkali, Georgia; Vrettou, Christina; Traeger-Synodinos Joanne et al. (2005), Birth of a healthy infant following trophectoderm biopsy from blastocysts for PGD of ß-thalassaemia major: Case report. Human Reproduction, Jg.20, Nr.7, S.1855-1859. Kokkali, Georgia; Traeger-Synodinos Joanne; Vrettou, Christina et al. (2007), Blastocyst biopsy versus cleavage stage biopsy and blastocyst transfer for preimplantation genetic diagnosis of ß-thalassaemia: a pilot study. Human Reproduction, Epub. January 29th. Kollek, Regine (1999), Vom Schwangerschaftsabbruch zur Embryonenselektion? Expansionstendenz reproduktionsmedizinischer und gentechnischer Leistungsangebote. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.121-124. Kollek, Regine (2002), Präimplantationsdiagnostik: Embryonenselektion, weibliche Autonomie und Recht. 2.Auflage, Tübingen-Basel: Francke (Ethik in den Wissenschaften, Bd.11). Literaturverzeichnis 193 Kommission für Grundpositionen und ethische Fragen der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V. (2007), Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V.. www.medgenetik.de/sonderdruck/2007_gfh_positionspapier.pdf, www.gfhev.de, www.medgenetik.de, 15.11.2007, 10.05.2009. Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik e.V. (2001), Positionspapier der Gesellschaft für Humangenetik e.V.. Medizinische Genetik, Sonderdruck 7.Auflage, Oktober, S.47-54. Korff, Wilhelm; Beck, Lutwin; Mikat, Paul im Auftrag der Görres-Gesellschaft (Hrsg.) (2000), Lexikon der Bioethik. 2.Auflage, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus (Bd.1-3). Krebs, Dieter (2000), In-vitro-Fertilisation: zum Problemstand. In: Korff, Wilhelm; Beck, Lutwin; Mikat, Paul (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, S.291-294. Kreß, Hartmut (2001), Menschenrecht auf Gesundheit - Die Verwendung verwaister Embryonen ist ethisch denkbar. Deutsches Ärzteblatt, Jg.98, Nr.49, S.A 3272-3274. Kreß, Hartmut; Racké, Kurt (Hrsg.) (2002), Medizin an den Grenzen des Lebens. Lebensbeginn und Lebensende in der bioethischen Kontroverse. Münster-Hamburg-London: LIT (Münsteraner Bioethik-Studien, Bd.2). Kreß, Hartmut (2002a), Biomedizin am Lebensbeginn. Gefährdung der Menschenwürde oder Bewährungsprobe ethischer Rationalität?. In: ders.; Racké, Kurt (Hrsg.), Medizin an den Grenzen des Lebens, Münster-Hamburg-London: LIT, S.172-199. Kröner, Hans-Peter (1997), Von der Eugenik zum genetischen Screening: Zur Geschichte der Humangenetik in Deutschland. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.23-47. Kröner, Hans-Peter (2000), Eugenik: Zum Problemstand. In: Korff, Wilhelm et al. (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 194 Literaturverzeichnis Kuhse, Helga; Singer, Peter (1993), Muß dieses Kind am Leben bleiben? Das Problem schwerstgeschädigter Neugeborener. 1. überarbeitete und erweiterte, deutsche Auflage, Erlangen: Harald Fischer. Kuhse, Helga; Singer, Peter (Hrsg.) (1999), Bioethics: an anthology. 1.Auflage, Oxford-Malden: Blackwell (Blackwell philosophy anthologies, Bd.9). Kuliev, Anver; Rechitsky, Svetlana; Verlinksy, Oleg et al. (2005), Preimplantation diagnosis and HLA typing for haemoglobin disorders. Reproductive BioMedicine Online, Jg.11, Nr.3, S.362-370. Kuliev, Anver; Rechitsky, Svetlana; Laziuk, Katya et al. (2006), Pre-embryonic diagnosis for Sandhoff disease. Reproductive BioMedicine Online, Jg.12, Nr.3, S.328-333. Kutzer, Klaus (2002), Embryonenschutzgesetz - Wertungswidersprüche zu den Regelungen bei Schwangerschaftsabbruch, Früheuthanasie, Sterbehilfe und Transplantation? Eröffnung der 25. Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung am 28. September 2001 in Ulm. Medizinrecht, Jg.20, Nr.1, S.24-26. Käßmann, Margot (2003), Gentechnik - Chancen und Risiken aus theologischer Perspektive. Vortrag bei der Gesellschaft der Freunde der Medizinischen Hochschule Hannover am 29.10.2003. www.evlka.de/content.php3?contentTypeID=2-15k, www.evlka.de, 07.11.2006. Lanzerath, Dirk; Honnefelder, Ludger (1998), Krankheitsbegriff und ärztliche Anwendung der Humangenetik. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.51-77. Lanzerath, Dirk (2000), Behinderung/ Behinderte: Ethisch. In: Korff, Wilhelm et al. (Hrsg.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, S.327-330. Le Caignec, Cedric; Spits, Claudia; Sermon, Karen et al. (2006), Single-cell chromosomal imbalances detection by array CGH. Nucleic Acids Research, Epub. May 12th. Literaturverzeichnis 195 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (2004), Legge 19 febbraio 2004, n.40: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Nr.45, 24-2-2004, S.5-13. Lemke, Thomas (2001), Zurück in die Zukunft? - Genetische Diagnostik und das Risiko der Eugenik. In: Graumann, Sigrid (Hrsg.), Die Genkontroverse, Freiburg im Breisgau: Herder, S.37-44. Levron, Jacob; Aviram-Goldring, Ayala; Madgar, Igal et al. (2001), Sperm chromosome abnormalities in men with severe male factor infertility who are undergoing in vitro fertilization with intracytoplasmic sperm injection. Fertility and Sterility, Jg.76, Nr.3, S.479-484. Levy, Neil (2007), Against sex selection. Southern medical Journal, Jg.100, Nr.1, S.107-109. Liening, Paulus (1998), Autonomie und neue gendiagnostische Möglichkeiten - Die neuen gendiagnostischen Möglichkeiten im Spannungsfeld von individueller Entscheidung und gesellschaftlichen Zusammenhängen. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.173-201. Los, Frans J.; Van Opstal, Diane; van den Berg, Cardi (2004), The development of cytogenetically normal, abnormal and mosaic embryos: a theoretical model. Human Reproduction Update, Jg.10, Nr.1, S.79-94. Ludwig, Michael; Diedrich, Klaus (1999), Die Sicht der Präimplantationsdiagnostik aus der Perspektive der Reproduktionsmedizin. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.38-44. Ludwig, Annika K.; Sutcliffe, Alastair; Diedrich, Klaus et al. (2006), Post-neonatal health and development of children born after assisted reproduction: A systematic review of controlled studies. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Repoductive Biology, Jg.127, Nr.1, S.3-25. 196 Literaturverzeichnis Lunshof, Jeantine E. (1998), Genetische Beratung: Zwischen Nichtdirektivität und moralischem Diskurs. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.227-237. Lübbe, Weyma (2003), Das Problem der Behindertenselektion bei der pränatalen Diagnostik und der Präimplantationsdiagnostik. Ethik in der Medizin, Jg.15, Nr.3, S.203-220. Magli, Maria C.; Gianaroli, Luca; Fortini, Daniela et al. (1999), Impact of blastomere biopsy and cryopreservation techniques on human embryo viability. Human Reproduction, Jg.14, Nr.3, S.770-773. Magli, Maria C.; Gianaroli, Luca; Ferraretti, Anna P. et al. (2004), The combination of polar body and embryo biopsy does not affect embryo viability. Human Reproduction, Jg.19, Nr.5, S.1163-1169. Maguire, Reiley (1988), Personhood, Covenant, and Abortion. In: Jung, Patricia; Shannon,Tom (Hrsg.), Abortion and Catholicism: the American Debate. New York: Crossroad Publishing Company , S.100-120. Maier, Barbara (1998), Ethische Probleme der Pränataltherapie. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.149-170. Maio, Giovanni (2001), Die Präimplantationsdiagnostik als Streitpunkt - welche ethischen Argumente sind tauglich und welche nicht?. Deutsche Medizinische Wochenschrift, Jg.126, Nr.31/32, S.889-895. Maio, Giovanni (2002), Welchen Respekt schulden wir dem Embryo? Die embryonale Stammzellforschung in medizinethischer Perspektive. Deutsche Medizinische Wochenschrift, Jg.127, Nr.4, S.160-163. Maio, Giovanni (2003), Wie legitim ist die PID?. Frauenarzt, Jg.44, Nr.7, S.720-724. Literaturverzeichnis 197 Maio, Giovanni (2009), Auf ein Wort. Warum der Embryo Würdeschutz und nicht nur Respekt braucht. Das Beispiel der Reproduktionsmedizin. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.55, Nr.1, S.90-95. Markl, Hubert (2001), Freiheit, Verantwortung, Menschenwürde: Warum Lebenswissenschaften mehr sind als Biologie. Ansprache des Präsidenten Hubert Markl auf der Festversammlung der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin am 22. Juni 2001. www.mpg.de/pdf/jahrbuch_2001/jahrbuch2001_009_024.pdf, www.mpg.de, 10.10.2007, 08.05.2009. Markl, Hubert (2002), Wir verjagen unsere Forscher. DIE ZEIT, Nr.23, S.32. Marlow, Neil (2004), Neurocognitive outcome after very preterm birth. Archives of Disease in Childhood/Fetal and Neonatal Edition, Jg.89, Nr.3, S.F224-F228. Marlow, Neil; Wolke, Dieter; Bracewell, Melanie A. et al. (2005), Neurologic and Developmental Disability at Six Years of Age after Extremely Preterm Birth. New England Journal of Medicine, Jg.352, Nr.1, S.9-19. McArthur, Steven; Leigh Don; Marshall, James T. et al. (2005), Pregnancies and live births after trophectoderm biopsy and preimplantation genetic testing of human blastocysts. Fertility and Sterility, Jg.84, Nr.6, S.1628-1636. McGee, Glenn (1997), Parenting in an Era of Genetics. Hastings Center Report, Jg.27, Nr.2, S.16-22. McMahon, Catherine A; Ungerer, Judy A.; Beaurepaire, Jeanet et al. (1995), Psychosocial outcomes for parents and children after in vitro fertilization. A review. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Jg.13, Nr.1, S.1-16. 5. Medizinisch-ethische Klausur- und Arbeitstagung "Pränatale Medizin im Spannungsfeld von Ethik und Recht" im Schloss Schwarzenfeld (1998), Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik. Entwurf Stand 19.01.1998. Der Gynäkologe, Jg.31, Nr.7, S.639-642. 198 Literaturverzeichnis Mieth, Dietmar (1997), Ethische Probleme der Erforschung des menschlichen Genoms. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.177-194. Mieth, Dietmar (1999), Präimplantationsdiagnostik im gesellschaftlichen Kontext - eine sozialethische Perspektive. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.77-86. Mieth, Dietmar; Graumann, Sigrid; Haker, Hille (1999a), Präimplantationsdiagnostik- Eckpunkte einer zukünftigen Diskussion. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.136-141. Miny, Peter; de Geyter, Christian; Holzgreve, Wolfgang (2006), Neue Möglichkeiten der pränatalen genetischen Diagnostik inklusive Präimplantationsdiagnostik. Therapeutische Umschau, Jg.63, Nr.11, S.703-709. Mottla, Gilbert L.; Adelman, Mark R.; Hall, Jerry L. et al. (1995), Fertilization and early embryology: Lineage tracing demonstrates that blastomeres of early cleavage-stage human pre-embryos contribute to both trophectoderm and inner cell mass. Human Reproduction, Jg.10, Nr.2, S.384-391. Moutou, Céline et al.; Gardes, Nathalie; Nicod, Jean-Christophe (2007), Strategies and outcome of PGD of familial adenomatous polyposis. Molecular Human Reproduction, Jg.13, Nr.2, S.95-101. Msall, Michael E.; Tremont, Michelle R. (2002), Measuring functional outcomes after prematurity: developmental impact of very low birth weight and extremely low birth weight status on childhood disability. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, Jg.8, Nr.4, S.258-272. Munné, Santiago; Lee, Andrew; Rosenwaks, Zev et al. (1993), Diagnosis for major chromosome abnormalities in human preimplantation embryos. Human Reproduction, Jg.8, Nr.12, S.2185-2191. Literaturverzeichnis 199 Munné, Santiago; Magli, Maria C.; Cohen, Jacques et al. (1999), Positive outcome after preimplantation diagnosis of aneuploidy in human embryos. Human Reproduction, Jg.14, Nr.9, S.2192-2199. Munné, Santiago; Sandalinas, Mireia; Escudero, Tomas et al. (2003), Improved implantation after preimplantation genetic diagnosis of aneuploidy. Reproductive BioMedicine Online, Jg.7, Nr.1, S.91-97. Munné, Santiago (2005), Analysis of chromosome segregation during preimplatation genetic diagnosis in both male and female translocation heterozygotes. Cytogenetic & Genome Research, Jg.111, Nr.3/4, S.305-309. Munné, Santiago; Fischer, Jill; Warner, Alison et al. (2006), Preimplantation genetic diagnosis significantly reduces pregnancy loss in infertile couples: a multicenter study. Fertility Sterility, Jg.85, Nr.2, S.326-332. Nationaler Ethikrat (Hrsg.) (2003), Genetische Diagnostik vor und während der Schwangerschaft. Stellungnahme . Berlin: Nationaler Ethikrat. Nationaler Ethikrat (2004), Polkörperdiagnostik. www.ethikrat.org/stellungnahmen/pdf/Stellungnahme_PKD.pdf, www.ethikrat.org, 07.03.2007, 10.05.2009. Nawroth, Frank; Ludwig, Michael; Mallmann, Peter et al. (2000), Naturwissenschaftliche und (arzt-) rechtliche Grundlagen der Präimplantationsdiagnostik. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.63-79. Neidert, Rudolf; Statz, Albert (1999), Zehn Thesen zur Präimplantationsdiagnostik. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.132-135. Neidert, Rudolf (2002), Sollen genetische Analysen am frühen Embryo zugelassen werden? Präimplantationsdiagnostik in juristischer Sicht. In: Kreß, Hartmut; Racké, Kurt (Hrsg.), Medizin an den Grenzen des Lebens, Münster-Hamburg-London: LIT, S.33-61. 200 Literaturverzeichnis Netzer, Christian (1998), Führt uns die Präimplantationsdiagnostik auf eine Schiefe Ebene?. Ethik in der Medizin, Jg.10, Nr.3, S.138-151. Neuber, Evelyn; Mahutte, Neal G.; Arici, Aydin et al. (2006), Sequential embryo assessment outperforms investigator-driven morphological assessment at selecting a good quality blastoycst. Fertility and Sterility, Jg.85, Nr.3, S.794-796. Neuer-Miebach, Therese (1999), Welche Art von Prävention erkaufen wir uns mit der Zulässigkeit von Präimplantationsdiagnostik?. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.125-131. Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.) (2005), Angewandte Ethik: die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung; ein Handbuch. 2. aktualisierte Auflage, Stuttgart: Kröner. Nikolettos, Nikos; Asimakopoulos, Byron; Papastefanou, Ioannis S. (2006), Intracytoplasmic sperm injection - an assisted reproduction technique that should make us cautious about imprinting deregulation. Journal of the Society for Gynecologic Investigation, Jg.13, Nr.5, S.317-328. Nippert, Irmgard (1997), Psychosoziale Folgen der Pränataldiagnostik am Beispiel der Amniozentese und Chorionzottenbiopsie. In: Petermann, Frank; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.107-126. Offit, Kenneth; Kohut, Kelly; Clagett, Bartholt et al. (2006), Cancer Genetic Testing and Assisted Reproduction. Journal of Clinical Oncology, Jg.24, Nr.29, S.4775-4782. Oliver, Bonamy R.; Plomin, Robert (2007), Twins' Early Development Study (TEDS): a multivariate, longitudinal genetic investigation of language, cognition and behavior problems from childhood through adolescence. Twin Research and Human Genetics, Jg.10, Nr.1, S.96-105. O’Neill, Onora (1988), Children’s Rights and Children’s Lives. Ethics, Jg.98, Nr.3, S.445-463. Literaturverzeichnis 201 O’Neill, Onora (1996), Tugend und Gerechtigkeit. Eine konstruktive Darstellung des praktischen Denkens. Berlin: Akademie-Verlag. Otani, Tetsuo; Roche, Muriel; Mizuike, Miho et al. (2006), Preimplantation genetic diagnosis significantly improves the pregnancy outcome of translocation carriers with a history of recurrent miscarriage and unsuccessful pregnancies. Reproductive BioMedicine Online, Jg.13, Nr.6, S.869-874. Papanikolaou, Evangelos G.; Camus Michel; Kolibianakis, Efstratios M. et al. (2006), In Vitro Fertilization with Single Blastocyst-Stage versus Single Cleavage-Stage Embryos. The New England Journal of Medicine, Jg.354, Nr.11, S.1139-1146. Parens, Erik (2005), Creativity, gratitude, and the enhacement debate. In: Illes, Judy (Hrsg.), Neuroethics in the 21st century. Defining the issues in theory, practice, and policy, Oxford: Oxford University Press, S.75-86. Pearl, Raymond (1928), Eugenics. In: Baur, Erwin et al.(Hrsg.), Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, Berlin: Institut für Vererbungsforschung, S.15. Pearl, Raymond (1928), Eugenics. In: Nachtsheim, Hans (Hrsg.), Verhandlungen des V. internationalen Kongresses für Vererbungswissenschaften, Leipzig: Gebrüder Bornträger, S.261. Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.) (1997), Perspektiven der Humangenetik: medizinische, psychologische und ethische Aspekte. Paderborn: Schöningh. Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (1997), Fortschritt der Humangenetikeine interdisziplinäre Herausforderung. In: dies. (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.9-20. Plomin, Robert; DeFries, John C. (1998), The genetics of cognitive abilities and disabilities. Scientific American, Jg.278, Nr.5, S.62-69. 202 Literaturverzeichnis Poikkeus, Piia; Gissler, Mika; Unkila-Kallio, Leila et al. (2007), Obstetric and neonatal outcome after single embryo transfer. Human Reproduction, Jg.22, Nr.4, S.1073-1079. Propping, Peter (1998), Genetische Pränataldiagnostik - Brauchen wir eine Qualitätskontrolle?. Deutsches Ärzteblatt, Jg.95, Nr.21, S.A-1302-1303. Propping, Peter (2007), Neufassung des Positionspapiers der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V.. Medizinische Genetik, Jg.19, Nr.3, S.378-379. Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht e.V. (2005), Einbecker Empfehlungen zu Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik. 11. Einbecker Workshop November 2004. Medizinrecht, Jg.23, Nr.2, S.117-118. Prüll, Cay-Rüdiger (2008), Wandel der vorherrschenden Krankheitslehren - Aus der Geschichte der pathologisch-anatomischen Sektion. In: Stefenelli, Norbert (Hrsg.), Körper ohne Leben: Begegnung und Umgang mit Toten, Wien-Köln-Weimar: Böhlau, S.569-579. Quante, Michael (1997), Ethische Probleme mit dem Konzept der informierten Zustimmung im Kontext humangenetischer Beratung und Diagnostik. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; ders. (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.209-227. Quante, Michael (2003), Wessen Würde? Welche Diagnose? Bemerkungen zur Verträglichkeit von Präimplantationsdiagnostik und Menschenwürde. In: Siep, Ludwig; ders. (Hrsg.), Vom Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben, Münster-Hamburg-London: LIT, S.133-152. Racké, Kurt (2002), Forschung an importierten humanen embryonalen Stammzellen. Entscheidungsfindung einer Ethikkommission. In: Kreß, Hartmut; ders. (Hrsg.), Medizin an den Grenzen des Lebens. Lebensbeginn und Lebensende in der bioethischen Kontroverse, Münster-Hamburg-London: LIT, S.87-93. Rager, Günter (Hrsg.) (1998), Beginn, Personalität und Würde des Menschen. 2.Auflage, Freiburg-München: Alber (Grenzfragen, Bd.23). Literaturverzeichnis 203 Rager, Günter (2000), PID und Status des Embryos. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.81-89. Rau, Johannes (2001), Wird alles gut? Für einen Fortschritt nach menschlichem Maß. In: Graumann, Sigrid (Hrsg.), Die Genkontroverse, Freiburg im Breisgau: Herder, S.14-29. Rawlinson, Mary C. (1982), Medicine’s Discourse and the Practice of Medicine. In: Kestenbaum, Victor (Hrsg.), The Humanity of the ill: phenomenological perspectives, Knoxville: University of Tennessee Press, S.69-85. Ray, Pierre F.; Gigarel, Nadine; Bonnefont, Jean P. et al. (2000), First specific preimplantation genetic diagnosis for ornithine transcarbamylase deficiency. Prenatal Diagnosis, Jg.20, Nr.13, S.1048-1054. Recchia, Giuseppe (2000), 2010: medicina predittiva e terapia personalizzata: quali problemi etici dovremo affrontare?. Bioetica, Nr.1/2000, S.113-122. Rechitsky, Svetlana; Strom, Charles; Verlinksy, Oleg et al. (1998), Allele Dropout in Polar Bodies and Blastomeres. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Jg.15, Nr.5, S.253-257. Rechitsky, Svetlana; Strom, Charles; Verlinksy, Oleg et al. (1999), Accuracy of Preimplantation Diagnosis of Single-Gene Disorders by Polar Body Analysis of Oocytes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Jg.16, Nr.4, S.192-198. Rechitsky, Svetlana; Kuliev, Anver; Sharapova, Tatyana et al. (2006), Preimplantation HLA typing with aneuploidy testing. Reproductive BioMedicine Online, Jg.12, Nr.1, S.89-100. Rehmann-Sutter, Christoph (1998), DNA- Horoskope. In: Düwell, Marcus, Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.415-443. Reindal, Solveig Magnus (2000), Disability, gene therapy and eugenics - a challenge to John Harris. Journal of Medical Ethics, Jg.26, Nr.2, S.89-94. 204 Literaturverzeichnis Reiss, Michael J.; Straughan, Roger (2001), Improving Nature?: The science and ethics of genetic engineering. Canto ed. Auflage, Cambridge: Cambridge University Press. Renwick, Pamela J.; Trussler, Jane; Ostad-Saffari, Elham et al. (2006), Proof of principle and first cases using preimplantation genetic haplotyping - a pradigm shift for embryo diagnosis. Reproductive BioMedicineOnline, Jg.13, Nr.1, S.110-119. Richter, Eva (1998), Keine Abtreibung unter Zeitdruck. Deutsches Ärzteblatt, Jg.95, Nr.22, S.A 1363. Richter, Gerd; Krones, Tanja; Koch, Manuela C. et al. (2004), Präimplantationsdiagnostik: Möglichkeit zur Erfüllung des Kinderwunsches - Die Einstellung von Betroffenen - eine empirische Studie zur gegenwärtigen Debatte. Deutsches Ärzteblatt, Jg.101, Nr.6, S.A 327-328. Robertson, John (1994), Children of Choice: Freedom and the New Reproductive Technologies. Princeton: University of Princeton Press Rosenbusch, Bernd (2006), The contradictory information on the distribution of non-disjunction and pre-division in female gametes. Human Reproduction, Jg.21, Nr.11, S.2739-2742. Ruppel, Katja; Mieth, Dietmar (1998), Ethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.358-379. Rösler, Roland (2000), Gedanken zur " Präimplantationsdiagnostik ". www.cdl-online.de/archiv/bio/prid.htm, www.cdl-online.de/index1.htm, 05.09.2006, 10.05.2009. Sandalinas, Mireia; Sadowy, Sasha; Alikani, Mina et al. (2001), Developmental ability of chromosomally abnormal human embryos to develop to the blastocyst stage. Human Reproduction, Jg.16, Nr.9, S.1954-1958. Schlick, Moritz (1984), Fragen der Ethik. 1.Auflage, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Literaturverzeichnis 205 Schmidt, Harald Thomas (2003), Präimplantationsdiagnostik: Jenseits des Rubikons? Individual- und sozialethische Aspekte der PID/PGD. Münster-Hamburg-London: LIT (Münsteraner Bioethik- Studien, Bd.4). Schmidtke, Jörg (1995), Die Indikationen zur Pränataldiagnostik müssen neu begründet werden. Medizinische Genetik, Jg.7., S.49-52. Schmuhl, Hans-Werner (2005), Grenzüberschreitungen: das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 1927-1945. Göttingen: Wallstein (Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bd.9). Schockenhoff, Eberhard (1993), Ethik des Lebens. Mainz: Matthias-Grünewald. Schockenhoff, Eberhard (2000), Ein gesundes Kind um jeden Preis? Ethische Erwägungen zur PID. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.91-105. Schockenhoff, Eberhard (2003), Fortpflanzungsfreiheit und verantwortliche Elternschaft - Zur ethischen Problematik der Präimplantationsdiagnostik. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.49, Nr.4, S.379-396. Schott, Heinz (2002), "Ethik des Heilens" versus "Ethik der Menschenwürde" - eine kritische Betrachtung jenseits von Pro und Kontra. Deutsches Ärzteblatt, Jg.99, Nr.4, S.A 172-175. Schramme, Thomas (2005), "Vorgeburtliche Diagnostik - Eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung?" Satellitentagung der Akademie für Ethik in der Medizin e.V., 28.29. September 2005, Witten/Herdecke. Ethik in der Medizin, Jg.17, Nr.4, S.337-340. Schreiber, Hans-Ludwig (2003), Die Würde des Menschen - eine rechtliche Fiktion?. Medizinrecht, Jg.21, Nr.7, S.367-372. Schroeder-Kurth (1997), Auf eine Wort: Präimplantationsdiagnostik. Medizinische Genetik, Jg.9, S.154-159. 206 Literaturverzeichnis Schroeder-Kurth, Traute (1999), Stand der Präimplantationsdiagnostik aus Sicht der Humangenetik. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.45-54. Schroeder-Kurth, Traute (2000), Präimplantationsdiagnostik in Deutschland - ganz oder gar nicht! Ein Plädoyer gegen halbherzige Scheinlösungen. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.46, Nr.2, S.123-136. Schulman, Joseph D.; Karabinus, David S. (2005), Scientific aspects of preconception gender selection. Reproductive BioMedicine Online, Jg.10, Supplement 1, S.111-115. Schuth, Walter; Neulen, Josef; Breckwoldt, Meinert (1989), Ein Kind um jeden Preis? Psychologische Untersuchungen an Teilnehmern eines In-vitro-Fertilisations-Programms. Ethik in der Medizin, Jg.1, Nr.1, S.206-221. Schäfer, Gereon; Groß, Dominik (2008), Eingriff in die personale Identität - Die Argumente für psychopharmakologisches Enhancement greifen zu kurz. Deutsches Ärzteblatt, Jg.105, Nr.5, S.A 210-212. Schöne-Seifert, Bettina (1999), Präimplantationsdiagnostik und Entscheidungsautonomie. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.87-98. Schöne-Seifert, Bettina (2005), Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hrsg.), Angewandte Ethik, Stuttgart: Kröner, S.690-804. Schüler, Herdit M.; Zerres, Klaus (1998), Pränatale Diagnostik. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.15-25. Scully, Jackie L.; Banks, Sarah; Shakespeare, Tom W. (2006), Chance, choice and control: Lay debate on prenatal social sex selection. Social Science & Medicine, Jg.63, Nr.1, S.21-31. Sèle, Bernard; Testart, Jacques (1999), Eugenics comes back with medically assisted procreation. In: Hildt, Elisabeth; Graumann, Sigrid (Hrsg.), Genetics in Human Procreation, Aldershot-Brookfield USA: Ashgate, S.169-174. Literaturverzeichnis 207 Sermon, Karen; Van Steirteghem, André; Libaers, Inge (2004), Preimplantation genetic diagnosis. The Lancet, Jg.363, Nr.9421, S.1633-1641. Sermon, Karen D.; Michiels, An; Harton, Gary et al. (2006), ESHRE PGD Consortium data collection VI: cycles from January to December 2003 with pregnancy follow-up to October 2004, Human Reproduction. Advance Access published online, November 28th. Sewing, Karl-Friedrich (2002), Bioethik- ein Problem der Gattungsethik?. In: Kreß, Hartmut; Racké, Kurt (Hrsg.), Medizin an den Grenzen des Lebens, Münster-Hamburg-London: LIT, S.135-140. Siep, Ludwig (1993), Ethische Probleme der Gentechnologie. In Ach, Johann S.; Gaidt, Andreas, Herausforderungen der Bioethik, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, S.137-156. Siep, Ludwig; Quante Michael (Hrsg.) (2003), Der Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben: ethische, medizintheoretische und rechtliche Probleme aus niederländischer und deutscher Perspektive. Münster-Hamburg-London: LIT (Münsteraner Bioethik-Studien, Bd.1). Sills, E. Scott; Kirman, Irena; Thatcher, Samuel S. 3rd et al. (1998), Sex-selection of human spermatozoa: evolution of current techniques and applications. Archives of Gynecology and Obstetrics, Jg.261, Nr.3, S.109-115. Simon, Alex; Schenker, Joseph G. (2005), Ethical consideration of intentioned preimplantation genetic diagnosis to enable future tissue transplantation. Reproductive BioMedicine Online, Jg.10, Nr.3, S.320-324. Singer, Peter (1989), Praktische Ethik. Stuttgart: Reclam. Sjöblom, Peter; Menezes, Judith; Cummins, Lisa et al. (2006), Prediction of embryo developmental potential and pregnancy based on early stage morphological characteristics. Fertility and Sterility, Jg.86, Nr.4, S.848-861. 208 Literaturverzeichnis Sorgner, Stefan Lorenz; Birx, H. James; Knoepffler, Nikolaus (Hrsg.) (2006), Eugenik und die Zukunft. Freiburg im Breisgau-München: Karl Alber (Angewandte Ethik, Bd.3). Sorgner, Stefan Lorenz (2006a), Facetten der Eugenik. In: ders.; Birx, H. James; Knoepffler, Nikolaus (Hrsg.), Eugenik und die Zukunft, Freiburg im Breisgau-München: Karl Alber, S.201-209. Spaemann, Robert (1987), Über den Begriff der Menschenwürde. In: Böckenförde, ErnstWolfgang; ders. (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde: historische Voraussetzungen - säkulare Gestalt - christliches Verständnis. Stuttgart: Klett-Cotta, S.295-312. Speck, Otto (2005), Soll der Mensch biotechnisch machbar werden? Eugenik, Behinderung und Pädagogik. München-Basel: Ernst Reinhardt. Spiewak, Martin (2003), Mutterglück im Rentenalter. DIE ZEIT, Nr.5, 23. Januar 2003, S.24. Spits, Claudia; De Rycke, Martine; Verpoest, Willem et al. (2006), Preimplantation genetic diagnosis for Marfan syndrome. Fertility and Sterility, Jg.86, Nr.2, S.310-320. Starck, Christian (Hrsg.) (1999), Das Bonner Grundgesetz: Kommentar, begr. von Hermann von Mangoldt, fortgef. von Friedrich Klein. Bd.1, 4.Auflage, München: Vahlen. Statistisches Bundesamt (2007), Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2000 bis 2005. www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab16.php, www.destatis.de, 11.01.2007. Steel, Kathleen O. (1994), The Road that I see: Implications of New Reproductive Technologies. Cambridge Quaterly of Healthcare Ethics, Jg.4, Nr.3, S.351-354. Steffann, Julie; Frydman, Nelly; Gigarel, Nadine et al. (2006), Analysis of mtDNA variant segregation during early human embryonic development: a tool for successful NARP preimplantation diagnosis. Journal of Medical Genetics, Jg.43, Nr.3, S.244-247. Literaturverzeichnis 209 Steigleder, Klaus (1998), Müssen wir, dürfen wir schwere (nicht-therapierbare) genetisch bedingte Krankheiten vermeiden?. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke, S.91-119. Stengel-Rutkowski, Sabine (1997), Möglichkeiten und Grenzen pränataler Diagnostik. In: Petermann, Franz; Wiedebusch, Silvia; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.49-80. Steptoe, Patrick C.; Edwards, Robert G. (1978), Birth after the reimplantation of a human embryo. The Lancet, Jg.2, Nr.8085, S.366. Striegler, Arndt (2009), In Großbritannien heiß diskutiert: eine Ausweitung der Präimplantationsdiagnostik. Ärzte Zeitung vom 14.01.2009. Testart, Jacques; Sèle, Bernard (1995), Towards an efficient medical eugenics: is the desirable always the feasible?. Human Reproduction, Jg.10, Nr.12, S.3086-3090. Thornhill, Alan R.; de Die-Smulders, Christine; Geraedts, Joep P. et al. (2005), ESHRE PGD consortium 'Best practice guidelines for clinical preimplantation genetic diagnosis (PGD) and preimplantation genetic screening (PGS)'. Human Reproduction, Nr.20, S.35-48. Tomi, Diana; Schultze-Mosgau, Askan; Eckhold, Juliane et al. (2006), First pregnancy and life after preimplantation genetic diagnosis by polar body analysis for mucopolysaccharidosis type I. Reproductive BioMedicine Online, Jg.12, Nr.2, S.215-220. Twisk, Moniek; Mastenbroek, Sebastiaan; van Wely, Madelon et al. (2006), Preimplantation genetic screening for abnormal number of chromosoms (aneuploidies) in in vitro fertilisation or intracytoplasmic sperm injection. Cochrane Database for Systematic Reviews, Jg.25, Nr.1, Art. No.: CD005291. United Nations (1948), Universal Declaration of Human Rights - Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10th December 1948. www.un.org/Overview/rights.html, www.un.org, 25.01.2007, 25.01.2007. 210 Literaturverzeichnis United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (1997), Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte. www.unesco.de/445.html?&L=0, www.unesco.de/index.html?&L=0, 05.04.2007, 20.03.2009. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2005), Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte. www.unesco.de/erkl_bioethik_05_text.html?&L=0, www.unesco.de/index.html?&L=0, 14.06.2007, 10.05.2009. Van Baar, Anneloes L.; van Wassenaer, Aleid G.; Briët, Justine M. et al. (2005), Very Preterm Birth is Associated with Disabilities in Multiple Developmental Domains. Journal of Pediatric Psychology, Jg.30, Nr.3, S.247-255. Van den Daele, Wolfgang (1985), Mensch nach Maß? Ethische Probleme der Genmanipulation und Gentherapie. München: Beck. Van den Daele, Wolfgang (2000), Die Natürlichkeit des Menschen als Kriterium und Schranke technischer Innovation. WechselWirkung, Jg.21, Nr.103/104, S.24-31. Van Ommen, Gert-Jan B. (2002), The Human Genome Project and the future of diagnostics, treatment and prevention. Journal of Inherited Metabolic Disease, Jg.25, Nr.3, S.183-188. Verlinsky, Yury; Kuliev, Anver (1996), Preimplantation Polar Body Diagnosis. Biochemical and Molecular Medicine, Jg.58, Nr.1, S.13-17. Verlinsky, Yury; Cieslak, Jeanine; Ivakhnenko, Victor et al. (1999), Prevention of Age-Related Aneuploidies by Polar Body Testing of Oocytes. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Jg.16, Nr.4, S.165-169. Verlinsky, Yury; Rechitsky, Svetlana; Verlinksy, Oleg et al. (1999a), Pregnancy testing for single-gene disorders by polar body analysis. Genetic Testing, Jg.3, Nr.2, S.185-190. Literaturverzeichnis 211 Verlinsky, Yury; Evsikov, Sergei (1999b), Karyotyping of human oocytes by chromosomal analysis of the second polar bodies. Molecular Human Reproduction, Jg.5, Nr.2, S.89-95. Verlinsky, Yury; Rechitsky, Svetlana; Verlinksy, Oleg et al. (2002), Polar body-based preimplantation diagnosis for X-linked disorders. Reproductive BioMedicine Online, Jg.4, Nr.1, S.38-42. Verlinsky, Yury; Cohen, Jacques; Munné, Santiago et al. (2004), Over a decade of experience with preimplantation genetic diagnosis: a multicenter report. Fertility Steriliy, Jg.82, Nr.2, S.292-294. Viafora, Corrado (2000), Procreazione assistita in Europa. Etica per le professioni, Nr.2, S.93-98. Vieth, Andreas (2003), Wie viel Wasser enthält der Rubikon der Freiheit? Die Berliner Reden von Johannes Rau und Hubert Markl. Eine Analyse aus philosophischer Sicht. In: Siep, Ludwig; Quante, Michael (Hrsg.), Der Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben, Münster-Hamburg-London: LIT, S.107-131. Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. (1990), Ethische Grundaussagen. Geistige Behinderung, Jg.29, Nr.4, S.255-257. Warburton, Dororthy; Stein, Zena; Kline, Jennie et al. (1986), Cytogenetic abnormalities in spontaneous abortions of recognized conceptions. In: Porter, Ian H.; Willey, A. (Hrsg.), Perinatal Genetics: Diagnosis and Treatmen, New York: Academic Press, S.133 ff.. Weber, Max (1911), Diskussion. In: Simmel, Georg (Hrsg.), Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. Oktober in Frankfurt am Main. Tübingen: Mohr, S.151-156. Weltärztebund (2002), Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. www.uni-essen.de/anaesthesiologie/pdf/richtlinien/07helsinki.pdf, 04.04.2007, 10.05.2009. 212 Literaturverzeichnis Wetzstein, Verena (2001), „Lasst uns Menschen machen ...“. Über Homunculi und andere Kreaturen. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.47, Nr.3 , S.313–321. Widmer, Pierre (1994), Human rights issues in research in medical genetics. In: Council of Europe: Ethics and Human Genetics, Strasbourg: Council of Europe, S.175-188. Wiedebusch, Silvia (1997), Die Entscheidung über die Inanspruchnahme pränataler Diagnostik. In: Petermann, Franz; dies.; Quante, Michael (Hrsg.), Perspektiven der Humangenetik, Paderborn: Schöningh, S.127-151. Wiesing, Urban (1998), Gene, Krankheit und Moral. In: Düwell, Marcus; Mieth, Dietmar (Hrsg.), Ethik in der Humangenetik, Tübingen-Basel: Francke- Verlag, S.78-87. Wiesing, Urban (1999), Der schnelle Wandel der Reproduktionsmedizin und seine ethischen Aspekte. Ethik in der Medizin, Jg.11, Supplement 1, März, S.99-103. Wiesing, Urban (2006), Zur Geschichte der Verbesserung des Menschen. Von der restitutio ad integrum zur transformatio ad optimum. Zeitschrift für medizinische Ethik, Jg.52, Nr.4, S.323-338. Willadsen Steen; Munné, Santiago; Schimmel, Tim et al. (2003), Applications of nuclear sperm duplication. Fifth International Symposium On Preimplantation Genetics, 5th-7th June, Antalya, Turkey, Abstract, S.35. Wils, Jean-Pierre (2003), Person - Leib - Mensch. In: Siep, Ludwig; Quante, Michael (Hrsg.), Der Umgang mit dem beginnenden menschlichen Leben, Münster-Hamburg-London: LIT, S.17-37. Wilton, Leeanda; Voullaire Lucille; Sargeant, Paul et al. (2003), Preimplantation aneuploidy screening using comparative genomic hybridization of fluorescence in situ hybridization of embryos from patients with recurrent implantation failure. Fertility Sterility, Jg.80, Nr.4, S.860-868. Literaturverzeichnis 213 Winter, Stefan; Fuchs, Christoph (2000), Von Menschenbild und Menschenwürde. Deutsches Ärzteblatt, Jg.97, Nr.6, S.A 301-305. Wivel, Nelson A.; Walters, LeRoy (1993), Germ-Line Gene Modification and Disease Prevention: Some Medical and Ethical Perspectives. Science, Jg.262, Nr.5133, S.533-538. Wolf, Susan M.; Kahn, Jeffrey P.; Wagner, John E. (2003), Using Preimplantation Genetic Diagnosis to Create a Stem Cell Donor: Issues,Guidelines & Limits. The Journal of Law, Medicine and Ethics, Jg.31, Nr.3, S.327-339. Wolff, Gerhard (2002), Genetische Sicht der Entwicklung der menschlichen Frucht - Die Bedeutung von Chromosomenstörungen. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung, Jg.96, S.362-367. Woopen, Christiane (2000), Indikationsstellung und Qualitätssicherung als Wächter an ethischen Grenzen? Zur Problematik ärztlichen Handelns bei der Präimplantationsdiagnostik. Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Jg.5, S.117-139. Zech, Nicolas H.; Lejeune, Bernard; Puissant, Fancoise et al. (2007), Prospective evaluation of the optimal time for selecting a single embryo transfer: day 3 versus day 5. Fertility and Sterility, Jg.88, Nr.1, S.244-246. Zeiler, Kristin (2007), Who Am I? When Do "I" Become Another? An Analytic Exploration of Identities, Sameness and Difference, Genes and Genomes. Health Care Analysis, Jg.15, Nr.1, S.23-32. Ziegler, Uta (2004), Präimplantationsdiagnostik in England und Deutschland. Frankfurt a. M.: Campus.