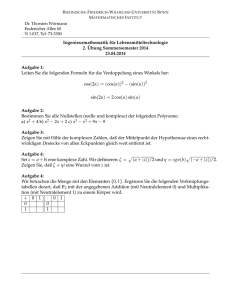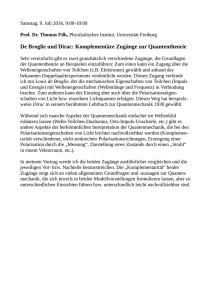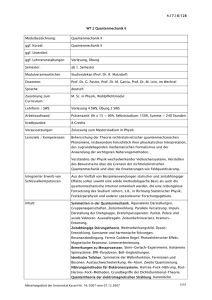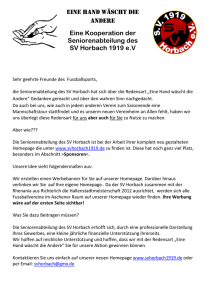Inhaltsverzeichnis
Werbung

Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Materiewellen und Schrödingergleichung
1.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Klassische Mechanik vs. Quantenmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Stationäre Zustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 SG für ein freies Teilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Teilchen in Potentialtöpfen etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 Gebundene Zustände und Streuzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2 Potentiale mit Singularitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3 Unendlich tiefer Potentialtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.4 Einige allgemeine Eigenschaften der stationären Lösungen in einer Dimension
1.5.5 Der endlich tiefe Potentialtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.6 Tunneleffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Harmonischer Oszillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.1 ...in einer Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2 Analytische Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.3 Zusammenfassung: eindimensionaler, harmonischer Oszillator . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
4
7
9
12
12
14
15
17
20
25
25
25
26
30
2 Formale Struktur der Quantenmechanik
2.1 Hilbertraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Lineare Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Observablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Heisenbergsche Unschärferelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Harmonischer Oszillator - Lösung mit algebraischer Methode . . .
2.6 Zeit - Energie - Unschärferelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Dirac-Notation und Postulate der Quantenmechanik . . . . . . . .
2.8 Das Spektrum selbstadjungierter Operatoren . . . . . . . . . . . .
2.9 Darstellung von Zuständen und Operatoren in verschiedenen Basen
2.10 Zeitliche Entwicklung von Quantensystemen . . . . . . . . . . . . .
2.10.1 Zeitentwicklungsoperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11 Heisenbergbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
30
33
35
36
37
40
41
44
47
52
52
53
3 Dreidimensionale Probleme im Zentralpotential
3.1 Klassische vs. Quanten-Mechanisch . . . . . . .
3.1.1 2-Körperproblem in der klass. Mechanik
3.1.2 quantenmechanisches Problem . . . . .
3.2 Der Drehimpuls . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 SG in Kugelkoordinaten . . . . . . . . . . . . .
3.4 Winkelgleichung . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Die Radialgleichung . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Das Wasserstoffatom . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Der Runge-Lenz-Pauli-Vektor . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
56
56
57
58
63
64
67
68
73
.
.
.
.
.
75
75
76
77
80
82
4 Teilchen im elektromagnetischen Feld
4.1 Klassischer Hamiltonoperator . . . . . .
4.2 Quantenmechanischer Hamiltonoperator
4.3 Konstantes Magnetfeld . . . . . . . . . .
4.4 Spin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Pauligleichung . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seite 1
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4.6
4.7
Inhaltsverzeichnis
Drehung von Spinoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Addition von Drehimpulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Zeitunabhängige Störungstheorie
5.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nicht-entartete Störungsrechnung . . .
5.3 Störungstherme für entartete Zustände
5.4 Ritzsches Variationsprinzip . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
84
86
89
89
90
91
92
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 Grundlagen der Quantentheorie vieler Teilchen
6.1 Schrödingergleichung . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Ununterscheidbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Das Heliumatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Parahelium: Störungsrechnung 1. Ordnung
6.3.2 Variationsrechnung für Parahelium . . . . .
6.3.3 Störungsrechnung für Orthohelium . . . . .
6.3.4 Austauschwechselwirkung . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
94
. 94
. 95
. 96
. 97
. 98
. 99
. 100
7 Messprozess
7.1 Spinkorrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 EPR-Paradoxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Quantenmechanik und Bellsche Ungleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
101
102
103
Seite 2
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
1 Materiewellen und Schrödingergleichung
1.1 Vorbemerkungen
Ende 19. Jh: Grundlagen der klassischen Physik weitgehend abgeschlossen.
• Klassische Mechanik und spez. Relativitätstheorie
• Elektrodynamik
• Thermodynamik
Experimente, die im Widerspruch zum klassischen Theoriegebäude stehen
(1) Lichtwellen zeigen Teilcheneigenschaften, z.B.. photoelektrischer Effekt
Licht schlägt Elektronen aus der Metallplatte heraus → Messung des e− -Stroms
Erwartung klassischer Physik: Elektronen absorbieren die Energie des Lichtfeldes ⇒ Strom ∝
Intensität der Strahlung
Beobachtung: Strom fließt nur, falls die Frequenz ω des einfallenden Lichtes groß genug ist
Ekin
|{z}
=
kin. Energie d. Elektronen
~ω
|{z}
von Elektronen abs. Energie
−
W
|{z}
Austrittsarbeit aus Metall
Erklärung (Einstein 1905): Lichtquanten mit Energie ~ω schlagen e− aus Metall heraus
~=
h
= 1, 054572 · 10−34 J · s Plancksches Wirkungsquantum (Naturkonstante)
2π
Dimension von ~: Energie × Zeit = Ort × Impuls = Wirkung
Weitere Experimente: Die Evidenz von Lichtquanten zeigen:
• Hohlraumstrahlung
• Comptonstreuung
(2) Teilchen zeigen Welleneigenschaften: Doppelspaltexperiment
a) Quelle sendet klassische Teilchen aus (Kugeln, Schrotkörner): Intensitäten addieren sich:
I1,2 = I1 + I2
b) Quelle sendet elektromagnetische Wellen aus: Spaltbreite d ≈ Wellenlänge der Welle λ →
Beugung.
⇒ Interferenzmuster: I1,2 = |A1 + A2 |2 6= I1 + I2
c) Quelle sendet Elektronen aus (S1 und S2 genügend klein)
experimentelle Details:
Seite 3
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
• Experiment so, dass im Mittel nur ein Elektron zwischen Spalt und Detektorschirm unterwegs
ist
• Mittelung über viele Elektronen ⇒ Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x), dass Elektron im Ort x
aufschlägt.
• P (x) ≡ Intensitätsverteilung bei der Beugung von Lichtwellen
• insbesondere Interferenzmuster, wenn S1 und S2 offen sind
⇒ P1,2 (x) 6= P1 (x) + P2 (x)
• Messung, welchen Spalt das Elektron passiert hat, zerstört Interferenzmuster
Folgerung:
• Elektronen können sich wie Wellen verhalten.
• Einführung einer Wahrscheinlichkeitsamplitude Ψ(x) ∈ C, so dass P1,2 (x) = |Ψ1 (x) + Ψ2 (x)|2
(ohne Durchgangsmessung)
• stochastische Beschreibung für die Bewegung des Elektrons erforderlich
→ Bewegungsgleichung, die Welle-Teilchen-Dualismus beschreibt?
1.2 Klassische Mechanik vs. Quantenmechanik
einfaches Problem: Teilchen der Masse m, dass sich in x-Richtung bewegt und auf das die Kraft F (x)
wirkt.
F (x) = −
∂U (x)
mit F (x) konservativ, U (x) Potentialfunktion
∂x
klassisch:
Newton II: m
d2 x
∂U
=−
(1)
2
dt
∂x
→ Anfangsbedingungen: x(0), ẋ(0) ≡
dx(0)
≡ v(0)
dt
→ Lösung von Gl. (1) liefert Phasenraumtrajektorie
(x(t), m · v(t) = p(t) )
|{z}
Impuls
quantenmechanisch:
zentrale Größe:
Ψ(x, t): komplexwertige Wellenfunktion des Teilchens
∂Ψ(x, t)
~2 ∂ 2 Ψ
Schrödingergleichung (SG): i~
=−
+ U Ψ (2)
∂t
2m ∂x2
Eigenschaften von Gl. (2):
1. SG lineare, partielle Differentialgleichung
⇒ Superpositionsprinzip Ψ1 , Ψ2 Lösungen der SG
Seite 4
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
→ λ1 Ψ1 + λ2 Ψ2 mit λ1 + λ2 ∈ C auch Lösung
2. SG 1. Ordnung in Zeit t:
→ Kenntnis von Ψ(x, t = t0 ) genügt, um Ψ(x, t > t0 ) zu bestimmen
3. Korrespondenzprinzip: Für “~ → 0“ Übergang in klassische Mechanik (später)
statistische Interpretation: |Ψ(x, t)|2 : Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen zur Zeit t am Ort x zu finden.
+∞
Z
Normierung:
|Ψ(x, t)|2 dx = 1
−∞
• Diese Bedingung schränkt die physikalischen Lösungen der SG auf quadratintegrable
Funktionen ein.
1
• Ψ(x, t) geht für |x| → ∞ schneller gegen 0 als p
|x|
• wichtige Eigenschaft: Normierung bleibt zeitlich erhalten
d
Beweis:
dt
+∞
+∞
Z
Z
∂
2
|Ψ(x, t)| dx =
|Ψ(x, t)|2 dx
∂t
−∞
−∞
∂
∂
|Ψ|2 = (Ψ∗ Ψ) (konjugiert komplexe Fkt. von Ψ)
∂t
∂t
= Ψ∗
SG:
∂Ψ ∂Ψ∗
+
Ψ
∂t
∂t
i~ ∂ 2 Ψ
i
∂Ψ
=
− UΨ
∂t
2m ∂x2
~
i~ ∂ 2 Ψ∗
i
∂Ψ∗
=−
+ UΨ
2
∂t
2m ∂x
~
∂|Ψ|2
i~ ∗ ∂ 2 Ψ
i ∗
i~ ∂ 2 Ψ
i
=
Ψ
−
Ψ
U
Ψ
−
Ψ + U Ψ∗ Ψ
2
2
∂t
2m
∂x
~
2m ∂x
~
2
i~
∂ 2 Ψ∗
∂
i~
∂Ψ∗
∗∂ Ψ
∗ ∂Ψ
=
Ψ
−
Ψ =
Ψ
−
Ψ
2m
∂x2
∂x2
∂x 2m
∂x
∂x
⇒
d
→
dt
Z∞
i~
|Ψ(x, t)| dx =
2m
2
−∞
∞
∂Ψ∗
∗ ∂Ψ
Ψ
−
Ψ
=0
∂x
∂x
x=−∞
Ψ(x, t) → 0 für x → ∞
Erwartungswert von x:
Seite 5
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
+∞
Z
hxi =
x|Ψ(x, t)|2 dx
−∞
Mittelwert von wiederholten Messungen an einem Ensemble von identisch präperierten Teilchen.
Erwartungswert der “Geschwindigkeit“.
+∞
+∞
Z
Z
∂|Ψ|2
∂ −i~
∂Ψ∗
∗ ∂Ψ
Ψ
dx x
=
dx x
−
Ψ
∂t
∂x 2m
∂x
∂x
d hxi
=
dt
−∞
−∞
∞
Z∞
∗
∗
∂Ψ ∂Ψ
∂Ψ ∂Ψ
i~
x Ψ∗
−
Ψ
−
dx Ψ∗
−
Ψ
=
2m
∂x
∂x
∂x
∂x
x=−∞
−∞
∞
Z
i~
∂Ψ
−
=
dx Ψ∗
2m
∂x
−∞
i~
=−
2m
Z
Ψ∗
Z∞
∂Ψ∗
Ψ
∂x
{z
}
dx
−∞
|
∞
R
=[Ψ∗ Ψ]∞
x=−∞ −
−∞
dx Ψ∗
∂Ψ
∂x
∂Ψ
dx
∂x
d hxi
Impuls-Erwartungswert: hpi = m
=
dt
Z
∂
Ψ
dx Ψ −i~
∂x
| {z }
∗
p̂
∂
heißt Impulsoperator
∂x
2 Z
p
Kinetische Energie: < T >=
= Ψ∗
2m
p̂ = −i~
~2 ∂ 2
−
2m ∂x2
|
{z
}
Ψ dx
T̂ :Operator der kin. Energie
d hpi
Man kann zeigen:
=
dt
∂U
−
∂x
Diese Gleichung entspricht i.a. nicht der Newtonschen Bewegungsgleichung, insbesondere
∂U
−
∂x
6= −
∂U (hxi)
∂x
Bemerkungen:
• zentrale Größe Ψ(x, t) → |Ψ(x, t)|2 Wahrscheinlichkeit
Seite 6
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
• Impulsoperator p̂ = −i~
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
∂
∂x
• SG lässt sich auch wie folgt schreiben: i~
Hamilton-Operatur
• SG in 3 Dimensionen:
∂Ψ(x, t)
= (T + U )Ψ = HΨ; Es gilt H = T + U
∂t
~2 2
∂Ψ(~r, t)
1 2
p~ = −
∇ ⇒ i~
= HΨ(~r, t)
2m
2m
∂t
~2 2
= −
∇ + U (~r, t) Ψ(r, t)
2m
• geladenes Teilchen mit Ladung e im externen elektromagnetischen Feld:
~
~ = −∇ρ(~r, t) − 1 ∂ A
E
c ∂t
~ = ∇ × A(~r, t)
B
ρ(~r, t): skalares Potential A(~r, t): Vektorpotential mit c: Lichtgeschwindigkeit
Hamiltonfunktion (klassisch): H =
q.m.: H =
e ~ 2
1 p~ − A
+ eρ
2m
c
e ~ 2
1 −i~∇ − A
+ eρ
2m
c
N wechselwirkende Teilchen:
HN =
N
X
p~2k
+ U (~r1 , . . . , ~rN , t)
2mk
k=1
p~2k
2
= −~
∇2k
⇒ SG: i~
2
= −~
∂2
∂2
∂2
+
+
∂x2k
∂yk2 ∂zk2
∂
Ψ(~r1 , ~r2 , . . . , ~rn , t) = HN Ψ
∂t
besonders wichtig für Festkörperphysik: Coulomb-Potentialfunktion
U=
1 X ek el
beschreibt WW zwischen Elektronen und Kernen.
4πε0
|~rk − ~rl |
k>l
1.3 Stationäre Zustände
Teilchen der Masse m in einer Dimension im Potential U = U (x)
SG: i~
∂Ψ
~2 ∂ 2 Ψ
=−
+ UΨ
∂t
2m ∂x2
Seite 7
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Separationsansatz: Ψ(x, t) = ρ(x)α(t)
⇒ i~ρ(x)
~2
∂ 2 ρ(x)
∂α(t)
=−
α(t)
+ U ρ(x)α(t)
∂t
2m
∂x2
dividiere durch ρα ⇒
1 ∂α
i~
α
| {z∂t}
Funktion von t
~2 1 ∂ 2 ρ
=−
+U
2m ρ ∂x2
|
{z
}
Funktion von x
⇒ rechte und linke Seite gleich einer Konstanten E
i~
∂α(t)
= Eα (3)
∂t
−
~2 ∂ 2 ρ
+ U ρ = Eρ (4)
2m ∂x2
Gl. (3) und (4) gewöhnliche Differentialgleichungen
Gl. (4) heißt zeitunabhängige SG
i
Lösung von Gl. (3): α(t) = e− ~ Et
Bemerkungen:
i
• separierbare Lösungen: Ψ(x, t) = ρ(x)e− ~ Et beschreiben stationären Zusände, denn:
i
i
|Ψ(x, t)|2 = Ψ∗ Ψ = ρ∗ e ~ Et ρe− ~ Et = ρ∗ ρ = |ρ(x)|2 unabhängig von t
Konsequenz: Erwartungswerte h. . . i zeitlich konstant
• Hamiltonoperator: Ĥ = −
~2 ∂ 2
+ U (x)
2m ∂x2
⇒ Ĥ = Eρ Eigenwertgleichung mit E=Gesamtenergie: Eigenwert des Op Ĥ
Z
< Ĥ >=
Z
∗
ρ Ĥρ dx = E
ρ∗ ρ dx = E
|{z}
=|ρ|2
< Ĥ 2 >= E 2 ⇒< Ĥ 2 > − < Ĥ >2 = 0 =Varianz von Ĥ
Gilt nur für separierbare Lösung: Jede Messung der Gesamtenergie liefert mit Sicherheit die
Energie E
• allgemeine Lösung: darstellbar als Linearkombination von unendlich vielen separierbaren
Lösungen
Ψ(x, t) =
∞
X
i
cn ρn (x)e− ~ En t mit cn =komplexe Koeffizienten
n=1
Seite 8
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
beachte: allgemeine Lösung nicht stationär, Zeitabhängigkeit fällt beim Berechnen von
|Ψ(x, t)|2 nicht heraus.
1.4 SG für ein freies Teilchen
Teilchen der Masse m in einer Dimension, nun U = 0 ⇒ zeitunabh. SG
−
~2 d2 ρ
= Eρ
2m dx2
⇒
d2 ρ
1√
2
2mE
=
−k
ρ
mit
k
=
±
dx2
~
E=
~2 k 2
>0
2m
Lösungen der Form: ρ(x) = Aeikx mit A ∈ C
~k2
ferner: α(t) = e−i 2m t =: e−iωt mit ω =
oder ω = vk mit v =
~k 2
Dispersionsrelation
2m
~k
ω
= = Phasengeschwindigkeit der Welle
2m
k
⇒ Ψ(x, t) = Aei(kx−ωt) = Aeik(x−vt)
Problem: Normierung
Z∞
dx Ψ∗k Ψk = |A|2
−∞
Z∞
dx = ∞
−∞
→ für freies Teilchen existiert kein stationärer Zustand → Es gibt kein freies Teilchen mit
bestimmter Energie
Allgemeine Lösung: Wellenpaket
1
Ψ(x, t) = √
2π
Z∞
dk A(k)ei(kx−ω(k)t)
−∞
Umkehrformel:
1
A(k) = √
2π
Z∞
dx Ψ(x, t)ei(kx−ω(k)t)
−∞
Z∞
2
Z∞
dx |Ψ(x, t)| =
Parseval-Gleichung:
−∞
dk |A(k)|2
−∞
Seite 9
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Geschwindigkeit, mit der sich das Paket bewegt?
Ψ normiert ⇒ Erwartungswert für Ortsmittelpunkt des Pakets.
Z∞
hxi =
Z∞
dx x|Ψ(x, t)|2 =
−∞
dx x Ψ∗ (x, t)
Z
∗
Z
dx Ψ
dk A(k)ei(kx−ωt)
−∞
−∞
1
hxi = √
2π
Z∞
dk A(k)e−iωt
1 ∂ ikx
e
i ∂k
Z
Z
+∞
h
i
1
1
1
∂
∗
ikx−ωt ikx
−iω(k)t
dxΨ
partielle Integration: hxi = √
A(k)e
−
dk
e
A(k)e
i
i
∂k
2π
−∞
|
{z
}
=0 wegen A(k=±∞)=0
Z
Z
Z
h
i Z
1
∂ 1
−iω(k)t
−iωt
∗
ikx ∂
√
A(k)e
= dk i
A(k)e
dx Ψ
dk ie
dx Ψ∗ (x, t)eikx
hxi = √
∂k
∂k
2π
2π
Z
1
√
dx Ψ∗ (x, t)eikx = A∗ (k)eiω(k)t
2π
Z
⇒ hxi =
d
⇒
hxi =
dt
∗
iω(k)t
dx A (k)e
Z∞
Z
i Z
∂A(k)
∂ h
∂ω(k)
∗
iω(k)t
= dx A (k)i
i
A(k)e
+t·
|A(k)|2 dk
∂k
∂k
∂k
∂ω
|A(k)|2 dk =
∂k
∂ω
∂k
−∞
A(k) stark um bestimmten Wert von k konzentriert
⇒ Mittelpunkt des Pakets bewegt sich mit der Geschwindigkeit
vg =
∂ω(k)
Gruppengeschwindigkeit
∂k
ω(k) =
~ 2
k ⇒ de Broglie-Beziehungen:
2m
p = m · vg = ~k
E=
p2
= ~ω
2m
(k − k0 )2
Bsp: Graußsches Wellenpaket: A(k) =
−
1 exp
4σk2
((2π)σ 2 ) 4
1
k
Wahrscheinlichkeitsverteilung für Impuls: (p = ~k)
Seite 10
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
(k − k0 )2
exp −
p̃ = |A(k)| = q
2σk2
2πσ 2
1
2
k
σk = ∆k =
1
∆p
~
1
Ψ(x, t) = √
2π
Z∞
dk A(k)ei(kx−ω(k)t) liefert wieder Gaußfunktion
−∞
⇒ Wahrscheinlichkeitsverteilung als Funktion von x und t.
(x − v0 t)2
exp −
P (x, t) = |Ψ(x, t)| = q
2σk2
2πσ 2
2
1
k
∂ω ~
v0 =
= k0
∂k k=k0
m
σx2 =
1
~2 t2 2
+
σ
m2 k
4σk2
σx = ∆x misst die Lokalisierung im Ortsraum
⇒ Je lokalisierter ein Teilchen im k-Raum ist, desto delokalisierter ist es im Ortsraum
t = 0 : σx =
1
1
~
~
oder ∆x =
=
⇒ ∆x · ∆p =
2σk
2∆k
2∆p
2
Scharfe Verteilung im Impulsraum = breiter Verteilung im Ortsraum und umgekehrt.
t > 0 : ∆x · ∆p >
~
2
Allgemein kann man für beliebige Wellenfunktionen zeigen:
∆x · ∆p ≥
~
Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (auch Unschärferelation)
2
⇒ genaue Kenntnis des Ortes mit ungenauer Kenntnis des Impulses verknüpft und umgekehrt.
⇒ Begriff der Bahn eines Teilchens quantenmechanisch nicht sinnvoll.
Bsp.: Elektron:
me = 9, 11 · 1031 kg
~ = 1, 05 · 10−34 Js
∆x ≈ 10−10 m
m
~
∆p ≈
= 10−24 kg oder ∆v ≈ 106 m/s
∆x
s
Staubteilchen:
Seite 11
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
m ≈ 10−6 kg
∆v = 10−4 m/s
⇒ ∆x ≥ 10−24 m vernachlässigbar!
1.5 Teilchen in Potentialtöpfen etc.
1.5.1 Gebundene Zustände und Streuzustände
Ausgangspunkt: stationärer Zustand eines Teilchens der Masse m mit Energie E im Potential U (x)
⇒ zeitunabhängige SG
~2 d2
−
+ U (x) ϕ(x) = Eϕ(x) (*)
2m dx2
|
{z
}
=Ĥ
Eigenwertgleichung: Ĥϕ = Eϕ mit E: Eigenwert und ϕ: Eigenfunktion
schreibe nun Gl. (*) um:
1 d2 ln|ϕ|
+
ϕ dx2
definierte χ ≡
d ln|ϕ|
dx
2
dχ
d ln|ϕ|
⇒
+ χ2 = −k 2 (x) (**)
dx
dx
Rx
χ bekannt ⇒ |ϕ(x)| = e
dy χ(y)
Z
Integrationskonstante aus
dx |ϕ|2 = 1
Verhalten von |ϕ(x)| für |x| → ∞ kann nun mit Hilfe von Gl. (**) analysiert werden.
Annamhe: U (x) = U0 |x|a für |x| → ∞ mit a > 0, U0 > 0
⇒ −k 2 (x) ∝ |x|a für |x| → ∞
ln |ϕ| − A|x|b für |x| → ∞ mit b > 0, A > 0 (, da |ϕ| → 0 für |x| → ∞)
Setze Ansatz χ ≡
d ln|ϕ|
= −Ab|x|b−1 in Gl. (**) ein.
dx
−Ab(b − 1)|x|b−2 + A2 b2 |x|2(b−1) =
2m
(U0 |x|a − E)
~2
b > 0 ⇒ b − 2 < 2(b − 1)
⇒ 2. Term auf der linken Seite der Gl. dominiert für große |x|
Seite 12
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
|x| → ∞ : A2 b2 |x|2(b−1) =
1
A=
1 + 1/2a
r
2m
1
U0 |x|a ⇒ b = 1 + a
2
~
2
2mU0
~2
charakteristische Länge l =
⇒A=
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
~2
2mU0
1
2+a
1
1
l−(1+a/2) ⇒ ln |ϕ| = −A|x|b = −
1 + a/2
1 + a/2
1
⇒ |ϕ| ∝ exp −
1 + a/2
|x|
l
|x|
l
1+a/2
1+a/2 !
Beispiele: a = 2 (harmonischer Oszillator)
"
1
|ϕ| ∝ exp −
2
|x|
l
2 #
|x|
l
3 #
für |x| → ∞, l =
~2
2mU0
14
a=1
"
3
|ϕ| ∝ exp −
2
2
für |x| → ∞, l =
~2
2mU0
13
U (x) = U0 = const. für |x| → ∞, d.h. a = 0
ferner Annahme E < U0 , analog zu Vorgehen zu a > 0
r
ln|ϕ| = −A|x|, A > 0 ⇒ A =
2m(U0 − E)
|x|
−1
≡ l ⇒ |ϕ| ∝ exp −
~2
l
In beiden Fällen U (x) = U0 |x|a und U (x) = U0 gilt E < U0 für große |x|, klassisch nicht erlaubt!
q.m. |ϕ(x)|2 > 0 d.h. endliche Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im klassisch verbotenen Bereich
E < U zu finden.
allgemein: Zustand hängt vom Verhalten von U (x) für |x| → ∞ ab.
gebundener Zustand
E < U (x → −∞) und E < U (x → ∞) ⇒ Wellenfunktion ϕ(x) fällt “komprimiert“ exponentiell für
|x| → ∞ ab.
Streuzustände
E > U (x → −∞) und / oder E > U (x → +∞)
q.m.: Tunnelphänomen: Teilchen kann Potentialbarrieren durchtunneln.
Seite 13
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Spezialfall: U (|x| → ∞) → 0 ⇒
E < 0 : gebundener Zustand
E > 0 : Streuzustand
1.5.2 Potentiale mit Singularitäten
nichtlineare Dgl. für χ
2m
dχ
+ χ2 = −k 2 (x), k 2 (x) = 2 (E − U (x))
dx
~
nun: U (x) mit singulären Term:
(1) U (x) =
Ur (x)
| {z }
+Us Θ(x − xs )|x − xs |a mit a > −1, Us > 0
reguläre Fkt.
Θ(x − xs ) =
beachte:
0 x < xs
1 x ≥ xs
dΘ(x)
= δ(x) (Delta-Fkt.)
dx
2mU0
integriere Dgl. für χ: χ(x) = χr (x) +
~2
Z
dx0 Θ(x0 − xs )|x0 − xs |a
{z
}
|
=Θ(x−xs )
Rx
dx0 |x0 −xs |a
xS
= χr (x) +
⇒ (x) =
2mU0
1
Θ(x − xs )
|x − xs |a+1
2
~
a+1
1 dϕ(x)
stetig in x = xs für a > −1
ϕ(x) dx
⇒ ϕ(x) stetig differenzierbar
(2) U (x) = Ur (x) + Us δ(x − xs )
einige Eigenschaften der δ-Funktion
δ(x) =
0 x 6= 0
mit
∞ x=0
Z∞
δ(x) dx = 1
−∞
δ(x) kann als Grenzwert einer Funktionenfolge dargestellt werden, z.B.
1
n
2
• δ(x) = lim √ e− 2 nx
n→∞
2π
Seite 14
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
1 sin(nx)
= lim
• δ(x) = lim
n→∞
n→∞ π
x
Zn
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
dx eiyx
−n
integriere singulären Anteil von χ über kleine Umgebung [xs − , xs + ] um xs
xZs +
dχ
dx 0 =
dx
χ(xs + ) − χ(xs − ) =
0
xs −
xZs +
dx0
xs −
2mUs
2mUs
δ(x0 − xs ) =
2
~
~2
oder
1
ϕ(xs )
dϕ
dx
ϕ stetig, aber
dϕ
−
dx
xs +
!
=
xs −
2mUs
~2
dϕ
macht einen Sprung bei x = xs und ist daher unstetig
dx
1.5.3 Unendlich tiefer Potentialtopf
U (x) =
0 für 0 ≤ x ≤ L
∞
für sonst
ϕ(x) = 0 außerhalb des Topfes, U = 0 innerhalb des Topfes ⇒ zeitunabhängige SG
−
~2 d2 ϕ
d2 ϕ
1√
2
2mE und E > 0
=
Eϕ
oder
=
−k
ϕ(x)
(+)
mit
k
=
2m dx2
dx2
~
beachte: für jede normierbare Lösung der zeitunabhängigen SG muss E größer als der Mindestwert
von U (x) sein (→ Ü-Aufgabe)
allgemeine Lösung von Gl. (+)
ϕ(x) = A sin(kx) + B cos(kx), ϕ(x) stetig bei x = 0 und x = L
⇒ ϕ(0) = ϕ(L) = 0
!
⇒ ϕ(0) = A sin(0) + B cos(0) = B = 0
ϕ(x) = A sin(kx)
!
ϕ(L) = A sin(kL) = 0
⇒ 2 Fälle:
• A = 0: triviale Lösung, für die |ϕ(x)|2 nicht normierbar ist
• sin(kL) = 0 ⇒ kL = 0, ±π, ±2π, ±3π, . . .
negative Lösungen enthalten keine zusätzlichen Informationen: sin(−Θ) = −sin(Θ), das “−“ kann in
A “hineingezogen“ werden.
Seite 15
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
k = 0 führt auf ϕ(x) = 0 → nicht normierbar
⇒ kn =
nπ
~2 kn2
n2 π 2 ~2
mit n = 1, 2, 3, · · · ⇒ En =
=
L
2m
2mL2
Erlaubte Energieeigenwerte sind diskret, nicht kontinuierlich! A aus Normierung
ZL
|A|2 sin2 (kx) dx = |A|2
L !
=1
2
0
2
⇒ |A| =
oder A =
L
r
2
r
⇒ ϕn (x) =
2
L
nπ 2
sin
x
L
L
⇒ ϕn (x) beschreiben stehende Wellen
→ ϕ1 (x): Grundzustand, ϕn (x), n > 1: Angeregte Zustände
weitere Eigenschaften der ϕn (x):
• ϕ2n , n = 1, 2, 3, . . . : ungerade Funktionen bzgl. x =
L
2
• ϕ2n+1 , n = 0, 1, 2, . . . : gerade Funktionen bzgl. x =
L
2
• ϕn (x), n = 1, 2, 3, . . . hat n − 1 Knoten (Nulldurchgänge)
Z
• Orthonormalität:
ϕ∗n (x)
ϕm (x) dx = δmn =
0 m 6= n
1 m=n
Vollständigkeit:
Definition: System von orthonormierten Funktionen {ϕn } vollständig:
Z
⇒ jede quadratintegrable Funktion f (x):
ϕ∗n (x)f (x)dx = 0 ∀n ist identisch 0.
↔ f(x) kann nach Funktionensystem {ϕn } entwickelt werden (f (x) quadratintegrabel!)
hier: f (x) =
∞
X
n=1
r
Cn ϕn (x) =
∞
nπ 2X
Cn sin
x Fourierreihe von f (x)
L
L
n=1
Für Fourierreihen garantiert der Satz von Dirichlet die Vollständigkeit.
Koeffizienten Cn ?: Multipliziere f (x) mit ϕ∗ (x) und integriere über alle x.
Seite 16
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
Z
Z
ϕ∗m (x)f (x)dx
=
ϕ∗m (x)
∞
X
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Cn ϕn (x)dx =
n=1
∞
X
Z
Cn
n=1
ϕ∗m (x)ϕn (x)dx = Cm
|
{z
}
δnm
Z
⇒ Cn =
ϕ∗n (x)f (x)dx
allgemeine Lösung der zeitabhängigen SG:
Ψ(x, t) =
∞
X
r
Cn
n=1
nπ 2
π~n2
t
sin
x exp −i
L
L
2mL2
Cn durch Anfangsbedingung festgelegt: Ψ(x, 0) = sin
r
⇒ Cn =
2
L
ZL
sin
nπ x ϕn (x)
L
nπ x Ψ(x, 0)dx
L
0
Bedeutung der Cn :
Z
1=
|Ψ(x, 0)|2 dx =
∞
X
Z
!
Cn ϕm (x)∗
n=1
=
∞ X
∞
X
∗
Cm
Cn
m=1 n=1
∞
X
!
Cn ϕn (x) dx
n=1
∞
X
Z
ϕm (x)ϕn (x) dx =
|Cn |2
|
{z
} n=1
δnm
D E Z
Energie-Erwartungswert: Ĥ = Ψ∗ ĤΨ dx
∞
X
Z
=
!∗
Cm ϕm
m=1
=
XX
m
Ĥ
∞
X
Cn ϕn
dx
n=1
∗
Cm
Cn En δnm =
n
!
X
|Cn |2 En
n
⇒ |Cn |2 : Wahrscheinlichkeit dafür, dass das System die Energie En hat.
1.5.4 Einige allgemeine Eigenschaften der stationären Lösungen in einer Dimension
zeitunabhängige SG:
2m
(1) ϕ00 (x) +k 2 (x)ϕ(x) = 0 mit k 2 = 2 (E − U (x))
| {z }
~
2ϕ
dx2
≡d
Seite 17
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
oder
(2) Ĥϕ(x) = E ϕ(x) mit Ĥ = −
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
~2 d2
+ U (x)
2m dx2
(1) U (x) reell ⇒ Ĥ reell: Ĥ = Ĥ ∗
⇒ auch ϕ∗ (x) Lösung von Gl. (2) und damit sind auch Re(ϕ(x)) und Im(ϕ(x)) Lösungen
1
Re(ϕ(x)) = (ϕ(x) + ϕ∗ (x))
2
i
Im(ϕ(x)) = (ϕ∗ (x) − ϕ(x))
2
⇒ Es genügt, rein reelle Lösungen von Gl. (2) zu betrachten.
(2) Parität: betrachte Abbildung ϕ(x) → ϕ(−x)
→ Paritätsoperator: P̂ ϕ(x) = ϕ(−x)
klar P 2 ϕ(x) = P̂ ϕ(−x) = ϕ(x) ⇒ P 2 = 1 identische Abb.
⇒ Eigenwerte von P̂ : P̂ ϕ = λϕ ⇒ P 2 ϕ = ϕ = λ2 ϕ ⇒ λ± = ±1
λ+ = +1: gerade Parität, Eigenfunktionen von P symmetrisch: P̂ ϕg (x) = ϕg (−x) = ϕg (x)
λ− = −1: ungerade Parität, Eigenfunktionen von P antisymmetrisch: P̂ ϕu (x) = ϕu (−x) = −ϕu (x)
Annahme: Potential U (x) symmetrisch, d.h. P̂ U (x) = U (−x) = U (x)
~2 00
ϕ (−x) + U (−x) ϕ(−x) = Ĥϕ(−x) = Ĥ P̂ ϕ(x)
⇒ P̂ Ĥϕ(x) = P̂ f (x) = f (−x) = −
| {z }
| {z }
2m
f (x)
=U (x)
⇒ P̂ Ĥ = Ĥ P̂ (Ĥ und P̂ kommutieren)
⇒ P̂ Ĥϕ(x) = ĤP ϕ(x) = E P̂ ϕ(x)
⇒ Ĥϕ(−x) = Eϕ(−x)
2 Möglichkeiten, Eigenfunktionen zum gleichen Eigenwert E zu konstruieren:
ϕg (x) =
1
(ϕ(x) + ϕ(−x))
2
symmetrische Lösung mit P̂ ϕg = ϕg oder gleich 0 (falls ϕ ungerade)
ϕu (x) =
1
(ϕ(x) − ϕ(−x)) antisymmetrischer Lösung mit P̂ ϕu = −ϕu oder gleich 0 falls ϕ gerade.
2
Anwendung auf unendlich tiefen Potentialtopf:
Seite 18
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
(
nur symmetrisches Potential U (x) =
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
0
für −
∞
L
L
≤x≤
2
2
sonst
⇒ Eigenfunktionen ϕn (x) gerade oder ungerade bzgl. Ursprung
(3) Wronski-Determinante
ϕ1 (x) und ϕ2 (x) reelle Lösungen von Gl. (2) zu Energien E1 und E2 (ϕ1 , ϕ2 beschreiben gebundene
Zustände)
⇒ ϕ001 (x) +
ϕ1 (x) = 0 · ϕ2 (x)
k12 (x)
| {z }
= 2m
(E1 −U (x))
~
ϕ2 (x)ϕ001 (x) + k12 (x)ϕ2 (x)ϕ1 (x) = 0
analog: ϕ1 (x)ϕ002 (x) + k22 (x)ϕ1 (x)ϕ2 (x) = 0
Differenz: ⇒ ϕ2 (x)ϕ001 (x) − ϕ1 (x)ϕ002 (x) = (k22 (x) − k12 (x))ϕ1 (x)ϕ2 (x) =
2m
(E2 − E1 )ϕ1 (x)ϕ2 (x)
~2
integriere von x0 bis x1 ; linke Seite der Gleichung mit partieller Integration:
Zx1
dx(ϕ2 ϕ001
−
ϕ1 ϕ002 )
=
(ϕ2 (x)ϕ01 (x)
−
x0
⇒
(ϕ2 (x)ϕ01 (x)
−
x1
ϕ1 (x)ϕ02 (x))
x0
x1
ϕ1 (x)ϕ02 (x))
2m
= 2 (E2 − E1 )
~
Zx1
−
x0
x0
dx(ϕ02 (x)ϕ01 (x) − ϕ01 (x)ϕ02 (x))
{z
}
|
=0
Zx1
dx ϕ1 (x)ϕ2 (x)
x0
Definition Wronski-Determinante:
ϕ1 (x) ϕ2 (x)
0
0
0
ϕ (x) ϕ0 (x) = ϕ1 (x)ϕ2 (x) − ϕ2 (x)ϕ1 (x)
1
2
x1
Zx1
2m
(E1 − E2 ) dx ϕ1 (x)ϕ2 (x)
⇒ W (ϕ1 , ϕ2 , x) =
~
x0
x0
→ unabhängig von der bestimmten Form von U (x)
→ E1 = E2 ⇒ W (ϕ1 , ϕ2 , x) = const.
Folgerungen:
• Anzahl der Knoten der Wellenfunktion ϕn (x) :
Seien x0 , x1 benachbarte Knoten der Funktion ϕm (x):
Seite 19
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
→ ϕm (x) mit festem Vorzeichen für x0 < x < x1
→ ϕm (x) < 0 für x0 < x < x1 : ϕ0m (x0 ) < 0, ϕ0m (x1 ) > 0
ϕm (x) > 0 für x0 < x < x1 : ϕ0m (x0 ) > 0, ϕ0m (x1 ) < 0
Sei nun o.B.d.A. En > Em und ϕm (x) < 0 für x0 < x < x1 , x0 und x1 Knoten ϕm (x)
x1
ϕn (x)ϕ0m (x)
⇒
x0
2m
= 2 (En − Em )
~
Zx1
ϕn ϕm dx
x0
ϕn (x1 ) ϕ0m (x1 ) − ϕ0m (x0 ) ϕn (x0 )
| {z }
>0
| {z }
>0
2m
= 2 (En − Em )
~ | {z }
>0
Zx1
x0
ϕn (x) ϕm (x) dx
| {z }
<0
→ ϕn > 0 in x0 < x < x1 : linke Seite > 0, rechte Seite < 0 Widerspruch!
→ ϕn < 0 in x0 < x < x1 : linke Seite < 0, rechte Seite > 0 Widerspruch!
⇒ ϕn (x) muss zwischen x0 und x1 das Vorzeichen ändern, hat also mindestens einen Knoten in
(x0 , x1 )
E1 < E2 < E3 < · · · < Em < . . .
Knotensatz: ϕn hat n − 1 Knoten; zwischen 2 benachbarten dieser n − 1 Knoten hat ϕn+1
mindestens einen Knoten.
• Energien des diskreten Spektrums sind nicht entartet (gilt nur für eindimensionale Systeme)
Beweis: Annahme: ϕn (x), ϕ̃n (x) verschiedene Eigenfunktionen zu demselben Eigenwert En
⇒ W (ϕn (x)ϕ̃n (x), x) = const. ∀x
⇒ ϕn (x)ϕ̃0n (x) − ϕ̃n (x)ϕ0n (x) = const.
Normierung ⇒ ϕn (x) = ϕ̃n (x) = 0 für |x| → ∞
⇒ ϕn ϕ̃0n − ϕ̃n ϕ0n = 0
⇒
ϕ0n
ϕ̃0
= n ⇒ ϕn (x) = const. ϕ̃n (x) q.e.d.
ϕn
ϕ̃n
1.5.5 Der endlich tiefe Potentialtopf
U (x) =
−U0 für − L ≤ x ≤ L
0
für |x| > L
mit U0 > 0
E < 0: gebundene Zustände, E > 0: Streuzustände
Seite 20
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
a) E < 0
diskretes Spektrum von Energieeigenwerten En
SG: ϕ00 (x) = −k 2 (x)ϕ(x)
x < −L und x > L: k 2 (x) =
−L ≤ x ≤ L: k 2 (x) =
2m
E
~2
2m
(E + U0 )
~2
Lösungen dieser Gl.?
• U (x) symmetrisch: U (x) = U (−x) ⇒ ϕn (x) gerade oder ungerade Funktionen
• ϕn (x) : n − 1 Knoten
r
2m
−1
• U (x) ≡ 0 für |x| > L ⇒ |ϕn (x)| ∝ exp(−κ|x|) mit κ = l = − 2 En
~
nun quantitativ:
I) x < −L: klassisch verbotener Bereich:
k 2 (x) = −
2m
|E| = −κ2
~2
⇒ ϕ00 (x) − κ2 ϕ(x) = 0
⇒ ϕI (x) = A+ eκx +
A− e−κx
| {z }
→∞ für x→−∞⇒A− =0
⇒ ϕI (x) = A+ eκx
II) −L ≤ x ≤ L
k2 =
2m
(U0 − |E|) > 0
~2
ϕII (x) = B+ eikx + B− e−ikx
III) x > L
analog zu Bereich I: ϕIII (x) = C− e−κx , Stetigkeit von ϕ und ϕ0 bei x = ±L
(i) A+ e−κL = B+ e−ikL + B− eikL
(ii) C− e−κL = B+ eikL + B− e−ikL
(iii) κA+ e−κL = ik B+ e−ikL − B− eikL
(iv) −κC− e−κL = ik B+ eikL − B− e−ikL
Seite 21
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
4 Gleichungen in 4 Unbekannten
Lösungen mit gerader Parität: ϕ(x) = ϕ(−x)
⇒ A+ = C− = Ag , B+ = B− = Bg
⇒ Ag e−κL = 2Bg cos(kL)
⇒ κAg e−κL = 2Bg k sin(kL)
⇒κ=k
Bg =
sin(kL)
= k tan(kL) (*)
cos(kL)
e−κL
Ag
2cos(kL)
⇒ ϕg (x) =
Ag eκx
für − ∞ < x ≤ −L
e−κL
cos(kx)
Ag
cos(kL)
Ag e−κx
für − L ≤ x ≤ L
für L ≤ x < +∞
Konstante Ag aus Normierung, Energieeigenwerte aus Gl. (*)
Lösungen mit ungerade Parität: ϕ(x) = −ϕ(−x)
⇒ A+ = −C− = Au , B+ = −B− = Bu
analog zu eben: −κ = k cot(kL) (**)
Au eκx
e−κL
⇒ ϕu (x) = −Au
sin(kx)
sin(kL)
−Au e−κx
für − ∞ < x < −L
für − L ≤ x ≤ L
für L < x < +∞
Konstante Au aus Normierung ⇒ Au = Ag
Bestimmung der Energieeigenwerte:
definiere:
η = κL ⇒ η 2 =
2mL2
|E|
~2
ξ = kL ⇒ ξ 2 =
2mL2
(U0 − |E|)
~2
⇒ Gl. (*) und (**)
Seite 22
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
η = ξ tan ξ, η = −ξ cot ξ
numerische Lösung dieser Gleichungen liefert mögliche Energiewerte E
alternativ: graphische Lösung
ξ2 + η2 =
2mL2
U0 = R2 beschreibt Kreise mit Radius R
~2
Anzahl der Lösungen hängt von L und U0 ab! Endliche Anzahl von Lösungen.
Symmetrische Lösung existiert für beliebige Werte von R, antisymmetrische Lösungen nur für
R>
π
π 2 ~2
⇒ L2 U0 >
2
8m
b) E > 0
ϕ(x) rein oszillatorisch und nicht normierbar
→ keine stationären Zustände → Wellenpakete: Überlagerung der stationären Lösungen
kontinuierliches Spektrum von Energien.
Endliches Potential mit Breite L (Gebiet II), Wall links (Gebiet I) und Wall rechts (Gebiet III)
I,III: ϕ00 = −k02 ϕ mit k02 =
II: ϕ00 = −k 2 ϕ mit k 2 =
2m
E
~2
2m
(E + U0 )
~2
allgemeine Lösungen:
I: ϕI (x) = A+ eik0 x + A− e−ik0 x
II: ϕII (x) = B+ eikx + B− e−ikx
III: ϕIII (x) = C+ eik0 x + C− e−ik0 x
Betrachte nun eine Welle, die von −∞ kommend nach rechts läuft; im Gebiet III daher nur eine nach
rechts laufende Welle ⇒ C− = 0
ϕI (x) = A+ eik0 x + A− e−ik0 x
A+ : Amplitude der einlaufenden Welle
A− : Amplitude der reflektierten Welle
ϕIII (x) = C+ eik0 x
C+ : Amplitude der auslaufenden, transmittierten Welle
Seite 23
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Stetigkeitsbedingungen für ϕ, ϕ0 bei x = ±L:
(i) A+ e−ik0 L + A− e−ik0 L = B+ e−ikL + B− eikL
(ii) ik0 A+ e−ik0 L − A− eik0 L = ik B+ e−ikL − B− eikL
(iii) B+ eikL + B− e−ikL = C+ eik0 L
(iv) ik B+ eikL − B− e−ikL = ik0 C+ eik0 L
⇒ C+ =
e−i2k0 L A+
cos(2kL) − i
k02 +k2
2kk0 sin(2kL)
Transmissionskoeffizient: t =
T =
C+
A+
|C+ |2
= |t|2
|A+ |2
Wahrscheinlichkeit für die Transmission der einlaufenden Welle
2
k0 + k 2
−1
2
⇒ T = cos (2kL) +
sin2 (2kL)
| {z }
2kk0
=1−sin2 (2kL)
2m
2m
E und k 2 = 2 (E + U0 )
2
~
~
p
U02
2 2L
=1+
sin
2m(E + U0 )
4E(E + U0 )
~
setze k02 =
⇒ T −1
T = 1: “transparenter Bereich“, Resonanzen
2L p
2m(En + U0 ) = nπ mit n = 1, 2, 3, . . .
~
⇒ En + U0 =
π 2 ~2
n2
2m(2L)2
Energien En Resonanzen: destruktive Interferenz von bei x = −L und x = L reflektierten Wellen
Reflexionswahrscheinlichkeit: R =
|A− |2
= 1 − |t|2 mit T + R = 1
|A+ |2
physikalische Zustände ⇒ Streuung von Wellenpaketen
Z
Ausgangspunkt: freies Teilchen χ(x, t) =
ω=
dk
ϕ(k)eikx−iωt
2π
~k 2
, ϕ(k) um k = k0 zentriert
2m
Seite 24
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
Z
x < −L Ψ(x, t) = χ(x, t) +
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
dk
ϕ(k)A− ei(kx−ωt) ≈ χ(x, t) + A− (k0 )χ(−x, t)
2π
t >> 0 Ψ(x, t) ≈ A− (k0 )χ(−x, t)
Z
x>L
dk
ϕ(k)C+ (k)ei(kx−ωt) ≈ C+ (k0 )χ(x, t)
2π
1.5.6 Tunneleffekt
Potentialbarriere
0 < E < U0 : E =
~2 2
~2 2
k0 , U0 − E =
κ ⇒ Übungsaufgabe
2m
2m
Barriere groß: κL >> 1
2 p
16E(U0 − E)
exp − L 2m(U0 − E)
T ≈
~
U02
beliebige Potentialberge (T << 1) Zerlegung in N rechteckige Schwellen der Breite ∆x
T =
N
Y
i=1
(
N
2 Xp
2m(U (xi ) − E)∆x
Ti = exp −
~
)
i=1
2 Zb p
∆x → 0: T ≈ exp −
2m(U (xi ) − E)dx Gamow Faktor
~
a
1.6 Harmonischer Oszillator
1.6.1 ...in einer Dimension
klassisch: Kleine Auslenkung der Feder → Hook’sches Gesetz: F = −kx mit k = Federkonstante
1
1
k
→ Potential: U (x) = kx2 = mω 2 x2 mit ω 2 =
2
2
m
Bewegungsgleichung:
d2 x
+ ω2x = 0
dt2
allgemeine Lösung: x(t) = A sin(ωt) + B cos(ωt)
quantenmechanisch:
Ĥ = −
~2 d2
1
+ mω 2 x2 zeitunabhängige SG: Ĥϕ(x) = Eϕ(x)
2
2m dx
2
Seite 25
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Welche Lösungen erwarten wir?
•
•
•
•
gebundene Zustände, diskretes Energiespektrum (weil U (x) beschränkt)
U (x) ist symmetrisch [U (x) = U (−x)] → ϕ(x) ist entweder gerade oder ungerade
Wellenfunktion für angeregte Zustände mit 1, 2, 3, . . . Knoten
Verhalten der ϕn (x) für |x| → ∞?
1
siehe Kap. 5.1: |ϕ(x)| ∝ exp −
2
1
U0 = mω 2 ⇒ l =
2
~2
2mU0
41
=
|x|
l
~
mω
2 !
1
2
r
1 2
1 mω 2
mω
mit S =
⇒ |ϕ(x)| ∝ exp −
|x| ∝ − S
x
2 ~
2
~
1.6.2 Analytische Methode
SG mit dimensionsloser Variable ξ
2E
d2 ϕ(ξ)
= (ξ 2 − )ϕ mit =
2
dξ
~ω
1 2
Ansatz: ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ
dϕ
=
dξ
1 2
dh
− ξh e− 2 ξ
dξ
d2 ϕ(ξ)
=
dξ 2
⇒
1 2
d2 h
dh
2
− 2ξ
+ (ξ − 1)h e− 2 ξ
2
dξ
dξ
d2 h
dh
− 2ξ
+ ( − 1)h = 0
dξ 2
dξ
Potenzreihenansatz: h(ξ) =
∞
X
ak ξ k
k=0
∞
⇒
dh X
=
k ak ξ k−1
dξ
k=0
∞
X
d2 h
2
=
2
·
a
+
2
·
3
·
a
ξ
+
3
·
4
·
a
ξ
+
·
·
·
=
(k + 1)(k + 2)ak+2 ξ k
2
3
4
dξ 2
k=0
∞
X
⇒
((k + 1)(k + 2)ak+2 − 2kak + ( − 1)ak )ξ k = 0
k=0
Seite 26
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Koeffizienten vor jeder Potenz von ξ müssen verschwinden
⇒ (k + 1)(k + 2)ak+2 − 2kak + ( − 1)ak = 0
⇒ ak+2 =
(2k + 1 − )
ak Rekursionsbeziehung
(k + 1)(k + 2)
1
1
1
gerade Polynome: a2 = (1 − )a0 , a4 = (e − )a2 = (e − )(1 − )a0
2
12
24
⇒ hg (ξ) = a0 + a2 ξ 2 + a4 ξ 4 + . . . durch a0 bestimmt
ungerade Polynome:
⇒ hu = a1 ξ + a3 ξ 3 + a5 ξ 5 + ... durch a1 bestimmt.
vollständige Lösung: h(ξ) = hg (ξ) + hu (ξ)
1 2
ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ
Normierbarkeit? Rekursion für k groß: ak+2 ≈
k
2 !
k+2
2 !
=
2
k+2
k groß
≈
1 2
2
ak+2
2
ak ⇒
=
k
ak
k
2
1
⇒ ak ≈ C k k
2 !
⇒ ϕ(ξ) = h(ξ)e− 2 ξ = C
X 1
1 2
ξ 4 e− 2 ξ
k
2 !
| k {z }
=eξ2
Z∞
⇒
dξ|ϕ(ξ)|2 = ∞ nicht normierbar
−∞
Konsequenz: Damit ϕ(ξ) normierbar ist, muss die Reihe h(ξ) =
X
ak ξ k bei einem endlichen k
k
abgebrochen werden.
⇒ Es gibt ein kmax = n, für das gilt an+2 = 0, außerdem:
• n gerade ⇒ a1 = 0
• n ungerade ⇒ a0 = 0
an+2 = 0 wird gemäß der Rekursionsbeziehung durch 1 = 2n + 1 erfüllt
2E
=
⇒ En =
~ω
1
n+
~ω mit n = 0, 1, 2, 3, 4, . . . , ansonsten: nicht normierbare Lösungen
2
nun: Dgl. für hn (ξ) mit En = 2n + 1
Seite 27
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
Umbenennung: hn (ξ) → Hn (ξ)
⇒
d2 Hn
dHn
− 2ξ
+ 2nHn = 0 (H)
dξ 2
dξ
Hermitesche Dgl: Hn (ξ): Hermitesche Polynome
Bestimmung der Hn (ξ):
(1) differenziere Gl. (H) nach ξ ⇒
d2 dHn
d dHn
dHn
− 2ξ
+ 2(n − 1)
=0
dξ 2 dξ
dξ dξ
dξ
Dgl. für
⇒
dHn
entspricht Dgl. für Hn−1
dξ
dHn (ξ)
= CHn−1 (ξ) (*)
dξ
Konvention: Konstruiere Hn (ξ) so, dass der Vorfaktor zur höchsten Potenz von Hn (∝ ξ n ) gleich 2n
ist.
⇒ höchste Potenz auf beiden Seiten von Gl. (*)
d n n
2 ξ = n 2n ξ n−1 = c 2n−1 ξ n−1 ⇒ c = 2n
dξ
⇒
dHn
= 2nHn−1 (ξ) (E1)
dξ
(2) erzeugende Funktion: Definition: F (s, ξ) =
∞
X
Hn (ξ)
n=0
∞
dF (s, ξ) X 1
=
dξ
n!
dHn
dξ
| {z }
n=0
sn = 2
n!
sn
∞
X
Hn−1 n
s = 2sF
(n − 1)!
n=0
(E1)
= 2nHn−1
⇒ F (s, ξ) = F (s, 0)e2sξ
F (s, 0) =
X Hn (0)
n!
sn
Hn (0)? wähle Hn (0) so, dass Vorfaktor zu ξ n -Term gleich 2n ist.
⇒ Hn (0) =
0
für n ungerade
n n!
(−1) 2 n 2
!
für n gerade
Seite 28
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
1
⇒ F (x, 0)
∞
X
(−1)n
n!
n=1
⇒ F (x, ξ) = e
s2 +2ξ
s2n = e−s
MATERIEWELLEN UND SCHRÖDINGERGLEICHUNG
2
ξ 2 −(s−ξ)2
=e
=
∞
X
Hn (ξ)
n=0
n!
sn (E2)
dn −ξ2 −(s−ξ)2 (3) aus (E2) folgt: Hn (ξ) = n e
ds
s=0
Funktion f = f (s − ξ) ⇒
df
df
=−
ds
dξ
2
n −(s−ξ)
n
dn F (s, ξ)
2
ξ2 d e
n ξ2 d
=
e
=
(−1)
e
e−(s−ξ)
n
n
n
ds
ds
dξ
⇒
⇒ Hn (ξ) = (−1)n eξ
2
dn −ξ2
e
(E3) Rodrigues-Formel
dξ n
klar: Hn (ξ) = · · · + 2n ξ n
Hn (−ξ) = (−1)n Hn (ξ) mit n gerade, Hn gerade, sowie n ungerade, Hn ungerade
(4) Ü-Aufgabe:
Z∞
dξ Hn (ξ) Hm (ξ) e
−ξ 2
=
√ 0 n für n 6= m
π n! 2 für n = m
−∞
r
ξ=
r
⇒
mω
x
~
mω
~
Z∞
dx(Hn (x))2 e−
mω 2
x
~
=
√
π 2n n!
−∞
⇒ normierte Wellenfunktion
ϕn (x) =
mω 1
4
π~
√
1 mω 2
1
Hn (x)e− 2 ~ x
n
2 n!
Rodrigues: ⇒
H0
H1
H2
H3
=1
= 2ξ
= 4ξ 2 − 2
= 8ξ 3 − 12ξ
Seite 29
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
1.6.3 Zusammenfassung: eindimensionaler, harmonischer Oszillator
~2 d2
1
+ mω 2 x2
2m dx2 2
1
~ω mit n = 0, 1, 2, 3, 4, . . . , ansonsten: nicht normierbare
Energieeigenwerte: En = n +
2
Lösungen ϕ(x)
SG: Ĥϕ(x) = Eϕ(x), Ĥ = −
Eigenfunktion: ϕn (x) =
r
ξ=
mω 1
4
π~
√
1 mω 2
1
Hn (x)e− 2 ~ x
2n n!
mω
x
~
Hn (ξ) aus Rodrigues-Formel oder Rekursionsbeziehung (siehe Aufgabe 4.2):Hn (ξ) = (−1)ξ
2
dn −ξ2
e
dξ n
Eigenschaften:
1 mω 2
x
~
1. |x| → ∞ : ϕn (x) ∝ e− 2
2. U (x) = U (−x) ⇒ ϕn gerade oder ungerade Funktionen
3. Knotensatz erfüllt
Z∞
4. Funktionensystem {ϕn } orthonormal:
dx ϕn (x) ϕm (x) = δnm
−∞
5. + vollständig ⇒
Ψ(x, t)
| {z }
quadratintegrable Fkt.
=
∞
X
i
Cn ϕn (x) e− ~ En t
n=0
• Funktionensystem {ϕn (x)} Basis eines Vektorraums?
• ϕn (x) Eigenfunktion des Hamiltonoperators Ĥ: bilden solche Funktionen immer eine Basis?
• andere Basen möglich?
2 Formale Struktur der Quantenmechanik
2.1 Hilbertraum
quantenmechanischer
Z Funktionenraum: Raum der quadratintegrablen Wellenfunktionen:
d
H = {Ψ : R → C| d~r|Ψ(~r)|2 < ∞} mit d = Raumdimensionen
H Hilbertraum:
komplexer Vektorraum → linearer Raum (Superpositionsprinzip)
Seite 30
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
mit Skalarprodukt, der → orthogonale Zustände
vollständig und normiert → normierte Zustände
ist.
1. Vektorraum
a) Ψ1 , Ψ2 ∈ H ⇒ Ψ1 + Ψ2 ∈ H
b) Ψ ∈ H, α ∈ C ⇒ αΨ ∈ H
mit (a) ⇒ Ψ1 , Ψ2 ∈ H, α1 , α2 ∈ C ⇒ α1 Ψ1 + α2 Ψ2 ∈ H Linearität
ansonsten üblichen Vektorraumaxiome
2. Skalarprodukt
Ψ1 , Ψ2 ∈ H
Z
hΨ1 |Ψ2 i =
d~r Ψ∗1 (~r)Ψ2 (~r) mit folgenden Eigenschaften:
a) hΨ|Ψi ∈ R, hΨ|Ψi ≥ 0 nicht-negativ
hΨ|Ψi = 0 ⇒ Ψ = 0 damit positiv definiert
b) hΨ1 |Ψ2 i = hΨ2 |Ψ1 i∗
c) hΨ1 |α2 Ψ2 + α3 Ψ3 i = α2 hΨ1 |Ψ2 i + α3 hΨ1 |Ψ3 i
aus (b) und (c) folgt
hαΨ1 + α2 Ψ2 |Ψ3 i = α1∗ hΨ1 |Ψ3 i + α2∗ hΨ2 |Ψ3 i antilinear im ersten Argument
Schwarzsche Ungleichung:
|hΨ1 |Ψ2 i|2 ≤ hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i
Beweis: klar für Ψ1 = 0
Ψ1 6= 0: zerlege Ψ2 in Anteile parallel und senkrecht zu Ψ1
Ψ2 = λΨ1 + Ψ⊥
2
hΨ1 |Ψ⊥
2 i = 0, λ =
hΨ1 |Ψ2 i
hΨ1 |Ψ1 i
⊥
hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i = hΨ1 |Ψ1 i hλΨ1 + Ψ⊥
2 |λΨ1 + Ψ2 i
2
⊥
2
= hΨ1 |Ψ1 i {|λ2 | hΨ1 |Ψ1 i + hΨ⊥
2 |Ψ2 i} ≥ |λ| hΨ1 |Ψ1 i
Seite 31
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
= hΨ1 |Ψ1 i2
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
|hΨ1 |Ψ2 i|2
= |hΨ1 |Ψ2 i|2 q.e.d.
hΨ1 |Ψ1 i2
|hΨ1 |Ψ2 i|2 = hΨ1 |Ψ1 i hΨ2 |Ψ2 i falls Ψ⊥
2 = 0 oder Ψ2 = λΨ1
3. Skalarprodukt erzeugt eine Norm:
||Ψ|| =
p
hΨ|Ψi erfüllt Bedingungen an eine Norm.
a) ||Ψ|| ≥ 0, ||Ψ|| = 0 ⇒ Ψ = 0 nicht-negativ
b) homogen: ||αΨ|| = |α|||Ψ|| mit α ∈ C
c) ||Ψ1 + Ψ2 || ≤ ||Ψ1 || + ||Ψ2 || (folgt aus Schwarzscher Ungleichung)
4. vollständiger Vektorraum: Konvergenz von Funktionenfolgen in H
(Ψn )n∈N Ψn → Ψ mit n → ∞
↔ lim ||Ψn − Ψ|| = 0 Konvergenz im quadratischen Mittel
n→∞
Cauchyfolge: ||Ψn − Ψm || → 0 für n, m → ∞
H ist vollständig, da jede Cauchyfolge in H konvergiert.
5. vollständige Basis
Funktionensystem {un ∈ H} mit hun |um i = δnm
∀n, m bildet Basis, falls ∀Ψ ∈ H gilt: Ψ(~r) =
X
Cn un (~r)
n
H separabel → abzählbar viele Basisvektoren un
6. Fouriertransformierte von Ψ(~r)
1
Ψ(~r) =
| {z } (2π)3
∈H
Z
1
~
d~k Ψ̃(~k) eik·~r =
| {z }
(2π)3
Z
d~k Ψ̃(~k)un (~r)
∈H
~
Bilden Funktionen {uk (~r) ≡ eik·~r }
Basis von H? Nein, da uk (~r) 6∈ H → u0k s bilden eine uneigentliche Basis
7. physikalische Zustände
Vektoren in separablen Hilbertraum Ψ(~r, t) ∈ H mit t = const.
||Ψ|| = 1
Seite 32
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
Bemerkung: Wellenfunktionen, die sich um einen Phasenfaktor eiα vom Betrag 1 unterscheiden
sind äquivalent.
2.2 Lineare Operatoren
Betrachte im Folgenden Operatoren A, deren Definitionsbereich der gesamte Hilbertraum H ist.
Ziel: Zusammenhang: lineare Operatoren ↔ Messgrößen
1. Lineare Operatoren
A : H → H linear, wenn ∀Ψ1 , Ψ2 ∈ H und α, β ∈ C gilt
A(αΨ1 + βΨ2 ) = α(AΨ1 ) + β(AΨ2 )
Gegenbeispiel: AΨ = Ψ2
A(αΨ1 + βΨ2 ) = (αΨ1 + βΨ2 )2 6= αΨ21 + βΨ22
Definition: [A1 , A2 ] = A1 A2 − A2 A1 , i.a. [A1 , A2 ] 6= 0
2. Skalarprodukte
Z
hΨ1 |AΨ2 i =
d~r Ψ∗1 (~r) AΨ2 (~r)
Z
hA1 Ψ1 |A2 Ψ2 i =
hAi =
hΨ|AΨi
hΨ|Ψi
d~r (A1 Ψ1 )∗ (~r) (A2 Ψ2 )(~r)
||Ψ||=1
=
hΨ|AΨi
adjungierter Operator A†
hΨ1 |A† Ψ2 i = hAΨ1 |Ψ2 i
hA† Ψ1 |Ψ2 i = hΨ1 |AΨ2 i
Eigenschaften: (A† )† = A, (A1 A2 )† = A†2 A†1
3. hermitesche Operatoren
A = A† selbstadjungierte Operatoren
Beispiel: Impulsoperator in x-Richtung: px = −i~
Z
hΨ1 |px Ψ2 i =
d~r Ψ∗1 (~r)(−1)i~
∂
∂x
∂Ψ2 (~r)
∂x
Seite 33
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Z
partielle Integration: =
Z
=
∂Ψ1
d~r −i~
∂x
d~r i~
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
∂Ψ∗1 (~r)
Ψ2 (~r)
∂x
∗
Ψ2 (~r)
= hpx Ψ1 |Ψ2 i
⇒ px hermitesch; beachte Operator
∂
nicht hermitesch.
∂x
4. Eigenwerte und Eigenvektoren hermitescher Operatoren
AΨ = aΨ mit a ∈ C, 0 6= Ψ ∈ H und a = Eigenwert von A und Ψ = Eigenvektor von A
Eigenwerte hermitescher Operatoren sind reel:
Beweis: hΨ|AΨi = a hΨ|Ψi
hΨ|AΨi = hAΨ|Ψi = haΨ|Ψi = a∗ hΨ|Ψi ⇒ a = a∗
q.e.d.
hΨ|AΨi = hA† Ψ|Ψi
A selbstadjugiert (hermitesch): A = A† , AΨ = aΨ, A = A† ⇒ Eigenwert reell
• Eigenvektoren hermitescher Operatoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
Beweis: sei AΨ1 = a1 Ψ1 und AΨ2 = a2 Ψ2 mit a1 6= a2 ⇒
hΨ2 |AΨ1 i = a1 hΨ2 |Ψ1 i
hAΨ2 |Ψ1 i = a2 hΨ2 |Ψ1 i
andererseits: hΨ2 |AΨ1 i = hAΨ2 |Ψ1 i
⇒ (a2 − a1 ) hΨ2 |Ψ1 i = 0 ⇒ hΨ2 |Ψ1 i = 0 q.e.d.
• Entartung der Eigenwerte:
AΨ1 = aΨ1 , AΨ2 = aΨ2 , mit Ψ1 6= Ψ2
⇒ A(c1 Ψ1 + c2 Ψ2 ) = a(c1 Ψ1 + c2 Ψ2 )
Ψ1 , Ψ2 spannen Teilraum zu a (den sogenannten Eigenraum) auf → orthogonale Basis mit
Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren.
• Anzahl der Eigenwerte eines hermiteschen Operators höchstens abzählbar unendlich
– Separabilität von H
– Menge der Eigenwerte heißt diskretes Spektrum
Seite 34
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
• A selbstadjungiert mit rein diskreten Spektrum
– Eigenvektoren von A spannen den gesamten Hilbertraum H auf (Vollständigkeit)
2.3 Observablen
Observable: repräsentiert durch selbstadjungierten Operator, A = A† , z.B. Ort, Impuls, Energie, ...
Messgrößen: Eigenwerte a der Observablen, a ∈ R
• Erwartungswert: hAi = hΨ|AΨi
• Standardabweichung σA
2
Varianz σA
= h(A − hAi)2 i = hA2 i − hAi2
Bsp: ϕn stationärer Zustand
⇒ Ĥϕn = En ϕn , hϕn |ϕn i = 1
⇒ hĤi = hϕn |Ĥϕn i = En
2
hĤ 2 i − hĤi = 0 ⇒ En scharfer Messwert
kompatible Observablen:
A, B kompatible Observable ⇒ A, B besitzen gemeinsame Basis von Eigenzuständen
⇒ A, B gleichzeitig scharf messbar. Dann gilt:
[A, B] = A · B − B · A = 0
Beweis:
A fn = an fn
B fn = bn fn
⇒ fn Eigenfunktion von A und B
beliebige Funktion f ∈ H:
f=
X
cn fn
[A, B]f = (AB −BA)
X
cn fn = A
X
cn bn fn −B
X
cn an fn =
X
an cn bn fn −
X
cn an bn fn = 0
⇒ [A, B] = 0
inkompatible Observablen: [A, B] 6= 0
Seite 35
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
A, B besitzen keine gemeinsame Basis von Eigenzuständen.
2.4 Heisenbergsche Unschärferelation
A, B selbstadjungierte Operatoren mit [A, B] 6= 0, Dann gilt:
2
σA
2
σB
1
≥
h[A, B]i
2i
2
Beweis:
2
σA
= hΨ|(A − hAi)2 Ψi = h(A − hAi)Ψ | (A − hAi)Ψi = hf |f i
|
{z
} |
{z
}
f
=f
2
= hg|gi mit g = (B − hBi)Ψ)
analog: σB
2
2
Schwarzsche Ungleichung ⇒ σA
σB
= hf |f i hg|gi ≥ |hf |gi|2
2
2
2
2
z ∈ C: |z| = [Re z] + [Im z] ≥ [Im z] =
setze z = hf |gi ⇒
2
σA
2
σB
1
(z − z ∗ )
2i
1
(hf |gi − hg|f i)
≥
2i
2
hf |gi = h(A − hAi)Ψ|(B − hBi)Ψi = hΨ|(A − hAi)(B − hBi)Ψi
= hΨ|(AB − A hBi − B hAi + hAi hBi)Ψi = hΨ|ABΨi − hBi hΨ|AΨi − hAi hΨ|BΨi + hAi hBi hΨ|Ψi
| {z }
=1
= hABi − hBi hAi − hAi hBi + hAi hBi = hABi − hAi hBi
2
1
2
2
analog: hg|f i = hBAi − hAi hBi ⇒ σA
σB
≥ hAB
− BA}i q.e.d
| {z
2i
=[A,B]
Beispiel: A = x Ort, B = p = −i~
[x, p]Ψ(x) = −i~x
⇒ [x, p] = i~ ⇒
d
Impuls
dx
dΨ
d
dΨ
dΨ
+ i~ (xΨ(x)) = −i~x
+ i~Ψ(x) + i~x
= i~Ψ(x)
dx
dx
dx
dx
σx2
σp2
2
~
~
≥
⇒ σx σp ≥
2
2
Bsp. harmonischer Oszillator
Grundzustand: ϕ0 (x) =
mω 1
2
π~
1 mω 2
x
~
e− 2
Seite 36
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
r
q
~
2
2
σx = hx i0 − hxi0 =
2mω
r
q
m~ω
2
σp = hp2 i0 − hpi0 =
2
⇒ σx σp =
~
2
2.5 Harmonischer Oszillator - Lösung mit algebraischer Methode
Ĥϕ = Eϕ, Ĥ =
1 2
d
[p̂ + (mωx)2 ], p̂ = −i~
2m
dx
Idee: versuche Ĥ zu faktorisieren
â = √
1
(ip̂ + mωx)
2~mω
↠= √
1
(−ip̂ + mωx)
2~mω
⇒ â↠=
1
1
1
1
(ip̂ + mωx)(−ip̂ + mωx) =
(p̂2 + (mωx)2 − imω [x, p̂]) =
Ĥ +
| {z }
2~mω
2~mω
~ω
2
=i~
1
1
†
†
, analog: Ĥ = ~ω â â +
⇒ Ĥ = ~ω ââ −
2
2
Kommutator: [â, ↠] = â↠− ↠a =
1
Ĥ
1
Ĥ
+ −
+ =1
~ω 2 ~ω 2
zeige nun: ↠ϕ löst SG zu Eigenwert E + ~ω
1
Ĥ(â ϕ) = ~ω â â +
2
†
†
1 †
†
†
(â ϕ) = ~ω â ââ + â ϕ
2
†
1
1
= ~ω↠|{z}
â↠+ ϕ = ↠~ω ↠â + + 1 ϕ = ↠(Ĥ + ~ω)ϕ = ↠(E + ~ω)ϕ = (E + ~ω)(↠ϕ)
2
2
=1+↠â
analog: Ĥ(âϕ) = (E − ~ω)(âϕ)
⇒ â: Absteigeoperator, ↠: Aufsteigeoperator, â, ↠heißen Leiteroperatoren
E + 2~ω = (↠)2 ϕ
E + ~ω = ↠ϕ
E=ϕ
E + ~ω = âϕ
E − 2~ω = â2 ϕ
Seite 37
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Grundzustand ϕ0 ⇒ âϕ0 = 0 ⇒ √
⇒
1
2~mω
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
d
~
+ mωx ϕ0 = 0
dx
dϕ0
mω
=−
xϕ0
dx
~
mω
⇒ ϕ0 (x) = Ce− 2~ x
2
Z
Konstante aus Normierung:
1
zug. Energie: ~ω â â +
2
†
dx |ϕ(x)|2 = 1 ⇒ ϕ0 (x) =
mω 1
4
π~
mω
e− 2~ x
2
ϕ0 = E0 ϕ0 mit âϕ0 = 0
1
⇒ E0 = ~ω
2
angeregte Zustände aus Grundzustand:
1
1
ϕn (x) = Cn (â ) ϕ0 (x) , En = ~ω n +
→ ϕn = √ (â†n )ϕ0
2
n!
† n
↠ϕn =
âϕn =
Z
√
√
n + 1ϕn+1
nϕn−1
dx ϕ∗n (x)ϕn (x) = 1 = hϕ|ϕi
0
Z
d
H = {Ψ : R → C|
d~r|Ψ(~r)|2 < ∞}
1 x=0
0 sonst
0
f (x) ∈ H , aber
Z
dx|f (x)|2 = 0 → auf H0 Halbnorm definiert
Nullfunktionen:
Z
0
N = {f ∈ H | d~r|f |2 = 0}
H = H0 /N Quotientenraum
→ Äquivalenzklassen von Funktionen, die sich nur auf Nullmengen unterscheiden.
Ψ1 ∼ Ψ2 ↔ Ψ1 − Ψ2 ∈ N ↔ ||Ψ1 − Ψ2 || = 0
→ Einheitsstrahlen im Hilbertraum: [Ψ] = {eiα Ψ : Ψ ∈ H, ||Ψ|| = 1, α ∈ R}
Seite 38
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
â = √
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
1
(ip̂ + mωx)
2~mω
1
(−ip̂ + mωx)
2~mω
1
1
†
†
Ĥ = ~ω ââ −
= ~ω â â +
2
2
↠= √
1
→ En = ~ω n +
2
ϕn (x) = Cn (↠)n ϕ0 (x)
Bestimmung der Cn :
• ↠ϕn = en ϕn+1 , âϕn = fn ϕn−1 , en , fn Konstanten
1
• Ĥϕn = ~ω n +
2
ϕn
1
1
†
~ω ââ −
ϕn = ~ω n +
ϕn
2
2
⇒ â↠ϕn = (n + 1)ϕn
1
1
• ~ω ↠â +
ϕn = ~ω n +
ϕn ⇒ ↠âϕn = nϕn
2
2
h↠ϕn |↠ϕn i = |en |2 hϕn+1 |ϕn+1 i = hâ↠ϕn |ϕn i = (n + 1) hϕn |ϕn i
⇒ |en |2 = (n + 1) ⇒ en =
√
n + 1 ⇒ ↠ϕn =
√
n + 1ϕn+1
• hâϕn |âϕn i = |fn |2 hϕn−1 |ϕn−1 i = h↠âϕn |ϕn i = n hϕn |ϕn i
⇒ âϕ =
√
• ϕn+1 = √
nϕn−1
1
↠ϕn
n+1
ϕ1 = ↠ϕ0
1
1
ϕ2 = √ ↠ϕ1 = √ (↠)2 ϕ0
2
2
ϕ3 = √
1
(↠)3 ϕ0
3·2
ϕ4 = √
1
(↠)4 ϕ0
4·3·2
Seite 39
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
1
⇒ ϕn = √ (↠)n ϕ0
n!
Bemerkungen:
• 3-dimensionale harmonischer Oszillator: wichtiges Modell in der Festkörperphysik zur
Beschreibung von Gitterschwingungen im harmonischen Festkörper
• Leiteroperatoren wichtig zur Beschreibung von fermionischen und bosonischen
Vielteilchensystemen
2.6 Zeit - Energie - Unschärferelation
wir hatten: A, B selbstadjungierte Operatoren mit [A, B] 6= 0
2 2
σA
σB
≥
2
1
h[A, B]i
2i
2 2
σA
σB : Standardabweichungen der Observablen A und B bzgl. Messung an identisch präparierten
Systemen
Beispiel: A = x, B = −i~
⇒ σx σp ≥
d
= p̂
dx
~
2
betrachte nun zeitliche Entwicklung des Erwartungswertes eines Operators O
d
d
∂
d<O>
=
hΨ|OΨi “hereinziehen“ der Ableitung ⇒
→
dt
dt
dt
∂t
∂Ψ
∂t
|{z}
=h
|OΨi + hΨ|
∂O
∂Ψ
Ψi + hΨ|O
i
∂t
∂t
i~ ∂Ψ
=ĤΨ
∂t
=−
1
1
∂O
hĤΨ|OΨi + hΨ|OĤΨi + h
i
ih | {z } i~
∂t
=hΨ|ĤOΨi
=
⇒
i
∂O
h[Ĥ, O]i + h
i
~
∂t
d<O>
i
∂O
= h[Ĥ, O]i + h
i
dt
~
∂t
Sei nun O selbstadjungiert und nicht explizit zeitabhängig, d.h. h
⇒
2 2
σH
σO
≥
∂O
i=0
∂t
2 2 1
1 ~d<O > 2
~
d<O> 2
h[Ĥ, O]i =
=
2i
2i i
dt
2
dt
Seite 40
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
~ d < O > ⇒ σH σO ≥ 2
dt
Definitionen: σH ≡ ∆E
d < O >
∆t
σO = dt
∆t: Zeitdauer, auf der sich der Erwartungswert < O > um eine Standardabweichung σO ändert.
⇒ ∆E · ∆t ≥
~
2
Bsp: betrachte Linearkombination zweier stationärer Zustände
i
i
Ψ(x, t) = C1 ϕ1 (x)e− ~ E1 t + C2 ϕ2 (x)e− ~ E2 t
⇒ |Ψ(x, t)|2 = C12 |ϕ1 (x)|2 + C22 |ϕ2 (x)|2 + 2C1 C2 ϕ1 (x)ϕ2 (x)cos
Ü-Aufg.
⇒
∆t =
E2 − E1
t
~
2π~
, ∆E = E2 − E1 ⇒ ∆E · ∆t = 2π~
E1 − E2
2.7 Dirac-Notation und Postulate der Quantenmechanik
Betrachte Vektoren in 2 Dimensionen
~v : abstrakter Vektor, darstellbar in unendlich vielen Basen
v
~v = ~v · êx + ~v · êy = x mit ê = Einheitsvektoren
vy
v 0
~v = ~v · êx0 + ~v · êy0 = x
vy 0
beachte: Skalarprodukt invariant unter Basiswechsel
nun: Darstellung von Wellenfunktionen als “abstrakte Vektoren“
|Ψi ∈ H: ket-Vektor, jedem ket-Vektor ist ein bra-Vektor hΨ| zugeordnet
hΨ| |Ψi bra(c)ket, formal: hΨ| = (|Ψi)† ; (|Ψi)†† = |Ψi
Bemerkungen:
• bra-Vektoren spannen den zu H dualen Vektorraum H∗ auf
• analog in endlich-dim. Vektorräumen
Seite 41
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
v1
v2
ket: |vi = .
..
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
bra: hv| = (v1∗ , v2∗ , . . . , vn∗ )
vn
• Skalarprodukt hΨ1 |Ψ2 i
• Erwartungswert eines Operators A
< A >Ψ = hΨ|AΨi = hΨ|A|Ψi
• Dualraum H∗ alle beschränkten und linearen Funktionale T : H → C
Z
hΨ| = Ψ∗ dx angewandt auf |χi ∈ H
Z
⇒
Ψ∗ χ dx = hΨ|χi ∈ C
0
..
.
• Sei {|ni} diskrete Orthonormalbasis |ni analog zu Einheitsvektor
1 mit n-te Stelle = 1
..
.
⇒ hm|ni = δmn
|Ψi in dieser Basis |Ψi =
X
Cn |ni Vollständigkeit
n
Cn = hn|Ψi ∈ C ⇒ |Ψi =
X
|ni hn|Ψi ⇒ Vollständigkeitsrelation
n
X
|ni hn| = 1
n
• Definition: Projektionsoperator:
P̂Ψ = |Ψi hΨ| angewandt auf |χi:
P̂Ψ |χi = |Ψi hΨ|χi
Eigenschaften: P̂Ψ
1. P̂Ψ2 = P̂Ψ
2. P̂ selbstadjungiert
3. mögliche Eigenwerte λ = 0 und λ = 1
ket |Ψi ∈ H, bra hχ| ∈ H∗
Seite 42
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
ket Ψ =
X
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
|ni hn|Ψi
n
X
|ni hn| = 1
n
Postulate der Quantenmechanik
1. physikalische (reine) Zustände entsprechen Einheitsstrahlen im Hilbertraum
[Ψ] = {eiα Ψ : Ψ ∈ H, ||Ψ|| = 1, α ∈ R}
2. Observablen werden durch selbstadjungierte Operatoren repräsentiert, Messwerte durch
Eigenwerte solcher Operatoren
3. zeitliche Entwicklung von Zuständen
SG: i~
∂
|Ψi = Ĥ |Ψi mit Ĥ= Hamiltonoperator
∂t
4. Zustandsreduktion
hAiΨ = hΨ|AΨi
Messung
=
a: Eigenwert zum Eigenzustand |ai von A mit A = A†
⇒ System geht bei der Messung in den Zustand |ai über.
Betrachte Eigenzustände |ni zu Operator A:
A |ni = an |ni (Beispiel: Ĥ |ni = En |ni)
⇒ |Ψi =
X
|ni hn|Ψi =
n
X
Cn |ni
n
Bedeutung der Koeffizienten Cn = hn|Ψi?
Messung von A im Zustand |Ψi liefert einen der Eigenwerte a1 , a2 , a3 , . . .
Behauptung: |Cn |2 ist die Wahrscheinlichkeit Pn , bei der Messung von A den Eigenwert an zu finden.
Pn = |Cn |2 mit
X
Pn = 1
n
Beweis: hAiΨ = hΨ|A|Ψi =
X
m,n
analog: hAk i =
hΨ|mi hm|A|ni hn|Ψi =
| {z }
=an δmn
X
n
an hΨ|ni hn|Ψi =
| {z } | {z }
∗
=Cn
=Cn
X
an |Cn |2
n
X
|Cn |2 (an )k
n
h1i = hΨ|Ψi = 1 =
X
|Cn |2 ⇒ Beh. q.e.d
n
Seite 43
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
allgemein: p(α → β) = |hβ|αi|2
Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Messung an Zustand |αi dieser in den Zustand |βi übergeht.
hβ|αi heißt Übergangsamplitude
2.8 Das Spektrum selbstadjungierter Operatoren
1) A selbstadjungiert, d.h. A = A†
A |Ψi = a |Ψi
Eigenvektor: |Ψi ∈ H
Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten zueinander orthogonal → diskretes Spektrum von
reellen Eigenwerten
2) Impulsoperator
p̂x = −i~
∂
, p̂x = p̂†x
∂x
Eigenwertgleichung für p̂x
−i~
∂
ϕ(x) = pϕ(x) mit p: Impuls-Eigenwert
∂x
Eigenvektoren? → Ebene Wellen
i
ϕ(x) = N e ~ px = N eikx = N uk (x)
p = ~k
Problem: uk (x) nicht normierbar ⇒ uk (x) 6∈ H
uk (x): uneigentlicher Eigenvektor
p = ~k uneigentlicher Eigenwert
→ kontinuierliches Spektrum
→ Menge der uneigentlichen Eigenwerte bildet kontinuierliches Spektrum
Z
→ Kontinuums-Orthonormalitätsbeziehung huk |ul i =
Z
→ Vollständigkeit: ϕ(x) =
Z
ϕ̃(k) =
dy
ϕ(y)u∗k (y)
dx e−i(k−l)x = 2πδ(k − l)
dk
ϕ̃(k)uk (x)
2π
Z
⇒ ϕ(x) =
Z
dy ϕ(y)
dk ∗
u (y)uk (x)
2π k
Seite 44
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Z
⇒
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
dk
uk (x)u∗k (y) = δ(x − y)
2π
Vollständigkeitsrelation → Erweiterung der Dirac-Notation auf Vektoren, die nicht aus H sind.
uk → |ki
p̂ |ki = ~k |ki
Orthonormalität hk|k 0 i = 2πδ(k − k 0 )
Z
dk
|ki hk| = 1
2π
Vollständigkeit:
Z
dx e−ikx ⇒ hk|Ψi =
bra-Vektor: hk| =
Z
dx e−ikx Ψ(x) = Ψ̃(k)
Ψ̃(k) Fouriertransformierte von Ψ(x)
Z
Ψ(x) =
dk
Ψ̃(k)e−ikx
2π
Es gilt die Parsevalsche Gleichung
Z
Z
∗
dx Ψ (x)χ(x) =
Z
also insbesondere:
Z
Beweis:
Z
=
dk ∗
Ψ̃ (k)χ̃(k)
2π
dx |Ψ(x)|2
Z
∗
dx Ψ (x)χ(x) =
Z
dx
Z
dk ∗
Ψ̃ (k)
dx χ(x)e−ikx =
2π
{z
}
|
dk ∗
Ψ̃ (k)e−ikx χ(x)
2π
Z
dk ∗
Ψ̃ (k)χ̃(k) q.e.d.
2π
=χ̃(k)
⇒ bis auf Faktor
1
gleiche Norm in Orts- und Impulsraum (k-Raum)
2π
3) Ortsoperator
Ortsoperator Q̂: Multiplikationsoperator auf Wellenfunktion Ψ(x)
Q̂Ψ(x) = xΨ(x) (keine Eigenwertgleichung!)
Eigenfunktion ±-werte von Q̂?
Q̂χq (x) = qχq (x) ∀x ∈ R mit q: Eigenwert von Q̂
| {z }
=xχq (x)
Seite 45
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
⇒ (x − q)χq = 0
⇒ x 6= q ⇒ χq = 0
⇒ χq Deltafunktion χq (x) = δ(x − q) 6∈ H
Dirac-Notation: χq (x) → |qi
Q̂ |qi = q |qi
|qi uneigentlicher Eigenvektor
q uneigentlicher Eigenwert
analog zu Impulseigenfunktion:
Z
0
1) hq|q i =
dx δ(x − q)δ(x − q 0 ) = δ(q − q 0 )
Z
2) Vollständigkeit:
dq χq (x)χq (x)χ∗q (y) =
Z
dq δ(x − q)δ(y − q) = δ(x − y)
Z
dq |qi hq| = 1
Z
3) bra-Vektor: hq| =
dx δ(x − q)
Z
hq|Ψi =
dx δ(x − q)Ψ(x) = Ψ(q) oder
Z
hx|Ψi =
dq δ(q − x)Ψ(q) = Ψ(x)
4) Warum uneigentliche Eigenvektoren?
→ wichtig für Beschreibung von Streuzuständen (z.B. ebene Welle beim freien Teilchen)
→ Darstellung von beliebigem Vektor ∈ H (→ endlicher Potentialtopf)
5) Spektralsatz
Sei A selbstadjungierter Operator
Ψa : eigentlicher oder uneigentlicher Vektor zum Eigenwert a
Es gilt:
1. Spektrum von A rein reell
2. Orthogonalität hΨa |Ψb i = 0 für a 6= b
Seite 46
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
3. Vollständigkeit: eigentliche und uneigentliche Eigenvektoren spannen den ganzen Hilbertraum
auf. ⇒ |Ψi ∈ H
|Ψi =
X
Z
|ni hn|Ψi +
da |ai ha|Ψi
n
Vollständigkeitsrelation:
X
Z
|ni hn|Ψi +
da |ai ha| = 1
n
6) Spektraldarstellung von Operatoren
A = A† mit rein diskretem Spektrum ⇒ a |ni = an |ni
Zerlegung in Projektoren
A=A
X
|ni hn| =
X
n
an |ni hn|
n
allgemeines Spektrum: A =
X
Z
an |ni hn| +
da a |ai ha|
n
7) Wahrscheinlichkeitsinterpretation
rein diskretes Spektrum: Pn = |hn|Ψi|2 = Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Messung |Ψi in den
Eigenzustand |ni übergeht.
Z
A mit kontinuierlichem Spektrum: hAiΨ = hΨ|A|Ψi =
da da0 hΨ|ai ha|A|a0 i ha0 |Ψi
| {z }
a0 δ(a−a0 )
Z
=
Z
da hΨ|ai a ha|Ψi =
da |ha|Ψi|2 a
⇒ |ha|Ψi|2 = Wahrscheinlichkeitsdichte P (a) für den Messwert a
Beispiel: |ha|Ψi|2 = |Ψ(x)|2 = Wahrscheinlichkeitsdichte für x
2.9 Darstellung von Zuständen und Operatoren in verschiedenen Basen
(1) “abstrakter“ Zustand |Ψi ∈ H kann im allgemeinen wie folgt dargestellt werden:
|Ψi =
X
n
Z
|ni hn|Ψi +
| {z }
Ψn
da |ai ha|Ψi
| {z }
Ψ(a)
Ψn : Komponenten von |Ψi in diskreter Basis
Ψ(a): Komponenten von |Ψi in kontinuierlicher Basis
Seite 47
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
Bsp: endlicher Potentialtopf
X
|Ψi =
Z
|ni Ψn
| n {z
+
}
E>0 Streuzustände
E<0 gebundene Zustände
Ψ(x) = hx|Ψi =
X
n
dk
|ki Ψk
2π
{z
}
|
Z
dk
hx|ki Ψk (x)
2π | {z }
hx|ni Ψn (x) +
| {z }
=Cn
=eikx
Linearer Operator A in Spektraldarstellung: |ni , |ai Eigenvektoren des Operators A
⇒A=
Z
X
an |ni hn| +
da a |ai ha|
n
allgemein: → diskretes Spektrum
A=
X
|ni
n,m
hn|A|mi
| {z }
hm| =
X
|ni An,m hm|
n,m
MatrixelementeAn,m
X
Produkt zweier Operatoren: AB =
n,m,l
|ni hn|A|mi hm|B|li hl| =
| {z } | {z }
Z
→ Kontinuierliches Spektrum: A =
An,m
Z
da
Bm,l
X
n,m,l
|ni
Anm Bml
| {z }
hl|
Matrixmultiplikation
da0 ha| ha|A|a0 i ha0 |
→ auch wichtig: “gemischte“ Matrixelemente ha|A|ni
(2) Ortsdarstellung: Wellenfunktion Ψ(x) = hx|Ψi
linearer Operator A in Spektraldarstellung
Z
A=
Z
dx
0
0
Z
0
dx |xi hx|A|x i hx | =
| {z }
Z
dx
dx0 |xi A(x, x0 ) hx0 |
A(x,x0 )
Z
(AΨ)(x) = hx|A|Ψi =
0
0
Z
0
dx hx|A|x i hx |Ψi =
dx0 A(x, x0 )Ψ(x0 )
Z
Ortsoperator: Q̂ =
dx |xi x hx| (diagonal)
oder Q(x, x0 ) = hx|Q̂|x0 i = x0 hx|x0 i = x0 δ(x − x0 ) = xδ(x − x0 )
Z
Impulsoperator: (P̂ Ψ)(x) = hx|P̂ |Ψi =
i
dk
hx|ki hk|P̂ |Ψi
2π
p=~k
hx|ki = e ~ px = eikx
(kompatibel mit Orthonormalitätsbedingung hk|k 0 i = 2πδ(k − k 0 ))
Seite 48
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Z
dk ikx
e ~k hk|Ψi =
2π
⇒ (P̂ Ψ)(x) =
Z
Z
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
dk ~ ∂ ikx
e hx|Ψi
2π i ∂x
dk
∂
∂
(−)i~
hx|ki hk|Ψi = −i~ Ψ(x)
2π
∂x
∂x
=
∂
in Ortsdarstellung
∂x
!
P̂ 2
~2 ∂ 2
P̂ 2
Ψ(x)
Ψ (x) = hx|
|Ψi = −
(
2m
2m
2m ∂x2
⇒ P̂ = −i~
analog:
~2
−
2m
∂2
∂x2
kinetische Energie in Ortsdarstellung
Zeitentwicklung von abstraktem Zustand |Ψ(x)i
⇒ SG: i~
∂
P̂ 2
|Ψ(x)i = Ĥ |Ψ(t)i mit Ĥ =
+ U (Q̂) mit Q̂: Ortsoperator
∂t
2m
⇒ Ortsdarstellung
hx|i~
∂
∂
|Ψ(t)i = i~ hx|Ψ(t)i = hx|Ĥ|Ψ(t)i
∂t
∂t | {z }
=Ψ(x,t)
hx|Ĥ|Ψ(t)i = −
~2 ∂ 2 Ψ(x, t)
+ hx|U (Q̂)|Ψ(t)i
|
{z
}
2m ∂x2
=U (x)Ψ(x,t)
⇒ i~
∂Ψ(x, t)
=
∂t
~2 ∂ 2
−
+
U
(x)
Ψ(x, t)
2m ∂x2
|Ψ(x, t)|2 = |hx|Ψ(t)i|2 = Wahrscheinlichkeitsdichte, das System zur Zeit t am Ort x zu finden.
(3) Impulsdarstellung
Impulseigenzustände |ki → |pi
Ψ(p, t) = hp|Ψ(t)i; p̂ |pi = p |pi
Z
p̂ =
dk
|pi p hp| diagonal
2π
klar: hp|i~
hp̂|
∂
∂
|Ψ(t)i = i~ Ψ(p, t)
∂t
∂t
p̂2
p2
p2
|Ψ(t)i =
hp|Ψ(t)i =
Ψ(p, t)
2m
2m
2m
Ortsoperator in Impulsdarstellung:
Seite 49
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Z
Z
hp|Q̂|Ψ(t)i =
∂
= i~
∂p
Q̂ = i~
dx hp|xi hx|Q̂|Ψ(t)i =
Z
dx hp|xi hx|Ψ(t)i = i~
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
i
dxe− ~ px x hx|Ψ(t)i =
Z
dx i~
∂ − i px
e ~ hx|Ψ(t)i
∂p
∂
Ψ(p, t)
∂p
∂
Ortsoperator in Impulsdarstellung
∂p
∂
analog: hp|U (Q̂)|Ψ(t)i = U i~
Ψ(p, t)
∂p
⇒ SG in Impulsdarstellung
∂
i~ Ψ(p, t) =
∂t
p2
+U
2m
∂
Ψ(p, t)
i~
∂p
1
1
|Ψ(p, t)|2 =
|hp|Ψ(t)i|2 = Wahrscheinlichkeitdichte für System zur Zeit t mit Impuls p
2π
2π
Bemerkung:
∂
kompliziert und daher S’G in Impulsdarstellung schwieriger zu lösen
i.a. ist der Operator U i~
∂p
als die in Ortsdartellung
Ausnahme:
→ freies Teilchen U (Q̂) = 0
→ harmonischer Oszillator U (Q̂) =
mω 2 2
Q̂
2
(4) Energiedarstellung: diskrete Eigenzustände des Hamiltonoperators Ĥ |ni = EN |ni
Komponenten des Zustands |Ψi ∈ H in dieser Basis: ϕn = hn|Ψi
→ Lösungen der stationären SG
ϕ0
ϕ1
|Ψi = ϕ
2
..
.
Hamiltonoperator in dieser Darstellung: Ĥ =
X
n,m
=
X
|ni
hn|Ĥ|mi
| {z }
|mi
=Em hn|mi=Em δnm
|ni En hn|
n
Seite 50
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
E0
E1 0
Matrixdarstellung: Ĥ =
E2
0
...
Ĥ diagonal in dieser Basis → Lösung der SG durch Diagonalisieren des Hamiltonoperators
(5) Basiswechsel: Wechsel zwischen diskreten Basen: {|vn i}n∈N , {|um i}m∈N
betrachte: |Ψi ∈ H
|Ψi =
X
|vn i hvn |Ψi =
X
|vn i Ψ(vn )
n
n
X
Ψ(um ) = hum |Ψi =
n
hum |vn i hvm |Ψi
| {z } | {z }
=Umn
Ψ(vn )
entsprechend:
(mit Anm → A∗mn )
Ψ(vn ) = hvn |Ψi
=
X
m
=
X
hvn |um i
| {z }
Ψ(um )
†
=hum |vn i∗ =Umn
†
Unm
Ψ(um )
m
(U U † )kl =
X
†
=
Ukn Unl
X
huk |vn i hvn |ul i = huk |ul i = δkl
n
n
⇒ U −1 = U † mit U unitärer Operator
Basiswechsel von Operatoren: Operator A in u-Basis:
(u)
Akl = huk |A|ul i =
X
m, n huk |vm i hvm |A|vn i hvn |ul i =
X
†
m, nUkm A(v)
mn Unl
⇒ A(u) = U A(v) U †
Bemerkung:
(1) Das Skalarprodukt ist invariant unter unitärer Transformation
†
hU ϕ|U Ψi = hϕ| U
U |Ψi = hϕ|Ψi
|{z}
=1
→ U beschreibt verallgemeinerte Drehung im Hilbertraum
(2) → U unitär → Transformation zwischen verschiedenen Orthonormalbasen
Seite 51
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
2.10 Zeitliche Entwicklung von Quantensystemen
2.10.1 Zeitentwicklungsoperator
SG: i~
∂
|Ψ(t)i = Ĥ |Ψ(t)i
∂t
|Ψ(t)i ∈ H mit hΨ(t)|Ψ(t)i = 1 ∀t
Ansatz: beschreibe Zeitentwicklung des Zustandes |Ψi durch Operator U , U unitär: U −1 = U †
|Ψ(t)i = U (t, t0 ) |Ψ(t0 )i mit t > t0
Eigenschaften von U (t, t0 ):
!
1. Norm: hΨ(t)|Ψ(t)i = hΨ(t0 )|U † (t, t0 )U (t, t0 )|Ψ(t0 )i = hΨ(t0 )|Ψ(t0 )i = 1
⇒ U † (t, t0 )U (t, t0 ) = 1 mit U : Unitär
Zeitentwicklung entspricht einer “Drehung“ im Hilbertraum.
2. U (t0 , t) = 1
3. U (t0 , t0 ) = U (t0 , t)U (t, t0 )
t0 = t0 ⇒ 1 = U (t0 , t)U (t, t0 )
⇒ U (t, t0 ) = U −1 (t0 , t) = U † (t0 , t)
⇒ U † beschreibt Zeitentwicklung mit umgedrehter Zeitachse.
4. abgeschlossenes, konservatives System
→ Zeitnullpunkt nicht ausgezeichnet ⇒ U (t, t0 ) = U (t − t0 ), setze nun t0 = 0
Annahme: Hamiltonoperator Ĥ nicht explizit zeitabhängig
SG: i~
i~
∂
|Ψ(t)i = Ĥ |Ψ(t)i
∂t
∂
U (t) |Ψ(0)i = ĤU (t) |Ψ(0)i
∂t
i
Lösung: U (t) = e− ~ Ĥt
U (t) unitär, da Ĥ hermitescher Operator
i Zt
Bem: Ĥ explizit zeitabhängig ⇒ U (t) = exp −
dt0 H(t0 )
~
0
Seite 52
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
{|ni} vollständiges Orthonormalsystem zum Hamiltonoperator Ĥ
Ĥ |ni = En |ni
→ Ĥ in Spektraldarstellung: Ĥ =
X
Ĥ |ni hn| =
X
→ Zeitentwicklungsoperator: U (t) =
En |ni hn|
n
n
X
i
e− ~ En t |ni hn|
n
→ betrachte Zustand: |Ψ(0)i =
X
Cn (0) |ni
n
|Ψ(t)i = U (t) |Ψ(0)i =
X
i
e− ~ Em t |mi hm|ni hn|ni cn (0) =
m,n
X
i
e− ~ En t Cn (0) |ni =
n
X
Cn (t) |ni
n
i
⇒ Cn (t) = Cn (0)e− ~ En t
Schrödingerbild: Betrachtung von zeitabhängigen Zuständen und zeitunabhängigen Observablen
2.11 Heisenbergbild
Idee: Basiswechsel durch unitäre Transformation, so dass nun Zustände zeitunabhängig und
Observablen (Operatoren) zeitabhängig werden.
|Ψ(t)i
| {z }
→
Schrödingerbild
|ΨH i
| {z }
= U † (t) |Ψ(t)i = |Ψ(0)i
Heisenbergbild
t = 0: S-Bild und H-Bild identisch
Operatoren: A → AH (t) = U † (t) A U (t) unitäre Transformation
Rücktransformation: A = U (t) AH (t) U † (t)
genauso |Ψ(t)i = U (t) |ΨH i
Eigenschaften:
1. Erwartungswerte invariant:
hΨH |AH (t)|ΨH i = hΨ(t)| U (t)U † (t) A U (t)U † (t) |Ψ(t)i = hΨ(t)|A|Ψ(t)i
| {z }
| {z }
=1
=1
2. Skalarprodukt invariant
hΨH |ϕH i = hΨ(t)|U (t)U † (t)|ϕ(t)i = hΨ(t)|ϕ(t)i
3. Kommutatoren: C := [A, B] = AB − BA
Seite 53
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
[A, B] = U AH U † U BH U † − U BH U † U AH U † = U AH BH U † − U BH AH U † = U [AH , BH ]U †
multipliziere von links mit U † und von rechts mit U
⇒ [AH , BH ] = U † [A, B] U = U † CU = CH
| {z }
=C
⇒ Kommutatoren bleiben forminvariant.
4. Bewegungsgleichung für Operator AH
wir hatten: i~
dU
dU †
= Û oder −i~
= (ĤU )† = U † Ĥ (*)
dt
dt
dAH (t)
d
1
1
∂A
(∗)
= (U † AU ) = − U † HAU + U † A HU + U †
U
dt
dt
i~
i~
∂t
1
1
∂A
i
∂A
†
= U − ĤA + AĤ U + U †
U = U † [H, A]U + U †
U
i~
i~
∂t
~
∂t
definiere:
∂A
∂AH
= U † (t)
U (t)
∂t
∂t
A nicht explizit zeitabhängig ⇒
∂AH
=0
∂t
(3)
U † [A, H]U = [AH , HH ]
⇒ i~
dAH (t)
∂AH
= [AH , HH ] + i~
(H)
dt
∂t
Heisenbergsche Bewegungsgleichung
∂A
∂H
=
=0
∂t
∂t
i
⇒ U (t) = e− ~ Ht
⇒ [H, U ] = 0
⇒ HH (t) = Ĥ
i
i
dann: AH (t) = e ~ Ht Ae− ~ Ht
dAH (t)
= 0 ⇔ [A, H] = 0, A ist dann Erhaltungsgröße
dt
Bemerkung: Warnung: Berechnung der Zeitableitung
∂A(t)
∂t
Bsp: A(t) = (p̂ + xt)2
p, x “normale“ Variablen:
∂A
= 2x(p + xt) = 2(p + xt)x
∂t
Seite 54
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
p̂ Impulsoperator, x Ort:
2
FORMALE STRUKTUR DER QUANTENMECHANIK
∂A
= 2x(p + xt) 6= 2(p + xt)x
∂t
nun A(t) = p̂2 + (px, xp)t + x2 t2 , dann:
∂A
= px, +xp + 2x2 t
∂t
5. Ehrenfest Theoreme
Annahme: Ĥ nicht explizit zeitabhängig, Gl. (H) ⇒
i~
∂AH (t)
d
hΨH |AH (t)|ΨH i = hΨH |[AH (t), H]|ΨH i + i~ hΨH |
|ΨH i
dt
∂t
⇒ i~
d
∂A
hΨH |AH (t)|ΨH i = h[A, H]i + i~ h
i
{z
}
dt |
∂t
=hAi
nun: Ĥ =
p~ˆ2
+ U (~r)
2m
[rj , H]f (~r) = [rj , −
=−
=
~2 ∂ 2
]f (~r) mit f (~r) : Testfunktion und rj : j-te Komponente des Ortes
2m ∂rj2
~2 ∂ 2
~2 ∂
~2 ∂ 2 f
rj 2 +
(r
f
(~
r
))
=
f (~r)
j
2m ∂rj
2m ∂rj2
m ∂rj
i~ ~ ∂
i~
f (~r) ⇒ [rj , Ĥ] = P̂j
m i ∂rj
m
| {z }
=P̂j
[Pj , Ĥ] = −i~
∂U (~r)
∂rj
d < ~r >
1
=
< p~ >
dt
m
⇒
d < p̂~ >
= − < ∇U (~r) >
dt
m
d2 < ~r >
= − < ∇U (~r) >
dt2
i.a.< ∇U (~r) >6= ∇U (< ~r >)
Beispiel: 1-dim harmonischer Oszillator
U (x) =
d2
m 2 2
ω x ⇒ m 2 < x >= −mω 2 < x > =
ˆ klassische Bewegungsgleichung für < x >
2
dt
{|ni} stationäre Zustände
Seite 55
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
hn|x|ni = 0, hn|p|ni = 0 (vgl. 6.3)
→ “keine Dynamik“
Wellenpaket: |ϕ(t)i =
∞
X
n=0
|ni hn|ϕ(t)i
| {z }
=cn (t)
< x >ϕ = hϕ(t)|x|ϕ(t)i
m
d2 < x >ϕ
= −mω 2 < y >ϕ
dt2
Lösung: < x >ϕ = A cos(ωt + δ)
3 Dreidimensionale Probleme im Zentralpotential
3.1 Klassische vs. Quanten-Mechanisch
3.1.1 2-Körperproblem in der klass. Mechanik
U (~r1 , ~r2 ) = U (|~r2 − ~r1 |) = U (r)
Zerlegung der Teilchenbewegung in Schwerpunkts- und Relativbewegung
~ =
Schwerpunkt: R
1
(m1~r1 + m2~r2 )
m1 + m2
~ = const.
Gesamtimpuls: P~ = (m1 + m2 )Ṙ
⇒ Schwerpunkt bewegt sich geradlinig gleichförmig, Dynamik in Relativbewegung.
~+
~r2 = R
m1
~r, ~r = ~r2 − ~r1
m1 + m2
~¨ + m1 m2 ~r¨ = F~12 (Kraft von Teilchen 1 auf Teilchen 2
m~r¨2 = m2 R
| {z } m1 + m2
| {z }
=0
µ
µ~r¨ = F~12 mit µ: reduzierte Masse
→ Zweiteilchensystem auf Bewegung eines Teilchens mit Masse µ reduziert.
~ = µ~r × ~r˙ → L
~ = const.
Drehimpuls: L
~ ~r ⊥ L,
~ ~r˙ ⊥ L
~
→ Bewegung verläuft in der Ebene ⊥ zu L:
Einführung von Polarkoordinaten ⇒ Radialgleichung
Seite 56
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
µr̈ = −
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
dUef f (r)
L2
mit Uef f = U (r) +
dr
2µr2
Erhaltungsgrößen:
→ Energie, Impuls, Drehimpuls
→ für Potential U (r) = −
θ
r
(Graviatation, Coulomb)
~ = ~r˙ × L
~ − θ ~r
Runge-Lenz-Vektor erhalten: A
r
~ zeigt vom Brennpunkt zum Perihel k große Bahnachse.
A
3.1.2 quantenmechanisches Problem
H-Atom, U (r) = −
e2
4πε0 r
mp = 1, 67 · 10−27 kg, me = 9, 11 · 10−31 kg ⇒
reduzierte Masse: µ =
me mp
1
= me
me ≈ me
me + mp
1+ m
p
SG im Zentralpotential i~
Z
Normierung:
mp
= 1836, 11
me
∂Ψ(~r, t)
~2 2
= ĤΨ(~r, t) mit Ĥ = −
∇ + U (r)
∂t
2M
|Ψ(~r, t)|2 d3 r = 1
zeitunabhängige SG: Ĥϕ(~r) = Eϕ(~r)
allgemeine Lösung (nur Betrachtung gebundener Zustände)
Ψ(~r, t) =
X
i
cn ϕn (~r)e− ~ En t
n
Koeff. cn aus Ψc (~r, 0)
Z
⇒ cn =
d3 rϕ∗n (~r)Ψ(~r, 0)
Kommutatoren: [ri , pj ] = i~δij mit i, j = 1, 2, 3
[ri , rj ] = [pi , pj ] = 0
Rolle des Drehimpulses?
Seite 57
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
3.2 Der Drehimpuls
(1) ~n: Drehachse (~n2 = 1), α : Drehwinkel
rx
zerlege Ortsvektor ~r = ry
rz
~r = (~r · ~n)~n + (~r − (~r · ~n)~n)
| {z } |
{z
}
⊥~
n
k~
n
gedrehter Vektor: ~r0 = (~r · ~n)~n + (~r − (~r · ~n)~n)cos α + (~n × ~r)sin α
Bsp: ~n = êz z-Achse
~r0 = rz êz j + (rx êx + ry êy )cos α + (rx êy − ry êx )sin α
cos α −sin α 0
rx
ry = R~r
= sin α cos α 0
0
0
1
rz
infinitesimale Drehung im Winkel ⇒ cos ≈ 1, sin ≈ ⇒ ~r0 = ~rj + ~n × ~r + O(2 )
nun Transformation: Ψ0 (~r0 , t) = Ψ(~r, t) mit ~r00 = R~r (gedrehter Zustand) und Ψ(~r, t) (ungedrehte
Wellenfunktion)
äquivalent Ψ0 (~r, t) = Ψ(R−1~r, t)
infinitesimale Drehung:
Ψ0 (~r) = Ψ(~r − |{z}
~n ×~r)
≡~
≈ Ψ(~r) − (~ × ~r) · ∇Ψ(~r)
i
= Ψ(~r) − (~ × ~r) · p~Ψ(~r)
~
i
= Ψ(~r) − ~ (~r × p~)Ψ(~r)
~
i ~
= Ψ(~r) − ~ LΨ(~
r)
~
~ = ~r × p~ Drehimpulsoperator
L
Seite 58
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
i ~
Ud () = 1 − ~ · L
Drehoperator für infinitesimale Drehung
~
Ψ0 (~r) = UD (~)Ψ(~r)
endliche Drehung: → UD (~
α)
i
UD (αx + x , αy , αz ) ≈ (1 − x Lx )UD (~
α)
~
⇒
UD (αx + x , αy , αz ) − UD (αx , αy , αz )
x
x → 0 :⇒
∂UD (~
α)
i
= − Lx UD (~
α)
∂αx
~
i
i~
~
oder ∇UD (~
α) = − L
UD (~
α) ⇒ UD (~
α) = e− ~ α~ ·L mit UD (0) = 1
~
UD (~
α) unitärer Operator
Transformation von Observablen
†
(~
α)
A0 = UD (~
α)AUD
A drehinvariant ⇔ [Lj , A] = 0, j = 1, 2, 3
~ 2 , Lj ] = 0
Bsp: [~
p2 , Lj ] = 0, [~r2 , Lj ] = 0, [L
Operatoren Lx , Ly , Lz sind Generatoren (Erzeugende) von Drehungen im Raum.
(2) Kommutatoren
[Lx , Ly ] = [ypz − zpy , zpx − xpz ] = [ypz , zpx ] − [ypz, xpz ] − [zpy , zpx ] + [zpy , xpz ]
= ypx [pz , z] +xpy [z, pz ] = i~(xpy − ypx ) = i~Lz
| {z }
| {z }
=−i~
=i~
analog: [Ly , Lz ] = i~Lx , [Lz , Lx ] = i~Ly
in kompakter Form: [Li , Lj ] = i~i,j,k Lk mit i,j,k = (êi × êj ) · êk
(i, j, k)zyklisch aus (1, 2, 3)
1
= −1 (i, j, k)antizyklisch aus (1, 2, 3)
0
sonst
zyklisch: im Uhrzeigersinn, antizyklisch: gegen den Uhrzeigersinn
Summenkonvention: (~a × ~b)k =
3
X
ijk ai bj
i,j=1
Seite 59
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
Kurzschreibweise: ~a × ~b = ijk ai bj êK
Bemerkungen:
• Komponenten des Drehimpulses sind inkompatible Observablen
~
• Unschärferelation σLx σLy ≥ |hLz i|
2
• Lx , Ly , Lz besitzen keine gemeinsamen Eigenfunktionen
• [L2 , Lj ] = 0, j = 1, 2, 3 ⇒ L2 und Lj (z.B. Lz ) gemeinsame Eigenfunktionen
L2 f = λf , Lz f = µf
(3) mögliche Eigenwerte von L2 und Lz
Idee: verwende Leiteroperatoren L± = Lx ± iLy und bestimme Eigenwerte von L± f bzgl. L2 und Lz
[Lz , L± ] = ±~L±
[L2 , L± ] = 0
⇒ L2 (L± f ) = L± L2 f = λ(L± f )
|{z}
=λf
L± f Eigenzustand von L2 zum selben Eigenwert λ
⇒ Lz (L± f ) = (Lz L± − L± Lz ) f + L± Lz f
|{z}
|
{z
}
=[Lz ,L± ]=±~L±
=µf
= (µ ± ~)(L± f )
L+ Aufsteigeoperator, L− Absteigeoperator
Beh. f hat eine obere Schranke fOS mit L+ fOS = 0 und eine untere Schranke fU S mit L− fU S = 0
Beweis: hf |L2 |f i = λ = hf |L2x + L2y + L2z |f i = hLx f |Lx f i + hLy f |Ly f i + hLz f |Lz f i
| {z } | {z } | {z }
≥0
⇒ λ ≥ µ2 oder |µ| ≤
≥0
=µ2
√
λ
µ < 0 ∃ untere Schranke µmin = ~l
µ > 0 ∃ obere Schranke µmax = ~l
Lz fOS = ~l fOS , L2 fOS = λfOS
Man kann zeigen (Ü-Aufgabe)
L2 = L± L∓ + L2z ∓ ~Lz
⇒ L2 fOS = (L− L+ + L2z + ~Lz )fOS = (~2 l2 + ~2 l)fOS = ~2 l(l + 1)fOS
Seite 60
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
⇒ λ = ~2 l(l + 1)
untere Schranke L− fU S = 0
Lz fU S = ~lfU S
2
L2 fU S = λfU S = (L+ L− + L2z − ~Lz )fU S = (~2 l − ~2 l)fU S = ~2 l(l − 1)fU S
⇒ λ = ~2 l(l − 1) ⇒ l(l + 1) = l(l − 1)
zwei Lösungen:
• l = l + 1 kommt als untere Schranke nicht in Frage
• l = −l
Eigenwerte von Lz : ~m mit m ∈ Z
m durchläuft in ganzzahligen Schritten Werte von −l bis −
N Schritte wischen −l und l ⇒ l = −l + N ⇒ l =
N
2
⇒ mögliche Werte von l sind ganzzahlig oder halbzahlig.
3
1
l = 0, , 1, , 2, . . .
2
2
m = −l, −l + 1, . . . , l − 1, l 2l + 1 m-Werte
• Eigenfunktionen des Drehimpulses?
• Kugelkoordinaten (U (r) radialsymmetrisch)
• Spektrum der Eigenwerte rein aus Kommutatorbeziehungen abgeleitet
~ und L2 in Kugelkoordinaten:
(IV) L
kartesische Ortskoordinate ~r = r1 ê1 + r2 ê2 + r3 ê3
Transformation: ri = ri (u, v, w) mit i = 1, 2, 3
⇒ neue Einheitsvektoren:
∂~r 1 ∂~r
êu =
mit hu = hu ∂u
∂u
êv =
∂~r 1 ∂~r
mit hv = hv ∂v
∂v
∂~r 1 ∂~r
Es gilt êu · êv = êu · êw = êv · êw = 0
êw =
mit hw = hw ∂w
∂w Funktionaldeterminante:
Seite 61
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
∂r1
∂u
∂(r1 , r2 , r3 ∂r1
=
∂(u, v, w)
∂v
∂r1
∂w
∂r2
∂u
∂r2
∂v
∂r2
∂w
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
∂r3 ∂u ∂~r
∂~r
∂r3 ∂~r
=
·
×
∂v ∂w
∂v ∂u
∂r3 ∂w
= hu hv hw êu · (êv × êw ) = hu hv hw
ein-eindeutige Zuordnung (u, v, w) ↔ (r1 , r2 , r3 ) ⇒
∂(r1 , r2 , r3
6= 0
∂(u, v, w)
Volumenelement: d3 r = dx dx dz = hu hv hw du dv dz
Gradient ∇ =
êu ∂
êv ∂
êw ∂
+
+
hu ∂u hv ∂v hw ∂w
Laplace ∆ = ∇2 =
1
∂ hv hw ∂
∂ hw hu ∂
∂ hu hv ∂
+
+
hu hv hw ∂u hu ∂u ∂v hv ∂v ∂w hw ∂w
Kugelkoordinaten:
x = r sin θ · cos ϕ y = r sin θ · sin ϕ z = r cos θ
∂~r p
hr = = sin2 θcos2 ϕ + sin2 θsin2 ϕ + cos2 θ = 1
∂r
∂~r p
hθ = = r2 cos2 θ(cos2 ϕ + sin2 ϕ) + r2 sin2 θ = r
∂θ
∂~r p
hϕ = = r2 sin2 θ(sin2 ϕ + cos2 ϕ) = rsin θ
∂ϕ
hr hθ hϕ = r2 sin θ
êr = sin θ cos ϕêx + sin θ sin ϕêy + cos θêz
êθ = cos θ cos ϕêx + cos θ sin ϕêy − sin θêz
êϕ = −sin ϕêx + cos ϕêy
⇒ ∇ = êr
∂
1 ∂
1
∂
+ êθ
+ êϕ
∂r
r ∂θ
r sin θ ∂ϕ
~ = ~ (~r × ∇) = ~ (rêr × ∇) = ~
Drehimpuls: L
i
i
i
∂
1 ∂
(êr × êθ )
+ (êr × êϕ )
∂θ
sin θ ∂ϕ
êr × êθ = êϕ
êr × êϕ = −êθ
Seite 62
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
~ =~
⇒L
i
~
=
i
∂
1 ∂
êr
− êθ
∂θ
sin θ ∂ϕ
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
∂
∂
∂
cos θ
∂
cos θ
∂
êx −sin ϕ
+ êy cos ϕ
+ êz
−
cos ϕ
−
sin ϕ
∂θ sin θ
∂ϕ
∂θ sin θ
∂ϕ
∂ϕ
~
⇒ Lx =
i
~
⇒ Ly =
i
∂
∂
cos ϕ
− cot θ sin ϕ
∂θ
∂ϕ
⇒ Lz =
∂
∂
−sin ϕ
− cot θ cos ϕ
∂θ
∂ϕ
~ ∂
i ∂ϕ
längere Rechnung liefert L2 in Kugelkoordinaten (verwende L2 = L+ L− + L2z − ~Lz )
2
2
L = −~
1 ∂
sin θ ∂θ
∂
sin θ
∂θ
1 ∂2
+
sin2 θ ∂ϕ2
3.3 SG in Kugelkoordinaten
Betrachte stationäre SG
−~2
∆Ψ + U (r)Ψ = EΨ
2M
−~2 1 ∂ 2 ∂
1
∂
∂
1
∂2
r
+
sin θ
+
Ψ(r, θ, ϕ) + U (r)Ψ = EΨ
2M r2 ∂r ∂r r2 sin θ ∂θ
∂θ r2 sin2 θ ∂ϕ2
Separationsansatz: Ψ(r, θ, ϕ) = R(r)Y (θ, ϕ)
−~2
2M
Y ∂ 2 ∂R
R
∂
∂Y
R ∂2Y
r
+
sin
θ
+
r2 ∂r ∂r
r2 sin θ ∂θ
∂θ
r2 sin2 θ ∂ϕ2
teile durch RY und multipliziere mit −2
⇒
(2) −
|
+ U (r)RY = ERY
M r2
~2
∂
1 ∂ 2 ∂R 2M r2
1
r
−
(U (r) − E) = −
R ∂r ∂r
~2
Y sin θ ∂θ
1 d
⇒ (1)
R dr
∂Y
1
∂2Y
sin θ
−
∂θ
Y sin2 θ ∂ϕ2
2M r2
2 dR
r
−
(U (r) − E) = l(l + 1) Radialgleichung
dr
~2
1 ∂
∂
1 ∂2
sin θ
+
Y (θ, ϕ) = l(l + 1)Y Winkelgleichung
sin θ ∂θ
∂θ sin2 θ ∂ϕ2
{z
}
=
1
L2
~2
Seite 63
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
3.4 Winkelgleichung
L2 Y (θ, ϕ) = ~2 l(l + 1)Y (θ, ϕ)
→ Y (θ, ϕ) Eigenfunktion von L2 zum Eigenwert ~l(l + 1)
→ Gleichung unabhängig von U (r) ⇒ Y für alle radialsymmetrischen Potentiale gleich.
Separationsansatz: Y (θ, ϕ) = W1 (θ)W2 (ϕ)
W2 (ϕ) ∂
⇒−
sin θ ∂θ
∂W1 (θ)
W1 (θ) ∂ 2 W2 (ϕ)
sin θ
−
= l(l + 1)W1 W2
∂θ
sin2 θ ∂ϕ2
sin θ ∂
sin2 θ
⇒
multipliziere −
W1 W 2
W1 (θ) ∂θ
⇒
∂W1 (θ)
1 ∂ 2 W2 (ϕ)
sin θ
+
= sin2 θ l(l + 1)
∂θ
W2 (ϕ) ∂ϕ2
d2 W2 (ϕ)
= −m2 W2 (ϕ)
dϕ2
oder L2z W2 (ϕ) = −~2 m2 W2 (ϕ)
→ m variiert in ganzzahligen Schritten von −l bis −l
Lösung: W2 (ϕ) = eimϕ
periodische Funktion von Periode 2π
W2 (ϕ + 2π) = W2 (ϕ)
eim(ϕ+2π) = eimϕ
⇒ eim2π = 1
⇒ m = 0, ±1, ±2, ±3, . . . , m hat keine halbzahligen Werte.
Lz Ylm (θ, ϕ) = ~mYlm (θ, ϕ)
|{z}
~ ∂
i ∂ϕ
zu geg. l läuft m von −l bis l: (m = 0, ±1, ±2, . . . )
verwende Leiteroperatoren: L± = Lx ± iLy
L+ =
~
i
|
sin ϕ =
∂
∂
~
∂
∂
−sin ϕ
− cot θ cos ϕ
+i
−cos ϕ
− cot θ sin ϕ
∂θ
∂ϕ
i
∂θ
∂ϕ
{z
} |
{z
}
=Lx
=Ly
1 iϕ
1 iϕ
e − e−iϕ , cos ϕ =
e − e−iϕ
2i
2
Seite 64
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
⇒ L+ = ~eiϕ
∂
∂
+ i cot θ
∂θ
∂ϕ
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
L+ Wll (θ)eilϕ = 0
⇒ ~eiϕ
∂
∂
+ i cot θ
∂θ
∂ϕ
⇒ ~ei(l + 1)ϕ
Wll (θ)eilϕ = 0
∂
− l cot θ Wll (θ) = 0
∂θ
⇒ Wll (θ) = Cl (sin θ)l mit Cl : Normierungskonstante
Normierung:
Zπ
Z2π
dθ sin θ
0
= 2π|cl |
0
2
Zπ
=Yll (θ,ϕ)
dθ (sin θ)2l+1
|0
⇒ |Cl |2 =
!
dϕ |Wll (θ)eilϕ |2 = 1
{z
}
|
{z
}
2(2l l0 )2
= (2l+1)!
(2l + 1)! 1
4π
(2l l!)2
Anwendung des Absteigeoperators
L− = ~e
−iϕ
∂
∂
+ i cot θ
−
∂θ
∂ϕ
L− Yll (θ, ϕ) = Yll−1 (θ, ϕ) = −~
∂
∂θ
|{z}
= −~(sin θ)−l
−sin θ d
= ~(sin θ)−(l−1)
∂
+ l cot θ Wll (θ)ei(l−1)ϕ
∂θ
(sin θ)l Wll (θ)ei(l−1)ϕ
d
cos θ
d
(sin θ)2 Wll (θ)ei(l−1)ϕ
d cos θ
wende L− (l − m)-mal an (m ≥ 0)
Ll−n
− Yl l(θ, ϕ)
−
= ~(sin θ) m
d
d cos θ
l−m
(sin θ)l Wll (θ)einϕ
Seite 65
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
−
= ~(sin θ) m
d
d cos θ
l−m
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
Cl (sin θ)2l Wll (θ)einϕ
Substitution t = cos θ, sin2 θ = 1 − t2
⇒
Ll−m
− Yll
2 −m
2
= ~(1 − t )
d
dt
l−m
Cl (1 − t2 )l eimϕ ∝ Ylm (θ, ϕ) mit m ≥ 0
⇒ Ylm = Clm Plm eimϕ mit Clm : Normierungskonstante
m≥0
m
(l + m)! 1
Plm (t) = (−1)
(1 − t2 )− 2
l
| {z } (l − m)! 2 l!
l+m
d
dt
l−m
(1 − t2 )l
Konvention
zugeordnete Legendre-Polynome
Es gilt: Pl,−n (t) = (−1)m
1
⇒ Plm (t) = l (1 − t2 )
2 l!
(l − m)!
Plm (t)
(l + m)!
d
dt
l+m
(t2 − 1)l
Normierung:
Z1
dt Plm (x)Pl0 m (x) =
2 (l + m)!
δll0
2l + 1 (l − m)!
−1
⇒m≥0
s
Ylm (θ, ϕ) = (−1)m
2l + 1 (l − m)! imϕ
e
Plm
4π (l + m)!
∗
, mit Ylm (θ, ϕ) Kugelflächenfunktionen
Es gilt Ylm = (−1)m Yl,−m
Bemerkungen:
• Eigenfunktionen von L2 und Lz
Lz Ylm =
~ ∂
Ylm = ~mYlm
i ∂ϕ
−l ≤ m ≤ l
L2 Yl m = ~2 l(l + 1)Ylm
• Yl m bilden vollständiges, orthonormiertes Funktionensystem (Basis) auf der Einheitskugel
Seite 66
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
Zπ
Z2π
sin θ dθ
0
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
dϕ Yl∗1 ,m1 Yl∗2 ,m2 = δl1 ,l2 δm1 ,m2
0
⇒ beliebige Funktionen f (θ, ϕ) kann nach den Ylm entwickelt werden.
f (θ, ϕ) =
∞ X
l
X
flm Ylm (θ, ϕ)
l=0 m=−l
Z
flm =
Z
sin θ dθ
dϕ f ∗ (θ, ϕ)Ylm (θ, ϕ)
• Parität: ~r → −~r : r → r, θ → π − θ, ϕ → ϕ + π
P̂ Ylm (θ, ϕ) = Ylm (π − θ, ϕ + π) mit P̂ : Partitätsoperator
cos(π − θ) = −cos θ
⇒ Plm (−cos θ) = (−1)l+m Plm (cos θ)
eim(ϕ+π) = (−1)m eimϕ
⇒ Ylm (π − θ, ϕ + π) = (−1)l Ylm (θ, ϕ)
Beispiele:
1
Y00 = √
4π
r
3
Y11 = −
sin θeiϕ
8π
r
3
Y10 =
cos θ
r 4π
15
Y22 =
sin2 θe2iϕ
32π
r
15
Y21 = −
sin θ cos θeiϕ
8π
r
5
Y20 =
(3cos2 θ − 1)
16π
l: Bahndrehimpulsquantenzahl, m: magnetische Quantenzahl
3.5 Die Radialgleichung
d
dr
dR(r)
2M r2
r2
−
(U (r) − E)R(r) = l(l + 1)R(r)
dr
~2
substituiere u(r) = rR(r)
Seite 67
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
u dR
1 du
u
,
=
− 2
r dr
r dr
r
d2 u
d
2 dR
r
=r 2
dr
dr
dr
⇒R=
⇒r
u(r)
d2 u 2M r
− 2 (U (r) − E)u(r) = l(l + 1)
2
dr
~
r
multipliziere mit −
−
~2
⇒
2M r
~2 d2 u(r)
~2 l(l + 1)
u(r) = Eu(r)
+
U
(r)
+
2M dr2
2M r2
→ eindimensionale, stationäre SG mit effektivem Potential
Uef f (r) = U (r) +
~2 l(l + 1)
2M r2
analog: effektives Potential in klassischem 2-Körperproblem, Uef f (r) = U (r) +
L2
2µr2
3.6 Das Wasserstoffatom
me −1
reduzierte Masse: M = me 1 +
≈ me
mp
U (r) = −
γ
e2 1
=−
4π r
r
| {z 0}
=γ
betrachte gebundene Zustände E < 0
d2 U (r) 2M γ
l(l + 1)
2M
+ 2 U (r) −
U (r) = − 2 E U (r)
dr2
~ r
r2
~
ρ = κr, κ2 =
ρ0 =
⇒
2M |E|
~2
2M γ
~2 κ
d2
ρ0 l(l + 1)
+
−
− 1 U (ρ) = 0
dρ2
ρ
ρ2
asymptotisches Verhalten
ρ→0:
1
-Term dominant
ρ2
Seite 68
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
⇒
d2
l(l + 1)
−
2
dρ
ρ2
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
U ≈0
Lösung: U ∼ ρl+1
(andere Lösung: U ∼ ρ− physikalisch nicht sinnvoll, divergiert für ρ → 0)
ρ → ∞ Konstanter Term dominiert ⇒
d2 U (ρ)
≈U
dρ2
Lösung: U ∼ e−ρ
⇒ Ansatz: U (ρ) = ρl+1 e−ρ W (ρ)
⇒ρ
d2 W
dW
+ 2(l + 1 − ρ)
+ (ρ0 − 2(l + 1))W = 0
2
dρ
dρ
Potenzreihenansatz: W (ρ) =
∞
X
ak ρk
k=0
⇒ Rekursionsgleichung
ak+1 =
2(k + l + 1) − ρ0
ak
(k + 1)(k + 2l + 2)
ak+1
2
≈
ak
k
k → ∞ :⇒
⇒ ak ≈ ⇒ W (ρ) ≈
∞
X
(2ρ)k
k=0
k!
= e2ρ
führt auf nicht-normierbare Lösung
⇒ Reihe muss bei einem endlichen Wert von k abgebrochen werden, so dass: aN +1 = 0
⇒ AN +1 =
2(N + l + 1) − ρ0
aN = 0
(N + 1(N + 2l + 2)
⇒ ρ0 = 2(N + l + 1) ≡ 2n
En = −
M e4
1
mit n = 1, 2, 3, 4, . . . Hauptquantenzahlen
2
2
2~ (4π0 ) n2
|
{z
}
=13,6eV
N = 0, 1, 2, . . . radiale QZ
Zustand |n l ni
n=N +l+1⇒l ≤n−1
Seite 69
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
|m| ≤ l mit l: Bahndrehimpuls-QZ, Neben-QZ
m: magnet. QZ
Energieentartung:
n = 1: |1 0 0i
n = 2: |2 0 0i , |2 1 − 1i , |2 1 0i , |2 1 1i
n = 3:
|3 0 0i , |3 1 − 1i , |3 1 0i
|3 1 1i , |3 2 − 2i , |3 2 − 1i
|3 2 0i , |3 2 1i , |3 2 2i
⇒ Entartungsgrad der Energie En
n−1
X
(2l + 1) = n2
l=0
Bemerkungen:
~
(I) En unabhängig von l, Grund: erhaltener Runge-Lenz-Pauli-Vektor A
(II) Rydbergkonstante: RH =
M e4
RH
=13,6 eV ⇒ En = 2
2
2
2~ (4π0 )
n
Eigenfunktionen Rnl (r)? ⇒ Zusammenfassung der bisherigen Schritte:
~2 d2 U (r)
Dgl. für R(r), U (r) = rR(r) ⇒ −
+ Uef f (r)U (r) = E U (r) mit E < 0 gebundene
2M dr2
Zustände
H-Atom: Uef f (r) = −
γ
~2 l(l + 1)
+
r
2M r2
skalierte Variablen: ρ = κr, κ2 =
2M |E|
2M γ
, ρ0 = 2
~2
~ κ
Ansatz: U (ρ) = ρl+1 e−ρ W (ρ)
|{z} | {z }
ρ→0
ρ→∞
→ Dgl. für W (ρ)
ρ
d2 W
dW
+ 2(l + 1 − ρ)
+ (ρ0 − 2(l + 1))W = 0
dρ2
dρ
Ansatz: W (ρ) =
X
∞
ak ρk
k=0
normierbare Lösungen nur, wenn die Reihe bei einem endlichen Wert von k abgebrochen wird:
Seite 70
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
W (ρ) =
X
N
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
ak ρk
k=0
⇒ Rekursionsbeziehung
ak+1 = 2
k+l+1−n
ak , n = N + l + 1
(k + 1)(k + 2l + 2)
Wnl (ρ): Polynom vom Grad N = n − l − 1
1
Rnl (r) = ρl+1 e−ρ W (ρ)
r
r
2M |E|
M e2 1
r 1
ρ = κr =
r
=
r≡
2
2
~
~ 4π 0 n
r0 n
r0 =
4π 0 ~2
= 0, 529 · 10−10 m = 0, 529 Å Bohrscher Radius
M e2
betrachte n = 1, l = 0:
R10 (r) =
a0 − rr
e 0
r0
Z∞
Normierung:
!
r2 dr|R10 |2 = 1
0
|a0 |2
= 2
r0
Z∞
e
|0
− r2r 2
0
r dr = |a0 |2
{z
r0
4
}
= 41 r03
2
⇒ a0 = √
r0
1
−r
Ψ110 (r, θ, ϕ) = R10 (r)Y00 (θ, ϕ) = p 3 e r0
| {z }
πr0
= √1
4π
betrache n = 2, l = 0
a1 = −a0 , a2 = 0
a0
⇒ R20 (r) =
2r0
r
− r
1−
e 2r0
2r0
r
Normierung ⇒ a0 =
2
r0
betrachte beliebige n, l : t = 2ρ
Seite 71
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
t
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
d2 W
dW
+ {(2l + 1) + 1 − t}
+ {(n + l) − (2l + 1)} W = 0
2
dt
dt
Laguerresche Dgl: Lösungen: Wnl (t) = L2l+1
n+l (t) zugeordnetes Laguerrepolynom
LSr (t)
d S t d r −t r
= −
e
e t
dt
dt
Beispiele: L00 = 1, L20 = 2, L01 = −t + 1, L21 = −6t + 18, L02 = t2 − 4t + 2, . . .
⇒: H-Wellenfunktion:
s
2 3 (n − l − 1)! − nrr
2r l 2l+1 2r
0
L
Ylm (θ, ϕ)
Ψnln =
e
n+l
r0 n
2n[(n + l)!]3
nr0
nr0
Bemerkungen:
(i) Radialanteil der Wellenfunktion mit N = n − l − 1) Knoten
(ii) Energiespektren:
E4 = -0,85 eV
E3 = -1,51 eV
E2 = -3,40 eV
E1 = -13,6 eV
Bei einem Übergang von einem angeregten Zustand in einen Zustand niedrigerer Energie wird
Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung frei.
Eγ = EA − EE = −13, 6eV
Eγ = hν =
1
1
− 2
2
nA n E
hc
mit c: Lichtgeschwindigkeit, ν: Frequenz der Strahlung, λ: Wellenlänge,
λ
EE : Endzustand, EA : Anfangszustand
⇒
1
=R
λ
1
1
− 2
n2E
nA
Rydberg-Formel
R = 1, 097 · 107 m−1 Rydbergkonstante
Spektroskopie: Übergänge nach
nE
nE
nE
nE
= 1:
= 2:
= 3:
= 4:
Lyman-Serie ∼ Ultraviolett-Bereich 91 nm - 121 nm
Balmer-Serie
Paschen-Serie
Brachet-Serie
Einige Linien der Balmer-Serie sind im sichtbaren Bereich (∼ 380 nm - 780 nm)
3 → 2: 656,3 nm rot
Seite 72
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
4 → 2: 486,1 nm blau-grün
8 → 2: 388,8 nm violett
3.7 Der Runge-Lenz-Pauli-Vektor
γ
klassisch: Erhaltungsgröße beim Keplerproblem Potential U (r) = −
r
~ = ~r˙ × L
~ − γ ~r = 1 p~ × L
~ − γ ~r
A
r
M
r
~
dA
= 0 ⇒ geschlossene Bahnen, kenie Drehung des Perihels
dt
allgemien gilt für Zentralpotential Bahnen in der Ebene, aber nicht geschlossen
q.m.: W. Pauli (1926)
betrachte Coulomb-Potential U (r) −
γ
r
~ = 1 (~
~ −L
~ × p~) − γ ~r
Definition: A
p×L
2M
r
Ü-Aufgabe:
~ = 0 ⇒ A:
~ Erhaltungsgröße mit H: Hamiltonoperator
1. [H, A]
~ ·A
~=A
~·L
~ =0
2. L
~ 2 + ~~2 ) + γ 2
~ 2 = 2 H(L
3. A
M
4. [Lj , Ak ] = i~jkl Al
5. [Aj , AK ] = −
r
~0 =
definiere A
−
2i~
Hjkl Ll
M
M ~
A mit E < 0
2E
E: Energieeigenwert von H, Skalierung sinnvoll
wg. Gl(1):
Gl.(4) ⇒ [Lj , A0k ] = i~jkl A0l (+)
Gl.(5) ⇒ [A0j , A0k ] = i~jkl L0l (++)
1 ~
~ 0 ), K
~ = 1 (L − A
~ 0)
definiere nun I~ = (L
+A
2
2
Seite 73
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 3 DREIDIMENSIONALE
PROBLEME IM ZENTRALPOTENTIAL
aus (+) und (++) folgt:
[Ij , Ik ] = i~jkl Il
[Kj , Kk ] = i~jkl Kl
~ 2 , Kj ] = 0
[Ij , Kk ] = 0, [I~2 , Ij ] = 0, [K
2 entkoppelte und untereinander kommutierende Sätze von Drehimpulsoperatoren
→: Eigenzustände |i iz k kz i
I~2 |i iz k kz i = ~2 i(i + 1) |i iz k kz i
3
1
i = 0, , 1, , 2, . . .
2
2
~ 2 |i iz k kz i = ~2 k(k + 1) |i iz k kz i, k = 0, 1 , 1, 3 , 2, . . .
K
2
2
1
~ 02 + 2 L
~ ·A
~0
I~2 = ~
L2 + A
| {z
}
4
=0,Gl. (2)
1 ~ 2 ~ 02
~2 ⇒ i=k
(L + A ) = K
4
1 ~ 2 M ~2
2
~
K =
L −
A
4
2E
1
=
4
(3)
M
2
1
M 2
2
2
2
2
~
~
L −
E(L + ~ ) + γ
=
~+
γ
2E M
4
2E
⇒E=−
M γ2
M γ2
M γ2
1
3
=
−
=
−
mit k = 0, , 1, , 2, . . .
2(4~2 k(k + 1) + ~2 )
2~2 (4k 2 + 4k + 1)
2~2 (2k + 1)2
2
2
definiere Haupt-QZ n = 2k + 1 = 1, 2, 3, . . .
⇒ En = −
M γ2
Balmerformel
2~2 n2
Lz = Iz + Kz
Iz |i iz k kz i = ~iz |i iz k kz i mit −i ≤ iz ≤ i
Kz |i iz k kz i = ~kz |i iz k kz i mit −k ≤ kz ≤ k
Eigenwerte von Lz : ~m = ~iz + ~kz
1
3
⇒ m muss ganzzahlig sein wegen i = k = 0, , 1, , 2, . . . und damit auch l
2
2
Entartung der Energieeigenwerte:
Seite 74
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
festes i ⇒ (2k + 1) Eigenwerte von Iz : iz = −k, . . . , +k
festes k = i ⇒ (2k + 1) Eigenwerte von kz : kz = −k, . . . , +k
Lz = Iz + Kz ⇒ (2k + 1)2 verschiedene Eigenwerte für Lz
⇒= (2k + 1)2 = n2
~ zurückzuführen (höhere
Die Entartung beim Coulombproblem ist also auf die Erhaltung von A
Symmetrie beim Coulombproblem)
4 Teilchen im elektromagnetischen Feld
4.1 Klassischer Hamiltonoperator
E-Dynamik: elektrische und magnetische Feldstärken mit Potentialen verknüpft:
~
~ = − 1 ∂ A − ∇Φ
E
c ∂t
~ =∇×A
~
B
~ Vektorpotential, Φ skalares Potential, c: Lichtgeschwindigkeit
A:
Lagrange-Funktion
L(~r, ~r˙, t) =
m ˙2
~r + e
2
1 ~
·A−Φ
2
mit e: Ladung des Teilchens
~ und Φ sind nicht eindeutig festgelegt, folgende transformierte Potentiale beschreiben
Bemerkung: A
den gleichen phys. Zustand:
~0 = A
~ + ∇f (~r, t) mit f : beliebige Funktion
A
Φ0 = Φ −
1 ∂f (~r, t)
→ Eichinvarianz
c ∂t
Euler-Lagrange-Gleichung
d
dt
pj ≡
∂L
∂ ẋj
x1
∂L
=
mit ~r = x2
∂xj
x3
∂L
e
= mẋj + Aj mit Pj : j-te Komponente des kanonischen Impulses
∂ ẋj
c
∂L
∂Φ
e ∂Ak
= −e
+ ẋk
∂xj
∂xj
c ∂xj
Seite 75
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
3
X ∂Ak
∂Ak
→
ẋk
ẋk
∂xj
∂xj
k=1
e
ṗj = mẍj + Ȧj
c
~ = A(~
~ r, t) ⇒ Ȧj = ∂Aj + ∂Aj ẋk
A
∂t
∂xk
e
∂Φ
+ ẋk
⇒ mẍj = −e
∂xj
c
∂Aj
∂Ak
−
∂xj
∂xk
−
e ∂Aj
c ∂t
oder
m~r¨ = −e∇Φ −
e ∂A e ˙
~
+ ~r × (∇ × A)
| {z }
c ∂t
c
~
=B
~ + 1 ~r˙ × B)
~ = F~L Lorenzkraft auf geladenes Teilchen
= e(E
c
Hamiltonfunktion:
H(~
p, ~r, t) = p~ × ~r˙ − L
3 ~
1
A einsetzen
~r˙ = p~ −
m
mc
⇒H=
1 e ~ 2
p~ − A
+ eΦ
2m
c
Bemerkung: ẋj =
∂H
∂H
, ṗj = −
⇒ m~r¨ = F~L X
∂pj
∂xj
4.2 Quantenmechanischer Hamiltonoperator
“Ansatz“: H =
=
1 e ~ 2
p~ − A
+ eΦ
2m
c
1 e ~ 2
−i~∇ − A
+ eΦ
2m
c
Wirkung auf Wellenfunktion: Ψ(~r, t)
HΨ =
1 e ~ 2
−i~∇ − A + eΦ Ψ =
2m
c
∗: Coulomb-Potential U (r) = eΦ = −
!
2
~2
i~e ~+A
~·∇ Ψ+ e A
~ 2Ψ
−
∆ + |{z}
eΦ Ψ +
∇·A
2m
2mc
2mc2
∗
γ
r
~ = (∇ · A)Ψ
~ +A
~ · ∇Ψ
Betrachte ∇ · AΨ
Seite 76
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
~=0
Coulomb-Eichung: ∇ · A
⇒ HΨ =
SG: i~
e2 ~ 2
~2
i~e ~
A·∇+
A Ψ
−
∆ + eΦ +
2m
mc
2mc2
∂Ψ
= HΨ
∂t
~0 = A
~ + ∇f (~r, t)
Bemerkung: Eichtransformation A
Φ0 = Φ −
1 ∂f (~r, t)
c ∂t
∂Ψ0
∂t
ie
0
mit Ψ = Ψexp
f (~r, t)
~c
führt auf SG: H 0 Ψ0 = i~
⇒ Ψ und Ψ0 beschreiben den gleichen physikalischen Zustand.
4.3 Konstantes Magnetfeld
(i) Geladenes Teilchen im konstanten und homogenen Magnetfeld
~ 0, Bz ) = ∇ × A
~
B(0,
~ = (−Bz y, 0, 0); Φ = 0
wähle A
stationäre SG: Hϕ(~r) = Eϕ(~r)
~2
H=−
2m
∂2
∂2
∂2
+
+
∂x2 ∂y 2 ∂z 2
−
i~eBz ∂
e2 Bz2 2
y
+
y
mc ∂x 2mc2
Separationsansatz: ϕ(~r) = eiαx+iβz χ(y)
~2
~2 ∂ 2
~eBz α
e2 Bz2 2 iαx+iβz
2
2
⇒ −
(−α − β ) −
+
y+
y e
χ(y)
2m
2m ∂y 2
mc
2mc2
= Eeiαx+iβz χ(y), α, beta ∈ R konstant
⇒
~2 d2
~eBz α
e2 Bz2 2
−
+
y+
y χ(y)
2m dy 2
mc
2mc2
=
E−
~2 2
~2 2
α −
β χ(x)
2m
2m
substituiere: y = y 0 −
~α
eBz
mit ω0 =
Zyklotronfrequenz
mω0
mc
Seite 77
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
=E−
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
~2 2
β
2m
2 !
m
~α
~2 d2
~α
+ ω0 y 0 −
−
+ ~ω0 α y 0 −
χ0 (y 0 )
2m dy 02
mω0
2
mω0
⇒
=
4
~2 2
α χ0 (y 0 )
−
2m
⇒
~2 d2
m 2 02
χ0 (y 0 ) = χ0 (y 0 ) harmonischer Oszillator
+ ω0 y
2m dy 02
2
⇒ Energieeigenwerte n = ~ω0
1
n+
2
mit n = 0, 1, 2, . . .
χ0 (y 0 ): Hermite-Polynome, symmetrisch um y 0 = 0 bzw. y0 = −
~α
~c
=−
α
mω0
eBz
~2 2
1
En (β) =
β + ~ω0 n +
2m
2
ϕ(~r) = e
iαx+iβz
~c
χn y −
α
eBz
diese Zustände heißen Landau-Niveaus
• freie Bewegung in z-Richtung
• Energie hängt nicht von α ab ⇒ unendlichefache Entartung
• keine Lokalisierung in x-RIchtung ⇒ Eigenfunktionen Wellenpakete dre Form
ϕ(~r) = eiβz
Z
dα ˜
~c
f (α)eiαx χn y −
α
2π
eBz
~2 2
β
2m
1
~e
1
~e
E⊥ = ~ω0 n +
=
Bz n +
=
(2n + 1)Bz
2
mc
2
2mc
En (β) = Ek + E⊥ mit Ek =
=−
~|e|
(2n + 1)Bz
|2mc
{z }
(**) = µB = 9, 274 · 10−24 J/T Bohrsches Magnetron
∗∗
geladenes, sich drehendes Teilchen
~
• magnetischer Dipol mit Dipolmoment µ
~ ∝L
→ E⊥ = −µz Bz Energie des Dipols
Eigenfunktionen χ0n (y 0 ) → |ni
Seite 78
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
Ehrenfest-Gleichung: m
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
d2 0
hy i = −mω02 hy 0 i
dt2
hn|y 0 |ni = 0, hn|py0 |ni = 0 ⇒ keine Dynamik
→ Wellenpaket
|χ0 (t)i =
∞
X
n=0
|ni hn|χ0 (t)i =
| {z }
=cn
∞
X
cn (t) |ni
n=0
hχ0 (t)|y 0 |χ0 (t)i ≡ hy 0 iχ0
m
d2 hy 0 iχ0
dt2
= −mω02 hy 0 iχ0
Lösung: hy 0 iχ0 = A cos(ωt + δ)
(ii) Spektrum des H-Atoms im Magnetfeld
H=−
γ
i~e ~
e2 ~ 2
~2
~2
∆− +
A·∇+
A vernachlässige Term ∝ A
2M
r
Mc
2M c2
~ konstant, homogen
B
~ = − 1 ~r × B(
~ =
~ = ∇ × A)
~
A
ˆB
2
⇒
i~e
i~e ~
~ · ∇Ψ = i~e (~r × ∇) · BΨ
~ = − i~e L
~ · BΨ
~
A · ∇Ψ = −
(~r × B)
Mc
2M c
2M c
2M c
~ mit µ
= −~
µ · BΨ
~=
H=−
e ~
L magnetisches Moment
2M c
~2
γ
e ~ ~
e ~
∆− +
L · B mit µ
~=
L
2M
r
2M c
2M c
~ = (0, 0, Bz ), Bz konstant + homogen
sei nun B
~2
γ
e
e
∆− −
Lz Bz = H0 −
Lz B z
2M
r
2M c
2M c
eBz
RH
e~Bz
Lz |n l mz i = − 2 −
mz |n l mz i
Sei |n l mz i −
2M c
n
2M c
⇒H=−
⇒ E = En −
eBz
~mz mit ωL : Lamorfrequenz
{z c}
|2M
=ωL
= En − ~ωL mz
→ Magnetfeld führt zu (2l + 1)-fachen Aufspaltung der Energieniveaus (Aufhebung der Entartung)
→ normaler Zeeman-Effekt
Seite 79
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
→ Größenordnung: ~ωl = 4 · 10−6 · 13, 6eV
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
Bz
Vs
1m
2
1
→ experimenteller Befund: Hinweise auf halbzahligen Drehimpuls: l = , Stern-Gerlach-Versuch
2
(1922)
→ Spinhypothese vom Wahlbach und Goudsmit (1925)
4.4 Spin
~ intrinsischer Drehimpuls des Elektrons, kein klassisches Analogon
Spin S:
~ Drehimpulsoperator mit Vertauschungsrelation
S
[Sj , Sk ] = i~ jkl Sl
~ 2 , Sj ] = 0
[S
~ 2 und S3
⇒ ∃ gemeinsame Eigenzustände von S
Eigenwerte von
s= 1
~ 2 : ~2 s(s + 1) =2 3 ~2
S
4
S3 : ~ms mit ms = ±
1
2
⇒ 2 Eigenvektoren |+i , |−i mit
1
S3 |+i = ~ |+i
2
1
S3 |−i = − ~ |−i
2
die einen 2-dimensionalen, komplexen Vektorraum aufspannen
⇒ h+|−i = 0, h+|+i = h−|−i = 1
beliebiger Vektor |χi dieses Vektorraums kann wie folgt dargestellt werden:
|χi = χ+ |+i + χ− |−i mit |χ+ |2 + |χ− |2 = 1
|χi , |+i und |−i können wie folgt als Vektoren dargestellt werden: (in C2 )
|χi =
χ+
1
0
, |+i =
, |−i =
χ−
0
1
Diese Vektoren werden Spinoren genannt.
Seite 80
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
S3 diagonale Matrix in dieser Darstellung
~
~
S3 = , σ3 =
2
2
1 0
0 −1
S1 , S2 bzw. σ1 , σ2 in dieser Darstellung?
→ verwende Leiteroperatoren: S± = S1 ± iS2
Wirkung auf Basisvektoren:
0
0
1
0
=
=
, S−
S+
1
0
0
0
1
0
0
1
=~
=~
, S−
S+
0
1
1
0
⇒ S+ = ~
0 1
0 0
, S− = ~
0 0
1 0
1
~
⇒ S1 = (S+ + S− ) =
2
2
~
0 1
= σ1
1 0
2
1
~ 0 −i
~
1
0 1
S2 = (S+ − S− ) = − ~i
=
= σ2
−1 0
2i
2
2 i 0
2
~ = ~ ~σ mit σ1 =
⇒ S
2
1 0
0 −i
0 1
, σ3 =
, σ2 =
0 −1
i 0
1 0
σ1 , σ2 , σ3 heißen Paulimatrizen
2
2
~ 2 = ~ (σ 2 + σ 2 + σ 2 ) = ~ 3
S
2
3
4 1
4
1 0
0 1
Eigenschaften:
1. [σj , σk ] = 2i jkl σl
2. σj2 = 1
3. σj σk + σk σj = 2δkj 1
σ2 σ3 = iσ1 , σ3 σ1 = iσ2 ,
⇒ σj σk = δjk 1 + i jkl σl
Seite 81
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
4.5 Pauligleichung
Spin unabhängig von räumlichen Freiheitsgraden, kann also nicht in Ortsbasis dargestellt werden
• Beschreibung durch Spinoren |χi
• gesamter Raum durch Tensorprodukt aus Orts-Hilbertraum HR und 2-dim Hilbertraum für
Spin-Freiheitsrad, H2
H = HR ⊗ H 2
Basis |~ri |σi ≡ |~ri ⊗ |σi
⇒ beliebige Wellenfunktion
|Ψi =
XZ
d3 r Ψσ (~r) |~ri |σi
σ=±
⇒ Spinorwellenfunktion
Ψ+ (~r)
Ψ(~r) =
Ψ− (~r)
Ψ† (~r) = Ψ∗+ (~r), Ψ∗− (~r)
Norm: hΨ|Ψi =
XZ
3
Z
2
d r |Ψσ (~r)| =
d3 r |Ψ+ |2 + |Ψ− |2 = 1
σ
Wahrscheinlichkeitsdichte:
ρ(~r) = Ψ† (~r)Ψ(~r) = |Ψ+ |2 + |Ψ− |2
|Ψσ (~r)|2 :Wahrscheinlichkeitsdichte, dass das Teilchen am Ort ~r mit Spin σ zu finden ist.
Erwartungswerte für Spinkomponenten:
Z
hΨ|Sα |Ψi =
3
Z
†
d r Ψ (~r)Sα Ψ(~r) =
3
d r
Ψ∗+ (~r), Ψ∗− (~r)
XZ
Ψ+ (~r)
Sα
=
d3 r Ψ∗σ (Sα )σ
Ψ− (~r)
0
σ 0 Ψσ 0
σ,σ
Z
speziell: hΨ|S3 |Ψi =
d3 r
~
|Ψ+ |2 + |Ψ− |2
2
Hamiltonoperator für Teilchen mit Spin
1
?
2
~ → magnetisches Moment µ
Bahndrehimpuls L
~=
e ~
L
2mc
~ =− e L
~B
~
→ Term in Hamiltonian: HL = −~
µ·B
2mc
Seite 82
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
Ansatz für magnetisches Moment des Spins µ
~s = g
e ~
S
2mc
g: gyromagnetischer Faktor (Landéfaktor), g kann im Rahmen der Quantenelektrodynamik
berechnet werden ⇒ g = 2, 002319304386 ≈ 2
Beitrag zum Hamiltonian Hs = −g
e ~ ~
e ~~
~
SB = −
~σ B = µB ~σ B
2mc
m2
~ 2 -Term)
konstantes, kleines Magnetfeld B (vernachlässige B
⇒H=
1 2
e ~
~
p~ + eΦ −
(L + ~~σ ) · B
2m
2mc
beliebiges Magnetfeld B(~r, t): Pauligleichung
i~
∂
∂t
2
1 e~
e~
Ψ+ (~r, t)
Ψ+ (~r, t)
~ r, t)
=
p~ − A(~
r, t) + eΦ(~r, t) −
~σ · B(~
Ψ− (~r, t)
Ψ− (~r, t)
2m
c
2mc
nichtrelativistischer Grenzfall der Diracgleichung
einfaches Beispiel: Ψ(t) =
⇒H=−
Ψ+ (t)
Ψ− (t)
keine Ortsabhängigkeit
e~
~ mit h+|+i = 1
~σ · B
2mc
~ 0, Bz ) konstant + homogen
wähle B(0,
d
SG: i~
dt
e~
Ψ+ (t)
Ψ+ (t)
=−
σz Bz
Ψ− (t)
Ψ− (t)
2mc
1 0
σz =
0 −1
⇒ i~
d
dt
e~Bz
Ψ+ (t)
Ψ+ (t)
=−
σz Bz
Ψ− (t)
−Ψ− (t)
2mc
Lösung:
iωL t
eBz
Ψ+ (t)
e
Ψ+ (0)
= −iωL t
mit ωL =
Lamorfrequenz
Ψ− (t)
e
Ψ− (0)
2mc
a
setze Ψ(0) =
mit a, b ∈ R
b
~ = Ψ† (t) ~ ~σ Ψ(t)
⇒ hSi
2
hS1 i = ab ~ cos(2ωL t)
hS2 i = −ab ~ sin(2ωL t)
~
hS3 i = (a2 − b2 )
2
Seite 83
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
Präzessionsbewegung um die Achse des Magnetfeldes mit Frequenzs 2ωL
4.6 Drehung von Spinoren
|+i , |−i Eigenvektoren (EV) bzgl. Sz , nun gesucht:
EV |ê± i bzgl. beliebiger Richtung, beschrieben durch den Einheitsvektor (Kugelkoordinaten)
ê = (sin θ cos ϕ, sin θ sin ϕ, cos θ) mit 0 ≤ ϕ < 2π und 0 ≤ θ ≤ π
Eigenwert (EW)-Gleichung:
~
Sê |ê± i = ± |ê± i
2
~ = ~ ê · ~σ = ~ (sin θ cos ϕ σ1 , sin θ sin ϕ σ2 , cos θ σ3 )
Sê = ê · S
2
2
~
cos θ
sin θ e−iϕ
=
−cos θ
2 sin θ eiϕ
θ
cos 2
⇒ |ê+ i =
θ
sin eiϕ
2
θ −iϕ
−sin 2 e
|ê− i =
θ
cos
2
Diese Zustände sind bis auf einen Phasenfaktor eiα eindeutig.
→ beliebiger Spinor
χ=
χ+
χ−
mit |χ+ |2 + |χ− |2 = 1
θ
θ
χ+ = cos eiα+ , χ− = cos eiα−
2
2
wähle ϕ = α+ − α− ⇒ χ EV bzgl. eines Einheitsvektors ê
1
Fazit: Für einen Spin − -Zustand gibt es immer eine Richtung ê, für die dieser Zustand ein
2
~ ist.
Eigenzustand des Operators ê · S
~ = ~ ~σ erzeugt Drehungen von Spinoren:
S
2
i
~
χ0 = e− ~ α~ ·S χ mit α
~ = α · ~n mit α: Drehwinkel, ~n: Drehachse
Seite 84
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
i
α·~
σ
2
χ0 = e|−{z
α) unitäre Matrix U † U = 1
} χ mit U (~
=U (~
α)
i
U (~
α) = e− 2 α·~σ = cos
α
α ~n~σ − i sin
~n~σ
2
2
∞
X
(−1)j α 2j
cos
~n~σ =
~n~σ
2
(2j)! 2
α
j=0
α
2
~n~σ
⇒ cos
2j
=
α 2j
2
((~n · ~σ )2 )j =
α 2j
2
1
∞
α
X
(−1)j α 2j
~n~σ = 1
= 1cos
2
(2j)! 2
2
α
j=0
sin
∞
∞
X
X
(−1)j α 2j+1
(−1)j α 2j+1
~n~σ =
~n~σ
= (~n~σ ) =
2
(2j + 1)! 2
(2j + 1)! 2
α
j=0
= (~n~σ ) sin
j=0
α
U (~
α) = cos
2
α
2
1 − i(~n · ~σ )sin
α
2
U (2π~n) = −1 ⇒ χ0 = −χ
U (4π~n) = 1
weiteres Beispiel:
−sin ϕ
α = θ, ~n = cos ϕ
0
0
sin θ cos ϕ
⇒ Drehung êz = 0 → ê = sin θ sin ϕ
1
cos θ
θ
θ −iϕ
−sin e
θ
θ
cos 2
2
⇒ U = cos 1 − i sin (sin ϕ σ1 − cos ϕ σ2 ) =
θ
θ
2
2
iϕ
sin e
cos
2
2
θ
1
cos 2
⇒U
=
θ = |ê+ i
0
sin eiϕ
2
θ −iϕ
0
−sin 2 e
U
=
θ = |ê− i X
1
cos
2
Seite 85
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
Bemerkung:
i
~
~ generiert Drehungen der Wellenfunktion → UL (~
Bahndrehimpuls L
α) = e− ~ α~ ·L
betrachte Spinorwellenfunktionen:
Ψ+ (~r)
Ψ(~r) =
Ψ− (~r)
UL (~
α)Ψ+ (~r)
Ψ (~r) = Us (~
α)
UL (~
α)Ψ− (~r)
0
= Us (~
α)UL (~
α)Ψ(~r)
i
~
~
= e− ~ α~ ·(L+S) Ψ(~r)
~ +S
~ erzeugt räumliche Drehung
⇒ Gesamtdrehimpuls ~j = L
4.7 Addition von Drehimpulsen
~ +S
~ mit L:
~ Bahndrehimpuls und S:
~ Spin
Beispiele: J~ = L
~=S
~ (1) + S
~ (2) Spins zweier Elektronen
S
nun: betrachte 2 Drehimpulse J~(1) und J~(2)
Eigenschaften:
(α)
(α)
(1) [J~j , J~k ] = i~jkl J~(α) l mit α = 1, 2
(1)
(2)
[J~j , J~k ] = 0
(ii) (J~(1) )2 |j1 m1 i = ~2 j1 (j1 + 1) |j1 m1 i
(1)
J~3 |j1 m1 i = ~m1 |j1 m1 i, analog J~(2)
−j1 ≤ m1 ≤ j1
2j1 + 1 Werte
−j2 ≤ m2 ≤ j2
2j2 + 1 Werte
(iii) Gesamtdrehimpuls
J~ = J~(1) + J~(2)
Basis des zugehörigen Vektorraums wird durch folgende Werte aufgespannt
|j1 m1 ; j2 m2 i ≡ |j1 m1 i ⊗ |j1 m2 i
Seite 86
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
zugehöriger Hilbertraum
H = Hj1 ⊗ Hj2
dimH = (2j1 + 1)(2j2 + 1)
(iv) [Jj , Jk ] = i~jklJl
(v) gesucht: Eigenzustände von |j m, j1 j2 i von J~2 , J3 , (J~(1) )2 , (J~(2) )2
1
J~2 |j m; j1 j2 i = ~2 j(j + 1) |j m; j1 j2 i mit j = 0, , 1, . . .
2
J3 |j m; j1 j2 i = ~m |j m; j1 j2 i mit −j ≤ m ≤ j
(1)
(2)
J3 = J3 + J3
⇒ m = m1 + m2
(α)
(vi) |j1 m1 ; j2 m2 i i.a. nicht Eigenzustand von J~2 , denn [J~2 , J~3 ] 6= 0
j = j1 + j2 größtmöglicher Wert
m = −(j1 + j2 ), . . . , j1 + j2 − 1, j1 + j2
|j1 j2 ; j2 j2 i = |j1 + j2 ; j1 + j2 ; j1 j2 i
| {z } | {z }
=j
=m
für gegebenes m und verschiedene Werte von m1 und m2 mit m = m1 + m2 möglich
m = 5, j1 = 3
m = 4, j2 = 2
m=3
m=2
(vii) mögliche Werte für den Gesamtdrehimpuls
j1 + j2 , j1 + j2 − 1, . . . , |j1 − j2 |
Anzahl der Möglichkeiten:
jX
1 +j2
(2j + 1) = (2j1 + 1)(2j2 + 1)
j=|j1 −j2 |
Basistransformation:
|j m; j1 j2 i =
X
|j1 m1 ; j2 m2 i hj1 m1 ; j2 m2 |j m; j1 j2 i
m=m1 +m2
X
m=m1 +m2
|j1 m1 ; j2 m2 i >
j1 j2 j
Cm
| 1{zm2 m}
Clebsch-Gordon-Koeffizienten
Seite 87
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
4
TEILCHEN IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD
1
1
(viii) Beispiel: j1 = , j2 = , mögliche Zustände:
2
2
|
11 11
;
i ≡ |+ +i
22 22
1 1 11
i ≡ |− +i
| ,− ;
2 2 22
|
11 1 1
; , − i ≡ |+ −i
22 2 2
1 1 1 1
| , − ; , − i ≡ |− −i
2 2 2 2
(α)
(α)
Leiteroperatoren: J± = J1
(α)
± iJ2
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
J~2 = (J~(1) )2 + (J~(2) )2 + 2J~(1) J~(2) = (J~(1) )2 + (J~(2) )2 + J~3 J~3 + J~+ J~− + J~− J~+
⇒ J~2 |+ +i =
3 2 3 2
~~
~ + ~ +2
+ 0 + 0 |+ +i = 2~2 |+ +i
4
4
22
J~2 |− −i = 2~2 |− −i
~2
⇒ J |+ −i =
~~
3 2 3 2
~ + ~ −2
4
4
22
|+ −i + ~2 |− +i = ~2 (|+ −i + |− +i)
J~2 |− +i = ~2 (|− +i + |+ −i)
j = 1: J~2 |j mi j1 j2 i = ~2 j(j + 1) |j mi = 2~2
{z
}
|
≡|j mi
|1 1i = |+ +i, da J~2 |+ +i = 2~2 |+ +i
1
1
|1 0i = √ (|+ −i + |− +i) mit √ : Normierung
2
2
1
1
J~2 |1 0i = √ ~2 |+ −i + ~2 |− +i + ~2 |− +i + ~2 |+ −i = √ 2~2 (|+ −i + |− +i) = 2~2 |1 0i X
2
2
|1 − 1i = |− −i
j = 1: Tripplett: |1 1i , |1 0i , |1 − 1i
1
j = 0: |0 0i = √ (|+ −i − |− +i) Singulett
2
1
J~2 |0 0i = √ ~2 |+ −i + ~2 |− +i − ~2 |− +i − ~2 |+ −i = 0 |0 0i X
2
Clebsch-Gordon-Koeffizienten:
Seite 88
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
X
|j mi =
j1 j2 j
|j1 m1 ; j2 m2 i Cm
1 m2
5
ZEITUNABHÄNGIGE STÖRUNGSTHEORIE
m
m=m1 +m2
1 1
1
1 1
1
|1 0i = C 12 −2 1 0 |+ −i + C−2 12 1 0 |− +i
| 2{z 2 }
| {z2 2 }
= √1
2
= √1
2
5 Zeitunabhängige Störungstheorie
5.1 Problemstellung
Ausgangspunkt: Hamiltonoperator
H = H0 + λH1
H0 : Spektrum der EW und EV bekannt: H0 |n(0) i = En(0) |n(0) i mit hm(0) |n(0) i = δmn
H1 : beschreibt (kleine) Störung des Systems lambda ∈ R: Hilfsparameter
gesucht: EW und EV von H : H |ni = En |ni
Idee: entwickle |ni nach bekannten Eigenzuständen: |n(0) i
|ni =
X
|m(0) i cmn
m
Bestimme diese Entwicklung approximativ im Rahmen einer Störungstheorie → entwickle E1 und
|ni nach Potenzen von λ
En = En v + λEn(1) + λ2 En(2) + . . .
En(i) , i ≥ 1: Korrektur i-ter Ordnung zum n-ten EW
|ni = |n(0) i + λ |n(1) i + λ2 |n(2) i + . . .
→ versuche En(i) und |n(i) i mit i ≥ 1 durch bekannte EW En(i) und EV |n(0) i auszudrücken.
(i) λ wird zur Sortierung der Ordnung der Entwicklung benötigt.
(ii) |ni gemäß obiger Entwicklung unnormiert → Normierung von |ni durch hn(0) |ni = 1
⇒ λ hn(0) |n(1) i + λ2 hn(0) |n(2) i + · · · = 0
⇒ hn(0) |n(1) i + hn(0) |n(2) i = · · · = 0 (Begründung hierfür später)
(iii) wichtig, ob |n(0) i entartet oder nicht entartet ist → Störterm kann Entartung aufheben.
Seite 89
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
5
ZEITUNABHÄNGIGE STÖRUNGSTHEORIE
5.2 Nicht-entartete Störungsrechnung
Zustände |n(0) i seien nicht entartet ⇒ EW-Gleichung
(H0 +λH1 )(|n(0) i+λ |n(1) i+λ2 |n(2) i+. . . ) = (En(0) +λEn(1) +λ2 En(2) +. . . )(|n(0) i+λ |n(1) i+λ2 |n(2) i+. . . )
ordne nach Potenzen von λ
H0 |n(0) i + λ(H0 |n(1) i + H1 |n(0) i) + λ2 (H0 |n(2) i + H1 |n(1) i) + . . .
= En(0) |n(0) i + λ(En(0) |n(1) i + En(2) |n(0) i) + λ2 (En(0) |n(2) i + En(1) |n(1) i + En(2) |n(0) i)
⇒ (i) H0 |n(0) i = En(0) |n(0) i
(ii) H0 |n(1) i + H1 |n(0) i = En(0) |n(1) i + En(1) |n(0) i
(iii) H0 |n(2) i + H1 |n(1) i = En(0) |n(2) i + En(1) |n(1) i + En(2) |n(0) i
multipliziere Gl. (ii) von links mit hm(0) |
⇒ hm(0) |H0 |n(1) i + hm(0) |H1 |n(0) i = En(0) hm(0) |n(1) i + En(1) hm(0) |n(0) i
|
| {z }
{z
}
=δmn
(0)
=Em hm(0) |m(1) i
(0)
⇒ (Em
− En(0) ) hm(0) |n(1) i + hm(0) |H1 |n(0) i = En(1) δmn
m=n
En(1) = hn(0) |H1 |n(0) i
Korrektur zur Energie in erster Ordnung = Erwartngswert der Störung im ungestörten Zustand
hm(0) |n(1) i =
hm(0) |H1 |n(0) i
(0)
(0)
En − Em
Entwicklungskoeffizienten in der Basis der ungestörten Eigenzustände
⇒ |n(1) i =
X
|m(0) i hm(0) |n(1) i =
n6=m
X
|m(0) i
n6=m
hm(0) |H|n(0) i
(0)
(0)
En − Em
Warum hn(0) |n(1) i = 0
|n(1) i Lösung von Gl. (ii) ⇒ |n(1) i + α |n(0) i mit bel α ∈ R auch Lösung von Gl. (ii)
→ Nutze diese Freiheit, um m = n-Term abzuziehen
setze im folgenden hn(0) |n(1) i = 0 für i ≥ 1
Korrektur 2. Ordnung:
Seite 90
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
5
ZEITUNABHÄNGIGE STÖRUNGSTHEORIE
Gl. (ii) ⇒ hn(0) |H0 |n(2) i + hn(0) |H1 |n(1) i
|
{z
}
(0)
=En hn(0) |n(2) i=0
= En(0) hn(0) |n(2) i +En(1) hn(0) |n(1) i +En(2) hn(0) |n(0) i
| {z }
| {z }
| {z }
=0
=0
⇒ En(2) hn(0) |H1 |n(1) i =
=1
X |hm(0) |H1 |n(0) i|2
(0)
(0)
En − Em
n6=m
5.3 Störungstherme für entartete Zustände
(0) (0)
H0 |n(0)
α i = En |nα i mit α = 1, . . . , k, k-fache Entartung
|n(0)
α i bilden Orthonormalbasis in k-dimensionalen Eigenraum ⇒
(0)
hn(0)
α |nβ i = δαβ ∀α, β = 1, . . . , k
⇒ H0 |n
(0)
i=
En(0) |n(0) i
mit |n
(0)
i=
k
X
|n(0)
α i cα
α=1
Gl.(ii) ⇒ (H0 − En(0) ) |n(1) i = −(H1 − En(1) ) |n(0) i
(0)
multipliziere von links mit hnβ |
(0)
(0)
hnβ |H0 − En(0) |n(1) i = − hnβ |H1 − En(1) |n(0) i
{z
}
|
=0
⇒
k
X
(0)
hnβ |H1 |n(0)
α i cα =⇒
α=1
⇒
k
X
k
X
(0)
En(1) hnβ |n(0)
α i cα
|
{z
}
α=1
=δβα
(0)
(1)
(hnβ |H1 |n(0)
α i − En δαβ )cα = 0 (*)
α=1
(0)
(Ĥ1 )αβ = hnβ |H1 |n(0)
α i
⇒ Säkulargleichung
det(Ĥ1 − En(1) 1) = 0
→ Polynom k-ten Grades in En(1)
(1)
→ k Lösungen Enx
, mit x = 1, . . . , k
Seite 91
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
5
ZEITUNABHÄNGIGE STÖRUNGSTHEORIE
(1)
→ homogenes Gleichungssystem (*) liefert für verschiedene Enx
die EV mit Komponenten
cαx , x = 1, . . . , k
5.4 Ritzsches Variationsprinzip
stationäre SG: HΨn = En Ψn
{Ψn } vollständige Orthonormalbasis, n = 0, 1, 2, 3, . . .
⇒ bel. Funktion Ψ mit hΨ|Ψi = 1 lässt sich wie folgt darstellen:
Ψ=
X
cn Ψn
n
Seien nun die Ψn und En unbekannt. Dann kann die Grundzustandsenergie E0 wie folgt abgeschätzt
werden:
E0 ≤ hΨ|H|Ψi ≡ hHi mit Ψ : bel. Funktion mit hΨ|Ψi = 1
Beweis: 1 = hΨ|Ψi
=h
X
cm Ψm |
m
=
=
X
cn Ψn i
n
XX
m
X
n
c∗m cn hΨm |Ψm i
| {z }
=δmn
X
X
XX
|cn |2 hHi = h
ck Ψk |H|
cl Ψl i =
c∗k cl El δkl
n
=
X
k
Ek |ck |2 ≥ E0
l
l
X
k
l
|ck |2 = E0
| k {z }
=1
Ritzsches Verfahren: betrachte eine Schar von Testwellenfunktionen, die von Variationsparametern
α1 , . . . αp abhängt:
Ψ(α1 , . . . , αp ) normierte Wellenfunktion
E(α1 , . . . , αp ) = hΨ(α1 , . . . , αp )|H|Ψ(α1 , . . . , αp )i
minimiere nun E bzgl. der αi
⇒ ER = min E(α1 , . . . , αp ) ≥ E0
αi
ER obere Schranke für E0
Bsp.1: harmonischer Oszillator
Seite 92
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
H=−
5
ZEITUNABHÄNGIGE STÖRUNGSTHEORIE
~2 d2
1
+ mω 2 x2
2
2m dx
2
2
Ansatz für Testfunktion: Ψ(x) = Ae−bx → funktionale Form der Wellenfunktion für |x| → ∞
Normierung:
!
Z∞
1 ==
dx e
−2bx2
2
r
= |A|
π
2b
−∞
⇒A=
2b
π
1
4
~2
hΨ|H|Ψi = −
2m
2b
π
1 Z∞
2
e
−2bx2
d2 −2bx2
1
(e
)dx + mω 2
2
dx
2
−∞
=
2b
π
1 Z∞
2
2
x2 e−2bx dx
−∞
~2
mω 2
b+
(+)
2m
8b
minimiere bzgl. b:
d
db
~2
mω 2
b+
2m
8b
=0
~2
mω 2
1
−
= 0 ⇒ b = f racmω~
2m
8b
2
in Gl. (+): ⇒
1
1
1
ER = ~ω + ~ω = ~ω = exakte Grundzustandsenergie
4
4
2
Bsp. 2: Potentialtopf
U (x) =
H=−
0 |x| < L
∞ |x| > L
~2 d2
+ U (x)
2m dx2
1
exakt: ϕ0 (x) = √ cos
L
~2
E0 =
2m
π2
4L2
1
√ x
2L
nun: Variationsrechnung
Anforderungen an Testfunktion
Seite 93
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
→ ϕ(x, α) = 0 für |x| > L
→ keine Knoten
wähle ϕ(x, α) = N (Lα − |x|α )
ϕ(x, α) = 0 für |x| > L
Normierung:
N
2
ZL
α
α 2
dx(L − |x| ) = 2N
2
ZL
−L
dx(Lα − xα)2 = L2α+1
2α2 2N 2
(2α + 1)(α + 1)
0
⇒ N2 =
(α + 1)(2α + 1)
4α2 L2α+1
~2
⇒ E(α) = −N
2m
2
ZL
dx(Lα − |x|α )
d2
(Lα − |x|α )
dx2
−L
= N2
~2 2α−1 α2
~2 (2α + 1)(α + 1)
L
=
m
2α − 1
4mL2
2α − 1
√
1
αmin = (1 + 6) ≈ 1, 72
2
ER = E(αmin ) ≈ 1, 00298E
6 Grundlagen der Quantentheorie vieler Teilchen
6.1 Schrödingergleichung
betrachte System aus N Teilchen (spinlos) → Gesamt-Hilbertraum
H = H1 ⊗ H2 ⊗ · · · ⊗ HN
Hi : Hilbertraum von Teilchen i
→ uneigentliche Basis im Ortsraum
|vecr1 i ⊗ · · · ⊗ |~rN i ≡ |~r1 , . . . , ~rN i
→ bel. Zustand in Ortsraumbasis
Z
Z
3
|Ψi = d r1 . . . d3 rN |~r1 , . . . , ~rN i h~r1 , . . . , ~rN |Ψi
|
{z
}
=Ψ(~
r1 ,...,~
rN )
Seite 94
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
Z
d3 r1 . . .
=
Z
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
d3 rN Ψ(~r1 , . . . , ~rN ) |~r1 , . . . , ~rN i
→ Normierung
Z
Z
3
d r1 . . .
d3 rN |Ψ(~r1 , . . . , ~rN )|2 = 1
im folgenden Hamiltonoperator der Form:
H=
N
X
1 (i)2
p~
+ U (~r1 , . . . , ~rN )
2mi
i=1
Annahme: N -Teilchenpotential paarweise additiv
N
U (~r1 , . . . , ~rN ) =
N
1 XX
Uij (|~ri − ~rj |) mit i 6= j
2
| {z }
i=1 j=1
≡rij
Coloumbpotential
Uij (rij ) =
SG: i~
1 z i zj e 2
mit zi e: Ladung von Teilchen i
4π0 rij
∂
Ψ(~r1 , . . . , ~rN , t) = HΨ(~r1 , . . . , ~rN , t) mit Spinfreiheitsgraden
∂t
Ψ = ϕ(~r1 , . . . , ~rN , t)χ(σ1 , . . . , σN , t) mit σi = ±1
6.2 Ununterscheidbarkeit
• N-Teilchensystem, wobei alle Teilchen identische Eigenschaften bzgl. Masse, Ladung etc. haben
• Überlapp der Wellenfunktionen
• q.m. keine Teilchentrajektorien wie im klassischen Fall
⇒ Teilchen sind ununterscheidbar
Bsp.: Streuung zweier Elektronen
−
e−
1 , e2 : aus dem Unendlichen einlaufende Elektronen
Vielteilchenzustand für ununterscheidbare Teilchen
(1) betrachte System aus N Teilchen, die nicht miteinander wechselwirken:
H=
N
X
i=1
H(i) mit H(i) = −
~2
∆i + U (~ri )
2m
stationäre SG: HΨ(1, . . . , N ) = EΨ(1, . . . , N )
Seite 95
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
Einteilchen Wellenfunktion:
H(i)ϕαi = Eαi ϕαi (i)
αi : Satz von QZ für Teilchen i → Elektron αi = (ni , li , mi , msi )
Gesamt-Wellenfunktion: Produkt der Einteilchen-Wellenfunktionen
Ψ(1, . . . , N ) =
N
Y
ϕαi (i) (*)
i=1
E=
N
X
Eαi
i=1
Ununterscheidbarkeit: Zustand des System wird beschrieben als Linearkombination von Termen der
Form (*)
Bsp: n = 2
Ψ(~r1 , ~r2 ) = N (ϕ1 (~r1 )ϕ2 (~r2 ) ± ϕ2 (~r1 )ϕ1 (~r2 )) mit N : Normierungsfaktor
→ Für Elektronen gilt das Pauliverbot. Jeder Einteilchenzustand ϕα kann höchstens von einem
Elektron besetzt werden.
→ Wellenfunktion ist in diesem Fall total antisymmetrisch (Pauliprinzip)
→ im Bsp.: Ψ(~r1 , ~r2 ) = N (ϕ1 (~r1 )ϕ2 (~r2 ) − ϕ2 (~r1 )ϕ1 (~r2 ))
Konstruktion einer total antisymmetrischen Wellenfunktion für N Teilchen
ϕα1 (1) . . .
1
..
..
Ψα1 ,...,αN (1, . . . , N ) = √ det .
.
N!
ϕαN (1) . . .
ϕα1 (N )
..
.
ϕαN (N )
Bemerkungen:
• Teilchen, die dem Pauliprinzip genügen, tragen immer einen halbzahligen Spin und heißen
Fermionen.
• Teilchen mit ganzzahligem Spin heißen Bosonen. → Wellenfunktion total symmetrisch
6.3 Das Heliumatom
He-Kern ≈ 8000 mal schwerer als Elektron → vernachlässige Bewegung des Kerns
Hamiltonoperator: z = 2
Seite 96
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
~2
~2
e2
1
ze2
ze2
H=−
−
+
= H(1) + H(2) + Uee (r12 )
∆1 −
∆2 −
2m
4π0 r1 2m
4π0 r2 4π0 |~r1 − ~r2 |
|
{z
}|
{z
} |
{z
}
=H(1)
=H(2)
=Uee (r12 )
Wellenfunktion: Ψσ1 σ2 (~r1 , ~r2 ) = ϕ(~r1 , ~r2 )χ(σ1 , σ2 )
~=S
~ (1) + S
~ (2)
Gesamtspin: S
⇒ Spintriplett, S = 1 ⇒ Orthohelium
|1 1i = |+ +i
1
|1 0i = √ (|+ −i + |− +i)
2
|1 − 1i = |− −i
Pauliprinzip ⇒ ϕ(~r1 , ~r2 ) muss antisymmetrisch sein
Spinsingulett, S = 0 → Parahelium
1
|0 0i = √ (|+ −i − |− +i)
2
antisymmetrisch ⇒ ϕ(~r1 , ~r2 ) symmetrisch
6.3.1 Parahelium: Störungsrechnung 1. Ordnung
Problem für H0 = H(1) + H(2) gelöst.
En(0)
1 n2
2
= En1 + En2 = −z RHe
RHe =
me4
2~(4π0 )
1
1
+ 2
2
n1 n2
mit z = 2
m −1
1+
= 13, 604eV mit m: Elektronenmasse, MHe : Masse des He-Kerns.
MHe
1
m
≈
MHe
8000
Parahelium: ϕ(~r1 , ~r2 ) symmetrisch
ϕ(~r1 , ~r2 ) = N (ϕn1 l1 m1 (~r1 )ϕn2 l2 m2 (~r2 ) + ϕn2 l2 m2 (~r1 )ϕn1 l1 m1 (~r2 ))
Grundzustand: n1 = n2 = 1 ⇒ ϕ(~r1 , ~r2 ) = ϕ100(~r1 )ϕ100 (~r2 )
(0)
E11 = −2 · 4 · RHe = −108, 8eV
störungstheoretische Korrektur 1. Ordnung für den Grundzustand
Z
∆E11 = h100, 100|Uee |100, 100i =
3
d r1
Z
d3 r2 |ϕ100 (~r1 )|2 |ϕ100 (~r2 )|2
e2
1
4π0 |~r1 − ~r2 |
Seite 97
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
1
ϕ100 (~r) = √
π
z
r0
3
2
e
− rzr
0
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
mit z = 2, r0 : Bohrscher Radius
orientiere ~r1 in Richtung der z2 -Achse
|~r1 − ~r2 | =
⇒ ∆E11
5
=
4r0
q
r12 + r22 − 2r1 r2 cos θ2
1
= 2
π
e2
4π0
8
r02
2 Z
3
Z
d r1
d3 r2 e
− r4 (r1 +r2 )
0
1
p
2
2
r1 + r2 − 2r1 r2 cos θ2
5
= zRHe = 34eV
4
(0)
⇒ E11 ' E11 + ∆E11 = −108, 8eV + 34eV = −74, 8eV
experimenteller Wert: E11 = −78, 975eV
6.3.2 Variationsrechnung für Parahelium
Idee: z → z ∗ effektive Ladungszahl: Elektronen bewegen sich im Coulombfeld des Kerns, das durch
das jeweilige andere Elektron abgeschirmt ist.
⇒ Testfunktion
Ψ(~r1 , ~r2 , z ∗ ) = ϕ100 (~r1 , z ∗ )ϕ100 (~r2 , z ∗ )
Hamiltonoperator: z = 2
H=
1 (1)2
z ∗ e2
(z − z ∗ )e2
1 (2)2
z ∗ e2
(z − z ∗ )e2
e2
1
−
−
p~
−
+
p~
−
+
2m
4π0 r1
4π0 r1
2m
4π0 r2
4π0 r2
4π0 |~r1 − ~r2 |
⇒ hΨ|H|Ψi = E(z ∗ ) = 2E0 (z ∗ ) −
2
= −2z ∗ RHe − 2
1
2(z − z ∗ )e2
hϕ100 | |ϕ100 i + hΨ|Uee |Ψi
4π0
r
(z − z ∗ )e2 z ∗ 5 ∗
+ z RHe
4π0 r0 4
|
{z
}
=2RHe (z−z ∗ )z ∗
∗2
∗
= −2z RHe − 4RHe zz + 4RHe z
∗2
5 ∗
5 ∗
∗2
∗
+ z RHe = RHe 2z − 4zz + z
4
4
∂E(z ∗ )
5
27
∗
∗
Minimum:
= 0 = RHe 4z − 4z +
= RHe 4z −
∂z ∗
4
5
⇒ z∗ =
27
= 1, 6875
16
Seite 98
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
⇒ ER = RHe
27
5
−8+
8
4
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
27
729
=−
RHe = −77, 5eV
16
128
6.3.3 Störungsrechnung für Orthohelium
Orthohelium ϕ(~r1 , ~r2 ) antisymmetrisch
1
ϕ(~r1 , ~r2 ) = √ (ϕn1 l1 m1 (~r1 )ϕn2 l2 m2 (~r2 ) − ϕn2 l2 m2 (~r1 )ϕn1 l1 m1 (~r2 ))
2
hier: (n1 , l1 , m1 ) 6= (n2 , l2 , m2 )
Zustand niedrigster Energie: n1 = 1, n2 = 2
1
ϕ = √ (ϕ100 (~r1 )ϕ2lm (~r2 ) − ϕ2lm (~r1 )ϕ100 (~r2 ))
2
5
(0)
E12 = − z 2 RHe = −68, 0eV
4
störungstheoretische Korrektur
∆E1n
=
1
=
2
1 e2
2 4π0
Z
3
Z
d3 r2 |ϕ100 (~r1 )ϕnlm (~r2 ) − ϕnlm (~r1 )ϕ100 (~r2 )|2
Z
d3 r2
d r1
Z
d3 r1
e2
1
4π0 |~r1 − ~r2 |
1
|ϕ100 (~r1 )ϕnlm (~r2 )|2
|~r1 − ~r2 |
+|ϕnlm (~r1 )ϕ100 (~r2 )|2 − ϕ∗100 (~r1 )ϕ∗nlm (~r2 )ϕnlm (~r1 )ϕ100 (~r2 ) − ϕ∗nlm (~r1 )ϕ∗100 (~r2 )ϕ100 (~r2 )ϕnlm (~r2 )
e2
=
4π
| 0
Z
e2
4π
| 0
Z
−
3
Z
d r1
1
|ϕ100 (~r1 )ϕnlm (~r2 )|2
|~r1 − ~r2 |
{z
}
d3 r2
=Knl
d3 r1
Z
1
ϕ∗ (~r1 )ϕ∗nlm (~r2 )ϕnlm (~r1 )ϕ100 (~r2 )
|~r1 − ~r2 | 100
{z
}
d3 r2
=Anl
= Knl − Anl mit Knl : Coulombenergie, Anl : Austauschenergie (rein quantenmechanischer Effekt!)
(0)
Orthohelium: E12 = E12 + K2l − A2l
K21 = 13, 2 eV
A21 = 15, 9 eV
A20 = 0, 6 eV
(0)
Parahelium E12 = E12 + K2l − A2l
Termschema von He:
Seite 99
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616 6 GRUNDLAGEN
DER QUANTENTHEORIE VIELER TEILCHEN
Bezeichnungen: l = 0, 1, 2, 3, . . . mit
l = 0 : s(sharp)
l = 1 : p(principle)
l = 2 : d(diffuse)
l = 3 : f (fine)
Grundzustand: 1s mit 1: Hauptquantenzahl, s: Drehimpulsquantenzahl
Gesamtsystem:
2s+1
LJ mit s: Gesamtspin, L Gesamtbahndrehimpuls, J: Gesamtdrehimpuls
6.3.4 Austauschwechselwirkung
(0)
He : E1n = E1n + Knl ± Anl
+Anl : Parahelium
−Anl : Orthohelium
Interpretation von ±Anl ?
Betrachte dazu einfacheds Modell: 2 Teilchen in 1 Dimension, die die Zustände ϕ1 (x) und ϕ2 (x)
einnehmen können.
Z
Annahme: dx ϕ∗1 (x)ϕ2 (x) = 0
(1)ϕ(x1 , x2 ) = ϕ1 (x1 )ϕ2 (x2 ) Teilchen unterscheidbar
1
(2)ϕ(x1 , x2 ) = √ (ϕ1 (x1 )ϕ2 (x2 ) + ϕ2 (x1 )ϕ1 (x2 )) Bosonen
2
1
(3)ϕ(x1 , x2 ) = √ (ϕ1 (x1 )ϕ2 (x2 ) − ϕ2 (x1 )ϕ1 (x2 )) Fermionen
2
berechne nun mittleres Abstandsquadrat zwischen den Teilchen
δ 2 = h(x1 − x2 )2 i = hx21 i + hx22 i − h2x1 x2 i
Fall (1): Teilchen unterscheidbar
hx21 i =
Z
dx1 dx2 |ϕ(x1 , x2 )|2 x21 =
Z
dx1 x21 |ϕ1 (x1 )|2
Z
dx2 |ϕ2 (x2 )|2 = h1|x21 |1i
|
{z
}
=1
hx22 i = h2|x21 |2i
hx1 x2 i = h1|x1 |1i h2|x2 |2i
⇒ δF2 1 = h1|x21 |1i + h2|x22 |2i − 2 h1|x1 |1i h2|x2 |2i
Seite 100
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
7
MESSPROZESS
Fall (2): Bosonen
hx21 i =
Z
hx22 i =
1
1
h2|x22 |2i + h1|x22 |1i
2
2
dx1 dx2 x21 |ϕ1 (x1 )ϕ2 (x2 ) + ϕ2 (x1 )ϕ1 (x2 )|2 =
1
1
h1|x21 |1i + h2|x21 |2i
2
2
hx1 x2 i = h1|x|1i h2|x|2i + 2|h1|X|2i|2
Fall (3): Fermionen
δ 2 = δF2 1 + 4|h1|x|2i|2
Symmetrische Wellenfunktionen lassen Teilchen tendenziell näher zusammenrücken, während
Teilchen, deren Zustand durch antisymmetrische Wellenfunktionen beschrieben werden, im Mittel
weiter voneinander entfernt sind.
zurück zu He:
Ortho-He: ϕ(~r1 , ~r2 ) antisymmetrisch ⇒ δ 2 > δF2 1 ⇒ Energie niedriger
Para-He: ϕ(~r1 , ~r2 ) symmetrisch ⇒ δ 2 < δF2 1 ⇒ Energie größer
7 Messprozess
7.1 Spinkorrelation
betrachte 2-Elektronensystem im Singulett-Zustand
1
|0, 0i = √ (|+ −i − |− +i)
2
z-Achse als Quantisierungsachse, deshalb schreibe
1
|0, 0i = √ (|z+ z− i − |z− z+ i)
2
Experiment für System im Singulett-Zustand
B
Teilchen 2
←
⊗
Teilchen 1
→
A
Beobachter A und B, die beliebig weit voneinander entfernt sein können.
Verschiedene Messungen:
• A und B messen Sz , A misst ±
~
~
⇒ B misst mit Sicherheit ∓
2
2
Seite 101
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
• A macht keine Messung ⇒ B misst mit Wahrscheinlichkeit 1/2
7
MESSPROZESS
~
~
oder −
2
2
x-Achse als Quantisierungsachse
1
|0, 0i = √ (|x− x+ i − |x+ x− i)
2
Beobachter A: Messung von Sz oder Sx
Beobachter B: Messung von Sx
A misst Sx = +
~
~
⇒ B misst Sx = −
2
2
A misst Sz = +
~
~
⇒ B misst mit Wahrscheinlichkeit 1/2 jeweils ±
2
2
wegen [Sz , Sx ] 6= 0 ist Sx dabei vollkommen unbestimmt.
7.2 EPR-Paradoxon
Einstein, Podolsky, Rosen (1935)
→ physikalische Realität
“Kann man den Wert einer physikalischen Größe mit Sicherheit vorhersagen, ohne ein System zu
stören, dann gibt es ein Element der physikalischen Realität, das dieser Größe entspricht.“
→ Lokalitätsprinzip:
Die Messergebnisse am System A hängen nur von den Parametern des Systems A ab, und die
Messergebnisse am System B hängen nur von den Parametern des Systems B ab.
→ Obwohl Sx und Sz nicht gleichzeitig gemessen werden können, hat jeder Spin eine eindeutige z
und eine eindeutige x-Komponente, z.B. (z+ , x− ) (widerspricht der QM!)
2 Elektronen im Spin-Singulett-Zustand
Teilchen 1
(z+ , x− )
(z+ , x+ )
(z− , x+ )
(z− , x− )
↔
↔
↔
↔
Teilchen 2
(z− , x+ )
(z− , x− )
(z+ , x− )
(z+ , x+ )
⇒ erklärt auch obiges Experiment
Verallgemeinerung: betrachte Spinkomponenten bzgl. dreier Einheitsvektoren n̂1 , n̂2 , n̂3
~ · n̂3
~ · n̂1 , S
~ · n̂2 , S
→S
Seite 102
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
7
MESSPROZESS
nun 8 Möglichkeiten:
Teilchen 1
(n̂1+ , n̂2+ , n̂3+ )
(n̂1+ , n̂2+ , n̂3− )
(n̂1+ , n̂2− , n̂3+ )
(n̂1− , n̂2+ , n̂3+ )
(n̂1+ , n̂2− , n̂3− )
(n̂1− , n̂2+ , n̂3− )
(n̂1− , n̂2− , n̂3+ )
(n̂1− , n̂2− , n̂3− )
Teilchen 2
(n̂1− , n̂2− , n̂3− )
(n̂1− , n̂2− , n̂3+ )
(n̂1− , n̂2+ , n̂3− )
(n̂1+ , n̂2− , n̂3− )
(n̂1− , n̂2+ , n̂3+ )
(n̂1+ , n̂2− , n̂3+ )
(n̂1+ , n̂2+ , n̂3− )
(n̂1+ , n̂2+ , n̂3+ )
Population
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
~ · n̂1 ) den Wert + ~ und B für (S
~ · n̂2 )
P (n̂1+ , n̂2+ ) = Wahrscheinlichkeit, dass Beobachter A für (S
2
~
den Wert + misst.
2
=
N3 + N5
8
P
Ni
i=1
P (n̂1+ , n̂3+ ) =
N2 + N5
8
P
Ni
i=1
P (n̂3+ , n̂2+ ) =
N3 + N7
8
P
Ni
i=1
⇒ P (n̂1+ , n̂2+ ) ≤ P (n̂3+ , n̂2+ ) + P (n̂1+ , n̂3+ ) Bellsche Ungleichung
folgt aus dem Lokalitätsprinzip
7.3 Quantenmechanik und Bellsche Ungleichung
Eigenvektoren zu ~s · ~n
θ
θ
θ iϕ
cos 2
|n̂+ i =
=
cos
|+i
+sin
e |−i
θ
|{z}
2 |{z}
2
sin eiϕ
2
1
0
=
=
0
1
θ iϕ
−sin 2 e
|n̂− i =
θ
cos
2
... hier fehlt was ...
Seite 103
Prof. Dr. Horbach, SS 2014, HHU Duesseldorf
Vorlesung: Quantenmechanik, inoffizielle Mitschrift
by: Christian Krause, Matr. 1956616
7
MESSPROZESS
1
= √ (|+i1 |−i2 − |−i1 |+i2 )
2
Wahrscheinlichkeit P (n̂1+ , n̂2+ ): Quadrat der Projektion von |0, 0i auf die jeweiligen Eigenzustände
⇒ P (n̂1+ , n̂2+ )
θ1
+
= 1 h+| cos
2
θ1
1 h−| sin
2
⊗
θ2
+
2 h+| cos
2
θ2
2 h−| sin
2
2
1
√ (|+i1 |−i2 − |−i1 |+i2 ) 2
θ2
θ1
θ2 2
θ1
− sin cos
= cos sin
2
2
2
2 1
= sin2
2
1
(θ2 − θ1 )
2
wähle nun θ1 = 0◦ , θ2 = 120◦ , θ3 = 60◦ ⇒
1
3
P (n̂1+ , n̂2+ ) = sin2 (60◦ ) =
2
8
1
1
P (n̂1+ , n̂3+ ) = sin2 (30◦ ) =
2
8
1
1
P (n̂3+ , n̂2+ ) = sin2 (30◦ ) =
2
8
⇒ Bellsche Ungleichung:
1 1
2
3
≤ + = Widerspruch
8
8 8
8
Quantenmechanische Vorhersage ist im Widrespruch zur Bellschen Ungleichung und zum
Lokalitätsprinzip.
•
•
•
•
•
Klausur
Drehimpulsoperatoren (Kommutatoren)
Störungsrechnung + Variationsrechnung
harmonischer Oszillator
Aufgaben zu Spins
Seite 104