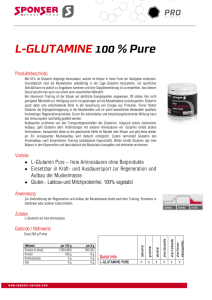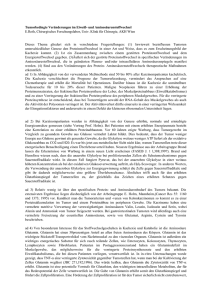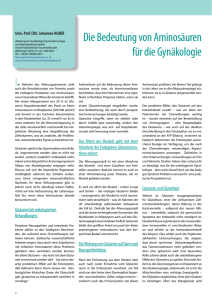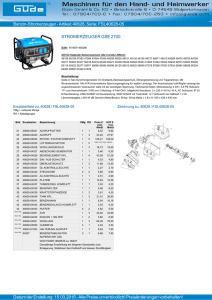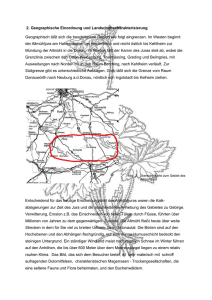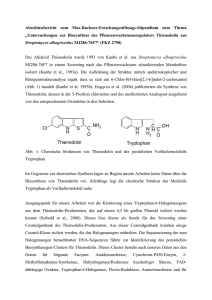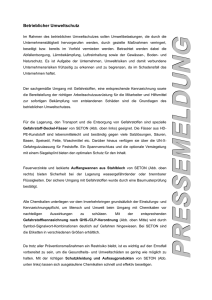Glutamin Dipeptid Supplementation in der enteralen Ernährung
Werbung

Aus der Klinik für Chirurgie des St. Josef Hospital Bochum Universitätsklinik der Ruhr-Universität-Bochum Direktor: Prof. Dr. med. V. Zumtobel Glutamin Dipeptid Supplementation in der enteralen Ernährung: Effekt enteraler bzw. parenteraler Zufuhr auf zelluläre und humorale Immunparameter. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin einer Hohen Medizinischen Fakultät der Ruhr -Universität Bochum Vorgelegt von Lars Schäfer aus Bochum (Geburtsort) 2003 Dekan: Prof. Dr. G. Muhr Referent: Priv. Doz. Dr. M. Senkal Koreferent: Prof. Dr. B. May Tag der mündlichen Prüfung: 29.07.2003 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung…………………………………………………………………………….1 1.1 Perioperative Immunantwort 1.2. Postoperative Immunonutrition 1.2.1 Immunmodulation durch Nährsubstrate 1.2.1.1 Glutamin zur Immunmodulation 2 Zielsetzung.......................................................................................................17 3 Material und Methoden……………………………………………………………..18 3.1 Patienten 3.1.1 Einschlusskriterien 3.1.2 Ausschlusskriterien 3.2. Behandlungsregime 3.2.1. Glutamin parenteral 3.2.2. Glutamin enteral 3.3. Zielparameter 3.4. Messverfahren 3.5. Statistische Methoden 4 Resultate………………………………………………………………………….….27 4.1 Patientencharakteristika 4.2 Ernährungsdaten 4.3 Laborchemische Parameter im Blut 4.4 T-Lymphozyten Subsets 4.5 Immunglobuline 4.6 Zytokine 5 Diskussion........................................................................................................47 5.1 Glutamin und zelluläre Immunparameter 5.2 Glutamin und Serum-Immunglobuline 5.3 Glutamin und Serum Zytokine IL-2, IL-6 und TNF-α 6 Zusammenfassung und Anregungen.…….......................................................57 7 Literaturverzeichnis……………………...………………………………...……..…59 Abkürzungen Ala-Gln Alanylglutamin AS Aminosäure BMI Body Mass Index CD Cluster of Differentiation DNS Desoxyribonukleinsäure FNKJ Feinnadelkatheterjejunostomie GH Growth Hormone Gln Glutamin GSH Glutathion Ig Immunglobulin IL Interleukin Li Lithium MHC Major Histocompatibility Complex ml Milliliter µl Mikroliter = 1*10-6 l MRSA Methicillin (Vancomycin) Resistenter Staphylokokkus Aureus N Stickstoff nm Nanometer = 1*10-9 m pg Picogramm = 1*10-12 g RNS Ribonukleinsäure TCGF T-Cell-Growth-Factor TEN totale enterale Ernährung TNF Tumor Nekrose Faktor TPN totale parenterale Ernährung Seite 1 1. Einleitung Die charakteristische Funktion des Immunsystems ist die, die Integrität des Körpers als abgeschlossenes System gegen fakultativ pathogene Einflüsse von außen und innen zu bewahren. Diese Fähigkeit beruht auf zwei Grundprinzipien, die einander zu einer komplexen aber spezifischen Abwehrreaktion ergänzen. Zelluläre und humorale Mechanismen ermöglichen es, zwischen in der Entwicklung als „Selbst“ erlernten und fremden Strukturen, zu differenzieren. Die MHC-Moleküle sind der wesentliche Bestandteil der zellulären Immunerkennung. Jede Zelle des Körpers bekundet über MHC-Moleküle ihre Unversehrtheit und ihre Zugehörigkeit zum selben System. Die enge Interaktion antigenpräsentierender und regulierender und phagozytierender Zellen und -erkennender sowie deren Syntheseprodukte ermöglicht sowohl eine fein abgestimmte als auch umfassende Abwehrreaktion. Als interzelluläre Überträgerstoffe wurden mit den Zytokinen Proteine identifiziert, die pleiotrope Funktionen erfüllen und neben der direkten Kommunikation der Abwehrzellen auch systemische Wirkungen wie die Synthese von Akut-PhaseProteinen steuern4 . Im Unterschied zu den Hormonen werden die Zytokine von verschiedenen Zelltypen synthetisiert, haben zahlreiche Zielzellen und wirken bevorzugt paraund autokrin5. Eines der ersten beschriebenen Interleukine ist das IL -1, welches eine entscheidende Rolle bei der Auslösung einer Immunreaktion spielt. Wie bereits Seite 2 oben erwähnt, ist einer der ersten Schritte die Aufnahme und Präsentation von antigenem Material durch antigenpräsentierende Zellen. Die Ausschüttung von IL1 ist neben dem Kontakt von MHC-II-Molekül und T-Zell-Rezeptor ein Faktor, der den kontaktierten T-Helfer-Lymphozyten zur Proliferation stimuliert und so eine umschriebene und gerichtete Abwehrreaktion einleitet. Die aktivierten T-HelferZellen stimulieren ihrerseits zytotoxische T-Zellen und B-Lymphozyten über Sekretion weiterer Interleukine. Beim IL -1 wird besonders deutlich, dass sich das Wirkungsspektrum eines Zytokins nicht auf eine Funktion beschränken lässt. Neben den Lymphozyten regt es auch Hepatozyte n zur gesteigerten Synthese von Akute -Phase-Proteinen an, aktiviert Makrophagen, löst Fieber und Abgeschlagenheit im ZNS aus, steigert die Adhäsion von Leukozyten am Endothel, stimuliert Fibroblasten und Osteoklasten, wodurch eine umfassende Immunreaktion gegen den pathogenen Einfluss aufgebaut wird. Neben verschiedenen Effektorzellen konnte mit der Zeit auch nachgewiesen werden, dass nicht nur Makrophagen, sondern ebenfalls Endothel-, Epithelzellen, BLymphozyten, Fibroblasten, Gliazellen und andere IL -1 sezernieren. Die unterschiedlichen Affektoren und Effektoren heben einmal mehr die Komplexität der abgestimmten immunen Reaktion hervor. Der TNF-α ist dem IL-1 sowohl strukturell als auch funktionell in weiten Bereichen ähnlich. Der Name dieses Zytokins rührt von der Tatsache, dass unter seinem Einfluss eine erhöhte Nekroserate bei Tumorzellen beobachtet wurde. Frühe Hoffnungen auf einen bedeutenden therapeutischen Nutzen wurden jedoch durch seine weitreichenden zusätzlichen Funktionen enttäuscht. Der hauptsächlich von Makrophagen, aber auch von Lymphozyten sezernierte Faktor aktiviert NK-, K-Zellen, Makrophagen und Granulozyten, sorgt für eine Erhöhung der MHC-Molekül-Dichte auf den Zelloberflächen, fördert ebenfalls die Akut-Phase-Protein Synthese, wirkt als endogenes Pyrogen und stimuliert die Freisetzung von Hypophysenhormonen. Neben der immunstimulatorischen Komponente geht von ihm durch gesteigerte Koagulabilität des Blutes im Zusammenspiel mit dem Endothel und einer durch Katabolimus ausgelösten Kachexie eine Gefährdung des Organismus bei chronischen entzündlichen oder neoplastischen Erkrankungen aus 6. Seite 3 Das IL-2 wurde über seine Funktion, die Langzeitkultur von T-Zellen zu ermöglichen, Hauptsynthese zunächst und Hauptwachstums- als TCGF Zielzellen und (T-Cell-Growth-Factor) sind die T-Lymphozyten, Differenzierungsfaktor dient. bekannt. denen Durch IL -2 Seine es als wird die Aktivierung einzelner Lymphozyten durch Antigenpräsentierende Zellen weiter auf umgebene T-Zellen und, wie neuere Arbeiten gezeigt haben, ebenfalls auf BLymphozyten übertragen7. Die durch IL-2 gesteigerte IL -2-Rezeptor Synthese ermöglicht dem Immunsystem eine auto- und parakrine Verstärkung der Reaktion im Sinne des bewährten Schneeballsystems. Die Übertragung des Immunstimulus von aktivierten T-Lymphozyten auf ihre Mitstreiter der B-Reihe erfolgt über die vermehrte Sekretion von IL -4. Diese werden in ihrem Wachstum und ihrer Ausreifung gefördert und zu vermehrter Synthese von Immunglobulinen angeregt. Neben B-Zellen hat IL -4 auch modulatorische Effekte auf T-Lymphozyten und Makrophagen. Die Stimulation der B-Zellen ist auch eine der Hauptfunktionen des IL -6, welches in unserer Studie neben IL -2 und TNF-α ebenfalls erfasst wurde. Von Tund B-Zellen, Makrophagen und Fibroblasten synthetisiert sorgt es als Wachstumsfaktor zunächst für eine Vermehrung der B-Lymphozyten und anschließend für eine immunkompetente Differenzierung. Ebenso wie IL -1 und TNF-α wirkt es in der Leber als der potenteste Initiator der Akute-Phase-Reaktion und deckt im Gegensatz zu den vorher genannten Zytokinen das gesamte Spektrum der Proteinsynthesesteigerung und –hemmung ab8. Viele der in Studien in vitro und in vivo beobachteten Effekte lassen sich nicht durch die alleinige oder überwiegende Wirkung eines Zytokins erklären, sondern sind vielmehr als komplexes Zusammenspiel vieler bekannter und weiterer unbekannter Immunmodulatoren zu verstehen. So lassen sich die Modulatoren ihrer Funktion nach in Untergruppen zusammenfassen. Die oben genannten Faktoren IL-1, IL-6 und TNF-α lassen sich zum Beispiel gemeinsam entzündungsfördernden mit Zytokine IL -8 und einteilen, TGF-β in da ihnen eine Gruppe der immunologisch die Stimulation der Akut-Phase-Reaktion und eine Förderung der proteolytischen Seite 4 Prozessierung und Präsentation von Antigenen mittels MHC-II Molekülen gemein ist. Diesen steht die Gruppe bevorzugt entzündungshemmender Mediatoren mit IL-10, IL-13 und TGF-β gegenüber, die diesen Effekten entgegenwirken9. Tab.1.: Hauptfunktionen der Zytokine Zytokin Synthese- / Zielzelle Funktion IL-1 Antigen präsentierende Zellen, B- T-Lymphozyten Proliferation, Lymphozyten, Endothel-, Synthese von Akute -Phase Epithelzellen, Fibroblasten / T- Proteinen, Fieber, Helfer Zellen, Hepatozyten, Makrophagenaktivierung, Makrophagen, Osteoklasten, Leukozytenmigration Fibroblasten, Endothelzellen IL-2 Antigen präsentierende Zellen / T- wichtigster T-Zell WachstumsLymphozyten und Differenzierungsfaktor, Erhöhte IL-2 Rezeptordichte IL-4 T-Lymphozyten / B- und T- B- Zell Wachstums- und Lymphozyten, Makrophagen Differenzierungsfaktor, gesteigerte Immunglobulinsynthese, IL-6 TNF-α T- und B-Lymphozyten, Proliferation und Differenzierung Makrophagen, Fibroblasten / B- der B-Lymphozyten, Synthese Lymphozyten, Hepatozyten von Akute -Phase Proteinen Makrophagen, Lymphozyten / NK- Aktiviert NK-, K-Zellen, , K-Zellen, Makrophagen, Makrophagen und Granulozyten, Granulozyten erhöhte MHC-Molekül Dichte, Synthese von Akute -Phase Proteinen, Fieber, Katabolismus, gesteigerte Koagulabilität Seite 5 1.1 Perioperative Immunantwort Im Rahmen der postoperativen Anpassungsreaktionen von Kreislauf und Stoffwechsel mit Umverteilung von Zirkulation und Umstellung auf Katabolismus sind auch Veränderungen der Immunreaktion zu beobachten, deren Genese im Kampf gegen postoperati ve Komplikationen zunehmendes Interesse erweck hat. Die Tatsache, dass eine Immunsuppression sowohl bei der humoralen als auch der zellulären und sowohl bei der spezifischen als auch bei der unspezifischen Abwehr zu beobachten ist, macht den Organismus postoperativ an vielen Stellen verletzlich und bietet eine breite Angriffsfläche für schädigende Einflüsse, wie bakterielle Besiedlung und Infektion. Dabei ist die Schwächung der humoralen Reaktion in der gestörten Stimulation der B-Zellen durch aktivierte T-Helfer-Zellen begründet. Es konnte gezeigt werden, dass sich Defizite in der T-Zell abhängigen humoralen Antwort bei postoperativer Verabreichung von Tetanus-Toxoid mit Pneumokokken-Antigen nicht reproduzieren ließen10. Bei den Pneumokokken-Antigenen handelt es sich um Polysaccharide, welche eine direkte B-Zell Aktivierung bewirken und somit eine T-Zell unabhängige humorale Immunantwort auslösen. Die These, dass zelluläre Mechanismen ausschlaggebend für die postoperative Immunosupression seien, wurde durch die enge Korrelation zwischen dermal getesteter Anergie und infektiösen Komplikationen erhärtet11. Die im Scratch-Test geprüfte Reaktion vom verzögerten Typ (Typ IV Reaktion) basiert bekanntermaßen auf der zellulären Komponente der Immunabwehr, so dass die Ausprägung der Verzögerung dermaler Reaktionen (delayed Hypersensitivity) mit verstärkten infektiösen Geschehen nach operativen Eingriffen positiv korrelierten11,12. Weiter konnte unter Zuhilfenahme der intrakutanen Testung gezeigt werden, dass das Ausmaß der Hyp- bzw. Anergie positiv mit der Schwere des chirurgischen Eingriffs korreliert13 . Das bedeutet, dass mit zunehmendem Schweregrad der operativen Intervention mit einer weitreichenderen Seite 6 Immunsuppression zu rechnen ist, sodass gerade die Chirurgie mit großen Eingriffen an einem potenten präventiven oder reaktiven Therapieansatz interessiert ist. Mit diesem Hintergrund bleibt nun die Frage, ob es sich bei der zellulären Abwehrschwäche um ein eher quantitatives oder qualitatives Problem handelt. Dazu waren nähere Untersuchungen notwendig, die sowohl zelluläre wie auch Zytokin-Parameter der einzelnen beteiligten Komponenten erfassen. Quantitativ finden Verschiebungen innerhalb der Leukozytenpopulationen statt. So kommt es zu einer Verminderung der Blutlymphozyten mit Herabsetzung der B-Zell- und T-Zell-Zahlen14,15 . Bei einer verhältnismäßigen Verschiebung innerhalb der verschieden T-Lymphozyten Populationen kann es bereits zu einer Beeinträchtigung der Immunfunktion kommen, weshalb der CD4+/CD8+ Quotient auch als einfacher, preiswerter und reproduzierbarer Indikator für die Abwehrfunktion des Körpers genutzt wird17. Im Gegensatz zum Abfallen der Lymphozyten kommt es zu einem Anstieg der Monozyten und der Neutrophilen Granulozyten14,16. Doch die Alteration in der postoperativen Immunkompetenz ist durch bloße mengenmäßige Veränderungen der beteiligten Zellen nicht ausreichend zu charakterisieren. Auch sind Veränderungen der Serum -Zytokin Spiegel bekannt, die neben einem Einfluss auf die Proliferationsgeschwindigkeit wie oben beschrieben auch den Funktionszustand der Immunzellen maßgeblich bestimmen. Direkt nach großen chirurgischen Eingriffen wurde ein kurzzeitiger IL-1 Anstieg beschrieben, der zumindest über den Zeitraum einiger Stunden die körperliche Abwehr mit beeinflusst18. Diese Entwicklung konnte bei kleineren Operationen wie z.B. der Versorgung von Leistenbrüchen nicht beobachtet werden, ebenso wie der postoperative Abfall des IL -2 Levels 18,19. Die Synthese des IL -2 durch Mononukleäre Zellen fällt mit großen Eingriffen im Vergleich zu präoperativen Serumspiegeln ab14. Darüber hinaus bleibt die zelluläre Synthese- bzw. Sekretionsstörung z.T. bis über den achten postoperativen Tag hinaus erhalten19. Diese Beeinträchtigung der Immunkaskade wird durch das herabgesetzte postoperative Ansprechen der Zielzellen auf den IL2 Stimulus verstärkt und gibt neben der beschriebenen quantitativen Immundepression einen konkreten Anhalt für eine in erster Linie die T-Zellen betreffende qualitative, also funktionelle Störung der Immunabwehr. Dass dieser Seite 7 Mechanismus eine Rolle bei der Entwicklung von Komplikationen spielt, wird durch eine Untersuchung gestützt, die bei Patienten nach Verbrennungen zwischen denen mit positiven und denen mit negativen Blutkulturen differenzierte. Bei Patienten mit negativen Blutkulturen wurde ein insgesamt besseres Ansprechen der Zellen auf den Interleukinstimulus beobachtet. Bei zusätzlicher operativer Therapie wurde die Antwort auf IL -2 noch weiter gesenkt20. Auch um den Verlauf von IL -6 zu ergründen bemühten sich zahlreiche Studien. Im Gegensatz zum vorangegangen IL -2 kommt es postinterventionell zu einem Anstieg des IL -6 Levels im Serum. Dieser erreicht innerhalb von zwei Tagen sein Maximum und fällt bei komplikationslosem Verlauf anschließend auf Normalwerte zurück18. Die Höhe des Anstiegs korreliert dabei positiv mit der Dauer der Operation, weshalb IL -6 auch als empfindlicher und früher Marker eines Zellschadens dient und die Höhe des Peaks Auskunft über das Ausmaß des Traumas erteilt21. Ein weiterer Effektor im IL -6 Verlaufsprofil ist die Entwicklung von Komplikationen. Tritt in der Phase nach der chirurgischen Intervention eine unerwartete Komplikation auf, so ist dies z.T. bereits zwölf bis 48 Stunden vor signifikanten klinischen Zeichen anhand eines unverhältnismäßigen IL -6 Anstiegs zu erkennen, wodurch wichtige Zeit in der reaktiven Therapie gewonnen werden kann22. Dass ebenso wie ein vermindertes Vorkommen eines Zytokins auch das übermäßige Vorhandensein schädlich für den Organismus sein kann, wird in der Eigenschaft des IL -6 deutlich die apoptotisch begrenzte Lebensdauer der Neutrophilen Granulozyten zu verlängern. Dies zieht eine länger anhaltende Phagozytose und Superoxid-Ausschüttung mit sich, was wiederum eine weitreichendere toxische Schädigung des Gewebes bedingt16 . Auch wenn sich einige Aspekte der Immunsuppression anhand der beschriebenen Effekte erklären lassen, so verbleibt noch ein großer Teil funktioneller Störungen, die bei der näheren Betrachtung der zellulären Abläufe auffallen. So ist die Phagozytoseaktivität ebenso wie die Transformation in immunozytäre Blasten nach Verbrennungen vermindert. Die Immunglobuline und die aktivierten T-Lymphozyten (CD3+/HLA-DR+) im Serum sind herabgesetzt23. Bei operativen Eingriffen sinkt die Chemotaxis der Neutrophilen Granulozyten mit Beginn der Inzision und steigt erst in den Folgetagen allmählich wieder an15 . Seite 8 Die Kenntnis der einzelnen Komponenten der postoperativen Immunsuppression ist der Ausgangspunkt für Überlegungen, wie einer solchen Entwicklung therapeutisch zu begegnen oder möglichst vorzubeugen ist. In der Hoffnung, die Immunkompetenz zu bewahren, wurden immunsuppressive Faktoren im Serum gefunden, die bevorzugt bei großen chirurgischen Eingriffen oder schweren Entzündungsreaktionen auftreten24 und therapeutisch antagonisiert werden könnten. So wurde unter anderem in einer anderen Arbeit das PGE 2 als ein Mediator für die Abwehrschwäche inhibiert und der zuvor beobachtete Lymphozyten Abbau konnte verhindert14 dadurch werden. Andere Therapiekonzepte sind zum Beispiel Antikörper gegen die proinflammatorischen Zytokine (TNF-α Antikörperfragment Afelimomab) oder deren lösliche Rezeporen (löslicher TNF-α Rezeptor). Ebenso ist neben einer Senkung der Serumkonzentration die Blockade der Rezeptoren (IL -1 Rezeptor-Antagonisten) in Studien untersucht worden, um die Signalwege einer gesteigerten Entzündungsreaktion zu unterbrechen. Bisher waren Prognoseverbesserungen jedoch selten, nachweisbar63. so Auch z.B. für das aufwendigere TNF-α Antikörperfragment Verfahren wie die Afelimomab Elemination von Immuninhibitoren aus dem Blut mittels Hämofiltration oder Plasmapherese bleiben zur Zeit noch Studien und eingeschränkten Instituten vorbehalten64. Als mögliches ubiquitär nutzbares und vielversprechendes Konzept hat sich zu dem in den letzten Jahren die Immunnutrition entwickelt. 1.2 Postoperative Immunnutrition Die Art und Weise der intensivmedizinischen Ernährungstherapie hat in den letzten Jahren zunehmend an Interesse gewonnen, da zum einen der physische Zustand des Patienten mit eventueller Mangelernährung einen erheblichen Einfluss auf den klinischen Verlauf ausübt und des weiteren ein in seiner Funktion beeinträchtigter Magen-Darm-Trakt eine kontrovers diskutierte Rolle in der Initiierung und Aufrechterhaltung infektiöser Komplikationen zu spielen scheint. Seite 9 Demnach hat die Ernährung neben der bloßen Zufuhr von Nährstoffen weitere modulatorische Effekte, die über Beeinflussung der Komplikationen, dadurch der Liegedauer und schließlich der Behandlungskosten ein erhebliches strategisches Potential birgt. Bei der intensivmedizinischen Nahrungszufuhr kommen prinzipiell zwei unterschiedliche Darreichungsformen zum Einsatz: die „totale enterale Nutrition“ (TEN) und die „totale parenterale Nutrition“ (TPN). Wie bei jeder Therapie gibt es dabei für beide Ernährungsformen absolute und relative Kontraindikationen, wobei die Definition der Grenzen und die Überschneidung ihrer Indikationen noch immer Grundlage vieler Diskussionen ist. 1.2.1 Immunmodulation durch Nährsubstrate Mit der intensiven Beschäftigung mit der peri- und postoperativen Ernährung sind zunehmend Substanzen in das Interesse gerückt, denen neben ihrer Funktion als essentielle oder fakultativ essentielle Nahrungsbestandteile auch pharmakologische Effekte auf das Immunsystem zugesprochen werden. Die drei Hauptgruppen bilden dabei die konditionell-essentiellen Aminosäuren wie Glutamin und Arginin, sowie die mehrfach ungesättigten ω-3-Fettsäuren und RNANukleotide. Neben den Aminosäuren, die standardmäßig in Nährlösungen zur TEN und TPN enthalten sind, interessieren einige der AS besonders in der Hinsicht, dass sie normalerweise vom Körper selbst synthetisiert werden können, also zu den Nicht-essentiellen AS zählen, bei bestimmten Stoffwechselbedingungen allerdings Engpässe im Pool dieser Substanzen auftreten und diese dadurch als fakultativ essentiell einzustufen sind. Von besonderem Interesse in der Ernährungsmedizin sind Arginin und Glutamin. Seite 10 1.2.1.1 Glutamin zur Immunmodulation Beim Glutamin (Gln) handelt es sich um eine Aminosäure mit einem Gerüst aus fünf Kohlenstoffatomen und einer zusätzlichen Amidgruppe am δ-Kohlenstoff. Bei physiologischem PH-Wert liegt es aufgrund der negativen Ladung der Carboxylgruppe und der positiven Ladung der Aminogruppe mit einer ausgeglichenen Nettoladung vor, was ihm eine leichte Passage durch biologische Membranen ermöglicht, eine der Grundvoraussetzungen für seine vielfältigen Funktionen. Die direkt mit dem Glutaminmetabolismus in Verbindung stehenden Enzyme, sind zum einen die Glutaminase, die Glutamin zu Glutamat und Ammoniak hydrolysiert und zum anderen die Glutamin-Synthetase, die den energiepflichtigen Syntheseschritt in entgegengesetzter Richtung katalysiert (Abb.1). Da der menschliche Organismus in der Lage ist, Glutamin de novo zu synthetisieren, zählt man es prinzipiell zu den nicht-essentiellen Aminosäuren. Die Beobachtung, dass die Beanspruchung an Gln in bestimmten physiologischen Situationen wie körperlichem Stress oder Krankheit die Synthesekapazität übersteigt, hat im letzten Jahrzehnt jedoch dazu geführt, es ebenso wie Arginin als „bedingt essentielle Aminosäure“ zu betrachten. Abb.1: enzymatisch katalysierte Reaktionen zwischen Glutamin und Glutamat Seite 11 Dem Glutamin kommen im Körper vielseitige Funktionen zu. Wegen seiner einfachen Passage durch biologische Membranen, dient die AS zum Transport von Atomen und Molekülen zwischen den verschiedenen Geweben31 . Durch die enzymatisch katalysierte Kopplung von Ammoniak an Glutamat zu Glutamin im Zytoplasma der Zellen, sind diese in der Lage den für sie toxischen Stoff in den Blutstrom abzugeben und in der Leber über den Harnstoffzyklus zu entgiften. Ein weiteres Organsystem in dem Glutamin an der Ammoniakausscheidung beteiligt ist, sind die Nieren, die bei der Steuerung des Säure-Basen-Haushaltes über Ammoniak anfallende saure Valenzen in das Tubulussystem sezernieren. Ca. 30 bis 35% des im Plasma transportierten Stickstoffs ist in Glutamin enthalten. Neben der Ausscheidung der toxischer Verbindungen, verteilt oder bindet Glutamin Aminogruppen in verschiedensten chemischen Reaktionen (Abb.2). Als Stickstoffdonator fungiert die AS unter anderem der Synthese von Purinen und Pyrimidinen die weiter in Kofaktoren, RNS und DNS Moleküle eingebaut werden. In den Schleimhäuten ist Glutamin N-Donator bei der Synthese von Aminozuckern, die wichtig für die Funktion und Integrität der Schleimhautoberflächen sind 28. Abb.2: Reaktionen mit Glutamin bzw. Glutamat als Stickstoffdonator Auch das Kohlenstoffgerüst der AS ist Ausgangspunkt biologisch wirksamer Metabolite. Der Weg in die verschiedenen Synthesewege verläuft dabei zumeist über die Desaminierung zu Glutamat. Seite 12 Für das zentrale Nervensystem (ZNS) ist die anschließende Decarboxylierung von Glutamat zu γ-Amino-Buttersäure (GABA), welche als Transmitter in Hypothalamus, Medulla oblongata und Zerebellum fungiert, entscheidend. Die Vereinigung von Glutamat mit Cystein und Glycin mündet in Glutathion, welches als Redoxpuffer Proteine und Häm-Eisen vor Oxidation schützt und die Zellen vor der schädigenden Wirkung freier Radikale bewahrt. Für die Integrität des Bindegewebes fließt Glutamin über Prolin und Hydroxyprolin in die Kollagensynthese ein (Abb.3 ). Eine der Hauptfunktionen des Kohlenstoffgerüsts der AS ist zudem die Bereitstellung von Energie in den schnell proliferierenden Geweben wie Enterozyten, Immunozyten, Makrophagen und Fibroblasten. Damit die Resorption von Nährstoffen auch in Hungerzuständen und unter Glukose- und Fettsäurenmangel gewährt werden kann, bedienen sich die Enterozyten zweier zusätzlicher Energiequellen. Ihren Hauptenergielieferanten stellen die Ketonkörper dar, dicht gefolgt von Glutamin und Glukose29. Die von luminal und basal aufgenommene AS wird einerseits, ebenso wie bei den übrigen schnell proliferierenden Zellen, über Glutamat und α-Ketoglutarat dem Citratzklus zugeführt, andererseits sind die Enterozyten in der Lage, Glutamin als kurzkettige Fettsäure zu oxidieren, bei der im Vergleich zur lediglich bis zum Pyruvat verstoffwechselten Glukose die 15-fache Menge an ATP gewonnen werden kann. Abb.3: Reaktionen mit Glutamin, Glutamat und α-Ketoglutarat als Kohlenstoffdonatoren Seite 13 Den schnell proliferierenden Zellen ist gemein, auch unter normalen Stoffwechselbedingungen eine hohe Aufnahmerate an Glutamin aufzuweisen, um in den entsprechenden Situationen eine schnelle Zellantwort zu ermöglichen. Auch die übrigen Gewebe können von Glutamin als Energiequelle profitieren, da es als glukoplastische AS in der Leber genutzt werden kann30. So kann Glutamin sowohl als Stickstoff- als auch Kohlenstoffshuttle zwischen den verschiedenen Geweben begriffen werden. Seine vielseitigen Aufgaben in den verschiedenen Reaktionen ziehen bei mangelnder Verfügbarkeit entsprechend weitreichende Organbeteiligungen nach sich. Freies Gln erreicht die höchste Konzentration unter den freien AS im Plasma. Dieser Plasmaspiegel wird unter normalen Bedingungen konstant gehalten, reagiert auf Stoffwechselveränderungen allerdings sehr labil, wodurch es zu einem Abfall um bis zu 30% des Ausgangswertes kommen kann25. Um einen sinkenden Plasmaspiegel auszugleichen, wird Glutamin besonders aus Skelettmuskelzellen freigesetzt, in denen es einen Anteil von über 60% an den zytosolischen freien AS hat. Diese zytoplasmatische Konzentration wird in Stresszuständen um bis zu 50% reduziert26,27. Neben der Skelettmuskulatur ist auch die Lunge reich an Glutamin-Synthetase. Zwar ist sie mit ihrer Zellmasse den Muskeln unterlegen, doch wird dies durch den erhöhten Blutfluss ausgeglichen, sodass sie äquivalente Mengen an Glutamin freisetzen kann. Der veränderte Glutaminmetabolismus ist auf die stressassoziierte Hormonund Zytokinreaktion zurückzuführen. So bewirken Steroide eine gesteigerte Glutaminfreisetzung aus Skelettmuskulatur und Lunge durch eine Steigerung der Glutamin-Synthetase Aktivität. Auch die Ausschüttung von IL -1 und IL -6 ziehen eine zunehmende Abgabe der AS nach sich32,18. Die postoperativ verstärkte Sekretion der Zytokine und Steroide erklärt somit den in dieser Situation beobachteten intrazellulären Konzentrationsabfall. Da jedoch unter anderem auch die intestinale Glutaminaseaktivität und damit der Glutaminverbrauch unter Hormoneinfluss steigt, reicht die gesteigerte Freisetzung alleine nicht aus, um den körperlichen Bedarf abzudecken33 und so wurde bereits 1985 in Studien versucht, den Aminosäureverlust durch Substitution auszugleichen27. Seite 14 Dem Einzug der Glutamins in die intensivmedizinische Ernährungstherapie standen zunächst seine unvorteilhaften chemischen Eigenschaften im Wege. So zeichnet sich freies Glutamin unter normalen Lagerbedingungen und insbesondere bei der Sterilisation durch seine Instabilität und die geringe Löslichkeit aus. Um einen Zerfall in Pyroglutaminsäure und Ammoniak zu verhindern, ist die Lagerung bei +4°C und eine Zubereitung unter streng aseptischen Bedingungen notwendig34,35. Die geringe Löslichkeit in wässrigen Lösungen bedeutet bei der Zufuhr relevanter Glutaminmengen eine erhebliche Volumenbelastung, die gerade in der postoperativen Therapie häufig nicht zu tolerieren ist. Viele der durchgeführten Studien haben sich besonders in Kombination mit TPN auf die Untersuchung freien Glutamins konzentriert. Als Alternative zu der beschriebenen Darreichungsform bietet sich die Applikation von Glutaminmetaboliten wie α-Ketoglutarat oder aber die Gabe von Glutamin enthaltenen Dipeptiden, wie Alanin-Glutamin (Ala-Gln) oder GlycinGlutamin (Gly-Gln). Bei der enteralen Zufuhr werden diese als intakte Dipeptide von den Enterozyten resorbiert und anschließend verstoffwechselt. Das enteral verabreichte Glutamin wird zu fast 100% in den ersten Dünndarmabschnitten resorbiert42, wobei mehr als 25% des resorbierten Glutamins als Citrullin in den Blutstrom übertreten, was sich unter anderem positiv auf den Argininstoffwechsel auswirkt36. Bei parenteraler Applikation führen extra- sowie intrazelluläre Proteasen zur schnellen Spaltung und somit Utilisation der beteiligten Aminosäuren37,38,39. In vitro Studien über die Rolle des Glutamins haben bereits früh gezeigt, dass der AS eine essentielle Bedeutung für das Wachstum von Zellkulturen zukommt. Bei Gln-freier Nährlösung war es nicht möglich die gewünschten Zellen zu kultivieren, was erstmalig die Aufmerksamkeit auf die AS lenkte 40,41. Die deutlichsten Ergebnisse lieferten bisher die Tierexperimente, die eine verbesserte Stickstoffutilisation ebenso wie einen reduzierten Zytoplasmakonzentrationsabfall im Skelettmuskel nachwiesen43,44. Im Vergleich zu alleiniger TPN konnte bei Gln-Supplementation eine Zunahme der Villushöhe und Mucosazellfunktion nachgewiesen und bei nachträglicher Ergänzung eine Aufhebung der atrophiebedingten Dysfunktion unter TPN erzielt werden45,46. Zusätzlich war die Darmschleimhaut für toxische Schäden unter Radio- und Seite 15 Chemotherapie weniger anfällig54,55. Diese Effekte können unter anderem auf eine unter Gln-Gabe gemessene Steigerung der Organdurchblutung zurückgeführt werden, welche sich besonders im Dünndarm bemerkbar macht47. Neben einer erhöhten Schleimhautintegrität waren zudem positive Effekte auf Lymphozyten und Makrophagen zu beobachten. Bei den T-Zellen konnte die Proliferation durch glutaminreiche Diät gesteigert werden und es kam zu einer vermehrten Th1-Reaktion in Form von erhöhter IL -2 Synthese und IL-2-Rezeptor Expression48 . Ebenfalls für eine Förderung der Th1-Antwort spricht die gemessene Sekretion von TNF-α und IL-6 durch Makrophagen, die im Vergleich zu Standarddiäten nach vermehrter Glutaminzufuhr deutlich erhöht war49. Auch die Wiederherstellung des mukosalen IgA Gehaltes und die Förderung der Abwehr des oberen Respirationstraktes sind beschriebene Vorteile des Glutamins 61 . Die mit zusätzlichem Glutamin ernährten Tiere profitierten des weiteren bei gleichbleibendem Leber GSH Gehalt von dem protektiven Effekt eines gesteigerten Plasma Gluta thion Spiegels und so einem Rückhalt gegen eventuelle oxidative Schäden, z.B. bei massiver Makrophagen- und Granulozytenaktivität50. Die Sorge, dass sowohl gesundes als auch Tumorgewebe von dem erhöhten GSH-Schutz profitieren, konnte dadurch widerlegt werden, dass das Tumorgewebe paradoxerweise durch eine Abnahme des GSH sensitiver für Chemotherapeutika wurde57. Das Zusammenspiel der oben beschriebenen Einflüsse auf Mukosa und Immunsystem kann auch als ein entscheidender Faktor für verminderte Schäden bei Endotoxinbelastung und reduzierte bakterielle Translokation im künstlichen Sepsis Modell verstanden werden51,52. Zusätzlich zu der herabgesetzten Translokation aus dem Darmlumen, was noch immer als nicht unumstrittener Ausgangspunkt für infektiöse Komplikationen bei kritisch Kranken diskutiert wird, konnte eine positivere Überlebensrate unter den Versuchstieren verzeichnet werden52. Auch bei septischer Belastung mit MRSA konnte die Überlebensrate durch Gln Gabe verbessert werden56. Der Mangel an befriedigenden klinischen Ergrebnissen ist zum einen in den ethisch nicht rekonstruierbaren entsprechenden Versuchsanordnungen und zum anderen veränderten Reaktionsweisen der unterschiedlichen Organismen begründet. So ist unter anderem bekannt, dass die im Tiermodell beobachtete Seite 16 Mukosaatrophie nach einigen Tagen TPN bei Menschen erst nach Wochen und auch dann nicht in dem Maße auftritt53,59. In klinischen Studien wurde auf zellulärer Ebene bei enteraler Supplementierung von Glutamin unter Radiotherapie eine Aufrechterhaltung der sonst verminderten Lymphozyten erreicht58 . Bei den Phagozyten war eine Korrelation zwischen Glutamingehalt des Nährmediums, Rezeptorexpression und Phagozytose zu verzeichnen, was unter anderem auf die Unterversorgung mit ATP zurückgeführt wurde60,62. Seite 17 2. Zielsetzung Eine große Anzahl von Untersuchungen hat sich bisher mit der pharmakologischen Wirkung des Glutamins, bevorzugt in in-vitro und tierexperimentellen Studien, beschäftigt; dies z.T. mit vielversprechenden zytologischen, immunologischen und den postoperativen Krankheitsverlauf beeinflussenden Ergebnissen. Seit der Einführung der immunfördernden Nahrungszusätze, wurden diese in vielen klinischen Bereichen in die adjuvanten Therapiekonzepte übernommen. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war der prospektiv- randomisierte Vergleich der enteralen versus parenteralen Applikation von Glutamin nach großen abdominalchirurgischen Eingriffen. Dabei sollte der Effekt dieser Applikationsformen auf die postoperative Immunantwort untersucht und mit einer Patientengruppe ohne Glutaminsupplement verglichen werden. Hierzu wurden verschiedene Parameter der humoralen (IgA, IgG, IgM, IL-2, IL-6, TNF-α) und zellulären (Lymphozytensubsets mit CD4+-, CD8+- und HLA-DR+- Lymphozyten) Immunantwort, sowie Serum-Entzündungsparameter (Leukozyten, CRP, Fibrinogen) an drei postoperativen Tagen (1.postoperativer, 5. postoperativer und 11.postoperativer Tag) in drei Studiengruppen (enterale Glutaminsubstitution, untersuc ht. parenterale Glutaminsubstitution, Kontrollgruppe) Seite 18 3. Material und Methoden Es handelt sich um eine prospektiv randomisierte, offene Studie an Patienten nach großer Oberbauchchirurgie (Gastrektomie, Ösophagus - und Pankreasresektionen) bei Malignomen und kritisch kranken Patienten. Insgesamt sollten drei Studiengruppen a 15 Patienten untersucht werden. Dabei sollte eine Gruppe enterale Standardernährung (Fresubin, Fresenius-Kabi GmbH, Deutschland) erhalten, die zweite Gruppe eine isonitrogene Ernährung mit zusätzlicher enteraler Glutamingabe und die dritte Gruppe eine zur enteralen Ernähung ergänzende paranterale Glutaminapplikation erhalten. 3.1 Patienten 3.1.1 Einschlusskriterien In die Erhebung eingeschlossen wurden alle Patienten deren Erkrankung eine Indikation der oben aufgeführten Eingriffe darstellt und bei denen eine postoperative enterale Ernährung über mindestens fünf aufeinanderfolgende Tage geplant war. Voraussetzung war eine enterale Substratzufuhr von mehr als 50% Seite 19 des Zielvolumens. Beide Geschlechter in einem Alter zwischen 18 und 85 Jahren wurden nach Aufklärung über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Untersuchung und mündlicher Einverständniserklärung in die Datenerhebung aufgenommen. 3.1.2 Ausschlusskriterien Nicht in die Studie übernommen wurden neben Patienten, die mindestens einem der Einschlusskriterien nicht entsprachen, ferner schwangere Patientinnen, insulinpflichtige Diabetiker, Patienten mit Leber- oder Niereninsuffizienz, Patienten mit bekannter Unverträglichkeit gegen Nahrungsmittel und anderen allergischen Dispositionen oder medikamentöser Behandlung mit Hemmstoffen der Prostaglandinsynthese in den letzten zwei Wochen vor der klinischen Prüfung. Vor Beginn der Studie wurde mittels EDV eine Randomliste über 45 Patienten erstellt, in der diese der Reihenfolge nach einer der drei Gruppen zugeordnet wurde: • Gruppe A (enterale Glutaminzufuhr) • Gruppe B (parenterale Glutaminzufuhr) • Kontrollgruppe (Standard enterale Ernährung) Seite 20 3.2 Behandlungsregime Alle Patienten, die sich einem großen Oberbaucheingriff unterziehen, erhalten standardmäßig intraoperativ eine Feinnadelkatheterjejunostomie (FNKJ) mit Kathetern der Größe 5-9 Char zur postoperativen enteralen Ernährung. Die Substratzufuhr erfolgte dabei nach einem etablierten Schema über die ersten vier postoperativen Tage: • 1. Post-OP Tag: 500 kcal/d • 2. Post-OP Tag: 1000 kcal/d • 3. Post-OP Tag: 1500 kcal/d • 4.-10. Post-OP Tag: 2000 kcal/d Die Kontrollgruppe (Gruppe C) erhielt vom ersten bis einschließlich zum zehnten Post-OP Tag die kommerziell erhältlichen Enteralia Fresenius Plus Sonde oder Energan Plus Sonde (Fresenius-Kabi GmbH, Deutschland). 3.2.1 Glutamin enteral Patienten der Gruppe A erhielten eine isoenergetische sowie isonitrogene Ernährung mit zusätzlicher Gabe enteralen Dipeptids (Alanylglutamin Dipeptamin, Fresenius-Kabi GmbH, Deutschland) in einer Menge von 20 g/d. Dabei wurde das Dipeptid vor Verabreichung in den Ernährungsbeutel eingefüllt. 3.2.2 Glutamin parenteral Die zusätzliche parenterale Glutamingabe in Gruppe B wurde über Verdünnung der 20 g Dipeptamin (entspricht 100ml) in physiologischer NaClLösung zur Reduktion der Osmolarität bewerkstelligt und periphervenös appliziert. Seite 21 Begonnen wurde mit dem Ernährungsregime am Morgen des ersten postoperativen Tages. Flüssigkeit und Elektrolyte sowie Spurenelemente und Vitamine konnten nach Bedarf ergänzt werden, sowie nach Ermessen des Untersuchers eine intravenöse Infusion (5%ige Glukoselösung), glutamin- und argininfreie AS-Lösungen und Standardlipidlösungen. Eine orale Nahrungsaufnahme von weniger als 200 kcal/d wurde außerdem gestattet. Bei Unverträglichkeitsreaktionen im Rahmen der Ernährung wurde die stündliche Zufuhrrate reduziert unter Berücksichtigung der Mindestmenge von 50% der Vorgaben. 3.3 Zielparameter Am ersten, fünften und elften postoperativen Tag wurde bei den Patienten zur Bestimmung der zellulären und humoralen Immunparameter und einem Routinelabor Blut abgenommen. Die bestimmten Parameter sind der folgenden Tabelle zu entnehmen (Tab.2). Seite 22 Tab.2: Laborparameterbestimmungen an den Studientagen Parameter Routinelabor Serummonovette 10ml GOT, GPT, AP, γGT, Na, K, Ca, Cl, Glukose, Kreatinin, Harnstoff, Harnsäure, ges. Bilirubin, ges. Cholesterin, Triglyceride, Albumin, ges. Eiweiß, CRP, Transferrin Na-Zitrat Monovette PTT, PT (Quick), Fibrinogen 5ml EDTA-K Monovette 3ml Hämoglobin, Hämatokrit, Thrombozyten, Erythrzyten, Leukozyten, Monozyten, Lymphozyten, eosinophile Granulozyten, neutrophile Granulozyten, basophile Granulozyten Serummonovette 10ml Prokalzitonin (PCT), IgM, IgG, IgA Lymphozytenstatus EDTA-K Monovette 3ml CD4 positive, CD8 positive, HLA-DR positive Lymphozyten Zytokine Aminosäuren Glutathion Serummonovette 10ml IL-2, IL-6, TNF-α und Li-Heparinat Monovette Alanin, Arginin, Asparagin, 10ml Asparaginsäure, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Serin, Threonin, Thryptophan, Tyrosin, Valin, Glutathion (GSH), Glutathiondisulfit (GSSG) Seite 23 3.4 Messverfahren Die Monovetten zur Aminosäuren-, Zytokin- und Glutathionbestimmung wurden im Anschluss an die Abnahme direkt im Labor weiterverarbeitet. Dazu wurden sie zunächst für fünf Minuten bei 3500 Umdrehungen pro Minute zentrifugiert. Danach wurde von der Zytokinprobe ca. 1 ml Überstand in einen Reagenzbehälter gefüllt. Der Probenrest wurde verworfen. Aus der Li-Heparinat Monovette wurde ebenfalls 1 ml Überstand zur Bestimmung des Glutathions gewonnen. Des weiteren wurde 1 ml Überstand in ein Reagenzröhrchen gefüllt und zur vollständigen Proteinfällung im Verhältnis 10:1 mit Sulfosalicylsäure (SSA, 30% mit 1 mmol/L Norvalin als internem Standard) versetzt. Nach der einstündigen Aufbewahrung im Kühlschrank bei 4°C wurde die Probe erneut für 15 min zentrifugiert und eine möglichst große Menge proteinfreier Überstand entnommen. Alle drei gewonnenen Proben wurden neben den zu erhebenden Parametern mit einer Ziffernfolge aus Patientennummer und Studientag beschriftet und bis zur Messung bei einer Temperatur von -80°C aufbewahrt. Die Bestimmung der Aminosäuren und des Glutathions erfolgte im Institut für Ernährungswissenschaften der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Leiter: Prof. Dr. P. Stehle). Die quantitative Erhebung der Zytokine IL-2, IL-6 und TNF-α fand im Labor des St. Josef Hospitals Bochum statt. Dazu dienten ELISA Kits der Firma Immunotech (Marseille, Frankreich) in denen mittels Sandwich Technik eine der Zytokinkonzentration proportionale Farbreaktion ausgelöst wird. Eine doppelte Messung einer Probe wurde durchgeführt, um eine Bestätigung der Ergebnisse zu erreiche n. Außerdem musste genug Probe erhalten bleiben, um hohe Konzentrationen (>1000 pg/ml) zu verdünnen und Seite 24 erneut zu bearbeiten. Die Vertiefungen der Tabletts wurden mit jeweils 100 µl der Proben versehen, wobei pro Tablett eine Vertiefung zur Kontrolle frei blieb und eine die mitgelieferte Standardlösung an Zytokinen als Referenz enthielt. Die Tabletts waren dabei bereits mit spezifischen monoklonalen Anti-IL-2, Anti-IL-6 bzw. Anti-TNF-α Antikörpern ausgestattet In der ersten Inkubationsphase wurden danach enzymkonjugierte AntiZytokin-Antikörper hinzugefügt und je nach Zytokinkit 2 Stunden unter kontinuierlicher Rotation bei 18-25°C (IL-2 und IL-6) oder 12-16 Stunden in Ruhe bei 2-8°C (TNF-α) inkubiert. Die IL-2 und IL -6 Antikörper waren mit Acetylcholinesterase konjugiert, die TNF-α Antikörper mit Alkalischer Phosphatase (AP). Nach Abschluss der immunologischen Inkubation wurden die Tabletts gewaschen und damit von ungebundenen Molekülen gereinigt. Die enzymatische Inkubation erfolgte mit 200 µl spezifischen Substrats, welches Acetylthiocholin bei der IL-2 und IL-6 und Paranitrophenylphosphat (PNPP) bei der TNF-α Messung enthielt. Nach 30 Minuten Inkubation unter Lichtausschluss wurde die enzymatische Reaktion mittels Stopreagenz beendet. Die Farbreaktion konnte unter Licht der Wellenlänge 405 bis 414 nm abgelesen werden, wobei die freigebliebene Vertiefung und die Standardlösung als Anhaltspunkte dienten. Als Normalwerte bei gesunden Individuen sind bei dem IL -6 Kit 8 pg/ml und bei dem TNF-α Kit <5 pg/ml angegeben, bei der IL -2 Messung wird ein laboreigener Referenzwert empfohlen. Die Erfassung der Lymphozytensubsets erfolgte automatisiert mittels Durchflußzytometrie. Dabei werden die Zellen in einer Zählkammer mittels der sogenannten hydrodynamischen Fokussierung linear angeordnet, sodass die Zellen einzeln von einem elliptisch gebündelten Laserstrahl getroffen werden. So wird der Strahl zum einen an den Zellen gestreut und zusätzlich emittieren diese ein Licht mit den ihnen anhaftenden Antikörpern charakteristischer Wellenlänge. Über die Brechung des Lichtstrahls an den Zellen wird zum einen deren Zellgröße (forward scatter; Brechung im Bereich der Lichtachse) und des weiteren der Granulagehalt des Zytoplasmas (side Scatter; Brechung im Bereich von ca. 90° zum Lichtstrahl) gemessen. Das von fluoreszierenden Antikörpern emittierte Licht gibt Anhalt über charakteristische Oberflächenmoleküle wie z.B. CD- Seite 25 Moleküle, die in Zusammenhang mit den vorher beschriebenen Messungen eine Eindeutige Identifizierung der Immunzellen ermöglichen. Die in dieser Untersuchung verwendeten Antigenmuster sind der untenstehenden Tabelle (Tab.3) zu entnehmen. Tab.3: gemessene Lymphozytensubsets Oberflächenantigene Zellart CD3+ reife T-Lymphozyten CD3+/CD4+ T-Helfer Zellen CD3+/CD8+ T-Killer und T-Suppressor Zellen CD3+/HLA-DR+ aktivierte T-Lymphozyten 3.5 Statistische Methoden Die Dokumentation der Daten erfolgte mittels Microsoft Excel, die statistische Auswertung mit dem Statistikprogramm SPSS 10.0 für Windows. Die Probanden der Studie wurden wie bereits beschrieben prospektiv randomisiert einer von drei unabhängigen Gruppen zugeordnet. Bei der statistischen Auswertung wurde von dem sonst in der Medizin beliebten t- bzw. F-Test (ANOVA) abgesehen, da wir mehrere Voraussetzungen für die Durchführung dieses Tests verletzt sahen. Zum einen handelte es sich mit 15 geplanten Probanden pro Gruppe noch um einen geringen Stichprobenumfang, sodass eine Normalverteilung bzw. eine symmetrische Verteilung der Werte, sowie nicht signifikant unterschiedliche Varianzen der drei Gruppen nicht sicher zu erwarten waren. Des Weiteren ist es generell nicht unproblematisch, Laborparameter als metrisch skaliert anzusehen. Zwar ist der Abstand zwischen zwei Einheiten prinzipiell gleich und es existiert für die meisten Parameter auch ein fixer Nullpunkt, doch erfolgt mit der diagnostischen Interpretation auch ein Rückschritt auf ein ordinal skaliertes Datenniveau. So ist der rechnerische Abstand eines Seite 26 CRP-Wertes zwischen 5,0 und 9,0 mg/l zwar gleich dem Abstand zwischen 25,0 und 29,0 mg/l und mit einem Nullpunkt theoretisch sogar rationalskaliert, in seiner klinischen Relevanz allerdings nicht ebenbürtig und lässt daher lediglich einen Schluss von „größer als“ bzw. „kleiner als“ zu. Ebenso verhält es sich mit der Großzahl der klinisch chemischen Parameter. Da der Kruskal-Wallis-Test und der Mann-Whitney-U-Test die Datenverteilung anhand ihrer Rangreihenfolge untersuchen, setzen diese die oben genannten Bedingungen nicht voraus. Die Gruppen wurden an jedem der drei Studientage bezüglich der interessierenden Immunparameter verglichen. Dies erfolgte zunächst für alle drei Gruppen mittels eines Kruskal-WallisTestes mit dem Testniveau von α=0,5%. Im Falle eines signifikanten Unterschiedes wurde der paarweise Gruppenvergleich mittels Mann-Whitney-UTest durchgeführt. Dieses Vorgehen sicherte die Einhaltung des vorausgesetzten Testniveaus bei der Betrachtung von mehr als zwei unabhängigen Gruppen und ermöglichte zudem den direkten Vergleich der einzelnen Gruppen1,2 . Seite 27 4 Resultate Die Datenerhebung erstreckte sich über einen Zeitraum von Januar 1999 bis Dezember 2000. 4.1 Patientencharakteristika In die Messungen wurden insgesamt 49 Patienten (n=49) eingeschlossen, 29 (59,2%) männlichen und 20 (40,8%) weiblichen Geschlechts, von denen 16 Patienten Gruppe A (32,7%), 15 Gruppe B (30,6%) und 18 Gruppe C (36,7%) zugeordnet wurden. Das Alter bewegte sich dabei in einem Intervall von 36 bis 84 Jahren mit einem Mittelwert von µ=63 Jahren und einer Standardabweichung von s=11,3 Jahren. Aus dem ursprünglichen Patientenkollektiv wurden im Laufe der Studie die in Tabelle 4 (Tab.4) aufgeführten zehn Patienten von der statistischen Verarbeitung ausgeschlossen. Dies erfolgte zum größten Teil aus dem Grunde, dass die Patienten aufgrund peri- und postoperativer ernährungsbedingter Komplikationen in einem unzureichenden Maß enteral ernährt werden konnten. Seite 28 Tab.4: Aus der Bewertung ausgeschlossene Patienten Patientennummer Grund des Ausscheidens 41 Keine Anlage einer FNKJ 21, 25, 35, 39 Aufgrund klinischer Komplikationen Indikation zur Drosselung der enteralen Ernährung, sodass eine Zufuhr von weniger als 90% der geforderten Glutamin Dipeptid Menge erreicht wurde 14, 26, 34, 36, 44 postoperativ weniger veranschlagten Menge als an 50% der enteraler Ernährung zugeführt Nach Ausschluss der genannten Probanden ergab sich ein Patientenkollektiv aus 39 Patienten. Davon waren 10 Patienten der enteral supplementierten Gruppe (Gruppe A), 14 der parenteral supplementierten Gruppe (Gruppe B) und 15 der Kontrollgruppe (Gruppe C) zugeordnet. Bezüglich der Alters- und Geschlechtsverteilung und der körperlichen Charakteristika, gemessen anhand von Größe, Gewicht und BMI, ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (Tab.5 ) Tab.5.: Patientencharakteristika nach Gruppen Gruppe enterale parenterale Glutaminzufuhr Glutaminzufuhr Kontrollgruppe (C) (A) (B) 5:5 10 : 4 8:7 61,3 64,4 64,4 Gewicht (in kg) 74,5 73,7 71,4 Größe (in cm) 171,1 172,6 168,8 BMI (in kg/m2) 25,6 24,9 24,9 Geschlecht (männlich:weiblich) Alter (Mittelwert in J) Seite 29 Die Diagnosenverteilung innerhalb der einzelnen Gruppen ist der folgenden Tabelle (Tab.6) zu entnehmen. Tab.6: Diagnoseverteilung innerhalb der Gruppen Gruppe (C) Gesamt 2 5 8 6 7 7 20 Papilla Vateri Ca 0 1 1 2 Pankreas Ca 2 1 2 5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 14 15 39 enterale parenterale Diagnose Glutaminzufuhr Glutaminzufuhr (A) (B) Ösophagus Ca 1 Magen Ca Ösophagus- Kontrollgruppe stenose Magenstromatumor Chronisches Ulcus ventriculi Pankreatitis Gesamt Seite 30 4.2 Ernährungsdaten Auch wenn die Nahrungszufuhr innerhalb der Studie einem vorgegebenen Protokoll folgen sollte und die Ernährung innerhalb der Gruppen insgesamt gut vertragen wurde, so unterlagen die verabreichten Nährstoffe und Kalorien individuellen therapie- und verlaufsbedingten Schwankungen. Um diese darzustellen seien im Folgenden die Verläufe der absoluten und der enteralen Energiezufuhr aufgeführt. Gesamtenergiezufuhr Die gesamte Energiezufuhr ergibt sich aus den enteral via FNKJ und parenteral via ZVK verabreichten Kalorien (s.a. 4.3). Dabei kam es zu einem signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen am zweiten postoperativen Tag (p<0,05). Bei näherer Untersuchung mittels MannWhitney-U-Test zeigte sich eine signifikante Differenz (p<0,01) zwischen der Gruppe mit parenteral verabreichtem Glutamin (Gruppe B) und der Kontrollgruppe (Gruppe C), die im Verlaufsdiagramm als verzögerter Ernährungsaufbau in Gruppe B imponierte (Abb.4). Die verbleibenden Studientage ließen statistisch keine gruppenspezifischen Ernährungscharakteristika erkennen. Grafisch war zu sehen, dass in Gruppe B auch nach dem sechsten postoperativen Tag die Kalorienzufuhr unterhalb der der anderen Gruppen lag und am achten und neunten Tag sogar noch kurzzeitig weiter abfiel (Abb.4). Seite 31 Abb.4: Verlaufsdiagramm der Gesamtenergiezufuhr innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) enterale Entergiezufuhr Nachdem in der gesamten Energiezufuhr lediglich ein kleiner Unterschied zwischen den Gruppen nachzuweisen war, wurden die via FNKJ verabreichten Energiemengen separat betrachtet, um eventuelle schwerwiegendere Abweichungen in der Ernährungsart aufzudecken. Ebenso wie in der vorangegangenen Betrachtung, war auch hier ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit parenteraler Glutaminzufuhr (Gruppe B) und der Kontrollgruppe (Gruppe C) am zweiten Ernährungstag zu erkennen (p<0,01). Dieser setzte sich darüber hinaus am dritten Tag fort (p<0,05). Grafisch entsprach der verzögerte Anstieg in Gruppe B dem der gesamten Energiezufuhr (Abb.4) und auch das Verbleiben unterhalb des Niveaus der übrigen Gruppen war zu erkennen, blieb jedoch außerhalb der statistischen Signifikanz (Abb.5). Seite 32 Abb.5: Verlaufsdiagramm der enteralen Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Energiezufuhr innerhalb der Seite 33 4.3 Laborchemische Parameter im Blut Die Entwicklungen der Leukozyten, Lymphozyten, neutrophilen Granulozyten und Monozyten, sowie des CRP und des Fibrinogens wiesen in der postoperativen Phase keine signifikant voneinander abweichende Verläufe auf . Bei den Leukozyten war allen drei Gruppen ein leichter Rückgangs zum fünften postoperativen Tag gemein mit anschließendem Anstieg zum Studienende. Dabei fiel auf, dass die Glutamin supplementierten Gruppen (Gruppe A und B) nahezu identisch verliefen und die Werte der Kontrollgruppe (Gruppe C) stets leicht unter denen der übrigen Gruppen verblieben. Des weiteren war der Anstieg zum letzten Studientag hin in der Kontrollgruppe verhältnismäßig gering ausgebildet (Abb.6). Bei den Lymphozyten kam es in Gruppe B zunächst zu einer Abnahme, mit einem anschließenden Anstieg der Werte, wohingegen in Gruppe A und C ein stetiger Anstieg zu verzeichnen war, der in der Kontrollgruppe (Gruppe C) deutlicher ausgeprägt war (Abb.7). Bezüglich der neutrophilen Granulozyten erreichten alle Studiengruppen einen vergleichbaren Wert am letzten Studientag, wobei die enteral zusatzernährte Gruppe (Gruppe A) zunächst abfiel um wieder anzusteigen, die parenterale Gruppe zunächst anstieg, um danach wieder abzufallen und die Werte der Kontrollgruppe (Gruppe C) stetig fielen (Abb.8). In der Gruppe mit enteraler Glutaminsupplementation (Gruppe A) erfolgte bei den Monozyten ein steiler Anstieg zum fünften postoperativen Tag und kehrte am zehnten Tag nahezu zum Ausgangswert zurück. Bei parenteraler Glutaminzufuhr (Gruppe B) fielen die Werte zum elften postoperativen Tag ab und in der Kontrollgruppe (Gruppe C) letztendlich stiegen die Werte weniger als in Gruppe A an und fielen danach ebenfalls zu den Ausgangswerten zurück (Abb.9 ). Das CRP fiel bei enteraler Glutamingabe (Gruppe A) stetig ab. Die Werte der Kontrollgruppe (Gruppe C) stiegen zunächst ein wenig an um danach Seite 34 ebenfalls steil abzufallen. Unter parenteraler Glutamingabe (Gruppe B) stiegen die Werte hingegen auf ein Maximum der Kurve zum letzten Studientag hin an(Abb.10). Während die CRP-Werte zwischen den Gruppen noch leicht unterschiedlich verliefen, so waren diese das Fibrinogen betreffend nahezu identisch. Zum fünften Tag stiegen sie in allen Gruppen steil an fielen zum letzten Studientag wieder steil ab (Abb.10 u. 11). Abb.6: Verlaufsdiagramm der Leukozyten innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Seite 35 Abb.7: Verlaufsdiagramm der Lymphozyten innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Abb.8: Verlaufsdiagramm der neutrophilen Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Granulozyten innerhalb der Seite 36 Abb.9: Verlaufsdiagramm der Monozyten innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Abb.10: Verlaufsdiagramm des CRP (C reaktives Protein) innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Seite 37 Abb.11: Verlaufsdiagramm des Fibrinogen innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) 4.4 T-Lymphozyten Subsets Die einzelnen Parameter der T-Lymphozyten Subsets wiesen an keinem der drei postoperativen Studientage einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen auf . In dem Verlaufsdiagramm der CD4+-Lymphozyten stiegen alle Werte zum 5. postoperativen Tag an, wobei in der Gruppe mit enteraler Zufuhr von Glutamin (Gruppe A) lediglich ein sehr geringer Anstieg zu verzeichnen war. Am elften postoperativen Tag erreichten alle drei Gruppen ein vergleichbares Niveau, wobei die Werte der enteral zusatzernährten (Gruppe A) und der Kontrollgruppe (Gruppe C) bis dahin anstiegen, die der parenteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe B) vom fünften zum elften postoperativen Tag hingegen abfielen. Die Unteschiede im Seite 38 Verlauf relativierten sich allerdings dahingehe nd, dass über die gesamte Studiendauer die Normgrenzen nicht verlassen wurden (Abb.12). Abb.12: Verlaufsdiagramm der CD4+-Werte innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Bei den CD8+-Lymphozyten ließen sich keine signifikanten Unterschiede in der postoperativen Phase, wobei auffiel, dass bei nahezu parallelem der Kurven die Werte der Kontrollgruppe stets über denen der enteral zusatzernährten (Gruppe A) und diese wiederum über denen der parenteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe B) lagen. Nach einem anfänglichen steilen Abfall kam es in allen Gruppen zu einer Erholung zum elften postoperativen Tag(Abb.13). Seite 39 Abb.13: Verlaufsdiagramm der CD8+ Lymphozyten innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Ebenso wie die CD4+- und CD8+-Parameter verhielt sich auch ihr Quotient, die CD4+/CD8+ Ratio, an den postoperativen Tagen nicht signifikant unterschiedlich für die drei Gruppen. Im Verlauf zeigten alle Gruppen einen Anstieg zum fünften Tag. In Gruppe A und C stiegen die Werte weiter gering an und fielen in Gruppe B ab (Abb.14). Seite 40 Abb.14: Verlaufsdiagramm der CD4+/CD8+ Ratio innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Die HLA-DR+ Lymphozyten wiesen im statistischen Test keine signifikanten Unterschiede auf. Im Verlaufdiagramm hingegen fiel auf, dass neben einem simultanen, zunächst sinkenden und danach ansteigenden, Verlauf in den Glutamin supplementierten Gruppen in der Kontrollgruppe ein stetiger Abfall der Werte bis zum Studienende hin erfolgte (Abb.15). Seite 41 Abb.15: Verlaufsdiagramm der HLA-DR+ Lymphozyten innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) 4.5 Immunglobuline Im Gegensatz zu den vorangegangenen Lymphozyten Subsets ließen die Diagramme der Immunglobuline für alle Gruppen einen annähernd gleichen Verlauf in der postoperativen Phase erkennen (Abb.16, Abb.17 und Abb.18). Die größten Unterschiede zwischen den Gruppen waren beim IgA zu erkennen, wo sie nur knapp die Signifikanz verfehlten(p=0,055). Seite 42 Abb.16: Verlaufsdiagramm des IgA innerha lb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Bei den übrigen Immunglobulinen IgG und IgM waren über die gesamte Studiendauer ebenfalls keine signifikanten Gruppenunterschiede nachweisbar. Auch optisch verliefen die gegen die Zeit aufgetragenen Mediane aller Gruppen im Vergleich zu den vorher betrachteten zellulären Parametern gleichförmig vom ersten zum elften postoperativen Tag hin ansteigend mit einer kleinen Abweichung nach oben im IgM Wert der Gruppe mit parenteraler Glutaminzufuhr (Gruppe B), sowie nach unten im IgA Wert der Gruppe mit enteraler Glutaminzufuhr (Gruppe A) am fünften postoperativen Tag (Abb.16, 17 und18). Seite 43 Abb.17: Verlaufsdiagramm des IgG innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Abb.18: Verlaufsdiagramm des IgM innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Seite 44 4.6 Zytokine Die IL-2 Werte wiesen keine signifikanten gruppenspezifischen Unterschiede auf. Dabei verliefen die Graphen der Gruppe mit parenteraler Glutamingabe (Gruppe B) und der Kontrollgruppe (Gruppe C) nahezu auf einem Level und lediglich die Gruppe mit enteraler Glutamingabe (Gruppe A) wich am ersten postoperativen Studientag leicht davon ab. Während in den Gruppen B und C ein stetig fallender Verlauf zu verzeichnen war, stieg das IL -2 der enteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe A) zunächst an, um danach auf einen nahezu identischen Wert aller Gruppen abzufallen (Abb. 19): Abb.19: Verlaufsdiagramm des IL -2 innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Seite 45 Auch bei Betrachtung des IL-6 ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Prüfungsgruppen nachweisen. Dies lies sich auch im Verlauf der Mediane nachvollziehen, in denen sich übereinstimmende Graphen für alle drei Gruppen über die gesamte Studiendauer zeigten (Abb.20). Es kam zu einem stetigen Abfall zum Studienende hin mit einem zunächst steilen und später flachen aber weiter fallenden Verlauf. Abb.20: Verlaufsdiagramm des IL -6 innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Für den TNF-α ließen sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen feststellen. Im Verlauf der Mediane fielen jedoch drei verschiedene Kurven für die jeweiligen Gruppen auf. So wiesen die Werte der Gruppe mit enteraler Glutamingabe (Gruppe A) vom ersten postoperativen Tag aus ein stetiges Wachstum bis hin zum letzten Studientag auf. Einen vergleichbaren Betrag am letzten Tag zeigte die Gruppe mit parenteraler Zusatzernährung, die jedoch von einem geringeren Ausgangsniveau von weniger als der Hälfte des Wertes in Gruppe A einen steileren Aufwärtstrend aufwies. In der nicht Glutamin supplementierten Kontrollgruppe hingegen fielen die Werte zunächst ab. Zum elften postoperativen Tag stiegen sie noch an, blieben letztendlich aber deutlich unter dem Niveau der Glutamingruppen (Abb.21). Seite 46 Abb.21: Verlaufsdiagramm des TNF-α innerhalb der Studiengruppen über die Studiendauer (Mediane) Seite 47 5 Diskussion Die Konfrontation des menschlichen Körpers mit einer operativen Intervention beinhaltet eine Fülle von unphysiologischen Einflüssen, die eine Herausforderung für die Integrität und Funktion des Organismus darstellen. Dabei addieren sich widernatürliche Bedingungen einer schweren Erkrankung, der perioperativen Anästhesie und des chirurgischen Eingriffes der Art, dass je nach Ausprägung mit der postoperativen Phase eine Situation entsteht, die die Abwehr gegen pathologische Einwirkungen auf ein bedrohliches Maß herabsetzt. Um dieser Resistenzminderung zu begegnen, wird seit Jahren an supportiven Therapien in allen beteiligten Disziplinen geforscht, wobei in der postoperativen Phase der Ernährungstherapie zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet wird. In unserer Studie galt es, den unterschiedlichen Einfluss enteral oder parenteral zugeführter glutaminhaltiger Dipeptide auf den Verlauf zytologischer und humoraler Immunparameter nach großen Oberbaucheingriffen zu untersuchen. Dazu wurden die Patienten prospektiv randomisiert einer Behandlungsgruppe zugeordnet und an drei postoperativen Tagen (1.postoperativer, 5. postoperativer und 11. postoperativer Tag) bezüglich ihrer zellulären (Lymphozytensubsets mit CD4+-, CD8+- und HLA-DR+-Lymphozyten) und humoralen (IgA, IgG, IgM, IL -2, IL-6, TNF-α) Immunkomponenten untersucht. Da es sich bei der zellulären und humoralen Abwehr um sich gegenseitig beeinflussende Prozesse handelt, sind diese in der kausalen Betrachtung nicht Seite 48 strikt voneinander zu trennen und werden an einigen Stellen überlappend behandelt. Seite 49 5.1 Glutamin und zelluläre Immunparameter Wie die Untersuchungen des Immunsystems in der postoperativen Phase von Markewitz et al.14, Slade et al.15 und Kobayashi et al.16 ergaben, kommt es nach einem operativen Eingriff zu einem Abfall der Lymphozytenzahlen und einem Anstieg der neutrophilen Granulozyten. In den uns vorliegenden Daten sind in diesen zwei Zellreihen vom ersten postoperativen Tag bis zum Studienende deutliche Entwicklungen zu erkennen. Bei den Lymphozyten kommt es in der Kontrollgruppe sogar zu mehr als einer Verdopplung der Zellzahlen von unter 8 auf über 16 Zellen/µl (Abb.7). Ein eindeutiger Anstieg ist auch in der enteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe A) zu verzeichnen. Die Tatsache, dass der Anfangswert in der parenteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe B) bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen von dem der anderen zwei Gruppen abweicht, lässt keinen weiteren Vergleich zu. Bei korrekten Messwerten, muss von einem, von uns nicht näher zu bestimmenden Faktor in Gruppe B ausgegangen werden, welcher bei den geringen Patientenzahlen eine derartige Abweichung bedingt. Als denkbare Faktoren kommen sowohl operative Unterschiede als auch z.B. Begleiterkrankungen in Frage. Des Weiteren muss ein systematischer Fehler in Betracht gezogen werden. Bei ähnlichen Verläufen der drei Gruppen vom fünften zum elften postoperativen Tag ist eine anfängliche Differenz von uns nicht zu erklären und bleibt in größeren Patientengruppen zu überprüfen. Die gleiche Problematik verwehrt uns eine Aussage über den Einfluss des Glutamins auf die neutrophilen Granulozyten. Zunächst ist ein Abfall der Zellen in der Kontrollgruppe mit annähernd zehn Punkten am ausgeprägtesten (Abb.8 ). Ein entsprechender Verlauf lässt sich auch in der enteral Glutamin supplementierten Gruppe (Gruppe A) sehen. Die geringen Abweichungen der beiden Gruppen an den letzten zwei Tagen sind dabei zu vernachlässigen, da sie lediglich ca. 2 Zellen/µl betragen. Auch hier weicht die parenteral supplementierte Gruppe Seite 50 (Gruppe B) mit ihrem Ausgangswert von dem der anderen ab, um am fünften und elften postoperativen Tag dann entspreche nd abzufallen. Da zu keinem Zeitpunkt signifikante, gruppenspezifische Unterschiede vorliegen, kann kein Einfluss des Glutamins nachgewiesen werden. Bezüglich der Gruppen A und C bleibt festzuhalten, dass eine postoperative enterale Glutaminsupplementation im Vergleich zur Standardernährung in unserer Untersuchung keinen Effekt auf die Lymphozyten und neutrophilen Granulozyten hat. Zur Beurteilung einer parenteralen Glutaminzufuhr bleiben weitere Untersuchungen eine Erklärung der Differenzen schuldig. Beim ersten Blick auf das Diagramm der Monozyten (Abb.9 ) scheinen große Unterschiede zwischen den Gruppen vorzuliegen. Dieser Eindruck wird schnell durch die vertikale Skalierung des Diagramms entkräftet. Eine maximale Differenz von 3 Zellen/µl liegt außerhalb der klinischen Bedeutsamkeit. Bei fehlender Signifikanz konnte von uns keine Beeinflussung der Monozytenzahlen durch eine zusätzliche Glutamingabe gezeigt werden. In unseren Daten ließ sich kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Gruppen die T-Lymphozyten Subsets betreffend nachweisen und somit auch keine Auswirkung einer Glutaminapplikation auf diese Zellfraktionen. Auch aus den Verläufen der Graphen waren keine Auffälligkeiten zu erkennen, welche eine Gruppe gegenüber den anderen hervorgehoben hätten. Bei den CD4+-Lymphozyten ist es die Gruppe mit enteraler Glutaminzufuhr (Gruppe A), welche zunächst auf dem Niveau des ersten postoperativen Tages verbleibt. Da die Werte der Gruppen B und C zum fünften postoperativen Tag hin anstiegen, bleibt neben der Frage, ob sich die Entwicklung in größeren Gruppen ebenso zeigt, die Suche nach einem ursächlichen Faktor offen. Die Analyse der CD8+-Lymphozyten zeigt wiederum das Problem, dass die Ausgangswerte aller Gruppen mit einer maximalen Differenz von 6% voneinander abweichen. Die Verläufe der Werte über die Studiendauer gestalten sich erstaunlich gleichförmig und lassen auch hier keinen Einfluss des Glutamins erkennen. Bei unterschiedlichen Ausgangswerten der HLA-DR+-Lymphozyten mit einer Abweichung der parenteral Glutamin supplementierten Gruppe (Gruppe B) um zwei Prozentpunkte nach unten, heben sich die Grafen der zusätzlich Seite 51 ernährten Gruppen von dem der Kontrollgruppe ab. Nach einem anfänglichen Abfall der HLA-DR+-Lymphozyten kommt es in den Gruppen A und B wieder zu einem Anstieg. Die aktivierten Lymphozyten der Kontrollgruppe hingegen fallen weiter ab und erreichen erst am elften postoperativen Tag ihr Minimum. Die fehlende Signifikanz und die bereits anfangs bestehenden Unterschiede machen weitere Untersuchungen notwendig. Diese können auch Aufschluss über die Tatsache bringen, ob ein Abfall der HLA-DR+-Lymphozyten wie er auch von Vrsansky et al.23 beschrieben wurde, über den elften postoperativen Tag weiter zu verfolgen ist und ein wahres Minimum eventue ll sogar erst später erreicht wird. Die aktivierten T-Lymphozyten (HLA-DR+) stehen durch ihre Funktion an einer zentralen Position der Immunreaktion. Durch eine Beeinflussung dieser Zellfraktion kann daher von potentiell weitreichenden Auswirkungen auf die Abwehr ausgegangen werden, deren Bedeutung ebenfalls durch weiterführende Studien zu erschließen ist. Seite 52 5.2 Glutamin und Serum-Immunglobuline Vrsansky et al.23 beschrieben bei Verbrennungsopfern und Adler et al.3 nach Nieren-Karzinom Operationen einen perioperativen Abfall der Immunglobuline. Parallel zu der Entwicklung der Immunglobuline beschrieben Markewitz et al.14 und Slade et al.15 einen Abfall der gesamt Lymphozyten zum ersten postoperativen Tag. Das Minimum wurde dabei am Abend des Operationstags erreicht und bis zum fünften postoperativen Tag wurde bei dem überwiegenden Teil der Patienten wieder der Normalbereich der Parameter erreicht. Auch in unserer Studie kam es von postoperativ erniedrigten Werten zu einem sukzessiven Anstieg der Immunglobuline aller Klassen in allen drei Studiengruppen. Der Anstieg ließ sich darüber hinaus bis zum letzten Studientag verfolgen. Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen konnten von uns nicht nachgewiesen werden und auch ein in allen Gruppen vergleichbarer Verlauf der Parameter lässt bei den uns vorliegenden Daten nur den Schluss zu, dass keine der angewandten Therapieformen einen Einfluss auf die SerumImmunglobuline zu haben scheint, wie er z.B. von Li et al.61 bezüglich des IgGs beschrieben wurde. Im Vergleich der einzelnen Immunglobulinklassen fällt auf, dass sich die Werte des IgA und IgM über die gesamte Dauer innerhalb der Normgrenzen bewegen. Es kann also von einer auch postoperativ ausreichenden Ig -Synthese ausgegangen werden. Gerade die Immunglobuline der A Klasse spielen als Teil der Mukosa-assoziierten Abwehr eine wichtige Rolle bei dem Kontakt des Organismus mit Antigenen und der systemischen Immunantwort auf diese. Damit stehen sie auch im Fokus der Diskussion um den Status des Magen-Darm-Traktes in der Entwicklung eines Multiorganversagens (MOV). Im Gegensatz dazu bewegen sich die IgG Werte am ersten und fünften postoperativen Tag unterhalb des Normbereichs und kehren erst danach in die Seite 53 physiologischen Grenzen zurück. Dies betrifft alle drei Gruppen und kann als Teil einer postinterventionellen Abwehrschwäche angesehen werden. Eine klinische Relevanz kann nur durch weitere Studien belegt werden. Seite 54 5.3 Glutamin und Serum Zytokine IL-2, IL-6 und TNF-α Den Zytokinen kommt als interzellulär vermittelndem Mediatorsystem eine zentrale Rolle in der gegenseitigen Aktivierung und Potenzierung der immunologischen Reaktion zu. So sind auch sie Teil der postoperativ zu beobachtenden Herabsetzung der Abwehrfunktion, wie sie unter anderem von Akiyoshi et al.19 als postoperativ abnehmender Serumspiegel des IL -2 beschrieben wurde. Neben der alleinigen quantitativen Suppression des Immunsystems ist auf zellulärer Ebene ebenfalls eine alterierte Rezeptordichte und Signaltransduktion in kausalem Zusammenhang mit der herabgesetzten Reagibilität zu sehen. Der beschriebene postoperative Abfall des IL -2 trifft die Immunzellen durch den Einfluss auf die CD3+/CD4+ T-Helferzellen in einer entscheidenden Schaltstelle. Mit Beginn der enteralen Nahrungszufuhr und der Glutaminsubstitution in den entsprechenden Gruppen war unter parenteraler Glutamingabe (Gruppe B) sowie ohne Glutamin (Gruppe C) eine sukzessive Abnahme des IL-2 zu verzeichnen. In der Gruppe mit enteral zugeführtem Glutamin kam es hingegen mit einsetzen der Ernährung zu einem IL -2 Anstieg. Die gegensätzlichen Verläufe bzw. Level der HLA-DR+-Lymphozyten ließen erst zum Ende der Studie den Glutamin supplementierten Gruppen Vorteile durch die Ernährung mutmaßen. So konnte trotz des gemeinsamen Tiefpunktes des IL -2 Spiegels am elften postoperativen Tag der Glutamin supplementierten Gruppen ein Anstieg der HLADR+-Lymphozyten erkannt werden, wohingegen die aktivierten Lymphozyten in der Kontrollgruppe weiter abfielen. Bei insgesamt fallenden Zytokinwerten könnte dies als Ausdruck einer gesteigerten Empfindlichkeit der Lymphozyten auf den Mediator gedeutet werden. Seite 55 Bei Betrachtung der IL -6 Level beschrieben z.B. Parry-Billings et al.18 einen steilen postoperativer Anstieg mit Maximum vor dem fünften postoperativen Tag. Damit ist der postoperative Verlauf aller drei Studiengruppen gut vereinbar. In dem nahezu gleichförmigen Abfall der Werte ließen sich keine signifikanten gruppenspezifischen Unterschiede finden. Etwas zeitlich versetzt ließ sich auch in den vom IL-6 induzierten Akute-Phase Proteinen ein postoperativer Abfall der Werte finden. Der gleichförmige IL -6 Verlauf ließ auf keinen Einfluss einer der Therapieformen diesbezüglich schließen. Im Gegensatz zu den anderen Zytokinen mit vergleichbaren postoperativen Verläufen, wiesen alle drei Gruppen auffällig heterogene TNF-α Spiegel auf. Nach Beginn der Dipeptidgaben zeigte sich in den Glutamin supplementierten Gruppen ein auf das Doppelte erhöhter TNF-α Spiegel im Vergleich zur Kontrollgruppe. Aufgrund der fehlenden statistischen Signifikanz ist diese Tatsache allerdings mit Vorsicht zu betrachten und müsste durch weitere Werte bestätigt oder widerlegt werden. Eine gesteigerte TNF-α Sekretion unter Glutamintherapie wurde auch von Yaqoob et al.49 beschrieben. Dieser Effekt ließ sich auf unsere Daten übertragen (Abb.21). Als Folge eines erhöhten TNF-α Spiegels sind gegensätzliche Effekte denkbar. Für die Umbau- und Regenerationsvorgänge nach chirurgischen Eingriffen oder auch schweren Traumata birgt eine gesteigerte Aktivität der durch TNF-α stimulierten Zellen wie Monozyten und Granulozyten das Potential einer verbesserten Wund - und Anastomosenheilung mit den entsprechenden Konsequenzen für die anschließende Heilungsphase. Untersuchungen zur Anastomosen- oder Wundheilung konnten der Glutamintherapie allerdings bisher keine überzeugenden Effekte nachweisen. Eine vermehrte TNF-α Sekretion kann jedoch auch als Teil einer überschießenden Entzündungsreaktion Nachteile für den Patienten mit sich bringen. So ist bei einem kritisch erkrankten Organismus in einer verstärkten Immunreaktion auch immer die Gefahr einer umfassenden Organschädigung mit Initiierung oder Triggerung eines Multiorganversagens zu sehen. Daher ist es wichtig das Ausmaß einer eventuellen geförderten monozytä ren Potenz in weiteren Untersuchungen zu klären. Dies bezieht die Bestimmung weiterer Seite 56 beteiligter Komponenten wie unter anderem ein von Denno et al.50 beschriebenes protektiv-erhöhtes GSH mit ein. Aus den uns vorliegenden Daten war bei den Zytokinen lediglich ein Trend zu einer erhöhten TNF-α Spiegel erkennbar. Der Umfang mit eventuellen Voroder sogar Nachteilen des Glutamins für chirurgische Patienten bleibt ebenso wie Unterschiede durch die verschiedenen Applikationswege in weiteren Studien abzuklären. Seite 57 6 Zusammenfassung und Anregungen Wir untersuchten bei 39 Patienten nach großen Oberbaucheingriffen mit postoperativ enteraler Ernährung den Einfluss von enteral und parenteral zugeführten Glutamin-Dipeptiden auf zelluläre und humorale Immunparameter. Bei der Betrachtung der zellulären und humoralen Immunparameter konnte von uns kein signifikanter Nachweis eines Einflusses einer der untersuchten Therapieformen erbracht werden. Aufgrund mangelnder signifikanter gruppenspezifischer Unterschiede konnten aus den abweichenden Verläufen der Werte zwischen den drei Studiengruppen allenfalls Deutungen über die Wirksamkeit der von uns verabreichten Diät angestellt werden. Aus einer positiven Tendenz der Glutamin supplementierten Gruppen bei den HLA-DR+-Lymphozyten zum elften postoperativen Tag hin könnte durchaus eine weitreichende Auswirkung auf die Immunreaktion resultieren, da die aktivierten T-Lymphozyten eine zentrale Position in der Kaskade der Abwehrprozesse einnehmen. In unserer Untersuchung waren im Gegensatz dazu annähernd gleiche IL -2 Verläufe zu erkennen. In nachfolgenden Studien bleibt die Frage zu klären, ob unter Glutamingabe eine veränderte Lymphozytenreaktion auf Zytokinstimuli nachgewiesen werden kann. Im Rahmen dieser Untersuchung wäre des weiteren der beobachtete Anstieg des TNF-α und der Einfluss auf die einzelnen Zellpopulationen zu betrachten. Die Tatsache, dass die postoperative Ernährung in der parenteral zusatzernährten Gruppe (Gruppe B) signifikant verzögert erfolgte, lässt eine neue Seite 58 Frage aufkommen: kann die Glutamingabe bei einem verzögert gesteigerten Ernährungsregime den Verlauf der von uns bestimmten Immunparameter im Vergleich zu planmäßig ernährten Patienten erhalten? Eine Antwort darauf könnte eine Therapieoption bei komplikationsbedingt gestörtem Ernährungsaufbau bedeuten. Da das Immunsystem ein multifaktoriell beeinflusstes Organ darstellt, wird es sich auch in Zukunft schwierig gestalten, einigen wenigen Parametern einen Einfluss auf den Gesamtorganismus zuzuschreiben. Um die Einflussfaktoren auf das Abwehrsystem möglichst gering zu halten und somit den Kreis der Kausalzusammenhänge zu beschränken, wäre es sinnvoll in bevorstehenden Studien den Schweregrad der Erkrankungen mit seinen systemischen Auswirkungen mit einzubeziehen und die Patienten aus verschiedenen Kollektiven von benignen bis hin zu weit fortgeschrittenen malignen Erkrankungen auf die unterschiedlichen Therapieansätze zu randomisieren. Seite 59 7. 1 Literaturverzeichnis Büning H, Trenkler G Nichtparametrische statistische Methoden de Gruyter Berlin, New York, 1994 2 Trampisch H-J, Windeler J Medizinische Statistik Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2000 3 Adler G, Eichman W, Szczepanski M, Targonska I, Jasinska A Postoperative plasma interleukin-6 in patients with rena l cancer correlates with C-reactive protein but not with total fibrinogen or with high molecular weight fibrinogen fraction Thromb Res 1998;89(5):243-8 4 Dinarello CA The biological properties of Interleukin-1 Eur Cytokin Netw 1994; 5:517-531 5 Loppnow H Zytokine: Klassifikation, Rezeptoren, Wirkungsmechanismen Internist 2001; 42:13-27 6 Beutler B, Cerami A Cachektin and tumor necrosis factor as two sides of the same biological coin 7 Nature 1986; 320:584 Minigari MC, Gerosa F, Moretta A, Zubler RH, Moretta L factor activity of immunoaffinity purified and B-cell recombinant growth human interleukin 2 Eur J Immunol 1985; 15:193 8 Castell JV, Gomez-Lechon MJ, David M, Andus T, Geiger T, Trullenque R, Fabra R, Heinrich PC Interleukin-6 is the major regulator of acute phase protein synthesis in adult human hepatocytes FEBS 242(2):237-9 Lett 1989; Seite 60 9 Fiebiger E, Meraner P, Weber E, Fang IF, Stingl G, Ploegh H, Maurer D Cytokines regulate proteolysis in major histocompatibility complex class IIdependent antigen presentation by dendritic cells J Exp Med 2001; 193(8):881-92 10 Nohr CW, Latter DA, Meakins JL, Christou NV In vivo and in vitro humoral immunity in surgical patients: antibody response to pneumococcal polysaccharide 11 12 Surgery 1986; 100(2):229-38 MacLean LD, Meakins JL, Taguchi K, Duignan JP, Dhillon KS, Gordon J Host resistance in sepsis and trauma Ann Surg 1975; 182(3):207-17 Miles AA, Miles EM, Burke J value The and duration reactions of the skin to the primary lodgment of bacteria of defense Br J Exp Pathol 1957; 38:79-96 13 Christou NV, Superina RA, Broadhead M, Meakins JL Postoperative depression of host resistance: determinants and effect of peripheral protein sparing therapy 14 Surgery 1982; 92:786-792 Markewitz A, Faist E, Weinhold C, Lang S, Endres S, Hultner L, Reichart B Alterations of cell-mediated immune response following cardiac surgery Eur J Cardiothorac Surg 1993; 7(4):193-9 15 Slade MS, Simmons RL, Yunis E, Greenberg LJ after major surgery in normal patients 16 17 Immunodepression Surgery 1975; 78(3):363-72 Kobayashi E, Yamauchi H Interleukin-6 and a delay of neutrophil apoptosis after major surgery Arch Surg 1997; 132:209-10 Hansbrough JF, Bender EM, Zapata-Sirvent R, Anderson J Altered helper and suppressor lymphocyte populations in surgical patients. A measure of postoperative immunosuppression Am J Surg 1984; 148(3):303-7 18 Parry-Billings M, Baigrie RJ, Lamont PM, Morris PJ, Newsholme EA Effects of major and minor surgery on plasma glutamine and cytokine levels Ann Surg 19 1992; 127:1237-1240 Akiyoshi T, Koba F, Arinaga S, Miyazaki S, Wada T, Tsuji H Impaired production of interleukin-2 after surgery Clin Exp Immunol 1985; 59(1):45-9 20 Zoch G, Hamilton G, Rath T, Meissl G, Kneidl R, Roth E, Funovics J Impaired cell-mediated immunity in the first week after burn injury: investigation of spontaneous blastogenic transformation, PHA, IL-2 Seite 61 response and plasma suppressive activity Burns Incl Therm Inj 1988; 14(1):7 -14 21 Cruickshank AM, Fraser WD, Burns HJ, Van Damme J, Shenkin A Response of serum interleukin-6 in patients undergoing elective surgery of varying severity 22 Clin Sci (Colch) 1990; 79(2):161-5 Baigrie RJ, Lamont PM, Kwiatkowski D, Dallman MJ, Morris PJ Systemic cytokine response after major surgery Br J Surg 1992; 79(8):757-60 23 Vrsansky P, Janota S children 24 Immunological consequences of burn injury in Eur J Pediatr Surg 1995; 5(1):37-9 McLoughlin GA, Wu AV, Saporoschez I Correlation between anergy and circulating immunosuppressive factor following major surgical trauma Ann Surg 1979; 190:297-304 25 Askanazi J, Carpentier YA, Michelsen CB, Elwyn DH, Furst P, Kantrowitz LR, Gump FE, Kinney JM Muscle and plasma amino acids following injury. Influence of intercurrent infection Ann Surg 1980; 192(1):78-85 26 Roth E, Funo vics J, Muhlbacher F Metabolic Disorders in severe abdominal sepsis: Glutamine deficiency in skeletal muscle Clin Nutr 1982; 1:25-41 27 Kapadia CR, Colpoys MF, Jiang ZM, Johnson DJ, Smith AJ, Wilmore DW Maintenance of skeletal muscle intracellular glutamine during standard surgical trauma 28 JPEN J Parenter Enteral Nutr 1985; 9:583-9 Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM Prinzipien der Biochemie Spektrum Akademischer Verlag 1994 29 Chapman MA, Grahn MF, Giamundo P, O'Connell PR, Onwu D, Hutton M, Maudsley J, Norton B, Rogers J, Williams NS New technique to measure mucosal metabolism and its use to map substrate utilization in the healthy human large bowel Br J Surg 1993; 80(4):445-9 30 Ross BD, Hems R, Krebs HA The rate of gluconeogenesis from various precursors in the perfused rat liver 31 Biochem J 1967; 102:942-951 Marliss EB, Aoki TT, Pozefsky T, Most AS, Cahill GF Jr splanchnic glutmine andstarved man and glutamate metabolism J Clin Invest 1971; 50(4):814-7 Muscle in and postabsorptive Seite 62 32 Austgen TR, Chakrabarti R, Chen MK, Souba WW skeletal muscle glutamine metabolism in Adaptive regulation in endotoxin-treated rats J Trauma 1992; 32:600-7 33 Dudrick PS, Sarantos P, Ockert K, Chakrabarti R, Copeland EM, Souba WW Dexamethason stimulation of glutaminase expression in mesenteric lymph nodes 34 Am J Surg 1993; 165:34-9 Dimarchi RD, Tam JP, Kent SBH, Merrifield RB Weak acid-catalysed pyrrolidone carboxylic acid formation from glutamine during solid phase peptide synthesis 35 36 Int J Peptide Protein Res 1982; 19:88 Khan K, Hardy G, McElroy B, Elia M The stability of L-glutamine in total parenteral nutrition solutions Clin Nutr 1991; 10:193 Windmueller HG, Spaeth AE Course and fate of circulating citrulline Am J Physiol 1981; 241:E473-80 37 Stehle P, Fürst P In vitro hydrolysis of glutamine -, tyrosine- and cystein- containing short chain peptides 38 Clin Nutr 1990; 9:37 Lochs H, Williams PE, Morse EL, Abumrad NN, Adibi SA Metabolism of dipeptides and their constituent amino acids by liver, gut, kidney and muscle 39 Am J Physiol 1988; 254:E588 Hundal HS, Rennie MJ Skeletal muscle tissue contains extracellular aminopeptidase activity against Ala-Gln but no peptide transporter Eur J Clin Invest 1988; 18:163-A34 40 Eagle H Nutrition needs of mammalian cells in tissue culture Science 1955; 122:501-4 41 Eagle H, Oyama VI, Levy M, et al The growth response of mammalian cells in tissue culture to L-glutamine and L-glutamic acid J Biol Chem 1955; 218:607-617 42 Déchelotte P, Darmaun D, Rongier M, Hecketsweiler B, Rigal O, Desjeux JF Absorption and metabolic effects of enterally administered glutamine in humans 43 Am J Physiol 1991; 260(23):G677-82 Babst R, Hörig H, Stehle P, et al Glutamine peptide-supplemented long-term total parenteral nutrition: effects on intracellular and extracellular amino acid patterns, nitrogen economy, and tissue morphology in growing rats JPEN J Parenter Enteral Nutr 1993; 17:566 Seite 63 44 Roth E, Karner J Ollenschläger G, Simmel A, Fürst P, Funovics J Alanylglutamine reduces muscle loss of alanine and glutamine in postoperative anaesthetized dogs 45 Clin Sci 1988; 75:641 Yoshida S, Leskiw MJ, Schluter MD, et al Effekt of total nutrition, systemic sepsis, and glutamine on gut mucosa in rats parenteral Am J Physiol Endocrin Metab 1992; 263:E368 46 Tamada H, Nezu R, Imamura I, et al The dipeptide alanyl-glutamine prevents intestinal mucosal atrophy in parenterally fed rats JPEN J Parenter Enteral Nutr 1992; 16:110 47 Houdjik APJ, Van Leeuwen PAM, Boermeester MA, Van Lambalgen T, Teerlink T, Flinkerbusch EL, Sauerwein HP, Wesdorp RIC Glutamine- enriched enteral diet increases splanchnic blood flow in the rat Am J Calder PC Phys 1994; 267(30):G1035-40 48 Yaqoob P, Kew S, Wallace FA, Miles EA, Dietary glutamine enhances Th1 lymphocte responses Clin Nutr 1998; Suppl. P.17 49 Yaqoob P, Wells SM, Wallace FA, Calder PC Dietary glutamine enhances cytokine production by macrophages Clin Nutr 1998; Suppl. P.15 50 Denno R, Rounds JD, Faris R, Holejko LB, Wilmore DW Glutamine- enriched total parenteral nutrition enhances plasma glutathion in the resing state J Surg Res 1996; 61:35-8 51 Dugan MER, McBurney MI Luminal glutamine perfusion endotoxin-related changes in ileal permeability of the piglet JPEN alters J Parenter Enteral Nutr 1995; 19:83 52 Gianotti L, Alexander JW, Ge nnari R, Pyles T, Babcock GF Oral glutamine decreases bacterial translokation and improves survival in experimental gut origin sepsis JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995; 19:69 53 Buchmann AL The use of glutamine in parenteral nutrition Gastroenterology 1995; 108:1961-3 54 Fox AD, Kripke SA, DePaula J, et al Effect of a glutamine supplemented enteral diet on methotrexat-induced enterocolitis Entera Nutr 1988; 12:325-31 JPEN J Parenter Seite 64 55 Klimberg VS, Salloum RM, Kaspar M, et al Oral glutamine accelerates healing of the small intestine and improves outcome following whole abdominal radiation 56 Arch Surg 1990; 125:1040-45 Suzuki I, Matsumoto Y, Adjei AA, et al Effect of glutamine-supplemented diet an response to methicillin resistant staphylococcus aureus infection in mice J Nutr Sci Vitaminol 1993; 39:405-10 57 Fair MJ, Kornbluth J, Blossom S, Schaeffer R, Klimberg VS Glutamine enhances immunoregulation of tumor growth JPEN J Parenter Enteral Nutr 1994; 18: 471-6 58 Shirouzu Y, Yoshida S, Matsui M, Ishibashi N, Noake T, Yoshizumi T, Shirouzu K Effect of glutamine supplement on immune function an advanced esophageal cancer patients with radio-chemotherapy Clin Nutr 1996; ESPEN Supplement P.18 59 Pironi L, Paganelli GM, Miglioni M, et al Morphologic and cytoproliferatorive patterns of duodenal mucosa in two patients after long term parenteral nutrition: changes with oral refeeding and relation to intestinal resection JPEN J Parenter Enteral Nutr 1994; 18:351-4 60 Spittler A, Winkler S, Gotzinger P, Oehler R, Willheim M, Tempfer C, Weigel G, Fugger R, Boltz-Nitulescu G, Roth E Influence of glutamine on the phenotype and function of human monocytes Blood 1995; 86(4):1564-9 61 Li J, Kudsk KA, Janu P, Renegar KB Effect of glutamine-enriched total parenteral nutrition on small intestinal gut-associated lymphoid tissue and upper respiratory tract immunity Surgery 1997; 121:542-9 62 Ogle CK, Ogle JD, Mao J-X, et al Effect of glutamine on phagocytosis and bacterial killing by normal and pediatric burn patient neutrophils JPEN J Parenter Enteral Nutr 1994; 18:128-33 63 Bloos F, Reinhart K Antiinflammatorische Therapie in der Sepsis Der Chirurg 2002; 73: 1087-92 64 Höflich C, Volk H-D 2002 73:1100-04 Immunmodulation in der Sepsis Der Chirurg Lebenslauf n Persönliche Daten Name: Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: Familienstand: Konfession: Vater: Mutter: Lars Schäfer 06.08.1975 Bochum deutsch ledig römisch-katholisch Dr. Bernd Schäfer Brigitte Schäfer, geb. Reymann n Schulbildung 8/1981 bis 6/1985 8/1985 bis 6/1994 Kirchschule Bochum-Wattenscheid Hellweg-Gymnasium in Bochum Wattenscheid mit Abschluss Allgemeine Hochschulreife 7/1994 bis 10/1995 Zivildienst auf der Station für Querschnittsgelähmte und Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma im Bergmannsheil Bochum n Hochschulstudium 10/1995 bis 4/2002 8/1997 8/1998 9/2000 4/2001 5/2002 Famulaturen Medizinstudium an der Ruhr -Universität-Bochum Ärztliche Vorprüfung Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Ausbildung im Praktischen Jahr in der Augusta Krankenanstalt 4 Monate Innere Medizin (Prof. Dr. A. S. Petrides und Prof. Dr. M. Wehr) 4 Monate Chirurgie (Prof. Dr. S. John) 4 Monate Anästhesie (Dr. Hasselbring) Dritter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung Hausärztlich-Internistische Praxis Dr. B. Schäfer Abteilung für Chirurgie, St. Josef Hospital Bochum (RUB) Abteilung für Anästhesie, St. Josef Hospital Bochum (RUB) Medizinische Klinik I (Onkologie), St. Josef Hospital Bochum (RUB) Dissertation „Glutamin Dipeptid Supplementation in der enteralen Ernährung: Effekt enteraler bzw. parenteraler Zufuhr auf zelluläre und humorale Immunparameter“ unter der Leitung von PD Dr. med. M. Senkal in der chirurgischen Abteilung des St. Josef Hospitals in Bochum -RuhrUniversität-Bochum n ärztliche Tätigkeit 7/2002 bis 6/2003 seit 2/2003 Datum, Unterschrift AiP in der Abteilung für Gastroenterologie der AugustaKranken Anstalt Bochum unter der Leitung von Hr. Prof. Dr. A. S. Petrides AiP in der Abteilung für A nästhesie der S tädtischen Kliniken Dortmund gGmbH unter der Leitung von Hr. PD. Dr. J. F. Zander