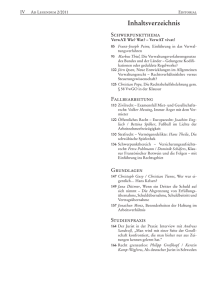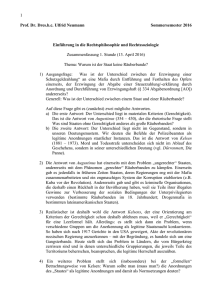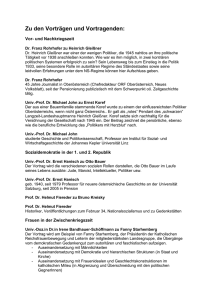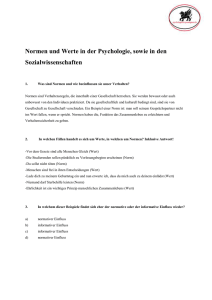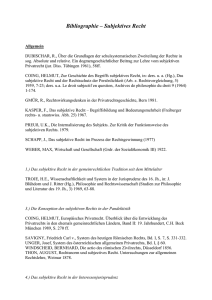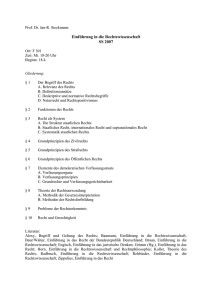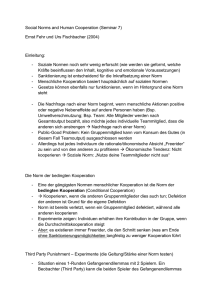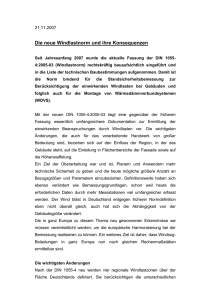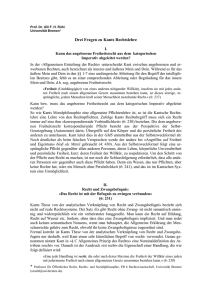Dietmar von der Pfordten Vorlesung Theorie und Methoden des
Werbung

Dietmar von der Pfordten Vorlesung Theorie und Methoden des Rechts 5. Vorlesung: Der Positivismus und die Reine Rechtslehre I. Der Positivismus/Der Gesetzespositivismus Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts begann sich eine Geistesströmung zu etablieren, die dann ab der Mitte des Jahrhunderts dominant wurde: der Positivismus. Auguste Comte (1798-1857) veröffentlichte 1830-1842 sein sechsbändiges Werk Cours de philosophie positive (Abhandlung über die positive Philosophie). 1844 erschien die Kurzfassung Discours sur l’esprit positif. In diesen Werken propagiert er eine Reduktion aller Wissenschaft auf Tatsachenbeobachtung sowie daraus abgeleitete Grundgesetze (allerdings möglichst wenige). Nach Comte durchläuft die Menschheit in ihrer Geschichte drei Stadien (sog. Dreistadiengesetz): ein theologisches, ein metaphysisches, ein positives. Während im theologischen Stadium die natürlichen Tatsachen als Wirkungen übernatürlicher Wesen aufgefaßt werden, also von Naturgeistern, Göttern oder zuletzt im Monotheismus eines Gottes, treten im metaphysischen Stadium abstrakte Kräfte an ihre Stelle, etwa der Wille oder das Absolute. Im letzten, positiven Stadium wird dagegen auf letzte absolute Einsicht in die Ursachen der Phänomene verzichtet. Lediglich die empirischen Tatsachen werden miteinander verbunden. Comte sah sich selbst als einen Vertreter dieses letzten Stadiums. Am Beispiel des Dreistadiengesetzes ist auch das Element der Evolution (ohne Bezug auf Darwin) in seinem Werk nicht zu übersehen. Comte ist der Ahnherr der Soziologie, welche die Philosophie zu verdrängen versuchte. Er postulierte einen sechsstufigen Aufbau der Wissenschaft, in dem die Mathematik die Basis ausmachte und auf den anderen Stufen, die Mechanik und die Astronomie, die Physik, die Chemie, die Biologie, und die Soziologie anzusiedeln sind, welche er als eine Art "soziale Physik" verstand. Ähnlich positivistische Strömungen innerhalb der allgemeinen Philosophie wurden kurze Zeit später auch in England und in Deutschland präsent. Zu erwähnen wären etwa für England Herbert Spencer und Deutschland Ernst Haeckel oder E. Dühring. Spencer hatte eine eigene evolutionistische Konzeption vorgetragen, wurde von Darwin inspiriert und als eigenständiger Philosoph wahrgenommen. Haeckel war vor allem ein Popularisierer der Darwinschen Evolutionstheorie in Deutschland, während Dühring sich genuin 2 als Positivisten bezeichnete. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann der Positivismus dann auch auf die Auffassungen des Rechts zu wirken. Rezipiert wurden Evolutionsaspekte dabei kaum, sondern die Orientierung an Tatsachen. Man sah das Recht vor allem oder ausschließlich als empirische Tatsache an, wobei zwei Alternativen zur Verfügung standen: Man konnte es entweder als psychologische Tatsache der seelischen Innenwelt des Menschen oder als soziologische Tatsache des äußeren gesellschaftlichen Daseins beschreiben. Oft wurden auch beide Auffassungen verbunden. Für ersteres stand etwa die psychologische Rechtstheorie Ernst Rudolf Bierlings in seinem Hauptwerk „Juristische Prinzipienlehre“ (5 Bände 1894-1917). Entscheidend wird bei ihm die Anerkennung des Rechts durch die Menschen: „Recht im juristischen Sinne ist im allgemeinen alles, was Menschen, die in irgend welcher Gemeinschaft miteinander leben, als Norm und Regel dieses Zusammenlebens wechselseitig anerkennen.“ (I, S. 19). Für die Auffassung des Rechts als soziale Tatsache steht vor allem Max Weber. Recht ist nach seiner Auffassung eine Ordnung, „die äußerlich garantiert ist durch die Chance des physischen oder psychischen Zwangs durch ein auf Erzwingung der Innehaltung oder Ahndung der Verletzung gerichtetes Handeln eines eigens darauf eingestellten Stabes von Menschen“. Auch alle Theorien, die das Recht in der Nachfolge Nietzsches vor allem als soziale Macht sehen (etwa Foucault) gehören in diese Gruppe. Man kann diese Auffassung vom Recht als bloßer empirischer Tatsache den „rechtstheoretischen Positivismus“ nennen. Er hängt zusammen mit einem rechtsethischen Positivismus oder Nihilismus: Für eine derartige positivistische Auffassung kann eine naturrechtliche oder rechtsethische Verpflichtung für das Recht nicht relevant werden. Sie ist einer rationalen Untersuchung und Betrachtung nicht zugänglich. Vom rechtstheoretischen und rechtsethischen Positivismus nicht logisch abhängig, aber doch auch nicht unbeeinflußt war schließlich ein Positivismus der juristischen Methodenlehre und damit vor allem der Rechtsquellen. Dem fiel zuerst das wissenschaftliche Recht zum Opfer und in einer radikaleren Version auch das Gewohnheitsrecht. Übrig blieb von den drei Rechtsquellen Savignys und Puchtas dann nur das Gesetz als Rechtsquelle. Man hatte den sog. „Gesetzespositivismus“ erreicht. Er findet sich bereits in der bekannt gewordenen Schrift „Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft“ von Julius Hermann von Kirchmann aus dem Jahre 1848 mit dem berühmten Zitat: „Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zur Makulatur.“ 3 Damit scheint aber der Gesetzespositivismus in der Form des Rechtsquellenpositivismus und seine Auffassung von der Rechtswissenschaft in eine Krise oder "Widerspruch" zu geraten; jedenfalls in eine deutliche Spannung zu den philosophischen Ausgangspunkten des Positivismus. Denn als Tatsachen, d.h. als Normen, deren Existenz durch empirisch beobachtbare Rechtsquellen "positiv" nachweisbar sein sollte, erwiesen sich dann die Gesetze doch als nicht permanent oder als nicht beständig genug, anders als die empirischen Tatsachen der Wissenschaft im Geiste des Positivismus. Wie könnte dann überhaupt das Recht oder die Rechtswissenschaft im Sinne des Rechtsquellenpositivismus den positivistischen Wissenschaftsidealen entsprechen? Was wäre dann der Gegenstand der Rechtswissenschaft? Vom Standpunkt des Rechtsquellenpositivismus und insbesondere vom Standpunkt Kirchmanns besteht auch ein gewisser Gegensatz zu dem rechtstheoretischen Rechtspositivismus in seiner psychologischen oder soziologischen Version: Wenn nämlich Kirchmann mit seiner Behauptung recht hat, dann dürfen Anerkennung im Sinne Bierlings oder Chance des Zwangs im Sinne Webers nicht mehr so relevant für die Identifikation dessen sein, was Recht ist, soweit der Gesetzgeber seine drei berichtigenden Worte gesprochen hat. Kirchmann hat seine These nicht als Kritik am Gesetzespositivismus gefaßt, sondern in dessen Konsequenz und als Kritik an der Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft. Der Gesetzespositivismus wurde weiter von vielen Dogmatikern propagiert und auch einigen Rechtstheoretikern, insbesondere von K. Bergbohm und auch von Hans Kelsen. Mit dem Positivismus verbunden ist häufig eine subjektivistische Theorie der Auslegung und Rechtsfortbildung und zugleich eine strenge Bindung der Rechtsanwendung an die Rechtssetzung durch das Gesetz. Die theoretische Frage bleibt dennoch offen, wie der Gesetzespositivist (und auch der Rechtswissenschaftler allgemein) auf die These Kirchmanns reagieren soll. Eine der konsequentesten und aussagekräftigsten gesetzespositivistischen Antworten darauf ergibt sich aus Kelsens Reiner Rechtslehre, der wir uns gleich zuwenden werden. Bevor wir uns aber mit Kelsen beschäftigen, wollen wir einen allgemeinen Blick auf das heutige Selbstverständnis des Rechtspositivismus werfen. Einer der heutigen Vertreter in Deutschland, Norbert Hoerster, sieht fünf allgemeine Thesen, die in Zusammenhang mit rechtspositivistischen Theorien gestanden haben oder stehen. Diese sind: 1. Der Begriff des Rechts ist ethisch neutral zu definieren (Neutralitätsthese) 4 2. Der Begriff des Rechts ist durch den Begriff des Gesetzes zu definieren (Gesetzesthese) 3. Die Anwendung des Rechts erfolgt im Wege wertungsfreier Subsumtion (Subsumtionsthese) 4. Die Maßstäbe richtigen Rechts sind subjektiver Natur (Subjektivitätsthese) 5. Die Normen des Rechts sind in jedem Fall zu befolgen (Befolgungsthese) Von diesen fünf Thesen ist für die Definition des Rechtspositivismus nach Hoerster die erste absolut wesentlich; sie wird in der Regel zusammen mit der vierten angetroffen, obwohl sie nicht notwendig mit dieser verbunden sei. Obwohl auch die Thesen 3 und 5 dem Rechtspositivismus zugeschrieben werden und mit ihm konsistent sind, ist Hoerster zuzustimmen, dass sie heute kaum von einem Rechtspositivisten vertreten werden. Die These 2 schließlich impliziert, dass der Rechspositivismus die Möglichkeit des Gewohnheitsrechts ablehnen würde, eine These, die nach Hoerster mit dem Rechtspositivismus nicht einhergehen muss. Tatsächlich stehen in den verschiedenen Versionen des Rechtspositivismus, die wir oben erwähnt haben (rechtsheoretisch, rechtsethisch, rechtsquellenbezogen oder methodenbezogen) unterschiedliche Gesichtspunkte im Vordergrund, die diesen verschiedenen Thesen entsprechen. II. Elemente der Reinen Rechtslehre: Hans Kelsen Betrachten wir jetzt eine prominente, vielleicht auch die prominenteste, und besonders umfassende Konzeption des Rechtspositivismus im Sinne des Gesetzespositivismus und durchaus auch im Sinne eines rechtstheoretischen und rechtsethischen Positivismus, Kelsens Reine Rechtslehre. Zunächst einige Daten zu Person und Werk: Hans Kelsen, *11.10.1881 (Prag). Studium der Rechtswissenschaft in Wien, Heidelberg und Berlin. 1906 Promotion an der Wiener Universität, 1911 dort Habilitation. 1914-1918 beamteter Dozent an der Exportakademie des k. k. Handelsministeriums (unterbrochen durch den 1. Weltkrieg). 1918-1930 Professor an der Universität Wien, maßgebliche Mitarbeit an der Bundesverfassung Österreichs, Richter am Verfassungsgerichtshof, 1930-1933 ordentlicher Professor an der Universität Köln, ab 1933 Lehrtätigkeit am Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales in Genf und zugleich an der Deutschen Universität in Prag, wo er bis 1939 als Professor tätig war. 1940 Emigration in die USA, Lehrtätigkeit an der New School for Social Research. 1940-1942 Lecturer bzw. Research Associate an der Harvard Law School. 1942-1945 Gastprofessor am Political Science-Department der University of California in Berkeley. Ab 1945 dort Professor. #19.04.1973 (Berkeley). - 5 Werke: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz (1911); Über Staatsunrecht (1913); Zur Lehre vom öffentlichen Rechtsgeschäft (1913); Zur Lehre vom Gesetz im formellen und materiellen Sinn (1913); Reichsgesetz und Landesgesetz nach der österreichischen Verfassung (1914); Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts (1920); Sozialismus und Staat (1920, erweiterte Auflage 1923); Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (1923); Allgemeine Staatslehre (1925); Justiz und Verwaltung (1929); Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit (1929); Der Staat als Integration (1930); Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht (1932); Staatsform und Weltanschauung (1933); Reine Rechtslehre (1934, geänderte und erweiterte Auflage 1960); Society and Nature (1943); General Theory of Law and State (1945); Principles of International Law (1952); Allgemeine Theorie der Normen (1979). Kelsen ist durch den Neukantianismus und den Wertrelativismus beeinflußt. Allerdings variiert die Stärke der Präsenz neukantianischer Elemente in den verschiedenen Phasen der reinen Rechtslehre. Stellt der Gesetzspositivisums auf das Bestehen von Gesetzen als empirischer Tatsachen ab, so folgt ihm Kelsen insofern als er auch für Rechtsnormen die Objektivität garantiert sehen will, die wir auch im Fall einer wissenschaftlichen Untersuchung haben, die ihre Erkenntnisse auf empirische Tatsachen stützt. Auch die Kriterien mit denen die Rechtswissenschaft ihre Aussagen trifft, sollen empirisch-objektiv-positivistisch sein. Jedoch unterscheidet sich Kelsen an einem wichtigen Punkt von der bisherigen rechtspositivistischen Tradition, indem er den Dualismus zwischen Sein und Sollen ganz besonders in den Vordergrund stellt. Tatsächlich geht er von einer unüberbrückbaren und fundamentalen Dualität oder Trennung zwischen dem Bereich des Seins, der Tatsachen sowie der Tatsachenurteile, und dem Bereich des Sollens aus. Die Normen selbst sind keine empirischen Tatsachen, sondern gehören dem Bereich des Sollens an. Ihre "spezifische" Existenzweise ist nach Kelsen ihre Geltung. Durch die Beobachtung empirischer Tatsachen, etwa der Sitzung eines Parlaments und durch die Hinzunahme bestimmter Normen, etwa der Normen der Verfassung und der Geschäftsordnung dieses Parlaments können wir die Erkenntnis gewinnen, dass eine bestimmt Norm gilt. Aber wir können zu einer solchen Konklusion über die Geltung einer Norm niemals durch die bloße Beobachtung von Tatsachen gelangen. Diese Unterscheidung zwischen Sein und Sollen ist nach Kelsen unserem Bewußtsein unmittelbar vorgegeben. Sie ist nicht weiter analysierbar oder erklärbar. (An diesem Punkt greift er auf Simmels "Einleitung in die Moralwissenschaft" zurück.) 6 Kelsen steht mit dieser Überzeugung auf einer Linie des Denkens, die (außer dem ebenfalls neukantianisch geprägten Simmel) weitere, etwa David Hume, Immanuel Kant und George H. Moore miteinander verbindet. Diese Philosophen haben einen ähnlichen Gedanken ausgedrückt, auch wenn die philosophische Interpretation ihrer Position zu diesem Thema – vor allem im Fall Humes – nicht unwesentlich schwankt. Andererseits sollte man betonen, dass diese philosophischen Ansichten sich auf das moralische und nicht auf das rechtliche Sollen beziehen.1 (Auf das Verhältnis zwischen dem moralischen und dem rechtlichen Sollen auch unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidung zwischen Sein und Sollen geht Kelsen in den "Hauptproblemen der Staatsrechtslehre" ein. ) Beim Dualismus zwischen Sein und Sollen handelt es sich auch bei Kelsen vor allem um einen erkenntnistheoretischen Dualismus, nämlich in dem Sinne, daß allein aus Erkenntnissen über den Bereich des Seins keine Erkenntnisse über den Bereich des Sollens, nämlich über die Frage, ob 1 Hume schreibt beispielsweise an einer Stelle, sinngemäß, daß ihm bei der Lektüre moralphilosophischer Arbeiten aufgefallen sei, dass der jeweilige Autor nach einer Reihe von Beobachtungen und Aussagen über Tatsachen plötzlich einen Sprung macht und anfängt über das zu reden, was der Fall sein soll. Hier liegt aber ein Problem, meint Hume. Es ist nicht eindeutig, ob Hume hier tatsächlich auf dem Standpunkt steht, ein solcher Übergang "vom Sein zu Sollen" sei unmöglich (was eher der traditionellen Interpretation seines Denkens entspricht) oder ob er auf dem Standpunkt steht, dass ein solcher Übergang zwar möglich sei, aber in den bisherigen Ansätzen fehlerhaft vollzogen. Bei I. Kant korreliert diese Trennung mit seiner Lehre von dem guten Willen, der rein von empirischen Bestimmungen sei und nur von dem kategorischen Imperativ geleitet wird. Die Trennung zwischen Sein und Sollen scheint aber auch allgemein eine Voraussetzung seines Denkens zu sein, wie seine Unterscheidung zwischen den philosophischen Fragen "was kann ich wissen" und "was soll ich tun" (in der Jäsche - Logik um 1800) verrät. Auch bei Kant stößt jedoch die Interpretation seiner Trennung von Sein und Sollen auf gewisse Schwierigkeiten, die mit seiner Lehre vom moralischen Gesetz als "Faktum der Vernunft" verbunden sind. George H. Moore vertrat in seinem "Principia Ethica" (1903) die Auffassung, dass das Prädikat "gut" unanalysierbar sei. Jeder Versuch, dieses Prädikat anhand weiterer Prädikate zu analysieren, und damit auch zu definieren, sei gegenüber dem Einwand nicht gefeit, man können immer noch sinnvoll die Frage aufwerfen, ob diese(r) definierende Zustand, Relation oder Eigenschaft wirklich gut sei (sog. "Argument der offenen Frage"). Insbesondere ist die Gleichsetzung der der Bedeutung von "gut" mit der Bedeutung irgendwelcher empirischer Prädikate ganz verfehlt (sog. "naturalistischer Fehlschluß"). "Gut" ist ein Prädikat, dessen Bedeutung wir allein anhand einer besonderen Fähigkeit erfassen können (Lehre von dem "moralischen Intuitionismus"). Diese Argumentation Moores in den ersten Kapiteln der "Principia Ethica", das eher ein Werk des Übergangs in seinem Denken darstellt, ist in ihren Details nicht einfach zu rekonstruieren. Jedoch bezieht sich Kelsen in der zweiten Auflage der Reinen Rechtslehre (1960) zugunsten des Dualismus zwischen Sein und Sollen explizit auch auf diese Lehre. 7 eine Norm gilt oder nicht, gewonnen werden können.2 2 In einem strenger logischen Sinne ist dieser Dualismus nicht völlig gesichert; er teilt jedenfalls nicht die Evidenz, die etwa das logische Gesetz der Identität, "jedes Objekt ist mit sich identisch" charakterisiert. Es gibt nämlich einige auf den Philosophen A. N. Prior zurückgehende Paradoxien, die diesen Dualismus problematisieren, und jedenfalls zeigen, dass die Trennung zwischen Sein und Sollen aus rein logischer Sicht nicht so evident ist, wenn wir den üblichen Folgerungsbegriff der modernen Logik zugrundelegen. Nach diesem Folgerungsbegriff folgt ein Satz q aus einer Menge von Prämissen M genau dann, wenn in dem Fall, dass alle Sätze aus M wahr sind, auch q wahr ist. Die Paradoxien von A. N. Prior lauten nun: Haben wir eine Tatsachenaussage wie "es regnet", dann können wir auf den Satz "es regnet oder du sollst nicht lügen" schließen. Genauso gut können wir natürlich aus dem Satz "es regnet" auf den Satz "es regnet oder du sollst lügen" schließen. Wir können aus diesem Satz, "es regnet", auch schließen auf: "Es regnet oder es schneit". Denn aus jedem Satz können wir auf die Disjunktion dieses Satzes mit jedem beliebigen Satz schließen, da die Disjunktion niemals falsch wird, wenn das eine Disjunktionsglied, (nämlich in diesem Fall das deskriptive, die "Tatsachenaussage") wahr ist. Nun ist klar, daß ein Satz wie "es regnet oder du sollst nicht lügen" einen deskriptiven Teilsatz, nämlich "es regnet" und einen normativen Teilsatz hat, nämlich "du sollst nicht lügen", Wie sollen wir einen solchen komplexen Satz klassifizieren? Klassifizieren wir ihn als normativ, also als einen "Sollsatz", dann haben wir ein glattes Beispiel für einen Übergang vom Sein zum Sollen. Klassifizieren wir solche Sätze, die Disjunktionen zwischen deskriptiven und normativen Sätzen sind, als deskriptiv, dann haben wir das Problem, dass wir dann aus einer (wie gerade festgelegt) deskriptiven Disjunktion "p oder du sollst nicht lügen" und aus einem zusätzlichen deskriptiven Satz "nicht p" auf "du sollst nicht lügen" schließen können. (Wobei p ein beliebiger deskriptiver Satz ist.) Wieder ein glatter Übergang von Sein zum Sollen. Klassifizieren wir ihn schließlich als "gemischt", dann wird die Evidenz, dass ein solcher Übergang von Sein zu Sollen logisch nicht möglich sei, doch erschüttert: Denn wir haben weiter oben gesehen, dass ein Übergang von einem rein deskriptiven Satz ("es regnet") zu einem nach jetziger Festlegung "gemischten" ("es regnet oder du sollst nicht lügen") möglich ist. Wir haben danach gesehen, dass auch ein Übergang von einem "gemischten" Satz mit Hilfe eines deskriptiven Satzes zu einem rein normativen Satz möglich ist (aus "p oder du sollst nicht lügen" und "nicht p" zu "du sollst nicht lügen"). Warum wäre dann ein Übergang von Sein zu Sollen mittels solcher gemischter Sätze nicht möglich? Wir haben ein Problem und das Problem ist, dass aus rein logischer Sicht, unter Zugrundelegung des Folgerungsbegriffs der klassischen Logik, wir doch keine klaren Evidenzen darüber haben, oder anhand eines Beweises entwickeln können, dass in allen denkbaren Situationen ein solcher Übergang völlig ausgeschlossen ist. Das wäre aber eine notwendige Bedingung, um die Trennung zwischen Sein und Sollen als rein "logische Trennung" aufzufassen. Es gibt verschiedene Ansätze, mit den Bespielen Priors umzugehen; zu diesen gehören auch solche, die den logischen Folgerungsbegriff durch zusätzliche Kriterien modifizieren. Man kann aber den Dualismus zwischen Sein und Sollen auch als nicht logische, sondern erkenntnistheoretische oder ontologische Frage ansehen. Die erkenntnistheoretische Deutung entspricht auch der neukantianischen Position Kelsens. 8 Betrachten wir die Auswirkungen dieser tragenden Unterscheidung zwischen Sein und Sollen auf seine Konzeption des Rechts und der Rechtswissenschaft. Denn es geht in der Reinen Rechtslehre vor allem um eine Konzeption der Rechtswissenschaft, um ein aus der Sicht Kelsens konsequentes Durchdenken oder zu Ende Denken der Art, wie die Rechtswissenschaft arbeitet. Ist sie eine Naturwissenschaft, eine Gesellschaftswissenschaft oder etwas Drittes? Betrachtet man die Phänomene, mit denen sich die Rechtswissenschaft beschäftigt, so könnte man den Eindruck gewinnen, das sie sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft verankert sind. Was sind die Gegenstände der Rechtswissenschaft und welche Besonderheiten haben sie? Die Gegenstände der Rechtswissenschaft sind nach Kelsen vorwiegend Akte. Bei Akten kann man nach Kelsen zwei Aspekte unterscheiden: Einen im Raum und Zeit vor sich gehenden Akt oder äußeren Tatbestand und die Bedeutung dieses Aktes; und zwar die Bedeutung, die das Recht, die Rechtswissenschaft, diesem Akt beimißt. Der äußere Tatbestand ist an sich ein naturgesetzlich bestimmter Vorgang. Als solcher ist er nicht Gegenstand der Rechtswissenschaft. Was diese Vorgänge zu Vorgängen der Rechtswissenschaft macht, ist ihr spezifisch juristischer Sinn. Was ist dieser spezifisch juristische Sinn? Wie kommt aber die Zuschreibung eines "juristischen Sinns" von Akten zustande? Und wo stehen in diesem Modell die Rechtsnormen? Kelsen bringt u. a. das Beispiel einer Person, die auf ein Blatt Papier schreibt, "das ist mein Testament, und im Falle meines Todes soll mit meinem Vermögen geschehen, dass ...". Das Hinschreiben dieser Worte ist ein naturgesetzlich bestimmter Vorgang. Mit diesem Vorgang verbindet diese Person einen subjektiven Sinn. Sie will bestimmen, was im Falle ihres Todes mit ihrem Vermögen geschehen soll. Diesem Vorgang schreibt seinerseits das Recht einen Sinn zu. Es kann daraus ein rechtsgültiges Testament machen. In diesem Fall erklärt das Recht den subjektiv, durch diese Person, gemeinten zum juristischen relevant oder zum "objektiven" Sinn dieses Aktes. Das Recht kann aber auch diesen subjektiv gemeinten Sinn für rechtlich unerheblich erklären, wenn etwa ein Formfehler vorgekommen ist. Das Recht erklärt dann, diese Verfügung für unwirksam. Die Deutung der Akte erfolgt durch Rechtsnormen. Die Rechtsnormen schreiben bestimmten naturgesesetzlichen Vorgängen, nämlich solchen, die Tatbestand eines Aktes sind, einen Sinn zu. In einigen Fällen erfolgt dies dadurch, dass Rechtsnormen den subjektiv gemeinten Sinn des Aktes auch für dessen objektiven Sinn erklären. In manchen Fällen kann es aber auch vorkommen, dass der Sinn, den das Recht einem Akt zuschreibt, wenig mit dem subjektiven Sinn gemeinsam hat, der damit durch die handelnde Person verbunden wird. 9 Die Rechtsnormen sind also in dieser Konzeption Deutungsschemata für Akte. Zugleich sind sie aber, und das macht den Kern dieser Konzeption aus, selbst der Sinn von Akten, nämlich von Akten der Gesetzgebung, oder auch, wie wir gleich sehen werden, der Verwaltung oder der Justiz. Der juristisch relevante Sinn von Handlungen in einem Sitzungsraum des Parlaments wird ihnen durch die Verfassung und die Geschäftsordnung zugeschrieben. Die Empirie, nämlich die empirische Erkenntnis und Erfahrung des Tatbestandes dieser Akte ist eine notwendige Voraussetzung der Zuschreibung eines juristisch relevanten Sinnes durch Rechtsnormen. Die Rechtsnormen funktionieren nur dann als Deutungschemata für Akte, die zu der Zuschreibung eines objektiven Sinnes führen, wenn sie die Bedingung für diese Zuschreibung an empirisch überprüfbare Elemente knüpfen. Damit entsteht eine Hierarchie von Akten, die durch weitere Akte, nämlich durch Normen einen juristisch relevanten, objektiven Sinn bekommen. Normen sind selbst Akte, denen durch weitere Normen ein juristisch relevanter oder "objektiver" Sinn zugeschrieben wurde. Damit gelangen wir zu der Verfassung, die den Akten der Gesetzgebung einen objektiven Sinn verleiht. Um auch die Verfassung in diese Konzeption einzubinden und sie als gedeuteten objektiven Sinn der Akte der verfassungsgebenden Personen darzustellen, führt Kelsen eine weitere Norm ein, die Grundnorm. Die Grundnorm ist keine positiv gesetzte, sondern eine von der Rechtswissenschaft oder vom juristischen Denken vorausgesetzte Norm, die die Deutung von Akten als juristisch relevant überhaupt, ermöglicht. Im Anschluß an Kant bezeichnet Kelsen die Grundnorm als eine "transzendental-logische Bedingung", also als eine Bedingung der Möglichkeit rechtswissenschaftlichen Denkens. (Kant hatte als Bedingungen für die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt aus seiner Sicht von der Erfahrung unabhängige Anschauungen des Raumes und der Zeit und Verstandesbegriffe angesehen.) Dieses kantische Element, nämlich die Charakterisierung der Grundnorm als "transzendental" wird in der späteren Entwicklung der Reinen Rechtslehre etwas abgeschwächt. Manchmal bezeichnet er die Grundnorm als hypothetisch oder als reine Fiktion. Betrachten wir nun einige Konsequenzen aus dieser grundlegenden Konzeption. Aber vorher können wir die Frage zu beantworten versuchen, wie auf dem Boden der reinen Rechtslehre eine Antwort auf Kirchmanns Kritik möglich ist. Aus der Sicht der Reinen Rechtslehre wären die Erkenntnisse der Rechtswissenschaft nicht bloße 10 Erkenntnisse von bestimmten Normen, die heute gelten und morgen nicht. Die Erkenntnisse der Rechtswissenschaft sind eher Zusammenhänge der Gestalt "wenn die Norm N gilt und wenn die Fakten a, b, c vorliegen, dann gilt auch die Norm H, die der objektive Sinn der Handlung h ist" , d.h. eine Handlung h wird durch die Norm N bei Vorliegen der Eigenschaften a, b, c ein juristisch relevanter Sinn zugeschrieben, der sie zu einer Norm H macht. Solche Konditionalaussagen werden nicht durch drei berichtigende Worte des Gesetzesgebers korrigiert oder falsifiziert. Nachdem wir jetzt den Kern der Theorie dargestellt haben, betrachten wir einige weitere allgemeine Aspekte der Konzeption Kelsens. Kelsen versuchte, die Rechtsphilosophie auf eine von ethischen, psychologischen, soziologischen, politischen und ökonomischen Einflüssen gesäuberte rechtstheoretische Beschreibung des Rechtssystems zu reduzieren. Das Rechtssystem ist nach seiner Auffassung ein hierarchisches System von Zwangsnormen mit einer bloß gedachten, geltungsverleihenden „Grundnorm“ an der Spitze. Hans Kelsens Grundthese in der „Reinen Rechtslehre“ lautet: Die Rechtslehre bzw. Rechtstheorie soll „rein“ sein! “Rein” ist eine Theorie des Rechts, die sich nur auf den Gegenstand “Recht” konzentrieren soll, ohne mit Psychologie, Soziologie, politischer Theorie oder Ethik vermengt zu sein. Die Vermeidung eines sog. “Methodensynkretismus” ist also oberstes Gebot. Die Reine Rechtslehre will „die Rechtswissenschaft von allen ihren fremden Elementen befreien.” Sie ist eine Theorie des positiven Rechts (S. 1). Kelsen wendet sich gegen jede Theorie der Gerechtigkeit mit wissenschaftlichem Anspruch. Die Rechtsethik ist für ihn bloße Politik. Das bedeutet: Die Rechtsphilosophie kann nur aus einer Rechtstheorie bestehen, nicht aber aus einer Rechtsethik. Diese skeptische Auffassung gegenüber der Ethik entspricht der Grundhaltung des logischen Positivismus bzw. logischen Empirismus der damaligen Zeit (Ayer, Schlick, Wittgenstein) zur Ethik. Danach kann die Ethik nur die tatsächliche Moral beschreiben oder die Ethiksprache analysieren, also nur„Metaethik“ sein, aber keine normativ gehaltvolle Theorie aufstellen. Der Kern der Kelsenschen Rechtstheorie ist die Lehre vom Stufenbau des Rechts. Obwohl diese Lehre schon vorher vertreten wurde, hat Kelsen sie ausgebaut, verfeinert und populär gemacht. Das Recht ist danach als Stufenbau von Rechtsnormen zu denken, als ein System. Der Stufenbau der Rechtsordnung führt zu einer Hierarchie von Rechtssetzern: Verfassungsgeber Gesetzgeber Verordnungsgeber 11 Behörde und Gericht Die Theorie des Stufenbaus der Rechtsordnung hat zusammen mit dem Postulat der Reinheit einige Folgen, die von traditionellen Lehren der Rechtswissenschaft abweichen. Die Unterscheidung und Trennung der Staatsfunktionen wird bloß zu einer quantitativen Angelegenheit erklärt. Jeder Akt ist zugleich Vollziehung und Rechtssetzung. (Ausnahme sind nur die Grundnorm und der ultimative Akt der Rechtsvollstreckung). Der traditionelle Begriff des Staates wird aufgelöst. Der Staat ist eine juristische Person, nämlich ein durch Normen geschaffenes Zurechnungssubjekt für Akte, das als Zurechnungssubjekt der gesamten Rechtsordnung erklärt wird. Die Interpretation des Rechts ist außerhalb der Bindung an die höherrangige Norm Rechtssetzung. Wegen der „Reinheit“ seiner Theorie kann Kelsen den Stufenbau aber nur beschreiben, jedoch nicht erklären, etwa durch Verweis auf externe historische, politische, ökonomische oder soziale Einflüsse. Er kann den Stufenbau auch nicht rechtfertigen. Dazu müßte er sich auf eine Rechtsethik beziehen. Kelsen unterscheidet weiterhin zwischen dynamischen und statischen Systemen. Das Recht ist seiner Meinung nach ein dynamisches System, kein statisches: -statisches System: Norm gilt kraft inhaltlicher Rückführung auf höhere Norm. Sie kann in ihrem Inhalt aus der höheren Norm abgeleitet werden. -dynamisches System: Norm gilt unabhängig von ihrem Inhalt kraft ihrer formalen Ermächtigung durch höherrangige Norm, z. B. Ermächtigung zum Erlaß einer Verordnung durch Gesetz, Ermächtigung zum Erlaß eines Verwaltungsaktes durch Verordnung usw. Der Charakter der Dynamik erleichtert die ständige Veränderung des Rechts, da nicht jede inhaltliche Modifikation auf einer Ebene sofort auf allen Ebenen zu inhaltlichen Veränderungen führen muß. Aber: Moderne Rechtssysteme schreiben vielfach auch eine inhaltliche Verbindung der Normen verschiedener Hierarchiestufen vor: Man denke z. B. an Art. 80 I S. 1+2 GG: “Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden.” Eine ähnliche inhaltliche Bindung ergibt sich auch aus dem Prinzip der Verfassungsmäßigkeit nichtverfassungsmäßigen Rechts (Art. 20 III GG: “Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 12 gebunden.”) Sie ergibt sich weiterhin aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte. Nur eine inhaltliche Hierarchie kann überdies die Funktionen der Demokratie, der sachangemessenen Abstraktheit und Konkretheit sowie der Rationalisierung der Entscheidung durch Rückgriff auf höhere oder niedere Ebenen erleichtern. Kelsens Kennzeichnung des Rechts als ausschließlich oder auch nur vorherrschend dynamische Stufenordnung ist also zumindest für eine Rechtsordnung wie die deutsche problematisch. Die Stufenordnung des modernen Rechts ist vielmehr wohl eher eine Verschränkung von formalen und inhaltlichen Hierarchieelementen. Nach Kelsen vermittelt die übergeordnete Rechtsnorm Geltung. Man erhält auf diese Weise eine Geltungspyramide mit der Verfassung an der Spitze. Aber: Was vermittelt der Verfassung ihre Geltung? Kelsens Antwort: eine oberste bloß gedachte Grundnorm. Diese lautet: “Man soll sich so verhalten, wie es die Verfassung vorschreibt!” “Alle Normen, deren Geltung auf eine und dieselbe Grundnorm zurückgeführt werden kann, bilden ein System von Normen, eine normative Ordnung. Die Grundnorm ist die gemeinsame Quelle für die Geltung aller zu einer und derselben Ordnung gehörigen Normen, ihr gemeinsamer Geltungsgrund. Daß eine bestimmte Norm zu einer bestimmten Ordnung gehört, beruht darauf, daß ihr letzter Geltungsgrund die Grundnorm dieser Ordnung ist. Diese Grundnorm ist es, die die Einheit einer Vielheit von Normen konstituiert, indem sie den Grund für die Geltung aller zu dieser Ordnung gehörigen Normen darstellt.” (S. 197). “Sofern nur durch die Voraussetzung der Grundnorm ermöglicht wird, den subjektiven Sinn des verfassungsgebenden Tatbestandes und der der Verfassung gemäß gesetzten Tatbestände als deren objektiven Sinn, das heißt: als objektiv gültige Rechtsnorm zu deuten, kann die Grundnorm in ihrer Darstellung durch die Rechtswissenschaft als die transzendental-logische Bedingung dieser Deutung bezeichnet werden.” (S. 204f.) Aber: wie kann eine bloß gedachte Bedingung, ein subjektives Wollen in objektives Sollen verwandeln und oberster Geltungsgrund sein? Kelsens Rechtstheorie versucht das Rechtssystem gegen alle externen Gesichtspunkte, seien sie sozialer oder ethischer Natur abzuschotten. Dazu benutzt er den Begriff der objektiven Geltung. Das bedeutet: Die objektive Geltung stellt quasi das allumfassende Verbindungselement zwischen den einzelnen Rechtsnormen dar. Nur mit Hilfe der objektiven Geltung kommt der Stufenbau zustande. Neben der These des Stufenbaus ist demnach eine Norm- und Geltungstheorie das Herzstück der Kelsenschen Rechtstheorie. Kelsen stellt die Frage, wie kann eine Rechtsnorm als 13 subjektiver Rechtssetzungsakt „objektiv“ sein. Seine Antwort lautet: der subjektive Willensakt kann nur durch eine übergeordnete Norm als Deutungsschema objektiv sein. Dies ist das Herzstück von Kelsens Norm- und Geltungstheorie. Dazu kommen drei weitere Elemente. Die Normund Geltungstheorie umfaßt also folgende vier Elemente: (1) Die übergeordnete Rechtsnorm ist ein erkenntnistheoretisches Deutungsschema, das ein subjektives Sollen/Wollen als bloße Tatsache, als bloßes Sein in ein objektives Sollen, eine objektive Norm verwandelt (vgl. den Sein-Sollen-Dualismus!): Aber: - Warum soll eine solche Deutung nicht auch durch andere Sozialnormen als durch Rechtsnormen erfolgen, etwa durch sprachliche Normen? - Was heißt objektiv? Nur Intersubjektivität ist möglich! (2) Die Geltung ermöglicht die Inkorporation einzelner Willensakte in das Rechtssystem, das heißt deren Auszeichnung als Rechtsnormen und damit als Teil des Rechtssystems. Aber: Inkorporation muß nicht durch höherrangige Normen erfolgen: neben Art.76ff. GG spielen z. B. beim Gesetzeserlaß das Bundeswahlgesetz und die Geschäftsordnung des Bundestages ebenfalls entscheidende Rolle. Auch eine Inkorporation durch Selbstdeutung ist möglich, z. B. im Falle einer Revolution. (3) Die Geltung bewirkt die rechtsinterne Rechtfertigung niederrangiger Rechtsnormen durch höherrangige Rechtsnormen. Aber: Rechtsinterne Rechtfertigung verleiht keine Objektivität und über die reine Positivität des Rechts hinausgehende rechtsethische Rechtfertigung. (4) Die Geltung bewirkt schließlich die Konfliktlösung zwischen konkurrierenden Rechtsnormen, also die Kollisionsvermeidung. Dieser Geltungsbegriff ist plausibel. Das heißt: Der Geltungsbegriff dient der Kollisionslösung. Dazu ist die Bildung einer übergeordneten Kollisionsregel zweckmäßig, aber kein weiterer Regreß erforderlich, da jede Norm für sich selbst die Geltung behauptet.