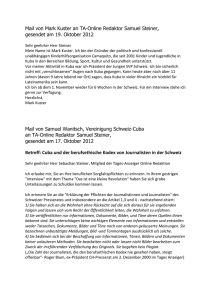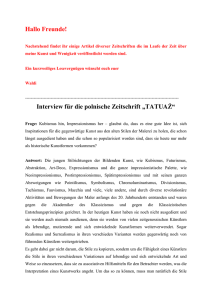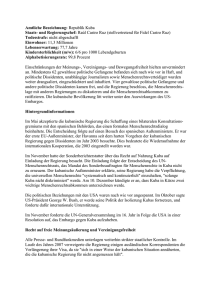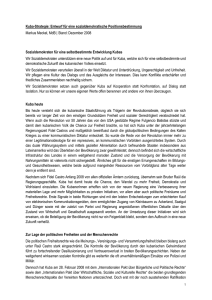SWR2 Musikstunde
Werbung

___________________________________________________________________________ 2 SWR2 Musikstunde, Dienstag, 02. Oktober 2012, 09.05 – 10.00 Uhr Zeitreisen – zur Musik im literarischen Werk von Alejo Carpentier Teil 2: Die verlorenen Spuren Anders als dem namenlosen Helden seines Kurzromans „Finale auf Kuba“ ist Alejo Carpentier die Flucht vor den Schergen General Machado geglückt. Mit falschen Ausweispapieren erreicht er Paris, in den 1920er Jahren das musikalische Herz der Moderne, damals bevorzugter Fluchtpunkt der Emigranten aus Ost und West, der europäische Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen aus der Alten und der Neuen Welt. Aber wenn wir noch einen Augenblick bei Carpentiers literarischem „Finale auf Kuba“ verweilen, dann wird deutlich, dass Carpentier in diesem Kurzroman alle – mithin auch autobiographisch geprägte Handlung um einen Schlüsselbegriff herum organisiert hat. Und dieser Schlüsselbegriff heißt: Zeit. Besser noch: Echtzeit. Musik und Zeit – von nichts anderem handelt der Roman. Wir erinnern uns: Der namenlose Flüchtling hatte sich vor seinen Verfolgern in einen Konzertsaal gerettet. Dort wird gerade die Eroica gespielt. Die dauert so um die 46 Minuten. Also hat der Verfolgte, auf den draußen die Männer warten, die ihn exekutieren werden, noch eine gute Dreiviertelstunde zu leben. Musik spielt immer in Echtzeit. Und verbraucht auf der Seite des Hörers und des Musikers immer „echte Lebenszeit“. Deutlicher und dramatischer könnte man diese Tatsache kaum literarisch darstellen. Das ist das eine. Zugleich aber transzendiert das Musikhören die reale Echtzeit. Und in Gedanken – während auf der Bühne die Eroica spielt – erlebt der Verfolgte noch einmal die Umstände seiner Flucht, die kurze Geschichte seines Lebens als ein radikales Spiel mit dem Tod, den das Finale der Eroica nun unweigerlich bringen wird. Soviel vorab zu der musikalischen Zeitreise, die Carpentier in seinem „Finale auf Kuba“ unternimmt. Und damit „Willkommen zur Musikstunde“. Heitor Villa-Lobos Mazurka-Chôro. Un peu lent aus: Suite populaire brésilienne Frank Bungarten (Gitarre) Frank Burgarten spielte diese brasilianische Mazurka von Heitor Villa-Lobos. Mit dem Brasilianer, der sich in den Pariser Salons als „Der musikalische Wilde aus dem Regenwald“ stilisierte, hatte Carpentier in Paris gleich Freundschaft geschlossen. Für Carpentier war seine Musik das beste Beispiel dafür, wie sich die europäische Musiktradition im Spiegel der 3 lateinamerikanischen Kultur neu und anders erfinden konnte. Carpentiers ästhetisches Konzept des Afrocubanismo mit seinem topographischen Schwerpunkt auf der Zuckerinsel wich allmählich einer Betrachtung, die den ganzen lateinamerikanischen Kontinent ins Auge fasste. Gewiss, für ihn war die Karibik immer noch das Mittelmeer der Neuen Welt. Aber vom Pariser Exil aus gesehen, waren Kuba und die Antillen „nur“ kleine Inseln. Die Musik Heitor Villa-Lobos – das hatte Carpentier sofort erkannt – stand für diese selbstbewusste Lateinamerikanität, in der die Grenzen zwischen den Inseln und Staaten der Neuen Welt aufgehoben waren. Natürlich trifft Capentier in Paris auch seinen Kollegen Robert Desnos, mit dessen Ausweispapieren ihm die Flucht aus Kuba gelungen war. Nächtelang sitzen die beiden zusammen und legen die brandneuen amerikanischen Platten von Vaughn De Leath, dem „Original Radio Girl“, oder von Sophie Tucker auf. What´ll you do Sophie Tucker Eine Grammophon-Aufnahme, wie sie Carpentier und Desnos in ihren langen Nächten bei Whiskey und Zigarren aufzulegen pflegten: Sophie Tucker war das, damals die „First Lady of Show-Business“. Für einen anderen engen Freund von Carpentier waren diese populären Songs aus Grammophon und Radio – ob nun französisch oder amerikanisch – nichts weiter als widerlicher Müll. „Bidetwassermusik“ – so nannte Edgard Varèse diese Spielarten der Unterhaltungsmusik. Ihre Geschwätzigkeit ging ihm ungeheuer auf die Nerven. Aber Varèse – das berichtet Carpentier – hatte eine Schwäche für die Komponisten Lateinamerikas. Insbesondere für den Kubaner Amadeo Roldàn, für den Carpentier ein Libretto geschrieben hatte. Außerdem hatte sich Varèse auch mit Heitor Villa-Lobos angefreundet. Carpentier, Zeuge dieser Freundschaften, bezweifelte allerdings stets, dass Varèse diese folkloristisch inspirierte Musik auch tatsächlich „liebte“. Was ihn zu faszinieren schien, das waren die enormen perkussiven Ressourcen dieser Musik. Ihr Arsenal aus Claves, Maracas, Guiros, Bongos und Kongas. Carpentier berichtet von der Probe eines Streichquartetts in der Wohnung von Villa-Lobos, bei der Varèse und er anwesend waren. „Spielen Sie so viele falsche Noten, wie Sie wollen“, sagte Villa-Lobos zu den Musikern, „aber beachten Sie den Rhythmus genau. Er ist das ganze Werk.“ „Er hat Recht“, bemerkte Varèse wenig später zu Carpentier, „nur ist es unzureichend, einfach von Rhythmus zu reden. Der Rhythmus ist ja bloß eine Schlagkonstante. Dazu muss etwas anderes kommen: Die Perkussion muss 4 sprechen, sie muss ihre eigenen Pulsationen erlangen. Sie muss ihre Kraft dem ganzen Orchester einhauchen.“ Edgard Varèse Ionisation. Für 13 Schlagzeuger Mitglieder des New York Philharmonic Orchestra Leitung: Pierre Boulez „Ionisation“ für 13 Schlagzeuger von Edgard Varèse. Es spielten Mitglieder des New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Pierre Boulez. In diesem Schlagzeug-Stück tauchen zum ersten Mal in der europäischen Musik, neben zwei Sirenen, auch afrokubanische und afrobrasilianische Schlaginstrumente auf, darunter Maraca-Rasseln, Bongos, Guiros und Claves. Als Varèse, Villa-Lobos und Carpentier in Paris zusammentreffen, hatte Varèses Musik auf der anderen Seite des Atlantiks bereits für einigen Skandal gesorgt. In Paris war das Publikum an derlei Skandale gewohnt und einigermaßen abgebrüht. Außerdem wollte sich niemand noch einmal so blamieren wie einst bei Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. Die Pariser, so fasst dies Carpentier zusammen, applaudierten verhalten, weil Varèses Musik so hübsch dissonant war. Aber dass in seiner Musik Begriffe wie Konsonanz oder Dissonanz überhaupt keine Rolle spielten, das verstand das Publikum in Paris nicht. Kurz vor seiner Abreise aus New York, hatte Varèse zusammen mit Henry Cowell, mit dem mexikanischen Komponisten Carlos Chavez und mit der finanziellen Unterstützung von Charles Ives die Pan American Association of Composers ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Förderung der Komponisten Nord-, Mittel- und Südamerikas durch Aufführungen ihrer Werke. 1932 veranstaltet die Pan-Amerikanische-Vereinigung Konzerte in Paris und Berlin. Auf dem Programm auch Arcana für großes Orchester von Varèse. In Paris wurde die Aufführung enthusiastisch gefeiert. In Berlin schrieb die Kritik: „Zum Schluss gab es eine end- und sinnlose Klangferkelei von Edgard Varèse. Ein Tönescheusal, das ohne geistige Disziplin und künstlerische Vorstellung die Hörer mit Skorpionenpeitschen traktiert und friedsame Konzertbesucher zu Hyänen werden lässt.“ Jetzt hatte auch die Alte Welt ihren VarèseSkandal. Edgard Varèse Ausschnitt aus: „Arcana“ für großes Orchester New York Philharmonic Orchestra Leitung: Pierre Boulez 5 Ein Ausschnitt aus „Arcana“ von Edgard Varèse mit dem New York Philharmonic Orchestra. 1933, nach dem Sturz des verhassten Diktators Machado, den er auch von Paris aus bekämpft hatte, hätte Carpentier eigentlich ohne weiteres in seine kubanische Heimat zurückkehren können. Schon drei Jahre zuvor war sein Freund Villa-Lobos nach Brasilien zurückgereist. Allerdings unter anderen Vorzeichen. In Brasilien, wo sich Getúlio Vargas, Gouverneur des südlichen Bundesstaates Rio Grande und Ex-Militär, an die Macht geputscht hatte, war VillaLobos zum brasilianischen Nationalkomponisten, zum offiziellen Musik-Repräsentanten des Vargas-Regimes avanciert. Er machte Karriere im Schatten der Macht und ließ sich bereitwillig zu Propagandazwecken einspannen. Carpentier schiffte sich erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Le Havre ein. Aus „Heimweh nach Havanna“, wie er später bekannte. Aber auch in Kuba war die politische Situation unter den Kommunisten und Präsident Batista alles andere als stabil. Als sich für Carpentier die Möglichkeit ergab, in der Rundfunkabteilung der venezolanischen Werbeagentur Ars zu arbeiten, ließ er sich in Caracas nieder. Hier begann er wieder ernsthaft zu schreiben; hier sollte er an der Hochschule bis 1957 Kulturgeschichte unterrichten; hier verfasste er eine Monographie über die Musik Kubas. Und von hier aus unternahm er jene abenteuerlichen Reisen in die Region der Großen Savanne, zum oberen Lauf des Orinoco und ins Amazonasbecken, die er in seinem Roman „Die verlorenen Spuren“ literarisch verarbeiten sollte. Carlos Chavez Ausschnitt aus: Sinfonia indiana The New World Symphony Leitung: Michael Tilson Thomas Ein Ausschnitt aus der Sinfonia indiana von Carlos Chavez. Carpentiers Roman „Die verlorenen Spuren“, der auf die Erfahrungen seiner von Caracas aus durchgeführten Reisen zum Orinoco zurückgreift, führt seinen Helden, einen namenlosen spanischen Musikforscher und gescheiterten Komponisten, auf eine Zeitreise zum Ursprung der Musik. Er hat eine schauspielernde Ehefrau, die Abend für Abend im selben Stück auf der Bühne steht, eine kapriziöse Geliebte, muss sich – ähnlich wie Carpentier – mit der Produktion von SoundTracks für Werbefilme beschäftigen und lebt also in einer Welt betriebsamer Nichtigkeiten, sagen wir: in New York. Seit mindestens drei Jahren war er in keinem Sinfoniekonzert mehr – das bürgerliche Konzertwesen ödet ihn an. Als es ihn eines Tages während eines Wolkenbruchs zufällig in ein Konzert verschlägt, in dem, ohne dass er zuvor davon weiß, 6 Beethovens Neunte gespielt wird, verlässt er fluchtartig den Konzertsaal. „Wenn ich schon manche Musik nicht ertragen kann, weil sie mich zu sehr an Kinderkrankheiten erinnert, so noch weniger das „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium“, dem ich immer ausgewichen war wie jemand, der jahrelang bestimmte Gegenstände nicht anblickt, weil sie ihn an einen Toten erinnern.“ Die Emphase dieser Musik ist ihm unerträglich. Er flieht. Zufällig begegnet er seinem alten Lehrer, dem Kurator einer musikethnologischen Sammlung von exotischen Instrumenten und Tondokumenten, der ihm unbedingt eine bestimmte Aufnahme vorspielen will. Es ist eine Schallplatte ohne Etikett, nur halb berillt, die der Kurator vorsichtig auf ein Grammophon legt. Und dann beginnt auch schon ein Vogel zu zwitschern. Verwundert sieht er den alten Mann an, der väterlich-milde lächelt, als habe er ihm soeben ein unschätzbares Geschenk gemacht. Jetzt ist etwas anderes zu hören, kein Zweifel. Es ist noch nicht einmal der Gesang eines sonderlich musikalischen Vogels, auf Triller versteht sich der Zwitscherer eben so wenig wie auf angehaltene Töne… Die Platte ist fast abgelaufen und er begreift noch immer nicht und hat keine Ahnung, was er mit einem Dokument anfangen soll, das allenfalls einen Ornithologen interessieren könnte. Ricardo Alves Iawekidi suyá legend Der Kurator erklärt, dass das Gezwitscher nicht von einem Vogel, sondern von Indios stammt, den primitivsten des ganzen Kontinents, die den Gesang eines Vogels nachahmen, ehe sie ihn jagen, damit nach der rituellen Inbesitznahme der Stimme die Jagd günstig verlaufe. Jetzt begreift er. Das Tondokument wäre der Beweis für seine Theorie über die Ursprünge der Musik, über die er früher einmal gearbeitet hat. Und diese seltsame Flöte wäre ein wichtiger Beleg für die Entstehung der Musik aus dem Wunsch, den Gesang der Vögel oder den Schritt der Tiere, die Natur-Sinfonie des Urwalds nachzuahmen: ein unaufhörlicher Mimetismus der Urnatur. Also lässt er alles hinter sich und begibt sich auf eine so abenteuerliche wie beschwerliche Reise ins „Herz der Finsternis“ des lateinamerikanischen Kontinents. Xavier Quijas Yxayotl Tonantzin Carpentier schickt seinen Musikologen auf eine Reise, die er Jahre zuvor so fast selbst unternommen hatte. In einem Dorf am Rande des Urwalds, einem letzten Außenposten der Zivilisation hört er eines Abends eine ihm bekannte Musik. Jemand hat ein uraltes Radio eingeschaltet. Es ist die gleiche Musik, die den Reisenden vor einigen Tagen aus dem 7 Konzertsaal vertrieben hatte. Doch in dieser Nacht gewinnt die so weit entfernt aufgeführte Musik eine geheimnisvolle Macht. Er hält das Gesicht an den Apparat, um zu hören, und die Musik nimmt ihn mit auf eine innere Reise. Beim Klang der Hörner glaubt er, seinen Vater mit seinem Spitzbart zu sehen, einen Musikalienhändler, der ihm vom Musikleben in Europa erzählt und mit ihm über die Arbeiter gesprochen hatte, die sich Beethovens Neunte anhörten; er ahnt die energischen Gesten des Dirigenten und denkt an seine Zeit als Militärdolmetscher in Europa, an seine Nacht in der Requisitenkammer des Bayreuther Festspielhauses und an seine schlimmsten Begegnungen mit der kaltblütigsten Barbarei der Geschichte… Ludwig van Beethoven Ausschnitt aus: 6. Satz „Allegro assai vivace alla marcia“ aus: Sinfonie Nr. 9 op. 125, d-Moll Anima Eterna Leitung: Joos van Immerseel Dann schaltet er das Radio aus. Plötzlich langweilt ihn diese Neunte mit ihren unerfüllten Versprechungen, ihrem messianischen Drang, zumal dieses Jahrmarktsarsenal der türkischen Musik, die im Prestissimofinale so pöbelhaft ausufert…Er erträgt das nicht. Zwei Wochen später, an Fronleichnam, erreicht der Reisende in Begleitung eines Missionars eine Ruinenstadt mit den niedergebrannten Grundmauern einer Kirche aus der Kolonialzeit. Einzig ein fast völlig überwucherter Rundbogen steht noch. In seinem abgebröckelten Giebelrelief erkennt der Musikforscher die Figuren eines himmlischen Konzerts, mit Gambe, Theorbe, Tastenorgel, Viola und mit einem Maraca spielenden Engel. Die indianische Maraca, eine Rassel, ist eine Art Sprachrohr der Götter, mit der sie mit den Menschen kommunizieren. Ihr Klang, ihre Rhythmen sind die Sprache der Götter. Ein indianisches Sakralinstrument in der Hand eines himmlischen Musikanten: Für Carpentiers Musikologen verkörpert diese Darstellung eine Symbiose der Kulturen, wie sie sich erstmals in der Geschichte der Menschheit auf dem lateinamerikanischen Kontinent ereignet hat. Ein Emblem des IndioBarock. Er zückt sein Notizbuch, um seine Entdeckung zu skizzieren, da bricht ein karnevalistischer Mummenschanz über ihn herein, denn an Fronleichnam wird hier der Apostel Jakobus durch die Straßen geführt. Ricardo Alves Ritmo de carnaval 8 Kaum ist die ekstatische Prozession verschwunden, als ein Ton, der aus der Nähe und zugleich aus großer Ferne zu kommen scheint, Carpentiers Musikforscher aus seinen Gedanken reißt: Neben ihm psalmodiert sein Reisebegleiter, der Missionar Bruder Pedro, um sich für Fronleichnam das Gedächtnis aufzufrischen, einen gregorianischen Gesang, der in Neumen auf den vergilbten, von Insekten zernagten Seiten eines geschichtsträchtigen Liber Usualis steht. Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium Cinquecento Wie bei der Eroberung des lateinamerikanischen Kontinents ist die geistliche Musik der katholischen Kirche in Gestalt von Bruder Pedro ein ständiger Begleiter von Carpentiers Musikforscher auf seiner Suche nach der präkolumbianischen Flöte am Oberlauf des Orinoco. Diese Forschungsreise ist zugleich eine Reise, die mit jedem Schritt, den die Reisenden in den tropischen Urwäldern vordringen, in der Zeit zurück führt. Es ist eine Zeitreise, die die Männer zuletzt an den Ursprung der Musik bringt. An einem Abend erreichen sie ein Habitat von Indianern, die auf einer weit älteren Kulturstufe stehen als die vom Abend zuvor. „Wir haben das Paläolithikum verlassen“, lässt Carpentier seinen Musikologen räsonieren, „hier beginnt die große Nacht der Zeiten, und wir betreten einen Bereich, der die Grenzen des Menschen in eben jene finstere Nacht der Zeiten zurückversetzt.“ Hier erlebt der namenlose Suchende die Beschwörung eines Stammesangehörigen, der von einer giftigen Schlange gebissen wurde: das Ritual eines Schamanen, der das einzige Instrument schwingt, das diese Menschen kennen: eine Kürbisrassel. Die schamanistische Totenbeschwörung beschreibt der Reisende so: „Dann ertönt im großen Regenwald, der sich mit nächtlichem Schrecken füllt, das Wort, das schon nicht mehr gesprochenes Wort ist. Eine Sprache in der Stimme des Sprechenden und eine in der Stimme des Geistes, der von der Leiche Besitz ergriffen hat. Die eine ist dunkel und verworren, die andere, in mittlerer Tonhöhe, klingt zornig und barsch. Manchmal sind kehlige Portamenti zu hören, die in einem langgezogenen Geheul ausklingen, oder Silben, die so oft wiederholt werden, dass ein Rhythmus entsteht; Triller, die plötzlich von vier Tönen unterbrochen werden, sind schon der Keim einer Melodie. Was der Beschwörer hier von sich gibt, geht über die gesprochene Sprache hinaus und ist dennoch vom Gesang noch weit entfernt. Dann wird die Sprache plötzlich weich. Im Munde des Zauberers, des orphischen Beschwörers, verröchelt unter Krämpfen und erstirbt diese Threnodie – denn dies und nichts anderes ist sein Klagegesang gewesen – und offenbart mir, der ich wie geblendet bin, dass ich eben der Geburt der Musik beigewohnt habe.“ Carpentiers 9 Musikforscher hat sein Ziel erreicht. Die gesuchte Flöte hat er zwar nicht gefunden, aber das macht nichts. Jetzt ist alles bewiesen. Er wird auch nicht mehr theoretisch über die Ursprünge der Musik spekulieren. Denn er hat dem Anfang der Musik selbst beigewohnt. Und: Er entschließt sich, bei diesem Stamm zu bleiben. Pathways of Gods Durch die Erfahrung der schamanistischen Beschwörung wird der Reisende auf wunderbare Weise fernab von aller Zivilisation wieder dazu angeregt, einen Jugendtraum zu verwirklichen und selbst zu komponieren: und zwar einen Klagegesang, eine Threnodie. Mit ungeahnter Leichtigkeit füllte er Seite um Seite jene Hefte, die er bei einem Weißen auftreiben kann, der unweit von seinem Stamm lebt. Dann geht das Papier zu Ende. Als eines Tages ein dröhnender Donner vom Himmel braust, fliehen die Menschen seines Stammes. Ein Flugzeug landet. Man hat ihn gesucht. Er galt als im Urwald verschollen und eine große Zeitung hat einen ansehnlichen Preis für seine Rettung ausgesetzt. Er steigt ein und fliegt zurück in die Zukunft. Die Hefte mit den Noten seiner unvollendeten Komposition bleiben im Urwald. Die Threnodie hat dann ein anderer komponiert. Igor Strawinsky Ausschnitt aus: „De elegia prima“ aus: Threni: id est Lamentationes Jeremiae prophetae für Sopran, Alt, 2 Tenöre, 2 Bässe, Chor und Orchester Südfunk-Chor Stuttgart Radio-Sinfonieorchester Stuttgart Leitung: Peter Eötvös