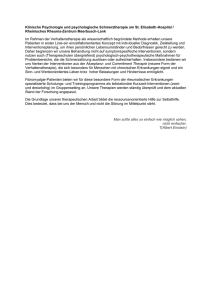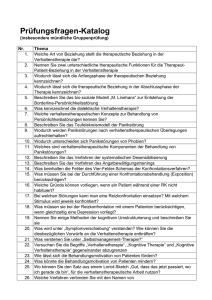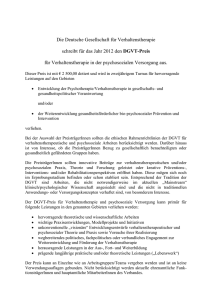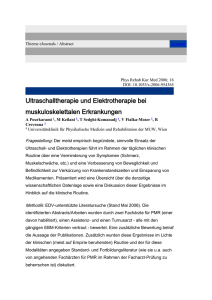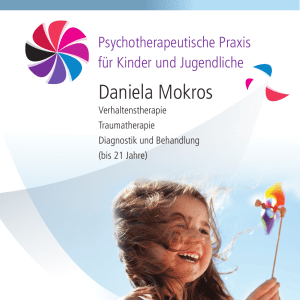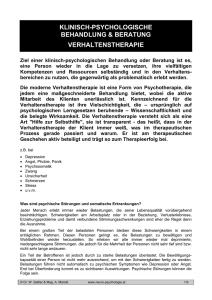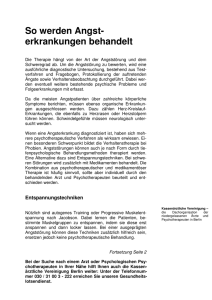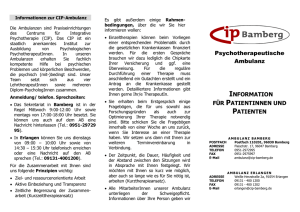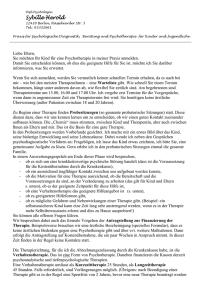Grundlagen - MediClin Bliestal Kliniken
Werbung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1. Teil Grundlagen und Denkmodelle der Verhaltensmedizin 1 Grundlagen 2 Das diagnostische Vorgehen 3 Salutogenese und Prävention 4 Gesprächsführung in der Verhaltensmedizin 5 Arzt-Patient-Kommunikation und die Verbesserung der Selbst-Effizienz der Patienten Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 3 1 1 Grundlagen 2 V. Köllner 3 4 5 6 7 8 9 10 Mit Hilfe der Lerntheorie lassen sich menschliche 11 Verhaltensweisen erklären und verstehen. Auf 12 dieser Grundlage können rationale Strategien zur 13 Veränderung ungünstiger Verhaltensmuster ent14 wickelt werden. Dies gilt sowohl für die Verhal15 tenstherapie als auch für die Kommunikation mit 16 Patienten im Rahmen der allgemein- oder fach17 ärztlichen Behandlung. Deshalb sollen die Grund18 lagen der Lerntheorie zunächst mit Hilfe eines 19 Fallbeispiels kurz dargestellt werden. Anschlie20 ßend folgt eine kurze Übersicht über Prinzipien 21 und Methoden der Verhaltenstherapie. 22 23 24 1.1 Krankheitsmodell der 25 Verhaltensmedizin 26 27 Ätiologiemodell. Grundlage des Ätiologiemodells 28 der Verhaltensmedizin ist keine einfache Kausal29 kette „Ursache Wirkung“, sondern ein Zusam30 menspiel von prädisponierenden Faktoren mit 31 auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingun32 gen (Abb. 1.1). 33 34 35 prädisponierende Faktoren genetische Veranlagung, 36 Lebensgeschichte, Vorerfahrungen, 37 soziale Faktoren etc. 38 39 auslösende Bedingungen 40 psychische, soziale oder somatische 41 Bedingungen lösen die Symptomatik aus 42 43 aufrechterhaltende Bedingungen 44 ungünstige kognitive oder Verhaltensmuster oder 45 soziale Bedingungen verhindern ein Abklingen der 46 Symptome und erhalten die Problematik aufrecht 47 Abb. 48 1.1 Das Ätiologieverständnis in Verhaltenstherapie und 49 Verhaltensmedizin. 50 51 52 Während in der Psychoanalyse die häufig weit in der Vergangenheit liegenden auslösenden Bedingungen einer Störung besondere Beachtung finden, spielen in der Verhaltensmedizin die aufrechterhaltenden Faktoren eine größere Rolle. Diese liegen eher in der Gegenwart und sind einer therapeutischen Beeinflussung leichter zugängig. Verhaltensanalyse. Grundlage einer verhaltensmedizinischen Intervention ist eine individuell durchgeführte Verhaltensanalyse, die sich mit der in Abb. 1.2 dargestellten Formel beschreiben lässt. Erfasst werden hierbei Auslösesituationen (S) eines Problemverhaltens (R), seine kurz- und langfristigen Konsequenzen (C) und das Kontingenzverhältnis, in dem diese auftreten (KV). Mit O sind die Organismusvariablen des Individuums gemeint, die es in die Problemsituation mitbringt. Dies können ebenso physiologische, psychologische und soziale Faktoren sein, wie die Vorerfahrungen, Werte und Normen eines Menschen. Die Durchführung einer Verhaltensanalyse wird ausführlich in Kap. 2 beschrieben. Teufelskreise. Ein wesentlicher aufrechterhaltender Faktor von Störungen sind Teufelskreise, die aus Fehlinterpretation von Körpersignalen hierdurch ausgelösten Ängsten oder ungünstigen Verhaltensmustern und einer hieraus folgenden Verstärkung der Symptomatik bestehen. S O R KV C Abb. 1.2 Formel zur Verhaltensanalyse (Erklärungen im Text). Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 4 1 Grundlagen Beispiele finden sich u.a. in den Kapiteln zu Angst, 1 Schmerz und Depression. Teufelskreismodelle, die 2 das ungünstige Zusammenwirken von körperli3 chen und psychischen Prozessen beschreiben, 4 werden von Patienten in der Regel wesentlich bes5 ser akzeptiert als rein psychologische Konzepte. 6 7 8 1.2 Psychologische Grundlagen 9 der Verhaltensmedizin 10 11 12 1.2.1 Klassisches Konditionieren 13 14 Der Mechanismus des klassischen Konditionierens 15 wurde erstmals von dem Physiologen I.P. Pawlow 16 (1927) beschrieben. Bei seinem grundlegenden 17 Experiment lernten Hunde, auf einen bisher neu18 tralen Reiz (Licht) mit einer physiologischen Reak19 tion (Speichelfluss) zu reagieren, die bis dahin nur 20 beim Anblick von Nahrung auftrat. 21 Mit dem in Abb. 1.3 dargestellten Schema lässt 22 sich beschreiben, wie Organismen im Laufe ihrer 23 Lebensgeschichte physiologische Reaktionen er24 lernen können. Eine aus dem Alltag vertraute CR 25 ist der Speichelfluss beim Anblick einer Zitrone. 26 Sie tritt nur auf, wenn zuvor die Erfahrung ge27 macht wurde, dass Zitronen sauer schmecken. An 28 diesem Beispiel lässt sich im Selbstversuch leicht 29 nachvollziehen, dass ein psychologischer Vorgang 30 in der Lage ist, eine physiologische Reaktion aus31 zulösen. 32 In Situationen, die als akute Bedrohung erlebt 33 werden, genügt bereits eine einmalige gemeinsa34 me Darbietung von UCS und CS, um eine Konditio35 36 37 UCR UCS (unkonditionierte Reak38 (unkonditionierter tion, hier Speichelfluss) 39 Stimulus, hier Futter) 40 41 wiederholte gemein42 same Darbietung 43 44 CR CS 45 (konditionierter (konditionierte Reaktion, Speichelfluss) 46 Stimulus, hier Licht) 47 Abb. 1.3 Modell der klassischen Konditionierung (Erklärun48 gen im Text). 49 50 51 52 nierung herzustellen. Dies war in der Evolution sinnvoll, da unsere Vorfahren nur wenige Gelegenheiten hatten, in solchen Situationen zu lernen. Insbesondere Angstreaktionen mit der dazugehörigen Sympathikusaktivierung (Kampf/Flucht-Reaktion) können auf diese Weise schnell gelernt werden. Habituation. Damit das Gehirn nicht mit irrelevanten Informationen belastet wird und physiologische Reaktionen nicht ständig zur Unzeit erfolgen, wird die Konditionierung wieder verlernt, wenn der UCS mehrmals hintereinander ohne den CS auftritt. Diesen Vorgang nennt man Habituation. Fallbeispiel Frau R., eine bis dahin gesunde, privat und beruflich erfolgreiche MTA, erkrankte mit 24 Jahren an einer schweren Kardiomyopathie. Wegen lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen musste ein AICD (Automatic implantable Cardioverter Defibrillator) implantiert werden. Als sie alleine vom Einkaufen aus dem Supermarkt nach Hause kam, spürte sie Herzrasen und erhielt danach einen Schock vom AICD. Dieser konnte die Kammertachykardie nicht durchbrechen und es erfolgte bald darauf ein zweiter Schock. Beide Schocks erlebte Frau R. als extrem unangenehm und schmerzhaft, gleichzeitig hatte sie Angst, dass auch weitere Schocks nicht greifen würden und sie nun sterben müsse. In der Folge erlebte die Patientin Angst, die sich bis zur Panik steigern konnten, wenn sie Herzklopfen spürte, alleine außerhalb ihrer Wohnung war oder in einem Supermarkt war. Die Angst war intensiver, wenn mehrere dieser Bedingungen zusammenkamen. In der lebensbedrohlichen Situation war es zu einer klassischen Konditionierung auf deren Begleitumstände gekommen. Eine Habituation trat nicht ein, da die Patientin immer, wenn diese Umstände auftraten, intensive Furcht und damit wiederum ein stark aversives Ereignis erlebte. Während die Ängste anfangs nur im Zusammenhang mit diesem Supermarkt auftraten, kam es nach kurzer Zeit zu einer Ausweitung auf andere Situationen, in denen die Patientin alleine unterwegs war. Dieser Vorgang wird Reizgeneralisierung genannt. Die Symptome traten auch dann noch auf, als die Patientin herztransplantiert und der AICD entfernt worden war. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.2 Psychologische Grundlagen der Verhaltensmedizin Konditionierung einer Immunsuppression. Auch 1 andere physiologische Reaktionen, wie z.B. Blut2 druckanstiege oder Immunreaktionen lassen sich 3 klassisch konditionieren. So gaben Ader und Cohen 4 (1982) Mäusen den Süßstoff Saccharin (als CS) wie5 derholt gemeinsam mit dem Medikament Cyclo6 phosphamid (als UCS), das eine Immunsuppression 7 (UCR) verursacht. Später löste dann Saccharin allei8 ne eine Immunsuppression (jetzt CR) aus. Nach die9 ser Konditionierung hatte die Süßstoffinjektion al10 leine eine positive Auswirkung auf den Verlauf einer 11 angeborenen Autoimmunerkrankung der Mäuse. 12 Derzeit wird erforscht, wie sich diese Befunde für 13 die Behandlung von Autoimmunerkrankungen, 14 HIV-Infektion und Krebs nutzen lassen. 15 16 Chronifizierung von Schmerzen. Bei der Chroni17 fizierung von Schmerzen spielt die klassische Kon18 ditionierung ebenfalls eine Rolle: Schmerz löst als 19 Schutzreflex eine Muskelverspannung aus. Diese 20 führt bei längerem Anhalten ihrerseits zu einer 21 Verstärkung der Schmerzen. Wenn nun bei einem 22 Patienten bei körperlicher Anstrengung in der Ver23 gangenheit Schmerzen aufgetreten sind, kann es 24 in der Folge nach kurzer Belastung oder schon 25 beim Gedanken daran zu einer Spannungserhö26 hung als CR und zu Schmerzen kommen. Durch 27 das Erlernen eines Entspannungsverfahrens kann 28 der Patient gegensteuern. 29 30 31 32 1.2.2 Operantes Konditionieren 33 34 Skinner (1953) zeigte, dass die Auftretenswahr35 scheinlichkeit eines Verhaltens von seinen Konse36 quenzen beeinflusst wird. Abb. 1.4 zeigt diesen Zu37 sammenhang, wobei R für das zu beeinflussende 38 Verhalten, C für dessen Konsequenz und K für ein 39 bestimmtes Kontingenzverhältnis steht. Als Ver40 stärker wird in diesem Zusammenhang eine Konse41 quenz bezeichnet, die zu einem häufigeren Auftre42 ten von R führt. Die kann sowohl eine positive 43 Konsequenz sein (positive Verstärkung) als auch 44 das Ausbleiben eines erwarteten negativen Ereig45 nisses (negative Verstärkung). So kann z.B. Alko46 holkonsum sowohl positiv (Gefühl der Entspan47 nung, angenehmer Geschmack) als auch negativ 48 (Antrinken gegen Entzugssymptome) verstärkt 49 werden. Negative Verstärkung ist also nicht mit Be50 strafung zu verwechseln. Wenn nach einer operan51 ten Konditionierung K über längere Zeit ausbleibt, 52 R 5 C K Abb. 1.4 Modell des operanten Konditionierens (Erklärungen im Text). tritt R zunehmend seltener auf und verschwindet schließlich. Es kommt zur Löschung. Das Kontingenzverhältnis beschreibt die Häufigkeit, mit der C auf R folgt. Eine kontingente Verstärkung wirkt zwar schneller, im Falle ihres Ausbleibens wird das gelernte Verhalten aber schneller wieder verlernt (Löschung). Im Falle einer inkontingenten Verstärkung wird hingegen Frustrationstoleranz gleich mitgelernt und das Verhaltensmuster ist sehr löschungsresistent. Ein Beispiel hierfür ist das pathologische Spielen, da der Spielsüchtige die Erfahrung macht, dass er nur lange genug durchhalten muss, bis wieder ein Gewinn kommt. Das ist auch ein Grund, warum bei der Kindererziehung Konsequenz so bedeutsam ist. Meist sind kurzfristige Konsequenzen stärker verhaltenssteuernd als langfristige. Dies ist eine der Erklärungen dafür, warum viele Menschen rauchen, obwohl sie um die gesundheitlichen Gefahren wissen. Gleichzeitig wird deutlich, warum Nichtraucherkampagnen, die lediglich vor den langfristigen Konsequenzen des Rauchens warnen, so wenig Erfolg haben. Heute wird deshalb mehr auf kurzfristige negative Konsequenzen des Rauchens (Mundgeruch, Potenzstörungen) und positive Folgen des Nichtrauchens (Fitness, schönere Haut) hingewiesen. Operantes Lernen spielt eine wesentliche Rolle in der Medizin: Für die Angststörungen wird dies im Fallbeispiel dargestellt. Depressive neigen dazu, sich zurückzuziehen und wenig aktiv zu sein. So fehlen ihnen Erfolgserlebnisse als positive Verstärker. Dieser Verstärkerverlust verschlechtert wiederum die Stimmung und vermindert den Antrieb. Therapieziel ist es deshalb, durch langsamen Aktivitätsaufbau (wobei Überforderung vermieden werden muss) dem Patienten wieder Erfolgserlebnisse zu vermitteln, die dann Verstärker für weitere Aktivitäten sind. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 6 1 Grundlagen Seligmans Depressionsmodell der „erlernten 1 Hilflosigkeit“, ist ebenfalls ein operantes Modell. 2 Sowohl in Tierexperimenten als auch klinisch 3 zeigte sich, dass eine Depression ausgelöst wird, 4 wenn das eigene Verhalten keine Auswirkung auf 5 die Konsequenzen hat. Dies ist der Fall, wenn ent6 weder immer Bestrafung oder Belohnung oder 7 Nichtbeachtung erfolgt oder wenn diese Konse8 quenzen nach dem Zufallsprinzip zugeteilt wer9 den. Die Konsequenzen können dann nicht mehr 10 als Verstärker wirksam werden; aktives, zielge11 richtetes Verhalten wird gelöscht. Wenn ein Kind 12 also unter Bedingungen von Misshandlung, Ver13 wöhnung, Vernachlässigung oder Willkür auf14 wächst, hat es ein höheres Risiko, in seinem spä15 teren Leben an einer Depression zu erkranken. 16 Die Aufrechterhaltung chronisch unspezifischer 17 Rückenschmerzen lässt sich als operant gelernte 18 „Bewegungsphobie“ beschreiben. Wenn ein Pa19 tient bei einer körperlichen Aktivität Schmerz er20 lebt und diese künftig meidet, wird das Vermei21 dungsverhalten negativ verstärkt („Ein Glück, 22 dass ich mich geschont habe, sonst wären die 23 Schmerzen bestimmt noch schlimmer gewor24 den!“) und eine korrigierende Erfahrung verhin25 dert. Gleichzeitig führt dieses Schonverhalten zu 26 einer Atrophie von Muskulatur, was langfristig 27 die Schmerzsymptomatik verschlimmert. 28 Schmerzverhalten wird positiv verstärkt, wenn 29 Angehörige nur bei direkter Schmerzäußerung 30 mit Zuwendung und Unterstützung reagieren. In 31 diesem Zusammenhang ist der Befund interes32 sant, dass Schmerzpatienten, die eine sehr hohe 33 Zufriedenheit mit ihrer Partnerschaft angeben, 34 ein größeres Chronifizierungsrisiko haben. 35 Auch für eine erfolgreiche Gestaltung der Arzt36 Patient-Kommunikation ist es hilfreich, die 37 Prinzipien des operanten Lernens zu kennen. 38 Wenn ein Arzt einem übergewichtigen Patien39 ten mit Bluthochdruck empfiehlt, körperlich 40 aktiv zu sein, so ist es wichtig, dass er bei den 41 nächsten Konsultationen nachfragt und inzwi42 schen umgesetzte Verhaltensänderungen posi43 tiv kommentiert. Andernfalls praktiziert er Lö44 schung, die Auftretenswahrscheinlichkeit des 45 gesunden Verhaltens verringert sich. 46 47 48 Fallbeispiel 49 50 Immer, wenn Frau R. sich vornahm, alleine einkaufen 51 zu gehen oder eine längere Autofahrt zu machen, tra52 ten Angstsymptome auf. Wenn sie sich daraufhin dazu entschloss, in ihrer Wohnung zu bleiben, besserten sich die Symptome schnell. Ihr Vermeidungsverhalten wurde so negativ verstärkt (durch Wegfall der quälenden Angstsymptome). Dieser Mechanismus spielt bei der Entstehung und Aufrechterhaltung des Vermeidungsverhaltens bei Angststörungen (siehe Kap. 16) eine bedeutende Rolle. Bei Frau R entwickelte sich eine Agoraphobie, die ihre Bewegungsfreiheit zunehmend einschränkte. Da sich nach der Transplantation ihr Mann von ihr getrennt hatte, war Frau R zunehmend einsam. Wenn sie Einkäufe oder Behördengänge wegen ihrer Angst nicht durchführen konnte, rief sie ihre Eltern an, die dann kamen, um die Dinge mit ihr gemeinsam zu erledigen. Ihr Vermeidungsverhalten wurde so durch die vermehrte Zuwendung zusätzlich positiv verstärkt. Den Eltern musste in einem Familiengespräch klar gemacht werden, dass sie ihre Tochter besser unterstützen konnten, wenn sie ihre Besuche unabhängig von Angstäußerungen der Tochter durchführen. 1.2.3 Modellernen Ein weiterer wichtiger Lerntyp ist das Lernen durch Beobachtung (Imitationslernen, Lernen am Modell). Dabei ist festzustellen, dass sich auch sehr komplexe Verhaltensweisen, wie z.B. das Verhalten in einem vornehmen Restaurant, durch diese Art des Lernens aneignen lassen. Eine der häufigsten Formen dieser Lernart stellt die Nachahmung eines beobachteten Verhaltens dar. Dabei beobachten wir andere Personen (Modelle) und deren Verhalten (Modellverhalten), was zu einer Veränderung unseres Verhaltens führt. Die Verhaltensmodifikation kann in drei Richtungen erfolgen: Lernen eines neuen Verhaltens, Auslösen eines bereits gelernten Verhaltens oder Lockerung bestehender Hemmungen. Modellernen ist ein wichtiger Wirkfaktor in verhaltensmedizinischen Gruppen, in denen Patienten Lösungsstrategien voneinander häufig leichter lernen als durch Interventionen der Therapeuten. Um ein ungünstiges Modellernen zu verhindern, gehen inzwischen immer mehr Kliniken dazu über, auch für Mitarbeiter ein Rauchverbot auszusprechen. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.2 Psychologische Grundlagen der Verhaltensmedizin Fallbeispiel 1 2 Frau R. tat sich in der Therapie zunächst schwer damit, 3 ihr Vermeidungsverhalten aufzugeben. Erst als sie in 4 einer Rehabilitationsklinik erlebte wie aktiv andere 5 herzoperierte Patienten ihr Leben gestalteten und sie 6 über das Internet Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe 7 junger Organtransplantierter aufnahm, wurde sie 8 selbst zunehmend aktiver. 9 10 11 1.2.4 Kognitive Faktoren 12 13 Unter kognitiven Prozessen versteht man gedank14 liche Leistungen wie Wahrnehmen, Erkennen, 15 Denken, Schlussfolgern, Erinnern usw. Ob Angst16 symptome auftreten, hängt u.a. davon ab, ob ein 17 bestimmter Stimulus zunächst wahrgenommen 18 und dann als bedrohlich interpretiert wird. Kogni19 tive Vorgänge spielen eine bedeutende Rolle bei 20 der Entstehung und Aufrechterhaltung ungünsti21 gen Gesundheitsverhaltens und psychischer Stö22 rungen: 23 24 Selektive Wahrnehmung. Patienten mit gesund25 heitsbezogenen Ängsten (Panikstörung, Hypochon26 drie) lenken ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf Rei27 ze, die für ihre Angstinhalte spezifisch sind. Diese 28 werden dann häufiger und intensiver wahrgenom29 men. Nachgewiesen wurde dies z.B. im Farbtest 30 nach Stroop. Hierbei werden Probanden in ver31 schiedenen Farben geschriebene Wörter präsen32 tiert mit der Aufforderung, so schnell wie möglich 33 die Farbe zu benennen. Dies geht schneller bei emo34 tional neutralen Wörtern; die Latenzzeit wird län35 ger, wenn die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung 36 des Wortes gelenkt wird. Patienten mit sozialer 37 Phobie zeigten deutlich längere Latenzen bei Wör38 tern, die soziale Gefahren beschreiben (z.B. Blama39 ge, peinlich, auslachen), während Patienten mit Pa40 nikstörung auf Begriffe aus dem Bereich Gesundheit 41 (z.B. Herzinfarkt, ersticken, Ohnmacht) ansprachen. 42 43 Verstärkte Selbstbeobachtung. Weiter konnte 44 nachgewiesen werden, dass Patienten mit gesund45 heitsbezogenen Ängsten ihren Körper verstärkt 46 beobachten und Körpersignale häufiger angstbe47 setzt bewerten. Die verstärkte Selbstbeobachtung 48 führt dazu, dass mehr Körpersymptome wahrge49 nommen werden. Dies wird dann als Verschlech50 terung des Gesundheitszustandes, also wiederum 51 als Gefahrensignal, interpretiert. 52 7 Automatische Gedanken. Automatisierte kognitive Prozesse sind an sich nicht pathologisch, sondern sie ermöglichen ein schnelles Funktionieren im Alltag. So laufen z.B. eine Reihe automatisierter Entscheidungsprozesse ab, bevor man mit dem Auto vor einer roten Ampel hält. Wie schwierig es ist, automatisierte Prozesse zu verändern, erfährt man, wenn man im Urlaub in einem Land mit Linksverkehr Auto fährt. Wenn nun Bewertungen automatisiert werden, die zu problematischen Verhalten führen, sind diese Gedanken dem Patienten nicht mehr bewusst und deshalb von ihm selbst nur schwer zu modifizieren. Kognitive Verzerrungen und logische Fehler. Häufig tragen kognitive Verzerrungen und logische Fehler dazu bei, problematische Verhaltensmuster aufrecht zu erhalten. Einige Beispiele hierfür sind: Alles-oder-Nichts-Denken („Jetzt, wo ich das Stückchen Schokolade gegessen habe, ist die ganze Diät im Eimer.“) Katastrophisieren („Wenn mein Partner mich verlässt, kann ich mir gleich einen Strick nehmen.“) Interpretationen mit Tatsachen verwechseln („Dass X mich so mürrisch angeschaut hat bedeutet, dass er mich nicht leiden kann.“) Übergeneralisieren („Wenn ich beim Tennis eine schlechte Figur gemacht habe, bedeutet dies, dass ich für Sport zu ungeschickt bin.“) Wenn im Gespräch mit dem Patienten solche kognitiven Verzerrungen deutlich werden, ist es wenig Erfolg versprechend, einfach zu widersprechen. Besser ist es, durch Hinterfragen eine Veränderung solcher Denkstrukturen anzuregen: „Wie viel haben Sie tatsächlich durch dieses eine Stück Schokolade zugenommen? Rechnen Sie einmal nach!“, „Wenn es mit dem Tennis nicht so geklappt hat – woran könnte das noch liegen? Kennen Sie sportliche Menschen, die auch nicht gut Tennisspielen? Welche Art von Bewegung könnte Ihnen mehr liegen?“ Dysfunktionale kognitive Schemata. Kognitive Schemata können als neuronale Netzwerke beschrieben werden, in denen Erinnerungen, Gedanken und Gefühle gespeichert sind und die gemeinsam abgerufen werden, wenn ein Teil des Schemas aktiviert wird. Der von Aaron Beck (1967) entwickelte Erklärungsansatz der Depression nimmt als Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 8 1 Grundlagen Ursache eine als Folge früherer ungünstiger Erfah1 rungen und Lernprozesse entstandene kognitive 2 Störung an. Hauptmerkmal ist eine verzerrte In3 terpretation, die zu einer negativen Sicht von sich 4 selbst, der Welt und der Zukunft führt. Gedächt5 nispsychologische Untersuchungen zeigen, dass 6 Gedächtnisinhalte stimmungskongruent gespei7 chert und abgerufen werden. In einer depressiven 8 Phase werden also selektiv negative Erinnerungen 9 bewusst. 10 11 Fallbeispiel 12 13 Die phobische Symptomatik bildet sich bei Frau R. auch 14 nicht zurück, nachdem während der Herztransplanta15 tion der AICD entfernt worden war und nun weder die 16 Gefahr lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen 17 noch von schmerzhaften AICD-Entladungen bestand. 18 Der postoperative Verlauf war komplikationslos und 19 ein Jahr danach hätte die Patientin eigentlich wieder ih20 rem Beruf nachgehen können, wenn sie nicht weiter 21 durch ihre Ängste eingeschränkt gewesen wäre. 22 Nach der Transplantation war es zu einer harmlosen 23 und erfolgreich behandelbaren Abstoßungsreaktion 24 gekommen. Diese war für die Patientin durch Rhyth25 musstörungen spürbar gewesen. Wenn Frau R. nun 26 Herzklopfen spürte, kam es zunehmend häufiger zu 27 dem automatischen Gedanken: „Das ist eine Absto28 ßung!“. Dieser wurde katastrophisierend verstärkt: 29 „Ich werde sterben, wenn ich nicht schnell Hilfe be30 komme!“. Gleichzeitig spürte sie als Folge von Auf31 merksamkeitslenkung und selektiver Wahrnehmung 32 immer häufiger kardiale Sensationen. Frau R. wurde 33 zunehmend öfter im betreuenden Transplantations34 zentrum aufgenommen, ohne dass ein organpatholo35 gischer Befund nachweisbar war. 36 Dies war der Grund, warum sie einem Psychotherapeu37 ten vorgestellt wurde. Die bereits zuvor bestehende 38 depressive Symptomatik war nicht beachtet worden. 39 Dies entspricht der Erfahrung, dass Angstsymptome 40 im klinischen Kontext auffallen, während eine Depres41 sion häufig unerkannt bleibt, wenn deren Symptome 42 nicht im Gespräch oder mit einem Screening-Frage43 bogen erfasst werden. 44 45 46 1.2.5 Die Rolle der Emotionen 47 48 In den letzten Jahren wurde u.a. durch die Re49 zeption neurowissenschaftlicher Erkenntnisse (Le 50 Doux 2003) die Bedeutung der Emotionen für die 51 52 Verhaltensmedizin stärker betont. Drei Aspekte sind von besonderer Relevanz: Die Hemmung des Ausdrucks insbesondere von negativen Emotionen in belastenden Situationen kann pathogene Wirkung haben, während sich das Training eines adäquaten Ausdrucks von Emotionen gesundheitsfördernd auswirkt. Pennebaker (1993) empfiehlt als einfach durchzuführende Basisintervention das Aufschreiben der eigenen Gefühle und des Erlebens in traumatischen oder belastenden Situationen. Die Unfähigkeit, Affekte zu kontrollieren, kann ebenso problematisch sein und für die Betroffenen zu bedrohlichen Situationen führen. Techniken zum Erlernen einer effektiveren Emotionswahrnehmung und -kontrolle wurden von Linehan (1996) zunächst für Patienten mit Borderline-Störung entwickelt und dann auf andere Störungsbilder übertragen. Gefühle können auch unangepasst an Stelle primärer Emotionen auftreten (z.B. Trauer und Selbstvorwürfe an Stelle von Wut) und so ihrer Signalfunktion verlustig gehen. In diesem Fall muss in einem längeren therapeutischen Prozess zunächst das sekundäre Gefühl verbalisiert und zu seinem biographischen Ursprung verfolgt werden, um schließlich das primäre Gefühl erlebbar zu machen und zu verbalisieren (Greenberg 2000). In der Psychotherapieforschung zeigte sich, dass eine Therapie, bei der abstrakt und ohne emotionale Beteiligung über Probleme gesprochen wird, eher geringe Wirkung hat. Grawe (1998) formulierte Problemaktualisierung und emotionale Aktivierung als wesentliche Wirkfaktoren von Psychotherapie. In der Verhaltenstherapie hat die Aktivierung von Emotionen durch die Konfrontationsbehandlung eine lange Tradition. Klinisch ist hierbei zu beobachten, dass es Patienten nach intensivem Erleben und Bewältigung von Angstaffekten nach der Konfrontation häufig leichter fällt, auch andere Gefühle zuzulassen und auszudrücken. Inzwischen werden auch in der kognitiven Therapie zunehmend emotionsaktivierende Techniken, wie z.B. Imaginationsübungen eingesetzt. Mittels Biofeedback können die hierbei ausgelösten physiologischen Veränderungen ggf. auch dem Patienten rückgemeldet werden. Häufig ist die Schulung der Körperwahrnehmung der Schlüssel zu einem besseren Zugang zu den eigenen Gefüh- Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.3 Subjektive Krankheitstheorie und Krankheitsverarbeitung len, so dass hierfür eine Vielzahl spezifischer 1 Übungen entwickelt wurde (Görlitz 1998). 2 3 Fallbeispiel 4 5 Zeitweise gelang es Frau R. nicht, die in der Therapie 6 gelernten Möglichkeiten zur Angstbewältigung einzu7 setzen und sie führte nur selten das verabredete Fit8 nessprogramm durch. Immer wieder kam es zu Panik9 anfällen und ihre Bewegungsfreiheit war weiterhin 10 deutlich eingeschränkt. In dieser Phase wurde in der 11 Therapie eine emotionsaktivierende Übung durchge12 führt: Nach Induktion von Entspannung sollte Frau R 13 die Augen schließen und sich ganz genau vorstellen, 14 wie ihr Leben in 5 Jahren aussehen würde, wenn sich 15 weiterhin nichts ändern würde. Die Übung löste bei der 16 Patientin heftige Trauer aus, nicht nur über die aktuel17 le Situation, sondern auch darüber, dass ihre bisherige 18 Lebensplanung durch die Krankheit aus den Fugen ge19 raten war. Ihr Mann hatte sie verlassen als sie dringend 20 seine Unterstützung gebraucht hätte und ihre Schön21 heit, die für sie einen hohen Stellenwert hatte, war 22 durch die Nebenwirkungen der Kortisontherapie be23 einträchtigt. In den nächsten Stunden nahm die Trau24 er über diese Verluste großen Raum ein. Danach war 25 Frau R. freier, sich der Planung neuer Lebensperspekti26 ven zuzuwenden und sich mit der Angst auseinander 27 zu setzen. Es wurde klar, dass die Angst ihr die Mög28 lichkeit gab, aktiv zu sein (Klinik aufsuchen, Eltern 29 alarmieren, Notarzt rufen) und deshalb leichter auszu30 halten war als die Trauer, der sie sich hilflos ausgelie31 fert fühlte. 32 33 34 35 36 1.3 Subjektive 37 Krankheitstheorie und 38 Krankheitsverarbeitung 39 40 41 Unter „subjektiver Krankheitstheorie“ versteht man 42 die Überzeugungen und Vorstellungen, die ein 43 Patient bezüglich 44 Art seiner Erkrankung, 45 Krankheitsursachen, 46 Zeitverlauf und Prognose sowie 47 Behandlungs- und Kontrollmöglichkeiten hat. 48 49 Kontrollüberzeugungen. Bei den Annahmen zu 50 Krankheitsursachen und Kontrollmöglichkeiten 51 kann unterschieden werden zwischen 52 9 internaler Kontrollüberzeugung („Ich kann mit meinem Verhalten den Verlauf der Erkrankung beeinflussen.“), sozial-externaler Kontrollüberzeugung („Ein guter Arzt wird mich wieder gesund machen können.“ Oder auch: „Wenn meine Frau weiter so an mir rumnörgelt, kann mein Blutdruck nicht runtergehen!“), fatalistischer Kontrollüberzeugung („Der Krankheitsverlauf wird durch Zufall/Schicksal/gesellschaftliche Verhältnisse/Gene bestimmt.“). Diese Überzeugungen bestimmen in wesentlichem Maße das Verhalten des Patienten. So reduzieren Herzinfarktpatienten mit internaler Kontrollüberzeugung signifikant häufiger ihre Risikofaktoren als solche mit externalem Attributionsstil. Umgekehrt kann bei einer schicksalhaft verlaufenden Erkrankung eine fatalistische Kontrollüberzeugung helfen, die Situation zu akzeptieren und nicht zusätzlich durch Schuldgefühle belastet zu sein, nicht genügend vorgebeugt oder gegen die Krankheit gekämpft zu haben. Wenn die Krankheitstheorien von Arzt und Patient weit auseinander liegen, so sind Noncompliance und mangelnder Therapieerfolg wahrscheinlich. Wenn ein Patient z.B. Müdigkeit und Abgeschlagenheit auf Elektrosmog durch eine in der Nachbarschaft errichtete Sendestation zurückführt, wird er wenig motiviert sein, die Hinweise des Arztes zur Einstellung des neu entdeckten Diabetes zu befolgen. In der Anamnese sollte unbedingt die subjektive Krankheitstheorie des Patienten erfragt werden. Wenn diese einer verhaltensmedizinischen Intervention entgegensteht, muss zunächst die Krankheitstheorie mittels Information oder kognitivem Umstrukturieren modifiziert werden. Fallbeispiel Frau R. war der Überzeugung, dass ihre Kardiomyopathie entstanden sei, weil sie eine Grippe nicht genügend auskuriert und sich zu wenig geschont habe. Als automatischer Gedanke fungierte die Überzeugung: „Wenn man es am Herz hat, muss man sich schonen.“ Dies brachte sie beim Auftreten von Angstsymptomen (Herzklopfen, Hyperventilation) dazu, körperliche Aktivität abzubrechen, was die selbstständige Durchfüh- Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 10 1 Grundlagen rung ihres Trainingsprogramms verhinderte. Erst als 1 diese Überzeugung modifiziert wurde, und Frau R. ver2 innerlichte, dass regelmäßiges Ausdauertraining ihr 3 Herz kräftigt und Schonung die Problematik ver4 schlechtert, konnte sie sich gegen die aufkommenden 5 Ängste wehren. 6 7 Weitere Informationen zu den Themen Krank8 heitsverarbeitung und Krankheitsverhalten finden 9 sich in den Kapiteln 3 und 15. 10 11 12 13 1.4 Theorien zur Veränderung 14 menschlichen Verhaltens 15 16 Banduras Konstrukt der Selbstwirksamkeit. In 17 den 70er-Jahren erwies sich ein auf Fremdkontrol18 le basierendes therapeutisches Konzept, wie es 19 von Skinner vertreten wurde, als nicht mehr zeit20 gemäß. Neue Konzepte setzen sich deshalb mit 21 kognitiven Prozessen ebenso wie mit der Möglich22 keit der Selbstregulation und Selbststeuerung aus23 einander. Im Rahmen seiner Theorie des Modeller24 nens entwickelte Bandura (1977) das Konstrukt 25 der Selbstwirksamkeit (Self Efficacy), welches be26 inhaltet, dass eine Person ihr Verhaltensmuster 27 nur dann ändert, wenn sie zuvor davon überzeugt 28 ist, das neue Verhalten auch tatsächlich ausüben 29 zu können. Die empirische Fundierung der Arbei30 ten Banduras erleichterte es auch ursprünglich be31 havioristisch ausgerichteten Forschern und Prakti32 kern, kognitive Konstrukte zu akzeptieren. 33 34 Selbstmanagement-Ansatz nach Kanfer. Einen 35 Schritt weiter ging Kanfer (1991), als er die kogni36 tionspsychologische Unterscheidung zwischen au37 tomatisierter und kontrollierter Informationsver38 arbeitung in die Verhaltensanalyse integrierte. 39 Aufgabe der von ihm formulierten Selbstmanage40 ment-Therapie ist es, dem Klienten über eine 41 Rückkehr in den Modus der bewussten Informa42 tionsverarbeitung zu helfen, dysfunktionale Mus43 ter zu erkennen und zu modifizieren. Dies kann 44 z.B. dadurch geschehen, dass der Klient aufgefor45 dert wird, Gefühle, Gedanken und Verhalten in 46 häufig wiederkehrenden Problemsituationen zu 47 beobachten und möglichst zeitnah zu protokollie48 ren. Solche Problemsequenzen werden dann in der 49 Therapiestunde in Zeitlupe betrachtet und auf dys50 funktionale Muster untersucht. Durch diesen the51 rapeutischen Prozess werden automatische Ge52 danken der bewussten Reflexion und Steuerung des Individuums wieder zugänglich gemacht. 7-Stufen-Modell der therapeutischen Veränderung. Der Selbstmanagement-Ansatz wurde dann von Kanfer und Mitarbeitern (1996) zu einem 7-Stufen-Modell der therapeutischen Veränderung ausgearbeitet (Abb. 1.5). Entscheidend ist hierbei, dass die eigentliche verhaltenstherapeutische Intervention (Phase 5) nur einen Teil der Therapie einnimmt und zunächst durch den Aufbau der therapeutischen Beziehung, eine individuelle Problemanalyse sowie ein gemeinsames Erarbeiten der Therapieziele vorbereitet wird. An die Intervention schließt sich eine Phase an, in der die Auswirkungen der erzielten Veränderung auf den Lebenskontext des Patienten betrachtet werden und in der der Umgang mit dem möglichen erneuten Auftreten von Symptomen und das Therapieende vorbereitet werden. Bei ausbleibenden therapeutischen Fortschritten sieht das Modell eine „Störfallanalyse“ vor, bei der überprüft wird, ob es notwendig ist, zu früheren Phasen des Prozesses zurückzukehren, also z.B. die Tragfähigkeit der therapeutischen Beziehung zu thematisieren oder Änderungsbereiche neu zu definieren. Dieses Modell bezieht so die therapeutische Beziehung mit in die Betrachtung ein und weist ihr einen zentralen Stellenwert zu. Stages of Change. Prochaska und DiClemente (1983) fanden bei der Untersuchung von Personen, die versuchten, mit dem Rauchen aufzuhören, ein bestimmtes Muster, nach dem der Veränderungsprozess ablief, unabhängig davon, ob professionelle Hilfe in Anspruch genommen wurde, oder nicht. Sie beschrieben in ihrem „transtheoretischen Modell“ der Verhaltensänderung einen sechsstufigen Ablauf (Tab. 1.1). Die immense praktische Bedeutung dieses Ansatzes liegt darin, dass innerhalb der verschiedenen Stadien die Anwendung unterschiedlicher therapeutischer Strategien sinnvoll ist, während andere mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben werden. Ein verhaltenstherapeutisches Nichtrauchertraining wäre z.B. in der Phase Preparation oder Action ein Angebot, das der Patient sinnvoll nutzen könnte, in der Precontemplation-Phase hingegen würde er den Sinn eines solchen Programms für sich nicht sehen können und allenfalls aus äußerem Zwang teilnehmen. In diesen frühen Phasen geht es vielmehr darum, Veränderungsmotivation Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.4 Theorien zur Veränderung menschlichen Verhaltens 11 1 Bezeichnung der Phasen wichtige Ziele 2 3 – Rollenstrukturierung 1. Eingangsphase: – Bildung einer kooperativen Arbeitsbeziehung (= „therapeutische Allianz“) 4 Schaffung günstiger – Beginn der problembezogenen Informationssammlung („Screening“ von Eingangsbe5 Ausgangsbedingungen schwerden und -erwartungen: erste Überlegungen zu therapeutischen Ansatzpunkten) 6 – optimale Gestaltung der „äußeren“ Therapiesituation 7 – Nutzung „inhärenter“ Motivationsbedingungen des Selbstmanagementkonzepts 8 2. Aufbau von – Reduktion von Demoralisierung und Resignation „Änderungsmotivation“ 9 – Einsatz spezieller Motivierungsstrategien und vorläufige Auswahl 10 – erste Ansätze einer „Ziel- und Wertklärung“ (ZWK) von Änderungsbereichen – (vorläufige) sachliche und motivationsabhängige Auswahl von Änderungsbereichen 11 12 – situative Verhaltensanalyse (von der Makro- zur Mikroebene) 13 3. Verhaltensanalyse – kontextuelle Verhaltensanalyse (von Mikro- zur Makroebene) und funktionales 14 – Erstellen eines (vorläufigen) funktionalen Bedingungsmodells Bedingungsmodell 15 16 – Klären von Therapiezielen 17 4. Vereinbaren – gemeinsame Zielanalyse therapeutischer Ziele 18 – Konsens über therapeutische Zielperspektiven 19 – Planung spezieller Maßnahmen (auf der Basis der Informationen aus den Phasen 20 5. Planung, Auswahl 1 bis 4) 21 und Durchführung – Entscheidung über spezielle Interventionen spezieller Methoden 22 – Durchführung der Maßnahmen 23 – kontinuierliche therapiebegleitende Diagnostik 24 6. Evaluation – Prä/Post-Evaluation 25 therapeutischer – „zielabhängige“ Evaluation des Einzelfalls Fortschritte 26 27 – Stabilisierung und Transfer therapeutischer Fortschritte 28 7. Endphase: – Arbeit an restlichen therapeutischen Ansatzpunkten bzw. Bearbeiten neuer therapeu29 Erfolgsoptimierung und tischer Ziele Abschluss der Therapie 30 – Erlernen von „Selbstmanagement“ als Prozess – Beendigen/Ausblenden der Kontakte 31 – Abschluss-„Feedback“ 32 – Vorbereitung von „Follow-up“ bzw. von Katamnesen 33 34 „Follow-up“/Katamnese 35 36 Abb. 1.5 7-Phasen-Modell des therapeutischen Prozesses (Reinecker 2005). 37 38 39 40 Tabelle 1.1 Veränderungs-Prozess-Modell Stufe 1 Precontemplation Vorstadium des Nachdenkens 41 von Prochaska und DiClemente (1983) Stufe 2 Contemplation Stadium des Nachdenkens 42 Stufe 3 43 44 Stufe 4 45 Stufe 5 46 Stufe 6 47 Preparation Vorbereitungsstadium Action Handlung Maintenance Aufrechterhaltung Relaps Rückfall 48 49 50 51 52 Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 12 1 Grundlagen aufzubauen, als konkrete Strategien zur Verände1 rung zu planen. Das transtheoretische Modell kann 2 also helfen, Patienten individuell therapeutische 3 Strategien zuzuordnen, die bei ihnen besonders Er4 folg versprechend sind. 5 6 7 1.5 Grundprinzipien der 8 kognitiven 9 Verhaltenstherapie 10 11 12 Die kognitive Verhaltenstherapie ist aus heteroge13 nen Denkrichtungen und Behandlungsansätzen 14 entstanden. Verbindendes Element ist die Orien15 tierung an der Lerntheorie und der empirischen 16 Psychologie. Deshalb ist es sinnvoll, nicht von ei17 ner Therapieschule, sondern von einer psychothe18 rapeutischen Grundorientierung zu sprechen. 19 20 Definition. Margraf (2000) formulierte folgende 21 Definition: „Die Verhaltenstherapie ist eine auf der 22 empirischen Psychologie basierende psychothe23 rapeutische Grundorientierung. Sie umfasst stö24 rungsspezifische und -unspezifische Therapiever25 fahren, die aufgrund von möglichst hinreichend 26 überprüftem Störungswissen und psychologi27 schem Änderungswissen eine systematische Bes28 serung der zu behandelnden Probleme anstreben. 29 Die Maßnahmen verfolgen konkrete und operatio30 nalisierte Ziele auf den verschiedenen Ebenen des 31 Verhaltens und Erlebens, leiten sich aus einer Stö32 rungsdiagnostik und individuellen Problemanalyse 33 ab und setzen an prädisponierenden, auslösenden 34 und/oder aufrechterhaltenden Problemänderun35 gen an. Die in ständiger Entwicklung befindliche 36 Verhaltenstherapie hat den Anspruch, ihre Effekti37 vität empirisch abzusichern.“ 38 Im Folgenden sollen einige Prinzipien darge39 stellt werden, die der verhaltenstherapeutischen 40 Arbeit zugrunde liegen. 41 42 Wissenschaftliche Fundierung. Die Verhaltens43 therapie geht davon aus, dass menschliches Ver44 halten hinreichend erklärt werden kann durch An45 wendung allgemeiner Prinzipien, die empirisch 46 ermittelt werden können. Dies bedeutet nicht, 47 dass sämtliche Prinzipien bereits bekannt sind, die 48 ein individuelles Verhalten ausreichend erklären. 49 Es ist jedoch keine vom sonst üblichen wissen50 schaftlichen Vorgehen abweichende Denkmetho51 52 dik notwendig, um zu erklären, warum jemand zu einem Zeitpunkt etwas Bestimmtes getan hat oder nicht. Mit Recht kann gefragt werden, wie die Anwendung allgemeiner Prinzipien der Individualität des Menschen gerecht werden soll. Hier ist zu beachten, dass die Prinzipien des Lernens einen formalen und weniger einen inhaltlichen Charakter haben. Sie beziehen sich darauf, wie und unter welchen Bedingungen gelernt wird, aber weniger darauf, was gelernt wird. Die Lerntheorie liefert also nur den formalen Rahmen, um zu verstehen, wie Lernvorgänge ablaufen und wie menschliches Verhalten erklärt werden kann. Dieser Rahmen muss dann in jedem Einzelfall anhand der individuellen Lern- und Lebensgeschichte eines Individuums mit Inhalt gefüllt werden. Experimentelle Methode. Experimentelles Vorgehen bedeutet, dass man die aus der Lerntheorie abgeleiteten Hypothesen und die Wirksamkeit der eingesetzten Therapiemethoden ständig am Therapieverlauf überprüft. Wenn aus der Verhaltensanalyse eines Symptoms eine bestimmte therapeutische Intervention abgeleitet wird, so ist deren Anwendung zugleich eine Überprüfung der vorausgegangenen Hypothesen. Wenn z.B. eine Angstsymptomatik nach einer korrekt durchgeführten Expositionstherapie bestehen bleibt, ist davon auszugehen, dass eine der Hypothesen, die über die Aufrechterhaltung des Symptoms gemacht wurden, falsch oder nicht hinreichend war. Möglicherweise wurden z.B. soziale Verstärker der Angst zu wenig berücksichtigt. Das experimentelle Vorgehen verbietet daher, das Scheitern einer Intervention vorschnell mit Non-Compliance oder Widerstand des Patienten zu erklären. Orientierung am Einzelfall. Ausgangspunkt einer therapeutischen Intervention ist nicht die Zuordnung zu einer diagnostischen Kategorie, sondern die individuell durchgeführte Verhaltens- und Problemanalyse. Das für die jeweiligen Problembereiche vorhandene Störungswissen (z.B. Therapiemanuale) wird auf den Einzelfall zugeschnitten. Orientierung am Problem und an möglichen Lösungen. Die Behandlung setzt in der Regel an der vom Patienten geschilderten und aktuell bestehenden Problematik an. Dies schließt nicht aus, dass im Rahmen des Änderungsprozesses neue Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.6 Methoden der Verhaltenstherapie Problembereiche aktualisiert und in Absprache 1 mit dem Patienten ebenfalls Inhalte der Therapie 2 werden können. Hierbei soll nach Möglichkeit 3 nicht nur das aktuell bestehende Problem gelöst, 4 sondern auch die Problemlösekompetenz des Pa5 tienten allgemein erhöht werden. Dies kann durch 6 das Transparentmachen des therapeutischen Vor7 gehens und dessen Übertragung auf andere Prob8 lembereiche erfolgen. So kann z.B. ein erfolgrei9 ches Expositionstraining bei einem Agoraphobiker 10 dazu genutzt werden, das Prinzip der Angstbewäl11 tigung durch Habituation zu verdeutlichen. Dies 12 kann er dann später auch in anderen Angstsitua13 tionen anwenden. Ebenso kann der Patient daraus 14 die Erfahrung ziehen, dass er schwierige Situa15 tionen offensichtlich besser bewältigen kann, als 16 er es sich selbst zunächst zutraut. 17 18 Transparenz und Hilfe zur Selbsthilfe. Das Erar19 beiten eines gemeinsamen Problemverständnisses 20 ist Grundlage der Verhaltenstherapie. Therapeuti21 sche Strategien werden offen gelegt und dem Pa22 tienten transparent gemacht, sowohl um seine Be23 reitschaft zur Mitarbeit zu erhöhen als auch, um 24 ihm dieses Wissen zur Erarbeitung eigener Prob25 lemlösestrategien zur Verfügung zu stellen. Im 26 Sinne des Selbstmanagement-Ansatzes soll der Pa27 tient zum Experten für die Lösung seiner Probleme 28 gemacht werden. Mit der Erreichung der verein29 barten Therapieziele endet der Behandlungsauf30 trag. Verhaltenstherapie soll Hilfe zur Selbsthilfe 31 und nicht dauerhafte Lebensbegleitung sein. 32 33 34 1.6 Methoden der 35 Verhaltenstherapie 36 37 Bereits eine kurz gefasste Darstellung der einzel38 nen verhaltenstherapeutischen Methoden und 39 Techniken würde den Rahmen dieses Buches 40 sprengen. Deshalb werden nur einige wenige Me41 thoden dargestellt, die als paradigmatisch für das 42 Verfahren insgesamt gelten können. Darüber hi43 naus sei auf die Darstellung von Behandlungs44 methoden in den folgenden Kapiteln und auf die 45 weiterführende Literatur (z.B. Margraf 2000; 46 Reinecker 2005; Linden u. Hautzinger 2004) ver47 wiesen. 48 49 50 51 52 1.6.1 13 Systematische Desensibilisierung Wenn eine Angstreaktion auf harmlose Reize eine klassisch konditionierte Reaktion ist, so kann diese durch Löschung wieder beseitigt werden. Eine konditionierte Reaktion auf einen konditionierten Reiz wird dadurch gelöscht, dass dieser Reiz häufig ohne den unkonditionierten Reiz dargeboten wird. Da eine wesentliche Bedingung für die Aufrechterhaltung der Angst in einer Angst verstärkenden physiologischen Reaktion besteht, müssen die Reize in einer niedrigen Intensität dargeboten werden, die diese Komponente nicht auslöst. Gleichzeitig wird durch Einsatz eines Entspannungsverfahrens ein angstinkompatibler Zustand erzeugt. Diesem Prinzip entspricht das abgestufte Vorgehen bei der Systematischen Desensibilisierung. Dieses Verfahren steht am Ursprung der Verhaltenstherapie und führte die Progressive Muskelentspannung in die Verhaltenstherapie ein (Wolpe u. Lazarus 1966). Es wird eine Hierarchie Angst auslösender Reize erstellt und dargeboten, wobei sichergestellt wird, dass es zu keiner ausgeprägten physiologischen und erlebnismäßigen Aktivierung kommt. Erst wenn eine Stufe der Hierarchie sicher toleriert wird (bei einem Spinnenphobiker z.B. das Betrachten der Abbildung einer Spinne), kommt der nächste Schwierigkeitsgrad zum Einsatz. (z.B. Spinne hinter einer Glasscheibe). Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwendig, außerdem lernt der Patient hierbei keine Strategien zur Angstbewältigung. Deshalb hat die systematische Desensibilisierung inzwischen eher historische Bedeutung und wird nur noch eingesetzt, wenn eine Kontraindikation gegen Konfrontationsverfahren besteht. 1.6.2 Konfrontationsverfahren Die Reizkonfrontation gehört zu den wirksamsten und am besten evaluierten Psychotherapieverfahren überhaupt. Grundprinzip ist die Konfrontation mit einem Angst auslösenden Reiz, die solange aufrechterhalten wird, bis der Patient einen deutlichen Rückgang der Angst verspürt (Habituation). Flooding. Die Methode der massierten Konfrontation (Flooding) beinhaltet die Konfrontation mit einem Angst auslösenden Reiz in seiner stärksten Ausprägung. Der Patient wird dann daran gehin- Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 14 1 Grundlagen dert, den Reiz zu vermeiden, was dazu führt, dass 1 die physiologischen Reaktionskomponenten ab2 klingen und der Patient die Erfahrung macht, dass 3 er in Anwesenheit der Angst auslösenden Reize ru4 higer wird. Hierbei muss unbedingt darauf geach5 tet werden, dass der Patient so lange in der Angst 6 auslösenden Situation verbleibt, bis er einen deut7 lichen Angstabfall verspürt. Deshalb kann eine Ex8 positionssitzung auch mehrere Stunden dauern. 9 Andernfalls wird das Vermeidungslernen verfes10 tigt und die Störung chronifiziert. 11 In diese Falle geraten viele Patienten, die sich 12 ohne therapeutische Begleitung Angstsituationen 13 aussetzen oder die von nicht qualifizierten Hilfs14 kräften begleitet werden, die nicht auf verdecktes 15 Vermeidungsverhalten achten oder die Übung zu 16 früh abbrechen. Am Beispiel Spinnenphobie be17 deutet dies, dass bereits in der ersten Expositions18 übung Körperkontakt mit Spinnen ausgehalten 19 werden muss. Voraussetzung hierfür ist eine ent20 sprechende Vorbereitung, in der dem Patienten 21 das Rational der Methode erklärt und das thera22 peutische Vorgehen abgesprochen wird. 23 Vorteile dieser Methode sind, dass die Erfah24 rung gemacht wird, dass die Angst überwunden 25 werden kann und dass allgemein wirksame Angst26 bewältigungsstrategien erlernt werden. Gegen27 über der systematischen Desensibilisierung be28 deutet dies: 29 schnelleren Wirkungseintritt, 30 bei Widerauftreten von Angst weiß der Patient, 31 wie er damit umgehen kann, 32 bei unterschiedlichen Angstauslösern müssen 33 nicht mehrere Hierarchien durchlaufen wer34 den, sondern es reichen auch hier einige wenige 35 Expositionssitzungen mit Instruktion zum ei36 genständigen Training. 37 38 Bei der abgestuften Exposition wird mit einem 39 Reiz begonnen, der zwar starke, aber nicht maxi40 male Angst auslöst. Diese Variante kann eingesetzt 41 werden, wenn sich für die massierte Konfrontation 42 keine Motivation aufbauen lässt. Die besten Er43 gebnisse mit der Konfrontation in vivo werden 44 bei allen Phobien sowie bei Zwangshandlungen er45 zielt. Bei der Therapie von Zwängen werden die 46 Patienten ebenfalls einem starken Angstauslöser 47 ausgesetzt (z.B. Berühren „kontaminierter“ Ge48 genstände oder Verlassen der Wohnung ohne Kon49 trollritual), anschließend wird die bisherige Stra50 tegie zur Spannungsreduktion (z.B. Waschritual 51 oder nach Hause fahren und Kontrollritual durch52 führen) verhindert, bis die sich dabei aufbauende Spannung nachlässt (also wiederum Habituation eintritt). Eine Alternative stellt die Konfrontation in sensu, also mit Hilfe imaginativer Techniken, dar. Sie hat sich als effektive Behandlungsmethode bei der posttraumatischen Belastungsstörung (Traumakonfrontation), bei der generalisierten Angststörung (Sorgenkonfrontation) oder bei Zwangsgedanken erwiesen. 1.6.3 Stimuluskontrolle Ansatzpunkt der Stimuluskontrolle ist das S, also der Beginn der S-O-R-C-Kette. Die Patienten lernen hierbei, die Auslösesituation für ein bestimmtes Problemverhalten zu identifizieren, um sie dann modifizieren oder kontrollieren zu können. Für einen Patienten mit Essanfällen könnte dies bedeuten, generell nicht mehr in der Küche, sondern nur noch am Esstisch zuvor portionierte Mahlzeiten zu essen. Fallbeispiel Frau R. neigte zeitweise dazu, morgens bereits vor dem Fernseher „kleben“ zu bleiben, wodurch sie ihr vorgenommenes Tagespensum nicht schaffte und zunehmend depressiv wurde. Sie wandte erfolgreich Stimuluskontrolle an, indem sie nicht mehr auf dem Sofa vor dem Fernseher, sondern in der Küche frühstückte und anschließend mit ihrem Trainingsprogramm begann. 1.6.4 Kognitive Verfahren Kognitives Umstrukturieren. Ein zentrales Element der Aufrechterhaltung psychischer Störungen sind nach der kognitiven Theorie von Beck die bereits oben beschriebenen automatischen Gedanken. Entscheidend ist hierbei, dem Patienten nicht einfach zu widersprechen oder ihn zu belehren, sondern mit ihm gemeinsam seine dysfunktionalen Gedanken zu hinterfragen, hierbei logische Fehler aufzuspüren und alternative Erklärungen für die Symptomatik zu finden. Ein Fallbeispiel hierzu findet sich in Kap. 16. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 1.6 Methoden der Verhaltenstherapie Fallbeispiel 1 2 Frau R. hatten schon viele Ärzte erklärt, dass ihre Sym3 ptome kein Hinweis auf eine akute Abstoßung sind 4 und meist war sie sich auch selbst darüber klar. Bei ei5 nem Panikanfall konnte sie dieses Wissen aber nicht 6 anwenden. Erst das wiederholte Hinterfragen ihrer 7 Angst auslösenden Überzeugungen in der Therapie 8 half ihr, auch beim Auftreten von Panik davon abzu9 rücken. 10 11 12 Eine weitere Hilfe bei der Entscheidung zwischen 13 zwei Erklärungen kann die Durchführung von Ver14 haltensexperimenten sein. 15 Die Technik des Entkatastrophisierens zeigt 16 eine kurze Fallsequenz: Eine Patientin hatte we17 gen chronischer Rückenschmerzen seit Jahren alle 18 geselligen Anlässe vermieden, worunter sie sehr 19 litt. Als Befürchtung nannte sie: „Dann könnten 20 meine Schmerzen schlimmer werden.“ Weiter als 21 zu diesem Punkt hatte sie bisher nicht gedacht, da 22 ihr selbstverständlich war, alles zu vermeiden, was 23 zu einer Schmerzverstärkung führen könnte. Auf 24 die Frage, was geschehen würde, wenn die Be25 fürchtung tatsächlich einträfe, antwortete sie: 26 „Dann müsste ich schlimmstenfalls früher gehen.“ 27 Ihr war klar, dass das Eintreten der Befürchtung 28 weniger belastend war als ihr freiwilliger Rückzug 29 und sie begann, wieder auszugehen. 30 31 Stress-Bewältigung. Auch die in Kapitel 13 aus32 führlich beschriebene Stressbewältigung ist den 33 kognitiven Verfahren zuzurechnen. 34 35 Selbstkontrolltraining. Insbesondere in der Prä36 vention und Rehabilitation haben Selbstkontroll37 techniken für den Abbau von Risikoverhalten bzw. 38 den Aufbau von gesundheitsförderndem Verhalten 39 eine erhebliche Bedeutung. Kanfer hat drei Kompo40 nenten des Selbstkontrolltrainings genannt: 41 Selbstbeobachtung (Self Monitoring): Es er42 folgt eine genaue Analyse des Verhaltens und 43 seiner kontrollierenden Bedingungen sowie 44 eine Aufzeichnung seines Auftretens. 45 Bewertung und Zielanalyse: Es werden Ziel46 vorstellungen erarbeitet und das tatsächliche 47 Verhalten anhand der Aufzeichnungen des Ver48 haltens bewertet. Dabei muss darauf geachtet 49 werden, dass beim schrittweisen Verändern 50 des Verhaltens die Bewertung an Zwischenzie51 len erfolgt und nicht am endgültig anzustre52 15 benden Ziel, um Misserfolgserlebnisse zu vermeiden. Selbstverstärkung: Der Patient wird angehalten, sich nach einer erbrachten Leistung selbst zu loben, oder es werden äußere Verstärker eingeführt. Euthyme Therapie. Dieser Behandlungsansatz wird in Kap. 9 beschrieben. Multimodale Therapie. Es hat sich gegenüber den Anfängen der Verhaltenstherapie gezeigt, dass die Anwendung isolierter Techniken zwar durchaus einen Effekt hat, dass dieser Erfolg jedoch größer ist, wenn Verhalten auf mehreren Ebenen betrachtet und beeinflusst wird. Für zahlreiche Krankheitsbilder wurden daher spezifische, multimodale Therapiemanuale entwickelt und erprobt, die Module mit unterschiedlichen therapeutischen Zielsetzungen und Strategien miteinander kombinieren. Verhaltenstherapeutische Gruppen. Störungsspezifische Programme standen auch in den 60er- und 70er-Jahre am Anfang der Entwicklung verhaltenstherapeutischer Gruppentherapie, wobei zunächst Konzepte der Einzeltherapie auf das Gruppensetting übertragen wurden. In einem nächsten Schritt wurden störungsspezifische, multimodale Gruppenprogramme entwickelt und evaluiert. Um auch Patienten mit komplexen Störungsbildern und Behandlungssettings, die keine Störungshomogenität ermöglichen können, gerecht zu werden, kamen zieloffene, kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppen hinzu (Fiedler 1996). Allen diesen Konzepten ist gemeinsam, dass der therapeutische Fokus nicht auf gruppendynamischen Prozessen und den Beziehungen der Gruppenteilnehmer untereinander liegt, sondern dass Lösungsansätze für psychische Probleme eines oder mehrerer Gruppenteilnehmer erarbeitet werden. Somit bilden Themen aus dem Lebensalltag der Teilnehmer und nicht das Geschehen in der Gruppe den Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit. Im Sinne einer „Einzeltherapie in der Gruppe“ kann hierbei der Aufmerksamkeitsfokus von Teilnehmer zu Teilnehmer wechseln. Die Gruppentherapie bietet gegenüber der Einzelarbeit neben dem ökonomischen Aspekt spezifische zusätzliche therapeutische Möglichkeiten, wie: Feedback von anderen Gruppenteilnehmern empfangen und diesen geben können. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 16 1 Grundlagen Rollenspiele und andere gruppenspezifische 1 Techniken 2 Die Problemlöseressourcen der übrigen Teil3 nehmer werden für den einzelnen nutzbar 4 Modellernen, Selbstverpflichtung 5 Erfahrung von Solidarität und wechselseitiger 6 Unterstützung 7 8 Nahezu unverzichtbar ist Gruppenarbeit in Berei9 chen wie dem Training sozialer Kompetenz oder 10 dem Selbstsicherheitstraining. Problematisch ist, 11 dass trotz dieser Vorteile das Gruppensetting sel12 tener eingesetzt wird, als es nach den Befunden 13 der Psychotherapieforschung wünschenswert wä14 re. Eine Ursache hierfür ist in einem Honorierungs15 system zu sehen, das insbesondere Kurzzeit-Grup16 pentherapie zunehmend unattraktiv macht. 17 18 19 Literatur 20 21 Bandura, A.: Self-efficacy: Toward a unifying theory of 22 behavioral change. Psychol. Rev. 84 (1977) 191–215. Beck, 23 A.T.: Depression: Clinical, experimental and theo24 retical aspects. Harper & Row, New York, 1967. Fiedler, P.: Verhaltenstherapie in und mit Gruppen. 25 Beltz, Weinheim, 1996. 26 Görlitz G.: Körper und Gefühl in der Psychotherapie – 27 Basisübungen. Reihe Leben Lernen, Bd. 120. Pfeiffer, 28 München, 1998 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Grawe, K.: Psychologische Therapie. Hogrefe, Göttingen, 1998. Greenberg L.: Von der Kognition zur Emotion in der Psychotherapie. In Lenz G., Sulz S.K.D. (Hrsg.): Von der Kognition zur Emotion. Psychotherapie mit Gefühlen. Cip-Medien, München, 2000, S. 77-110 Kanfer, F. H., Reinecker, H., Schmelzer, D.: Selbstmanagement – Therapie (2. Aufl.). Springer, Berlin, 1996. Kanfer, F.H., J.S. Phillips: Learning, Foundations of Behavior Therapy. Wiley, New York 1970. LeDoux J.: Das Netz der Persönlichkeit. Wie unser Selbst entsteht. Walter-Verlag, Düsseldorf, 2003 Linden, M., Hautzinger M. (Hrsg.): Verhaltenstherapie – Manual. Springer, Berlin, 2004. Linehan M.: Dialektisch-behaviorale Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Cip-Medien, München, 1996 Margraf, J. (Hrsg.) Lehrbuch der Verhaltenstherapie, 2 Bände, Springer, Berlin, 2000. Pavlow, I.P.: Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. Oxford University Press, 1927. Pennebaker J.W.: Putting stress into words: health, linguistic, and therapeutic implications. Prochaska, J., C. DiClemente: Stages and Process of Self Change of Smoking: Towards an Integrative Modell of Change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54 (1983), S. 390–395. Reinecker, H.: Verhaltenstherapie. In: W. Senf, M. Broda, Praxis der Psychotherapie. Thieme, Stuttgart (2005), S. 260–304 Skinner, B.F.: Science and human behavior: Free Press, New York 1953. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG