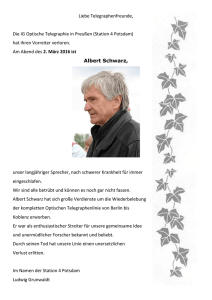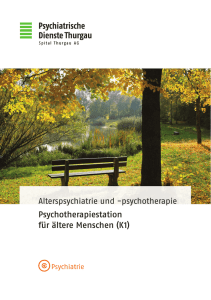Ueda (48435) / p. 1 /2.5
Werbung

Ueda (48435) / p. 1 /2.5.10 WELTEN DER PHILOSOPHIE A Ueda (48435) / p. 2 /2.5.10 Dieser Band vereint die kleineren deutschen Texte des japanischen Philosophen Shizuteru Ueda. Die meisten sind in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden erschienen und heute schwer zugänglich. Einige sind erst für dieses Buch verfasst worden. Das Themenspektrum reicht von Leere und Fülle, Erfahrung und Sprache über Tod und Selbst zu Schweigen und Gelassenheit, Freiheit, Wahrheit und Schönheit. In diesem Spannungsbogen entwickelt Ueda sein Verständnis des Zen aus der Perspektive des europäischen Denkens. Zugleich eröffnen sich Möglichkeiten der Vertiefung des europäischen Denkens durch die Erfahrung des Zen. Der Autor: Shizuteru Ueda, geboren 1926 in Tokyo als Sohn eines Shingon-Priesters, Studium der Philosophie bei Keiji Nishitani an der Universität Kyoto, 1959–63 Studium bei Friedrich Heiler und Ernst Benz an der Universität Marburg, Dissertation über »Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit: Die mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit der Mystik des Zen-Buddhismus«, 1964 Professor für Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Kyoto, 1977 Lehrstuhl für Philosophie und Religion an der Universität Kyoto. Als Repräsentant der dritten Generation der KyotoSchule führt er das Erbe Kitaro Nishidas weiter. Ueda (48435) / p. 3 /2.5.10 Shizuteru Ueda Wer und was bin ich? Ueda (48435) / p. 4 /2.5.10 Welten der Philosophie 6 Wissenschaftlicher Beirat: Claudia Bickmann, Rolf Elberfeld, Geert Hendrich, Heinz Kimmerle, Kai Kresse, Ram Adhar Mall, Hans-Georg Moeller, Ryôsuke Ohashi, Heiner Roetz, Ulrich Rudolph, Hans Rainer Sepp, Georg Stenger, Franz Martin Wimmer, Günter Wohlfahrt, Ichirô Yamaguchi Ueda (48435) / p. 5 /2.5.10 Shizuteru Ueda Wer und was bin ich? Zur Phänomenologie des Selbst im Zen-Buddhismus Verlag Karl Alber Freiburg / München Ueda (48435) / p. 6 /2.5.10 Originalausgabe © VERLAG KARL ALBER in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011 Alle Rechte vorbehalten www.verlag-alber.de Satz: SatzWeise, Föhren Druck und Bindung: AZ Druck und Datentechnik, Kempten Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier (säurefrei) Printed on acid-free paper Printed in Germany ISBN 978-3-495-48435-7 Ueda (48435) / p. 7 /2.5.10 Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 Leere und Fülle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Zum Selbstgewahrnis des wahren Selbst . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . 38 3 Das In-der-Doppelwelt-Wohnen Der Ort des Menschen nach dem Zen . . . . . . . . . . . 72 4 Was ist Zen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5 Tod im Zen-Buddhismus Eine Besinnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 6 Erfahrung und Sprache in Hinsicht auf die Problematik ›Glaube und Mystik‹ . . . . . 134 7 Schweigen und Sprechen im Zen-Buddhismus . . . . . . . . 145 8 Das Reale bzw. A-Reale im Sprechen des Zen Zu einem Gedicht eines Kindes . . . . . . . . . . . . . . 165 9 Meister Eckhart und Zen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 10 Wer und was bin ich? Phänomenologie des Selbst in der Perspektive des Zen-Buddhismus Zusammenfassende Wiederholung im Grundriss . . . . . . 193 Vorwort 2 Die zen-buddhistische Erfahrung des Schönen Nachwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Veröffentlichungen in deutscher Sprache . . . . . . . . . . . . . 219 7 Ueda (48435) / p. 8 /2.5.10 Ueda (48435) / p. 9 /2.5.10 Vorwort Die Aufsätze dieses Buches haben im Grunde zwei Teile bzw. Perspektiven, erstens theoretische Grundlagen des jeweiligen Themas und zweitens Beispiele aus der fernöstlichen Kulturgeschichte. Bei den theoretischen Grundlagen kommt es darauf an, in Orientierung an der westeuropäischen Philosophie, manchmal an einer bestimmten Philosophie wie z. B. der Heideggers, diese zu modifizieren und zu bearbeiten, um dann ein Beispiel aus der klassisch-chinesischen bzw. japanischen Kulturgeschichte wie z. B. das Nō-Theater oder das sog. Renku ›Anschlussgedicht‹ darstellen und interpretieren zu können. Im zweiten Teil bzw. in der zweiten Perspektive kommt es umgekehrt darauf an, Beispiele aus der japanischen Kulturgeschichte in einem weiteren Horizont zu begreifen und ihre mögliche Bedeutung für die gegenwärtige Welt zu entwerfen. In der Erörterung herrscht also ein zweifaches ›Zwischen‹ – erstens thematisch zwischen West und Ost und zweitens in der Darstellung zwischen der deutschen und der japanischen Sprache. Obwohl ursprünglich japanische Begriffe und Formulierungen hier in Deutsch wiedergegeben sind, wurden nicht japanische Texte ins Deutsche übertragen. Vielmehr sind die deutschen Texte als solche von Anfang an in Deutsch verfasst worden. Um so tiefer ist die Kluft zwischen der Welt der darstellenden deutschen Sprache und der Welt der dargestellten Sachen, die als solche zu der Welt des Japanischen gehören. Die Aufsätze dieses Buches stellen Versuche dar, thematisch-inhaltliche Brücken zwischen West und Ost zu bauen und zwar zugleich zwischen der deutschen und japanischen Sprache je den Bedeutungshorizont irgendwie zu erweitern. Zu diesem zweifachen horizontalen ›Zwischen‹ kommt nun ein drittes anderer Art, nämlich das vertikale ›Zwischen‹ von Philosophie und Religion, da das Thema der einzelnen Kapitel gerade auf Philosophie und Religion übergreift. 9 Ueda (48435) / p. 10 /2.5.10 Vorwort Jeder Aufsatz unternahm also eine Erörterung an einem unsichtbaren Ort an der Kreuzung des Horizontalen mit dem Vertikalen. Das ging nicht glatt und nicht problemlos, worüber der Verfasser sich bewusst sein musste. Er war nicht immer sicher, ob ihm die Ausführungen wirklich gelangen. Er wäre deshalb den Lesern dankbar, wenn er ihr Interesse für das genannte dreifache ›Zwischen‹ als Ort des Denk-würdigen wecken könnte. Der Verfasser möchte in Zukunft weitere Grundprobleme in dem dreifachen ›Zwischen‹ erörtern wie z. B. ›Zeit und Geschichte‹ oder ›die Einzelnen, Gemeinschaft und Gesellschaft‹. 10 Ueda (48435) / p. 11 /2.5.10 1 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Zum Selbstgewahrnis des wahren Selbst 1 Die Formulierung »Leere und Fülle« soll eine buddhistische Modifikation unseres Generalthemas »Einheit und Verschiedenheit« darstellen. Der Kategorie »Einheit« liegt der Begriff »eins« zu Grunde. Der Buddhismus überschreitet sozusagen diesen zur »Null« zurück. Das Wort »śūnya«, das als buddhistischer Terminus die Leere besagt, bedeutet zugleich im mathematischen Bereich die Null. Diese ist zwar keine Größe, hat aber mehrfach entscheidende Funktionen in mathematischen Operationen. Entsprechend ist es mit dem Begriff der »Leere« im Existenzbereich. Andererseits wird die Kategorie der Verschiedenheit zu der der Fülle konkretisiert. Es geht nämlich nicht nur um die Verschiedenheit untereinander, sondern weiter um eine spezifische Vollkommenheit eines jeden Einzelnen und um die konkrete Fülle des Ganzen. Radikalisierung zur Null einerseits und Konkretisierung zur Fülle andererseits, diese beiden gehören hier also zusammen. Auf der Grundlage dieser Zusammengehörigkeit wird auch im Buddhismus die Problematik »Einheit und Verschiedenheit« in verschiedenen Hinsichten erörtert. Die genannte Zusammengehörigkeit der Null, der Leere oder auch – im philosophischen Terminus: des absoluten Nichts – einerseits und der Fülle andererseits, diese Grundzusammengehörigkeit ist nun im buddhistischen Denken ursprünglich und eigentlich eine existenziale Kategorie, – eine existenziale Kategorie, die zum Selbstinnewerden des Selbst gehört, das seinerseits sein Selbst nicht in sich selbst, sondern gerade in der betreffenden Zusammengehörigkeit hat. In der Geschichte des Buddhismus ist es der Zen-Buddhismus, der die inzwischen mehrfach spekulativ entfaltete Zusammengehörigkeit wieder in ihren ursprünglichen lebendigen Existenzbereich zurückgeführt hat. Ursprünglich »Leere und Fülle. Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus. Einheit und Verschiedenheit«, hrsg. A. Portmann u. R. Ritsema, in: Eranos 45 (1976) 1980, S. 135–163. 1 11 Ueda (48435) / p. 12 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus So möchte ich versuchen, das Thema »Leere und Fülle« zunächst im ursprünglichen existenzialen Zusammenhang auszuführen und zwar hauptsächlich anhand von Beispielen aus dem Zen-Buddhismus zu behandeln, wobei ich zur Erklärung sowohl die Mahāyāna-Philosophie als auch die moderne japanische Philosophie heranziehe. Was ist unser Selbst? Wie ist es mit unserem Selbst? Zur Erhellung dieser Frage möchte ich mich der Anschaulichkeit halber auf einen kleinen altchinesischen Zen-Text, eine Art Bilderbuch, stützen, weil ich hoffe, auf diese Weise der Sache selbst angemessen näher zu kommen, ohne unvermittelt und unvorbereitet in eine Begrifflichkeit der abstrakten Ebene zu gleiten. Die Begrifflichkeit soll zwar zur Klarheit führen, führt aber manchmal in die Irre, wenn es an notwendigen Vorkenntnissen fehlt, insbesondere wenn es sich um eine Sache einer anderen kulturellen Welt handelt. Unser Thema gehört ursprünglich zum Selbstverständnis des ostasiatischen Menschen, dessen Begriffswelt sich in der altchinesischen und der japanischen Sprache ausdrückte, während es hier in der deutschen Sprache dargestellt wird. Die Kluft zwischen der darzustellenden ostasiatischen Sache und der darstellenden westlichen Sprache verlangt besondere Vorsicht sowohl vom Verfasser als auch von den Lesern. Unter diesen Umständen hilft uns vielleicht die Heranziehung einer Art Bilderbuch als eines grundlegenden Textes. I 1) Der Text stammt aus dem 12. Jahrhundert und heißt in der deutschen Übersetzung »Der Ochs und sein Hirte«. 2 Von diesem Text wird noch heute in japanischen Zen-Kreisen viel Gebrauch gemacht. Er stellt den Vorgang der Selbstrealisierung des Menschen in zehn Stationen anschaulich dar. Der Text gibt zu jeder Station ein kurzes Vorwort, eine Tuschezeichnung in einem kreisförmigen Rahmen und eine bündige Erklärung in Gedichtform. Jede Zeichnung zeigt anschaulich eine Der Ochs und sein Hirte. Eine altchinesische Zen-Geschichte. Erläutert von Meister Daizohkutsu R. Ohtsu mit japanischen Bildern aus dem 15. Jahrhundert, übers. von K. Tsujimura und H. Buchner, Pfullingen 2. Aufl. 1958, 4. Aufl. 1981. D. T. Suzuki, The Ten Oxherding Pictures I & II, in: Manual of Zen Buddhism, New York 1960, S. 127–144. 2 12 Ueda (48435) / p. 13 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus bestimmte Weise und Dimension der Existenz auf dem Weg zum wahren Selbst. Im Titel »Der Ochs und sein Hirte« ist der Ochse ein vorläufiges Symbol für das gesuchte wahre Selbst, und der Hirte stellt den Menschen dar, der sich um das wahre Selbst bemüht. Hier sollte gleich darauf hingewiesen werden, dass die Gestalt des Ochsen trotz des Titels »Der Ochs und sein Hirte« bzw. »Ten Oxherding Pictures« nicht in allen zehn Zeichnungen erscheint, sondern nur in vier. Dieses Verhältnis ist für das zen-buddhistische Verständnis des Selbst entscheidend wichtig. Ich werde später darauf zurückkommen. Die Titel des ersten Teils lauten: 1. »Die Suche nach dem Ochsen«, 2. »Das Finden der Ochsenspur«, 3. »Das Finden des Ochsen«, 4. »Das Fangen des Ochsen«, 5. »Das Zähmen des Ochsen« und 6. »Die Heimkehr auf dem Rücken des Ochsen«. Auf diese Weise wird die Beziehung des Hirten zum Ochsen immer enger und intimer bis zur 7. Station, wo die Einswerdung erreicht wird und der Mensch sich nicht mehr den Ochsen als Vereinigungsobjekt vorstellt. Das Selbst, so wie es und so weit es in dem Ochsen symbolisiert wird, ist jetzt realisiert worden, wodurch der Ochse als Symbol für das Selbst aufgehoben wird. Der Titel der 7. Station heißt »Der Ochse ist vergessen, der Hirte bleibt.« In der Zeichnung dazu ist der Ochse verschwunden und allein der Mensch bleibt da, wie dieser »ruhig und gelassen zwischen Himmel und Erde sein eigener Herr ist«. Die Strecke von der 1. bis zur 7. Station in ihrer Steigerung von Stufe zu Stufe zeigt nacheinander Stadien der buddhistischen Lehren, Einübung in die Versenkung, anstrengende und angespannte Zucht, Einswerdung in Glückseligkeit usw. Mit der 7. Station ist aber noch nicht das wahre Selbst realisiert, wie es der Zen-Buddhismus versteht. Wir sind immer noch unterwegs auf dem Weg zum Selbst, um mit einem entscheidenden Sprung einen Durchbruch zur 8. Station zu erreichen. Jetzt kommt aber mit der 8. Station das Charakteristische des wahren Selbst in der zen-buddhistischen Auffassung ausdrücklich zum Vorschein. 2) Die 8. Station, »Vollkommene Vergessenheit des Hirten und des Ochsen« oder »Doppelte Vergessenheit«, ist durch eine merkwürdige Zeichnung dargestellt, nämlich durch einen »leeren Kreis«, der nichts enthält, weder Hirte noch Ochs, überhaupt nichts. Auf diese Leerheit, in der nichts gezeichnet ist, kommt es hier in diesem Zusammenhang an. Nichts gezeichnet, das bedeutet das absolute Nichts, das hier über die 7. Station hinausgehend zunächst die absolute Negation bedeutet. 13 Ueda (48435) / p. 14 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Das absolute Nichts besagt aber im Buddhismus nicht, dass es überhaupt nichts gäbe. Es soll vielmehr den Menschen vom substantialisierenden Denken und vom substantialisierenden Selbstergreifen befreien. Für den Buddhismus liegt dem substantialisierenden Denken die Selbstsubstantialisierung des Menschen zugrunde, die seine verborgene Wurzel im Ich als solchem hat, in der Ich-Verhaftetheit. Das Ich wird in der buddhistischen Lehre als Ich-Bewusstsein verstanden und die elementarste Weise des Ich-Bewusstseins lautet: »Ich bin ich«, und zwar in der Weise: »Ich bin ich, denn ich bin ich.« Dieses »ich bin ich«, das seinen Grund wieder im »ich bin ich« hat und derart in sich geschlossen und verschlossen ist, dieses Ich-bin-ich gilt mit seiner so genannten dreifachen Selbstvergiftung, nämlich Hass gegen Andere, Grundblindheit über sich selbst und Habgier, als Grundverkehrtheit und Unheilsgrund des Menschen. Demgegenüber würde das wahre, d. h. im buddhistischen Verständnis selbst-lose, Selbst von sich sagen: »Ich bin ich und zugleich bin ich nicht ich« (nach der Formulierung von K. Nishitani) oder: »Ich bin ich, weil ich nicht ich bin« (Suzuki). Alles kommt auf die vollkommene Auflösung des geschlossenen, verschlossenen Ich-bin-ich, auf die endgültige Loslösung von der Ich-Fessel an. Der Ich-Mensch soll endgültig sterben um des wahren, selbst-losen Selbst willen. Der Weg von der 1. zur 7. Station ist zugleich der Prozess der Loslösung vom Ich-bin-ich. Wenn der Mensch aber auf der 7. Station, wo er als er selbst da ist, d. h. wo er noch als er selbst da ist, in Selbstgenügsamkeit und Selbstsicherheit stehen bleibt, fällt er mit seinem Selbstbewusstsein »ich bin jetzt, was ich sein soll« wieder in das verborgene Ich-bin-ich zurück, eine sublimere Form des religiösen Egoismus sozusagen. Auch seine eigene Religion zu lassen, das ist hier das letzte religiöse Anliegen. Daher führt die 8. Station ein für allemal mit einem entschiedenen, entschlossenen Sprung ins absolute Nichts, in dem weder der suchende Hirte noch der gesuchte Ochs, weder Mensch noch Buddha, weder Dualität noch Einheit ist. Übrigens sei in diesem Zusammenhang auf Meister Eckharts Gedanken hingewiesen: Gott vergessen, Gott lassen; von der Vereinigung mit Gott weg zum Nichts der Gottheit, das gleichzeitig der Grund der Seele ist. Der Mensch soll also, um zum Durchbruch zum wahren Selbst zu gelangen, dessen unbedingter Selbst-losigkeit entsprechend, nun alle bis dahin erreichten religiösen Einsichten und Erfahrungen ganz lassen, seiner selbst wie auch des Buddhas ganz ledig werden und ein für allemal ins lautere Nichts ein-springen, d. h. »groß sterben«, wie es im 14 Ueda (48435) / p. 15 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Zen-Buddhismus heißt. Im Begleittext zur Zeichnung des leeren Kreises heißt es: »Alle weltlichen Begierden sind abgefallen. Zugleich hat sich auch der Sinn der Heiligkeit völlig entleert. Verweile nicht vergnügt am Ort, wo der Buddha wohnt. Geh rasch vorbei an dem Ort, in dem kein Buddha mehr wohnt.« »Mit einem Schlag bricht jäh der große Himmel in Trümmer. Heiliges, Weltliches spurlos entschwunden.« Das drückt diese 8. Zeichnung aus. Nun darf das buddhistische Nichts, ein alles Substanzdenken auflösendes Nichts, nicht als das Nichts festgehalten, nicht für eine Art Substanz, für Minus-Substanz sozusagen, d. h. für ein nihilum gehalten werden. Es geht um die entsubstantialisierende Bewegung des absoluten Nichts, um das Nichts des Nichts, oder in einem philosophischen Terminus um die Negation der Negation, und zwar um eine reine Bewegung des Nichts in zusammenhängender Doppelrichtung. Nämlich erstens als Negation der Negation im Sinne der weiteren Verneinung der Negation, ohne zur Bejahung umzukehren, weit ins unendlich offene Nichts und zweitens als Negation der Negation im Sinne der Umkehr zur Bejahung ohne jede Spur der Vermittlung. Das absolute Nichts bewährt sich als diese dynamische Zusammengehörigkeit der unendlichen Negation und der unmittelbaren schlichten Beja15 Ueda (48435) / p. 16 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus hung. Auf diese Zusammengehörigkeit kommt es einzig an. Das absolute Nichts bewegt sich als das Nichts des Nichts. Das absolute Nichts, das von der 7. Station her als deren absolute Negation wirkt, ist als solches nichts anderes als diese dynamische Zusammengehörigkeit der Negation mit der Bejahung. So ereignet sich in diesem Nichts als dem Nichts des Nichts eine Grundwendung und eine völlige Umkehr wie im »stirb und werde« oder in »Tod und Auferstehung«. 3) Die Zeichnung der nächsten und 9. Station stellt einen blühenden Baum am Fluss dar, nichts anderes. Dazu heißt es im Begleittext: »Die Blumen blühen, wie sie von sich selbst blühen, der Fluss fließt, wie er von sich selbst fließt.« Es geht um den Menschen in seinem wahren Selbst. Warum hier plötzlich ein blühender Baum am Fluss? Es handelt sich hier, da wir uns auf dem Weg des Selbst befinden, nicht um eine äußere, gegenständliche bzw. uns umgebende Landschaft, aber auch nicht um eine metaphorische Landschaft als Ausdruck eines inneren Zustandes des Menschen oder um eine Projektion einer inneren Seelenlandschaft, sondern um eine völlig neue Realität als eine Ver-gegenwärtigung des selbst-losen Selbst. Es handelt sich um die Auferstehung aus dem Nichts, um die radikale Wendung von der absoluten Negation zum großen »ja«. Ja, das ist es! Da auf der 8. Station die Subjekt-Objekt-Spaltung in jeder Gestalt zum Vor-der-Spaltung im Nichts zurückgelassen wurde, so ist hier bei der Auferstehung aus dem Nichts ein blühender Baum am Fluss nichts anderes als das Selbst, und zwar nicht im Sinne substanzieller Identität der Natur und des Menschen, sondern in dem Sinne, dass ein blühender Baum, so wie er blüht, die Selbst-losigkeit des Menschen auf nichtgegenständliche Weise verkörpert. Das Blühen des Baumes, das Fließen des Wassers ist hier also, so wie es sich ereignet, zugleich ein Spielen der selbstlosen Freiheit des Selbst. Die Natur, wie die Blumen blühen, wie der Fluss fließt, ist der erste Auferstehungsleib des selbst-losen Selbst aus dem Nichts. Hier kann nicht von Naturmystik bzw. von Pantheismus die Rede sein. »Die Blumen blühen, wie sie blühen.« Daran ist nichts Mystisches. Hier ist vielmehr unmittelbar und einfach »ein blühender Baum am Fluss«, nichts anderes. Es ist das Einfache, dem nichts gegenübersteht, dem nichts sich hinzufügt. Dieses Einfache entfaltet sich, ohne die Einfachheit seiner Realität zu verlieren, wie schon gesehen: »Die Blumen blühen, wie sie von sich selbst blühen«, oder, um noch ein Beispiel für einen Zen-Spruch zu geben: »Ferne Berge, grenzenlos, 16 Ueda (48435) / p. 17 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus grün über grün«. Wo ist aber der Ort, an dem sich das Einfache so entfaltet, wie es von sich selbst ist, ohne jedes angeblich höhere bzw. menschliche Zutun? Im Mu-Shin, wie es in einem klassischen sinojapanischen Terminus heißt, d. h. im Nichts des Herzens, oder ganz direkt übersetzt, im Nichts-Herzen, wobei das Herz, auf der 8. Station ins Nichts entworden und jetzt von dem Nichts auferstanden, nichts anderes als gerade diese blühenden Blumen ist. Blühende Blumen offenbaren sich, geben sich ganz, wie sie von sich selbst blühen, im Nichts des Herzens, nicht aber dem Ich-Menschen. Hier liegt aufgrund des Nichts eine eigentümliche Verbindung der Existentialität des Selbst mit der Objektivität des Seienden vor. Nach einer traditionellen Wendung wird die Existenz »zum Ding«. So lautet ein Zen-Spruch: »Unerschöpfliche Fülle des Nichts: Blumen blühen, der Mond scheint.« Dies ist das erste Modell für unser Thema »Leere und Fülle.« Das sino-japanische Äquivalent des Wortes »Natur«, »Shi-zen« oder »Ji-nen« nach der fachbuddhistischen Lesung, bedeutet eigentlich so viel wie: »So sein, wie es von sich selbst her ist.« Es bedeutet nicht die Natur als eine bestimmte Region des Seienden im Ganzen, sondern die Seinswahrheit alles Seienden. Wenn der Mensch in seinem Nichts, also nicht vom Ich her, z. B. Blumen so erfährt, wie sie von sich selbst 17 Ueda (48435) / p. 18 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus her blühen oder, noch unmittelbarer ausgedrückt, wenn im Nichts des Menschen Blumen gegenwärtig so blühen, wie sie von sich selbst her blühen, so west er in eins damit in seiner eigenen Seinswahrheit. Die Natur in diesem Sinne der So-wie-von-sich-selbst-her-heit ist im Buddhismus ohne weiteres gleichbedeutend mit der Wahr-heit (Sanskrit »Tathatā«, sino-japanisch »Shinnyo«, wörtlich übersetzt »Soheit«). Der zur Wahrheit Erwachte heißt »Tathāgata« (sino-jap. »Nyorai«), also derjenige, der kommt und geht in der So-heit, als welche die Natur »naturt«. Bei der Bewegung von der 8. zur 9. Station handelt es sich nicht mehr wie bei den vorausgegangenen Stationen um eine stufenweise Steigerung, sondern um eine Zusammengehörigkeit bzw. eine Hinund-her-Umwendung. Das Nichts in der 8. und das Einfache in der 9. Station gehören der Sache nach derart zusammen, dass sie – um in einem Gleichnis zu sprechen – die beiden Seiten eines Stücks Papier, eines Papiers bilden. Die beiden Seiten sind weder zwei noch eins. Es handelt sich um die zusammengehörige, ineinander-durchdrungene Doppelperspektive, nämlich: die Richtung von der 8. zur 9. Station »in eins mit« der entgegengesetzten Richtung von der 9. zur 8. Station, so dass es in einer umkehrbaren Doppelaussage heißt: »Blühende Blumen, das heißt das Nichts; das Nichts, das heißt blühende Blumen.« Die klassische Formulierung im Buddhismus lautet: »Das Formhafte ist das Leere, das Leere ist das Formhafte« (Sanskrit »Rūpaṁ śūnyatā śūnyataiva rūpam«, sino-jap. »Shiki soku ze kū, kū soku ze shiki«). Es geht demnach um das absolute Zusammenfallen des Nichts und des Formhaften, wobei aber die Betonung nicht in der Identität als solcher liegt – das wäre wieder eine irrige Substantialisierung – sondern in der zusammenhängenden Doppelperspektive, die ihrerseits mit »Tod und Auferstehung« im existentiellen Bereich zusammenhängt. Die eine Richtung, das Formhafte als das Nichts zu durchschauen, wird als die »Große Erkenntnis« bezeichnet, während die andere Richtung, in der das Nichts unmittelbar als das Formhafte konkretisiert wird, als die »Große Sympathie« bezeichnet wird. 4) In der 10. und letzten Station ist die zwischenmenschliche Begegnung ausdrückliches Thema. Hier wirkt und spielt das wahre Selbst, vom Nichts auferstanden, zwischen Mensch und Mensch als selbstlose Dynamik des »Zwischen«, wobei dieses »Zwischen« jetzt der eigene Spielraum, Spielinnenraum des Selbst ist. Das von dem absoluten 18 Ueda (48435) / p. 19 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Nichts aufgeschnittene, geöffnete Selbst entfaltet sich als das »Zwischen«. Die Zeichnung hier stellt dar, wie sich ein Greis und ein Junge auf der Weltstraße begegnen. Hier handelt es sich nicht um zwei verschiedene Menschen, die sich dann zufällig treffen: »Ein Greis und ein Junge«, das ist eine selbst-lose Selbstentfaltung des Greises selbst. Wie es einem Anderen geht, das ist jetzt das innere Anliegen des Selbst in seiner Selbst-losigkeit. Die Sache des Jungen, wie sie ist, ist die eigene Sache des Greises, der seinerseits für sich keine Sache hat. Die communio des gemeinsamen Lebens ist der zweite Auferstehungsleib des selbst-losen Selbst. Ich bin »Ich und Du«; »Ich und Du«, das bin ich. Es handelt sich um das Selbst als Doppelselbst auf Grund der Selbstlosigkeit. Das ist das zweite Modell für das Thema »Leere und Fülle.« Im Begleittext wird bemerkt: »Freundschaftlich kommt dieser Mensch – der Greis – aus einem fremden Geschlecht (das ist, aus dem absoluten Nichts). Er hat sein leuchtendes Wesen schon tief vergraben. Bald kommt er mit einem ausgehöhlten Kürbis, mit Wein gefüllt, zum Markt. Bald kehrt er mit seinem Stab in seine Hütte zurück. Wie es ihm gerade gefällt, besucht er Weinkneipen und Fischbuden, wo die anderen im Umgang mit ihm zu sich selbst erwachen.« Zur Begegnung mit anderen Menschen wohnt das wahre Selbst 19 Ueda (48435) / p. 20 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus nicht im so genannten »Nirvāna«, sondern auf der viel befahrenen und ˙ viel begangenen Weltstraße, ohne aber das absolute Nichts zu verlassen. Es handelt sich dabei wieder um die doppel-perspektivische Dynamik: auf der Weltstraße wie im Nichts, im Nichts wie auf der Weltstraße. Die unermüdliche ernste Bemühung um die anderen ist dabei gleichzeitig ein Spiel für sich selbst auf Grund des Nichts, ohne dass dabei durch den Spielcharakter jedoch die Bemühung und das Mitleiden Einbuße erlitten. Dies meint der Zen-Buddhismus mit der charakteristischen Doppelaussage, die nur logisch gesehen einen Widerspruch darstellt. Einerseits heißt es: »Die Lebewesen sind unermesslich. Wir geloben, sie alle zu retten.« Andererseits heißt es: »Es gibt kein Lebewesen, das wir retten sollen und gerettet haben, auch keine Rettung.« Oder: »Schade! Alle Welt wollte ich bisher retten. Erstaunen! Es gibt keine Welt mehr zu retten.« Das Selbstbewusstsein, die anderen gerettet zu haben, das allein würde die Rettung innerlich schon wieder verderben. Selber zum wahren Selbsterwachen zu gelangen, das bewährt sich darin, einen anderen erwachen zu lassen, und zwar so, dass dieser selber erwacht. Auf Grund des formlosen, weiselosen Nichts ist die Art und Weise der Begegnung hier wieder sehr charakteristisch. Wenn die Begegnung irgendwo unterwegs auf der Strecke zwischen der 1. und der 7. Station stattfindet, so wird über religiöse Themen gesprochen werden. Hier aber nicht. Der Greis predigt nicht, belehrt nicht, sondern stellt in der Begegnung wie auch beim Zusammensein einfach Fragen: »Woher bist du?«, »Was ist dein Name?«, »Wie geht es dir?«, »Hast du schon gegessen?«, »Siehst du diese Blumen?«, um einige Beispiele aus der Geschichte des Zen-Buddhismus zu nennen. Diese sind alle zunächst unauffällige, alltägliche Fragen. Ob der Andere aber in Wahrheit weiß, woher er überhaupt kommt? Ob der Andere Blumen wirklich so sieht, wie sie von sich selbst her blühen? Der Greis fragt und bei dem anderen wird die Frage nach sich selbst, nach dem wahren Selbst erweckt: »Wer bin ich eigentlich?« Der Andere fängt an, selber »nach dem Ochsen zu suchen«. So haben wir von neuem die 1. Station. Die 10. Station ist also nicht der Abschluss, sondern der Anfang der 1. Station für einen Anderen, für einen Jungen, dem der Greis in seinem offenen »Zwischen« begegnet und bei dem dadurch die Frage nach dem wahren Selbst erweckt wird. Es geht um die Überlieferung des Selbst, von Selbst zu Selbst. 20 Ueda (48435) / p. 21 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus 5) Sehen wir zurück: während es sich von der 1. bis zur 7. Station grundsätzlich um eine stufenweise Steigerung des Vorankommens auf dem Weg zum Selbst handelt, stellen die letzten drei Stationen keine Steigerungen mehr dar, sondern zeigen die dreifache Erscheinung, in der jeweils das-selbe sich verwandelnd, auf eigene Weise total gegenwärtig ist. Dieses Selbe, das selbst-lose Selbst, ist seinerseits nur insofern voll real, als es sich in dreifacher Verwandlung jeweils vollkommen anders realisieren kann: als das absolute Nichts, als das Einfache der Natur und als das Doppelselbst der Kommunikation. Die letzten drei Stationen bilden gleichsam die Drei-ein-heit des wahren Selbst. Das Selbst ist dabei nirgends »da«, sondern bewegt sich in Verwandlung, jeweils einem Anlass entsprechend und zugleich von sich aus, unbehindert einmal ins Nichts spurlos entwerdend, einmal z. B. bei Blumen als diese selbst-los blühend, einmal bei der Begegnung mit einem Anderen diese Begegnung selbst zu seinem eigenen Selbst machend. Im freien Wechsel der Aspekte der 8., 9. und 10. Station bezeugt sich die Nichtsubstantialität des Selbst. Nicht die bleibende Identität mit sich in sich selbst, sondern eine ek-statische Bewegung, mit der Ek-sistenz einen unsichtbaren Kreis von Nichts-Natur-Person zu zeichnen, diese Bewegung macht das wahre selbst-lose Selbst. Die Aspekte, die drei Aspekte, die aber jeweils unendlich variiert werden können, können zwar noch vergegenständlicht, versinnbildlicht werden, wie die drei Stationszeichnungen sie darstellen. Die Bewegung als solche aber, auf die es einzig im Grunde ankommt, ist nie gegenständlich-bildlich fixierbar. Sie kann auch nicht durch einen Kreis, einen da-bleibenden, statischen Kreis symbolisiert werden. Es geht um die Kreisbewegung, um die Bewegung, einen Kreis zeichnen zu können. Aber diese Bewegung als solche, einen Kreis zeichnen zu können, muss auch den gezeichneten Kreis auslöschen können, sonst würde die Bewegung von dem Gezeichneten gefesselt werden. Auf das selbst-lose Selbst als Bewegung der Ek-sistenz wird nur noch mit Hilfsbezeichnungen hingewiesen, z. B. mit »fū-kaku«, das man mit »Würde des Windes« übersetzen kann. Die Bewegung des selbst-losen Selbst »weht« sozusagen. Unter der »Würde des Windes« wird etwas anderes als Persönlichkeit verstanden, dafür steht das japanische Wort »jin-kaku«, d. h. Würde des Menschen. Diese hat jeder Mensch als Mensch. Die Würde des Menschen ist bei einem jeden Menschen ganz gleich und unantastbar. Dagegen ist die Würde des Windes ganz individuell, bei einem jeden anders und charakteristisch, je mit verschiedener Ge21 Ueda (48435) / p. 22 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus schwindigkeit und je nachdem, welcher Aspekt zum Vorschein kommt. Ein Mensch hat auch keine Würde des Windes, wenn er, gefesselt von dem Ich-bin-ich, die betreffende Bewegung nicht machen kann. »Wie weht es bei Euch?«, »Wie ist es mit dem Winde Eures Hauses?«, so fragt man oft in der Zen-Geschichte einen Meister nach dem »Wie« seines Selbst. Die 8., 9. und 10. Station stellen also nicht eine Steigerung in Stufen dar, sondern drei Aspekte des wahren selbst-losen Selbst. Doch hat die Reihenfolge der Stationen dabei eine praktische Bedeutung. Das schlechthin Entscheidende auf dem Zen-Weg zum Selbst ist das Nichts-Ereignis, das das Ich-bin-Ich endgültig, d. h. auch in seiner subtileren Form im religiösen Bereich, durchbricht. In diesem absoluten Nichts entschwindet alles Formhafte, das heißt zugleich: das formfreie Selbst zeigt sich zunächst als das Formlose schlechthin, die Formlosigkeit als solche. Das ist die 8. Station, dargestellt durch einen leeren Kreis. Nun kreist sich der Kreis, nun bewegt sich das Nichts als entsubstantialisierende Dynamik zum Nichts des Nichts. So aufersteht das Selbst von dem Nichts, und zwar jetzt zum selbstlosen Selbst. Weshalb aber erscheint in der nächsten, 9. Station »ein blühender Baum am Fluss« und nicht ein Mensch? Es handelt sich um die Auferstehung von dem Nichts zu dem selbst-losen Selbst. Die Selbstlosigkeit als Grundbedingung des wahren Selbst wird dabei, um der Selbst-losigkeit willen, zunächst in einer Realität, in der der Mensch nicht vorkommt, z. B. in dem blühenden Baum verkörpert. Das zeigt die 9. Station. Ein blühender Baum am Fluss, nichts anderes. Der Mensch kommt dabei nicht vor. Das ist des Menschen Selbst-losigkeit als solche. Erst dann, auf Grund der die Selbst-losigkeit bewährenden und bewahrenden Verkörperungsrealität als grundsätzliche Vorbeugung gegen einen Rückfall ins Ich-bin-Ich, kommt das selbst-lose Selbst nun zum Vorschein, das wegen der Selbst-losigkeit das »Zwischen« des Ich-Du zu seinem eigenen ek-sistenten Innenraum macht. Das besagt die 10. Station. Ein solcher beweglicher Zusammenhang der 8., 9. und 10. Station gibt uns das dritte Modell für unser Thema »Leere und Fülle«. II In dem zweiten Teil sollen zum näheren Verständnis unseres Themas drei verschiedene Probleme aus dem oben erörterten Zusammenhang 22 Ueda (48435) / p. 23 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus einzeln aufgegriffen und in einer breiteren Perspektive behandelt werden. * 1) Das erste Problem bezieht sich auf die »śūnyatā« (»Leere« in der buddhistischen Bedeutung) bzw. das Nichts und das Eins-Sein. Der Buddhismus verneint grundsätzlich die Auffassung des Seins als solches mit der Kategorie »Substanz« als etwas Seiendes, das identisch mit sich selbst ist und seinen Seinsgrund in sich selbst hat. Der Buddhismus sieht in der Substantialisierung ein Werk der verborgenen Selbstsubstantialisierung des ich-verhafteten Menschen. Er kennt nur die Kategorie »Beziehung«. Dem buddhistischen Denken gemäß gibt es schlechthin nichts, was in sich selbst und durch sich selbst ist. Alles, was ist, ist erst in Beziehung zu anderen, und zwar in gegenseitig bedingender Beziehung. »Sein« heißt dann: »in sich selbst nichts sein und in einer Beziehung stehen«, wobei die grundsätzliche Geltung der Kategorie »Beziehung« charakteristisch ist. Denn was in einer Beziehung steht, ereignet sich erst aus der Beziehung und enteignet sich wieder in Beziehung. »Beziehung« ist ihrerseits auch kein bestehender Zustand, sondern ein dynamisches Geschehen des Zu-, Mit-, Für-, Durch-, Voneinander usw. In dieser Beziehungsdynamik ist ein Jedes in sich selbst ein Nichts und gerade dadurch für die universalen Beziehungen schrankenlos offen, die sich ihrerseits in dem Nichts eines Jeden in Einmaligkeit und Einzigartigkeit zentrieren. Das macht die Individualität eines Jeden aus. Ein Zen-Spruch sagt: »Es geht eine Blume auf und eine Welt entsteht.« Dieser zusammengehörige, dynamische Sachverhalt wird im buddhistischen Denken aus einer doppelten Perspektive betrachtet. Die Lehre der »śūnyatā«, gemäß der ein Jedes in seinem Eigensein leer ist, betrachtet den ganzen Sachverhalt in der Perspektive des »Nichts«, während die Lehre des »pratı̄tyasamutpāda«, des »Entstehens in gegenseitiger, allseitiger Abhängigkeit voneinander«, denselben Sachverhalt in der Perspektive der universalen Beziehungsdynamik betrachtet. Die Wahrheit aber liegt dabei in der untrennbaren Zusammengehörigkeit des Nichts mit der Beziehungsdynamik, wobei die Zusammengehörigkeit als solche des Seins und des Nichts ledig ist. Dieser Zusammengehörigkeit entsprechend bedient sich das buddhistische Denken vielfach einer eigentümlichen Formulierung: 23 Ueda (48435) / p. 24 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Es ist, und zugleich (d. h. nichtsdestoweniger) ist es nicht. Es ist nicht, und zugleich (d. h. nichtsdestoweniger) ist es. In diesem doppelperspektivischen »nichtsdestoweniger« bzw. »und zugleich« von A und Nicht-A sieht der Buddhismus die Wahrheit des Seins wie auch des Nichts. Sein allein, das wäre eine Einseitigkeit. Nichts allein, das wäre eine andere Einseitigkeit. Der Einblick in dieses »und zugleich« von A und Nicht-A heißt die prajñā-Erkenntnis, die absolute Weisheit jenseits von jeglichem Dualismus. Das »und zugleich« ist als solches weder A noch Nicht-A, durch keine bildliche, begriffliche und ideenhafte Fixierung zu bestimmen und deshalb von der modernen japanischen Philosophie manchmal als das absolute Nichts bezeichnet, dessen der Mensch nur in seinem »Nichts« auf nicht-gegenständliche Weise innewerden kann. Unsere Frage ist nun: Wie ist es mit dem Eins-Sein auf Grund der Zusammengehörigkeit des Nichts mit der Beziehungsdynamik? Das fünfundvierzigste Beispiel aus »Bi-yän-lu« 3 lautet: Ein Mönch fragte Dschau-dschou: Alle die Zehntausende von Dinglichkeiten gehen zurück auf Eines. Welches ist der Ort, auf den das Eins selbst zurückgeht? Dschau-dschou sagte: Als ich [noch] in Tjing-dschou lebte, machte ich mir [einmal] einen Leinenrock, der hatte ein Gewicht von sieben Pfund. »Alles Seiende geht auf Eines zurück.« Daran aber schließt sich im Zen-Buddhismus die Frage: »Worauf geht das Eine zurück?« Dass alles Seiende mit seinen Unterschieden und Gegensätzen auf das ursprüngliche Eine zurückgehe, ist die Lehre von der »All-Einheit«. Dabei aber ist noch nicht geklärt, was unter dem »Einen« gemeint ist. Unter Umständen könnte das Eine eine ontologische Sackgasse für Vielheit bedeuten. Deshalb geht der Zen-Buddhismus weiter mit der Frage: »Worauf geht das Eine zurück?« Auch bei dem Einen ist nicht Halt zu machen. Denn an dem Einen festzuhalten, das würde bedeuten: in der Einheit gefangen bleiben. Auch diese muss durchbrochen werden, da Bi-Yän-Lu, Meister Yüan-wu’s Niederschrift von der Smaragdnen Felswand verfaßt auf dem Djia-schan bei Li in Hunan zwischen 1111 und 1115 im Druck erschienen in Sitschuan um 1300. Verdeutscht und erläutert von W. Gundert, Bd. I–III, München 1977, Bd. II (1967), S. 241 ff. 3 24 Ueda (48435) / p. 25 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus sie nicht die Wahrheit sein kann. Insofern sie als Einheit im Unterschied zur Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit verstanden wird, wird sie zum Einen substantialisiert, das als solches dann mit einem bestimmten Begriff oder in einer bestimmten Form aufgefasst werden muss. So verstanden wäre das Eine nicht mehr das Einigende, sondern umgekehrt eine Ursache der Spaltung und Gegensätzlichkeit, da es anderes, das dieser Form sich nicht einfügt, ausschließen muss, und das Ausgeschlossene seinerseits das Eine wiederum in einer anderen Form als Prinzip in Anspruch nimmt. Dann kommt es zum Kampf um das Grundprinzip, der zur tiefsten Spaltung führt. In solcher Grundgegensätzlichkeit muss der Idealismus den Materialismus, der Theismus den Atheismus oder Nihilismus herausfordern und umgekehrt. Wenn alles »in Wahrheit« eins ist, dann muss das wahre Eins-Sein der substantiellen Fixierung durch bestimmte Formen des Einen enthoben sein. Darauf zielt die Frage: »Worauf geht das Eine zurück?« Diese Frage führt zur Erkenntnis, dass das Eine zu Nichts werden muss, oder der Mensch das Eine verlassen muss, und zwar in zwei dynamisch zusammengehörenden Richtungen, nämlich: einmal zum Nichts hin und zum anderen zur Vielheit hin (oder zur Vielheit zurück). Die Wahrheit des Einen ist also: das Nichts »und zugleich« die Vielheit. Die vollständige Formulierung lautet »weder das Eine noch das Viele; das Eine und zugleich das Viele, das Viele und zugleich das Eine.« Wenn das Eine zu Nichts geworden ist, dann kehrt es jetzt wieder als Beziehung »das Eine und zugleich das Viele, das Viele und zugleich das Eine«. Dieser Beziehung – das ist immer wieder hervorzuheben – liegt das ungründige Nichts zugrunde, das nunmehr auf der Beziehungsebene seine Negation ausübt: »Weder das Eine noch das Viele.« Das Nichts löst das Viele zum Einen auf und zerlegt zugleich das Eine in das Viele, wobei das Nichts aus dem Vielen die Gegensätzlichkeit – nicht aber die Unterschiedenheit und aus dem Einen die geschlossene und verschlossene Festigkeit – nicht aber die Einheit – eliminiert. So hat die Beziehung »das Eine und zugleich das Viele, das Viele und zugleich das Eine« ihren Möglichkeitsgrund im Nichts, das seinerseits seine Realität in der genannten Beziehung bewährt. In einer solchen Beziehungsdynamik bedeutet die wahre Überwindung der Vielheit gerade die Rückkehr zur Vielheit als dem Prozess, der zugleich vom Einen weg zum Nichts hinführt. Ein Zen-Spruch lautet: »Beim Frühlingswinde, gleichmäßig und unsichtbar, sind lange Äste mit Blüten lang, kurze kurz, je von sich selbst.« »Langes lang, Kurzes kurz«, oder »das Rot rot, das Grün grün.« Hierin sieht der Buddhismus 25 Ueda (48435) / p. 26 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus die formfreie Einheit, die Einheit, die jedes Seiende und Geschehende in seiner Einzigartigkeit belässt und die derart eine bunte Seinssymphonie in der Offenheit des Nichts darstellt. Das ist gemeint, wenn es im Buddhismus heißt: »Unterschiedenheit, das bedeutet Einheit; Einheit, das bedeutet Unterschiedenheit.« In diesem Zusammenhang sollte am Rande auf zwei charakteristische Termini hingewiesen werden. Der Buddhismus spricht nämlich von »ichi-nyo« bzw. von »fu-ni«. »Ichi« bedeutet »eins«, und »nyo« besagt »wie«, »so, wie«, wobei in diesem »wie« der buddhistische Wahrheitsbegriff »So-heit« mitklingt. »Ichinyo« kann ungefähr mit »wie eins« übersetzt werden, »ichi-nyo« bedeutet also »(zwei bzw. viele sind) wie eins«. Zwei sind eins, wie sie zwei sind. Anders gesagt: Zwei sind »nicht zwei«, was der letztere Terminus »fu-ni« zum Ausdruck bringt. »Fu« bedeutet »nicht«, »ni« »zwei«. Also spricht der Buddhismus weniger direkt von der Einheit, als von der »Wie-eins-heit« bzw. »Nicht-zwei-heit«. Hören wir noch einmal das Beispiel: Ein Mönch fragte Dschau-dschou: Alle die Zehntausende von Dinglichkeiten gehen zurück auf Eines. Welches ist der Ort, auf den das Eine selbst zurückgeht? Dschau-dschou sagte: Als ich in Tjingdschou lebte, machte ich mir einmal einen Leinenrock, der hatte ein Gewicht von sieben Pfund. Die Art und Weise der Erwiderung des Zen-Meisters ist vollkommen anders als die Art und Weise der oben versuchten Erörterung. Der ZenMeister weiß den Sachverhalt als solchen ganz konkret lebendig auszudrücken, statt über den Sachverhalt zu sprechen. * * 2) Das zweite Problem bezieht sich auf die nichtgegenständliche, ekstatische Erfahrung der Natur, wie in der Zusammengehörigkeit der 8. und der 9. Station der Ochsenbilder. In der Erklärung dort wurde gesagt: ein blühender Baum am Fluss ist dann nichts anderes als das selbst-lose Selbst. Dieser Sachverhalt, der sich in das Subjekt-ObjektSchema nicht einpassen lässt, soll nun von einer anderen Seite her erhellt werden, und zwar hauptsächlich in Anschluss an die Philosophie der »reinen Erfahrung« bei Kitarō Nishida (1870–1945), einem Vertreter der modernen Philosophie in Japan. 26 Ueda (48435) / p. 27 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus »In dem Augenblick des Sehens, des Hörens, noch ohne Reflexion wie z. B. ›ich sehe Blumen‹, auch noch ohne Urteil wie z. B. ›diese Blumen sind rot‹, in dem Augenblick dieses gegenwärtigen Sehens, des Hörens, da ist weder Subjekt noch Objekt. Diese ›unmittelbar erfahrende‹ Erfahrung, diese vom reflektierenden und urteilenden Denken noch nicht bearbeitete ›reine‹ Erfahrung ist der Seinsgrund der allerwirklichsten Wirklichkeit wie auch des wahren Selbst, da die Ununterschiedenheit noch vor der Subjekt-Objekt-Spaltung als ursprüngliche Ganzheitsfülle gegenwärtig ist.« Hier zeigt sich eine direkte Verbindung des Empirischen und des Metaphysischen und auch des Existenziellen auf eigene Art. Wenn Nishida vom Sehen, vom Hören spricht, so steht er mitten im Bereich der Erfahrung. Indem er aber der Erfahrung als solcher viel näher kommt als der Empirismus, der der Erfahrung von Anfang an verschiedene Denkkonstruktionen wie z. B. eine Voraussetzung von Empfindungsatomen als Grundlage der Erfahrung oder Verifizierbarkeit in Experimenten unterschiebt, so führt die Erfahrung bei Nishida direkt zum Metaphysischen. Auf diese Weise ist für Nishida das Metaphysische nicht jenseits der Erfahrung, wie dies in der Metaphysik meistens der Fall ist, sondern gerade in der entgegengesetzten Richtung, d. h. diesseits der erfahrenen Erfahrung inmitten der erfahrenden Erfahrung schlechthin. »In dem Augenblick des Sehens, des Hörens, da ist es weder Subjekt noch Objekt«, als solches unbestimmbar, geöffnet für die unendliche Offenheit und erfüllt. In diesem Sinne ist es das »Nichts«, zugleich aber die reine Präsenz schlechthin »ohne Sehendes und Gesehenes«. Diesen »Augenblick« kennen wir aber gewöhnlich nicht. Bei unserem Sehen und Hören überspringen wir schon den »Vor-der-Spaltung-Augenblick«. Wir vergessen den »Augenblick«, und aus einer locker gedehnten Zeit heraus sagen wir etwa: »Ich sehe Blumen«, als ob das Ich noch vor dem Sehen schon als Ich in sich bestände, wobei wir auch wie selbstverständlich denken, dieses »Ich sehe Blumen« wäre eine unmittelbare fundamentale Erfahrung. Für Nishida ist dies bereits eine Rekonstruktion des Erfahrenen im Subjekt-Objekt-Rahmen, also nicht mehr Gegenwart, sondern Vergangenheit, keine erfahrende Erfahrung mehr, sondern schon eine erfahrene Erfahrung, welche sich aus Reflexion als Ich und Re-präsenz der Blume als gesehener Blume re-konstruiert. Es ist aber nicht so, dass Nishida überhaupt Reflexion und Re-präsenz verneinen wollte. Was er verneinen wollte, war die als 27 Ueda (48435) / p. 28 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus selbstverständlich an den Anfang gesetzte Zweiheit verschiedener Formen wie Geist und Natur, Bewusstsein und Ding, ganz formal gesagt, Subjekt und Objekt. Es geht Nishida darum, wo die Unmittelbarkeit der Erfahrung anzusetzen ist, um jene ursprüngliche Unmittelbarkeit nämlich, die der Realitätsgrund ist und die für die Einheit der Erfahrung letzte Gewähr bietet. Diese Unmittelbarkeit verlagert er ins Vor-der-Spaltung zurück, und zwar zurückgeleitet durch die erfahrende Erfahrung selber. Das Vor-der-Spaltung können wir nicht durch Reflexion, nicht gegenständlich erfassen, sondern seiner nur unmittelbar auf nichtgegenständliche Weise ich-los innewerden. Aber wie geht das vor sich? Da wir gewöhnlich bei der erfahrenen Erfahrung sind, die sich ausspricht im »ich sehe Blumen«, d. h. da die ursprüngliche Unmittelbarkeit des Vor-der-Spaltung schon übersprungen und vergessen ist, so müssen wir, um ursprünglich zu sein, den Ursprung durch einen »Sprung zurück« erst nachholen, wie dieser als Radikalisierung vom »Schritt zurück« bei Heidegger gelten würde. Und zwar so, dass das Nachholen selber in die Unmittelbarkeit aufgehoben wird. Wie vollzieht sich aber ein solcher Rücksprung? Nicht durch unsere eigene willentliche bzw. reflexive Tätigkeit. Wir können nicht beliebig aus dem Subjekt-Objekt-Rahmen zurücktreten. So heißt es bei Nishida: »Im Augenblick des Sehens, des Hörens, da ist weder Subjekt noch Objekt.« Von dem »Augenblick« der Präsenz getroffen, aus der Fesselung im Subjekt-Objekt Rahmen herausgerissen, und auf diese Weise zugleich ich-los, werden wir sprunghaft zum Nichts des »vor« zurückgebracht. Die Bereitschaft von dem »Augenblick« getroffen zu werden, benötigt als unerlässliche Vorbedingung unsererseits die Übung, sich selber in den »Augenblick« des Sehens, des Hörens ich-los zu sammeln, obwohl wir derart getroffen werden müssen, dass die Übung selber spurlos in die Präsenz eingeht. Darin, dass das geschlossene Ich-bin-ich in dem, und durch den »Augenblick« durchbrochen wird, sieht Nishida das Empirisch-Metaphysische und das Existenzielle als die Einheit, die das Selbst auf dem ursprünglichen Grund des Vor-der-Spaltung realisiert. Nishida sieht also in dem Vor-der-Spaltung des gegenwärtigen Sehens oder Hörens das ursprüngliche Ineinandergreifen des Empirischen, des Metaphysischen und des Existenziellen, während diese drei meistens auseinander und gegeneinander auftreten, und dieses Aus- und Gegeneinander dem menschlichen Dasein ein verhängnisvolles Problem bereitet. Auf diese Weise werden wir also in dem »Augenblick« des Sehens, 28 Ueda (48435) / p. 29 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus des Hörens, von dem »Augenblick« getroffen und durchbrochen, zum Nichts des »vor« sprunghaft zurückgebracht und holen den Ursprung nach, der übersprungen und vergessen wurde. Aber nicht so, dass wir im Nichts entschwunden bleiben, nicht so, dass das »vor« alleine die ganze Wahrheit ist. Nishida sagt: »Vor der Spaltung«. Damit hat auch bei ihm die Spaltung eine Geltung. Aber Spaltung wovon? Das ist für ihn entscheidend frag-würdig. Es kommt ihm darauf an, von wo her und als was diese Spaltung erfahren wird. Hier liegt bei Nishida im Grunde eine Art Kreisbewegung vor. Zurück zum Nichts des »vor« und von daher das Subjekt-Objekt als Ur-Selbst-Teilung des »vor« zu erfahren, dessen Erfahrung nun die Selbstentfaltung der reinen Erfahrung bedeutet. Das Subjekt-Objekt-Feld ist jetzt der eigentliche Spielraum des Selbst, das, ins Nichts entworden, aus dem Nichts wird. Das Selbst sieht nunmehr alles »wie auf der eigenen inneren Handfläche« oder »wie sein eigenes Gesicht«, wie es im Zen-Buddhismus heißt. Nishida spricht jetzt von der Subjektseite bzw. Objektseite als einer und derselben entfalteten Erfahrung. Es handelt sich um eine Doppelperspektive, nicht um eine Zweiheit von Subjekt und Objekt. Diese Entfaltung der Erfahrung gehört für Nishida zu der reinen Erfahrung. Es bleibt zu fragen, ob die reine Erfahrung, wie sie von Nishida vertreten wurde, eine wirkliche Erfahrung ist? Ereignet sie sich wirklich bei jedem von uns? Als ein Beispiel, an dem »die reine Erfahrung« illustriert werden kann, wollen wir hier den bekannten Grabspruch Rainer Maria Rilkes heranziehen, ohne eine Interpretation des Gedichtes zu versuchen. Er lautet: Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern. In unserem Zusammenhang wollen wir uns dem »oh« zuwenden und fragen: Was ist eigentlich dieses »oh«? Diese fragende Hinwendung an das »oh« mag im Sinne einer deutschen Poetik nicht das am nächsten Liegende sein. Das Gedicht erfährt dadurch vielleicht eine gewisse Umdrehung, der zufolge nun ein unauffälliges »oh« zu einem großen »Oh!« wird, und dadurch das Gedicht als ein ursprüngliches Wortgeschehen wieder vernehmbar wird. »Rose, Oh! Reiner Widerspruch…« Was ist nun dieses »Oh!»? Als geschriebenes Wort ist es, grammatikalisch, eine Interjektion. Aber welches Ereignis ist eigent29 Ueda (48435) / p. 30 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus lich das »Oh!« im gegenwärtigen Ausrufen? Was geschieht, wenn »Oh!« in Wirklichkeit und Wahrheit ausgerufen wird? Man könnte kurz von »Oh-Ereignis« sprechen. Wenn wir dieses Gedicht nicht als fertig geschrieben oder gedruckt, sondern als ein Wortgeschehen in der gegenwärtigen Tat des Dichtens hören, so können wir in dem »Oh!« den Ursprung des Gedichtes vernehmen, aus dem sich die ganzen Versworte als dessen Artikulation entfalten. »Rose, Oh! …« Getroffen von der reinen Präsenz wird »Oh!« ausgerufen. Was ereignet sich als gegenwärtiges »Oh!»? Einerseits: Die reine Präsenz beraubt den Menschen der Sprache. »Oh!« Was da gegenwärtig west, ist nicht mehr dasjenige, das man oder »das Man« mit seinem vertrauten, aber auch abgenutzten Wort »Rose« bezeichnet; nicht mehr dasjenige, dem man in der sprachlich vorverstandenen Welt begegnet. Es blitzt da sozusagen die Rose auf, nein, ETWAS, etwas Unsagbares. Die Rose ist da zum »Oh!« geworden, oder angemessener ausgedrückt, entworden. Da wird die sprachlich vorverstandene Welt durchbrochen, zerrissen. Das »Oh!« ist ein Ur-laut der Präsenz in eins mit dem primitiven Urlaut, mit dem die Sprachwelt durchbrochen wird. »Oh!«: die Sprache wird hier in ein Unartikuliertes zurück- und zusammengenommen, um dann in die absolute Stille zu entwerden. »Oh!»—still. Das bedeutet zugleich den Wesenstod des Menschen als eines sprachbegabten Wesens. Dieses »Oh!« ist kein Wort, über das der Mensch verfügt. »Oh!« – dann wird dem Menschen die Sprache weggenommen. »Oh!« ist vielmehr der letzte Atemlaut, mit dem der sprachbegabte Mensch stirbt. Der Mensch ist, in seinem Wesen gestorben, zum »Oh!« geworden, entworden. Also nur noch »Oh!«, in dem sowohl die Rose als auch der Mensch entworden sind. »Oh!« – still. Anderseits ist nun dieses »Oh!« zugleich aber auch der anhebende, der erste Beginn der folgenden Versworte: »Oh reiner Widerspruch …« Es ist der allererste Urlaut, welcher in der absoluten Stille anklingt, und als welcher die sprachberaubende, unsagbare Präsenz selbst überhaupt zum Wort wird. Als die Präsenz des Unsagbaren ist dieses »Oh!« das allererste Wort. Es gehört zwar noch nicht zur Sprache, es ist aber ein un-wortliches Vor-wort zur Sprache, durch das überhaupt der Weg zur Sprache wieder erschlossen wird. Das bedeutet zugleich die Wiederauferstehung des Menschen zu seiner wesenhaften Sprachlichkeit. »Oh!«, das ist der erste, früheste Laut des Menschen, wenn er in die sein Wesen auszeichnende Sprachlichkeit wieder hinein30 Ueda (48435) / p. 31 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus geboren wird. »Oh!« – da wird alles in einem gesagt, aber noch unartikuliert, und in diesem Sagen, zwar noch unreflektiert, ursprünglich begriffen. Zusammenfassend: das Oh-Ereignis ist ein einziges »und zugleich« doppeltes Ereignis. In das einzige »Oh!« sind der Mensch und die Rose beide entworden, und zwar zum »Oh!«, das als solches »weder Subjekt noch Objekt« ist. Und zugleich ist dasselbe »Oh!« der eigentliche Ursprung für die Entfaltung der strukturierten Ganzheit. Es ist Nichts und Alles in einem, und zwar ganz konkret: »Oh!« Wenn das »Oh!« sich wirklich so ereignet, so ist das Oh-Ereignis für Nishida eine, bzw. in diesem Fall, die reine Erfahrung. Wie oben am Beispiel »Oh!« illustriert wurde, ist die reine Erfahrung weder sprachlich gefasste Erfahrung, noch sprach-lose Erfahrung, sondern die Erfahrung des Weggenommen-Werdens des Wortes und gleichzeitig die Erfahrung der Geburt des Wortes. Die Präsenz schlechthin beraubt den Menschen der Sprache und ist als solche zugleich selber das allererste Wort. Sie reißt sich von der Sprache los und drängt in die Sprache hinein. So ereignet sich durch das »Oh!« und als das »Oh!« eine extreme Kreisbewegung vom Wort weg zum Wort hin. Diese Bewegung bedeutet zugleich »Tod und Auferstehung« des sprachbegabten oder sprechenden Menschen. Es handelt sich um die radikale Freiheit von der Sprache und zugleich die ursprünglichste Freiheit zur Sprache. Als diese Freiheit ist das »Oh!« ein Grundereignis des menschlichen Wesens, und betrifft gleichzeitig das Seiende im Ganzen. Das »Oh!«, als das allererste Wort aus dem absoluten Schweigen, als das un-wortliche Vor-Wort zur Sprache überhaupt angesehen, könnte als »Urwort« bezeichnet werden. Damit ist aber durchaus nicht gemeint, dass jedes »oh« als eine Interjektion, die wir gelegentlich gebrauchen, schon ein Urwort wäre. Ohne das oben beschriebene Ereignis kann vom Urwort nicht die Rede sein. Umgekehrt gesagt, ist dieses Ereignis an kein bestimmtes Wort gebunden. Das betreffende Ereignis kann sich auch in vorsprachlichen Formen wie Lachen oder Weinen, ebenso in einem Atemzug, auch in einer Körperbewegung vollziehen, die wir Leib-Sprache nennen könnten. Sehr oft auch verschwindet das Urwort, wenn es zu einer sprachlichen Artikulation kommt, »zwischen den Zeilen« und bestimmt nun unsichtbar den Stil von der Gesamtkomposition bis zur Wortwahl. So bleibt bei dem Grabspruch Rilkes nur noch ein unauffälliges »oh«, das nach der Metrik schwach gelesen 31 Ueda (48435) / p. 32 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus wird. Das »oh!« artikuliert sich zu Versworten, auf die es bei einem Gedicht einzig ankommt, um dann in diesen Worten seine leise Spur »oh« zu hinterlassen. Einige weitere Bemerkungen zum Oh-Ereignis könnten zugleich zur Erklärung der »reinen Erfahrung« dienen: a) Im »Oh!« sind Schweigen und Sprechen eins. In diesem »Oh!« und als dieses »Oh!« schweigt die Sprache und spricht sich das Schweigen aus. Im »Oh!« befreit sich das Sprechen vom Reden. b) Bei diesem »Oh!« sind Wirklichkeit und Sprache noch nicht zu unterscheiden. »Oh!« – ein Urwort-Sprechen ist als erstes Ereignis in der absoluten Stille ohne Weiteres die erste Wirklichkeit. Urwort, das heißt, Ur-Sache. Da gibt es noch keine Kluft zwischen der Erfahrung und ihrem sprachlichen Ausdruck, keine Zweiheit von Realem und Irrealem. Diese absolute Ununterschiedenheit von Urwort und Ur-Sache in einem und demselben »Oh!« gewährt in verschiedenen Bereichen, wo Wirklichkeit und Sprache sonst getrennt sind, eine ursprüngliche und letzte Grundlage zur Verbindung der Wirklichkeit und der Sprache: so im Falle der Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Gegenstand, oder bei der Wirklichkeitsgestaltung durch das Wort, oder etwa bei der Tat, die Wort hält. c) Wer spricht eigentlich das »Oh!« als Urwort? Im Ausruf »Oh!« wird nicht gesagt: »Ich sage Oh!«. Vielmehr wird das Ich dabei vollkommen vergessen. Es ist nicht das Ich, das »Oh!« ausruft, sondern die Ek-stase. Das »Oh!« ereignet sich also als die ek-statische Einheit von Person, Sprache und Wirklichkeit (bzw. Sache). d) Ein einziges »Oh!« – doch dabei zwei entgegengesetzte Richtungen ineinander. Die Rose ist zum »Oh!« geworden, und zugleich ist der Mensch zum »Oh!« geworden. Ur-ansprechen und Ur-entsprechen in einem. »Oh!« – es handelt sich hier um eine Ur-zwiesprache in einem ursprünglichen Einklang. Das dialogische Wesen der Sprache reicht bis ins »Oh!« zurück. Das »Oh!« als ereignishafte »reine Erfahrung« ist auch eine Kreisbewegung aus der Sprache heraus über das absolute Schweigen wieder zur Sprache hin. Die anhebende Bewegung zur Sprache ist als solche das Urwort, das un-wortliche Vor-Wort zur Sprache. Dadurch wurde der Weg zur Sprache erschlossen. Und jetzt kommt es zur Sprache, d. h. das Urwort wird durch die Sprache in Worten artikuliert. Der ganze Grabspruch Rilkes kann in dieser Hinsicht als eine Artikulation des »Oh!« angesehen werden, des »Oh!« nämlich, das der Dichter, von der Präsenz getroffen, ek-statisch aufgerufen hat. Insofern es zur Ar32 Ueda (48435) / p. 33 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus tikulation gekommen ist und zwar dann erst und nur dann können wir auf den Ursprung zurückblickend so etwas wie das Urwort erkennen. Das »Oh« allein wäre nichts. Mit der Artikulation wird das »Oh« zu einem Nichts, das alles in einem sagt und sich nun artikuliert. Diese Artikulation des Urwortes kommt der oben erwähnten selbst-urteilenden Entfaltung der reinen Erfahrung gleich. So gelten die oben zur Erklärung der 9. Station angeführten Worte: »Die Blumen blühen, wie sie von sich selbst her blühen« auch als eine Artikulation der reinen Erfahrung. Nun ist aber das Problem der Artikulation ein eigenes Thema, das hier nicht weiter behandelt werden kann. Nur einige Hinweise. In der Artikulation des Urwortes, wie z. B. des »Oh!« sind in Hinsicht auf Modus und auf Dimension folgende Unterscheidungen zu treffen. A) Modal: a) Logos-Artikulation des »Oh!« als Ununterschiedenheit schlechthin, absolute Indifferenz, b) Pathos-Artikulation des »Oh!« als Urklang, c) Handlungsartikulation des »Oh!« als Urkraft. B) Dimensional: die erste und die zweite Artikulation. Der ZenSpruch: »Die Blumen blühen, wie sie von sich selbst blühen« gehört zur ersten Artikulation, während »die Philosophie der reinen Erfahrung« bei Nishida zu einer zweiten Artikulation gehört. Weitere Probleme in Bezug auf die Artikulation sind folgende, worauf hier nur hingewiesen werden sollte. 1) Was für ein Ereignis ist überhaupt die »Artikulation« des Urwortes? In welcher Beziehung steht die sprachliche Artikulation des Urwortes zur Leistung der Sprache? 2) Wodurch wird das Artikulierte gekennzeichnet? Was charakterisiert z. B. eine Aussage als Logosartikulation des Urwortes, insbesondere im Hinblick auf die »Logik«? * * * 3) Das dritte Problem bezieht sich ganz allgemein auf die zwischenmenschliche Beziehung. Unsere Frage ist: Was kennzeichnet die zwischenmenschliche Beziehung aufgrund des Nichts, in das der Mensch entwird und von dem er wieder aufersteht? In der 10. Station der Ochsenbilder begegnen sich zwei Menschen auf der Straße. Im Rahmen der Selbstwerdung auf dem Zen-Weg handelt es sich, wie im Bildtext erklärt, um das wahre Selbst, und zwar im Aspekt des Doppelselbst aufgrund der Selbst-losigkeit im Nichts. Auf33 Ueda (48435) / p. 34 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus geschnitten durch das absolute Nichts öffnet und entfaltet sich das Selbst selbst-los zum Zwischen, in dem der Andere in seiner Andersheit die Selbst-losigkeit des Selbst verwirklicht. Dieser Sachverhalt als solcher enthält mehr als das, was der Text im gegebenen Zusammenhang unmittelbar und ausdrücklich aussagt. Das Charakteristische darin wird am Problem »Ich und Du« zum Ausdruck kommen. In dem betreffenden Sachverhalt ist zwar die Ich-Du-Beziehung als ein wesenhaftes Moment enthalten, aber der gesamte Sachverhalt ist etwas anderes bzw. mehr als die Ich-Du-Beziehung. Das Beispiel der alltäglichen Begrüßungsform in der japanischen Tradition mag als Erklärung dienen. Zwei Bekannte begegnen sich auf der Straße. Sie machen zunächst eine Verbeugung voreinander, manchmal so tief, wie in die Richtung der Grund-losigkeit des Zwischen, wo weder »Ich« noch »Du« ist. Erst von da aus, dann sich aufrichtend und zueinander sich hinwendend die Begrüßung: »Schönes Wetter, nicht wahr?« »Ja, schön!« Das ist eine unauffällige alltägliche Szene. Es handelt sich um die gebräuchliche Form der Begegnung und Begrüßung. Eine Form ist nicht von Anfang an nur formal, obwohl sie manchmal zu einer bloßen Form entartet ist. Eine Form der Begrüßung ist ursprünglich ein elementarer Ausdruck und eine Vollzugsweise des Selbstverständnisses des Menschen bei der zwischenmenschlichen Begegnung, in dem sich das Wesen des Menschen ausdrückt. So ist zu fragen: welches Selbstverständnis des Menschen in der Begegnung liegt einer solchen Form der alltäglichen Begrüßung zu Grunde? Was geschieht in dieser Begrüßungsbewegung eigentlich? Die beiden Partner verbeugen sich zunächst gegenseitig tief voreinander. Man sagt gewöhnlich »aus Höflichkeit«. Seinsmäßig ist es eine tiefe Verbeugung und es liegt mehr in ihr als nur »Höflichkeit«. Es geht nämlich darum, sich selbst vor dem Anderen zum Nichts zu machen, in dem dann auch der Andere nicht da ist. Und zwar geschieht das gegenseitig. Statt ohne Weiteres in die Ich-Du-Beziehung einzutreten, geht es einem bei der Verbeugung darum, sich zunächst einmal in die Tiefe der Grund-losigkeit zu tauchen, d. h. das »ego« sozusagen brechend in die Tiefe des Nichts entwerden zu lassen, wo es weder »Ich« noch »Du« gibt. Es geht um eine Art Versenkung in das Nichts der Grund-losigkeit des Zwischen. Dann erst sich wieder aufrichtend, d. h. vom Nichts wieder auferstehend und sich zueinander hinwendend, stehen sich jetzt die beiden 34 Ueda (48435) / p. 35 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus Partner in einer Ich-Du-Beziehung gegenüber. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Ich-Du-Beziehung vom Weder-Ich-noch-Du im Nichts durchdrungen wird. Es ereignet sich hier eine dynamische Zusammengehörigkeit der Ich-Du-Beziehung und des Weder-Ich-nochDu im Nichts. Wie wirkt sich das in der Ich-Du-Beziehung aus? Mitten im »Zwischen«, als dem Raum des Einander-Gegenüberstehens wird, vom Nichts durchdrungen, eine unendliche Offenheit erschlossen. Jeder der beiden Partner hat nun die absolute Ununterschiedenheit als das Weder-Ich-noch-Du im Nichts erfahren. In diesem offenen Zwischen kann jeder der beiden Partner aufgrund jener Ununterschiedenheit einerseits die ganze Ich-Du-Beziehung als sein Selbst erleben (es handelt sich um die absolute Selbstständigkeit und Alleinigkeit), andererseits die ganze Ich-Du-Beziehung, in die er restlos aufgeht, dem Du überlassen (es handelt sich nun um die absolute Abhängigkeit). Aufgrund der Ununterschiedenheit also, die jeder der beiden Partner im Weder-Ich-noch-Du erfahren hat, kann er einerseits die ganze Beziehung auf der Ich-Seite erleben (»Ich und Du«, das bin ich zur absoluten Selbstständigkeit), und andererseits dieselbe Beziehung ganz der DuSeite überlassen (Ich bin in meiner absoluten Abhängigkeit »Ich und Du«, dessen Herr Du bist). Anders gesagt, es geht um die Gegenseitigkeit im Wechsel der Rolle des Herrn, wie es im Zen-Buddhismus heißt. Diese Zusammengehörigkeit der absoluten Selbstständigkeit und der absoluten Abhängigkeit – auch diese wiederum wechselseitig – kennzeichnet die Ich-Du-Beziehung aufgrund des Nichts. Beide Partner sind erst dadurch in einer solchen Beziehung sowohl absolut frei als auch einander vollkommen gleichgestellt. Sie verbeugen sich voreinander in die Grundlosigkeit des Nichts und, sich vom Nichts wieder aufrichtend, wenden sie sich einander zu. In dieser gesamten Bewegung sind verschiedene Phasen und Momente enthalten. A) weder »Ich« noch »Du« im Nichts. B) Ich-Du-Beziehung, und in dieser wiederum a) ein Gegenüber als Ich-Du auf der Beziehungsebene, und b) Zusammengehörigkeit der absoluten Selbstständigkeit und der absoluten Abhängigkeit auf Grund der vom Nichts durchdrungenen Ich-Du-Beziehung. Das bedeutet den gegenseitigen Wechsel der Rolle des Herrn zwischen den Partnern. Diese ganze Bewegung, die in ihren einzelnen Phasen und Momenten kompliziert erscheinen mag, aber in Wirklichkeit als Tat einfach ist, diese Bewegung stellt das selbst-lose Selbst in der zwischenmenschlichen Beziehung her. Umgekehrt gesagt: das selbst-lose Selbst muss in der zwi35 Ueda (48435) / p. 36 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus schenmenschlichen Beziehung die oben genannten verschiedenen Phasen und Momente frei durchlaufen können. Im Grunde genommen ist die gesamte Bewegung der Begrüßung nichts anderes als die Kreisbewegung in der 8., 9. und 10. Station der Ochsenbilder. Darin kommt die Ununterschiedenheit des Religiösen und des Alltäglichen zum Ausdruck, auf die es beim Zen-Buddhismus ankommt. Auf diese Weise wird der Alltag bis in die letzten Einzelheiten mit Bedeutung erfüllt. Es ist daher eine entscheidende Frage für jeden, ob er in Wirklichkeit und Wahrheit einen Partner so grüßen kann? In der Beziehungsdynamik auf Grund des Nichts versteht sich der Mensch nicht als das in sich mit sich selbst substanziell identische Subjekt, das nachher irgendwie eine Beziehung zum anderen aufnimmt, sondern er versteht sich jeweils schon aus der Beziehung, in der er sich von vornherein findet. Er versteht sich immer schon als »Partner des Partners«. Aus sich heraustreten, und immer schon in der Beziehung zum Anderen, im Gegenüber stehen – das gehört zur inneren Struktur des Selbst. Bezeichnet man diese Struktur des Aus-sich-Heraustretens« mit dem Terminus »Ek-sistenz«, so ist der Andere im Gegenüber kein Anderer, sondern gerade in seiner Andersheit die Verkörperung der »Ek-»heit der Ek-sistenz, der Außer-sich-heit des selbst-losen Selbst. Das Selbst und der Andere im Gegenüber, jedes durch das Nichts aufgeschnitten und geöffnet, fügen gegenseitig ihr Sein zusammen, so dass sie ineinander gefügt »weder zwei noch eins« sind. Das Ich und das Du sind dann zwei entgegengesetzte polare Perspektiven. Ich bin »Ich und Du«. Das gilt umgekehrt auch vom Du aus. Das Selbst ist die Beziehung »Partner des Partners«. Das bedeutet aber nicht einseitig eine Auflösung des Selbst in die Beziehung. Die ganze Beziehung ist das Selbst. »Ich und Du«, das bin ich. Dieser Sachverhalt ist aber kein ruhender Zustand, sondern jeweils ein Ereignis. Das sollte nur jedes Mal konkret in der Begegnung und Kommunikation vollzogen und bewährt werden. Auf der ethischen Ebene wird die Betonung, wie es naheliegt, auf das Moment der Selbstnegation gelegt, worin dem Anderen die Rolle des Herrn übergeben wird. Das bedeutet aber kein einseitiges Selbstopfer. Im Grunde geht es um den gegenseitigen Austausch des »demAnderen-den-Vorzug-Geben«, um den Austausch des »Bitte, nach Ihnen« sozusagen, allerdings nicht um einen bewussten absichtlichen Austausch – das wäre ein Handel zwischen Ich-Menschen. Während 36 Ueda (48435) / p. 37 /2.5.10 Leere und Flle – Śūnyatā im Mahāyāna-Buddhismus dieses genannten Austausches geschieht es in irgendeinem Moment, dass der eine »Danke schön« sagt und einen ersten Schritt macht, um dann den Partner zu seinem Schritt einzuladen. Wiederum ein Austausch. In diesem dem-Anderen-den-Vorzug-Geben (oder »dem-Anderen-den-Seinsvorrang-Lassen«) zeigt sich die Größe des selbst-losen Selbst, das seinerseits imstande ist, den Anderen aus dem Ich-Gefängnis zu befreien, so dass dann die oben erwähnte ek-sistierende Bewegung wechselseitig spielen kann. 37