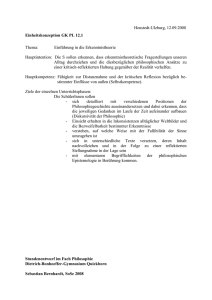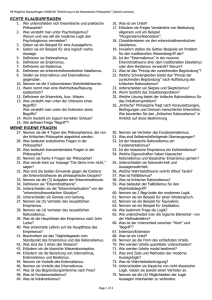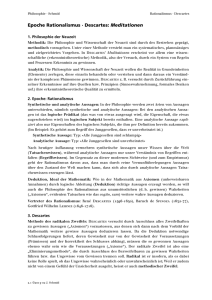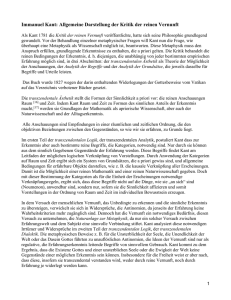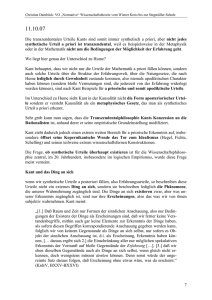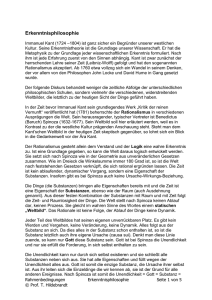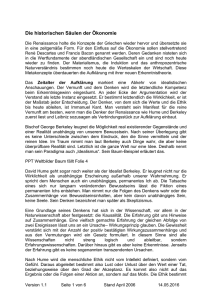Arbeitsblatt 2
Werbung

Kant und Nagarjuna – Erkenntnistheoretische und ethische Grundlagen im Idealismus und Madhyamaka Arbeitsblatt 2 Erkenntnistheoretische Positionen: Rationalismus – Empirismus – Skeptizismus – Kritischer Idealismus B. Grundzüge erkenntnistheoretischer Lehrmeinungen Definitionen und Positionen 1. Rationalismus 1.1. Weite Definition von Rationalismus Im weiten Sinn bezeichnet man als Rationalismus jede Position, die (1) erkenntnistheoretisch der Vernunft den Vorrang vor der Erfahrung einräumt, (2) metaphysisch Ursprung und Wesen des Kosmos in einem vernünftigen und insofern erkennbaren Prinzip ansiedelt, an dem die menschliche Vernunft Anteil hat, (3) ethisch die rationale Ausweisbarkeit von sittlichen Prinzipien und Normen vertritt. Die Vernunft bzw. der Verstand vermag also sowohl auf physikalischen wie auch auf metaphysischem und moralischem Gebiet die formale Struktur der Wirklichkeit zu erkennen. 1.2. Rationalismus als Epochenbegriff Als Epochenbegriff bezeichnet „Rationalismus“ eine mir Descartes beginnende philosophische Richtung der Aufklärung, die in Opposition zum (englischen) Empirismus steht. Zentral ist hierbei der Gedanke, in der Selbstgewissheit des reinen Denkens ein sicheres Fundament gegen skeptische Einwände (es gibt keine grundlegenden Wahrheiten bzw. Evidenzen, die keines weiteren Beweises bedürfen → Nicht-Begründbarkeit allen Wissens) zu finden. Bei Descartes ist es der methodische Rückgang auf das Cogito als unbezweifelbare Gewissheit und die Inhalte, die klar und deutlich dem Selbstbewusstsein gegeben sind. Charakteristisch für den Rationalismus ist seine Lehre von den angeborenen Ideen, d.h. den nicht aus der Erfahrung stammenden Ideen, die dem Bewusstsein inhärent sind. Als methodisches Ideal dient dem Rationalismus die Mathematik, die als Universalwissenschaft gilt (mathesis universalis), so dass sich selbst eine Ethik auf geometrische Weise (more geometrico) entwerfen lässt (Spinoza). 1.3. René Descartes (1596–1650) Descartes geht es, sehr vereinfacht ausgedrückt, darum, die Philosophie (die unvermeidlich mit den Fragen nach dem Dasein Gottes und dem Wesen der Seele) verbunden ist, auf ein sicheres Fundament zu stellen, d.h. einen Punkt zu finden, der, gleich den mathematischen Axiomen, unmittelbar gewiss und einleuchtend ist und den ganzen Bau der Philosophie zu tragen vermag. Hierzu gilt es zunächst, methodisch all das in Zweifel zu ziehen, was bisher als unbezweifelbare Wahrheit gegolten hat. 3 1. Als fragwürdig erscheint zunächst das Sein der Außenwelt, dass nämlich die Dinge in Wahrheit so sind, wie sie uns erscheinen und dass sie überhaupt existieren. 2. Auch unsere eigene leibliche Existenz (die uns bisher gewiss erschien) mithin das ganze Leben könnte ein beständiger Traum sein, dem nichts Wirkliches entspricht. 3. Dennoch scheint es ein unaufhebbares Wissen zu geben. Nämlich etwa der Satz „2 + 3 = 5“, oder die allgemeinsten Grundbegriffe wie Ausdehnung, Gestalt, Zeit, Raum. Aber auch diese unzertrennlich mit der Struktur des menschlichen Geistes verbundenen Gewissheiten könnten bloß die Produkte eines täuschenden Gottes (genius malignus) sein, der den Menschen in eine wesenhafte Verkehrung und Unwahrheit hineingeschaffen hätte. Der Zweifel aber gebiert aus sich selbst eine ursprüngliche Gewissheit: Mag auch alles, was ich mir vorstelle, jeder Gegenstand, den ich zu erkennen glaube, fragwürdig sein, so existieren doch meine Vorstellungen von diesem Gegenstand, und damit existiere auch ich, der ich diese Vorstellungen habe. Mag mich auch ein betrügerischer Gott täuschen, so existiere ich, der Getäuschte doch: „Ich denke, also bin ich“ bzw. „Ich zweifle, also bin ich“ bzw. „Ich werde getäuscht, also bin ich“. Was aber ist dieses „Ich“, das sich seiner selbst im Zweifel bewusst ist? In der Selbsterfahrung erfährt es sich als denkendes Wesen. Von der körperlichen Welt her und mit Hilfe der Begriffe, die aus der Erfahrung der Weltdinge geschöpft sind, kann es verstanden werden als ein „denkendes Ding“ (res cogitans) bzw. als Etwas, an dem sich die Eigenschaften des Denkens, Wollens und Fühlens in der gleichen Weise vorfinden, wie die Farbe oder Schwere an den Dingen der physikalischen Welt. Dabei ist das Wesen des „Ich“ „Denken“, in einem Sinn der den gesamten Bereich des Bewusstseins (Fühlen und Wollen) umfasst. Das bloß im Bewusstsein lebende Ich aber verliert theoretisch dabei den Kontakt mit den anderen nicht bewussten, nicht denkenden Wesen (res extensa). Die res cogitans ist durch eine unüberwindliche Kluft von der res extensa getrennt. Allerdings reicht auch die Entdeckung der Selbstgewissheit und die Untersuchung des Wesens des Ich nicht hin, die Philosophie auf ein sicheres Fundament zu stellen. Es bleibt die Frage nach dem Ursprung der Wirklichkeit bzw. die Frage nach Gott. Denn die grundlegende Verkehrung setzt ja, unter der Herrschaft des Schöpfergedankens, voraus, dass Gott als Betrüger gedacht wird. Descartes muss also nicht nur zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, sondern grundlegender, dass Gott überhaupt existiert und unsere klaren und deutlichen Erkenntnisse tatsächlich Gültigkeit hinsichtlich der Welt der Dinge besitzen. Descartes geht davon aus, dass der Mensch in seinem Innern die Idee eines höchst vollkommenen Wesens vorfindet. Ein unvollkommenes Wesen wie der Mensch kann aber die Idee des höchst vollkommenen Wesens nicht aus sich selbst hervorbringen. Also kann diese Idee nur durch das höchst vollkommene Wesen selbst in uns eingepflanzt sein (idea innata). Gott als Ursprung der Idee Gottes muss also notwendig existieren. Wenn aber Gott vollkommen ist, dann gehört zu seiner Vollkommenheit auch die Wahrhaftigkeit; denn Betrug entspringt einem Mangel. Also garantiert die Wahrhaftigkeit Gottes die Richtigkeit der Welt 4 und ihrer Erkenntnis, wobei auch die unmittelbare Evidenz daraus ihre letzte Begründung erhält. Literatur: Descartes, René: Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. (1637). Deutsch: Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. Hamburg: Meiner, 1997. Descartes, René: Meditationes de prima philosophia (1641). Deutsch: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Hamburg: Meiner, 2008. 2. Empirismus 2.1. Weite Definition von Empirismus Allgemein bezeichnet „Empirismus“ die erkenntnistheoretische Lehre, gemäß der alles Wissen seinen Ursprung nicht im Verstand oder der Vernunft, sondern allein in der Erfahrung (Beobachtung, Experiment) hat. Zentral für den Gebrauch des Erfahrungsbegriffs im Empirismus ist die Idee, dass das Erkenntnissubjekt dem Objekt (in letzter Konsequenz) passiv gegenübersteht. Erfahrung in diesem Sinne kann sich dann näher bestimmen als die Gesamtheit des noch unstrukturiert Gegebenen, das sich erst im Erkennen durch Begriffe und Erinnerung zu einer stabilen und erkennbaren Wirklichkeit formt. 2.2. Empirismus (Thomas Hobbes 1588–1679) Die Kritik von Hobbes am Rationalismus bezieht sich insbesondere auf die Beurteilung von Descartes’ erstem Prinzip. Daraus, dass ich denke, folgt zwar nach Hobbes, dass ich existiere, aber nur darum, weil jede Tätigkeit jemanden voraussetzt, der sie ausübt. Dass „Ich“ auf ein rein geistiges Wesen hinweist, lehnt Hobbes ab, da er es für möglich hielt, dass das Bewusstsein auf gewissen Vorgängen im menschlichen Organismus beruht. Begründete Urteile über das Verhältnis von Geist und Körper sind unmöglich, da wir grundsätzlich nicht imstande sind, das Wesen der Wirklichkeit, auch nicht das Wesen des Körpers, zu erkennen. Da es ohne Erfahrung keine Vorstellungen (Ideen) gibt, können wir auch keine Idee von Gott haben. Nach Hobbes gibt es also keine wahrhaften und unveränderlichen Naturen, deren Zusammenhang eine objektive vernünftige Ordnung bilden würde, auch keine einsichtigen Urteile, in denen etwas von dieser Ordnung erfasst würde. Das direkte Erfahrungsobjekt sind nicht die Dinge selbst, sondern die Vorstellungen. Wenn wir vernünftig urteilen, drücken wir also nicht eine Einsicht in die Natur der Dinge aus, sondern verbinden Namen aufgrund ihrer konventionellen Bedeutung. Namen werden aufgrund von Vorstellungen gebildet, die ihrerseits unmittelbar oder mittelbar der Erfahrung entspringen. Ihre genaue Bedeutung erhalten sie durch Übereinkunft der Angehörigen einer Sprachgemeinschaft. Hobbes fordert, die Vorstellungen, die er als die unmittelbaren Gegenstände des Bewusstseins ansieht, so lange zu zerlegen, bis man zu einfachen gedanklichen Elementen gelangt. Wenn 5 man den einfachen Gedanken Namen zuordnet, kann man mit diesen Namen, wie mit den Symbolen der Algebra, „rechnen“. Außer Nominaldefinitionen gibt es auch genetische Definitionen, die angeben, wie die definierte Sache entstanden bzw. als entstanden zu denken ist. (Bezeichnet man z.B. einen „Kreis“ als „Linie, die durch Bewegung eines Punktes mit konstantem Abstand von einem gegebenen Punkt erzeugt wird“, so liegt eine genetische Definition vor) Einfache Begriffe, die sich bei der Zergliederung der Vorstellungen von Dingen ergeben, sind „Größe“, „Gestalt“, „Bewegung“, „Raum“, „Zeit“, „Ursache“, „Wirkung“, mit denen sich Grundsätze formulieren lassen, die für alle Körper gelten (z.B. Trägheitsprinzip oder der Satz über die Gleichheit von Aktion und Reaktion). Diese Sätze sollen nicht nur für physikalische, sondern auch für organische und für soziale „Körper“ (Staaten) gelten. In der Erkenntnislehre erblickt Hobbes eine Anwendung der allgemeinen Bewegungsgesetze auf Bewegungen im menschlichen Organismus, insbesondere in den Sinnenorganen und den Nerven. Das Leben führt er auf die Bewegung der „Lebensgeister“ (spiritus animales) zurück. Wenn vermittels der Sinnesorgane Reize aufgenommen werden, wirken von außen kommende Bewegungen auf die Lebensgeister ein und rufen eine Reaktion hervor, die bewusst erfahren wird, entweder als Vorstellung oder als Begehren. Die Bewegung der Lebensgeister hat, wie jede Bewegung, die Tendenz, ihren Bewegungszustand beizubehalten. Unterliegt sie einem hemmenden Einfluss, erleben wir als Reaktion die Unlust, wird sie gefördert, entsteht das Gefühl der Lust. Je nachdem, ob etwas die vitale Bewegung fördert oder hemmt, wird es als Wert oder als Unwert erlebt und entweder begehrt oder abgelehnt. Am heftigsten lehnen alle Lebewesen ab, was zum völligen Aufhören der Vitalbewegung, mithin zum Tod führt. Die Selbsterhaltung ist das alles beherrschende Ziel auch des menschlichen Strebens, das daher egoistischen Charakter hat. Literatur: Hobbes, Thomas: Leviathan (1651). Deutsch: Leviathan. Hamburg: Meiner, 2004. 2.3. Empirismus (John Locke 1632–1704) Kurzreferat von Michael Palm Grundzüge der Position von John Locke Lockes Wissenschaftsverständnis gründet auf der Erfahrungswelt (Empirie), wie sie das 17. und 18. Jahrhundert definierte, wobei er die Aufgabe der Philosophie den Vorzeichen der Praxisrelevanz und Erfahrungsbereicherung unterordnete. Erkenntnistheoretisch leitet ihn die Frage nach dem Ursprung, der Gewissheit und dem Umfang der menschlichen Erkenntnis. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass der Mensch kein Bewusstsein von den „Ideen“ (dem Wahrzunehmenden bzw. der Vorstellung von Objekten) hat, das gleichsam nur aktiviert werden müsste, sondern der kindliche Verstand gleicht einem leeren, unbeschriebenen Blatt. („Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu“). Die „Ideen“ bzw. Vorstellungen, die jeder Mensch in seinem Bewusstsein findet, stammen ausschließlich aus der Erfahrung, 6 die allerdings bei allen verschieden ist, woraus sich Entwicklungsprozesse verschiedener Völker und Epochen erklären. die unterschiedlichen Dem Menschen eignet dabei a priori das Vermögen, Vorstellungen überhaupt bilden zu können. Die Erfahrung hat zwei Quellen: 1. die äußere Sinneswahrnehmung (sensation), die sich auf materielle Dinge bezieht 2. die innere Selbstwahrnehmung (reflection), die sich auf Bewusstseinsvorgänge bezieht (Denken, Wollen , Glauben usw.) Die aus diesen beiden Quellen stammenden Vorstellungen sind entweder einfach oder komplex: 1. Einfache Ideen, die nur durch den Sinn wahrgenommen werden (z.B. Farben und Töne) 2. Einfache Ideen, die durch mehrere Sinne wahrgenommen erfasst werden (Raum, Bewegung) 3. Einfache Ideen, die der Reflexion entspringen (innere Bewusstseinsvorgänge) 4. Einfache Ideen, an denen Sensation und Reflexion beteiligt sind (Zeit, Lust) In Bezug auf diese einfachen Ideen bzw. Vorstellungen verhält sich der Geist passiv, sie werden direkt durch vom Objekt ausgehende Reize verursacht. Die Sinneswahrnehmung kann wiederum unterteilt werden in 1. Primäre Qualitäten, die den äußeren Dingen als solchen zugeschrieben werden (z.B. Ausdehnung, Gestalt, Dichte, Zahl) 2. Sekundäre Qualitäten, die nur Empfindungen im Subjekt darstellen (z.B. Farbe, Geschmack, Geruch usw.) Der Geist hat aber auch die aktive Fähigkeit, durch Kombinatorik, durch Vergleichen, Trennen, Verbinden und Abstrahieren komplexe Ideen zu erzeugen, die allerdings wiederum aus einfachen Ideen zusammengesetzt sind, und an die Erfahrung gebunden bleiben. Dabei werden drei Arten von komplexen Ideen gebildet: 1. Substanzen sind entweder für sich selbst bestehende Einzeldinge oder Spezies (z.B. Mensch, Pflanze) 2. Modi sind komplexe Ideen, die nicht für sich bestehen, sondern an Substanzen vorkommen (z.B. Tag als einfacher Modus der Zeit). Daneben gibt es auch gemischte Modi, wie Moralbegriffe (z.B. Gerechtigkeit) 3. Relationen sind Ideen wie die von Ursache und Wirkung 7 Für Locke können dabei ohne die Untersuchung der Sprache keine gesicherten Schlüsse auf die menschliche Erkenntnis gezogen werden. Denn gerade die Worte bedeuten uns ja die Dinge, wobei meist vergessen wird, dass sie lediglich Zeichen darstellen, die die Substanz nur repräsentieren. Erkenntnistheorie ist also für Locke notwendigerweise mit Sprachphilosophie gekoppelt, wobei dem Unterscheidungsproblem zwischen der Wirklichkeit der Erfahrung, der Wahrnehmung und der Erfahrung repräsentierter Wirklichkeit durch willkürlich gesetzte Zeichen (Namen) eine entscheidende Bedeutung zukommt. Wenn keine verlässlichen Aussagen über die Wirklichkeit der Dinge an sich zu machen wären, dann gäbe es notwendig auch keine ewigen Wahrheiten, weshalb keine Person oder Glaubensgemeinschaft die allein gültige Wahrheit für sich in Anspruch nehmen könnten. Locke, John: An Essay concerning Humane Understanding. Deutsch: Versuch über den menschlichen Verstand. Hamburg: Meiner, 2000. 2.4. Grundzüge des Skeptizismus von David Hume (1711–1776) Kurzreferat von Erik Ositis Der Skeptizismus ist eine Weiterentwicklung des Empirismus durch David Hume, der die metaphysische Erkenntnis bestreitet und auch alle rein durch Gedanken hervor gebrachten Ergebnisse innerhalb der Naturwissenschaft nicht anerkennt. Wenn der Empirismus die Erkenntnis allein auf die Wahrnehmung konzentriert, d.h. durch die Sinne, so erweitert Hume, dass die Erkenntnis nicht weiter reiche als die Erfahrung, da für ihn nichts als real anzunehmen sei, was nicht durch äußere und innere Erfahrung gegründet ist. Auch für Hume gilt es also, die empirische Untersuchungsmethode in die Wissenschaft einzuführen und sich dabei auf Erfahrung und Beobachtung zu stützen (Induktion). Unmittelbarer Gegenstand unserer Erfahrung sind dabei allerdings nur unsere Bewusstseinsinhalte (Perzeptionen), die sich in zwei Klassen (hinsichtlich des Grades ihrer Intensität) unterscheiden: 1. Eindrücke (impressions), d.h. alle Sinneswahrnehmungen und inneren Selbstwahrnehmungen (Affekte, Emotionen, Wollen). 2. Vorstellungen (ideas) als Abbilder von Eindrücken, die wir haben, wenn wir uns mit diesen Eindrücken in Form von Nachdenken, Erinnern und Einbilden beschäftigen. Da die einfachen Vorstellungen (ideas) aus Eindrücken (impressions) entstehen, ist es uns nicht möglich, etwas vorzustellen oder zu denken, was nicht irgendwann in der unmittelbaren Wahrnehmung bzw. Erfahrung gegeben war. Aufgrund seiner Einbildungskraft (imagination) besitzt der Mensch jedoch die Fähigkeit, aus einfachen Vorstellungen komplexe Vorstellungen zu bilden. Diese komplexen Vorstellungen entspringen also nicht direkt einem unmittelbaren Eindruck, bleiben aber auf die Erfahrung verwiesen. Wie gelangen wir aber zu Urteilen über Tatsachen, die über unsere unmittelbare Wahrnehmung und Erinnerung hinausgehen? Die Verbindung von Vorstellungen folgt gemäß Hume dem Gesetz der Assoziation als Tendenz, von gewissen Vorstellungen zu anderen überzugehen, insbesondere gemäß dem Prinzip von Ursache und Wirkung. 8 Aussagen über Tatsachen bzw. über das Verhältnis von Tatsachen zueinander beruhen also in letzter Konsequenz immer auf Erfahrung unter dem Gesetz der Assoziation von Vorstellungen mit Hilfe der Beziehung von Ursache und Wirkung, d.h. die erwartete Wirkung wird aufgrund bisheriger Erfahrung erschlossen. Allerdings ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung nach Hume nicht streng allgemeingültig und notwendig, sondern A und B werden dann kausal verknüpft genannt, wenn deren Aufeinanderfolge mehrfach beobachtet wurde, so dass der Vorstellung von A die von B assoziativ aufgrund unserer Gewohnheit folgt. Die Frage was Erfahrung sei, beantwortet er also anhand bzw. unter Berücksichtigung der Kausalität, verstanden als Folgerung von Tatsachen. Der Ursprung des Kausalprinzips ist für ihn weder aus reiner Vernunft noch aus objektiver Erfahrung zu gewinnen. Für H. ist es unmöglich, die Wirkung einer Ursache gedanklich abzuleiten, und mit absoluter Notwendigkeit darzustellen, d.h. es gibt keine letztgültige Begründung, warum, wenn A auftritt, B darauf notwendig folgen muss oder gar mit A notwendig verknüpft ist. Die Gewohnheit und Regelmäßigkeit des Lebens bringen uns dazu, Assoziationen zu erstellen, diese können aber nicht beweisen, dass das bisherige Geschehen in der Art und Weise wie bisher, noch einmal auftritt, es ist nicht logisch notwendig, sondern zufällig, weil auch das Gegenteil der Fall sein kann. Vielmehr ist es die Gewohnheit, die unsere Erfahrung versucht, nutzbringend zu gestalten. Nach H. ist es der Glaube an Gesetzmäßigkeiten der uns dazu bringt Gesetze aufzustellen, die wir allerdings aus Beobachtung und Erfahrung gewonnen haben. Die Kraft, die zwei Geschehnisse miteinander verbindet, sei uns laut H. aber nicht zugänglich, es ist für uns nur eine konstante Beziehung zwischen Vorgängen. Zusammenhänge sind für uns also erkennbar, nicht aber die tatsächlichen Verknüpfungen, diese gestalten wir selbst durch Assoziation, die durch Gewohnheit zustande kommt. So ist Kausalität subjektiv, da bei wiederholten Vorgängen ein Gefühl subjektiver Notwendigkeit entsteht, das gegenüber A und B eine Erwartung erzeugt. Es entsteht ein intensives und lebhaftes Überzeugungsgefühl, das sich an Vorstellungen und Abläufe knüpft, nicht nur an Gedanken oder Vorstellungen. Wir sind felsenfest davon überzeugt. Dessen ungeachtet gebrauchen wir Assoziation, Gewohnheit und unsere Überzeugung (Glaube) für unsere Erfahrungsobjekte. Hiermit gründen wir laut H. Gesetze und allgemeine Ursachen, ohne die Transzendenz dabei zu nutzen, da die von H. vorgestellte Theorie eine empirische ist. Bei ihm spielt die Vernunft also keine allzu große Rolle, sie dient mehr oder minder nur der sinnvollen Verknüpfung von Geschehnissen. Er sagt auch, dass die Vernunft für sich allein nicht das Handeln bestimmen kann, sondern das jedes Handlungsmotiv gesteuert ist von einem Gefühl oder im Affekt geschieht. So ist für ihn Sittlichkeit erlebnisorientiert, gefühlt und hinterfragt, es richtet sich nach der Gesellschaft und deren Interessen. Handlungen werden als positiv bewertet, wenn sie nützlich oder angenehm sind für das Individuum selbst oder für andere bzw. das Ganze der Gemeinschaft. Die subjektiven Empfindungen beruhen für Hume dabei wesentlich auf den beiden Prinzipien der Selbstliebe und der Sympathie. Die Aufgabe einer Moralphilosophie liegt für Hume entsprechend darin, auf der Basis empirischer Methoden, die tatsächlich bestehenden moralischen Wertungen zu erklären, ohne sich dabei auf spekulative oder metaphysische Voraussetzungen bzw. Prämissen zu stützen. 9 Literatur (Auswahl): Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel/Stuttgart: Schwabe, 1971ff. Grundtexte: Hume, David: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748). Deutsche Übersetzung: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hamburg: Meiner, 12. Aufl., 1993 Hume, David: An Enquiry Concerning the Principles of Morals. (1751). Deutsche Übersetzung: Eine Untersuchung der Grundlagen der Moral. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. 3. Kritischer Idealismus 3.1. Definition des Kritischen Idealismus (Transzendentaler Idealismus) Eine Definition des kritischen bzw. transzendentalen Idealismus gibt Kant selbst in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1781: „Ich verstehe aber unter dem transzendentalen Idealism aller Erscheinungen den Lehrbegriff, nach welchem wir sie insgesammt als bloße Vorstellungen und nicht als Dinge an sich selbst ansehen, und dem gemäß Zeit und Raum nur sinnliche Formen unserer Anschauung, nicht aber für sich gegeben Bestimmungen oder Bedingungen der Objekte als Dinge an sich selbst sind“ (Kr.d.r.V., A 369) 3.2. Die Position des Kritischen Idealismus in ihren Grundzügen in Absetzung vom Rationalismus, Empirismus und Skeptizismus Kants Erkenntnislehre, so wie er sie maßgeblich in den beiden Auflagen der Kritik der reinen Vernunft vorlegt, stellt eine die Positionen und wesentlichen Momente des Rationalismus und Empirismus in einem neuen Standpunkt überführende, eigenständige Position dar. (Kurze Wiederholung) Sehr vereinfachend lässt sich der mit dem philosophischen Ansatz Descartes’ anhebende und sich über Spinoza, Malebranche bis hin zu Leibniz entfaltende Rationalismus als Position beschreiben, die davon ausgeht, dass sich das Wesen der Dinge durch eine Erkenntnis erfassen lässt, die allein auf reinen, der Vernunft bzw. dem (reinen) Denken selbst entsprungenen Begriffen beruht. Nicht die Erfahrung oder die Sinnlichkeit, die als eine depotenzierte und als solche nicht unmittelbar erkennbare, sondern verworrene Vernunfterkenntnis bloß ein minderes Vernunftvermögen darstellt, ist Ursprung und Grundlage wirklicher Erkenntnis, sondern die Vernunft und ihre reinen Begriffe, die es mit Hilfe der philosophischen Reflexion aus der verworrenen Erkenntnis, die uns die Sinnlichkeit bietet, herauszustellen gilt. Die von Bacon über Hobbes zu John Locke, Berkeley und Hume führende empiristische bzw. erfahrungsphilosophische Tradition geht dagegen davon aus, dass Erkenntnis allein auf sinnlicher Wahrnehmung – Beobachtung und Experiment – beruht. Hierbei hebt unsere Erkenntnis mit den Sinnen an und verbleibt im Bereich dieser Sinnlichkeit. Die Vernunft stellt dabei kein eigenständiges und spontanes Vermögen dar, welches Ideen und Begriffe aus sich selbst hervorbringen könnte. Vielmehr stammen ihre Vorstellungen, die sie aufeinander 10 bezieht und Gleichheiten oder Verschiedenheiten feststellt, allein aus der sinnlichen Wahrnehmung. Allerdings gibt es weder für den Rationalismus noch für den Empirismus Grund, daran zu zweifeln, dass die Dinge, so wie sie an sich sind, unserer Erkenntnis in irgendeiner Form zugänglich sind. Beide Positionen verfahren also unkritisch und dogmatisch. Denn der Rationalismus setzt die uneingeschränkte Erkenntnisfähigkeit unseres Vernunftvermögens, der Empirismus die uneingeschränkte Erkennbarkeit der Dinge unhinterfragt voraus. In der Weiterführung des Empirismus stellt sich für David Hume nun gerade im Hinblick auf die Möglichkeit von Erkenntnis das Problem, wie die sinnlich gegebenen Vorstellungen bzw. Wahrnehmungen überhaupt systematisch verbunden werden. Für ihn sind es insbesondere die Vorstellungen der Kausalität und der Substanz, vermittels deren wir die Wahrnehmungen zu einer einheitlichen Erfahrungswelt ordnen, und so zu Erfahrungsurteilen gelangen. Da für Hume Kausalität und Substanz weder reine Verstandesbegriffe noch reine Vernunftbegriffe sind, sondern lediglich auf Gewohnheit und Einbildung beruhen, ist in der Konsequenz dieser These jegliche Möglichkeit einer streng allgemeingültigen und notwendigen Aussage in den Bereichen der Naturwissenschaften und der Metaphysik ausgeschlossen. Dem Dogmatismus rationalistischer wie auch empiristischer Provenienz stellt der Skeptizismus Humes also ein mehr oder weniger begründetes Meinen oder Glauben gegenüber. (Kants Position in Grundzügen) Im Hinblick auf den wichtigen Begriff der Kausalität geht auch Kant davon aus, dass unsere Erkenntnis von der Erfahrung anhebt, denn um zwei Sachverhalte als Ursache und Wirkung zu bestimmen, müssen wir zuvor zumindest zwei Wahrnehmungen haben. Lässt sich für Hume nun nicht einsehen, mit welchem Recht wir beide Wahrnehmungen mit strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit im Sinne von Ursache und Wirkung verbinden, wir also den Gebrauch des Begriffs der Kausalität aus reiner Vernunft begründen können, so lässt sich für Kant dagegen der Begriff der Ursache, auf den auch Hume nicht verzichten wollte, aus der Erfahrung niemals begründen, weil der Begriff der Kausalität in der Erfahrung gar nicht beobachtet werden kann. Zwar muss es für Kant – entgegen den Positionen des Empirismus und Skeptizismus – insofern von jeglicher Erfahrung unabhängige bzw. reine Verstandesbegriffe (Kategorien) geben, entgegen einer ontologisierenden rationalistischen Metaphysik, die glaubt, aufgrund solcher reinen Begriffe zu einer klaren und deutlichen Erkenntnis des Wesens der Dinge und des moralisch Guten zu gelangen, schränkt Kant die Geltung solcher reinen Erkenntniselemente allerdings auf den Bereich einer uns möglichen Erfahrung ein. Das Ding an sich bzw. die Wirklichkeit, wie sie unabhängig von aller Erfahrungsmöglichkeit für sich selbst als absolute Realität besteht, auch wenn Kant ein solches Ding an sich denknotwendig voraussetzen muss, ist und bleibt gemäß Kant für uns unerkennbar. Die reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) besitzen zwar objektive Geltung, allerdings nur im Hinblick auf eine uns mögliche Erfahrung und deren Objekte. Gegenüber dem Rationalismus betont Kant die Unverzichtbarkeit der sinnlichen Anschauung für die Erkenntnis. Zwar stellt die Sinnlichkeit für Kant eine rezeptive Fähigkeit des Gemüts dar, von Gegenständen affiziert zu werden, dennoch ist sie – neben dem Verstand – einer der Stämme unseres Erkenntnisvermögens. Damit allerdings Erkenntnis entstehen kann, müssen 11 Sinnlichkeit und Verstand zusammenkommen. Denn durch die Anschauung werden uns zwar Gegenstände gegeben, durch den Verstand aber werden sie gedacht, d.h. begrifflich bestimmt. Kant geht es dabei im Folgenden allerdings weder um die empirischen Bedingungen unseres Verstandesvermögens, noch geht es ihm um eine empirisch begründete Theorie hinsichtlich der materialen Wirkung von Gegenständen auf unsere Sinne, die den reinen Verstandesbegriff der Kausalität bereits voraussetzen muss. Eine solche Theorie würde letztlich wieder auf die Position Humes und die mit ihr verbundenen Probleme bzw. auf den Schluss hinauslaufen, dass die Möglichkeitsbedingungen der Erfahrung die Möglichkeitsbedingungen der Gegenstände der Erfahrung sind. Eine solche Position lässt keinerlei Spontanität unseres Erkenntnisvermögens zu. Kant behauptet vielmehr, dass die Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung überhaupt zugleich die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sind. Insofern meint auch eine transzendentale Ästhetik (Ästhetik hier im Sinne der ursprünglichen griechischen Bedeutung von ›aisthesis‹ als ›sinnliche Wahrnehmung‹) nicht die Untersuchung der empirischen Wirkung von Gegenständen auf unsere Sinnesorgane, die – durch die von dem Gegenstand ausgehende Wirkung im Sinne des kausalen Zusammenhanges – zum Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen bzw. zur Empfindung veranlasst werden, sondern es geht ihm um den rein formalen Bezug der Sinnlichkeit und des Verstandes auf den Gegenstand. Die Sinnlichkeit stellt insofern eine Bedingung der Möglichkeit dafür dar, dass uns Gegenstände überhaupt als Erscheinungen gegeben werden. Der noch begrifflich unbestimmte Gegenstand einer sinnlichen Anschauung heißt bei Kant entsprechend Erscheinung, die durch den Verstand und seine reinen Begriffe bestimmte Erscheinung aber heißt Objekt. Literatur: Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (erste Auflage 1781) Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783) Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (zweite Auflage 1787) 12