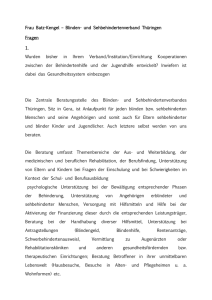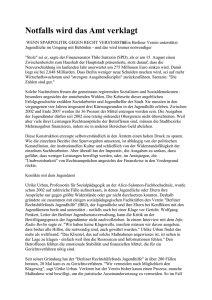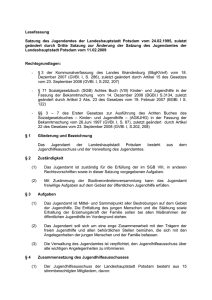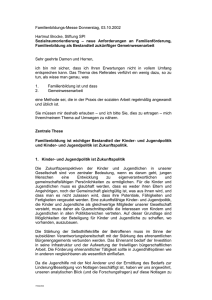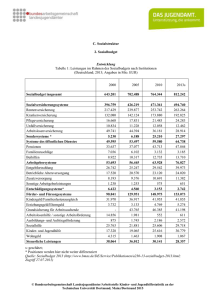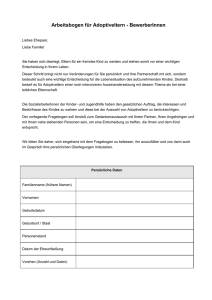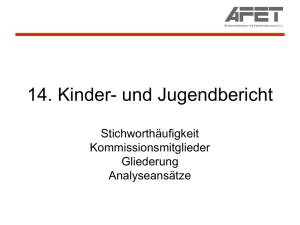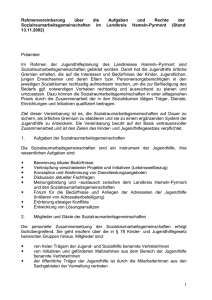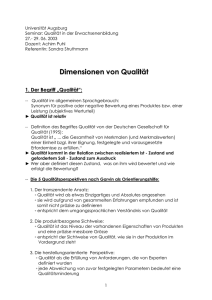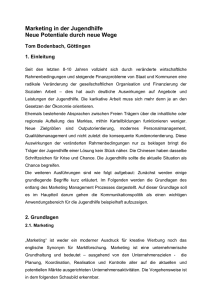DIE JUGENDHILFE UND DIE KRISE DES FORDISMUS
Werbung

III TEIL B: JUGENDHILFE FELD DES SOZIALEN UND DIE ENTWICKLUNGSDYNAMIKEN IM Gewohnheitsmäßig verdrängen wir schon das Faktum, dass die physische Qualität der Gesellschaft vermindert wird, wenn wir ihre schwächsten Mitglieder künstlich am Leben erhalten. Doch wir verschließen außerdem die Augen davor, dass auch das moralische und intellektuelle Niveau sinkt, wenn wir jene mitschleppen, die am wenigsten imstande sind, für (Herbert Spencer) sich selbst zu sorgen. 131 III. 1 JUGENDHILFE UND DIE KRISE DES FORDISMUS Die allgemeinste Aufgabe Sozialer Arbeit besteht in einer vermittelnden und führenden Bearbeitung des Verhältnisses von vergesellschaftetem Subjekt und subjektivierender Gesellschaft. Diese ‚Vermittlung’ geschieht innerhalb der Regelmäßigkeiten, die der Sozialen Arbeit in Form des Standes und Entwicklungsgrad jenes ‚space of rule’, der ‚das Soziale’ bezeichnet, zu Grunde liegen. Vor diesem Hintergrund ist es theoretisch notwendig, Jugendhilfe als eine gesellschaftliche Tätigkeit zu analysieren, die sowohl bezogen auf die gesellschaftliche Konstitution der Bereiche, die sie fokussiert, als auch hinsichtlich ihrer Konzepte, Methoden und Strategien durch die Rationalitäten der vorherrschenden sozialen Regulationsweise einer gesellschaftlichen Formation figuriert wird. Die Hochphase der Jugendhilfe als die Pädagogik des Sozialstaats (vgl. Böhnisch 1982) ist durch ihre enge und existenzielle Verknüpfung mit den Anforderungen und politischen Logiken und Rationalitäten des keyenesianisch-fordistischen Sozialstaats gekennzeichnet. Die Form der Hilfeleistungen wie die damit verknüpften Kontrollfunktionen der Jugendhilfe folgen im Wesentlichen den Anforderungen dieser Form des Sozialstaats an ‚seine’ Pädagogik. Strategisch und konzeptionell kann die Jugendhilfe in so fern als eine typische Profession des wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsfordismus betrachtet werden. Mit einer Neugestaltung der Rationalitäten, Arrangements und politischen Funktionen des Sozialaalstaates ebenso wie einer Modulation des Ensembles der Regelmäßigkeiten im Sozialen am Ende des ‚Fordismus’ wandelt sich auch die Jugendhilfe als dessen Teil. Die Dominanz ‚traditioneller’ Deutungs- und Handlungslogiken und Selbstverständnisse der Jugendhilfe wird dabei durchbrochen. Das bedeutet nicht, dass diese völlig verschwunden sind oder durch völlige ‚Neuerfindungen’ ersetzt worden sind. Die ‚fordistischen’ ‚Gegenstände’ sozialer Arbeit und die Art und Weise ihrer Bearbeitung werden nicht einfach obsolet, aber durch neue Entwicklungen sowie innerprofessionelle und disziplinäre Diskurse moduliert, relativiert, neu kontextuiert und dabei teils neu gestaltet, teils aber auch nur umetikettiert. Auf einer fachlichen Ebene ist es nicht zuletzt der verstärke Ruf nach Prävention als einer zentralen Strukturmaxime einer ‚modernen’ Jugendhilfe (vgl. Thiersch 1995), der den sukzessiven Niedergang des ‚alten’ Hilfe- und Kontrollparadigmas einläutet. Dabei beinhaltet die vorangetriebene, präventive Orientierung sowohl eine Zuspitzung der ‚traditionellen’ Widersprüche und Probleme des Sozialstaats wie der Funktion der Jugendhilfe in der ‚fordistischen’ Formation des Sozialen, als auch eine Kritik und Reaktion auf die Krise der Organisation, Gestaltung und Regulation der fordistischen Gesellschaftsformation des modernen Kapitalismus. Die institutionalisierte Entsprechung dieser Gesellschaftsformation auf der Ebene des Sozialen stellt eine Staatsform dar, die in so fern als ein ‚sozialdemokratischer’ Interventionsstaat (vgl. Dahrendorf 1987) bezeichnet werden kann, wie auch im - auf nationalökonomischer Ebene deutlich durch die Erhard’sche Variante des ‚Ordoliberalismus’ (vgl. Erhard 1962, Eucken 1949) geprägten - ‚konservativen’ Wohlfahrtsregime der Bundesrepublik (EspingAnderson 1990) eine ‚strukturelle, d.h. parteienabhängige bzw. -übergreifende (vgl. Aspalter 2001) - 132 ‚sozialdemokratisch-keynesianische Symbiose’ (vgl. Scharpf 1992) ein wesentliches Charakteristikum sozialpolitischer Regulation darstellt. Wie für alle (sozial)staatlichen Institutionen gesellschaftlicher Regulation lässt sich nun auch für die Jugendhilfe davon sprechen, dass tiefgreifende gesellschaftliche und politische Wandlungsprozesse Veränderungen des Referenzrahmens ihrer Organisations- und Interventionsstategien, -technologien und Ziele induzieren und zumindest langfristig betrachtet auch eine Veränderung dieser Institutionen selbst. Es zunächst ist es kaum mehr als eine unspektakuläre, historische und sozialwissenschaftliche Wahrheit, dass sich moderne Gesellschaften - als historisch kontingente, ideologische, ökonomische und politische Formationen (vgl. Althusser 1968) - ebenso permanent wandeln, wie die in ihr vorherrschenden Muster und Rationalitäten ökonomischer, kultureller und sozialer Produktion, Reproduktion und deren politische Regulation. Auch wenn institutionellen Dynamiken ein mitunter erstaunliches Maß an Eigenlogik aufzeigen wirkt sich Veränderungsdynamik auch auf die Institutionen – ihrerseits selbst Teil der Gesellschaft – aus (und vice versa). Solche permanenten Dynamiken und ‚Krisen’ müssen kein Indikator für Unstabilität oder Diskontinuität einer gesellschaftlichen Formation sein, vielmehr lässt sich die permanente politische Herstellung einer Balance dieser Prozesse – ein Hinweis auf die Tatsache, dass eine ‚Ordnung’ hergestellt werden muss und d.h. auf die Tatsache von ‚Regierung’ – auch als Hinweis für ‚Stabilität’ begreifen: Sie sind, wie es Durkheim (1961: 157) formuliert, „Bestandteil einer jeden gesunden Gesellschaft“. Seit Ende der 1970er Jahre befinden sich westlichen Gesellschaften jedoch in einer zunehmend fundamentalen und strukturellen Umbruchsituation. Insbesondere seit den 1980er Jahren lauten die Schlagworte ‚Krise des Sozialstaats’ und ‚Krise der Arbeitsgesellschaft’, sowie damit je im Zusammenhang stehend ‚Ökonomisierung’, ‚Deregulierung’, ‚Entindustrialisierung’, ‚Globalisierung’ etc.. Zugleich hätten die alten Klassen, Großorganisationen und sozialen Milieus ihre integrative Kraft verloren, die ‚Normalität des Normalarbeitsverhältnisses’ (Mückenberger 1986) und gesellschaftliche ‚Normalbiographien’ würden erodieren, Solidaritäten brüchig und Sicherungssysteme fragil: die kapitalistischen Gesellschaften des ausgehenden 20. Jahrhunderts würden sich zu ‚Konkurrenz-’ und ‚Risikogesellschaften’ wandeln. In diesem Kontext wird die Frage nach der gesellschaftlichen ‚Normalität’ - oder besser nach dem faktischen und wünschenswerten gesellschaftlichen Staus quo neu verhandelt und damit auch die Frage nach dem Gegenstand an dem sich die Soziale Arbeit in ihrer helfenden und kontrollierenden Dimension orientiert. Um diese gesellschaftliche Umbruchsituation theoretisch angemessen zu fassen, reicht eine sozialstrukturelle Analyse auf der Basis der theoretischen Werkzeugen Pierre Bourdieus alleine nicht aus. Eine Analyse, die sich nicht nur auf innerfeldspezifische Prozesse in einer gegebenen Gesellschaftsformation beziehen soll, sondern ihren Blick zugleich auch auf die sich wandelnde gesellschaftliche Formation richtet, d.h. auf die politischen, ökonomischen und ideologischen Regelmäßigkeiten der Regulation und Konstitution des sozialen Raums, verlangt andere und weitere Analysewerkzeuge. Auch mit Blick auf die Jugendhilfe kann sich eine sozio-analytische Einordnung nicht auf Rekonstruktion klassenstruktureller Einbettungen und Relationierungen zu den gegebenen 133 gesellschaftlichen Verhältnissen zu beschränken, sondern hat darüber hinaus den politischen Ort der Jugendhilfe analytisch zu systematisieren: „[P]olitics and social work have been intertwined even before the profession had a name. Unless we recognize how politics shape the creation of many social policies and institutions we often take for granted, we will never comprehend the intrinsically political nature of the work we do“ (Reisch 1997: 80, vgl. Groenemeyer 2001, Sünker 2000). Für eine solche Rekonstruktion bietet sich ein auf metatheoretische Kompatibilität bedachter Rekurs auf Konzepte an, wie sie insbesondere durch Analysen im Kontext der politisch-ökonomischen ‚Theorie der Regulation’ und durch die in Anschluss an die Arbeiten Michel Foucaults elaborierten ‚Governmentality Studies’ repräsentieren. III. 1.1 GRUNDZÜGE EINER REGULATIONSTHEORETISCHEN PERSPEKTIVE Eine heuristische Basis für die Analyse von (Trans)Formationen kapitalistischer Gesellschaften lässt sich in Form der - in Abgrenzung zu einem ökonomisch verkürztem Marxismus, ebenso wie zu funktionalistischen Vorstellungen und in Auseinandersetzung 1 entwickelten - ‚regulationstheoretischen’ Ansätze mit Althussers Strukturalismus finden. Diese bieten ein breites theoretisches Angebot, „das es erlaubt, mit Blick auf die Konfliktstrukturen und Krisenprozesse, die Brüche und Diskontinuitäten kapitalistischer Entwicklung sowie ihre gesellschaftlichen und sozialen Folgen [in] einem Zusammenhang zu rekonstruieren“ (Schaarschuch 1995: 74). Die zentralen, vornehmlich produktions- und reproduktionstheoretischen Annahmen dieses Theorieentwurfs zur Krise des fordistischen Gesellschaftsmodells erweisen sich dabei als kompatibel mit den ‚sozioanalytischen’ Werkzeugen des feldtheoretischen Zugangs Bourdieus (vgl. Bourdieu 1989, Bourdieu/Wacquant 1996, Hepp 2000). Aufgrund der Analyseprobleme im Kontext einer seit Ende der 1970er Jahren beobachtbaren Entwicklung westlicher Industriegesellschaften entwickelt sich ein ‚regulationstheoretischer’ Versuch einer Weiterentwicklung marxistischer Theorietraditionen zunächst in Frankreich. Die regulationstheoretisch vorgeschlagene Perspektive zielt vor allem auf die Analyse der Art und Form staatlicher Operationen in fortgeschritten kapitalistischen Gesellschaftsformationen. Gegenüber ökonomisch verkürzten Annahmen wird eine Verselbstständigung der Sphären von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft behauptet (vgl. Lehnhardt/Offe 1977, Offe 1972), wobei die Prämisse zentral ist, dass „[even if] the structural forms may determine state forms in the sense that the create certain pressures and generate certain parameters, the nature of state cannot simply be ‚read off’ form economic developments and that processes of capital accumulation are not themselves automatic but accomplishment” (Edwards/Matthews 1996: 214). Der analytische Vorteil des regulationstheoretischen Analysemodells liegt dabei in der Möglichkeit, die ökonomischen Verkürzungen instrumentell-marxistischer Ansätze, ebenso zu vermeiden wie eine Vernachlässigung ökonomischer und politischer Dimensionen zugunsten einer einseitigen Dominanz kultureller und kommunikativer Ansätze (vgl. Dangschat 1998). Die Überlegungen der Diese Ansätze lassen sich auf Arbeiten aus den Kreisen der französischen ‚Ecole de la Régulation’ und der USamerikanischen , Social Structures of Accumulation School’ zurückführen. 1 134 Regulationsschule münden jedoch nicht in eine eindeutig ausformulierte eigenständige ‚Gesellschaftstheorie’, sondern stellen eher eine ‚heuristische Konzeption’ dar (vgl. Hübner 1990), die es ermöglicht ein theoretisches Gerüst zu liefern, um die Umbrüche seit den 1970er Jahren zu analysieren. In diesem Sinne richten regulationstheoretisch beeinflusste Ansätze – hier besteht eine Korrespondenz zu Bourdieus ‚Sozioanalyse’ - ihren analytischen Blick auf „das durch spezifische Macht, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse strukturierte gesellschaftliche Ordnungsgefüge und die in diesem eingeschrieben Kämpfe“ (Bieling 2000: 197), ohne dabei die je historisch gültige gesellschaftliche Ordnung einseitig aus ökonomischen Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten (vgl. Hradil 1999, dazu auch: Bourdieu 1982, 1985, 1987, Bourdieu/Wacquant 1996). Kapitalistisch organisierte, gesellschaftliche Formationen werden als ein mehrdimensionaler, teils widersprüchlicher Ausdruck des jeweiligen Standes der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verstanden (vgl. Röttger 1997). Die Analyse eines spezifischen Verweisungsverhältnisses von Ökonomie und Politik wird mit der Analyse gesellschaftlicher Kraftfelder, Kräfteverhältnisse und Konfliktlinien verbunden. In den Vordergrund rückt aus einer regulationstheoretischen Perspektive die Frage nach Schaffung und Gestaltung der inneren Stabilität sozialer Ordnungen, die die Grundlage für die Herausbildung eines gesellschaftlich wirksamen Wertesystems darstellt und es ermöglicht jenen symbolischen Raum zu generieren, der die Entsprechungsverhältnisse und Austauschprozesse zwischen den Rationalitäts- und Regelmäßigkeitssystemen des Politischen, Sozialen und Ökonomischen zulässt, die für eine Erzeugung stabiler Gesellschaftsformation erforderlich sind. Die Grundprämisse regulationstheoretischer Ansätze besteht darin, dass der Erfolg kapitalistischer Arbeitsmärkte und ihres Geld- und Güterverkehrs aufgrund ihrer inhärenten Widersprüchlichkeit und Instabilität nur durch (sozial)politische Einbettungen und Steuerungen sichergestellt werden kann (vgl. Roth 1998). Eine solche Einbettung ist notwendig, da die ‚reine’ ökonomische Rationalität alleine nicht im Stande ist die Produktions- und Reproduktionsweisen einer wie auch immer organisierten Gesellschaft im konjunkturellen, zeitlichen Verlauf gleichgewichtig und reibungslos zu vollziehen (vgl. Aglietta 1998). Auf der Basis dieser Grundeinsicht rückt die Regulationstheorie jene gesellschaftlichen Kräfte in das Zentrum ihrer Analyse, die eine langfristige Stabilität des gesellschaftlichen Systems garantieren oder eben eine Transformation einer gesellschaftlichen Formation notwendig erscheinen lassen. Dabei nimmt neben der Analyse der Produktionsverhältnisse im engeren Sinne, auch die der Konsum-, bzw. sozialen Lebensformen, der politische und rechtliche Gestaltung der Klassenkämpfe wie rechtliche und soziale Ausformungen der Lohnarbeit (vgl. Aglietta 1979), kurz: die Analyse der sozialen und politischen Institutionen wie der sozio-kulturellen Normen und Ideologien zur Regulation der technologisch-ökonomischen Entwicklung, eine zentrale Stellung ein. Als analytische Einheiten dienen den regulationstheoretischen Ansätzen dabei die Begriffe des ‚Akkumulationsregimes’, der ‚Regulationsweise’ und der ‚hegemonialen Struktur’ einer Gesellschaft, deren Interdependenz den Fokus regulationistischer Überlegungen darstellen. Dabei wird angenommen, dass die Herausbildung, Stabilisierung und Reproduktion einer spezifischen, gesellschaftlichen Formation, bzw. eines ‚historischen Blocks’ (vgl. Gramsci 1991 ff, Jacobitz 1991) auf ein Entsprechungsverhältnis von Akkumulationsregime und Regulationsweise verwiesen ist. 135 Das Akkumulationsregime beschreibt „die makro-ökonomischen Regelmäßigkeiten und das besondere sozio-ökonomische Reproduktionsmuster der kapitalistischen Akkumulation“ (Bieling 2000: 200), d.h. es kennzeichnet eine Korrespondenz von Mustern der Produktion und des Konsums (vgl. Jessop 1986: 11). Bestandteil eines Akkumulationsregimes ist sein ‚technologisches Paradigma’, das die allgemeinen Prinzipien der Technikverwendung und Organisation von Arbeit bezeichnet, auf denen das jeweilige Akkumulationsregime basiert. Der Gesellschaftsstruktur besteht in maßgebliche der Einfluss Sicherstellung des einer Akkumulationsregimes systematischen auf die Reallokation des gesellschaftlichen Produkts (vgl. Lipitz 1985). Diese manifestiert sich im Wesentlichen über die Revenuen des Lohnverhältnisses aber auch über den Geld-, Waren- und Kreditverkehr in einem allgemeinen Sinn. Entscheidendes Element eines solchen Akkumulationsregimes ist die je dominante Produktionsweise, die auf die Arbeits- und Produktionsorganisation, auf die vorherrschenden Formen der Kapitalbildung und Kapitalreproduktion und auf die Mehrwertproduktion, Kapitalverwertung sowie Mehrwertrealisierung verweißt. Die Reproduktionsform eines solchen Regimes kennzeichnet die Struktur des gesellschaftlichen Verbrauchs entsprechend produzierter Güter und Dienstleistungen und damit verbunden auch die vorherrschenden Investitionszyklen und Konkurrenzformen. Untrennbar der mit Form des Akkumulationsregimes verknüpft, ist aus einer regulationstheoretischen Perspektive auch auf Frage der (sozial)staatlichen Regulation und der klassenspezifischen Weise des Konsums und der Reproduktion von Arbeitskraft. Regulationstheoretisch wird davon ausgegangen, dass soziale, institutionelle und politische Gegebenheiten konstitutiv und regulierend auf die kapitalistische (Re)Produktion einwirken. Diese ‚Regulationsweise’ bezeichnet die Steuerung der divergierenden, teils antagonistischen Interessen, die auf eine Weise geformt, verbunden oder kanalisiert werden, dass die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur, bzw. die ‚Reproduktion der Produktionsbedingungen’ (vgl. Althusser/Balibar 1972) – insbesondere hinsichtlich der Verfügung über genügend qualifizierter Arbeitskräfte (vgl. Lipitz 1992: 49) – gewährleistet und aufrecht erhalten werden kann. Die Regulationsweise umfasst also die „Gesamtheit institutioneller Formen, Netze und expliziter oder impliziter Normen, die die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines Akkumulationsregimes sichern“ (Lipitz 1985: 121). Sie bezieht sich nicht nur auf Unternehmensformen, Lohnverhältnisse, Geld- und Kreditbeziehungen etc., sondern umschießt auch Fragen nach den nationalen Spezifika der Regime und der Staatsinterventionen in ihren ökonomischen, sozialen, kulturellen symbolischen und rechtlichen Dimensionen. In den grundsätzlich als ‚krisenhaft’ verstandenen Prozessen der Regulation von Akkumulationsverhältnissen zielt das Funktionsprinzip der Regulation auf die Balance bzw. den Ausgleich von Störungen (vgl. Diettrich 1999). Epistemologisch unterscheiden sich regulationstheoretische von ableitungstheoretischen und funktionalistischen Annahmen dadurch, dass aus dieser Perspektive eine bestimmte Form der Regulation nicht kausal durch das Akkumulationsregime determiniert wird. Vielmehr ist ein Akkumulationsregime prinzipiell mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Regulationsweisen kompatibel. Sowohl das Akkumulationsregime, als auch die Regulationsweise sind ein je mögliches, strukturiertes Resultat des historischen und kontingenten Handelns, ökonomischer, gesellschaftlicher 136 und politischer Akteure und kein alleiniges Produkt ‚objektiver’ exogenen Determinanten. Die historisch konkrete Gesellschaftsformation wird daher als eine spezifische Form des Zusammenwirkens von Akkumulationsregime und Regulationsweise interpretiert. Eine solche Formation kann nur dann einen stabilen und dauerhaften Regulationszusammenhang darstellen, wenn die gesellschaftlichen Konflikte und Antagonismen beider Ebenen ausbalanciert und regulativ bearbeitet werden können (vgl. Hirsch 1990). Von einem Entwicklungsmodell oder einer Gesellschaftsformation, ist deshalb dann die Rede, wenn durch ein relatives Entsprechungsverhältnis der ökonomischen, sozialen, kulturellen, politischen und symbolisch-ideologischen Dimensionen einer Gesellschaft eine bestandsfähige und dynamische Kräftekonstellation erreicht wird. Umgekehrt wird die Reproduktion des ‚Gesamtsystems’ - als historische Artikulation einer gesellschaftlichen Formation - durch die Erzeugung und Aufrechterhaltung eines solchen Entsprechungsverhältnisses als ‚hegemoniales Entwicklungsmodell’ abgesichert. Ein hegemoniales Entwicklungsmodell ist weder das Ergebnis eines funktionalistischen ‚Masterplans’ hinter dem Rücken handelnder Akteure, noch kann es alleine auf bewusste und strategische Einflussnahmen identifizierbarer Akteure zurückgeführt werden. Es umfasst auch die strukturgenerierenden Momente präreflexiv strukturierter Praktiken, inkorporierter Deutungsmuster und Routinen des Alltags. ‚Hegemonie’ ist deshalb als ein doppeltes Verhältnis zu begreifen: als ein in institutionalisierten Kompromissen und sozialen Regelmäßigkeiten verobjektiviertes materielles Substrat und als ein gelebtes soziales Verhältnis (vgl. Bieling 2000). Vor allem dieser Bezug auf die Akteure und sozialen Praxen macht eine Kompatibilität der regulationstheoretischen und der ‚praxeologischen’ Annahmen Bourdieus deutlich. So hat in Bourdieus Ansatz die Verinnerlichung von Spielregeln, Gewohnheiten und Vorstellungen (Habitus, Doxa) einen zentralen Stellenwert. Die Konstitution der Kapitale als Machtmittel und Common Sense der Felder kann daher in einer differenztheoretischen, mirko- und mesologischen Korrespondenz zu der regulatorischen Fassung hegemonial strukturierter gesellschaftlicher Verhältnisse verstanden werden. Mit Blick auf moderne, ausdifferenzierte und komplexe Gesellschaften besteht der analytische Vorzug des Kapitalmodells Bourdieus dabei in der Einsicht, dass die Kapitalen nicht einheitlich, gleichmäßig und in gleicher Weise umfassend funktional den gesamten sozialen Raum strukturieren, sondern ihre Wirksamkeit feldspezifisch differenziert verortet wird. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ein Wandel der gesellschaftlichen Formation - der auf Basis einer regulationstheoretischen Heuristik analytisch fassbar ist - bezogen auf einzelne soziale Felder nicht gleichförmig wirkt und umgekehrt auch die Veränderung in einzelnen Feldern nicht direkt auf eine allgemeine und homologe Ursache zurückzuführen sind. Die Verschiebungen von einer ‚fordistischen’ zu einer ‚nach-fordistischen’ Gesellschaftsformation bzw. von einem übergreifenden wohlfahrtstaatlichen Arrangement zu einem ‚fortgeschrittenen Liberalismus’2 (vgl. Rose 1996a, O'Malley 2001a) müssen in unterschiedlicher Weise Der Ausdruck ‚fortgeschritten liberal’ bzw. ‚fortgeschrittener Liberalismus’ (advanced liberalism) wurde vor allem von Nikolas Rose etabliert. Er bezeichnet eine bestimmte Form der Regulations- bzw. ‚Regierungsweise’ (im weiten Sinne Foucaults), die sich, so die These, (gleichberechtigt) in eine Reihe anderer ‚Liberalismen’ einordnen lässt. Diese anderen ‚Liberalismen’ wären der ‚klassische Liberalismus’, der im 19. Jahrhundert vorherrschte, und der ‚soziale Liberalismus’ als eine Art Synonym für den fordistischen Wohlfahrtskapitalismus im ‚kurzen’ 20. Jahrhundert. 2 137 in die relativ autonomen Regelmäßigkeitssysteme einzelner sozialen Felder transformiert werden, um dort strukturierend zu wirken und damit mittelbar handlungswirksam zu werden. Wenn Akkumulationsregime und Regulationsweise nur dialektisch verknüpft in Erscheinung treten können, stellt eine gesellschaftliche Formation die Gesamtheit der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse als Produkt gesellschaftlicher Auseinersetzungen auf synchroner Ebene dar. Eingebunden in diese constraints, sind es die strukturierten (kollektiven) Dispositionen der Akteure, die in einer diachronen Entwicklungsdimension die Legitimation dieses Konsenses aufrechterhalten und somit zu Reproduktion und Sicherstellung der Voraussetzungen der Wirksamkeit und Gültigkeit ökonomischer Verwertungsprinzipien und ihren politischen, sozialen und kulturellen Entsprechungen beitragen. Nur so sind sowohl die relative Bestandsfähigkeit der Reproduktion des Gesamtsystems als auch die Hegemonialverhältnisse zwischen den Klassen (vgl. Häusler/Hirsch 1987) langfristig und ‚spannungsarm’ – d.h. auch mit überschaubaren Transmissions- und Kontrollkosten – zu sichern. Durch den Rekurs auf die Regulationsperspektive als polit-ökonomischer Theorieansatz kann die bei Bourdieu implizit bleibende, in bezug auf spezifische Gesellschaftsformen insgesamt eher vage Thematisierung der gesellschaftsorganisatorischen Ursachen für unterschiedliche Kapitalausstattung und ihrer relationalen Wertigkeit ausglichen werden. In diesem Sinne stehen beide Ansätze eher in einem komplementären Verhältnis, als auf metatheoretische Inkompatibilität zu verweisen. III. 1.2 DER FORDISTISCHE WOHLFAHRTSTAAT Die Verfestigungen und Wandlungen historisch konkreter gesellschaftlicher Formationen geschehen in Abhängigkeit von der Reproduktion der hegemonialen Strukturen, oder mit Bourdieu, den Logiken der Felder, der ‚objektiven’ Zwänge und je gültigen, common sensusalen Symbolformen und Machtverhältnissen. Bezüglich der gegenseitigen Konstitution und Begrenzung der zwar strukturell kompatiblen, aber nicht-identischen Beziehung von Akkumulationsregime und Regulationsweise, ist ein gesellschaftliches Entwicklungsmodell in so fern nicht nur ökonomisch, sondern auch und in erster Line hegemonietheoretisch zu fassen. Störungen des spannungsreichen Entsprechungsverhältnisses von Akkumulationsregime und Regulationsweise werden im Rahmen der Regulationstheorie durch den Begriff der ‚Krise’ verhandelt. Während ‚kleine Krisen’ - wie zum Beispiel konjunkturelle ökonomische Krisen, oder Regierungswechsel - im politischen Feld als ‚adaptive Prozesse’ innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Reproduktionsformen verlaufen (vgl. Altvater 1983: 228), stellen ‚große Krisen’ einen gesellschaftlichen Formbruch dar, in dem die hegemonialen Entsprechungsverhältnisse auf prima faci nicht vorhersagbare Weise strukturell neu organisiert werden: „In den großen Krisen und den damit verbundenen ökonomischen, politischen und ideologischen Auseinandersetzungen verschieben sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, werden soziale Kompromisse aufgekündigt und zerbricht das vorhandene institutionelle Gefüge der Regulation“ (Hirsch 1995: 63). In einer solchen Krise bilden sich zugleich die sozialen und institutionellen Strukturen heraus, die als Ensemble die kohärenzstiftende Grundlage für eine neue strukturell hegemoniale Artikulations- und Vergesellschaftungsform bieten. 138 Eine solche ‚große’, strukturelle Krise stellt das sukzessive Ende der ‚Fordismus’ und der Übergang von einer ‚fordistischen’ in eine ‚post-fordistische’ bzw. ‚fortgeschritten liberale’ Gesellschaftsformation dar. Der Begriff ‚Fordismus’ lässt sich vor allem auf die Analysen Antonio Gramscis (vgl. 1967: 376 ff) zurückführen und bezeichnet dabei zunächst ein ‚industrielles Paradigma’, wie es in den Fabrikhallen Henry Fords vorherrschte. Ford entwickelte nicht nur eine taylorisierte, massenhafte Fließbandproduktion für sein T-Modell, sondern trat – da für Massenproduktionen auch ein massenhafter Absatzmarkt erforderlich war - auch für eine gesellschaftliche Reproduktionsform ein, die es auch den Arbeitern ermöglichte, die Produkte ihrer Arbeit selbst zu kaufen (vgl. auch Keynes 1973 [1936]). Die strukturbestimmenden Prinzipien beschrieb Henry Ford im Jahre 1928 in seiner ‚Philosophie der Arbeit’: „Stellt eine Ware so gut und billig her, wie es möglich ist, und zahlt so hohe Löhne, daß der Arbeiter das, was er erzeugt, auch selbst zu kaufen vermag; schaltet jede Verschwendung aus und spart vor allem das kostbare Gut, die Zeit; laßt alle Arbeiten, die eine Maschine verrichten kann, von Maschinen verrichten, da Menschenkraft zu wertvoll ist; erschließt immer neue Kraftquellen – und ihr müßt prosperieren“ (zit. nach Bischoff 1999: 27). Das fordistische Entwicklungsmodell bedient in weiten Bereichen nicht nur einen ex ante vorhandenen Absatzmarkt, sondern zielt zugleich darauf ab, diesen erst aktiv zu schaffen. Vor allem aber zielt es auf eine – v.a. auf einer tayloristische Arbeitsorganisation basierende - hohe und preisgünstige Produktivität des Akkumulationsregimes. Auf der Ebene der Produktionsprozesse wird das Produktionswissen der vormals eher handwerksförmig produzierenden Lohnarbeiter, innerhalb der Prozesse der Arbeitsteilung auf die Ebene des Managements übertragen. Bezogen auf das industrielle Akkumulationsregime kann dieser Prozess als Teil einer Zerstörung der bisherigen Arbeits- und Subsistenzform im Sinne einer massenhaften und anhaltenden Prozess der „passiven Proletarisierung“ (Lenhardt/Offe 1979: 102) betrachtet werden, der einen wesentlichen sozialstrukturellen Aspekt des Industrialisierungsprozesses darstellt. III. 1.2.1 REGULATIONSPERSPEKTIVE Da im Rahmen des fordistischen Entwicklungsmodells mit dem Produktionszuwachs auch die Nachfrage expandiert, verläuft die ökonomische Reproduktion relativ dynamisch und störungsfrei, was durch die Beteiligung der Lohnabhängigen an dem Wachstum der Produktion über Tarifabschlüsse verstärkt und darüber hinaus durch die Expansion des Wohlfahrtsstaates – insbesondere in seiner ‚christdemokratisch-korporatistischen’ (vgl. Mann 1997: 116) Form als Sozialstaat - sowie staatlicher Dienste in den Gebieten der Bildung, Gesundheit und des Wohnens ergänzt wird. Auf der Akkumulationsebene kennzeichnet der ‚Fordismus’ zunächst ein Regime, in dem Massenproduktion durch eine Form des Massenabsatzes ermöglicht werden soll, die gleichsam Massenkaufkraft voraussetzen. Insofern geht mit der fordistischen Ära des Industriekapitalismus eine grundlegende ‚Durchkapitalisierung’ der Gesellschaft - sowohl im produktiven als auch im konsumtiven Bereich - einher, in der immer mehr gesellschaftliche Bereiche von industriellen Massenprodukten aber auch kommerzialisierten Dienstleistungen durchdrungen werden (dazu auch Habermas 1981). Abgesichert durch eine sozialstaatlich orientierte Regulationsweise führt diese ‚Durchkapitalisierung’, 139 insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in Form eine ‚Gewinner-Koalition’ für die meisten gesellschaftlichen Akteure zu einer beachtlichen Steigerung ihres materiellen und kulturellen Lebensstandards und damit verbunden zu gesteigerten Möglichkeiten der Lebensgestaltung (vgl. Beck 1983, 1986). Dieses ‚Fortschritts-Paradigma’ (vgl. Lipitz 1991: 680 f) ermöglicht eine materielle und ökonomische Einbindung der überwiegenden Mehrheit der abhängig Beschäftigten in das hegemoniale Entwicklungsmodell des Fordismus (vgl. Bieling 2000: 207). Es versicherte zugleich, dass der grundlegende bürgerliche Modus der Vergesellschaftung über die Zirkulation von Waren relativ reibungslos auf tendenziell alle Teile der Bevölkerung ausgeweitet werden kann, die nunmehr alternativlos darauf verwiesen sind ihre Arbeitskraft warenförmig zu veräußern. Dies wird sowohl durch verhältnismäßig attraktive Löhne begünstigt, wie durch bestimmte – insbesondere gegenüber Diversität verhältnismäßig ‚intoleranten’ (vgl. Young 1999) - Formen der sozialen Kontrolle verfestigt. Der ‚Sozialtyp des Massenarbeiters’ ist die Referenz und stellt der Ebene der Arbeitskraft eine Entsprechung dar, zu einer „durch Taylorisierung, durch Fließband und [… korespendierende] Fertigungs- und Absatzmethoden sich ausweitende[n], in die ganze Stadt, in Polizei, Gefängnisse, Schulen, ja in das Denken der Menschen sich hineinfressenden Massenproduktion“ (Negt/Kluge 1978: 343 f) verbilligter Konsumgüter3: „Lohnarbeit wird zur verallgemeinerten Normal-Existenzform“ (Schaarschuch 1990: 60) eines Gesellschaftsmodells das auf tayloristisch organisierter, standardisierter Massenproduktion sowie einer staatlich-bürokratischer Verteilung eines nicht unerheblichen Teils des Mehrprodukts beruht (vgl. Hirsch 1995). Sowohl als Reaktion auf die Anliegen einer starken Arbeiterbewegung vor dem Hintergrund der Systemkonkurrenz während des Ost-West-Konflikts, als auch aufgrund ihrer ruinösen Wirkung auf die Ressource Arbeitskraft, wird in diesem Zusammenhang der Versuch Armut und Verelendung zu verhindern bzw. zu kompensieren, zunehmend in Form ausgeweiteter sozialer Rechte staatlich institutionalisiert. Ein ‚um den Arbeitsmarkt herum‘ gebautes (vgl. Narr 1999), auf Sozialversicherungsbeiträgen basierendes - und daher tendenziell eher restitutiv als umverteilend ausgestaltetes (vgl. Sachße 1990) - Sicherungssystem des Sozialstaates stellt in diesem Sinne den eher ‚arbeiter-’ als ‚bürgerallgemeinen’ Versuch (vgl. Narr 1999), einer breitgetragenen, administrativ organisierten bzw. ‚erzwungen solidarischen‘ Form der sozialen Risikoversicherung dar (vgl. Ewald 1993). Den Kern dieser administrativen Solidarität, stellt eine Form der Verbindung des Ökonomischen und des Sozialen dar, die dem keynesianischen, sozialen Staat - als der zentralen Regulationsinstanz des Fordismus - das Paradox ermöglicht, das Soziale und das Ökonomische gleichzeitig führend zu artikulieren und es dem einen nicht zu erlauben über das andere zu dominieren (vgl. Donzelot 1994). Die auf einer solchen synchronisierten Artikulation basierende, kollektivierte Risikoversicherung kann als eine Art ‚Gesellschaftsvertrag’ betrachtet werden, der durch den sozialen Staat und seine Institutionen geregelt wird. Die Rolle des Staates beinhaltet dabei die Beförderung kollektiver Wohlfahrt durch den Einsatz keynesianischer sozialer und ökonomischer Techniken der Intervention. Sowohl die Frage der (Voll)Beschäftigung als auch die assimilatorische Eingliederung von Auch wenn Hannah Arendt in ihrer ‚Vita Activa’ von einer ‚Massengesellschaft’ und der „‚sozialsten’ aller Staatsformen, nämlich der Bürokratie’ (Arendt 1994: 41) spricht, artikuliert sie in erste Line eine Kritik am fordistischen Gesellschaftsmodell in seinen beiden Varianten: dem Sozialstaat und Staatssozialismus. 3 140 ausgeschlossenen oder sozial geschädigten Akteuren fällt nicht alleine den betroffenen Akteuren selbst zu, sondern wird in erster Linie als ‚kollektivierte’ Verantwortung des Staates verstanden. Die Etablierung des fordistischen Sozialstaats ist zentral mit der Aufgabe verbunden, „ein Gleichgewicht zwischen dem Block an der Macht und den subalternen Gruppen herzustellen“ (Schaarschuch 1990: 49). Diese Ausbalancierung dient nicht nur den Interessen der Subalternen, und sichert nicht nur deren ‚Loyalität’ (vgl. Schimank/Lange 2003), sondern geschieht in Form eines ‚Klassenkompromisses’, der zugleich auch den Interessen des ‚Machtblocks’ zweckdienlich ist (vgl. Schaarschuch 1990). Für die Verwirklichung der Interessen des hegemonialen Blocks ist neben dem Faktum der Zerstörung traditioneller Subsistenzformen – und dem damit einhergehenden „stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ (Marx 1953: 777) als ‚passive Proletarisierung’, durch eine strukturelle Erschwerung von Existenzen außerhalb einer marktbezogenen, lohnabhängigen Erwerbsarbeit (vgl. Scherr 1998) - ein staatlich durchgesetzter Prozess der ‚aktiven Proletarisierung’ notwendig (vgl. Lenhardt/Offe 1979, Müller/Otto 1980), da aufgrund der bestehenden Möglichkeit „von funktional äquivalenten ‚Auswegen’ aus dem Zustand passiver Proletarisierung […] die Bereitschaft der Arbeitskräfte sich tatsächlich zu verkaufen nicht als selbstverständlich angesehen werden kann“ (Lenhardt/Offe 1979: 104). Der Sozialhistoriker John Forster (1974: 33) sieht genau darin die Essenz der ‚großen Transformation’ in die kapitalistische Moderne: „The overriding priority was to bind the emergent labor force to the new employer class - and to do so during a period in which the old selfimposed disciplines of peasantcraft society were (at once and at the same time) both disintegrating and still dangerously potent“. Im Unterschied zu anderen Waren wird Arbeitskraft im Kapitalismus zwar als Ware behandelt, jedoch ist ihre Existenz und ihr Einsatz selbst, von dieser Warenförmigkeit logisch unabhängig. Die Bereitschaft zur warenförmigen Veräußerung der Arbeitskraft musste in so fern durchgesetzt, und gesellschaftlich bzw. institutionell reguliert werden. Mit der Durchsetzung auf die kapitalistische Produktion bezogener, gesellschaftlich flexibel gestaltbarer, ‚produktiver’ und ‚nicht-produktiver’ (z.B. Kinder, Schüler, Hausfrauen, Rentner etc.) Rollen (vgl. Döbert/Nunner-Winkler 1973) kann die Frage nach der gesellschaftlichen Reaktion auf eine Nicht-Integration in den Arbeitsmarkt flexibel bearbeitet und differenziert legitimiert werden. Zugleich ist es möglich für die soziokulturelle „Integration derjenigen [… zu sorgen], die auf dem Markt nicht unterkommen können, mithin der disziplinierenden Wirkung von Arbeit entzogen sind.“ (Lenhardt/Offe 1979: 110). Diese Integrationsbemühungen gelten aber nur für nicht direkt über Lohnarbeit im fordistischen Akkumulationsregime integrierte Akteure in ‚legitimen’ ‚nicht-produktiven’ Rollen, d.h. für diejenigen, die im Sinne einer politischen Regelung nicht als Lohnarbeiter in Frage kommen, oder über keine um die Lohnarbeiterrolle organisierte Rollenidentität verfügen (vgl. Döbert/Nunner-Winkler 1973: 319). Für alle anderen Formen der Lebensführung und Identitätsbildung, ist das Ziel fordistischer Regulation eine ‚Vergesellschaftung durch Lohnarbeit’. Eine arbeitsmarkt-externe Subsistenzform wird damit faktisch dem Belieben der Träger von Arbeitskraft enthoben. In diesem strukturellen Kontext wird von Seiten des fordistischen Staates – quasi als Kehrseite der Sozialpolitik – auf das 141 „Dauerproblem der ‚sozialen Integration’ der Lohnarbeiterschaft […] mit Mechanismen der sozialen Kontrolle reagiert […], die von den Mechanismen des Arbeitsmarkes nicht zuverlässig erzeugt werden. In diesem Zusammenhang ist einerseits die Kriminalisierung und Verfolgung solcher Subsistenzweisen zu nennen, die als Alternativen zum Lohnarbeitsverhältnis infrage kommen (vom Verbot des Bettelns bis zu Repressionsakten vom Typ des Sozialistengesetzes), und andererseits die staatlich organisierte Vermittlung von Normen und Werten, deren Befolgung auf den Übergang ins Lohnarbeitsverhältnis hinausläuft.“ (Lenhardt/Offe 1979: 105) Auch die Sozialpolitik selbst formuliert dabei Zugangskontrollen und definiert den angemessenen Gebrauch der zu Verfügung gestellten Leistungen, welcher sich ebenfalls an der Lohnarbeit als Normalexistenz ausrichten. Für potentiell Erwerbstätige, die sich noch in legitimen ‚nicht-produktiven Rollen’ (z.B. Schüler) bewegen, werden Disziplinaraspekte durchgesetzt, die ihrer Rolle als zukünftiger Träger der Ware Arbeitskraft entsprechen. Neben der Erzeugung der Bereitschaft die eigene Arbeitskraft warenförmig zu veräußern, erscheint es notwendig, die Voraussetzungen des Fungierens der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter im umfassenden Sinne zu etablieren. Dies setzt zumindest idealtypisch voraus, es allen Bürgern zu ermöglichen, in den gesellschaftlichen Tauschprozess (als Lohnarbeiter) einbezogen zu werden (vgl. Offe/Ronge 1976 siehe auch Böhnisch 1994). Es beinhaltet aber auch die gesellschaftliche Bereitstellung von außerhalb des Produktionsprozesses platzierten ‚Auffangbecken’ zur Sicherstellung der Reproduktion der Arbeitskraft für den Fall, dass ein aktueller Einsatz im Produktionsprozess nicht gesichert werden kann (vgl. Böhle/Sauer 1975: 64). Das gesamte wohlfahrtsstaatliche Arrangement des Fordismus beruht somit auf bestimmten Normalitätsannahmen, „centered on mass production, strong labor unions, and the normativity of the family wage“ (Fraser 2001: 1) sowie „der dauerhaften Erwerbstätigkeit der Männer bei lediglich sporadischer Erwerbstätigkeit der Frauen, der Selbstverständlichkeit des Eheschlusses und der Familiengründung für beide Geschlechter sowie einer interfamilialen Arbeitsteilung im Sinne des Modells der Hausfrauenehe“ (Kaufmann 1997: 60). Im Zusammenhang mit der Erfüllung elementarer Reproduktionsfunktionen unter den Bedingungen des abhängigen Lohnarbeiterdaseins als Normal-Existenz, erwächst zum einen eine starke Orientierung an der traditionellen Kernfamilie als markt-externes Subsystem (dazu Donzelot 1980), zum anderen, das Erfordernis einer Reihe von (sozial-)staatlich institutionalisierten Vorkehrungen als Regulativ zum Verhältnis von Produktion und Reproduktion. III. 1.2.2 AKKUMULATIONSPERSPEKTIVE Während mit den fordistischen Interventionslogiken auf der Ebene der Regulation darauf reagiert wird, dass „die faktisch massenhaft vollzogene Transformation der depossedierten Arbeitskräfte in Lohnarbeit […] nicht ohne staatliche Politiken möglich [ist]“ (Lehnhardt/Offe 1979: 103), wird auch aus der Perspektive des Akkumulationsregimes spätestens seit dem ‚Schwarzen Freitag’ (25. Oktober 1925) deutlich, dass sich der Laissez-faire Kapitalismus und der liberale Nachtwächterstaat als untaugliche Mittel zur Stabilisierung eines möglichst krisenfreien Produktions- und Reproduktionszusammenhangs erwiesen haben. In diesem Zusammenhang wird der nach John Maynard Keynes (vgl. 1973 [1936]) benannte ‚Keynesianismus’, als eine auf Stabilität gerichtete, nachfrageorientierte Wirtschaftsdoktrin, die einen 142 Interventionismus eines gesamtwirtschaftlich bewussten Staates zur krisenentschärfenden Moderation und antizyklischen Konjunkturpolitik beinhaltet, unter der Hegemonie der USA zunehmend zur weltweit vorherrschenden Regulationsform kapitalistischer Industriestaaten und behält diese Vormachtstellung auch bis in die 1970er Jahre hinein. Während die Außenhandelsbeziehungen in Folge des Abkommens von Bretton-Woods4 reguliert werden, wird der Nationalstaat in vielfacher Hinsicht in den kapitalistischen Reproduktionsprozess integriert und soll in erster Line über die Regulation des Kapital-, Waren- und Lohnverhältnisses ex ante für die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Realisierung des produzieren Mehrwerts sorgen (vgl. Bieling 2000). Eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik versucht die Verstetigung der kaufkräftigen Nachfrage im Binnenmarkt, nicht nur durch antizyklische Konjunkturpolitik zu erreichen, sondern – innerhalb des Paradigmas der Vollbeschäftigung und eines allenfalls konjunkturellen Arbeitskräftemangels – auch durch vielerlei beschäftigungssichernde Maßnahmen, durch ein produktivitätsorientiertes Lohnniveau, durch Niedrigzinspolitik sowie durch gesetzliche Kranken-, Renten-, und Arbeitslosenversicherung zu stützen. Diese Regulationsformen sind keinesfalls nur den Interessen des ‚Blocks der Macht’ – aus dessen Perspektive andere, weit weniger ‚soziale’ Regulationsformen ebenfalls möglich, funktional und auch politisch gefordert worden waren (vgl. Dixon 2000) – geschuldet, sondern werden auch durch den gesellschaftlichen Druck ‚von unten’, forciert und ausgeweitet. Insbesondere durch eine vergleichsweise starke und aktive Arbeiterbewegung wird ein kompromisshaftes Zusammenspiel des Ökonomischen und des Sozialen im Sinne eines wohlfahrtsstaatlichen Umbaus, und einer sozialpartnerschaftlichen Integration der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung unausweichlich gemacht (vgl. Buci-Glucksmann/Therborn 1982): „[I]m Widerstreit von Kapitalinteressen und Forderungen der Arbeiterbewegung, [sieht sich] der Staat genötigt, die Zuständigkeit für die Lösung sozialer Probleme in seine Verantwortung zu übernehmen, um, im Rahmen der gegebenen Produktions- und Herrschaftsverhältnisse, neue Formen der Arbeits- und Lebenssicherung für alle durchzusetzen und damit Bestand und Entwicklung der gegebenen Gesellschaft zu ermöglichen und zu garantieren“ (Thiersch/Rauschenbach 1984: 994). Die Balance zwischen dem Ökonomischen und dem Sozialen in einem ‚keynesianischen Wohlfahrtsstaats’ (vgl. Jessop 1992) ist wesentlich durch quantitativ umfassende und auf qualitativ relativ hohem Niveau standardisierte arbeitsmarkt- und sozialpolitische Formen der Regulation und Staatsintervention sowie durch ein dichtes Netzwerk organisierter Interessen gekennzeichnet. Diese Regulationsform wird vor allem in der Bundesrepublik durch korporatistische Verhandlungsnetzwerke und sozialpartnerschaftlich ausgerichtete Gewerkschaften unterfüttert. Insbesondere das - auf eine Wahlkampfparole der SPD im Jahre 1976 zurückgehende - ‚Modell Deutschland’ steht für ein politisches Modell der Konfliktverarbeitung auf der Grundlage der Integration der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiterschaft in Verhandlungsnetzwerken. Auf einer makroökonomischen Ebene besteht das wesentliche Ziel des korporatistischen Modells darin, den Widerspruch von gesamtwirtschaftlich als sinnvoll erachteten hohen und gesicherten Löhnen und Gehältern, und dem Im 1944 getroffenen Abkommen von Bretton-Woods wurden – unter der Vorherrschaft der USA - feste internationale Wechselkurse vereinbart. Mit der Gründung des IWF und der IRBD wurde zugleich der Grundstein für das Institutionensystem der Nachkriegszeit gelegt. 4 143 betriebswirtschaftlichen Interesse der Geringhaltung der ‚faux frais de production’ (vgl. Marx 1956) auszubalancieren. Im Sinne einer Regulationsweise makroökonomischen zuweilen die bzw. Globalsteuerung, ökonomischen erfordert Einzelinteressen die keynesianische betriebswirtschaftlicher Kapitalverwertung zu durchkreuzen und verlangt von daher auch selbst sozialpartnerschaftlich ausgerichtete Gewerkschaften als Verhandlungspartner und Transmissionsriemen. Im Gegenzug stützt der keynesianische Staat diese Formen gewerkschaftlicher Organisation durch gesetzliche Garantien, Mitbestimmungsrechte und eine Sicherstellung der Tarifautonomie. Dadurch ist es möglich, die Differenzen von Lohnarbeit und Kapital in Gremien aus – idealtypisch – gleichberechtigten, korporativen Verbänden der Kapitaleigner und Gewerkschaften zu verhandeln. Insgesamt fungiert der keynesianisch-fordistische Sozialstaat demnach „unbeschadet seiner im einzelnen lebenswichtigen Qualitäten […als] ein Aufsatz auf einer privat strukturierten, also kapitalistischen Ökonomie [, …in dem ö]konomische Interessen […] einen Definitionsfaktor für die gesamte Politik dar[stellen …]. Der Staat als sozialer Staat sollte das kapitalistische Vergesellschaftungsprinzip nicht abschaffen. Er sollte jedoch das Maß an Ausbeutung und Verelendung so modifizieren, daß die Klassengesellschaft überwunden werden konnte (Narr 1999: 23 f). Die fordistische Gesellschaftsformation stellt als das ‚golden age of capitalism’ (vgl. Marglin/Schor 1991) zumindest zwischen dem 2. Weltkrieg und den 70er Jahren (vgl. Lenonard 1997), teilweise bis in die 1980er Jahre, eine ‚Welt der Inklusion’ (vgl. Young 2001) dar, die auf Vollbeschäftigung, sicheren Arbeitsplätzen, der Entwicklung des Binnenmarktes, einer Stabilisierung des Massenkonsums sowie einem durch ‚aufgeklärte’ Sozialpolitik und professionelle ‚Sozialexperten’ institutionalisierten, und gleichzeitig korporativ organisierten, Klassenkompromiss basiert (vgl. Hirsch 2000, Lenonard 1997). Diese Regulationsform ermöglicht auch dem Durchschnittsbürger seit den 1950er Jahren dabei einen Lebensstil, „den sich eine Generation zuvor allerhöchstens die Wohlhabensten hätten leisten können“ (Hobsbawm 1994: 323). Die fordistische Phase des Kapitalismus ist insgesamt gekennzeichnet durch: „den Taylorismus […] in Wirtschaftsunternehmen, ständigen Produktionsfortschritt, stetige Lohnerhöhungen, den Ausbau sozialer Sicherungssysteme, Massenkonsum, der Ausweitung der Beschäftigung, der Vorherrschaft der Kernfamilien, die auf Konsum und die Reproduktion der Arbeitskraft konzentriert waren, die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeit und Kapital, Korporatismus (d.h. die Beteiligung großer Verbände und Organisationen an staatlicher Herrschaft), eine keynesianistische nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, einen ungebrochenen Fortschrittsglauben sowie das Vertrauen auf die Steuerbarkeit ökonomischer und sozialer Verhältnisse“ (Hradil 1999: 116). Dabei sorgen eine qua Verrechtlichung und Durchstaatlichung durchgesetzte quasi-universalistische Perspektive sozialer Sicherung und sozialer Ordnung auf nationalstaatlicher Ebene sowie steigende Reallöhne und sichere Beschäftigungsverhältnisse insbesondere nach Ende des Zweiten Weltkriegs für eine relative Stabilität dieser Gesellschaftsformation. 144 III. 1.2.3 DER ‚STRAF-WOHLFAHRTSKOMPLEX’ Devianztheoretisch kann davon ausgegangen werden, dass sich - auch wenn formale ‚Strafe’ im engeren Sinne sich vor allem seit dem 12. Jahrhundert sich zu entwickeln beginnt, und demnach von ‚Kriminalität’, im Sinne strafbarer Handlungen, schon länger existiert - eine verallgemeinerte Kategorie von ‚Kriminalität’ erst mit der Durchsetzung der Lohnarbeit zu entwickeln beginnt. Die Formen sozialer Kontrolle mit denen ‚Kriminalität’ qua Definition verbunden ist, sind in den dörflichen Gemeinschaften der Neuzeit noch eher partikularistisch orientiert, „d.h. was als Abweichung und Verbrechen in einer Gemeinde gesehen wurde, konnte in der anderen als normales Verhalten wahrgenommen werden. Mangels einer uniformen und eindeutigen Definition von Verbrechen und Abweichung war soziale Kontrolle eher eine Angelegenheit des Aushandelns als der Durchsetzung vorgegebener Standards. […Erst mit] der Durchsetzung der kapitalistischen Form der Fabrik- und Lohnarbeit und der damit einhergehenden Zerstörung traditioneller Lebensstile, etablierten sich allmählich uniforme Vorstellungen sozialer Normalität, die die Durchsetzung umfassender und allgemeiner Definitionen und Vorstellungen von Devianz und Normalität erleichterten. Bezugspunkte dieser neuen Verhaltensstandards waren die Fabrikdisziplin und das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Beide liefern universalistische Kriterien, die nicht mehr auf kommunale und lokale Standards angewiesen sind.“ (Kreissl 1987: 273 f) Die Etablierung einer prototypisch verallgemeinerten Kategorie von ‚Kriminalität’ ist eng verbunden mit einer Zentralisierung sozialer Kontrolle und mit zentralstaatlichen Lenkungs- bzw. Regulationsversuchen qua Recht. Beide Elemente werden insbesondere unter den Bedingungen der Notwendigkeit einer ‚aktiven Proletarisierung’ forciert. Regulationstheoretisch ist das (Straf-)Recht als Element der Regulation und Reproduktion eines Entwicklungsmodells zu analysieren und kann als ein Teil der Schutz und Funktionsgewährleistung des Gesamtsystems betrachtet werden. Im Verbund mit anderen formellen Formen sozialer Kontrolle geht es dem Strafrecht in seiner übergreifenden Funktion um die Legitimation von Herrschaft, insbesondere mit Blick auf die Regelung von Warentausch, Produktion und Reproduktion (vgl. Plewig 1990). Im Einzelnen können als zentrale Schutzzonen des in fordistisch organisierten kapitalistischen Gesellschaftssystems „1. die Produkte menschlicher Arbeit, 2. die sozialen Bedingungen der kapitalistischen Produktion, 3. die Muster von Verteilung und Konsum, 4. der Prozess der Sozialisation in produktive und nichtproduktive Rollen und 5. die Ideologie, die das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft sichert“ (Janssen 1997: 99) benannt werden. Die Aufgabe des Staates besteht damit im Paradox einer Förderung kapitalistischer Akkumulation und der gleichzeitigen Bewahrung der Legitimität der Produktionsweise wie seiner selbst (vgl. Michalowski 1988). Im Rahmen einer fordistischen Gesellschaftsformation beinhaltet dies, auch Devianz in erster Line wohlfahrtsstaatlich zu bearbeiten. Zwar expandieren in der Hochphase des Fordismus die (registrierten) Kriminalitätszahlen trotz eines relativ umfassenden keynesianischen Wohlfahrtsstaates in einem beachtlichen Maße (vgl. Cohen/Felson 1979, Smith 1995, Wouters 1999) - auch die Vereinten Nationen (2000: 3) machen darauf aufmerksam, dass „crime has unexpectedly increased in Western countries in times of increased affluence and improved social security“ - aber letztlich geht es den wohlfahrtsstaatlichen Strategien im Kern nicht ausschließlich darum, Kriminalität selbst durch einen wohlfahrtsstaatlich organisierten sozialen Ausgleich zu verhindern. Im Zentrum steht vor allem die Maxime ‚Sozialstaat 145 statt Strafrecht’ (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000: 322), bzw. mehr Wohlfahrt und weniger Gefängnisse. Wohlfahrtsstaatliche Interventionen sind ex ante nicht nur als eine mögliche Alternative zur Kriminalität konzipiert, sondern auch und primär als eine ‚produktive’ Form der Kontrolle, ein Versuch der Assimilation und der Hervorbringung spezifischer ‚fordistischer’ Normalidentitäten, d.h. dem Versuch die Regeln der fordistischen Lebensführungen - als eine regulierte ‚Einverleibung der Gesellschaft’ - in den Individualhabitus der Akteure zu verankern und so die Prinzipen des präreflexiven Ethos zu fördern, der die ‚vernünftigen’ von den ‚unvernünftigen’ Verhaltensformen trennt (vgl. Bourdieu 1976, 1987). Dieser Versuch geschieht auf der Basis einer Amalgamierung der Felder des Sozialen und der Kriminalitätskontrolle in einem umfassenden ‚Straf-Wohlfahrtskomplex’ (vgl. Garland 1981, 2001) bei dem auch das Gefängnis der Logik nach nur den Extrempol einer „welfare providing agency“ (Newburn 2002: 550) darstellt: Es soll nicht nur und nicht in erster Line „a place of punishment“, sondern vor allem auch „a place of social training“ sein (Coyle 2001: 2). Behandlungs- und Resozialisierungsbemühungen, die im Kontext des ‚wohlfahrtsstaatlichen Optimismus’ der 1960er und 1970er Jahre ihren Höhepunkt erreichen (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2000: 330 f) - und diesen im Verlauf der 1980er Jahre überschreiten - zielen ebenso wie die extra-justiziellen Bereiche des Wohlfahrtsstaats im wesentlichen auf eine Lohnarbeiterexistenz, als die für die gesellschaftliche Normalität konstitutive Form der Lebensführung. Dies ist vor allem im Jugendstrafrecht nicht nur eine professionelle Perspektive - die ihren Höhepunkt in der theoretisch konsequenten, praktisch einflussreichen aber letztlich gescheiterten Bewegung findet das Jugendstrafrecht in Jugendhilferecht aufzulösen und damit als Strafrecht abzuschaffen sondern stellt das dominante, verallgemeinerte Deutungsmuster des Straf-Wohlfahrtskomplexes5 und seiner vernehmlich resozialisierenden, individuelle Defizite ausgleichenden Form und Legitimation der Strafe dar (vgl. Mathiesen 1989). In diesem Kontext ist der ‚Straf–Wohlfahrtskomplex’ jenseits formulierter Strafzwecke ein der fordistisch formierten ‚Arbeitsgesellschaft’ (vgl. Matthes 1983) inhärenter Bestandteil. Die formelle Strafe fungiert dabei vor allem als ein „‚ultima ratio’ - System sozialer Kontrolle [, … dass] erst dann auf den Plan tritt, wenn die normalen Routineeinrichtungen sozialer Kontrolle, wie Familie, Nachbarschaft oder Arbeit, versagen. Auf letztere bleibt es ausgerichtet, von ihnen erhält die Strafe ihren ‚Sinn’“ (Sack 1998: 98, vgl. Rutter/Giller 1983). Das Strafrecht stellt in diesem Sinne funktional betrachtet eine Art erzwingende Steigerung der Interventionsrationalitäten sozialerzieherischer und anderer psychosozialer Dienste und Institutionen dar. Darüber hinaus hat es aber nicht nur ‚herstellende’, sondern auch ‚darstellende’ bzw. expressive Funktion (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1986, Steinert 1997) und in dieser Form selbst a priori spezifische Adressaten (vgl. auch Smaus 1998), bei denen sich die justizielle Kriminalitätskontrolle und ihre Dichotomie ‚schuldig’ versus ‚nicht schuldig’ mit einer Beurteilung und Bearbeitung der Lebensführung vermischt, in der der Frage der ‚Arbeitsmoral’ eine entscheidende Bedeutung zukommt (Cremer-Schäfer/Steinert 1998, Schumann 2002). So waren es nicht nur die Vertreter der Wohlfahrtsverbände sondern Bundesgerichthof, der höchstrichterlich feststellte, dass auch die Jugendstrafhaft – als das schärfste Schwert des Jugendstrafrechts - nichts anderem als dem Ziel der Erziehung und Wohlfahrt des Jugendlichen diene (vgl. BGHSt 16: 261, 263, nach Frehsee 1995: 370) 5 146 Seiner Kernstruktur nach folgt insbesondere das JGG zumindest in so fern nach wie vor – und möglicherweise verstärkt - dieser fordistischen Logik, wie es gezielt und beabsichtigt den sozialen Status des Angeklagten des Angeklagten ins Visier nimmt (vgl. Cicourel 1968, Geißler 1996, Bereswill/Greve 2001) und eben „nicht nur auf seine Tat, sondern auch auf seine Person (‚Erziehung’) reagiert“ (Plewig 1986: 259). Der soziale Status und die Formen der Lebensführung – die, neben der Tat als ‚Anlass’ über die Sanktions-, Erziehungs- oder Besserungsbedürftigkeit entscheiden – liefern in der Straf-Wohlfahrtsrationalität selbst entscheidende Anhaltspunkte für die ‚eigentlich’ zentralen Formen der Abweichung von einer fordistischen ‚Normalität’, auf deren Aufrechhaltung und Reproduktion das Strafrecht im wesentlichen zielt. So kommen etwa Prein/Seus (1999: 65) in einer Untersuchung aus den späten 1990er Jahren zu dem Ergebnis, dass für jugendliche Angeklagten, sobald ihnen „die Etablierung einer sogenannten männlichen ‚Normalbiographie’ (siehe Heinz 1996) […gelingt] der Staus ‚guter Lehrling’ oder ‚guter Arbeiter’ dominant [wird]; die Etikettierung ‚sozialer Abweichler’ kann trotz hoher Delinquenzbelastung abgewehrt werden“ (vgl. auch Dietz et al. 1997, Schumann 2002, Anhorn/Bettinger 2002). Das Strafrecht wird vor allem im Fordismus von einem Instrument, das nur der nachgehenden Ahndung und Bestrafung dient, zu einem Mittel bzw. einer Sozialtechnologie disziplinierender Prävention und Kontrolle. Die wesentliche Institution des fordistischen Sozialdisziplinierungsmodells sozialer Kontrolle bleibt aber die Fabrik selbst (vgl. Steinert 1993, Deleuze 1993) - das Gefängnis, ebenso wie andere Zwangsanstalten sind ihr Reflex (Melossi/Pavarini 1981), durch die der ‚soziale Staat’ zur Verstärkung sub- und extra-justizieller ‚Disziplinarapparate’ zurückgreifen kann. Neben dem dadurch induzierten (und legitimierten), im wesentlichen klassenspezifischen Selektionscharakter der ‚wohlfahrtsstaatlichen’ Strafe ergibt sich noch ein anderer, paradoxer Effekt der ‚sozialen Ideologie’ des Straf-Wohlfahrtskomplexes, der in seinem Ausmaß und seiner Form aus einer klassisch liberalen Perspektive kaum zu rechtfertigen gewesen wäre: Wenn das Gefängnis, oder eine Reihe von weiteren gestaffelten Behandlungs- und Sanktionsmaßnahmen unter- und außerhalb der Gefängnisses „could turn men and women who had committed crimes into law-abiding citizens, that in itself might become a justification for sending more people to prison”6 (Coyle 2001: 2). Gleichwohl können solche ‚Disziplinierungs-‚ und ‚Assimilationspraktiken’ nicht in einem schlichten Sinne mit Unterdrückung von Individualität und Subjektivität gleichgesetzt werden. Im Gegenteil sind sie als eine gesellschaftliche Praxis zu verstehen, durch die bestimmte ‚Individualitäten’ und ‚Subjekte’ erst hervorgebracht werden7. Die disziplinierenden und normierenden Praktiken des StrafWohlfahrtskomplexes lassen sich im Sinne von zugleich ‚vermassenden und individualisierenden Technologien’ einer „Verschränkung der Regulierung der Gesamtgesellschaft mit den Modi der Subjektkonstitution“ verstehen (Bublitz 2002: 4). Eine der je hegemonial artikulierten Gesellschaftsform entsprechende ‚Normalität’, ist dabei nicht nur die Basis, sondern auch das Produkt Andrew Coyle (2001: 2 f) paraphrasiert die Rationalität dieser Denkweise in einer idealtypischen Form wie folgt: „The magistrate or judge faced with the dilemma of what to do with the young man who persisted in petty offending was now presented with a positive option. He was now able to say to this young man, ‘I will send you to prison, where you will be trained to lead a law-abiding life’”. 7 „Die Disziplin“, schreibt Michel Foucault (1996) in der ‚Mikrophysik der Macht’, sei im Wesentlichen „die Kehrseite der Demokratie“. 6 147 der selbst permanenten praktischen Diskursen und politisch-symbolischen Kämpfen unterworfenen Rationalitäten und Technologien. Insofern kann ‚Normalität’ - auch in der vergleichsweise stabilen, fordistischen Form einer um die öffentlichen und privaten Bedingungen eines Normalarbeitsverhältnisses zirkulierende Normalität (vgl. Böllert 2001a) - nicht als ein statisches, rigides Regelsystem betrachtet werden, das von ‚Staatsapparaten’ (Althusser 1977) einfach durchgesetzt wird. Vielmehr ist es – auch in seiner Form als ‚gesellschaftliche Normalität’ mit Gültigkeitsanspruch für den tendenziell gesamten sozialen Raum einer Gesellschaftsformation - ein verallgemeinertes System von Regelmäßigkeiten, in denen systematische Praktiken normierender Normalisierung zugleich für dessen Inkorporierung und Habitualisierung in individuelle und kollektive Dispositionssysteme Sorge tragen. In diesem Sinn stellt Normalität auch keinen Zwang außerhalb eines ansonsten freien und den Normalisierungsinstitutionen gegenüberstehenden ‚Subjekts’ dar8, sondern eine Regelmäßigkeit der Konstitution, Wahrnehmung und Beurteilung sozialer Wirklichkeit, die auf ein ‚gesellschaftlich-externales’ und ‚subjektiv-internales’ Entsprechungsverhältnis verweist. Normalisierungspraktiken bezeichnen dabei ein Arrangement von Technologien, die darauf zielen das verallgemeinerte Regelmäßigkeitssystem zugleich als Dispositionssystem (Habitus) im ‚Subjekt’ selbst zu verankern. ‚Idealerweise’ stellt dies die Basis für eine ‚Subjektwerdung’ dar und wird dabei als Regelmäßigkeit der ‚subjektiven’ Konstitution sozialer Wirklichkeit vom handelnden ‚Subjekt’ selbst qua Handlung aktualisiert. Kurz: ‚Normalität’ ist eine „Ökonomie der Praxis“, die einer Logik unterliegt, die „gleichzeitig in den Institutionen, in den Mechanismen und in den Dispositionen, im Kopf der Leute ist“ (Bourdieu 1997: 80), während das fordistische ‚Sozialdisziplinierungsmodell’ als eine spezifische Möglichkeit - unter andern - zur regulativen Gestaltung dieser ‚Ökonomie der Praxis’ analysiert werden kann. III. 2 JUGENDHILFE IM FORDISMUS Obwohl bereits in der ‚prä-fordistischen’ Phase des Kapitalismus von ihrer Existenz gesprochen werden kann, erhält die – in diesem sinne typisch fordistische Profession - Jugendhilfe vor allem in der Hochphase9 des fordistisch-keynesanischen Staates, d.h. in der „wohlfahrtsorientierten BildungsBeschäftigungs- und sozialen Infrastrukturpolitik der 60er und 70er Jahre […] ihre professionelle Struktur und wohlfahrtlichte Legitimation“ (Böhnisch 1994: 16). Das Verhältnis von Sozialpolitik und Jugendhilfe bzw. allgemeiner, Sozialer Arbeit ist dabei dadurch gekennzeichnet, dass Soziale Arbeit und ihre Institutionen als eine Form organisierter Hilfe zwar relativ autonom die Art der je vorliegenden Hilfsbedürftigkeit als ihren spezifischen Ansatzpunkt selbst festlegte und professionsadäquat begründet und legitimiert, hierbei jedoch zugleich innerhalb der sozialpolitischen Logik bleibt. Soziale Arbeit funktioniert dabei als eine „pädagogische Entlastung der Sozialpolitik“ (Böhnisch 1982: 166): „Was die Sozialpolitik nicht lösen kann oder will, wird der Jugendhilfe zur pädagogischen Befriedung oder Verwaltung […] zugewiesen.“ (Böhnisch 1982: 166). 8 Eine Vorstellung, wie sie beispielsweise im Kontext der ‚Lebensweltorientierung’ in der Jugendhilfe zumindest implizit zum Ausdruck gebracht wird. 9 Retrospektiv kann zugleich ab den 1970er Jahren auch von der Endphase des Fordismus gesprochen werden. 148 Der Aufgabenbestimmung fordistischer Sozialpolitik entsprechend ist die Jugendhilfe funktional auf „die Integrationsfunktion in ein bestimmtes Modell der Lohnarbeit nach Maßgabe des Normalarbeitsverhältnisses […] ausgerichtet“ (Schaarschuch 1999: 63). Kennzeichnend für den deutschen Wohlfahrtsstaat ist dabei eine besondere ‚Doppelstruktur’ (vgl. Sachße/Tennstedt 1991: 411), die sich bis heute in einer ‚historischen Arbeitsteilung’ zwischen Sozialpolitik und Sozialer Arbeit zeigt (vgl. Münchmeier 1997, Peters 1995). In diesem Zusammenhang ist Soziale Arbeit in der fordistischen Gesellschaftsformation „Teil der staatlichen oder jedenfalls öffentlich organisierten Reproduktion der Individuen in dieser Gesellschaft und [dient] als Ergänzung oder Teil der Sozialpolitik“ (Auernheimer 1984: 101) bzw. als dispositionssensible Form einer „aktive[n] Gestaltung des Proletarisierungsprozesses“ und mithin als „spezifische Strategie der staatlichen Sicherstellung der Lohnarbeiterexistenz“ (Müller/Otto 1980: 8 f). Ihre integrative Ausrichtung, d.h. ihre Form sozialer Hilfe ist zugleich die Integration des Individuums in das Ensemble „der Zwänge, Normen und Werte der erwerbsgesellschaftlich-bürgerlichen Normalität10“ (Scherr ‚identitätsstützend’ und 1998: 509). Wie auch immer ‚subjektivitätsverbürgend’ bzw. ‚helfend’, ‚bedürfnisbefriedigend’ –generierend die spezifische Sozialisationsarbeit der Jugendhilfe für den je betroffenen sozialen Akteur auch ist, bleibt in der fordistischen Phase des Kapitalismus die „Arbeitsfähigkeit des einzelnen und damit auch die jeweils gegebenen und erreichbaren Arbeitsverhältnisse“ (Böhnisch/Schefold 1985: 24) unhinterfragbarer Kern ihrer Zielorientierungen. Der keynesianisch-fordistische Sozialstaat hat in der Jugendhilfe vor allem eine Instanz gefunden, um seine eigenen Reproduktionsleistungen zu bearbeiten und in ihrem Bestand zu sichern (vgl. Winkler 1995). Das zentrale Reproduktionsproblem, auf das (auch) mit Jugendhilfe, als Teil der sozialstaatlich regulativen Strategie ‚aktiver Proletarisierung’ gesellschaftlich zu reagieren hat, stellt die Tatsache dar, dass die Quelle ‚legitimer Identität’ im Fordismus - d.h. die Lohnarbeiterexistenz - eine sich nicht ‚automatisch’ einstellende, sondern zunächst vergleichsweise „unwahrscheinliche Form der menschlichen Existenz ist [. Weil] ihre Erhaltung hochkomplexe und differenzierte Strukturen erfordert, und sie zudem noch kulturell, sozial und personell äußerst voraussetzungsvoll ist, muss sie in aufwendigen Prozessen ‚als Pflicht normiert’ und ‚als Zwang installiert’ werden.“ (Sünker 1995: 78) Mit Norbert Elias (1969) kann die Geschichte der Neuzeit als eine Geschichte der Durchsetzung der Lohnarbeit – und mithin des disziplinierten Arbeitsbürgers – als Standardmodell gesellschaftlicher Teilhabe gelesen werden. Lohnarbeit im heutigen Sinne ist, so André Gorz (1994: 27), eine Erfindung der Moderne, der auf der Ebene sozialer Kontrolle das Modell einer ‚Disziplinargesellschaft’ entspricht, die durch eine Verlegung der Kontrolle in das Innere des Menschen gekennzeichnet ist und ihre Interventionen mithin von der Körperstrafe hin zur Therapie, Erziehung, Besserung verlagert (vgl. Foucault 1994). Diese Form der Kontrolle, als die Hauptkontrollform des Fordismus, ist zugleich die wesentliche Kontrollform der Jugendhilfe. Der für diese Kontrollform adäquate ‚Kontrollstil’ (vgl. Cohen 1993) der Jugendhilfe ist in der Regel weder punitiv ausgerichtet (vgl. Peters/Cremer-Schäfer 1973), Wie Albert Krölls (2003: 18) ausführt ist „der inhaltliche Maßstab sozialarbeiterischer Hilfe und sozialer Kontrolle […] vollständig identisch. Die Hilfestellung, welche die Sozialarbeit ihren Klienten bietet, ist nämlich darauf gerichtet, Bürgern, die von den Ordnungsvorstellungen der Instanzen sozialer Kontrolle abweichen, ihre (Re)Integration als ordentlichem Staatsbürger in eben diese Gesellschaft zu ermöglichen“. 10 149 noch auf einen engen juristischen Kontrollbegriff bezogen, der an ein ‚Konzept der Kriminalität’ angelegt ist und auf die negative Sanktion abweichender Handlungsweisen verweist (vgl. Sack 1993). Die Kontrolle der Jugendhilfe reagiert vielmehr ‚präventiv’ und ‚reaktiv’ auf ‚absehbar’ drohende oder aktual manifestierbare praxislogische Unterbietung und Infragestellungen der fordistischen Normalität – ob sie im juristischen Sinne ‚kriminell’ sind oder nicht. Dieser Kontrollstil kann im Wesentlichen als ‚Sozialdisziplinierung’11 charakterisiert werden (vgl. Oestreich 1969, Sachße 1986, Sack 1993c, historisch: Schilling 1999). Vor allem in seiner fordistischen Form ist die disziplinierende Form der Kontrolle dadurch gekennzeichnet, dass sich äußeren Zwang mit innerer Selbstregulierung koordiniert und dabei sie „nicht repressiv, sondern produktiv [ist], rational statt charismatisch […operiert und primär darauf gerichtet ist] ‚nützliche’ (wenn auch nicht vollkommen fügsame) Körper in national begrenzten Gesellschaften der Massenproduktion und des Massenkonsums“ zu mobilisieren (Fraser 2003: 247). Im Sinne dieses ‚sozialdisziplinierenden’ Kontrollmodus der Jugendhilfe geht es weniger um die Aufrechterhaltung von Normen als quasi juristische Prinzipien oder um die Befolgung bestimmter, dem Handeln äußerlicher Regeln, sondern vor allem um die Aufrechterhaltung, Reproduktion und habituelle Inkorporierung der Gesamtheit der wesentlichen ‚Regelmäßigkeiten’12 (dazu: Bourdieu 1992), des herrschenden Common Sense fordistischer ‚Normalität’ und ‚Normalidentität’, der sich für alle aufzwängt, die in die ‚inklusive Welt’ der sozialen Moderne (Young 2001) aufgenommen werden sollen13. Ziel ist die Erzeugung einer Form ‚praxislogischer Zustimmung’, die keiner bewussten, aufgeklärten und reflexiven Form der freiwilligen Entscheidung bedarf, sondern auf einer Inkorporierung sozialer (Macht)Relationen, einer, wie es Bourdieu (1997: 166) formuliert, „unmittelbaren, vorreflexiven Unterwerfung der sozialisierten Körper“ beruht, die sich nur in actu vollziehen und realisieren kann (vgl. Bourdieu 1992, 1997, Sack 1993c). ‚Disziplinierung’ ist dabei im Vergleich zu sozial ausschließenden Formen sozialer Kontrolle als eine gestaltende und produktive Herrschaftsform zu verstehen, die insbesondere in Form der (psycho)sozialen Dienste institutionalisiert werden kann. Das ‚object of knowledge’ der Disziplinierung stellt das einzelne Individuum als ein soziales, biographisches ‚ganzheitlich’ zu fassendes Wesen, als die - vermeintlich – kleinste ‚individierbare’ Einheit dar, auf dessen Habitus, innere Haltungen, Gesinnungen, Motivationen etc. disziplinierende Interventionsformen gerichtet sind. Die zentrale Technologie der personenbezogenen sozialen Dienste besteht dabei in dem Versuch einer normierenden Normalisierung ihrer Adressaten als ‚Subjekte’. Eine solche Technologie beinhaltet zuvorderst die Spezifizierung einer verallgemeinerten Norm in einer Form, durch die die individuelle Im Modell Gerhard Oestreichs ist Sozialdisziplinierung ein seit dem Absolutismus rekonstruierbarer Kontrollmodus der nicht mehr alleine auf die Ebene zentraler Regierungs- und Verwaltungsbehörden verweist, der auf alle einzelnen Individuen durchgreift und nicht nur auf ihr ‚äußerliches’ Verhalten, sondern auch auf ihre innere psychische Disposition zielt. 12 Diese Regelmäßigkeiten stellen eine Art soziale ‚Hintergrundgrammatik’ (P. Veyne) dar, die weder die Professionellen der Jugendhilfe noch ihre Adressaten expressis verbis formulieren zu wissen müssen. 13 Dem steht nicht entgegen, dass auch diese inklusive Welt fraglose Zugehörigkeit eine Fiktion ist, die gerade auf der Zurückdrängung von Differenz und Differentem beruht. „Nicht Zugehörigkeit“, so Paul Mecheril (2003: 35) aus einer kulturtheoretischen Perspektive, „sondern ‚Nicht-Zugehörigkeit’ ist das Prinzip der Moderne, und das Insistieren auf Reinheitsvorstellungen, Vollkommenheits-, Gleichheits-, Homogenitäts- und Kohärenzkonzepte kann als semantische Selbstbeschreibungs-Konsequenz dieser Realität per se eingeschränkter Zugehörigkeit verstanden werden“. 11 150 Einzigartigkeit der Normunterbietungen zu identifizieren, zu charakterisieren, zu klassifizieren und entsprechend zu standardisieren ist. Auf Basis einer solchen Standardisierungslogik und der daraus entwickelbaren, kausalen Wissensbestände über Normalität und Devianz zielt eine Normalisierung im disziplinierenden Sinne nicht nur auf die Korrektur des Individuums (vgl. O´Malley 1992), sondern vor allem auf die Hervorbringung einer korrigierten Individualität, d.h. einer Generierung ‚handlungsfähiger’, ‚normaler’ Subjekte und stabiler Identitäten innerhalb einer politisch regulierten Normalität. Dass die vorherrschenden präventiven Strategien der Jugendhilfe im fordistischen Sozialstaat im Kern personenbezogene, individualisierende Strategien sind, impliziert jedoch nicht ‚dem Sozialen’ keine Aufmerksamkeit zu schenken. Im Gegenteil. Basierend auf einer professionsadäquaten ‚evil causes evil’ Perspektive, der gemäß ‚schlechte Ursachen’ (‚Defizite‘ in Umwelt und Person) zu ‚bösen Konsequenzen’ (z.B. Devianz) führen, besteht die zentrale Annahme über die Gense aller möglichen ‚sozialen’ und ‚Lebensführungsproblemen’ darin, dass es zuforderst defizitäre soziale Umstände sind, die auf den einzelnen Akteur ‚abstrahlen’ (vgl. Sack 1993). Entsprechend der jugendhilfetypischen Positions-Dispositions-Relationierung kann die ‚unmittelbare Problemursache’ in die Person des Täters gelegt14 und dieser damit das Objekt der Intervention werden (vgl. Walklate 2002). Zugleich aber kann der ‚tieferliegende Grund’ dafür, dass dieser Akteur ‚fehlgeleitet, bzw. ‚kriminell’ geworden ist mit - ‚nicht selbst 15 Bedingungen verschuldeten’ - sozialisatorischen Wirkungen ‚schlechter’ gesellschaftlichen verbunden und ursächlich erklärt werden. Der sozialpädagogischen Kontrollform einer sozialen Disziplinierung entspricht insofern eine Interventionslegitimation, die es der Jugendhilfe ermöglicht, den moralisch verwerflichen Täter zu bestreiten und an seine Stelle die Figur eines ‚Opfers’ innerer und äußerer Verhältnisse zu setzen. In sofern kann die dominante ‚Ursachentheorie’, die den ‚fordistischen’ Interventionslogiken Sozialer Arbeit in Lebensführungsproblemen zu Grunde liegt (vgl. Thiem-Schräder 1989), als eine ‚soziale’ Variante eines „Lombrosian project“ verstanden werden, „based on the premise that criminals can somehow be scientifically differentiated from [conformist actors]“ (Garland 2002: 8, vgl. Peters 1973). Damit ist es der Jugendhilfe zugleich möglich „nicht primär nach Schuld und Verantwortung, sondern nach individuell nicht zurechenbaren Ursachen und Gründen“ (Scherr 1998: 64 f; vgl. Brumlik 1999) zu fragen und den ‚Gefährdeten’ und potentiellen oder inzident festgemachten ‚Kriminellen’, ‚Verwahrlosten’, ‚Abweichler’ etc. als identifizierbare und identifizierte einzelne Person, trotzdem zum Ausgangspunkt ihrer präventiven und reaktiven Interventionen zu machen. Jugendhilfe ist in diesem Sinne eine zentrale Institution und zugleich ein Produkt einer spezifischen Form der Bearbeitung des Sozialen, die es dem fordistischen Sozialstaat ermöglicht, die Frage ‚sozialer Probleme’ an die Stelle der ‚sozialen Frage’ zu setzen und damit verbunden auch das kompensatorisch zu bearbeitende Problem ‚sozialer Schichtung’ an das Problem ‚sozialer (politischer) Klassen’. Dabei gelingt es die ‚gefährlichen Klassen’ des frühen Kapitalismus (vgl. de Swaan 1993) zu ‚pathologischen’ (vgl. Peters 1973) bzw. von Sozialpathologien beeindruckten Individuen zu disaggregieren, und damit Auch in dieser Strategie bleibt also letztlich positivistisch-individualisierende Problemdeutung im Hintergrund erhalten und wirksam. 15 Dieser ‚tieferliegende’ Ursachenkomplex wird demnach im Wesentlichen der sozialstrukturell-positivistisch interpretiert. 14 151 zu Objekten der empirischen Human- und Sozialwissenschaften und der Technologien sozialer Dienste, wie zunächst der Psychiatrie, dann der Psychologie und allen voran der Sozialen Arbeit, werden zu lassen (vgl. Garland 1981, Pratt 1998, O’Malley 2001a). In bezug auf die Normalitätserwartungen fordistischer Akkumulations- und Regulationsbedingungen wird damit ein Kontrolltypus forciert, der die gesellschaftlich erwarteten Verkehrsformen nicht nur äußerlich schützt und zwangsförmig aktualisiert, sondern zugleich durch den Zugriff auf das Innere, des nach den fordistischen Regelmäßigkeiten erst hervorgebrachten ‚Subjekts’ sicherstellt. Mit Rekurs auf die Straf- und Wohlfahrtslogiken im Fordismus seit der Nachtkriegsära verweist Jock Young (1999a: 390) darauf, dass der zu bearbeitende Gegenstand vor dem Hintergrund der Messlatte gegebener, allgemeinverbindlicher Normalitätsstandards, in die es den ‚Abweichler’ positional und dispositional zu assimilieren gilt, in erster Linie im Problem der Diversität besteht. Der Logik nach ist die wohlfahrtsstaatliche Moderne „not afraid of the difficult individual. It was not difficulty which threatened modernity, but diversity. A whole barrage of experts—psychiatrists, social workers, criminologists—were in the business of explaining away diversity; a positivist social science was evolved which sought to explain the, remarkable’, why differences in values, attitudes and behaviour could possibly occur in a world which was both economically and socially so successful—the endpoint of historical development. Their task was to convert diversity into deviance”. Die zentralen instrumentellen Stützpfeiler ‚disziplinargesellschaftlicher’ Subjektivierungsweisen stellen Methoden der Generierung ‚fordistischer Identitäten’ mit einem ‚genormten Inventar’ an basalen Persönlichkeitsmerkmalen dar (vgl. Bröckling 2000), d.h. alle Formen und Techniken der „Normierung, Normalisierung, Subordination, Kolonialisierung und Assimilation“ (Cremer-Schäfer 1995: 97) oder kurz, des Produktiv- und Nützlichmachens. Diese ‚Stützpfeiler’ verweisen gleichsam auf den Stellenwert der ‚Integration’, die – im Sinne einer Gleichzeitigkeit von Einbeziehung und Formierung einen zentralen Garant für die soziale Kohärenz der Gesellschaftsformation darstellt. Die Rationalitäten sozialer Regulation im politischen Keynesianismus zeichnen sich durch den Versuch aus „[to] gran[t] social embeddedness [and] strong certainty of personal and social narrative, and a desire to assimilate the deviant, the immigrant, the stranger […] into a massive, homogeneous culture” (Young 2001a). ‚Integration’ und ‚Disziplinierung’, als normierende Normalisierung ist im Idealfall darauf ausgerichtet, dass der einzelne sich freiwillig in den normativen Konsens der Gesellschaft fügt, wobei die Basis dieser Freiwilligkeit nicht zuletzt durch den Wohlfahrtsstaat selbst sichergestellt wird (dazu Peters 2002, Schimank/Lange 2003). Im Rahmen der Entschärfung der sozialen Frage unter den Bedingungen eines fordistischen Wohlfahrtsstaates verkörpert Soziale Arbeit, als ein historisch zwar variabler aber integraler Bestandteil sozialpolitischen Handelns (vgl. Müller/Otto 1980), nicht nur die Sozialisierung und Einpassung der – aktualen und künftigen - Lohnabhängigen in die Verhaltensanforderungen und Verhältniszwänge einer kapitalistischen Gesellschaft, sondern auch „das sozialintegrative Versprechen, dass jedem in Not oder mit dem Gesetz in Konflikt Geratenen durch Beratung, Therapie und Pädagogik geholfen und der Anschluss an die Gesellschaft ermöglicht werden kann“ (Klatetzki/von Wedel-Parlow 1998: 574). Die normierend normalisierende Kontrolldimension Sozialer Arbeit wird dabei untrennbar mit den Modi ihrer Hilfeleistungen verbunden und nicht nur in ökonomischer, 152 sondern vor allem auch in sozialer, kultureller politischer und administrativer Hinsicht mittels Inklusion sichergestellt (vgl. Schaarschuch 1999). Die inkludierende Funktion Sozialer Arbeit im Sozialstaat, lässt sich insofern nicht ausschließlich als Versuch einer Hilfe im Sinne Generierung individueller gewünschter Gebrauchswerte für ihre Adressaten fassen. Vor dem Hintergrund der Einsicht „that the welfare state produces legitimacy and mass loyalty” (Peillon 1998: 219, vgl. Habermas 1981) wird Soziale Arbeit vor allem seit den 1970 ein Mittel zur Befriedigung von Randgruppen und als Formung und Einschränkung individueller Autonomie-, Freiheits- und Selbstverwirklichungsinteressen zu Gunsten einer Zurichtung von Individuen zu arbeitsfähigen und -willigen Lohnarbeitern und kritisiert16 (vgl. Autorenkollektiv 1977, Barabas et al. 1976, Brake/Bailey 1980, Danckwerts 1981, Hollstein/Meinhold 1973, Janowitz 1976, Pinker 1971, Piven/Cloward 1971, Simpkin 1979): „Social work came under attack as form of social control exercised under the humanitarian disguise of caring and this attack was developed into a more theoretically sophisticated analyses of the controlling and ideological function of welfare in the capitalist state” (Clarke 1979: 125). Gleichwohl hat der Sozialstaat - und mit ihm auch die Soziale Arbeit „mit seiner Politik der sozialen Balance einen Begriff von Normalität befördert […,] der abweichendes Verhalten nicht aussondert, sondern zu integrieren [… versucht. In diesem Zusammenhang ist Soziale Arbeit] zur allgemeinen sozialstaatlichen Institution der Bearbeitung ‚sozialer Probleme’ geworden [… und hat als,] Teil der sozialstaatlichen Politik der Sozialintegration, eine allgemeine gesellschaftspolitische Funktion erhalten“ (Böhnisch 1984: 83 f). Jene, durch die verallgemeinerte Normalität und den durchschnittlichen Lebensentwurf des keynesianischen Sozialstaats vorgezeichnete Form der Sozialintegration beinhaltet zugleich „die tendenzielle Übereinstimmung der lebensweltlichen Werthaltungen und Lebensführungen mit den geltenden gesellschaftlichen Normen“ (Böhnisch 1994: 31). Dies gilt bereits alleine, weil die Diagnose einer Hilfsbedürftigkeit einen „Aussage- bzw. Informationsgehalt [erst] bei gleichzeitiger Angabe der ‚Regeln’, der Normen, der ‚Demarkationslinie’“ (Rössner 1973: 259) erhält, an der sich diese orientieren kann. Die ‚sozialintegrative Kraft’ Sozialer Arbeit liegt in diesem Sinne in ihrem Beitrag, dass „Kinder und Jugendliche in die vorgegebenen gesellschaftlichen Normen hineinwachsen und diese trotz kontroversen Erfahrungen, die mit dieser Integration verbunden sind, anerkennen“ (Böhnisch 1982: 24). Dabei wandelt sich Soziale Arbeit in dem Maße von einem „repressiven zum ‚‚strategischen’ Instrument sozialer Integration“ (Böhnisch 1982: 25), wie sich „die Überzeugung durchsetzt, daß Formen abweichenden Verhaltens von Individuen und Gruppen sozial erzeugt sind und durch wissenschaftlich gegründete Sozial- und Psychotechniken (Beratung, Therapie, Erziehung, Resozialisation) der Möglichkeit nach in angepaßtes Verhalten verwandelt werden können, […] Praktiken der sozialen Aussonderung ihre Legitimation. An ihre Stelle treten die Ziele der Normalisierung abweichender Individuen orientierter Institutionen und Professionen in Verbindung mit den gleichwohl nicht obsolet werdenden Formen der polizeilich-strafrechtlichen Überwachung, Kontrolle und Sanktionierung“ (Scherr 1998: 509). Die Form der sozialintegrativen Vermittlung des Subjekts durch die Jugendhilfe, kann als Versuch einer Erzeugung eines sozio-moralischen Habitus verstanden werden, der die basale Disposition des 16 Ähnliches gilt auch für die treffende, feministische Kritik am Wohlfahrtsstaat: „A unifying theme of th[e] feminist critiques of social policy has been an analysis of the welfare state in relation to the family: as supporting relations of dependency within families: as putting women into caring roles; and as controlling the work of reproduction” (Pascall 1986: 3). 153 ‚freiwilligen’ Fügens in einen umfassenden hegemonialen Konsens beinhaltet. Im Rahmen der integrativen Funktion Sozialer Arbeit dominierten in der fordistischen Formation des Kapitalismus „Begriffe der Integrationswilligkeit und -fähigkeit, begleitet allerdings von ausgrenzenden und stigmatisierenden Etiketten für solche, die weder das eine noch das andere waren (z.B. gruppenfähig/nicht-gruppenfähig; resozialisierungsfähig/ nicht resozialisierungsfähig; therapiefähig/ therapieresistent)“ (Kunstreich 1998: 399). Eine ‚Freiwilligkeit’ oder zumindest ‚Willigkeit’ fungiert dabei als die entweder vorhandene oder zu erzeugende individuelle ‚Bringschuld’ des ‚hilfebedürftigen’ d.h. ‚autonomisierungs-’ und ‚integrationsbedürftigen’ Individuums gegenüber den herrschenden Verhältnissen. Erst an den Grenzen dieser Form wohlfahrtsstaatlicher Inklusion setzt die ‚ultima ratio’ Lösung des ‚StrafWohlfahrtskomplexes’ an (vgl. Garland 1981). Zwar gibt es auch in der fordistischen Gesellschaftsformation institutionalisierte Prozesse und juridische Formen von sozialem Ausschluss in verschiedenen Formen und Ritualen, aber diese sind mehr oder weniger selbstverständlich mit der moralischen Erwartung verbunden, dass ein solcher Ausschluss „nur vorläufig sei und vor allem dazu diene, das ausgeschlossene Subjekt früher oder später in die Gesamtheit der sozialen Beziehungen, in die ‚Gesamtgesellschaft’ wiedereinzugliedern“ (de Marinis 2000: 59). In dieser Form ist ein temporärer punitiver Ausschluss selbst - der fordistischen Logik des Nützlich-Machens folgend - weniger darauf gerichtet, Personen oder Risiken ‚unschädlich’ zu machen, sondern vor allem darauf spezifische Identitäten hervorzubringen. In diesem Sinne folgt selbst noch der ‚Ausschluss’ einer produktiven Logik: Er hat vor allem eine disziplinierend-normalisierende Funktionen und ist als Versuch der Erzeugung einer gesellschaftlich duldbaren Form des Habitus konzipiert17. Der Vollzug der Strafe als episodischer Ausschluss innerhalb eines integrierenden Rahmens des Wohlfahrtsstaats stellt insofern, als Disziplinierung qua Einschließung einen integralen Bestandteil eines Kontinuums von ‚Hilfe’ und ‚Kontrolle’ dar, in dem auch die Jugendhilfe angesiedelt ist. Als institutioneller Bestandteil dieses Kontinuums fungiert die Jugendhilfe nicht sowohl als auch, sondern in einer synonymen Form zugleich als lebensweltliche Hilfe, als Instrument der Sozialpolitik und als Kontrollagentur. Dieser prinzipielle Charakter der Jugendhilfe, eine Form der sozialen Unterstützung zu bieten, die systematisch mit einer dispositionsmodifizierenden Form sozialdisziplinierender Kontrolle verknüpft ist, materialisiert sich in der fordistischen Gesellschaftsformation vor allem darin, dass ihr als ein Instrument der Sozialpolitik die Aufgabe zukommt, „die zunehmend staatlich regulierte Reproduktion der Arbeitskraft sowohl durch öffentliche Sozialisationsprogramme zu verwirklichen (z.B. Vorschulerziehung, Jugendhilfe, subsidiäre Familienerziehung) als auch auf die Verletzung gesellschaftlicher Verkehrsformen (z.B. Diebstahl, mangelnde Arbeitsmotivation, Gewaltund Drogendelikte) durch unterschiedliche miteinander gekoppelte Maßnahmeprogramme (z.B. Beratung, Therapie, Heimerziehung) sanktionierend zu reagieren und durch materielle Hilfen (z.B. wirtschaftliche Jugendhilfe, Sozialhilfe) eine zeitlich fixierte, marktunabhängige Reproduktionssicherung zu übernehmen“ (Müller/Otto 1980: 9). Damit ist zumindest das in der sozialen Regulation der fordistischen Gesellschaftsformation rekonstruierbare Verhältnis von Hilfe und Kontrolle durch die Jugendhilfe gerade nicht „das von Zuckerbrot und Peitsche. Beide Maßnahmenvarianten zielen ja auf ‚Integration’, sind insofern Dem steht nicht entgegen, dass dieser Versuch in empirischer Hinsicht zu vergleichsweise unbefriedigenden Ergebnissen geführt hat (vgl. Martinson 1974, Schumann 2001, Stehr 2002). Allerdings war die Strategien und Technologien dieses Paradigmas bis zum Ende der 1970er Jahre von der Beweislast der empirischen Wirkungsforschung weitgehend entlastet (vgl. Dünkel/Rehn 2001) 17 154 äquivalent“ (Peters 1998: 21 f, vgl. Krölls 2003). Soziale Kontrolle in ihrer Form als Sozialdisziplinierung ist selbst ein zur Erhaltung des gesellschaftlichen Normen- und Wertebestands notwendiger Teil der Vorgänge sozialer Integration (vgl. Steinert 1995: 82). Vermittelt durch personenbezogene soziale Dienste stellt sie vor allem den inkludierenden und normalisierenden Versuch der Schließung der Kluft zwischen der Bandbreite empirisch feststellbarer Handlungsweisen und Dispositionen und den gesellschaftlich tolerierten und - normativ nicht faktisch – erwarteten und (symbolisch) durchgesetzten Lebens- und Handlungsformen dar, aus genau deren Unterbietung sich auch der Anspruch auf Hilfe und Unterstützung speist. Die Aufgaben subsidärer Existenzsicherung und Kontrolle - je als ‚Normalisierungsarbeit’ (vgl. Brunkhorst 1988) im Sinne einer normativen Integration sozial abweichender Gruppen und Individuen - sind demnach, zumindest von der Integrationsperspektive her betrachtet, nicht zu trennen, sondern Elemente einer vergleichsweise umfassenden sozialen Absicherung in der Hilfe Kontrolle einschließt und nicht im Widerspruch zu dieser steht (vgl. Bommes/Scherr 2000: 45). Gerade diese Gleichzeitigkeit kennzeichnet die fordistische Moderne als eine soziale ‚Welt der Inklusion’ (Young 1999: 57, Taylor 1999), deren wesentliche Kontrollrationalität darin besteht, Diversivität zugunsten einer umfassenden Form deiner fordistischen Normalität dadurch zu reduzieren, dass Abweichler im Sinne einer assimilierenden Normalisierung und Anpassung möglicht umfassend integriert werden. Die inklusive Welt des Nachkriegsfordismus ist entsprechend ‚intolerant’ gegenüber Verschiedenheit (vgl. Young 1999) – d.h. Habitus und Lebensweisen ‚unterhalb’ und ‚außerhalb’ der Normalitätsstandards bzw., mit Max Weber gesprochen, jenseits des ‚Rationalismus der ethisch-methodischen Lebensführung’ - aber ‚tolerant’ gegenüber Kriminellen, die durch eine Bearbeitungen ihrer inneren und äußeren Bedingen als ‚behandelbar’ und ‚integrierbar’ betrachtet werden (vgl. Young 1999). Mit der Krise des Fordismus als die Krise der ‚inklusiven Welt’ verlieren auch diese synonymisierten Kontroll- und Integrationsmodi ihren dominierenden und unhinterfragten Stellenwert. Nichtsdestoweniger hat sich die Gleichzeitigkeit kontrollierender und integrativer Funktionen, die die Jugendhilfe als Profession des fordistischen Wohlfahrtsstaats charakterisieren in weiten Bereichen erhalten (vgl. Böhnisch 1999). III. 2.1 EXKURS: DAS PROBLEM DER FUNDAMENTALKRITIK DER KONTROLLFUNKTION DER JUGENDHILFE Der Verweiß auf die Kontroll- bzw. Herrschaftsfunktion der Jugendhilfe ist zugleich ein Verweiß auf den der Jugendhilfe inhärent notwendigen Gesellschaftsbezug und damit verbunden auf die Widersprüchlichkeit ihrer Beziehung zur kapitalistischen Gesellschaftsformation. Jugendhilfe im Kapitalismus als sozialstaatlich erbrachte, dispositionssensible Antwort auf eine Unterbietung von ‚Kulturidealen’ beinhaltet nicht nur deren Bearbeitung als bedürfnisorientierte Unterstützung, sondern zugleich auch als deren symbolische Regulation im Sinne der Kontrolle von normativ abweichendem Verhalten (vgl. Bommes/Scherr 2000: 41). Dies geschieht untrennbar miteinander verknüpft und mit Bezug auf ein und dasselbe Phänomen im Sinne einer Vermittlung zwischen subjektivierender Gesellschaft und vergesellschaftetem Subjekt. 155 Der Verweiß auf die notwenige Gleichzeitigkeit einer Herrschafts- und Kontrolldimension der Jugendhilfe bzw. -fürsorge im Prozess der Erbringung von ‚Hilfe’ ist daher nicht als ihre Reduktion auf eine „Agentur der Reproduktion und Stabilisierung kapitalistischer Produktionsverhältnisse“ (Brumlik 1976: 242) oder ihrer Vertreter als ‚Agenten’ oder ‚Durchsetzer’ der Klasseninteressen der Bourgeoisie (vgl. Paulsen 1971, kritisch: Schmidt-Kowarzik 1995) und Verhinderer einer gesellschaftsverändernden Mobilisierung von Widerstandspotentialen zu interpretieren18 (dazu auch: Offe 1984). Diese und ähnliche Formen der Kritik vernachlässigen mit den fordistischen Formen sozialer Regulation einhergehenden „fortschrittliche[n] und emanzipatorische[n] Aspekte. Insbesondere schätz[en] sie die individualisierenden und subjektivierenden Momente sozialer Kontrolle zu gering; und sie reduzier[en] eine autonomieförderliche Orientierung allzu rasch auf normalisierende Kontrolle“ (Fraser 2003: 247f). Zurecht weist Abram de Swaan (1993) darauf hin, dass die ‚fremdherrschaftlichen’ Prozesse der Kollektivierung, Bürokratisierung und Professionalisierung der Daseinsfürsorge sozialhistorisch eher mit einer Autokomisierung der Klienten einhergehen19 (vgl. Hirschman 1995, Kreissl 1990, Kübler 1985). Neben der empirischen Fragwürdigkeit ist der in den Kontroll- und Zurichtungsvorwürfen an die soziale Arbeit häufig der angelegte Funktionalismus auch in ‚funktionalistischer’ Hinsicht kaum einsichtig: Eine ‚reine’ Unterdrückungsfunktion ließe sich - rein funktional betrachtet - durch ‚repressive Staatsapparate’ (Althusser 1971) vielfach ‚effizienter’ bewerkstelligen. In mancherlei Hinsicht verweißt die US-amerikanische Verschiebung vom ‚wohltätigen zum strafenden Staat’ in der Bearbeitung ‚sozialer Probleme’ in diese Richtung (vgl. Wacquant 2000), ohne dass man ernsthaft annehmen könnte, das kapitalistische System der USA sei dadurch gefährdet oder in bei einer Mehrheit der Bevölkerung delegitimiert – im Gegenteil20. Ebenfalls rein funktional betrachtet, spricht wenig dagegen, die Mehrzahl der ‚Unterbietungen’ gesellschaftlicher Ordnungsund Normalitätszumutungen - die ja häufig vor allem auch subjektives Leid erzeugen - einfach so lange zu ignorieren und unbearbeitet zu lassen, wie sie das (kapitalistische) System oder seine Teile nicht gefährden. Wenn sich demnach auch eine große Zahl ökonomisch, kulturell und sozial Deprivierter, Marginalisierter oder Ausgeschlossener weder als absehbar der Selbstversorgung fähig noch als mittelfristig ‚rentabel’ integrierbar noch als politisch systembedrohend erweist, könnte man wiederum rein funktionalistisch betrachtet und der ökonomischen Vernunft kapitalistischer Ökonomie gehorchend - den eigentumslosen und auf dem Arbeitsmarkt nicht nachgefragten Proletarier (vgl. Cohen 1995) bzw. die Adressaten von Wohlfahrtssystem und Fürsorge auch einfach verhungern lassen (vgl. Peters 1999). Der Wegfall der Jugendhilfe würde für ihre Adressaten in aller Regel weniger eine Befreiung von Kontrollmutungen als eine Verschlechterung ihrer Situation bedeuten (Bommes/Scherr 2000: 14). Dies gilt nicht nur für die Bundesrepublik und die Kritik kam keinesfalls nur von ‚links’. Insbesondere seit dem Ende der fordistischen Expansionsphase der Wohlfahrtsstaats wird Soziale Arbeit, wie Younghusband (1981: 9) ausführt, „accused, and sometimes accused itself, of being moralistic, authoritarian, knowing best what was good for other people, permissive, soft, manipulative, ineffective, damaging, essential, or a waste of public money”. 19 Darüber hinaus weisen van der Loo und van Reijen (1997: 250) darauf hin, dass ‚Disziplinierungsinteressen’ nicht immer den Interessen der Adressaten zuwiderlaufen. Es sei zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die „Klienten oder Patienten bewusst annehmen oder sogar darum ersuchen“. 20 Mit dem Slogan ‘Taxes down, Deathpenalty up’ wollten US-amerikanische Konservative Wahlen gewinnen. 18 156 Auch für die ‚aktive Proletarisierung’ gibt es Alternativen zur Disziplinierung durch soziale Dienste. So konnte eine Reihe von Untersuchungen nachzeichnen, dass es schon alleine durch Masseninhaftierung in einem durchaus beachtlichen Maße möglich ist, Arbeitsmärkte zu regulieren ((vgl. Weiss / South 1998, Beckett / Western 1999, Garland 2001c)). Bruce Western et al. (2001: 139) zeigen z.B. auf, dass „die konstant niedrige Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten [auch] von einer ständig im Wachsen begriffenen, erhöhten Inhaftierungsquote abhängt [… In diesem Sinne ist der] amerikanische Arbeitsmarkt nicht etwa ‚dereguliert’, sondern tatsächlich ‚hyper-reguliert’“. Statt einem Sozialstaat ist dabei aber ein ‚Gefängnis-industrieller Komplex’ die bevorzugte Arbeitsmarktpolitik für junge Männer deprivierter Bevölkerungsminoritäten (vgl. Wacquant 2002a). Wenn der Anspruch Hilfe, als quasi-universelle Garantie und Sicherung gesellschaftlicher Teilhabe, zu erbringen, mit der Wahrung der Teilhabeform - und d.h. mit sozialer Kontrolle - verbunden ist, so kann diese niemals herrschaftsfreie und neutrale Form gesellschaftlicher Regulation als Ganze nicht in Frage gestellt werden, ohne zugleich zu beachten, ob das Klientel Sozialer Arbeit der Hilfe bedarf, und diese Hilfe auch in ihrem, oder zumindest in Bezug auf ihr Interesse erbracht wird (vgl. Brumlik 1976). Das analoge Argument gilt für jenen Strang der Kontrollkritik, der sich in einer Gegenüberstellung von - nicht ideal-, sondern realtypisch gefasster - System- versus Sozialintegration gegen systemische Imperative richtet. Das entscheidende Problem einer Überbetonung einer systemischen Kolonialisierung der Lebenswelt der Adressaten durch die Jugendhilfe und der ‚Alltagswende’ in ihrem Kotau, besteht vor allem darin, dass ihr herrschaftskritischer Impetus im wesentlichen auf den Bereich ‚System’ beschränkt bleibt. Was Horkheimer (1970) und Adorno (1983) als ‚verwaltete Welt’ analysieren und kritisieren, wird bei Habermas (1981) zu einer ‚Kolonialisierung von Lebenswelten’ und erfährt in eben dieser Lebenswelt zumindest implizit und tendenziell seinen positiven Gegenbegriff. Vor allem in der Sozialen Arbeit21 wird der Lebensweltbegriff als positiv konnotierter Konterpart zum System adaptiert und liefert die Basis für eine Konzentration sozialpädagogischer Denk- und Handlungsrationalitäten auf den ‚tatsächlichen’ unmittelbaren Alltag der Adressaten als Opus Operandi Sozialer Arbeit. Ein problembezogenes und administrativ angeleitetes Bearbeitungsprogramm soll dabei zugunsten einer eher ethnographisch angeleiteten, ‚dialogisch’ konzipierten und (wie auch immer) ‚ganzheitlichem’ Vorgehensweise abgelöst werden (vgl. Thiersch 1986, 1992, 2000). Gegenüber dem System bzw. einem ‚juristisch-administrativ-therapeutischen Staatsapparat’ (Fraser 1994) wird dabei eine Lebensweltnähe im genannten Sinne zumindest präferiert22: die Bewältigung des Alltags solle ‚im gelingenden Falle’ gänzlich der ‚Selbstregulierung’ der Betroffenen überlassen bleiben (vgl. Thiersch 1992). Die Dechiffrierung sozialer und ‚Lebensführungsprobleme’ erfolgt dabei der Tendenz nach vor allem als eine Frage der ‚Sozialintegration’ als – vermeintliche – Alternative oder Opponent einer ‚kolonialisierenden’ ‚Systemintegration’, die ‚dem einzelnen äußerlich bleiben’ würde (vgl. Opielka 2002a). Dies geschieht nicht immer mit systematischem Rekurs auf Habermas In einer radikalen Variante, erhebt sich mitunter sogar das Votum für eine Non-Intervention nach systemischen Prämissen (zur Staatsskepsis oder gar ‚Staatsfeindschaft’ in der Sozialen Arbeit im allgemeinen siehe Schaarschuch 2003). 21 22 157 Wie sinnträchtig die Kritik am ‚System’ auch immer sein mag23, besteht das Problem der implizit oder explizit einseitig positiven Konnotierung der ‚Lebenswelt’ darin, die Aspekte von Klassenherrschaft, objektiven Interessen, Ungleichverteilungen von praxiswirksamen Kapitalen, Kämpfen um ihre hegemoniale symbolische Form etc. der Tendenz nach zu vernachlässigen wenn nicht völlig zu ignorieren24. Tatsächlich besteht die Tendenz im Namen der Lebenswelt der Adressaten eine vermeintliche „aktive Politisierung der Sozialarbeit“ zurückzudrängen, und dies damit zu begründen das der Blick auf „die Menschen in Not“ und „das Pädagogische an der Sozialpädagogik [dadurch] in den Hintergrund gedrängt“ worden seien (Fatke/Hornstein 1987: 590f). Es bleibt weitgehend unreflektiert, dass die Frage von (Klassen)Antagonismen, nicht nur Fragen des Staates oder ‚Staatsapparates’ bzw. ‚systemischer Institutionen’ sind, sondern auch und vor allem – und in aller Gewalt- und Herrschaftsförmigkeit - in die Ökonomie der (‚lebensweltlichen’) Praxis der gesellschaftlichen Akteure eingeschrieben sind. Der naive Blick, dass das bürokratische ‚kalte Ungeheuer‘ Staat (Foucault 2000) einer ‚guten‘ Zivilgesellschaft gegenübertritt, und dabei gängelnd und bevormundend für einen Großteil gesellschaftlichen Unbills verantwortlich zu machen ist, fällt weit hinter die von Marx und Engels (1972: 128) formulierte Einsicht zurück, dass „[n]ur der politische Aberglaube […], sich noch heutzutage ein[bildet], dass das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden müsse, während umgekehrt in Wirklichkeit der Staat durch das bürgerliche Leben zusammengehalten wird“. Wie es Antonio Gramsci (1991 ff: 783) formuliert hat, „ist festzustellen, dass in den allgemeinen Staatsbegriff Elemente eingehen, die dem Begriff der Zivilgesellschaft zuzuschreiben sind (in dem Sinne, könnte man sagen, dass Staat = politische Gesellschaft + Zivilgesellschaft, da heißt Hegemonie, gepanzert mit Zwang). Selbstregulierte lebensweltliche Gemeinschaften mögen einen Ort der Sozialintegration darstellen, der eine relative Autonomie von den Zumutungen des staatlichen Institutionengefüges und möglicherweise auch von kapitalistischen Marktordnungen verspricht. Wie sich im Verlauf dieser Arbeit jedoch noch deutlich zeigen wird, ist ein solcher sozialintegrativer Partikularismus (vgl. Kaufmann 2002) der Lebenswelt jedoch eines mit Sicherheit nicht: ein herrschaftsfreier Raum, der die Möglichkeit zur Entfaltung individueller Autonomiepotentiale für die am wenigsten Begünstigten umfassender gewährleisten würde als der soziale Staat und seine Institutionen. III. 3 KONTUREN EINES ‚FORTGESCHRITTENEN LIBERALISMUS’ ALS ‚NACH-FORDISTISCHE’ GESELLSCHAFTSFORMATION Bereits Mitte der 1970er Jahre - auf die der Geschichtswissenschaftler Wolfgang Reinhard (1999: 517) „beginnenden Zerfall des Sozialstaats“ datiert - werden die unkalkulierbaren, staatlich kaum mehr steuerbaren Risiken der Massenproduktion deutlicher. Eine fundamentale Erosion der fordistischen Prosperitäts-Konstellation der Nachkriegsphase bahnt sich an, in der die „enge Verbindung von Zu einer pointierten Kritik von Habermas’ Trennung von Lebenswelt und System siehe Hauck 1984 Aus einer feministischen Perspektive fragt Kuhlmann (2003: 44) nicht zu Unrecht kritisch danach, ob ,Selbstregulierung’ in der Lebenswelt nicht vor allem bedeute, dass „Frauen wieder unbezahlt und unsichtbar im Alltag der privaten Reproduktion verschwinden“. 23 24 158 Massenkonsum, Sozialstaat und Akkumulation, die das ‚goldene Zeitalter’ der Fordismus gekennzeichnet hatte“ zerbricht (Hirsch 2002: 94). Diese ‚Krise des Fordismus’ kann weder als monokausaler Krisenprozess, noch als zufällige Anhäufung unabhängiger gesellschaftlicher Probleme angemessen analysiert werden (Bieling 2000: 28). Das krisenhafte Ende der fordistischen Phase steht zunächst im Zusammenhang mit der Erschöpfung einer ‚langen Welle’ technologischer Entwicklung in den westlichen Industrienationen. Im Anschluss an die von Nikolai Kondratieff (1926) entwickelte Theorie von Regelmäßigkeitsmuster des Wandels in der Ökonomie, die nicht nur in konjunkturellen, sondern in strukturellen, wellenförmigen Zyklen den langfristigen Auf- und Abstieg der zentralen Produktionsweisen und -technologien bezeichnen, lässt sich davon sprechen, dass ein Ende des ‚vierten Kondratieffzyklus’ von einem weitreichenden, strukturellen Prozess der De-Industrialisierung gekennzeichnet ist (vgl. Dangschat 1998). In den 80er Jahren kommt es zu weltweit zu einer rückläufigen Realakkumulation im güterproduzierenden Bereich, in dem „in Folge des sinkenden Produktivitätszuwachses die organische Zusammensetzung des Kapitals [steigt] während sich seine Profitabilität“ verringert (Bieling 2000: 209). Der Fall der relativen Profitrate kann durch die Mobilisierung von ‚Gegentendenzen’ – etwa den Druck auf das, mittlerweile als ‚profit squeeze’ thematisierte, Lohnverhältnis und die Ausweitung und Intensivierung taylorisierter Arbeit - nicht mehr ausreichend kompensiert werden (vgl. Schaarschuch 1990). Zugleich verstärken sich auch die kulturellen und ökologischen Wiedersprüche des fordistischen Entwicklungsmodells (vgl. Altvater 1992), dessen strukturelle Krise sich nicht nur auf der Ebene des Akkumulationsregimes manifestiert, sondern auch eine Krise der kulturellen Hegemonie darstellt, in die im Rahmen einer „sinkenden Akzeptanz der tayloristisch-fordistischen Arbeits- und Lebensnormen und des Lebens im durchrationalisierten ‚Planstaat’ […] auch die Formen gesellschaftlicher Repräsentanz [geraten]“ (Brand et al.: 2000: 56). Proteste und Kritik wenden sich nicht nur gegen die Art der Produktion, sondern - als kulturelle und ökologische Kritik, insbesondere in Form der ‚Neuen Sozialer Bewegungen’ - auch gegen die Effekte fortschreitender Kommerzialisierung, den ausgreifenden Konsumgenuss und weite Teile des staatlichen Bürokratieapparats (vgl. Hirsch/Roth 1986), seine ‚Expertokratie‘ und eine ‚Kolonialisierung der Lebenswelt‘ (vgl. Habermas 1981). Die Neuen Sozialen Bewegungen positionieren sich nicht nur kritisch gegenüber dem fordistischen Sozialstaat, sondern artikulieren ihre Kritik ironischerweise häufig auch „in ways that also reflected the critiques of the Right: of the paternalistic and authoritarian intrusions into the lives (especially) of poor people; of the sense of ubiquitous state surveillance; of the ‚massification’ of the administrative apparatus, and so on“ (O´Malley 1999: 94). Der ökonomischen Krise wird mit umfassenden Versuchen der Flexibilisierung, Deregulierung und Senkung der Lohnkosten begegnet. Innerhalb des Akkumulationsregimes eines ‚ansteigenden’, ‚fünften Kondratieffzyklus‘ wird eine weitreichende Rationalisierung durch die arbeitseinsparende Qualität des Einsatzes von Mirkoelektronik im Produktionsprozess verstärkt. Aufgrund des Fehlens entsprechender Qualifikation der häufig ungelernten fordistisch-industriellen ‚Massenarbeiter‘ weist dieser Einsatz langfristig deutliche Grenzen einer tayloristischen Arbeitsorganisation auf und führt schließlich - als Form der Rationalisierung konzipiert - zu einer hautsächlich diesen Typus Arbeiter betreffenden, strukturellen Massenarbeitslosigkeit sowie zu einer „selektiven Einbeziehung relativ 159 hoch- wie auch geringqualifizierter Arbeitskraft in den Kern-, resp[ektive] Randbereichen der Produktion mit der Konsequenz einer Segmentierung und Polarisierung der Beschäftigtenstruktur“ (Schaarschuch 2003: 50). Diese Entwicklungen bilden dabei die Kehrseiten „eines grundlegenden Verwertungsdilemmas“: „die Freisetzungseffekte der neuen Steuerungs-, Automatisierungs-, und Rationalisierungstechniken können nicht mehr durch eine adäquate Marktexpansion kompensiert werden, der innere Mechanismus der Krisenüberwindung [des Fordismus] erlischt“ (Heidt 1998: 425). Ein weiteres Moment der Krise des Fordismus ist die Relativierung der US-amerikanischen Dominanz auf dem Weltmarkt. Aufgrund der ökonomischen Entwicklungen in (West-)Europa und Ostasien (insbesondere Japan) (vgl. Altvater/Hübner 1988) gibt die US-Regierung die Goldbindung des Dollars auf. Dies führt zu einer Schwächung der Weltwährung, das Bretton-Woods-System bricht zusammen, die Wechselkurse können frei flottieren und die internationalen Finanzmärkte gewinnen zusehends an Bedeutung (vgl. Hirsch 1993). Diese Form der ‚Globalisierung‘ der Wirtschafts- und Finanzbeziehung sowie die hiermit verbundenen grundlegenden Verschiebung des Verhältnisses von Finanz- und produktivem Industriekapital induzieren zugleich einen verschärften Anpassungsdruck der fordistischen Regulationsweise (vgl. Bieling 2000). Die vor allem auf die Binnenökonomie bezogene keynesianische Nachfragepolitik wird in Frage gestellt und angesichts erlahmender Produktivitätszuwächse auf der Ebene der Akkumulation, einer steigenden Sockelarbeitslosigkeit und damit verbunden - einer (relativ) sinkenden Massenkaufkraft, ist der keynesianische Sozialstaat auch innerhalb seiner nationalen Grenzen in eine substanzielle Krise geraten. Dabei sind die Auflösungsprozesse des fordistischen Klassenkompromisses bzw. die Wandelsprozesse hin zu einer ‚fortgeschritten liberalen‘ post-fordistischen Gesellschaftsformation von Beginn an nicht alleine durch eine unlinearen ‚Krise‘ des Akkumulationsregimes verantwortet und auch „ein nachfordistisches ‚flexibles Akkumulationsmodell’ [hat] einen großen Bedarf an flankierenden sozialen und politischen Institutionen, die eine vergleichsweise stabile Reproduktion dieses neuen Produktionssystems garantieren könnten“ (Roth 1998: 96). Die ‚Suche’ nach einem neuen Entwicklungsmodell ist also keinesfalls ausschließlich ökonomischen ‚Sachzwängen‘ geschuldet, sondern zugleich und in erster Linie eine Frage politischer Gestaltung und Durchsetzung, die in verschiedenen Nationalstaaten unterschiedlich verläuft. III. 3. 1 STANDORTPOLITIK Der grundlegende Formwandel des Akkumulationsregimes ist ohne Zweifel mit der fordistischen Regulationsweise schwer zu vereinbaren. Insofern gibt es zwar einen durch ‚Sachzwänge’ induzierten Bedarf an Transformation dieser Regulationsweise, deren Ausgestaltung jedoch eine primär politische und politisch disponible Angelegenheit bleibt. Dabei stellen die zu politischen Schlüsselbegriffen avancierten Schlagworte wie ‚Deregulierung‘, ‚Flexibilität‘, ‚Privatisierung‘, ‚Leistungsbereitschaft‘ etc. wesentliche Orientierungsmuster einer gesellschaftspolitischen Neuordnung dar (Bieling 2000: 212). Auf einer sozial- und wirtschaftspolitischen Ebene tritt an die Stelle der fordistisch-keyensianischen Nachfrageregulation, in der „nationalen Industrien durch Subventionen und Zölle geschützt oder die 160 Konjunkturzyklen durch eine Unterstützung des privaten Konsums ausgeglichen werden“, eine Politik die vor allem auf eine „aktive Gewährleistung der globalen Konkurrenzfähigkeit“ zielt (Dietrich 1999: 125, vgl. Hirsch 1995). Diese nationale Politik wird fiskalischer Hinsicht durch die Zinspolitik der Zentralbanken gestützt. Sollten diese gemäß der keynesianischen Lehre für niedrige Zinsen sorgen, die eine möglichst zu Vollbeschäftigung führende Rentabilität der Investitionen im Produktivbereich gewährleisten, favorisieren die Zentralbanken inzwischen eine Hochzinspolitik um den Standort für Finanzkapital und Geldvermögen attraktiv zu machen. Die gleichberechtigte Artikulation ‚des Ökonomischen’ und ‚des Sozialen’ (vgl. Donzelot 1994) weicht in diesem Zusammenhang einer wirtschafts- und sozialpolitischen Umorientierung, die Sozialleistungen zu einem ‚Standortrisiko‘ degradiert (vgl. Zänker 1994: 57) und die Zurückdrängung der Sozialpolitik zur Erfolgsbedingung für die Wirtschaftspolitik macht (vgl. Kaufmann 1997: 173). Zurückdrängung der Sozialpolitik bzw. die Relativierung der Bedeutung ‚des Sozialen’ stellt jedoch keinesfalls einem pauschalen Rückzug nationalstaatlicher Strukturpolitik, sondern im Gegenteil eine neue Form der ‚Durchstaatlichung‘ dar. Auf der Ebene nationalstaatlicher politischer Regulation bleibt auch vom ein keynesianischen Wohlfahrtsstaat zum ‚Wettbewerbsstaat‘ mutierter Nationalstaat ein starker, ökonomisch und sozial in erheblichem Umfang intervenierender Staat. Dabei zielt er allerdings weniger auf die Korrektur des Marktes, als auf dessen direkte und indirekte Förderung sowie die ‚Sicherung’ des Standorts. In wirtschafts- aber auch in sozialpolitischer Hinsicht wird der Staat damit sukzessive zu einer Instanz, die in erster Line der Gestaltung ‚außerbetrieblicher Rahmenbedingungen’ dient (vgl. Hirsch 1993, 1998). Zu diesen Rahmenbedingungen, gehören neben dem Abbau ‚bürokratischer Hindernisse‘ und arbeitsrechtlichen Schutzrechten vor allem die (akademische) Qualifikation von Arbeitskräften, insbesondere der Kernbelegschaften der hochproduktiven Sektoren, staatliche Initiativen in der Infrastruktur- und Technologiepolitik, sowie die Aufrechterhaltung politischer Stabilität, und hiermit verbunden ‚öffentlicher Ordnung‘ und ‚innerer Sicherheit’. Die wachsende Bedeutung letztgenannter ist in den OECD-Staaten unter anderem in einer signifikanten Korrelation, zwischen einer sinkenden Sozialleistungsquote und steigenden Zahlen beim Gefängnis- (r = -0, 60) und deutlicher noch beim Überwachungspersonal (r = -0, 79) dokumentierbar (vgl. Alber 2001: 1192). Der ‚neo-liberale’ ‚Anti-Etatismus’ beschränkt sich in so fern in erster Linie auf die ‚linke Hand des Staates’ (vgl. Bourdieu 1998), insbesondere seine „capacity to pursue effective social policies, including the enforcement of workers’ rights”25 (Tilly 1995: 16). Die ‚Verschlankung’ des Staates zielt in so fern primär „auf die sozialen Sicherungssysteme, sie ist gerichtet gegen die staatliche Funktion der ‚Daseinsvorsorge’ für die Schwächeren, während die Repressiv- und Kontrollfunktionen staatlicher Apparate von der Verschlankungskur ausgeklammert werden“ (Dahme/Wohlfahrt 2002: 26). Es entspricht nicht nur der neo-liberalen Wirklichkeit (dazu: Wacquant 2000), sondern auch der libertären Philosophie eines ‚Minimalstaats’, dass dieser, wie es Bourdieu Mit Blick auf diese Entwicklung ist eine ‚Staatsskepsis’, wie sie etwa Bill Jordan (2003: 9) für die Soziale Arbeit vorträgt, nicht unberechtigt: „if […social work] is too closely identified with government agencies, acting on behalf of state institutions which have lost their power to deliver positive welfare outcomes, and focusing instead on surveillance, control and enforcement, it will be compromised by association with an oppressive authority, and lose its impartiality and critical edge”. 25 161 formuliert, seine ‚rechte Hand’ stärkt, d.h. in allererster Line „ein starker Sicherheitsstaat [bleibt], der die Gestaltung der für die Funktionsfähigkeit von Märkten und der individuellen Vertragsfreiheit der Gesellschaftsmitglieder konstitutiven Normen garantiert und die dafür notwendigen Ordnungsleistungen erbringt“ (Funk 2002: 1333, vgl. North 1990), nämlich die „functions of protecting all its citizens against violence, theft, and fraud, and the enforcement of contracts, and so on“ (Nozick 1974: 26). Insofern ist der Kapitalismus nach dem Fordismus nicht einfach ein ‚desorganisierter Kapitalismus’ (vgl. Beck 1997: 32), sondern eine anders regulierte Form des Kapitalismus, in dem sich vor allem das Verhältnis der politischen Gestaltung des Sozialen und des Ökonomischen substanziell verändert: „Nicht eine Abnahme staatlicher Souveränität und Planungskapazitäten, sondern eine Verschiebung von formellen zu informellen Formen der Regierung lässt sich beobachten“ (Lemke et al. 2000: 26). Auch wenn sich zusätzlich zu einer solchen ‚Informalisierung‘ eine Verlagerung nationalstaatlicher politischer Handlungsmuster zu supra- und subnationalstaatlichen Politikformen feststellen lässt, kann nicht von Einbruch der Staatstätigkeit als solcher, sondern nur von einer nach innen expandierenden „Staatstätigkeit im Namen des Wohlfahrtsstaats“ (Roth 1998: 104), die Rede sein, die darauf gerichtet ist durch (re-)distributive Transferleistungen zur Steigerung der individuellen Nachfrage und des individuellen Wohlfahrtsniveaus beizutragen. III. 3. 2 SOZIALE SPALTUNGEN UND ‚PREKARITÄT’ ALS HERRSCHAFTSFORM Nicht nur die Form- und Strukturveränderungen des Akkumulationsregimes, sondern vor allem der Wandel der Regulationsweise und die Veränderungen der kulturellen Hegemonie bilden den Rahmen für neue Formen einer Hervorbringung von ‚Identitäten’ und Vergesellschaftung von ‚Subjekten’. Während sich eine ‚Vollkasko-Individualisierung‘ (Beck) im Rahmen einer relativen Homogenisierung der Sozialstruktur, Bildungsexpansion, wachsender Gleichheit in der Einkommensdistribution als Effekt von Vollbeschäftigung und verbesserter wohlfahrtsstaatlicher Versorgung etc. in Zeiten der Prosperität einer keyensianisch-sozialstaatlich regulierten Phase des Kapitalismus vollziehen konnte, kann eine wachsende Homogenisierung und Gleichheit der Gesellschaft für ‚nach-fordistische’ fortgeschritten liberale Gesellschaftsformationen nicht mehr angenommen werden (vgl. Hirst 2000: 127 f). Bei gestiegenem gesellschaftlichem Reichtum nimmt die relative Armut seit den 1970er massiv zu (vgl. Eichler 2001: 42). Insbesondere die zeitliche Periode seit den 1970er Jahren ist es, in der nach Beck von einem verstärkten Prozess einer ‚Risiko-Individualisierung‘, auszugehen sei. Vor dem Hintergrund von Flexibilisierungen und Deregulierungen der Arbeitsmärkte wie der sozialen Sicherungssysteme und einer zunehmend marktförmig vermittelten Form der Vergesellschaftung hätten auch die bislang nicht hinterfragten traditionellen Karrieremuster, ‚Normalarbeitsverhältnisse’ und -biographien sowie die klassischen familialen Reproduktionsstrukturen, ihre gesellschaftliche Leitbild- und individuell halt- und kohärenzstiftende Funktion zunehmend verloren. Zugleich werde die an administrativen Standardisierungsmustern, überholten Regeln, Lösungsstrategien und vor allem Kontrollansprüchen festhaltende Politik faktisch entmachtet (vgl. Beck 1994: 204 ff) und zunehmend außerhalb etablierten 162 Institutionen von den Individuen selbst gestaltet. Diese Entwicklungsprozesse würden „vom modernen Menschen ein individuelles Selbstmanagement (life management) [verlangen]“ (Wendt 2001: 1310). Die von ‚Modernisierungstheoretikern’ vornehmlich auf kulturalistischer Ebene beschriebe ‚Risikoindividualisierung’, benennt Strukturprozesse, die auch als Prekarisierungsformen in nachfordistischen Gesellschaftsformationen beschrieben werden können. Aus dieser Perspektive erscheinen die Prozesse hin zu einer ‚Risikogesellschaft’ auf der Ebene des Sozialen dann aber weniger als soziokulturellen Tatsachen und Produkte reflexiver gesellschaftlicher Modernisierung, sondern als vor allem als hegemonietheoretisch analysierbare, politisch induzierte Prozesse, die auf eine fundamentale Veränderung in der politischen Konstitution und Gestaltung des Sozialen verweisen. ‚Individualisierung’ meint aber dann nicht nur einen realen, gesellschaftlichen Prozess der Entbettung des einzelnen Akteurs aus seinen sozialen Milieus und Bezügen, sondern vor allem auch eine veränderte politische Rationalität: ‚individualisiert’ wird vor allem ‚das Soziale’ (vgl. Ferge 1997). Gemäß dieser Interpretation ist die ‚Risikoindividualisierung’ das Produkt einer fortgeschritten liberalen Regulationsweise, die den fordistisch-keynesianischen ‚Sozialkontrakt’ (vgl. Standing 1993) unterminiert hat. Diese Unterminierung betrifft zumindest drei zentrale Voraussetzungen und Bestandteile sozialer Sicherheit: „labour market security (efforts by the state to reach full employment), income security (through social provision, jobless benefits, and incorporation into unions) and employment security (the reduction of capitalist command over terms of hiring and firing). All in all, the structural roots of economic uncertainty and precariousness have ramified and extended in reach as well as depth”(Wacquant 1996: 125, vgl. Bauman 1998, Bourdieu 1998). Ein wesentlicher analytischer wie mittelbar politischer Unterschied zwischen diesen beiden Interpretationen bezieht sich im Kern sich auf die Annahme einer realen Individualisierung sozialer Ungleichheit einerseits, in der die Frage von Klassen zugunsten von Fragen des Risikos verschwindet (kritisch: O’Malley 2001) und in der Klassenpositionierungen aufgrund globaler ‚Modernisierungsrisiken’ durch transversale Risikopositionierungen ersetzt werdeb, gegenüber einer Analyse, die darauf besteht, dass soziale Ungleichheit nach wie vor keine individuelle bzw. primär dispositionale Frage sei, sondern in einem politischen Prozess dadurch individualisiert wird, dass (soziale) Risiken aus dem Sozialen entbettet und als individuelle und individuell zu managende Risiken neu konstituiert werden. Dabei wird weder bestritten, dass neben und teilweise auch relativ unabhängig von vertikalen sozialen Ungleichheiten auch horizontale Unterschiede strukturierend wirken, noch, dass Klassenunterschiede von neuen Risikogleichheiten, (etwa der globalen Umweltverschmutzung) begleitet werden, aber es wird bezweifelt, dass die zentrale Strukturierung der Gesellschaft auf der Basis eines freigesetzten individuellen und interindividuellen Umgangs mit Risiken jenseits von Klassenlagen verläuft (vgl. Rigakos/Hadden 2001). Nach einer solchen Interpretation haben ‚Risikogesellschaften‘ ihre immanenten Klassenkonflikte nicht überwunden, sondern vor allem neue Konfliktquellen (vgl. Engel/Strasser 1998: 100) in existierende positionale, materielle und symbolische horizontal und vertikal Ungleichheitsstrukturen hinzugefügt (vgl. Dangschat 1998, Kreckel 1998, Dederichs/Strasser 2000). 163 Ein wesentliches Moment, das die fordistische ‚Welt der Inklusion’ und die um ein Normalerwerbsverhältnis und eine Normalerwerbsbiographie – des ‚typischen’ Lohnarbeiters (im Vollerwerb tätig, männlich) und der davon abgeleitete Figur der Hausfrau und Mutter (für die Reproduktionsarbeiten verantwortlich, unbezahlt) - herum konstituierten Identitäten erschüttert hat, bezieht sich auf Prozesse, die als eine ‚Krise der Arbeitsgesellschaft‘ (vgl. Offe 1983) verhandelt werden. Eine solche Krisendiagnose findet ihre Basis in Arbeitslosigkeitsquoten, die langfristig im zweistelligen Prozentbereich liegen und einem ‚jobless growth‘ in dem Wachstum und Arbeit entkoppelt und immer „größerer Wohlstand von immer weniger Arbeitenden produziert“ wird, sowie der Beobachtung, dass „im wachsenden Maße sowohl wirtschaftlicher Aufschwung wie Abschwung zum Produktionsfortschritt [beiträgt]“ (Lepenies 1996: 106). Dem steht jedoch nicht entgegen, dass die sogenannte ‚Krise der Arbeit‘ in erster Line auf das sozial abgesicherte Vollerwerbsverhältnis zutrifft (vgl. Brose 2000), während die Erwerbsquote selbst mehr oder weniger permanent steigt (vgl. Bieling 2000: 181). Betrachtet man sich die Allokation der realen Beschäftigungsverhältnisse, die hinter den Erwerbsquoten stehen, so wird deutlich, dass vor allem die Zahl der auf dem ersten Arbeitsmarkt Vollbeschäftigten ab-, die der vorübergehend und prekär Beschäftigten aber deutlich und langfristig zunimmt (vgl. Dangschat 1994: 881). Diese Zahlen verweisen auf „Veränderungen im erwerbsbezogenen Inklusionsmodus, nicht jedoch einen generellen Bedeutungsverlust der Erwerbsarbeit. Im Gegenteil, in vielen OECD-Staaten wird über regierungsoffizielle Workfare-Programme die Erwerbsorientierung politisch noch mal akzentuiert.“ (Bieling 2000: 181 f) Während auf einer analytischen Ebene Kapitalismus ohne Lohnarbeit nicht existieren kann, ist diese empirisch auch in der ‚nach-fordistischen’ Formation des Kapitalismus keinesfalls im Verschwinden begriffen (vgl. Beck 1998), sondern die Nachfrage nach bezahlter Arbeit ist insgesamt angestiegen (vgl. Hirsch 2001, Statistisches Bundesamt 2002a): Statt von einem ‚Verschwinden’ ist demnach eher von einer ‚Intensivierung der Arbeit’ zu sprechen (vgl. Gollac/Volkhoff 2001). Dies gilt vor allem an den Polen im Bereich der Hochqualifizierten einerseits und im andererseits im prekarisierten bzw. Niedriglohnbereich, der auch in Deutschland bereits voll etabliert (vgl. Schäfer 1997), mit über einem Drittel der Bevölkerung unter der 75 % Marke des Nettoäquivalenzeinkommens auch stark besetzt ist (vgl. Hanesch et al 2000, Eichler 2001) und durch diverse nationale Spielarten von ‚workfare’-Politiken offensiv vorangetrieben wird (vgl. Grell et al. 2002, Wacquant 1996): Der Verlust von sicheren ‚Normalarbeitsplätzen’ im fordistischen Sinne, hat dabei für ein Akkumulationsregime, das vor allem flexible Arbeitsmärkte und strukturelle Wettbewerbsfähigkeit verlangt (vgl. Castel 2000, Jessop 1993, Hirsch 1998), seinen Status als Problem für das ökonomische Wachstum verloren und ist selbst Teil einer fortgeschritten liberalen Lösungsstrategie geworden. Eine ‚Krise der Arbeit‘ respektive der ‚Arbeitsgesellschaft’ (vgl. Böllert 2001a) bezieht sich in diesem Sinne nicht auf den Stellenwert der Lohnarbeit im ‚neuen Kapitalismus’ (vgl. Sennett 1998) per se, sondern auf ihre Funktion als zentrale Dimension einer verallgemeinerten sozialen Integration, die im Fordismus ihren Höhepunkt erreicht hat. Demgegenüber ist eine – gerade auch für die Integrationsvermittlungsfunktion der fordistischen Profession Jugendhilfe zentrale - „Erreichbarkeit des durchschnittlichen Lebensentwurfs, der auf Vollzeitarbeit […basiert, ist] für zunehmend mehr 164 Menschen nicht nur vorübergehend nicht mehr gegeben“ (Böhnisch 1994a: 47). Während damit ‚objektiv‘ die für die fordistische Gesellschaftsformation kennzeichnende gesellschaftliche Integration qua Lohnarbeit vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt wird, wird für die hierdurch nicht, oder nur prekär inkludierten die subjektive Bedeutung von Lohnarbeit als zentrale Ressource einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe systematisch gesteigert (vgl. Schaarschuch 1998). In diesem Kontext verstärkt sich auch der Konflikt zwischen Besitzern von ‚Normalarbeitsplätzen‘, die ihren noch privilegierten Status verteidigen und dem Rest der Lohnabhängigen (vgl. Hirsch 2001) dadurch, dass die Strategie einer ‚Dekommodifizierung’ der Arbeitskraft, wie sie im Kontext der ‚aktiven Proletarisierung’ durch den keynesianischen Sozialstaat vollzogen wurde (vgl. Lenhardt/Offe 1977) durch die ‚workfare’ Strategien (vgl. Jessop 2002) einer ‚administrativen Rekommodifizierung’ (vgl. Seeleib-Kaiser 1997) zur Wettbewerbsmodernisierung als dem Versuch einer Mobilisierung bisher nicht ausgeschöpfter ökonomischer Ressourcen und Potentiale abgelöst durch die Beschäftigungsverhältnisse induziert werden, die in hohem Maße prekär sind bzw. für weite Teile der Bevölkerung zu einer Prekarisierung ihrer Lebenslagen insgesamt beitragen. Im Kontext einer – zumindest in Westdeutschland - seit Anfang der 1990er Jahre fast durchweg rückläufigen die Entwicklung der realen Einkommen und einer im beiden Teilen der Bundesrepublik zu verzeichnenden Vergrößerung der Ungleichheit bei den verfügbaren und insbesondere den untersten Einkommen (vgl. Grabka 2000), hat sich in den letzten Jahren – wie in den meisten westlichen Gesellschaften - eine Klasse von ‚working poor’ herausgebildet. In der Bundesrepublik verfügt ein „hoher Anteil der armen Haushalte über Erwerbseinkommen […]. Diese Personen sind mehrheitlich einkommensarm trotz Erwerbsarbeit“ (Andreß 1999: 264 vgl. Bundesregierung 2001, Pohl/Schäfer 1996). Wenn die Bezahlung im Niedriglohnbereich mittlerweile kaum mehr einbringt als die staatlichen Unterstützungsleistungen (vgl. Jakobs 2000) bedeutet dies für die untersten Straten der Bevölkerung faktisch nur die Wahl zwischen einem immer schlechter alimentierten „Leben ohne Beschäftigung und Gelegenheitsarbeiten zu Hungerlöhnen“ (Young 2001: 189). In diesem Sinne kann man von einer doppelten gesellschaftlichen Spaltung sprechen: zum einen zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, zum anderen zwischen qualifiziert und unqualifiziert beschäftigten Arbeitskräften (vgl. Krätke 1995). Da der sozialstaatliche Schutz in dem von einem konservativen Korporatismus (vgl. Esping-Anderson 1990) geprägten bundesdeutschen Wohlfahrtsstaat weitgehend auf einem Versicherungssystem beruht, das sich am Normalarbeitsverhältnis orientiert, während der Sozialhilfe des Staates nur eine subsidiäre Rolle zukommt, kommt es zu einer zunehmenden Spaltung, bzw. Segmentierung zwischen im Normalarbeitverhältnis eingebundenen und vom Sozialstaat abhängigen sozialen Akteuren (vgl. Appelt/Weiss 2001). Im Kontext dieser Spaltungs- bzw. Marginalisierungstendenzen für deprivierte Gruppen unterhalb der Lohnabhängigenkerne, wird eine Zugehörigkeit und gesellschaftliche Teilhabe mit der Aufkündigung sozialen Common Sense der fordistischen Phase des Kapitalismus zunehmend exklusiver bestimmt (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2000: 61): Zum einen ist „das gegenwärtige Sicherungssystem der Bundesrepublik nur bedingt […auf die] Pluralisierung prekärer Formen der Lebensführung […] eingestellt […zum anderen besteht] das Problem einer wachsenden Selektivität des Arbeitsmarktes […]: Die Nachfrage nach Arbeitskräften konzentriert sich angesichts eines tendenziellen Überangebotes auf die aus Unternehmersicht brauchbarsten, produktivsten“ (Kaufmann 1997: 176). 165 Insgesamt kann damit für eine nach-fordistische Gesellschaftsformation nicht mehr nicht nur von einer zunehmenden Polarisierung zwischen Arm und Reich im Sinne eines Distributionskonflikts gesprochen werden (vgl. Zimmermann 1998), sondern auch im Sinne eines Produktionskonflikts, basierend auf den Flexibilitätsanforderungen des Akkumulationsregimes, wird eine gesellschaftliche Enthomogenisierung und Spaltung konstitutives Element eines neuen Entwicklungsmodells (vgl. Schaarschuch 1990). Auf der Ebene der Sozialstruktur beendet der Übergang vom Fordismus zu einer fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation den keyensianisch-sozialstaatlichen ‚Klassen-Deal’ (vgl. Hirsch 1990, Narr 1999) und induziert in Form einer Art spätmodernen ‚Gentrifizierung’ der Gesellschaft, Prozesse der Öffnung des sozialen Raums für die oberen Chargen der Gesellschaft, dem jedoch ein verstärkter Schließungsprozess für jene gegenübersteht, „die in dieser Mitte ihre Sicherheiten verlieren oder gar in prekäre Lebensverhältnisse absteigen müssen“ (Vester 1993: 9, vgl. Vester et al. 2001). Zwar bilden weiterhin etwa 60 % der Bevölkerung die ‚Mitte der Gesellschaft’, aber diese verliert zusehends ihren ‚integrativen’ Charakter (vgl. Dangschat 1994, Vester et al. 2001). Ein aufstiegsorientiertes Drittel dieser gesellschaftlichen Mitte hat sich nicht nur ihre Teilhabe umfassend gesichert, sondern auch ihre Chancen individueller Selbstbestimmung zum Teil beachtlich erweitert (vgl. Vester 1997: 182), während für etwa 40 % der Bevölkerung unterhalb einer ‚etablierten’ Mitte eine Zone ‚prekären Wohlstands’ mit unsicheren Standards entstanden ist (vgl. Hübinger 1996). Entlang vertikaler Klassenformationen verlaufend (vgl. Vester et al. 2001), ist in diesem Sinne eine ‚Risikogesellschaft’ entstanden, die nicht durch eine biopolare ‚Innen-Außen’ Sektorierung gesellschaftlicher Gruppen (vgl. Dubet/Lapeyronnie 1994) gekennzeichnet ist, in der sich unterhalb der ‚zufriedenen Mehrheit’ (vgl. Galbraith 1992) ‚klassenlos’ Inkludierter eine exkludierte Subpopulation als neue ‚Underclass’ herausbildet, sondern eine - für die Flexibilitätsanforderungen eines nach-fordistischen Akkumulationsregimes funktional notwendige (vgl. Schaarschuch 1996: 857 f) - graduelle Abstufung eines breiten Übergangs gesellschaftlicher Zentrums- und Peripheriezonen (vgl. Kreckel 1992). Für die Bundesrepublik kann in diesem Kontext eine Zunahme prekärer Situationen, eine zunehmende sozialstrukturelle Polarisierung und eine Abnahme gesellschaftlicher Distributionsgerechtigkeit konstatiert werden, die mit dem ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2001) auch quasi regierungsamtlich anerkannt wird. Zugleich ist in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren der ausgleichende Effekt des staatlichen Umverteilungssystems zugunsten des unteren Rands der Verteilung schwächer geworden. In Anlehnung an Robert Castel (1996, 2000) kann dies als die Ausweitung einer ‚Zone der Verwundbarkeit‘ verstanden werden, in der vor allem das Verhältnis zwischen Arbeitskraft und sozialen Sicherungsnetzen massiv gestört ist. Dabei verlaufen die wesentlichen gesellschaftlichen Konfliktlinien nicht nur zwischen der überwiegenden Majorität ‚drinnen’ und einer kleinen, umgrenzten ‚exkludierten’ Minderheit ‚draußen’, sondern gehen durch die ‚inkludierte’ Gesellschaft hindurch. Während sich die ‚Zone der Verwundbarkeit’ ausbreitet, nimmt zugleich die – für den Ausbau sozialer Rechte in fordistischen Phase des Kapitalismus wesentliche (vgl. Kaufmann 1994: 26 f) - Mobilisierung eines ‚Drucks von unten’ d.h. einer kollektiven Artikulation subhegemonialer Interessen, auf der 166 politischen Ebene ab. Da sich die Bildung ‚realer Klassen’ als real Interessen artikulierende Gruppen auch historisch nie alleine aus ihrer relativen Nähe in der Topologie eines sozialen Raums ergeben hatte (vgl. Thompson 1980, vgl. Bourdieu 1989), sondern als ein politischer Prozess unter der Bedingung und im Bewusstsein einer gemeinsamen, materiellen wie symbolischen Interessenstruktur und relativ homogener Lebenserfahrungen (vgl. Wright 1989), lässt sich weniger von einer Entstabilisierung von Klassenkulturen oder einer „Krise der Milieus (als Folge des Wertewandels), sondern [… von einer] Krise der politischen Repräsentation (als Folge einer zunehmenden Distanz zwischen Eliten und Milieus)“ sprechen (Vester et al. 2001: 104). In nach-fordistischen, fortgeschritten liberal regulierten Gesellschaftsformationen nimmt die Heterogenität der Lebenserfahrungen zu und die Interessen verschiedener Teile der immer stärker gespaltenen Lohnarbeiterschaft driften auseinander (vgl. Hirsch 1998). Dieses ‚Auseinandertriften’ ist nicht zuletzt ein Ergebnis einer ‚Prekarisierungsstrategie’, die als „Produkt eines politischen Willens“, auf einer Ausweitung der ‚Zonen der Verwundbarkeit’ bzw. „der Erreichung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt“ (Bourdieu 1998: 99): „Wo einst die Sicherheit der Arbeitsplätze und ein relativ gehobenes Lohnniveau gewährleistet und Wachstum wie Gewinn durch die damit verbundene Ankurblung der Nachfrage gesichert waren, maximiert die Produktionsweise den Gewinn durch den Abbau von Arbeitsplätzen und Lohnsenkungen, und der Aktionär kümmert sich nur noch um den Börsenkurs, der sein Nominaleinkommen bestimmt, und um Preisstabilität , die sein reales Einkommen möglichst nominal halten soll. Damit ist ein ökonomisches Regime entstanden, dass untrennbar mit dem politischen Regime verknüpft ist, jener mit einem bestimmten Herrschaftsmodus verbundene Produktionsmodus, der auf einer Institutionalisierung der Unsicherheit beruht und Herrschaft durch Prekarität ausübt: ein deregulierter Finanzmarkt begünstigt einen deregulierten Arbeitsmarkt und damit prekäre Arbeitsverhältnisse, denen sich die Arbeitnehmer nun zu fügen haben“ (Bourdieu 2001a: 53) Zugleich werden soziale Prekarisierungen insofern politisch vorangetrieben, wie die sozialen ‚Sicherheitssysteme’ selbst kein Bollwerk gegen Prekarität mehr daherstellen, sondern Transferleistungen selbst von der Übernahme prekärer Beschäftigungen und Tätigkeiten im Niedriglohnsektor abhängig gemacht, oder gar von diesen ersetzt werden (vgl. Kessl/Otto 2002). Diese Ausrichtung fortgeschritten liberaler Regierungsweisen des Sozialen, die an die Stelle von sozialen Garantien, ein aktivierendes Fördern und Fordern setzten und für zunehmend konditionale, individuelle und punktuelle Leistungen individuelle ‚Gegenleistungen’ Form einer selbstunternehmerischen arbeitsmarkbezogenen Form der Lebensführung trägt zumindest in so fern selbst zur sozialen Verunsicherung bei, wie sie nicht länger darauf zielt ‚soziale Angstfreiheit’ ‚existential security’ und ‚psychological certainty’ (vgl. Bauman 1998) - zu ermöglichen, sondern selbst soziale Verhältnisse in ‚moralische’ umgestaltet, und als Produkt individuellen Verhaltens und persönlicher Einstellungen repräsentiert. In dieser Hinsicht kann Prekarität in dem Maße als politische Herrschaftsform verstanden werden, wie der Abbau von kollektiven sozialen Sicherheiten und individuellen sozialen Rechten nicht nur als ‚fiskalische’ Notwendigkeit, sondern auch als ‚moralische’ und motivationale Grundlage der geforderten Eigenverantwortung verhandelt wird (vgl. Bourdieu 1998, 2001c, Völker 2002). Klassentheoretisch betrachtet gelingt es damit zugleich, materielle wie symbolische gesellschaftliche Auseinandersetzungen auf der Ebene von ‚Konkurrenzkämpfen’ isolierter Akteure zu halten (vgl. Bourdieu 1987: 251). Während sich die unteren gesellschaftlichen Klassen immer umfassender in 167 einem Zustand erheblicher sozialer Vulnerabilität befinden (vgl. Moser 1996) bleibt Prekarität von Lebens- und Erwerbsverhältnissen zwar klassenspezifisch rückgebunden und prästrukturiert (vgl. Layte et al. 2002) aber nicht auf diesen sozialpolitisch klar definierten Teil der Bevölkerung beschränkt, sondern ist zumindest als latente Gefahr auch für Angehörige der mittleren Klassen präsent (vgl. Buhr 2001) und führt ohne die Verbindung mit einer akuten Ausschlussdrohung zu einer tendenziellen Verallgemeinerung der Angst vor dem sozialen Abstieg (vgl. Kronauer 1997). Die sozialen Ängste in der Zone der Verwundbarkeit werden durch die Möglichkeit der Exklusion als potentieller Endpunkt noch verschärft und treiben die symbolischen Distinktions- bzw. Konkurrenzkämpfe von oben ebenso wie den Konformitätsdruck an den unteren Linien der Respektabilität noch zusätzlich an. Weniger transversalisierte ‚Risiken’ als ‚Prekarität’ und prekäre gesellschaftliche Teilhabeformen für immer weitere gesellschaftliche Gruppen können demnach als ein Kennzeichen einer klassenstrukturierten ‚Risikogesellschaft’ betrachtet werden26. Vor allem innerhalb der ‚Zone der Verwundbarkeit‘ stellen diese Ängste ein wesentliches Moment der Dynamik einer rigider werdenden Feststellung eines ‚Innerhalb’ in Abgrenzung zu einem sozialen ‚Außerhalb’ dar, und führen vor allem auch auf der Ebene der Ideologie zu Verschiebungen in dem spannungsreichen Verhältnis von Integration und sozialer Abfederung auf der einen und persönlicher Sicherheit und öffentlicher Ordnung auf der anderen Seite. Eine besonders für die Mittelklassen typische ‚status anexiety’, die eng mit der Erfahrung ökonomischer und kultureller Krisen in Verbindung steht beschreibt Gusfield (1963) für die USA bereits in den frühen 60er Jahren. Die symbolischen Reaktionen im Kontext dieser Ängste liegen dabei in der defensiven Konstruktion kollektiver Identitäten, einem „’Wir’ als Abwehr gegen Verwirrung und Entwurzelung“ (Sennett 1998: 190), die sich in Form einer ‚moralischen Militanz’ (vgl. Hunt 1999) nicht zuletzt auf die Feindschaft gegenüber Immigranten, Fremden und Außenseitern stützt (vgl. Hirsch 2001). In diesem Sinne hat sich in eine klassenstrukturierte ‚Risikogesellschaft’ eine für das nachfordistische Akkumulationssystem funktionale soziale Prekarität bis in die mittleren Klassen erweitert und darüber hinaus neue (Sub)Gruppen hervorgebracht hat, die um die Dimensionen von ‚Vulnerabilität’ beschrieben werden können jedoch zunehmend im Kontext der Dimension ihrer ‚Gefährlichkeit’ wahrgenommen werden (vgl. Defert 1991). Während nach wie vor die Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder „ihr Einkommen, ihren Status, ihre Identität, ihre Absicherung ihre gesellschaftliche Existenz und soziale Anerkennung aus ihrer Stellung innerhalb der Arbeitnehmerschaft [bezieht]“ (Castel 2001: 15) haben diese Gruppe das verloren, was für ihre gesellschaftliche Integration sorgt, für sie macht sich „Mangel, Ausgrenzung, Stigmatisierung und mangelnde Anerkennung breit“ (Eichler 2001: 58) und im Sinne einer „verschärften Klassenspaltung […wird für sie zunehmend] die Verknüpfung von Lohnarbeit, materieller Reproduktion und gesellschaftlicher Statuszuweisung […] allein negativ wirksam, nämlich als Abdrängung in eine Schattengesellschaft, die durch Armut und soziale Kontrolle bestimmt ist“ (Bonß/Heinze 1984: 30). Von einer ,Demokratisierung’ sozialer Risiken (vgl. Beck 1986) kann allerdings keine Rede sein. Blick man etwa alleine nur auf das ‚kulturelle Kapital’ so ist die Wahrscheinlichkeit unter die Armutsgrenze zu rutschen für Ungelernte um das 5fache höher als die von Hoch- und Fachhochschulabsolventen, die der Arbeitslosigkeit um das 7-10fache (vgl. Geißler 2002: 343 f, Statistisches Bundesamt 2002a) 26 168 Vor allem in den USA spielen diese ‚wirklich benachteiligten’ (vgl. Wilson 1987) für die im Extremfall keine Arbeitsform und kein ökonomisches, soziales oder kulturelles Kapital eine positive Identität konstituiert (Kronauer 1997: 46), politisch nur noch in so fern eine Rolle, wie sie Ordnungsprobleme auf die Wahrnehmungen und Konstruktionen des politischen Systems aufwerfen (vgl. Groenemeyer 1999a: 126), auf die mit punitiven Strategien eines strafenden Staates reagiert wird (vgl. Wacquant 2000, Western et al. 2001). Ob für die Bundesrepublik von einem nominal signifikanten Teil von Bevölkerungselementen, die Rede sein kann, der von allen zentralen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Austauschbeziehungen nicht nur sukzessiv entkoppelt, sondern völlig ausgeschlossen ist, lässt sich bezweifeln (Nogala 2000; Koch 1999, Andreß 1997). Unzweifelhaft ist jedoch, dass in fortgeschritten liberalen Gesellschaften nicht nur Arbeit und Einkommen, sondern auch die in sozialer Hinsicht existenziellen Chancen gesellschaftlicher Teilhabe ein knappes und ungleich verteiltes Gut geworden sind (vgl. Scherr 1999: 39). In diesem Sinne kommt der Sozialpolitik in einer ‚nach-fordistischen’, gesellschaftlichen Formation zunehmend die „Aufgabe des ‚Managements der Spaltung der Gesellschaft’ zu, d.h. die Schaffung und Erhaltung flexibler Zonen und Abstufungen zwischen Kern und Rand der Gesellschaft. Ziel der Sozialpolitik ist nicht mehr wie ehedem im Kontext der ‚fordistischen’ Formation primär die Integration in ein Modell der Lohnarbeit, sondern die Heterogenisierung der Lohnarbeiterschaft vor dem Hintergrund der Flexibilisierungsanforderungen macht eine Vielzahl von abgestuften Regelungen notwendig, die im weiten Übergangsspektrum zwischen festangestellter, vollzeitausgelasteter Kernarbeit und dauerhafter Ausgrenzung vermitteln“ (Schaarschuch 1996: 48). III. 3. 3. AKTIVIERENDE SOZIALPOLITIK Als ein parteiübergreifendes Muster der Versuche einer veränderten sozialpolitischen Regulation eines nachfordistischen Akkumulationsregimes zeichnet sich ein Bündel unterschiedlicher Strategien und Maßnahmen ab, deren Gemeinsamkeit im wesentlichen darin besteht, dass sie im Kontext von Konzepten einer ‚aktiven Staatsbürgerschaft’ und eines ‚ermöglichenden’ ‚innovativen’ ‚steuerenden’ oder ‚aktivierenden Staats’ den Abschied von einer ‚überzogenen Anspruchshaltung’ gegenüber dem Sozialstaat fordern, die die „Verantwortungsbereitschaft und das Engagement der Bürger und damit auch das Fundament staatlicher Ordnung“ (Alemann et al. 1999: 15) untergraben habe. Der Ausgleich von Marktdefiziten soll gemäß diesen Konzepten weniger durch direkte staatliche Interventionen und Transferleistungen erfolgen, sondern von den zugleich staatlich angeleiteten und ‚empowerten’ ‚zivilgesellschaftlichen’ Akteuren selbst ausgehen. Dabei wird im Kern eine Regulationsweise beschrieben, in der es nicht nur um einen bloßen quantitativen Rückzug, sondern vor allem um einen grundlegenden qualitativen Umbau des fordistisch-keynesianischen Sozialstaats geht. In diesem Umbau wird die sozialpolitische Regulation und öffentlich-rechtliche Gestaltung des Sozialen zunehmend an den Markt sowie an die sich selbst regulierenden ‚Subjekte’ überantwortet und damit das Verhältnis von Staat, Markt und ziviler Gesellschaft in einer deutlich veränderten Weise neu arrangiert. Weil sich der „bis dato allzuständige Staat“ weder in der Lage sehe, „seine gestaltenden, leistenden und wohlfahrtsorientierten Funktionen umfassend wahrnehmen“ zu können, noch weiterhin bereit wäre „dafür alleine Verantwortung zu tragen“ (Behrens 1999: 47 f) wird eine weitreichende Substitution des sozialpolitisch ‚aktiven’ Staats durch ‚aktive Bürger’ gefordert. 169 Parteiübergreifend sind sich ‚moderne Sozialdemokraten’ und Konservative im Kern einig, dass die sozialen Sicherungssysteme die „Fähigkeit Arbeit zu finden“ verhindern würden und deshalb „persönliche Leistung und Erfolg, Unternehmergeist, Eigenverantwortung und Gemeinsinn“ (Schröder/Blair 1999: 329) an die Stelle von einem „Sicherheitsnetz von Ansprüchen“ (Schröder/Blair 1999: 329) treten sollen, welches „von einer gigantischen bürokratischen Maschinerie“ (Biedenkopf 1997: 101) getragenen werde. Statt eines ‚universellen Sicherungsstrebens’ sei ein „Sprungbrett in die Eigenverantwortung“ (Schröder/Blair 1999: 329) bzw. ein „dezentralisiert[es] System von Gemeinschaften […] in dem jeder einzelne Verantwortung übernimmt“ (Biedenkopf 1997: 101 f) erforderlich. Die Grundintension der ‚workfare’ Pogrammatik des US-amerikanischen ‚Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act’ von 1996, nämlich ‚dem Menschen den Übergang von der Fürsorge zur Arbeit zu ermöglichen’, steht auch in Deutschland im Zentrum eines Umbaus der bisher mehr oder weniger umfassenden und verallgemeinerten staatlichen Sicherungssysteme in ein System selektiver, individuierter und zielgerichteter Unterstützungsmaßnahmen, die mit einer Arbeitsmarktpolitik kurzgeschlossen werden. Die Unterstützungsmaßnahmen und -angebote zielen im wesentlichen darauf, die betroffenen sozialen Akteure alleine dadurch zur Arbeit zu bewegen, dass reduzierte sozialen Transfer- und Lohnersatzleistungen (vgl. Eichel 1999) möglichst nur jenen zugute kommen lassen, die ‚arbeitswillig‘, oder zu keiner Arbeit fähig und mithin ‚wirklich bedürftig‘ sind. Wer sich diesen ‚Hilfsangeboten’ entzieht, hat der ‚neosozialen’ Logik folgend ‚berechtigter Weise‘ keine Unterstützung zu erwarten. Der ‚aktivierende Staat’, unterscheidet sich von einem ‚aktiven’ sozialen Staat - der die „Bedeutung von eigener Anstrengung und Verantwortung ignoriert und nicht belohnt“ (Schröder/Blair 1999), sondern den Märkten und dem Ehrgeiz der Bürger Grenzen gesetzt habe – dadurch, dass er ‚fördert und fordert’ aber nicht mehr „passiver Versorger der Opfer wirtschaftlichen Versagens“ sei (Schröder/Blair 1999). Die aktivierende Strategie liegt darin, dass ‚passive’ Sicherungssystem mit seinen positionskomensierenden Transferleistungen in ein ‚aktives’ umzubauen, in denen die Rückführung in Erwerbsverhältnisse oberste Priorität besitzt (vgl. Hanesch/Baltzer 2001). Dabei ist der reine Sachverhalt positionskomensierende Unterstützungen zu benötigen, alleine nicht mehr ausreichend, sondern wird an bestimmte dispositionale Aspekte gekoppelt, wie etwa die gezeigte Willigkeit und ‚aktive’ Bereitschaft des Leistungsadressaten ‚das Seine’ zu leisten: das heißt etwa nachweisbar bemüht zu sein, selbst irgendeine Form der Erwerbsarbeit zu suchen und was immer als ‚zumutbares’ Angebote definiert wird auch anzunehmen. Das Gebot des ‚Förderns und Forderns’ ebenso wie die Hilfe zur Arbeit verweisen nicht per se auf Workfare-Politiken und eine Abkehr von sozialstaatlichen Rationalitäten: „Dort wo das Fordern sich instrumentell dem Fördern unterordnet, steht Hilfe zur Arbeit in der […] Tradition des bisherigen Sozialstaatsgebots: ‚Fordern um erfolgreich zu fördern!’ Dort aber, wo das Fördern sich instrumentell dem Fordern unterordnet, verwirft Hilfe zur Arbeit die […] Tradition der bisherigen Sozialstaatsverpflichtung: ‚Fördern um erfolgreich zu fordern!’ […] In der zweiten Variante ist […] das Fördern eingebaut in das Fordern […] und findet seine Begrenzung und seine Legitimation dort, wo es dem Abbau sozialstaatlicher Hilfe dient. [… Eine weitere Differenzierung lautet wie folgt:] Dort, wo die professionelle Definition des individuellen Bedarfs sich dominant an den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten des Hilfeempfängers orientiert; dort wo diese Bedürfnis[e] und Möglichkeiten des Hilfeempfängers den Hilfeprozess in jeder seiner Phasen dominant steuern; dort 170 wo der Hilfeempfänger auf qualifizierte Weise Ko-Produzent im Hilfeprozess ist; dort die Bedarfsanalyse die Planung und Bereitstellung von Hilfemaßnahmen dominant beeinflusst; dort steht Hilfe zur Arbeit in der […] Tradition des bisherigen Sozialstaatsgebots. Dort aber, wo die professionelle Definition des individuellen Bedarfs sich dominant an der Zielsetzung der Vermittlung in Beschäftigung orientiert; dort, wo dieses Ziel der Vermittlung in Arbeit den Hilfeprozess in jeder seiner Phasen dominant steuert; dort wo die Partizipation des Hilfeempfängers bloß formal und weitgehend erzwungen ist; dort wo die vorhandenen Angebote an Maßnahmen und Arbeitsstellen die Hilfeprozesse und die Bedarfsfeststellung dominant beeinflussen; dort verlässt Hilfe zur Arbeit die […] Tradition der bisherigen Sozialstaatsverpflichtung“ (von Freyberg 2003: 93 f) Ferner lässt sich sagen, dass die Grenzen der traditionellen Sozialstaatsverpflichtung auch dort überschritten werden, wo sich die Hilfeprozesse und Hilfesysteme nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ an den fiskalischen Interessen der Sozialhilfeträger orientieren, wo das ‚Scheitern’ der Hilfe zur Arbeit, daran fixiert wird das die Nachfrage der Hilfeadressaten nicht zum Angebot passt und auf dieser Basis das Anrecht auf Hilfe teilweise oder völlig reduziert wird und wo die traditionellen Orientierungsgrößen der Hilfeleistungen – wie „menschliche Würde, soziale Gerechtigkeit und individuelle[r] Bedarf“ – an die Bereitschaft des Adressaten gebunden wird, sich in gegebene, ‚angebotene’ Beschäftigungen vermitteln zu lassen (von Freyberg 2003: 94 ff). Diese Verschiebungen bzw. Verabschiedungen von der traditionellen Sozialstaatsverpflichtung vollziehen sich vor dem Hintergrund eines neuen Staatsverständnisses in dem ‚soziale Probleme’ im allgemeinen, insbesondere aber Armut und Arbeitslosigkeit weniger als kollektive – und im gesellschaftlichen Großraum des Sozialen kollektivierte - Lohnarbeitsrisiken kapitalistisch organisierter Gesellschaften, denn als Probleme rekonstruiert, die durch die Anreize sowie die Mobilisierung und Aktivierung der betroffenen Akteure gelöst werden können. Entsprechend weniger erscheint es politisch notwenig, soziale Deprivation vor dem Hintergrund gesellschaftsstrukturellen Bedingungen und Widersprüchen zu thematisieren. Stattdessen wird sie in dem Sinne ‚sozio-kulturalisiert’ dass sie vor allem als ein Ausdruck von Unzulänglichkeit und mangelnder Verantwortung gefasst und damit zumindest implizit - als Art eine fortgeschritten liberale Variante der viktorianischen Unterscheidung von ‚deserving‘ und ‚undeserving poor‘ (vgl. Bourdieu 1998) - mit einem Stigma individueller moralischer Verfehlung belegt wird (vgl. Procacci 1994, Dahme/Wohlafahrt 2002)27. Statt auf re-distributiven Leistungen kapriziert sich die sozialpolitische Regulation von Prekarität, Deprivation und Marginalität auf einen Um-, Auf- und Ausbau personenbezogener sozialen Dienstleistungen, deren primäre Auggagenbeschreibung in ihrem Beitrag besteht, die ‚Employabilität’ von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern zu fördern (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002, Trube/Wohlfahrt 2001). Eine auf diesen Prämissen basierende ‚fördernden und fordernden’ Form sozialer (Dienst-) Leistungserbringung (vgl. Dahme et al. 2003) weist dabei deutliche Analogien zu den ‚prä-sozialen’ Rationalitäten der Armenfürsorge auf: 27 Der in dieser Form unerstellte „habitus of welfare recipients”, so führt Michel Peillon (1998: 223) aus, „is mirrored by that of the officials who deliver such means-tested benefits and services. These officials police access to social benefits, ensuring that only those with a legitimate entitlement receive them. They operated in a field with a political capital, and the exercise of their power immediately produces stigma, negative symbolic capital for their clients. The mechanisms of control and stigmatisation become the focus of a resistance, which must be overcome or neutralised by the administrative agencies. The position of such administrative agencies in the welfare field leads to the development of an ,administrative habitus’. This habitus does not correspond to a bureaucratic ethos, which would simply reflect the internal mode of operation of an organisation. It is based on the distance, which separates, in their objective position, officials and their clients. It is deeply rooted in the structure of the welfare field and cannot be presented as an issue of organisational effectiveness”. 171 „Das Hauptthema der Armenfürsorge seit ihrer Entstehung in den deutschen Städten der frühen Neuzeit war die Arbeit. Armenfürsorge sollte sicherstellen, daß die Armen sich zu allererst durch eigene Arbeit ernähren. Wer keine Arbeit hat, dem soll Arbeit beschafft werden, und nur wer ohne Verschulden außerstande ist zu arbeiten, soll Unterstützung erhalten. Wer dagegen mutwillig die Arbeit meidet, der hat jedes Anrecht auf Unterstützung verwirkt“ (Blanke/Sachße 1987: 255) Vor allem im 16. Jahrhundert dominiert eine von „restriktiven Polizeimaßnahmen“ begleitete Fürsorgeform, die sich im Wesentlichen als ein „Versuch der Erziehung gesellschaftlich nicht angepasster Armer zu ‚zucht’ und ‚ordnung’ [manifestiert], d.h. zur Einhaltung des bürgerlichen Tugendkodex durch Almosenentzug, Arbeitspflicht und Ausweitung der Strafjustiz“ (Fischer 1984: 88). Damit sollte, so resümiert Thomas Fischer (1984: 88) vor allem „ein reichliches Angebot an billigen, fügsamen und disziplinierten Arbeitskräften geschaffen werden“. Dennoch beschreiben die politischen Rationalitäten eines ‚aktivierenden’, ‚verhandelnden’ oder ‚Kernaufgabenstaates’ (vgl. Lindenberg 2000c: 29 f) – trotz einiger augenscheinlicher Parallelen, die sich als Strategien der Forcierung ‚passiver Proletarisierung’ (vl. Lenhardt/Offe 1979) verstehen lassen - keine Rückkehr zu den frühliberalen Politikmodi eines ‚prä-sozialen’ Nachtwächterstaats, sondern eine fundamentale Verschiebung der keynesianischen Verbindungen zwischen dem Ökonomischen und dem Sozialen (vgl. Donzelot 1995) im Sinne einer „Einführung des ökonomischen Denkens auch in die Sozial- und Gesellschaftspolitik“ (Hombach 1998: 63 f). Einem gleichzeitig als aufgebläht, omipräsent und impotent rekonstruierten Leviathan wird dabei das auf die Steuerung und Förderung der sozialen und ökonomischen Produktivität der ‚Zivilgesellschaft’ zielende Modell von einem ebenso starken wie sparsamen Staat gegenübergestellt, der Opfer verlangen und durchsetzen kann (Brunkhorst 2000) und sich dabei auf das prozeduale Steuern, Entscheiden und Anleiten konzentriert, die Verantwortung für die Umsetzung bzw. das ‚Machen’ aber an andere delegiert (vgl. Osborne/Gaebler 1997: 50, Roth 1998). Die Einbindung und Mobilisierung der Zivilgesellschaft und ihrer Akteure geschieht dabei zwar in erster Linie durch deliberative und mediative Mittel politischer Regulation ist dabei aber weniger auf eine Stärkung formaler demokratischer Beteiligung, als auf die Erweiterung flexibilisierter Verhandlungssysteme gerichtet und verschiebt dabei, demokratietheoretisch betrachtet, die Entscheidungskompetenzen von der Legislative zur Exekutive. Eine darauf basierende kooperative Regulationsweise, die darauf zielt ‚weniger zu rudern’ sondern ‚mehr zu steuern’ (Schröder/Blair 1999, Osborne/Gaebler 1997), kennzeichnet eine im Vergleich zu keyensianisch-fordistischen politischen Logiken grundlegende Rekonfiguration der ‚politischen Grammatik’ staatlichen Handelns (vgl. Veyne 1992), die darin besteht, durch die ‚Zivilgesellschaft‘ hindurch, auf die je eigenen Selbstregulierungsfähigkeiten von Individuen – ihr ‚kulturelles Kapital’ und die Selbstregulierungskapazitäten von einzelnen sozialen Gruppen - ihr soziales Kapital -, aktivierend, lenkend und formend einzuwirken und mit gesellschaftspolitischen Zielen und ökonomischen Profitmaximierungen (vgl. Lemke 1997: 255) zu verbinden, statt die staatlichen Ziele gegenüber der zivilen Gesellschaft und ihrer Akteure unilinear durchzusetzen und deren Selbstregulierungen zu verhindern. Damit ist eine deutliche Veränderung der politischen Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, in dem Sinne impliziert, dass der letztgenannten wieder mehr Verantwortung zur Eigenvorsorge und Selbstversorgung zugewiesen wird (vgl. Miegel 2002) 172 In diesem Zusammenhang nehmen die politischen Autoritäten gegenüber dem aktiv ‚sorgenden‘ (vgl. de Swaan 1993) bzw. ‚Vorsorgestaat‘ (vgl. Ewald 1993) zahlreiche Formen einer ‚bürokratischen Kolonialisierung’ der Bürger zurück: Die Bürger, so die neue Rationalität der Regierung des Sozialen, haben sich „von dem Wunsch nach einem Wohlfahrtsstaat, der ihnen in paternalistischer Weise die eigene Lebensversorgung abnimmt, zukünftig [zu] verabschieden“ (Behler 1999: 85) Zwar wird eine bestimmte Minderheit der Bevölkerung (z.B. Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Erwerbsunfähige) schärfer und rigider kontrolliert, aber für die Mehrheit der sozialen Akteure wird der gesellschaftssanitäre Versuch aufgegeben, sie als Individuen in möglichst vielen Sphären ihrer Existenz durch direkte Instruktionen zu regieren. Sozialpolitik folgt in diesem Sinne einer ‚liberalpaternalistischen’ Rationalität (vgl. Wacquant 2001). Die ‚Liberalität’ am ‚oberen Ende’ wird durch eine verstärkte Androhung von Sanktionen und Anwendungen von direktem oder indirekten Druck und Zwang am ‚unteren Ende’ ergänzt (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002, Dean 2002). So werden etwa Arbeitnehmer im Rahmen der Neufassung des Arbeitsförderungsgesetzes in § 2 SGB III dazu veranlasst „zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit 1. jede zumutbare Möglichkeit bei der Suche und Aufnahme einer Beschäftigung zu nutzen, 2. ein Beschäftigungsverhältnis, dessen Fortsetzung ihnen zumutbar ist, nicht zu beenden, bevor sie eine neue Beschäftigung haben und 3. jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen“. Dabei werden die fixierten Zumutungskriterien deutlich nach unten korrigiert. Bei Zuwiderhandlungen bzw. Verweigerungen reagieren die Arbeitsverwaltungen mit ‚Sperrzeiten’ des Anspruchs auf Arbeitslosengeld und einer Einschränkung der gegebenenfalls dann notwendigen Sozialhilfe, „auf das zum Lebensunterhalt Unerlässliche“ (§ 25 Abs. 2 BSHG). Zugleich wird die Frequenz und Rigidität ‚aktivierender’ und beaufsichtigender Überwachungen erhöht (vgl. Peck 1999), die beispielsweise durch verschiedene Formen von mehr oder weniger gesinnungsprüfenden ‚Profiling-’ und ‚Assessmentverfahren’ erfolgt oder durch ‚Case-Manager’ und ‚Berater’, die Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Motivation und Pflichtbewusstsein und andere für die ‚Emloyabilität’ (vgl. Blanke et al. 1999, Bundesregierung 1999, Benchmarking-Gruppe 2000) als wesentlich erachtete individuelle Dispositionen und deren Performanz erzeugen bzw. trainieren sollen (vgl. Gericke et al. 2001) und bis hin zum Einsatz von ‚Sozialdetektiven’ reichen (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002). Was einerseits als Widerspruch zu den fortgeschritten liberalen Freiheitsversprechen eines Rückzugs des bevormundenden bürokratischen Interventionsstaates gefasst werden kann, erscheint auf der Ebene politischer Steuerungsrationalität als keineswegs zwangsläufig paradoxe Komplementrarität. So bleibt auch in Bezug auf die paternalistischen Momente, die ‚fortgeschritten liberale’ Steuerungsrationalität eines ‚Regierens über Freiheit’ bestehen, d.h. der Versuch Individuen zu generieren, die möglichst wenig direkte Führung von außen bedürfen, sondern sich in einem spezifisch strukturierten Kontext möglichst selbst und selbstverantwortlich ‚regieren’ sollen (vgl. Rose 1996a). Dabei geht es unter anderem darum, dass Akteure einen Habitus inkorporieren, der ihre ‚Employabitlität’ dadurch sicherstellt, dass sie sich als eigeninitiative ‚Arbeitskraftunternehmer’ aktiv um die Verwertbarkeit ihres ‚Humankapitals Arbeitskraft’ und die Aufrechterhaltung wie möglichst permanente Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit kümmern. 173 Für diejenigen, die als ‚employable’, aktiv Arbeitssuchende einen solchen Habitus signalisieren „assistance can be provided by relying on their liberty and by only limited resort on authoritarian means […] the ,jobseeker’ can be treated as customer making choices in a market of employment assistance services” (Dean 2002: 46 f). Demgegenüber stellen die qua Zwang zu aktivierenden ‚Verweigerer’ eine Kategorie von Akteuren dar, die von ihrer Freiheit einen falschen Gebrauch machen. Sie verfügen noch nicht über die angemessenen Dispositionen, um durch ihre Freiheit, Autonomie und ihr Selbstinteresse hindurch regiert zu werden. Die Aufforderung an die Akteure ihr Leben eigenverantwortlich zu führen, bedeutet zum einen eine sukzessive Aufgabe aktiver struktureller Sozialreform als Bearbeitungsmodus ‚sozialer Probleme’ hin zu einer Verantwortlichmachung der ‚Subjekte’ und einem politisch induzierten Zwang ihre eigenen Risiken und Bedürfnisse im Einklang mit den politisch gesetzten Rahmungen zu gestalten, die mit einer ‚Ent-Responsibilisierung’ anderer gesellschaftlicher Gruppen und Akteure - am deutlichsten des Staates selbst - einhergeht (vgl. Hannah-Moffat 2002). Diese Neuformulierung der Strategien, Technologien und Teleologien staatlicher (Sozial)Politik finden ihren theoretischen Ausdruck am deutlichsten in den ‚life politics’ und der ‚Selbstsorge’ gesellschaftlicher Akteure, wie sie etwa von Anthony Giddens (vgl. 1991, 1997) formuliert und explizit oder implizit von den akademischen Protagonisten eines ‚aktivierenden Staates’ übernommen und vorangetrieben worden ist (Keupp 1997, 2000, 2001, Olk 2000, Wendt 2000). Im Kontext ‚Politik der Lebensführung’ wird den sozialen Dienste ein neues Aufgaben- und Selbstverständnis zugeschrieben. So solle es der Sozialen Arbeit etwa vor allem darum gehen in der „individualisier[ten…] Lebensführung des/der einzelnen [eine Entscheidungshilfen zu geben] welche politischethischen Verantwortungen man mit der jeweils gewählten Handlungsweise aktiv oder passiv zu übernehmen hat [… und dabei] den Horizont dessen ab[klären], was als moralisch akzeptables Verhalten gelten kann“ (Möller 1999). „Eigensinnige, individuelle Entscheidungen, die das Verhalten anderer beeinträchtigen und die mit politischen Entscheidungen des Gemeinwesens oder gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen in Konflikt geraten“, so führen Dahme/Wohlfahrt (2002: 23), die Konsequenz einer nach dem Paradigma der ‚Politik der Lebensführung’ neugestalteten sozialen Arbeit aus, ziehen „politische Interventionen nach sich […], die auch in Form Sozialer Arbeit auftreten können“. Dies geschieht in so fern, dass in dem Maße wie vergleichsweise selektiven, aktivierenden ‚Workfare-’ Strategien, „[which are] associated with means-testing“ (Rothstein 2001: 207), an Stelle einer vergleichsweise universellen, positionskompensierenden Form sozialer Sicherungssysteme rücken und soziale Regulationsformen im Mittelpunkt stellen, die „zu einer Zunahme an Interaktion in face-to-face Situationen führen [… und dabei] den Bedarf an Fachkräften [erhöhen], die im Umgang mit den ‚Kunden’ über sozialpädagogische Kenntnisse verfügen“ (Polutta 2003: 10). Im Kontext der Verbreitung einer solchen, stärker an den Dispositionen der Leistungsberechtigten und damit vermehrt den Interventionslogiken Sozialer Arbeit angeglichenen Form der Sozial- bzw. ‚life politics, ist zu erwarten, dass personenbezogene soziale Dienstleitungen „zukünftig in wachsendem Maße im Interesse des Gemeinwohls angesichts individueller Fehlentscheidungen entschieden intervenieren müssen, wobei die soziale Entschiedenheit nicht in das individuelle Ermessen der Sozialarbeiter gestellt wird; methodische Prinzipien sozialer Arbeit wie diskursive Lösungssuche, partnerschaftliche Zusammenarbeit, Akzeptanz des Klienten, Wahrnehmung anwaltlicher Funktion, Freiwilligkeit der Hilfe, 174 Bedürfnisorientierung der Hilfe u.ä. erscheinen aus dieser Perspektive als nicht mehr hinreichend für soziale Arbeit in einer individualisierten Gesellschaft und müssen, um Einsicht in die Notwendigkeit auch durchzusetzen zu können, durch autoritäre bis repressive Interventionsmittel ergänzt werden“ (Dahme/Wohlfahrt 2002: 23). Im Sinne einer „personenbezogenen Kontextsteuerung“ (Leisering/Hilkert 2000: 36) bietet sich Soziale Arbeit als personenbezogene soziale Dienstleistung in einer besonderen Weise an, und avanciert in so fern zu einem zentralen „Steuerungsinstrument der Aktivierungspolitik“, das sich aufgrund seiner Interventionsrationalitäten als tauglich erweist, um „als ausführendes Organ des aktivierenden Staates in Beschlag genommen“ zu werden (Dahme/Wohlfahrt 2003: 90). Dieser ‚neo-konservativen’ Form der Dienstleistungserbringung steht eine prinzipielle Beibehaltung der ‚neo-liberalen’ Selbstsorge- und Selbstverantwortungslogik nicht zwangsläufig entgegen (vgl. O’Malley 1999a). Eine fortgeschritten liberale Form des Autoritarismus basiert – zynisch formuliert - nicht auf einem ‚despotischen’, sondern ‚freiheitlichen Zwang’, der auf dem Kernprinzip eines ‚new paternalism’ beruht: „Those who would be free must first be bound“ (Mead 1997: 23). Im Gegensatz zu den ‚despotischen’ Formen des Zwangs, werden die ‚freiheitlich-autoritären’ bzw. ‚liberal-paternalistischen’ Zwangsmaßnahmen nicht unbedingt allgemein eingesetzt, sondern differenziert nach vordefinierten Kategorien, denen die Adressaten mittels Techniken des ‚Assessments’, ‚Profilings’ oder ‚Screenings systematisch zugeordnet werden können (vgl. Reis 2002). Jene, denen der Status ‚wirklich Bedürftiger’ zukommt, d.h. jene Akteure, die nicht fähig sind ‚autonom’ und ‚in ihrem eigenen Interesse’ zu handeln, wie etwa die für den Arbeitsmarkt zu alten, oder psychisch und physisch Kranke sind zwar tendenziellen Sparmaßnahmen unterworfen - eine „endgültige Verabschiedung von der Illusion, diese Gruppe der Arbeitslosen noch einmal in Beschäftigung zu bringen“, so etwa Büstrich (2002: 6 zit nach: Trube/Wohlfahrt 2003), lasse es „plausibel erscheinen, sie auch leistungsrechtlich arbeitsmarktferner einzuordnen und der Betreuung im Rahmen der Leistungen der Sozialhilfe ohne die bisherige arbeitsmarktpolitische Förderung des SGB III zu überantworten“ - die zwangsbasierten Maßnahmen des ‚new paternalism’ in der ‚Politik der Lebensführung’ wenden sich jedoch an Gruppen von Akteuren „who are potentially capable of exercising liberal autonomy but who are yet to be trained in the habits and capacities to do so“ (Dean 2002: 47). Zwangsmaßnahmen sind demnach vor allem zielgerichtete und instrumentelle Formen der Sanktion, die möglichst ‚dosiert’ und nur dort eingesetzt werden, wo das Ziel, die Individuen in einer Weise zu mobilisieren, und politische Ziele, wirtschaftliches Wachstum und persönliches Glück optimal und mit möglichst wenig direkten staatlichen Instruktionen zu verbinden (vgl. Miller/Rose 1994: 104), nicht in einer „zufriedenstellende[n] Regelung“ mündet (Schröder 2001: 17). Powell (2000: 56) hat als das wesentliche Moment der Verschiebung von einer im Kern ‚sozialdemokratischen’ (vgl. Dahrendorf 1987) bzw. interventionsstaatlichen zu einer fortgeschritten liberalen regulationsstaatlichen Form der Wohlfahrt als ein „redrawing of the boundaries between the individual and the state“ beschrieben. Auch von die Protagonisten eines ‚aktivierenden Staates’ selbst betonen, dass „es um ein ‚Neues Steuerungsmodell’ des Miteinander von Staat und Gesellschaft […geht, indem der Staat] von seiner obrigkeitsstaatlichen Provenienz [… abrückt, und sich als] partnerschaftlicher Manager einer auf Gemeinsinn orientierten Innovationspolitik“ (Behrens 1999: 49 f) darauf konzentriert, „Gesellschaften zu führen, steuern, kontrollieren oder managen“ (Bandemer u.a. 1995: 58). 175 Eine solche, indirekte Regierung ‚aus der Distanz’ (vgl. Rose 1996), die „Zielvorgaben macht und Mindeststandards setzt“, während die „konkrete Umsetzung […] den beteiligten Akteuren selbst überlassen“ bleibt (Schröder 2001: 17), hat nichts mit einer Rücknahme von politischem Gestaltungsanspruch per se zu tun. Sie beschreibt vielmehr eine Form gesellschaftspolitischer Gestaltung durch eine katalytische, moderierende, organisierende und anstoßende Form einer regulativen Politik (vgl. Fach 2000: 120, Trube/Wohlfahrt 2000: 2), die nicht auf die aktive Garantie und Gewährleistung sozialer und persönlicher Rechte, sondern auf eine Durchbrechung der ‚Klientenmentalität’ der Bürger (vgl. Murray 1995) und Schaffung von Rahmenbedingungen und Arrangements zielt, die deren „Bereitschaft zur Selbstverpflichtung und […] Fähigkeit zur Selbstregulierung“ (Schröder 2001: 17) erzeugen soll. Damit ist der Weg hin zu einem Wohlfahrtsarrangement beschrieben, in der „die Verantwortung des Staates darin gesehen [wird], Gelegenheiten zu schaffen, die die Bürger ergreifen müssen, um ‚das ihre zu leisten’ (Burkitt/Ashton 1996: 11) und ihre Ansprüche anzumelden“ (Harris/Kirk 2000: 126). In diesem Sinne kann von einer Art ‚Do-it-yourself’- Sozialpolitik (Klein/Millar 1995) gesprochen werden, in dem es weniger als Aufgabe des Staates gesehen wird mit Leistungen zu versorgen, als den Gelegenheitsraum zu bearbeiten, in dem selbstverantwortliche, umsichtige und aktive Bürger die Frage ihrer Absicherung für sich selbst zu bearbeiten haben. Allerdings bleibt dabei die Frage nach dem Möglichkeitskontext jene ‚Chancen’ zu ergreifen weitgehend ausgeklammert. Die soziale Strukturierung jener Chancen gerät alleine dadurch aus dem Blick, dass von gesellschaftlichen Positionierungen der Akteure weitgehend abstrahiert wird. Selbst noch der Frage habituell ‚inkorporierter’ Möglichkeiten der ‚Chancenergreifung’ wird vergleichsweise wenig Bedeutung beigemessen. Die fortgeschritten liberale Form der Sozialpolitik ist „eher verhaltens- als verhältnisorientiert. Die Betonung der Eigenverantwortung bedeutet auch: individuelles Verhalten muss sich den Verhältnissen anpassen und im Zweifelsfall dementsprechend qualifiziert, trainiert oder letztlich ‚dressiert’ werden. Bei der Erklärung der Ursachen von Sozialhilfe und Ausgrenzung wird psychologisch und weniger soziologisch-strukturell argumentiert“ (Dahme/Wohlfahrt 2002). So werden etwa selbst noch Kinder und Jugendliche als Akteure individuiert, die „die Chance [hätten], die eigene Entwicklung und die persönliche Biographie frei von allen sozialen Zwängen und unabhängig von sozialer Herkunft gemäß den individuellen Interessen und Ansprüchen, Bedürfnissen und Zielvorstellungen zu planen und gegebenenfalls zu realisieren“ (SPD 2001: 2). Eine solche als prima faci gegeben unterstellte, Möglichkeit der Autonomie und Selbstverantwortung jedes einzelnen sozialen Akteurs erlaubt einem ‚aktivierenden Staat’ es abzulehnen „den gesellschaftlichen Akteuren die Verantwortlichkeit für Problemlösungen“ (Bandemer/Hilbert 1999: 29) aus der zu Hand zu nehmen und auch von jenen, die sich in problematischen Situationen befinden zu fordern, sich primär selbst ‚als Problemlöser zu engagieren’ (vgl. Bandemer/Hilbert 1999). Dem liberalen Versprechen an die zivilen Akteure ihre Vorstellung eines gelungenen Lebens künftig autonomer als bisher gestalten zu können, steht im Falle des Misslingens demnach nicht nur die ‚Feststellung’, sondern der Vorwurf gegenüber ‚selber schuld’ zu sein. Die Spaltung einer nach-fordistischen, fortgeschritten liberalen Gesellschaft wird diesem Sinne sozialpolitisch eher auf einer symbolischen Ebene zusätzlich legitimiert als materiell kompensiert. 176 III. 4 JUGENDHILFE UND DIE KRISE DES FORDISTISCHEN WOHLFAHRTSSTAATS Von den als substanzielle Krise der fordistischen Gesellschaftsformation seit Mitte der siebziger Jahre beschriebenen Prozessen, vor allem einer zunehmenden strukturellen Verunmöglichung einer allgemeinen und umfassenden ‚Inklusion‘ durch Besitz und Verkauf der Ware Arbeitskraft (vgl. Böhnisch/Schröer 2001), kann die ‚fordistische Profession’ Jugendhilfe nicht unberührt bleiben. Von einer mit der ‚Krise des Fordismus’ einhergehenden ‚Krise des Wohlfahrtsstaates‘ ist gerade die Jugendhilfe „insofern besonders betroffen, als sie aus der Expansion der Institutionalisierung sozialer Hilfe einen wesentlichen Nutzen gezogen hat, indem sie aus einer randständigen, marginalen Disziplin und Profession zu einem zentralen und systemisch organisierten Element im Wohlfahrtsstaat geworden ist“ (Sünker 1995: 79). Als Ausdruck und als Reaktion auf die Krise des fordistischen Wohlfahrtsstaates finden in der Jugendhilfe zwei grundlegende Neustrukturierungsprozesse statt: 1. Ihre ‚Ökonomisierung‘ 2. Die Undefinition ihres Bezugs- und Aktionsfeldes – das Feld des Sozialen – zugunsten einer Nahraumorientierung (vgl. Kessl et al. 2002) und einer (Wieder-)Entdeckung der lokalen Gemeinschaft (vgl. Kessl 2000, Ziegler 2002). In der Zusammenführung beider Momente erfahren die in der fordistischen Ära des Kapitalismus gültigen Konzeptionen und der Modelle der Führung und ‚Subjektivierung’ der nachwachsenden Generation durch die Jugendhilfe zwar keine Ersetzung, aber eine fundamentale Verschiebung: Von der Repräsentation der Adressaten als „members of a flock to be shepherded“ und „children to be nurtured and tutored“ zu „rational calculation individuals whose preferences are to be acted upon“ (Rose 2000b: 185) III. 4. 1 JUGENDHILFE ALS (MARKTFÖRMIGE) DIENSTLEISTUNG In der Jugendhilfe wird den Umgestaltungen der gesellschaftlichen Formation und der Form ihrer Regulation durch Selbstverständnisses den als sozialen soziale Staat zunächst Dienstleistung durch eine begegnet. (Re)Konzeptualisierung Nach den ersten ihres fachlichen Dienstleistungsdiskursen der späten 1970er und 1980er Jahren, entwickelt sich dabei parallel zu den gewandelten Prämissen fortgeschritten liberaler Sozialstaatlichkeit ein ‚neuer’, von fachlich eigenständigen Diskurslinien relativ unabhängiger Diskurs in den 1990er Jahren, der vor allem „die Bedeutung externer, marktförmiger und betriebswirtschaftlicher Prinzipien für Effizienzsteigerung und Qualitätserhöhung der Dienstleistungsproduktion betont“ (Schaarschuch 1999a: 550). Unter dem Eindruck des ‚ersten Diskursstrangs’ wird 1989 bzw. 1990 das SGB VIII als ‚modernes Leistungsgesetz’ konzipiert und grundgelegt. Nicht nur im Kontext der ökonomischen, sondern auch der kulturellen und symbolischen Akzeptanzkrisen des Fordismus und eines darauf reagierenden Prozesses der ‚Modernisierung’ der kommunalen Verwaltungen, wandelt sich zunehmend auch das (propagierte) Selbstverständnis des Jugendamtes. Zunächst - und hier noch in einer idealtypischen Gegenüberstellung von rechts- oder besser obrigkeitsstaatlicher Tradition und einem ‚modernen’ 177 sozialstaatlichen Selbstverständnis auf verwaltungsrechtlicher Ebene (vgl. Kaufmann 1994) - von einer Eingriffs- zu Leistungsverwaltung und schließlich zu einem modernen ‚Dienstleistungsunternehmen’. Dabei ist der Begriff der ‚Dienstleistung’ offensichtlich Teil jenes Schlüsselvokabulars geworden, das für eine ‚moderne’ Jugendhilfe konstitutiven Charakter hat. Analytisch bezeichnet die Rede von Dienstleistungen jedoch zunächst kaum mehr als „eine resudiale Sammelkategorie in der all jene Arbeiten bzw. Arbeitsorganisationen auftauchen, die nicht eindeutig der ‚primären’ (gewinnenden) oder der ‚sekundären’ (herstellenden) Arbeit zugerechnet werden können und doch gleichzeitig ‚Arbeit’ (im Sinne kontraktueller Erwerbsarbeit) sind“ (Offe 1987). ‚Dienstleistungen’ sind bezogen auf kapitalistische Produktionsverhältnisse demnach keine epochalen Neuerscheinungen. Die lassen sich als ein Teil der „bestandsnotwenigen Ausbildung strukturfremder Systemelemente“ kapitalistischer Produktion betrachten, die sich als eher ‚administrativ’ den als ‚verwertungsgesteuerte’ Bereiche und Prozesse im Sinne „staatlich organisiert[er] Infrastruktur-, Dienstleistungs- und Repressionsfunktionen entwickelt [haben]“ (Offe 1972: 38) aufgrund einer zunehmenden „Notwenigkeit, die Kapitalbewegung in all ihren Phasen zum Gegenstand leitender, verwaltender, verteilender, planender usw. Tätigkeit zu machen [… die eine Dynamik reflektiert, in der n]icht mehr nur ‚Rahmenbedingungen’ der privatwirtschaftlichen Produktion […], sondern tendenziell jedes Element des Produktionsprozesses […] der Vermittlung durch bürokratische Arbeit [bedarf]“ (Offe 1972: 49). In diesem Sinne berichtet bereits Karl Marx (1953a) in seinen ‚Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie’ von einer Form menschlicher Arbeitskraft, die – innerhalb des Akkumulationsregimes zunehmend aus der direkten materiellen Produktion heraustritt, und den Charakter ihres ‚Wächters und Regulators’ übernimmt. Diese Form der Arbeit zeichnet sich aus der Perspektive der Wertlehre der politischen Ökonomie, gegenüber den anderen Formen industriekapitalistischer Arbeitskraftverwertung dadurch aus, dass sie nicht direkt wert- bzw. mehrwertschöpfend ist28. Die Funktion und die ‚Produktivität’ der ‚Wächter und Regulatoren’ im Produktionsprozess finden sich aber auf einer anderen, mittelnden Ebene: sie dienen dem Schutz seines Modus Operandi. Eine positiv definierbare analytische Gemeinsamkeit aller Dienstleistungen besteht, gleich ob sie auf Produktions- oder gesellschaftliche Reproduktionsformen und -weisen gerichtet sind, in einer solchen ‚formbeschützenden’ Funktion (vgl. Häußermann/Siebel 1995: 155), im Sinne einer kulturellen und institutionellen Gewährleistung, Verteidigung, Überwachung und Instandhaltung des gesellschaftlichen Auch im ‚Kapital’ (Band 1) rechnet Marx die „Regierung, Pfaffen, Juristen, Militär usw.“ (Marx 1953: 469) ausdrücklich nicht zu produktiven Lohnarbeiterklasse. In den ‚Grundrissen’ (Marx 1953a) spricht er von einem „Teil der dienenden Klasse, der nicht von Kapital, sondern von Revenue lebt“ und formuliert einen „wesentliche[n] Unterschied“ zwischen „dieser dienenden und der arbeitenden Klasse“. Ausführlich setzt sich Marx in den ‚Theorien über den Mehrwert’ mit ‚immateriellen’ Dienstleistungen auseinander: „Gewisse Dienstleistungen oder die Gebrauchswerte, Resultate gewisser Tätigkeiten oder Arbeiten, verkörpern sich in Waren, andre dagegen lassen kein handgreifliches, von der Person selbst unterschiednes Resultat zurück; oder ihr Resultat ist keine verkaufbare Ware. Z.B. der Dienst, den mir ein Sänger leistet, befriedigt mein ästhetisches Bedürfnis, aber was ich genieße, existiert nur in einer von dem Sänger selbst untrennbaren Aktion, und sobald seine Arbeit, das Singen, am Ende ist, ist auch mein Genuss am Ende: Ich genieße die Tätigkeit selbst - ihre Tonschwingungen auf mein Ohr. Diese Dienste selbst, wie die Ware, die ich kaufe, können notwendige sein oder nur notwendig scheinen, z.B. der Dienst eines Soldaten oder Arztes oder Advokaten, oder sie können Dienste sein, die mir Genüsse gewähren. Dies ändert an ihrer ökonomischen Bestimmtheit nichts: Wenn ich gesund bin und den Arzt nicht brauche oder das Glück habe, keine Prozess führen zu müssen, so vermeide ich es wie die Pest, Geld in ärztlichen oder juristischen Dienstleistungen auszulegen. Dienste können auch aufgedrungen sein, Beamtendienste etc.“ (Marx 1956: 380) 28 178 Ordnungsrahmens, seiner Funktionsbedingungen und historisch spezifischen Verkehrsformen (vgl. Berger/Offe 1980). Die ‚form-beschützende’ Funktion sozialer Dienstleistungen manifestiert sich in ihrer spezifischen Reaktion „auf soziale und sozial verursachte ‚form-gefährdende’ Problemstellungen von Individuen und Gruppen“ (Berger/Offe 1980: 22). Die Kustodialfunktion der personenbezogenen sozialen Dienstleitung Jugendhilfe äußert sich entsprechend in ihrer Reaktion auf ‚form-gefährdende’ Problemkonstellation im Feld des Sozialen, die auf die Dispositionen von Akteuren oder Gruppen von Akteuren wirken. Dabei sind die Reaktionen auf einer teleologischen Ebene auf das Ziel der Sicherung und Hervorbringung ‚legitimerweise’ erwarteter Strukturen von ‚Identität’ gerichtet (vgl. Olk 1986). In diesem Sinne unterscheiden sich soziale Dienstleistungen von stofflich-produktionsorientierten Dienstleistungen dadurch, dass erstgenannte mittelbar auf die Erzeugung eines materiellen Produkts zielen, dessen Gebrauchswert in der Be- bzw. Vernutzung besteht, während die Erbringung sozialer Dienstleistungen primär auf ein ‚soziales Erbringungsverhältnis’ (vgl. Schaarschuch 1998) im Sinne eines relationalen Vermittlungsverhältnisses der - uno actu - in der Dienstleistungsproduktion beteiligten Akteure bzw. repräsentierten Institutionen. Typischerweise geht es diesem Vermittlungsverhältnis um die Erfüllung eines ‚dreifachen Mandats’: Die Integration administrativer, ökonomischer und lebensweltlicher (bzw. informeller) Elemente, die aufeinander zu beziehen sind (vgl. Bauer 1995). Die Gebrauchswerteigenschaft sozialer Dienstleistungen besteht darin sich nicht auf Erzeugnisse, sondern auf Wirkungen, Ergebnisse oder Ereignisse zu beziehen (vgl. Bauer 1996). Personenbezogene soziale Dienstleistungen sind demnach als vermittelnde Normalisierungsarbeit – oder wahlweise normalisierende Vermittlungsarbeit - Tätigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar auf die Gewährleistung gesellschaftlicher ‚Normalzustände’ d.h. die „Abwehr von Risiken und die Beseitigung von Störungen“ (Olk 1986: 13) beziehen, bei dem sich das dienstleistungsförmig zu bearbeitende Problem als das „des Schutzes und der Bewahrung der ausdifferenzierten Elemente der Sozialstruktur und der Vermittlung zwischen ihnen [darstellt]“ (Offe 1987: 175). Der Jugendhilfe als personenbezogener sozialer Dienstleistungsarbeit geht es um die gleichzeitige Erzeugung von ‚Normalität’ und eine die Gewährung, Respektierung und Bestätigung der Individualität, Besonderheiten, Kontingenz, Variabilität und ‚Authenzität’ der Lagen und Bedürfnisse ihrer Adressaten. Durch die Balance einer wechselseitigen „Anpassung von ‚Besonderheit des Falls’ und ‚Generalität der Bezugsnorm’ [kann …] zugleich der ‚Fall’ normalisiert und die Norm individualisiert“ werden (Offe 1987: 175). Eine jugendhilfetypische Form sozialer Kontrolle, die sie akteursbezogen auf dessen spezifische positional-dispositionale Matrix bezieht, wird insofern auch in ihrer Konstitution als personenbezogene soziale Dienstleistungen weder analytisch noch praktisch suspendiert. Nichtsdestoweniger stellt eine Orientierung der Jugendhilfe an Dienstleistungskonzepten eine in fachlicher Hinsicht fundamentale Umorientierung dar. Diese Umorientierung reflektiert vor allem die Überzeugung, dass die ‚Subjektstellung’ der Leitungsadressaten, die in der bürokratisch-fordistischen Fassung der Jugendhilfe zwar nicht ausgeschlossen, aber keinesfalls ex ante gesetzt war, durch einen Rekurs auf fachspezifisch ausformulierte Konzepte der Dienstleistung eine stärkere Beachtung findet. Im ersten fachlichen Dienstleistungsdiskurs findet sich die Tendenz eine solche Aufwertung der Subjektstellung der Adressaten als ein in einem konsequent zu Ende gedachten Konzept der 179 Dienstleistung selbst angelegtes Moment zu betrachten. Begründet wird dies damit, dass personenbezogene soziale Dienstleistungen nicht materiell und ‚flüchtig’, d.h. nicht-lagerfähig und nicht-transportfähig seien. In diesem Sinne ist für sie ein ‚uno-actu Prinzip’ konstitutiv (vgl. HerderDornreich/Klötz 1972), das auf eine unmittelbare Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumption verweist. Personenbezogenen sozialen Dienstleistungen ist die Anwesenheit eines empirischen Nutzers als notwendig inhärent: „Die Dienstleistung wird ‚an’ einer Person erbracht. Voraussetzung dafür ist zunächst die Präsenz des Klienten, außerdem aber seine aktive Mitwirkung bei der Erbringung der Leistung“ (Blanke/Sachße 1987: 262). In dieser Hinsicht sind die Adressaten - zumindest - ‚KoProduzenten‘ im Prozess sozialer Dienstleitungsproduktion (vgl. Schaarschuch 1996, Gartner/Riessmann 1978). Wenn das Verhältnis von Produktion und Konsumption als eine Totalität gefasst wird (vgl. Marx 1974), in der sich die Konsumenten zugleich selbst (re)produzieren, ist ein solcher Produzentenstatus des Adressaten im Erbringungsverhältnis von Dienstleistungen auf theoretischer Ebene plausibel: „Jeder Konsumptionsakt von sozialen Dienstleistungen ist zugleich ein Akt der Produktion, jede Produktion zugleich Konsumtion. Das Erbringungsverhältnis kann vor diesem Hintergrund als eines konzipiert werden, in dem prinzipiell sowohl die Professionellen wie auch die Klienten, Patienten stets Produzenten und Konsumenten zugleich sind“ (Schaarschuch 1999a: 553). Auf Basis dienstleistungstheoretischer Erörterungen gibt es keinen Zweifel daran, dass eine ‚moderne’ Jugendhilfe analytisch als eine personenbezogene soziale Dienstleistung zu fassen ist. Analytisch gilt dies jedoch auch - und ebenso zweifellos - für z.B. die ‚eingriffsorientierte’ Fürsorgeerziehung nach dem RJWG und ebenso für die klassische Exekutivinstanz des physischen Gewaltmonopols des Staates: die Polizei. Dienstleistungen zu erbringen hat demnach per se wenig mit der Freiwilligkeit der oder einer Orientierung an den Interessen der Adressaten zu tun. Dienste können, wie es Marx in den ‚Theorien über den Mehrwert’ mit Blick auf Beamtendienste etc. formuliert, „auch aufgedrungen sein“. Die beschriebenen Formen der ‚Förderung und Forderung“ deprivierter Akteure vollzieht sich ihrer Logik nach als personenbezogene soziale Dienstleistung und schließlich ist es bezeichnend, dass etwa Frage die Frage ‚geschlossener’ Heimunterbringung in der Jugendhilfe, dort wo sie nicht (nur) als eine Form der Strafe, Abschreckung oder der Unschädlichmachung besonders riskanter Akteure verhandelt wird, als eine Möglichkeit argumentiert wird, das uno-acto-Prinzip und die Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsumtion als Basis für die Erbringung nicht-lagerbarer personenbezogener sozialer Dienstleitungen, auch dort zu ermöglichen, wo ansonsten die Gefahr eines Scheiterns groß ist, weil sich der Adressaten einer Leistungsproduktion entziehen. Aus einer analytischen Beschreibung und Funktionsbestimmung der Jugendhilfe als Dienstleistung alleine, ist demnach eine Stärkung, oder auch nur stärkere Beachtung der Nutzer keinesfalls einfach abzuleiten, ganz zu schweigen davon, dass die ‚Subjektivität’ der Adressaten Sozialer Arbeit dadurch in den Mittelpunkt gestellt würde. Im Dienstleistungskonzept von Badura und Gross (1977) beispielsweise erscheint der ‚ko-produzierende’ Nutzer dienstleistungstheoretisch widerspruchsfrei als lediglich rezeptiv-konsumierender Akteur, der konstitutiv auf den aktiv-produzierenden Professionellen verwiesen bleibt. Darüber hinaus führt auch eine dienstleistungstheoretisch per se nicht zwingende, aber programmatisch-konzeptionell proklamierte Adressatenorientierung nicht zu einer Aufgabe einer faktischen Dominanz der 180 Anbieterseite in personenbezogenen sozialen Dienstleistungen, weil sich ihre - unabhängig von den Wünschen des einzelnen ‚Ko-Produzenten’ existierende - formschützende Funktion, auf die Adressatenseite der am Prozess der Dienstleistungsproduktion Beteiligten bezieht und nicht umgekehrt. Diese in der formschützenden Funktion von personenbezogen sozialen Dienstleistungen konzeptionell angelegte Asymmetrie bleibt bereits auf einer theoretischen Ebene unsuspendierbar. Empirisch wird diese strukturelle Asymmetrie um den Umstand ergänzt, dass der Adressat im Prozess der Dienstleistungserbringung zwar als ein „unbedingt notweniger Faktor [… erscheint,] die Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung von Nachfragern, sowie die fachliche und soziale Kontrolle der Leistungserstellung [...] jedoch nahezu ausschließlich durch die Anbieter [erfolgt]“ (Wirth 1982: 119). Eine nutzerorientierte praktische Form der Einbeziehung des Adressaten als Ko-Produzent, im Sinne der Anerkennung seines Status als ‚Subjekt’ (vgl. Sünker 1992) und als (professionell unterstützter) Produzent seiner selbstbestimmten Lebenspraxis (vgl. Schaarschuch 1999a), ist demnach nicht zwangsläufig mit einer bloßen Neukonzeption der Jugendhilfe als Dienstleistung und dem theoretischen Rückgriff auf ein ‚Uno-Actu-Prinzip’ gewährleistet. Aus der bloßen theoretischen Bestimmung und Deskription der Jugendhilfe als Dienstleitung, ist keine bestimmte Präskription – z.B. die Stärkung der Autonomie des Adressaten – konzeptimmanent kausalistisch herzuleiten. Die Orientierung an den Interessen des Adressaten ist unabhängig vom Erbringungskontext, eine dienstleistungstheoretisch extern zu begründende Orientierung, die sich weder aus dem ‚uno-actu’ noch aus sonstigen analytisch-systematischen Strukturprinzipien personenbezogener sozialer Dienstleistungen ergibt. Ein Machtzuwachs auf der Adressatenseite verweist also nicht auf eine dienstleitungstheoretische Fassung der Jugendhilfe per se, sondern auf die kontingente Frage der je konkreten Konstitution des Dienstleistungskonzepts. Konzeptionelle Präskriptionen müssen daher auf eine Weise begründet werden, die nicht nur darauf verweißt, dass die Adressaten einer Dienstleitung gleichsam ihre Produzenten sind, sondern auch die Stellung dieser Produzenten im Erbringungsverhältnis beschreibt bzw. aufwertet. Dies kann etwa mittels eines ‚nachfrageorientierten’, markförmigen Ansatzes in Form eines ‚Kundenmodells’ oder durch demokratie- bzw. staatstheoretische Ansätze in Form eines ‚Bürgermodells’ geschehen. Die relative Einfachheit ökonomischer Modelle, sowie das (jenseits einiger wichtiger Ausnahmen, wie etwa der republikanisch-demokratietheoretischen Begründung von Andreas Schaarschuch 1998) weitgehende Versäumnis einer gesonderten Begründung des Nutzerstatus der nicht-marktförmigen Dienstleistungskonzepte, kann auf der Ebene der Disziplin als ein Faktor für die relative Dominanz des ökonomischen ‚Kundenmodells’ im sozialpädagogischen Diskurs betrachtet werden. Das Kundenmodells vermag sich mithin nicht nur aufgrund einer ‚neoliberalen’, gesellschaftlichen Umgestaltung, sondern auch auf einer theoretischen Ebene als vermeintlich weitgehend alternativlos darzustellen. Dem steht nicht entgegen, dass mit der Neukonzeption Sozialer Arbeit ‚jenseits der Bürokratie’ (vgl. Flösser 1994) und in einer Gegenüberstellung des Selbstverständnisses der traditionellen, ‚fordistischen’ Jugendhilfe als Sozialbürokratie versus ‚soziale Dienstleistung’ als Paradigma einer ‚modernen’ Jugendhilfe, die Hoffnung auf eine Zurückdrängung von „Bürokratie, Schwerfälligkeit, Innovationsfeindlichkeit, Ineffektivität, 181 Klientelisierung und mangelnde[r] Bedürfnisgerechtigkeit“ (Schaarschuch 1996a.: 12), sowie auf eine Demokratisierung sozialer Dienste durch die Etablierung partizipativer Verfahren jenseits klassisch repräsentativer Mechanismen (vgl. Redaktion Widersprüche 2000: 4) verbunden bleibt. Nichtsdestoweniger ist auch die fachliche Kritik der Bürokratisierung und Verrechtlichung der Jugendhilfe sowie die damit verbundene Forderung nach einer stärkeren ‚Subjektorientierung’ seitens der politisch progressiven Vertreter der Profession und Disziplin, mit dem Problem konfrontiert, dass ein leistungsfähiger und demokratisch-rechtsstaatlich organisierter Sozialstaat auch im Bereich des Sozialrechts notwendig erhebliche Verrechtlichungstendenzen mit sich bringt (vgl. Wittkämper 1992). Anders formuliert ist es prinzipiell alleine der Staat, der in seiner Konzeption als sozialer Rechtsstaat die „Teilhabe an den lebensnotwendigen Gütern und Leistungen“ garantieren kann und damit die „Vorbedingung individueller Freiheit“ darstellt (Hartwich 1970: 348). Dieses Konzeptionsproblem ‚subjektorientierter’ Wohlfahrtsstaatskritik hat sich dadurch verschärft, dass bis auf wenige Ausnahmen der faktische Status des Nutzers in den konzeptionellen Fassungen der Jugendhilfe als Dienstleistung letztlich kontingent blieb, während gleichzeitig - innerhalb und außerhalb des fachlichen Diskurses - eine Stärkung der Adressatenseite keinesfalls nur aufgrund ihres potenziell emanzipatorischen Charakters eingefordert wird. Gerade die mangelnde Passung von Angebot und Nachfrage stellt ein wesentliches Element des Vorwurfs der Verschwendung öffentlicher Gelder durch bürokratisch organisierte, öffentliche Verwaltungen dar, „die gegen die Risiken des freien Unternehmertums durch starre Statuszuweisungen geschützt und auf die korporatistische Verteidigung sozialer Errungenschaften versteift“ (Bourdieu et al. 1997: 210) und darüber hinaus vor allem mit sich selbst beschäftigt seien. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine marktorientierte Nutzung des Dienstleistungsbegriffs ab, die darauf zielt, Leistungsstandards der Jugendhilfe an ökonomische Kriterien zu binden und mit Rekurs auf die Notwenigkeit des Sparens in der öffentlichen Verwaltung letztlich auch zu senken (vgl. Schaarschuch 1998). Auf der Basis der Kritik an der Sozialbürokratie und im Kontext der mehrheitlich prekären finanziellen Lage 29 ‚Modernisierungsdruck’ 1990er Jahren zu der Kommunen, erhöht sich der ökonomische und politische auf die Administration. Dies führt seit den 1980er, vor allem aber seit den einer breiten Welle von Reformansätzen im öffentlichen Dienst und Umstrukturierungen der öffentlichen Verwaltung nach dem Leitbild eines wettbewerbs- und kundenorientierten Dienstleistungskonzerns (vgl. Kersting 1998). Im Zuge dieser Reformen als ein Ergebnis scheinbar konfliktfreier Sachpolitik, wird die Kommune selbst „zunehmend unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, die Verwaltungsspitze als Management bzw. Konzernspitze gesehen und versucht die Rolle des Rates zurückzudrängen“ (Kersting 1998: 163). Versuche die öffentlichen Dienste wie Privatunternehmen zu verwalten (vgl. Bourdieu et al. 1997) führen auf der Ebene der Gemeinde „zu einer neuen Entpolitisierung der Kommunalpolitik mit einer Administration, die im Rahmen der Standortdebatte die Voraussetzungen für ökonomische Entwicklung in den Vordergrund rückt, das Primat der Ökonomie im Modernisierung wird hier in einem ‚neutralen’ Sinne als Anpassung von Institutionen und Organisationen an soziale, kulturelle ökonomische und ideologische Wandlungsprozesse verstanden. 29 182 vorauseilenden Gehorsam (non decision) hervorhebt und sozialstaatliche Aufgabenbereiche privatisiert oder an die Zivilgesellschaft überträgt“ (Kersting 1998: 163). Mit dem Anschluss der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen an die international seit Mitte der 1970er Jahre vornehmlich gegenüber Infrastrukturorganisationen der öffentlichen Hand zu verzeichnenden Privatisierungstendenzen, erfassen Privatisierungs- bzw. ‚Ökonomisierungsprozesse’ in wachsendem Maße sämtliche Bereiche öffentlich verfasster Dienste. Wie auch immer die dadurch induzierten Umgestaltungen öffentlich-rechtlicher Leistungen in quasi-warenförmige Individualgüter aus Effizienzgesichtspunkten betrachtet werden mögen, stellen sie für die Institutionen des Sozialen in ihrer Gesamtheit einen grundlegenden Systembruch dar. III. 4. 2 DAS NEUE STEUERUNGSMODELL Ein wesentliches Moment des marktförmigen Umbaus der Kinder- und Jugendhilfe ist ihre Neuorganisation nach Maßgabe ‚Neuer Steuerungsmodelle’ unter der konzeptionellen Federführung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). Als eine deutsche Variante des ‚New Public Management’ geht es in den Neuen Steuerungsmodellen im Kern um eine Übertragung marktförmiger Prinzipien, Techniken, Rechnungsweisen sowie Unternehmensführungsmethoden aus der Betriebswirtschaft in die öffentlichen Institutionen sozialer Dienstleistungen (vgl. Flösser/Schmidt 1992, Krölls 1996). Maßnahmen einer solchen Form der Verwaltungsmodernisierung sind seit Mitte der 1990er in der Mehrheit der Jugendämter implementiert worden (vgl. Bussmann et al. 2003, Seckinger et al. 1998). Auf der Ebene der symbolischen Repräsentation soll sich dabei sowohl das Selbstverständnis der Anbieter personenbezogener Dienstleistungen an unternehmerischen Leitbildern orientieren, als auch ein Wandel der institutionellen Statusrepräsentation der Dienstleistungsnutzer vom bedürftigen Klienten zu einem Kunden vollzogen werden, der autonom auf dem Hilfemarkt Entscheidungen trifft (vgl. Otto/Flösser 1996, Wohlfahrt 2000). Die Umsteuerungsprozesse durch die Neuen Steuerungsmodelle zielen auf der Ebene der sozialen Dienstleistungsorganisationen unter anderem darauf, öffentliche Verwaltungen im Sinne eines wettbewerbsorientierten, selbstproduzierenden Unternehmens oder auf dem Markt der Wohlfahrtsökonomie einkaufenden „arranger of sevices provided by others“ (Salomon 1995: 20) umzubauen um damit - durch eine Dezentralisierung der Verantwortlichkeiten wie der Verwaltung von Ressourcen - eine Erhöhung der Flexibilität bei gleichzeitig erhöhten Möglichkeiten der internen wie externen Koordination und Kontrolle einzelner Einheiten zu erreichen. Auf der Basis klarer Ziel- und Produktbeschreibungen und deren standardisierten Messbarmachung soll eine wesentlich stärker ergebnis- als prozessorientierte Steuerung und Kontrolle des ‚Outputs’ (‚Management by Results’) nach Kriterien von Effizienz und Effektivität erfolgen. Durch ‚managerielle’ Techniken eines ‚Kontraktmanagements’ und ‚Controllings’ innerhalb der künstlich geschaffenen Wettbewerbsumwelt eines ‚Quasi-Marktes’ soll die Verwaltungsführung in die Lage versetzt werden, die fachlich ausführende Ebene dadurch ‚aus der Distanz’ zu steuern, dass sie verbindlich die Ziele und 183 ‚berechtigten’ Zielgruppen sowie die Qualität und Quantität der Leistungen festlegt, kontrolliert und mit Budgets ausstattet, während sie die Umsetzungsverantwortung zugleich verstärkt dezentralisierten, ‚autonomen’ Einheiten zukommen lässt (vgl. Mc Laughlin/Murji 2001, Olk 1994, Schmidt 1996, Wohlfahrt 2000). Die zentralen Kriterien, nach denen diese ‚Steuerung aus Distanz’ erfolgen soll, sind die der passgenauen Entsprechung des Wirkungsradius der Qualität und Quantität der Hilfe zu dem je festgestellten Bedarf als ‚Effektivität’ und deren optimales Verhältnis zu den hierfür verausgabten Kosten als ‚Effizienz’. Innerhalb des Spielraums der Effektivitäts- und Effizienzerfordernisse versprechen die Neuen Steuerungsmodelle den Mitarbeitern dadurch mehr Autonomie und Gestaltungsmacht, dass sie von ihnen fordern, sich in der aktiven und eigenverantwortlichen Weise eines ‚Unternehmers’ zu verhalten (vgl. Krölls 1996, Weber 2000). Dieser Autonomiegewinn gegenüber den - häufig als notwendiges aber hemmendes Element der fachlichen Praxis empfundenen – bürokratischen Logiken der Organisationen, stellt sich jedoch zugleich als ein Instrument neuer Formen der Steuerung dar30. Ihre Autonomie ist weniger als Element der Fachlichkeit bzw. des fachlichen Widerstands gegen die Verwaltungsführung, sondern selbst als eine sozialtechnisch zu erschließende Ressource konzipiert (vgl. Bröckling 2000: 142). Das Versprechen von mehr ‚Autonomie’ hat dann das schlichte Funktionalitätsargument auf seiner Seite, wenn es gelungen ist, sie auf die Verinnerlichung der Marktmechanismen zu verengen, und damit selbst zu einem manageriell exploitierbaren Rationalisierungsinstrument werden zu lassen. Damit ist es kein Widerspruch, sondern ein Kern der manageriellen Rationalität der Neuen Steuerungsmodelle, eine Stärkung der Autonomie und Gestaltungsmacht dort zu etablieren, wo es aus der Managementperspektive möglich ist und diesen zugleich dort, wo es ‚nötig’ erscheint, einen Planungs-, Steuerungs-, und Kontrollfetischismus entgegenzustellen, der Züge annimmt, die in ihrer Rigidität an die Blütezeiten einer tayloristischen Arbeitsorganisation erinnern (vgl. Pollit 1990, Simon 1996 siehe auch Bourdieu 2001a). Tendenzen einer ‚Taylorisierung’ der Sozialadministration bzw. der ‚Industrialisierung Sozialer Arbeit’ (vgl. Fabricant/Burghardt 1992) werden durch eine – im Versuch partikulare Nachfrage- und Angebotsstrukturen wie -inhalte in ein je flexibles Passungsverhältnis zu bringen, begründete - Spezialisierung auf möglichst kleine Aufgabenabschnitte und Tätigkeiten verstärkt, die eine quantitative Steigerung der Tätigkeitseinheiten sicherstellen sollen (vgl. Schaarschuch 2000). Die Wirkungen einer quasi-tayloristisierten Arbeitsorganisation bestehen, entgegen den ‚Enthierarchisierungsversprechen’, vor allem darin, die Führungs- und Managementebenen der Organisationen - die die Primärprozesse die Arbeitsebene nicht einmal allzu genau zu kennen brauchen (vgl. Lenk 2000) - aufzurüsten, während für die unteren Wie weit dieser Autonomiegewinn faktisch wird ist durchaus fraglich. Treffend weist Dedrichs (2000: 17) in Anlehnung an die Habitus-Feld-Theorie Bourdieus darauf hin, dass „[f]lexible Arbeitsrollen […] die Aushandlung von berufsrollenspezifischen Fähigkeiten und Tätigkeiten [erzwingen]. Diese Flexibilisierung erzeugt aber nicht größere Handlungsspielräume, sondern das Gegenteil: Als Persönlichkeit verklärt, entscheidet nun der Habitus über Erfolg oder Misserfolg, denn eindeutige Normen und deren Befolgung sind für Leistung nicht mehr ausschlaggebend. Sowohl die direkte als auch die indirekte Kommunikation über Arbeitsinhalte und –ziele sind dann nicht mehr ausschließlich über das organisationsinterne Protokoll vermittelbar. Die notwendigen Aushandlungen sind hochgradig habitusspezifisch: zwar sind sie durch schlanke Hierarchien gekennzeichnet, die Illusion der Gleichberechtigung erzwingt aber geradezu Machtspiele im informellen Bereich, wobei der ‚illusio’ eine entscheidende Rolle zufällt“. 30 184 Umsetzungsebenen eine Entwertung erfahren31. In Kombination mit zur Kompensation des Spardrucks auf der Ebene des Personals wie der Leistung ausgeweiteten Prozessen der Standardisierung, bildet diese Entwicklung den Kontext für eine Deprofessionalisierung bzw. einer Reduktion professioneller Praxis auf eine bloße Durchführungsfunktion managerieller Vorgaben32 (vgl. Schaarschuch 2000, Brodkin 2000, Harris/Kirk 2000, Fabricant/Burghardt 1992, Lundström 2000). III. 4.3 DIE SUBJEKTIVIERUNG DER ADRESSATEN ALS KUNDEN UND ‚SELBSTUNTERNEHMER’ Im Kontext der faktischen Dominanz marktliberaler Positionen im Modernisierungsdiskurs der kommunalen Verwaltungen hat sich eine Form der Orientierung an der ‚Nachfragerseite’ durchsetzen können. Dabei werden zwar bürokratische Herrschaftsformen kritisiert, ein Ausbau demokratischer Rechte und Standards gegenüber aber nicht gefordert. Stattdessen wird ein ‚konsumeristischer’ Ansatz favorisiert, der vor allem die Ergebnisdimension der Leistungserbringung fokussiert. „Entsprechend der Definition des Adressaten als Konsument bzw. Kunden öffentlicher Dienstleistungen rekurriert der konsumeristische Qualitätsbegriff ausschließlich auf die Bedürfnisbefriedigung […] . Das Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung erfährt hierdurch eine Entpolitisierung. Der zunächst von den Bürgern geforderten stärkeren Berücksichtigung der Adressateninteressen (‚citizenship’) steht nun das von den Anbietern proklamierte Leitbild der ‚Konsumentensouveränität’ gegenüber“ (Piel 1996: 93 ff). Um die Differenz zwischen den beiden idealtypischen Ansätzen zu verdeutlichen ist es wesentlich, dass die Frage des Nutzerstatus in der Erbringung der Dienstleistung untrennbar mit der Frage des gesellschaftlichen ‚Erbringungskontexts’ der Dienstleistung selbst verbunden ist (vgl. Gross 1993, Schaarschuch 1998). Der ‚Erbringungskontext’ bildet den Rahmen in dem sich die Erbringungsverhältnisse sozialer Dienstleistungen konkretisieren. Im einem Erbringungskontext ‚Markt’ rematerialisiert sich der ehemals als ‚bedürftig’ bestimmte ‚Klient’ idealerweise als ein ‚Kunde’, der sich unabhängig vom festgestellten Bedarf in ein angebotenes Produkt einkauft. Demgegenüber erfolgt in dem - aufgrund des verfassungsmäßigen Sparsamkeitsgebots (vgl. Maas 1996) - idealtypisch konkurrenzfreien Erbringungskontext ‚Staat’ die Distribution von Gebrauchswerten nach Maßgabe politisch-administrativer Entscheidungen (vgl. Schaarschuch 1996a). Während im Erbringungskontext ‚Staat’ der Einzelne als Bürger – und damit als Teil des demokratischen Souveräns – einer ‚durch ihn’ demokratisch legitimierten Administration gegenübertritt, ist er im Erbringungskontext ‚Markt’ - in dem die Leistungen als individuelles Gut bzw. als privat erbrachte Tauschwerte gefasst sind - ein konsumierender Einzelner der gegenüber einem beliebigen Anbieter eines beliebigen Produkts in Erscheinung tritt. Dabei zeichnet sich ein dualer Arbeitsmarkt ab, der über einen manageriellen Kern und eine wenig gesicherte Peripherie von Mitarbeitern verfügt „who are incrasingly reliant on short term contract funding“ (Stenson/Factor 1995: 174). Für eine solche Entwicklung in der Bundesrepublik spricht der kontinuierlich steigenden Anteil Teilzeitbeschäftigter (vgl. KomDat 2001) ebenso, wie das sinkenden „Interesse an den ‚schmutzigen’ Arbeitsfeldern […und die starke] Nachfrage nach Stellen in der ‚ordentlichen’ Sozialadministration“ (Scherr 2000: 182). 32 Ob gerade in diesem Kontext organisatorische oder fachliche Innovationspotentiale ‚besser’ als zuvor vorgebracht werden können ist fraglich. So hat etwa der Organisationssoziologe Raimund Hasse (2003) nachgezeichnet, dass das Zusammenspiel von Organisation und Wettbewerb weniger genuine Innovationsfähigkeit sondern vor allem Prozesse der Diffusion und damit der Nachahmung und Übernahme begünstigt. 31 185 Ebenso idealtypisch können den beiden Erbringungskontexten zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme der Nutzer auf das Erbringungsverhältnis sozialer Dienstleistungen zugeordnet werden (vgl. Hirschmann 1974): Während ein Einfluss des Nutzers auf die Erbringung von Dienstleistungen in einem angebotsorientierten, auf den Kunden gerichteten, privatrechtlich organisierten Markt durch die Möglichkeit der Abwanderung (‚exit’) impliziert ist, besteht die Möglichkeit des Einflusses im Rahmen des idealtypisch auf die Bedürfnisse des Bürgers gerichteten, öffentlich-rechtlichen und weitgehend konkurrenzlosen Referenzsystems Staat nicht in der Option des Abwanderns sondern in der politischen Artikulation von Interessen (‚voice’) (vgl. Schaarschuch 1996a). Während im Erbringungskonzept ‚Staat’ eine Nutzerorientierung in einer umfassenden Demokratisierung des Erbringungsverhältnis sozialer Dienstleistungen und damit mittelbar des öffentlichen Bereich gegenüber dem ‚Bürger’ liegt, besteht die idealtypische Nutzerorientierung des Marktes in der Varianz der konsumeristischen Wahl eines ‚Kunden’ und in der ‚Rechenschaft’ (‚accountability’) des Anbieters „comming to denote within governmental discourse […] the resposiveness of [… quasi-commercial] providers to their paying consumers“ (Loader/Sparks 2002: 88, vgl. Clarke 2001). Eine explizite Absicht der neuen Steuerungsmodelle ist es ‚Qualitätsverbesserungen’ der öffentlichen Leistungen durch die Ausstattung der Adressaten mit der Nachfragemacht eines ‚Kunden’ zu bewirken (vgl. Stöbe 1998). Diese konsumeristische Nachfragemacht basiert auf einer Konkurrenz der Anbieter bzw. nicht alternativlosen Angeboten, die für den ‚Kunden’ je zugänglich sind. Über die Frage des Raums an effektiver Wahlfreiheit hinaus, besteht ein Problem dieses Konzepts darin, dass weder garantiert ist noch ex ante voraussetzungslos davon ausgegangen werden kann, dass die erforderlichen Informationen aber auch die notwendigen ‚Fähigkeiten’ (‚Capabilities’ vgl. Sen 2000) für eine ‚freie’ Auswahl unter den Adressaten gleich verteilt und in vergleichbarer Weise zur Anwendung kommen (vgl. Becker 2000, Greener 2002, Hope/Sparks 2000, Schaarschuch 1998, Schnurr 2001). Eine solche Ungleichverteilung ist nicht nur Folge ‚persönlicher Präferenz’ (dazu umfassend: Bourdieu 1982), sondern erscheint „nicht zuletzt als Folge jener Bedingungen, die dazu geführt haben, dass […die Adressaten] solcher Dienste überhaupt bedürfen. Auf einer sehr grundsätzlichen Ebene ist choice als Instrument zur Beeinflussung der Leistungserbringung irrelevant für jene, die ihrer eigenen Wahrnehmung gemäß bestenfalls gegen ihren Willen oder gezwungenermaßen zu Leistungsempfängern wurden oder sich schlimmstenfalls als beschädigte Überlebende entmündigender und behindernder Dienste verstehen“ (Wistow/Barnes 1993: 185, nach Schnurr 2001: 1335) Zwar spricht - gedankenexperimentell - per se wenig gegen die Möglichkeit, dass auch Anbieter im Referenzsystem ‚Markt’ ihren ‚Kunden’ - jenseits der Option sich einen anderen Anbieter zu suchen bis zu einem gewissen Grad Möglichkeiten einräumen ihre Bedarfe und Interessen zu artikulieren und ihre ‚Produkte’ ihrerseits entsprechend zu modifizieren, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass eine auf Ökonomie, Effizienz und Effektivität gerichtete, - d.h. marktförmige - Form der Leistungserbringung sich vornehmlich um die klassische ökonomische Antwort auf Enttäuschung, die Exit-Option gestaltet (wobei dort wo eine Exit-Option nicht möglich oder nicht attraktiv erscheint – und dies scheint für die oligopolitistischen Quasi-Märkte sozialer Dienstleistung zumindest für die Nutzer weitgehend der Fall zu sein - Nachteile und Lasten z.T. sogar langfristig hingenommen werden vgl. Müller-Jentsch 2003). Während die ‚Voice-Option’ bei Hirschmans (1972: 30) „any attempt at all to change, rather than escape from, an objectionable state of affairs, whether through individual or collective petition” beschreibt und in so fern als eine zentrale Demarkationslinie für die demokratische Qualität der 186 Produktion ‚öffentlicher Güter’ verstanden werden kann, ist innerhalb eines Erbringungskontextes ‚Markt’ die ‚Exit-Option’ als Möglichkeit der Einflussnahme der Nutzer bzw. Kunden alleine deshalb dominant, weil sie gegenüber ihrer Alternative - d.h. einer nicht nur begrenzt modifikativen, sondern substanziell ‚partizipatorischen’ und effektiven Möglichkeit der Adressaten ‚Voice’ zu artikulieren (dazu: Schaarschuch 1998, Schnurr 2001) - für die Leistungsanbieter gerade auf einem Markt in dem sich die Kunden und die direkten Adressaten der Leistungen nicht entsprechen deutliche Vorteile verspricht: So kostet das Einräumen einer ‚Voice-Option’ nicht nur Zeit und verlangt ein Mehr an kommunikativen Ansprengungen, sondern hat aus der Perspektive des Erbringers den entscheidenden Nachteil, dass die Leistungserbringung weniger planbar und steuerbar ist - und sich in so fern auf das Maß ihrer ‚Accountability’ als ‚Provider’ gegenüber den in der Regel administrativen zahlenden ‚Purchaser’ auswirkt - und dass es sich vor allem auch das erzielen vergleichbarer instrumentellen Effekte bezüglich vorab definierter Ziele als in einem exzessiven Maße kostspieliger erweißt, als dann wenn lediglich eine Exit-Option bereit gestellt wird (vgl. Polikoff 1995). Systemlogisch müsste sich demnach eine Einlösung des Versprechens einer Orientierung (d.h. der Erhöhung der Möglichkeiten zur Einflussnahme) der Dienstleistungserbringung am Nutzer im Referenzsystem ‚Staat’ in der Stützung der ‚Voice’-Option zeigen und würde damit auf eine Demokratisierung des institutionellen und administrativen Erbringungskontextes und die systematische Achtung und Stärkung des Bürgerstatus der Adressaten, im Sinne der Respektierung ziviler, politischer und sozialer Freiheits- und Schutzrechte im Erbringungsverhältnis implizieren (vgl. Schaarschuch et al. 2001: 272). Demgegenüber kann eine Dienstleistungserbringung im Referenzsystem ‚Markt’ das Versprechen der Kundenorientierung aufrechterhalten, und trotzdem – systematisch widerspruchsfrei – von einem demokratisierenden und Grundrechte realisierenden Projekt absehen: Eine Einflussmöglichkeit bleibt durch die Abwanderungs-Option im Sinne einer konsumeristischen Wahlmöglichkeit des ‚Kunden’ gewährleistet. Der Rekurs auf den ‚Markt’ als zentrales Referenzsystem und den Kunden, als das ‚Subjekt’ dieses Systems, hat damit, wie John Clarke (2001: 3, 7) ausführt, „challenged conceptions of the public interest, striving to replace them by the rule of private interests, aggregated by markets […] It has insisted that the, monopoly providers’ of public services be replaced by efficient suppliers, disciplined by the competitive realities of the market (or, in some of its neo-conservative combinations, by philanthropy). It has disintegrated conceptions of the public as a collective identity, attempting to substitute individualised and economised identities as […] consumers (Clarke 1997). […T]he idea of the consumer has added new dimensions to the way the public interest is being represented. Above all, ,the consumer’ is held to mark a shift from, passive recipient’ to, active choice maker’ in relation to services. This active consumer is the force that requires modern public services to be adaptive, responsive, flexible and diverse rather than paternalist, monolithic and operating on a model of, one size fits all’. The consumer thus forges a story about the past and future of public services. […S]/he is an economic invention. Consumers know their own wants, can make rational choices and expect producers to serve them. […C]onsumers are abstracted from other social roles and positions, including the problematic and stressful conditions in which many public services may be used […And] consumers are both universal and particular: the role of consuming is universalised (and naturalised), while the wants are particularised (and individualised). Consumerism registers diversity (everyone has different wants) but does not recognise the inequalities of social differentiation. Finally, consumerism constructs the public interest as a series of specific and individualised encounters and interactions: each consumer consumes a particular bit of service. Collective consumption of public services is invisible (as is the, enforced consumption’ of services)”. Während die Orientierung an einem Bürgerstatus - dem Status des demokratisch legitimierten souveränen Rechtssubjekts - auf ein entsprechend der praktischen Realisierungsbedingungen dieses formalen Status zu gestaltendes, soziales Verhältnis verweist, impliziert die Kundenorientierung die 187 Fokussierung und Bearbeitung eines politisch kleingearbeiteten individuierten Falls, dem die isolierten Logiken und (Spar)Zwänge der Institutionen gegenüber stehen. Würde die Figur des Kunden tatsächlich ernst genommenen, wäre die Konsequenz soziale Leistungen weder als Teil einer Einlösung kollektiv gewährter sozialer (Teilhabe)Rechte, noch in kompensatorischer Weise gegenüber strukturellen Benachteiligungen von Klasse, Ethnie, Geschlecht oder Behinderung zu gewähren, sondern als individuelle Dienstleistungen für individuelle Marktteilnehmer. Auch die Qualität und Quantität der gewährten Dienstleistung ist dann nicht mehr als Konsequenz politisch zu verantwortender Entscheidungen, sondern als Ergebnis der Regulation der ‚unsichtbaren Hand’ (vgl. Smith 1776) des Marktes. Faktisch lässt sich von einem kaum überwindbaren Spannungsverhältnis zwischen Leistungserbringungsrationalitäten auf der Basis privat-gewerblicher Prämissen und der Anforderung an personenbezogene soziale Dienstleistungen in ihrer Produktion (immaterieller) öffentlicher Güter dem – im Referenzsystem ‚Staat’ qua Rechtsstatus gesicherten – Anspruch und Bedarf der Adressaten so umfassend gerecht zu werden, wie es sich in sozial- und rechtsstaatlicher Hinsicht legitimieren lässt (dazu auch: Sclar 2000). Das ökonomische Wettbewerbsprinzip im Bereich sozialer Leistungen formuliert nicht nur Klienten in Kunden um sondern unterwirft auch die Professionellen einer marktwirtschaftlichen Disziplin (vgl. O’Malley 2001) Nancy Fraser (2003: 254 f) spricht von einem „System der ‚entstaatlichten Governmentalität’ [… in dem] eine substantielle Wohlfahrtspolitik durch formale Technologien ökonomischer Verantwortlichkeit ersetzt [wird]; Rechnungsprüfer anstelle von öffentlichen Angestellten fungieren als oberste Repräsentanten der Disziplinierung [,…] Marktmechanismen, die an die Stelle der fordistischen Techniken ‚sozialer Kontrolle’ treten, organisieren weite Bereiche des menschlichen Lebens […]. Eine neue, postfordistische Form der Subjektivierung ist die folge. Das neue Subjekt der Governementalität gleicht weder dem viktorianischen Subjekt individualisierender Normalisierung noch dem fordistischen Subjekt kollektiver Wohlfahrt; es ist ein aktiver und verantwortlicher Akteur. Als Subjekt, das die freie Wahl (zwischen den Angeboten des Marktes) hat, und als Konsument von Dienstleistungen ist dieses Individuum dazu verpflichtet, seine Lebensqualität durch eigene Entscheidungen zu verbessern. Bei dieser neuen ‚Selbstsorge’ ist jeder Experte in eigener Sache dafür verantwortlich, sein eigenes Humankapital mit maximalem Gewinn zu verwalten“. Das Prinzip der kollektiven Wohlfahrt des fordistischen Sozialstaat verschiebt sich in so fern zu einer Stärkung des Prinzips der Selbstsorge unter den sozialpolitischen Vorzeichen, dass staatliche Wohlfahrt für den individuellen Akteur an seine Selbstsorge und Selbstfürsorge gekoppelt wird. Optimistisch formuliert wird auch den Adressaten der Jugendhilfe das explizite oder implizite Angebot gemacht „sich aktiv [auch] an der Lösung [… jener] Angelegenheiten und Problemen zu beteiligen“ für die „spezialisierte und autorisierte Staatsapparat[e]“ bisher weitgehende alleinige, professionelle Zuständigkeit für sich reklamierten. „Der ‚Preis’ für diese Beteiligung ist, dass sie selbst die Verantwortung für diese Aktivitäten – und für ihr Scheitern – übernehmen müssen“ (Lemke 1997: 254). Die soziale Verpflichtung des Staates wird demnach in einem stärkeren Maße als bisher mit einer individuellen Selbstverpflichtung des je einzelnen Adressaten verknüpft, wenn nicht in diese überführt. In so fern wird auch ein (politischer) Bezug der Jugendhilfe auf ‚das Soziale’ relativiert, da das „legitimationsbedürftige Entscheidungsproblem, welcher ‚KonsumentInnen’-Gruppe ‚personenbezogene DienstleistungsproduzentInnen’ am ehesten ihre ‚Dienstleistungen’ zugute kommen lassen und welche Gruppen tendenziell […] ausgeschlossen werden, […] im Verweis auf die angeblich geltenden ‚Marktmechanismen’ eine Verschleierung [erfährt]. Unabhängig von den vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten kann, den nicht zum Zuge gekommenen Gruppen die Verantwortung dafür, dass sie die ‚Dienstleistungen’ nicht ‚nachgefragt’ hätten, nun selbst zugeschoben werden.“ (May 1994: 68). 188 Eine solche Form der Verantwortlichmachung der nachfragenden - bzw. der nicht oder nicht adäquat nachfragenden - ‚Subjekte’ im Kontext einer privatrechtlich-fiskalischen Regelung der Erbringungsprozesse personenbezogener sozialer Dienstleistung impliziert eine Dethematisierung der strukturellen Bedingungen einer „realen Sicherung des Zugangs zu den Angeboten sozialer Dienstleistungen für die einzelnen von sozialer Ungleichheit betroffenen Akteure“. Einer Marktlogik entspricht demgegenüber die implizite Annahme jeder Akteur „sei berechtigt und es sei ihm möglich am ‚Markt sozialer Dienstleistungen’ teilzunehmen“ (Kessl/Otto 2001). Damit verschiebt sich die Repräsentation des Adressaten von einem von den Experten abhängigen und als ‚bedürftig’ identifizierten ‚Klienten’ der Jugendhilfeleistungen zu einem ‚Konsumenten’ bzw. ‚Kunden’, der sich rational und selbstverantwortlich für oder gegen bestimmte angebotene Leistungen entscheiden darf, aber sich auch zu entscheiden hat. Damit ist der Nutzer ex ante als ‚mündig’ unterstellt (kritisch: Brumlik 1992) - und in einem gewissen Sinne werden die Resultate Soziale Arbeit zu einer Voraussetzung ihres Tätigwerdens verkehrt - während sich die Jugendhilfe selbst auf dieser Basis verstärkt ‚nutzerorientiert’ bzw. ‚kundenorientiert’ gestalten kann. Unabhängig von der Feststellung, dass sich eine solche zunächst ‚ent-paternalisierende’ Umgestaltung der personenbezogenen sozialen Dienste (vgl. Langan 1998) mit den Interessen einer Vielzahl der bisher als abhängige ‚Klienten’ repräsentierten Akteure decken kann, hat die hierin immanent unterstellte Form der ‚Mündigkeit’ wenig mit jener bürgerlich-politischen Mündigkeit der Aufklärung zu tun, die etwa Immanuel Kant als Telos aller erzieherischen Tätigkeit setzt. Sie ist vielmehr die Mündigkeit des ökonomischen Bürgers, die weniger auf seine politische Souveränität, sondern auf ‚Kundensouveränität’ bei der Leistungsauswahl verweist (dazu Anderson 2003). Die neue ‚Mündigkeit’ und ‚Souveränität’ des Adressaten als Kunde bedeutet auch eine weitreichende Rückführung der positionalen und dispositionalen ‚sozialen Risiken’ in seine private ‚Verantwortlichkeit’, seine ‚Verantwortungsbereitschaft’ und seine Kapazitäten die ‚richtigen’ Entscheidungen zu treffen: es geht um eine Form der „reflexivity that accepts the existing rules of the game and attempts to make the best of them […] rather than attempting to challenge the rules themselves […] something that is clearly not to be encouraged“ (Greener 2002: 699). Die Metapher der Mündigkeit bleibt dabei zwar in einem gewissen Sinne ‚emanzipatorisch’ ist aber zugleich eine euphemistische Umschreibung für eine instrumentelle ‚ökonomische’ Rationalität: „Sie verwandelt den vermeintlichen Sparzwang in ein [... Hilfsleistungsa]ngebot und Kürzungen in Wahlfreiheit und Selbstbestimmung“ (Schmidt-Semisch 2002: 79). Der Preis für eine weitreichende Beteiligung des Adressaten als Kunde in einer Jugendhilfe als ‚ökonomisierte’ Dienstleistung ist es, dass die Adressaten sowohl die Verantwortung für die Herstellung und Wiederherstellung ihrer Lebensführungs- und Lebensbewältigungskompetenzen als für ein diesbezügliches Scheitern zu übernehmen haben. Ein empirisch zentrales Problem der ‚Freiwilligkeit’ der Teilnahme auf dem Dienstleistungsmarkt besteht darin, dass gerade marginalisierte und tendenziell ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen oft ausgesprochen negative Wahrnehmungen, Beurteilungen und Erwartungshaltung gegenüber Institutionen haben (vgl. Chassé 2001, Münder et al. 1998), die analytisch im Sinne eines symbolisch 189 negativ bewerteten, ‚verknüpfenden’ Sozialkapitals zu Institutionen fassbar sind (vgl. Woolcock 2000). Eine Unverfügbarkeit von positiven ‚Verknüpfungskapital’ im Erbringungsverhältnis personenbezogener sozialer Dienstleistungen kann sich nicht nur auf Seiten der Professionellen bzw. (Vertreter der) Institutionen, etwa im Sinne wenig ‚responsiver’ Angebote bis hin zu stigmatisierenden Expertenhandeln manifestieren, sondern vor allem auch auf Seiten potentieller Nutzer dazu führen, dass bestimmte Akteure oder ganze Gruppen von Akteuren die Hilfe, der sie bedürfen nicht nachfragen können oder wollen. Dies wird in dem Maße verstärkt, wie die Hilfeleistungen eben nicht ‚bedingungslos’ erfolgt, sondern die Nutzer selbst den Nachweis ihres legitimen Anspruchs zu erbringen haben (vgl. Kunstreich 1998, Rothstein/Stolle 2003) und gleichzeitig auch im Prozess der Leistungserbringung dazu aufgefordert werden ‚von sich aus’ das ‚ihre’ zu leisten (vgl. Burkitt/Ashton 1996). Ceteris paribus kann somit eben nicht davon ausgegangen werden, dass potentiell entmündigende Effekte institutioneller Interventionslogiken durch eine solche Form der Entbürokratisierung per se außer Kraft gesetzt wären. Sie findet sich nun allerdings auf einer anderen Ebene: Der Gefahr eines paternalistischen Zugriffs tritt die Gefahr der administrativen Nichtbearbeitung von Mängellagen an die Seite und das bedeutet noch mehr Entmündigung (vgl. Brumlik 1992: 249, Honneth 2002). Diese Gefahr der faktischen ‚Entmündigung durch Autonomie’ findet ihrer Basis in einer Veränderung der gesellschaftlichen und institutionellen Repräsentation (vgl. Melossi 2000) der Nutzer von sozialen (Dienst)Leistungen. Deren rationales Wahlhandeln (vgl. Rose 1989) rückt unter Absehung des gesellschaftlichen, bzw. des positionalen und dispositionalen Hintergrunds der Bedingungen des substanziellen Gebrauchs ihrer potentiellen Möglichkeit den Vordergrund (kritisch: Bourdieu/Wacquant 1996, Smelser/Swedburg 1994). In einer solchen Fassung des Einzelnen als ‚Unternehmer seiner selbst’ bzw. ‚Planungsbüro in eigener Sache’ wird das aus der ‚Zwangskollektivierung’ einer ‚administrativen Solidarität’ in seine individuelle Verantwortung auf dem Referenzsystem ‚Markt’ entlassene ‚Subjekt’ selbst zur entscheidenden Maßeinheit. Während die Leistungserbringungen einen Status erhalten, der dem Individuum geschuldet ist werden diese zugleich zu einer Verstärkung ihrer Eigenleistungen aufgefordert (vgl. Donzelot 1994): Ein ‚angemessener’ „Wille zur Selbsthilfe [wird] als Anspruchsvoraussetzung normiert und Verstöße dagegen mit Nichtbewilligung von Leistungen oder Leistungsentzug“ sanktioniert (Krölls 2000: 77), wobei die in diesem Kontext von der Sozialen Arbeit ‚angebotene’ „Hilfe zur Selbsthilfe“, weniger denn je als eine „Ermöglichung kollektiver Selbstbestimmung über das eigene gemeinsame Lebensschicksal […verstanden wird], sondern als Hilfe zur individuell-selbstständigen Reproduktion durch Teilnahme an Arbeits- und Warenmärkten“ (Müller et al. 1983: 148). Dabei ist es gerade die Kundenorientierung, die „in marktwirtschaftlich modernisierter Terminologie die oberste Sozialstaatsmaxime der Hilfe zur Selbsthilfe in Anschlag bringt“ (Krölls 2000: 77) und das Maß der je eignen Lebensführungsverantwortung zum entscheidenden Kriterium der Trennung von förderungswürdigen und förderungsunwürdigen Fällen macht. In diesem Sinne ist es die aktive und - im Sinne der leistungserbringenden Institution - ‚konstruktive’ Mitwirkungspflicht sowie die Signalisierung von (Mit)Arbeitsbereitschaft, die die Trennlinie zu den ‚unmündigen“ und ‚passiven’ Sozialleistungskonsumenten darstellt. Letztgenannte, die nicht fähig oder Willens sind, ihre neuen 190 Formen einer individualisierten Bringschuld zu realisieren, dürfen nicht damit rechnen, in den Genuss der neuen Freiheiten einer marktförmig erbrachten Form der Dienstleistung zu kommen. Sie befinden sich auf der anderen Seite jener neuen Logik, die Loïc Wacquant (2001) als ‚liberal-paternalistisch’ rekonstruiert, und die Mitchell Dean (2002) als die autoritären Maßnahmen des Marktliberalismus analysiert. Anstatt die Nutzer gegenüber ihren strukturellen Teilhabebeschränkungen zu fördern, „wird die ‚Lebensgestaltungsverantwortung’ an die einzelnen (individuellen und kollektiven) Subjekte überführt“ und von der Aufforderung begleitet „ein rationales Eigenverständnis als ‚Selbstversorgersubjekt’ […] zu entwickeln“ (Kessl/Otto 2001: 7). In der damit induzierten Veränderung der sozialen Repräsentation des Adressaten vom ‚abhängigen Klient’ zum ‚mündigen Kunden’ wird dieser „nicht langer länger als ein soziales Geschöpf verstanden, das die Befriedigung seines oder ihres Bedürfnisses nach Sicherheit, Solidarität und Wohlfahrt sucht, sondern als Individuum, das aktiv sein oder ihr Leben zu verwalten sucht um seine Erträge hinsichtlich Leistung und Erfolg zu maximieren“ (Miller/Rose 1994: 100). III. 4. 4 KONTUREN EINER NEUEN HERRSCHAFTSRATIONALITÄT EINER ‚ADMINISTRATIVEN JUGENDHILFE’ Als das zentrale Moment einer faktisch vollzogenen Umorientierung, weg von einem ersten, fachlichen, primär auf eine Verbessung des Nutzerstatus bzw. eine demokratische Verwirklichung des sozialen Bürgerstatus zielenden Dienstleistungsdiskurs hin zu einer Fokussierung des ökonomischen Bürgers als Kunden kann die Verschiebung „from provision through public services to provision through governmentally contrived markets in such services“ (Dean 2002: 47) betrachtet werden. Nichtsdestoweniger formuliert auch eine marktorientierte Fassung von ‚Leistungsangeboten’ auf der Ebene der Repräsentation der Akteure als ‚Unternehmer ihrer Selbst’, ‚Planungsbüros in eigener Sache’, ‚mündige Kunde’ etc. ein empanzipatorisches Versprechen an die Nutzer personenbezogener sozialer Dienstleistungen. An die Stelle des Verweises auf einen, pointiert formuliert, defizitären Sozialcharakters, den es durch normierende Normalisierung erst ‚nützlich zu machen’ gilt, rückt ein Akteur, dessen Status als ‚autonomes Subjekt’ ex ante betont wird und der sich als solches aus den Bevormundungen, Zumutungen und paternalistischen Gängeleien der bürokratischen Herrschaft eines scheinbar allgegenwärtigen, anmaßenden und zudringlichen ‚sorgenden Staates’ befreien kann. Mit dem Rekurs auf ‚Autonomie’ und ‚Subjektivität’ wird der selbe ‚point de résistance’ vorgeschlagen, den aufgeklärte und kritische Vertreter der Disziplin (vgl. Scherr 1997, Sünker 1989, 2000, Winkler 1998), als Grundlage für eine reflexive, den spätkapitalistischen Funktionsanforderungen wie staatlichen Zurichtungspotentialen kritisch begegnende Jugendhilfe, zur Geltung bringen. Allerdings bleibt die Freiheit und Autonomie des ‚Marktsubjekts’ – für die Nutzer der Jugendhilfe faktisch ohnehin eher eine symbolische Repräsentation in einem assoziativen Leitbild als ein realer Status - auf die freie Ausübung einer persönlichen Wahl aus den verfügbaren mehr oder – mit Blick auf die ‚reale’ Vielfalt zugänglicher Angebote personenbezogener sozialer Dienstleistungen in der Bundesrepublik eher - weniger vielfältigen Marktoptionen beschränkt (vgl. Rose 1989). Darüber ist die Ungestaltung der Erbringungslogiken sozialer Dienstleistungen nach ökonomischen Mustern in keiner Weise mit einem wie auch immer auf die Überwindung gesellschaftlicher oder im engeren Sinne 191 staatlich induzierter Zwangslagen gerichteten ‚Befreiungsprojekt’ verknüpft. Die beförderte ‚Freiheit’ des Kunden bezeichnet eine ‚Freiheit’, die sich nicht gegen staatliche ‚Herrschaftsformen’ verteidigen muss und die ihrerseits auch nicht gegen diese gerichtet ist. Aus einer ‚Herrschaftsperspektive’ ist sie eine ‚produktive’ und nach den Prämissen von ‚Effektivität’ und ‚Effektivität’ ‚nützliche’ und verwertbare Freiheit. Sie lässt sich selbst als ein Teil einer von den fordistischen Regelmäßigkeiten des Sozialen deutlich unterscheidbaren Steuerungs- und Regulationsrationalität betrachten, in der gerade die ‚freie Selbstbestimmung’ im Sinne einer selbstverantwortlichen ‚Lebensführungsrationalität’ (vgl. Hesse 1994) ‚rationaler’ Akteure als vermittelndes Medium zur Herrschaft implementiert wird. Ein in dieser Form als ‚autonom’ repräsentierter, konstituierter und aktualisierter Akteur, ist wie Voss und Pongaratz (1998: 149 ff) ausführen, dazu gehalten, sich selbst wie ein „herrschaftsausübender Unternehmer“ zu verhalten. Das herrschaftliche Moment besteht in dem Versuch einer „systematische[n] Nutzung und Zurichtung der menschlichen Fähigkeit, sich eigenverantwortlich zu steuern“. Herrschaftsfunktional betrachtet verspricht dies, bis zu einem gewissen Grad, eine Alternative zu dem schwierig legitimierbaren, oft kaum effizienten und bisweilen auch ineffektiven Projekt darzustellen, Handeln durch direkte und indirekte Kontrollinterventionen zu formen. Diese Form der Herrschaftsausübung basiert weniger auf Moralisierung, Normalisierung, Disziplinierung oder einer Anwendungen zwangsbasierter Maßnahmen, auch wenn diese für bestimmte Gruppen oder als nachgeordnete Strategien gleichwohl bestehen bleiben. Im Mittelpunkt steht vielmehr eine eher durch die Arrangements der Kontexte und Gelegenheitsstrukturen aber auch eine - im Zweifel durch die individualisierte Bearbeitung des einzelnen Akteurs erfolgende - Implementation eines entsprechenden durch die handelnden Akteure inkorporierten Habitus. Dieser basiert im Wesentlichen auf zwei ‚freien’ und gleichzeitig (selbst)zwingenden Einsichten: Zum ersten in der Einsicht der Notwendigkeit einer vorsichtigen und eigenverantwortlichen Selbstsorge. Zum zweiten und vor allem der Einsicht in das, ‚was vernünftig ist’ (vgl. Bourdieu 1985), worin eine ‚angemessene’, - d.h. eine rationale, durch die Sorge um sich selbst, das eigene Begehren ebenso wie die Optimierung eigene Zukunft angeleitete und in diesem Sinne moralisch wie instrumentell richtige - Lebensweise bestehen soll (vgl. Krasmann 1999, zur Verbreitung dieses Habitus vgl. Shell-Jugendstudie 2002). Der ‚gute Bürger’ ist dabei weniger das ‚disziplinierte’, gemäß verallgemeinerter Standards ‚normalisierte’ und ‚assimilierte’ Individuum, sondern vor allem der selbstverantwortliche und ebenso vorsichtig wie rational kalkulierende Akteur. Dass damit aber eine pauschale Zurückdrängung staatlicher Macht zugunsten personaler Autonomie im Sinne einer gesteigerten ‚Realfreiheit’ (vgl. van Parijs 1995) impliziert ist, lässt sich durchaus bestreiten. Sofern der nach marktförmigen Mustern verlaufende Umgestaltungsprozess sozialer Dienstleistungen eine zunehmende Verlagerung der Rahmenbedingungen des Erbringungskontextes von einer öffentlichen Allokation der Leistungen in einem öffentlich-rechtlichen Erbringungskontext zu deren öffentlichen und privatwirtschaftlichen Erbringung in einem fiskalisch-privatrechtlichen Rahmen impliziert, ist damit zunächst lediglich beschrieben, dass die direkten Leistungserbringungen zunehmend ‚jenseits des Staates’ erfolgen. Das bedeutet aber weder analytisch-systematisch, noch konzeptionell, noch empirisch, dass Form und Inhalt der erbrachten Leistungen damit einem 192 staatlichen Einfluss und Zugriff entzogen sind (vgl. Nogala 1995). Entscheidend ist das Verhältnis des Staates zu den Organisationen des Erbringeroligopols auf dem Quasi-Markt sozialer Dienstleistungen. Diese stehen weniger in einem Widerspruchs- als in einem (funktionalen) Komplementaritätsverhältnis zum dem sie ‚umstrickenden’ Staat, der sich selbst wiederum immer weniger als direkter und umfassender Durchführer und Versorger von Leistungen und Aufgaben sondern zunehmend als ‚verhandelnder’ ‚unterstützender’, ‚aktivierender’ oder ‚Kernaufgabenstaat’ verstanden wissen will (vgl. Lindenberg 2000c, Evers/Leggewie 1999). Die beschriebenen Verantwortungsverschiebungen sind demnach nicht ex ante als staatlicher Herrschaftsverlust, sondern vor allem als eine Veränderung seiner politischen Steuerungsrationalität zu fassen. Dabei führt eine politische Strategie der responsibilisierenden ‚Privatisierung’ in der Regel nicht dazu, dass sich die (einst) staatlichen Verantwortlichkeiten und die darin angelegten Herrschaftsstrukturen „überkommenen einfach rigiden auflösen. Im Sinne von Regelungsmechanismen Techniken, durch die die darauf zielen Entwicklung die von Selbstregulationsmechanismen“ zu ersetzen (Lemke 1997: 256), tendieren sie eher dazu, den staatlichen Handlungsspielraum und Einflussradius in die gesellschaftlichen Mirkostrukturen hinein auszudehnen und auch gegenüber nicht-staatlichen Akteure zu erweitern (vgl. Garland 1996: 454, Crawford 1999): Der Zentralstaates entledigt sich zwar seiner „Verantwortung, nicht jedoch seiner grundsätzlichen Lenkungskompetenz und -kapazität“ (Legnaro 1998: 277) Wenn ‚Privatisierung’ eine Absonderung von staatlichen Einflusssphären meint (vgl. Nogala 1995), gibt es im Prozess der Ökonomisierung - bzw. Kommodifizierung - personenbezogener sozialer Dienste nicht sonderlich viel ‚Privates’. Mit gleichem Recht lässt sich auch von einer verschleierten ‚Durchstaatlichung’ sprechen (vgl. Hirsch 2002), die sich insbesondere in Form eines kontrakuellen (Neo-)Korporatismus zwischen den (staatlichen) Leistungsgewährleistern und den unterschiedlichen leistungserbringenden Institutionen zeitigt. Dabei findet eine Verknüpfung interventionistischer Aspekte staatlicher Rationalitäten mit den Interessen und dem Kalkül der nach betriebswirtschaftlichen Parametern umorganisierten Erbringer sozialer Dienstleistungen statt. ‚Privatisierung’ und ‚Ökonomisierung’ der Jugendhilfe entspricht somit nicht einem unilinearen Prozess der Rücknahme öffentlicher bzw. staatlicher Regulierungsansprüche, sondern verweist auf eine dynamische Verflechtung und Verwischung der Grenzen von öffentlichen und privaten Regulationssphären (vgl. Stehr 2000). Die sich dabei ergebende Herrschaftsstrategie gegenüber dem Nutzer lässt sich als Teil einer Überführung (national- und lokal)staatlich verantworteter ‚Government’ Strategien in Strategien der ‚Governace’ beschreiben (vgl. Brandt et al. 2000, OECD 2001a, Kooiman 1993, Rhodes 1997). Während der Begriff ‚Government’ – im engeren Sinne der Politikwissenschaft auf den Modus einer Ausübung einer idealtypisch singulären, öffentlichen, kollektiv autorisierten, politischen Macht bzw. (hierarchischer) gesellschaftlicher Kontrolle verweist, und damit, wie es Mary Daly (2003: 114) formuliert, einen tatsächlichen oder vermeintlichen „main agent of collective power in society“ fokussiert, beschreibt ‚Governance’ eine stärker dezentralisierte Pluralität mehr oder weniger rational kalkulierender Versuche Subjektivität zu formen, und eine zu dieser Subjektivität analoge Form der Lebensführung lenkend zu beeinflussen, in denen den Apparaten des Staates nicht 193 mehr eine per se exklusive Stellung unterstellt wird33 (vgl. Newman 2001a, Rhodes 1997, Stenson 2001, siehe auch Mayntz 1992): „People are subjected to government by the state’s array of technologies of government, in which welfare epitomises and realises concerns about populations, their health and longevity, their education and a host of aspects of their conduct. Governance is perpetual because it is about modulating conduct through inculcating a command structure in the constitution of the individual and thereby ,normalising’ society and recreating social solidarity (Daly 2003: 117, vgl. Douglas 1999). Kontrolle und Autonomie verschieben sich im Arrangement der Goverancestrategien in einem gewissen Sinne von binären zu komplementären Begriffen. Die Betonung der hierarchischen Stellung des Kontrollierenden kann dabei aufgegeben werden, ohne dass damit notwendigerweise ein Verlust der Kontrollkapazität verbunden sein muss (vgl. Kikert 1995). Dies wird schlicht dadurch möglich, dass sich der Kontrollbezug von einer direkten Formung des Akteurs zu einer Regulation der Kontextvariablen verschiebt, bzw. von einer Veränderung der ‚Spieler’ zur Betonung ihrer Autonomie in veränderten ‚Spielregeln’34. Walter Kikert (1995: 149, vgl. Kickert/Klijn 1997) beschreibt nicht nur die Möglichkeit, sondern den Zwang solchen Steuerungsformen, die sich vor dem Hintergrund der Repräsentation des Nutzers als Kunden von direkten Anweisungen in die Distanz verlagern, wie folgt: „Assuming that in a network of nearly autonomous actors no coercive steering can be exercised by any actor, steering has to be non-coercive and has to take place by stimulation the various actors to display the collectively desired behaviour of their free will. Central top-down control has to be replaced by a varied system of incentives, which influence the actors and push them directly into particular desired direction. This is steering by ‚incentives’ or behavioural stimuli of a non coercive nature.“ Diese Strategietransformation impliziert nicht in erster Line mehr oder weniger, sondern vor allem eine veränderte Form politischer Herrschaft. In einem primär adaptiven Verhältnis zu nicht-öffentlichen Akteuren zielt sie weniger auf deren direkte Regierung, als auf eine indirekte Regulierung ‚aus der Distanz’ (vgl. Kikert 1995, Garland 2001, Rhodes 1998) durch die Akteure hindurch. Die Selbststeuerungsfunktionen der Individuen und Organisationen werden solange gerade nicht unterdrückt sondern unterstützt und hervorgebracht, wie es gelingt, sie in einer ‚richtig’ zu lenken und zu kanalisieren, dass sie selbst einen synergetischen und produktiven Faktor für die ‚Governance’ Strategien darzustellen, der cetris paribus in ökonomischer wie ideologischer Hinsicht effektiver und effizienter als eine ausschließlich direkt-staatliche Regulierung ist. Die darin angelegte partielle „Governance, […], is seen to imply a network form of control, to refer primarily to a process and to have associated with it diverse agents. The locale and exercise of power are central to governance. When applied empirically, governance is, though, most often used to refer to the changing nature of government and the public sector and how each articulates the distribution of power and control in society. It is especially attuned to a changing set of arrangements wherein there is a possibility that the state may no longer occupy a privileged position” (Daly 2003: 115 f) 34 Die Repräsentation dieser ‚Spieler’ wird durch die Figur des ‚Selbstunternehmers’ ziemlich treffend beschrieben. Dieser‚Selbstunternehmers’ ist sowohl eine programmatisch-politische Figur – als solche hat sie insbesondere in der Rede von der ‚Ich-AG’ Einzug in den politischen Diskurs gehalten – als auch eine analytische Figur, die auf eine bestimmte Form der ‚Regierungs-’ bzw. Herrschaftsrationalität aufmerksam macht. Als eine analytische Figur, hat sie sich insbesondere im Kontext der an Foucault anschließenden ‚Governmentality-Studies’ als fruchtbares Konzept erwiesen. Sie findet sich aber unabhängig von poststrukturalistischen Ansätzen auch explizit bei Max Weber. Weber spricht ebenfalls von Rationalitäten der Lebensführen. Die ökonomische Lebensführungsrationalität – sowie die dazugehörigen ‚Herrschafts-’ bzw. ‚Gehorsamsmotive’ – reflektiert bei Weber weniger die politische Herrschaft „kraft Autorität“, sondern eine davon unterschiedene ökonomische Herrschaft „kraft Interessenkonstellationen“ (Weber 1980: 542). Insofern die Governmentalitätsstudien die Frage nach den Arrangements von Interessekonstellationen als Herrschaftsrationalitäten rekonstruieren, könnte man sie in eine Weber’sche Tradition der Herrschaftsanalyse stellen, die im Kontext der Analysen und Theorien der Sozialen Arbeit erstaunlicherweise sehr wenig verbreitet ist. 33 194 Verschiebung von administrativ-wohlfahrtsstaatlichen Logiken der Regierung ‚des Sozialen’ (vgl. Donzelot 1994, Miller/Rose 1994) zu Lenkungsrationalitäten und -technologien ökonomischer und selbstinteressierter, individueller Subjekts induziert eine Art Dreiteilung der (potenziellen) Adressaten personenbezogener sozialer Dienste: Die Nicht-Nutzer, die sich ‚entschieden’ haben die freiwilligen Angebote nicht (richtig) nachzufragen und folglich die Verantwortung dafür selbst zu tragen haben, die Nutzer, die die ‚richtige Wahl’ in der Annahme der an sie gerichteten freiwilligen Angebote getroffen haben und die sich ‚angemessen’ und ‚produktiv’ an ihrer Erbringung beteiligen und schließlich die Nutzer, bei denen die ‚Freiwilligkeit’ ihre Grenzen hat. Für die ‚berechtigten’, ‚klug kalkulierenden’ und sich ‚angemessen beteiligenden’ Nutzer bedeutet der Abbau traditioneller ‚Governementstrukturen’ die Möglichkeit, sich statt in den kritisierten, potenziell entmündigenden ‚top-down’ Formen der Wohlfahrtsbürokratie, verstärkt in einem partizipativen, kooperativen und konsensualen Erbringungsverhältnis wiederzufinden. Sofern es den Dienstleistungserbringern gelingt, die Nutzer, in Kongruenz zu den performativ-messbaren Kriterien der Organisation, zu einer selbstunternehmerischen und eigenverantwortlich selbstgesteuerten Form der Lebensführung zu ermutigen, unterliegen die Nutzer kaum direkten oder gar ‚zwangsbasierten’ Formen der Kontrolle. Scheitert die Etablierung eines Arrangements der Selbstverantwortung und der flexibel regulierten Autonomie kann jedoch auf ‚traditionelle’ und neue teilweise sehr rigide Technologien zurückgegriffen werden. Relativierungen des ‚Freiwilligkeitsgrundsatzes’, ‚Behandeln unter Zwang’ die Rückkehr zu geschlossenen Heimen etc. verweisen auf eine optional verfügbare ‚harte Hand des Managements’ und eine auch - und sogar durchaus verstärkt - in einem fortgeschritten liberalen Erbringungskontexten bestehende Form der demonstrativen ‚Ausagierung’ staatlicher ‚Souveränität’ (vgl. Foucault 2000, Garland 2001). Völlig unabhängig von der Intrusivität der Interventionen im einzelnen, löst das Kundenkonzept sein emanzipatorisches Versprechen an die Nutzer alleine deswegen nicht bedingungslos ein, weil der privatisierten Verantwortlichkeitszuschreibung für das Gelingen oder Scheitern der Leistungserbringungen an den Nutzer kein äquivalenter (Gestaltungs)Machtzuwachs gegenübersteht: seine symbolische Repräsentation als ‚Kunde’ kann nicht mit dem realen Status der nachfragenden Seite im marktförmigen Cash-Ware Nexus gleichgesetzt werden, da ein Mangel an „Zahlungsfähigkeit und damit auch an jeder zahlungsfähigen Nachfrage“ (Schmidt-Grunert 1998: 18) regelmäßig selbst eine Ursache des Bedarfs an staatlich vermittelter Hilfe darstellt (vgl. Müller 1994, Brumlik 1992). Da der ‚Nutzer’ und der ‚Kostenträger’ der marktförmig erbrachten Dienstleistung Jugendhilfe (in der Regel35) nicht identisch sind, bildet sich für die Dienstleistungserbringer in dem ‚Drei-Seiten-VertragsVerhältnis’ (vgl. Gilbert 2000) mit dem auftraggebenden Finanzierer und dem im direkten Erbringungsverhältnis (ko)produzierendem Nutzer eine widersprüchliche „Nachfrage- und Vergütungsstruktur […aus]: einerseits erscheint sie gegenüber den Dienstleistungs-NehmerInnen als ‚uneigennütziger’ Geber von Dienstleistungen, andererseits gegenüber den Kostenträgern als ‚eigennütziger’ Anbieter und Verkäufer derselben“ (Bauer 1996: 23). 35 Es gibt für die Nutzer kostenpflichtige Leistungen 195 Wenn sich die ‚Kundenorientierung’ aus einer Ableitung der regulativen Kraft des marktförmigen Verhältnisses von Angebot und Nachfrage ergibt, so folgt daraus zwar eine systematische Beachtung der nachfragenden Seite, diese muss sich jedoch nicht notwendigerweise auf den Status des konsumierenden (Ko-)Produzenten in der Erbringungsrealisierung auswirken. Der marktförmigen Fassung einer Dienstleistung ist aber eine Orientierung am nachfragenden Kunden, immanent, und zwar sowohl analytisch-systematisch als auch bei Strafe ihres ökonomischen Untergangs (Marx). Dieser nachfragende Kunde wird jedoch weniger durch den Leistungsadressaten als durch die kostentragende Auftrageberseite repräsentiert. Weil der ökonomischen Parametern folgende ‚QuasiMarkt’ sozialer Dienste (vgl. Taylor-Gooby/Lawson 1993) als Kunden im analytisch engen Sinne ausschließlich den kommunalen Kostenträger (vgl. Schaarschuch 1998: 105) kennt und seine Kontrakte und Vereinbarungen mit diesem ‚Kunden’ schließt, wird die (Kontroll)Macht in der Hand der Administration durch ein marktrationales ‚Kundenkonzept’ nicht herausgefordert. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Administration als Geldgeber, die Leistungserbring vor allem fiskalisch steuert. Wenn das Steuerungsmedium Recht nur durch das Medium Geld ersetzt wird, bleibt die im fachlichen Dienstleitungsdiskurs als die wesentliche Kritik der Wohlfahrtsbürokratie zum Anschlag gebrachte Dominanz institutioneller bzw. ‚systemischer’ Imperative gegenüber den von den ‚Subjekten’ artikulierten Interessen und Bedürfnissen in lediglich formveränderter Gestalt bestehen. Zwar kann sich dabei eine ‚win-win’ Konstellation auf der ‚nachfragenden Seite’ im Sinne einer Art ‚Koalition’ von Adressaten und kostentragender Auftraggeberseite in den Fällen ergeben, in denen eine Interessengleichheit von Kostenträger und Nutzer unterstellt werden kann36, im Falle divergierender Interessen - und dabei insbesondere dann, wenn die Interessen des Staates „darauf gerichtet sind die Inanspruchnahme sozialer Leistungen zu verhindern oder einzugrenzen“ (Trube/Wohlfahrt 2000: 3) - bleibt aber das „Interesse der persönlichen NutzerInnen an einer optimalen Versorgung mit sozialen Dienstleistungen […] notwendigerweise auf der Strecke“ (Bauer 1996: 37). Die leistungserbringenden Institutionen sind in diesem Kontext nicht nur aufgrund ihrer ‚Kundenorientierung’, sondern sofern sie einer Marktlogik folgen - die sich vor dem Hintergrund von Budgetierungen als ökonomisches ‚Minimalmodell’ darstellt –, weil sie nicht ‚produktiv’ im engeren Sinne - d.h. nicht direkt (mehr)wertschöpfend - sondern ‚revenuenverschlingend’ sind37, praxislogisch dazu gehalten ihren ‚faux frais de production’ möglichst gering zu halten. Das bedeutet aus der Perspektive der leistungserbringenden Institutionen ihre Leistungen und Aufwendungen nicht über das mit dem Auftraggeber vereinbarte und bezahlte Minimum hinausgehen zu lassen. Während die Frage des ‚effektiven’ Einsatzes der ihm zur Verfügung gestellten Mittel im Interesse des markförmig Eine solche Allianz zwischen Staat und Nutzer, die sich formuliert als ‚Steigerung der Nachfragemacht’ ja gegenüber der Jugendhilfe artikulieren würde, ist vom Selbstverständnis der Sozialen Arbeit – der Tendenz eher als Allianz der sozialen Arbeit und ihrer Nutzer gegenüber staatlichen Zumutungen - so himmelweit entfernt, dass sich diese Möglichkeit im Diskurs der Sozialen Arbeit faktisch nicht formuliert wird. 37 Personenbezogene soziale Dienstleistung können darüber hinaus in einem gewissen Sinne als bewusst nicht markförmige Güter betrachtet werden, die den Charakter eines ‚Quasi-Kollektivgutes’ annehmen, sofern sie als Teil jener, wie Claus Offe (1972: 54 f) formuliert, „Gesamtheit der für das Verwertungssystem unverzichtbaren, aber nicht-rentablen und auch durch anderweitige gesellschaftliche Mechanismen (z.B. das Familiensystem) nicht zu erbringenden Güter und Leistungen“ betrachtet werden. 36 196 agierenden Dienstleistungserbringers liegt, ergibt sich für den Auftraggeber die „relative Qualität sozialer Dienstleistungen […] aus der Tatsache ihrer kostengünstigen und wirtschaftlichen Erbringung“ (Bauer 1996: 30). Die Entwicklung der Sozialgesetzgebung, mit einer faktischen Gleichstellung der traditionell privilegierten Wohlfahrtsverbände mit kommerziellen Anbietern (vgl. Merten/Olk 1999: 975) verschärft diese Tendenz - nicht weil einige Anbieter als ‚For-Profit Organisationen’ auftreten, sondern weil unterschiedliche Organisationen als konkurrierende Akteure im Wettbewerb der Wohlfahrtsproduktion auftreten. Sofern sich dabei eine freie Marktlogik durchsetzt, die nicht durch die Herausbildung von Monopol- oder kooperierenden Oligopolstellen der leistungserbringenden Organisationen ad absurdum geführt wird, bedeutet dies, dass jenes Angebot, das sich – gleich on nun von profit- oder gemeinwohlorientierten Institutionen erbracht wird - beim ‚contracting out’ als das kostengünstigste erweist, bzw. das aus der Perspektive der Kostenträger das beste PreisLeistungsverhältnis beinhaltet, den Zuschlag erhält. Damit sind die leistungserbringenden Institutionen gezwungen scharf zu kalkulieren und eben keine ‚unbezahlten’ Zusatzleistungen, bzw. keine Leistungen zu erbringen die qualitativ höher einzuschätzen sind, als dies vertraglich festgelegt ist. Da es darüber hinaus im Erbringungskontext Markt für Anbieter, die privat-gewerblichen Rationalitäten operieren rational wäre, ihre Angebote auf möglichst attraktive d.h. gewinnversprechende Aufgaben bzw. Kunden auszurichten, bleiben weniger lukrative Aufgaben den öffentlichen Trägern überlassen was eine „Spaltung des Wohlfahrtsstaates in Leistungssegmente unterschiedlicher Niveaus“ impliziert (Butterwegge 1999: 110). Wenn sich der Wert bzw. der ‚Output’ der erbrachten Leistungen der Jugendhilfe über den Markt bzw. über Kosten-Nutzen-Analysen bestimmt (vgl. Sommerfeld/Koditek 1994), lässt sich dies aber nicht durch eine forcierte Orientierung an den unter Umständen abweichenden Wünschen, Bedürfnissen Erwartungen, etc. der Nutzer im direkten Erbringungsverhältnis sichern, sondern vielmehr durch eine umfassende Standardisierung und eine Konzentration auf die Dimensionen der Steuerung gewährleisten. Dies hat zur Folge, dass die Primärprozesse auf der Ebene Leistungserbringung der Tendenz nach aus dem Blick geraten (vgl. Lenk 2000) und eine durch „autocratic managerial styles“ gekennzeichnete Form der Leistungsverwaltung befördert wird „with devolution of responsibility to subordinates, while policy making and fiscal control remain tightly in the grip of senior managers” (Stenson/Factor 1995: 174, vgl. Clarke et al. 1994). Die Frage von ‚Effektivität’ ist das entscheidende Kriterium eines solchen ‚managerialistischen’ Führungsstils im Erbringungskontext ‚Markt’ (vgl. Harris 1998). Unter Managerialismus kann die Umgestaltung innerorganisatorischer Strukturen und Handlungsabläufe auf der Basis folgender Präsuppositionen verstanden werden: „[-] [-] Handlungskoordinierung auf der Basis präziser Zielformulierungen und Aufgaben ist rationaler als Handlungskoordinierung auf der Basis von Wissen, abstrakten Regeln (auch Ethiken) und Aushandlungssystemen. […] Ergebniskontrolle auf der Basis objektiver quantifizierbarer Parameter ist rationaler als Ergebniskontrolle auf der Basis kommunikativer Abstimmungs- und Rückkopplungsprozesse“ (Otto/Schnurr 2000: 7). Wenn Effektivität die Optimierung des messbaren Verhältnisses von Input und Output der Leistungserbringung darstellt, so ist es erforderlich, beide Variablen vorab zu definieren. Dies gilt insbesondere im Kontext einer an Output-Kriterien ausgerichteten, kontraktförmig geregelten 197 Beauftragung freier Träger zur Durchführung von Dienstleistungen durch den öffentlichen ‚Kostenträger’38. Outputs d.h. prozessuale Ergebnisse der Leistungserbringung bzw. Outcomes d.h. aus dem Output resultierende Wirkungen, sollen dabei möglicht genau beschriebene Zielvariablen der Interventionen der Jugendhilfe darstellen, auf deren Basis transparente und überprüfbare Standards ausgewiesen und sichergestellt werden können (vgl. MFJFG-NRW 1999, Schumann et al. 1998). Der ‚Input’ als Intervention der Jugendhilfe wäre demnach möglichst so zu gestalten, dass er am effektivsten genau jene Zielvariable erreicht. Da der Nutzen Sozialer Arbeit in ihren Wirkungen gesehen wird, gilt das Erreichen dieser Wirkungen als der zentrale Prüfstein der ‚Qualität’ von Dienstleistungen überhaupt (vgl. Kaufmann 1977, Piel 1996). Dies gilt zwar für die Soziale Arbeit zunächst allgemein und insbesondere auch mit Blick auf das Interesse der Adressaten am ‚Gebrauchswert’ der Leistung (vgl. Schaarschuch 1996, 1998, 1999) - als dem Beitrag zur Lösung bzw. Bewältigung der in den jeweiligen Lebenskontexten der Adressaten virulenten positionaldispositionalen Problemlagen - bekommt jedoch im Kontext eines durch die markt- und wettbewerbsorientierten Mechanismen der Neuen Steuerungsmodelle forcierten ‚Kontraktualismus’ (vgl. Clarke/Newman 1997) bzw. ‚Managerialismus’ (vgl. Harris 1996) eine andere, spezifische Konnotation (vgl. Kessl 2001c, Kessl/Otto 2002, Otto/Schnurr 2000). Die ‚Ergebnisqualität’ im Sinne des Erreichens kontraktuell vereinbarerer Wirkungen würde auf Seiten der leistungserbringenden Organisation implizieren, dass neben der Frage der Kosten die im wesentlichen technische Frage ‚what works?’ das entscheidende Kriterium für die Auswahl einer Maßnahme darstellt. Die entscheidende Neuerung liegt nun nicht darin, dass sich Maßnahmen nicht aus sich selbst heraus begründen, sondern sich ihr Sinn unbestrittenermaßen nur aus ihren Wirkungen ergeben kann, sondern darin, dass sich diese Wirkungen im Kontext der manageriellen Prämissen des Kontraktualismus auf das definierte, in aller Regel proximale, kurzfristig erreichbare, an technischzählbaren Indikatoren bemessene Ziel bezieht, dessen Bestimmung - da generellen Entscheidungsbefugnisse gerade auch im Kontext Neuer Steuerungsmodelle wie vor ‚top-down’ strukturiert sind - nahezu ausschließlich in der Verfügungsgewalt des administrativen Managements liegt (dazu: Flösser 2000, Muetzelfeld 2000, van der Laan 2000). Sozialpädagogische ‚Professionalität’ erschöpft sich dabei in der Fähigkeit der mechanischen Umsetzung, der im ‚Idealfall’ durch Wirkungsforschung ermittelten Indikatoren und Parameter aus dem statisch-statistischen Bereich des Messbaren. Sozialpädagogen, so lässt sich im Anschluss an Stephen Ball sagen, werden nicht mehr ermutigt professionelle, politische, ethische etc. „Begründungen für ihr Handeln in der Praxis zu entwickeln, sondern sollen messbare outputs produzieren. Wichtig ist, what works, was funktioniert39“ (Ball 2002: 97), 38 Genau hierauf zielt die ‚Neue Steuerung’ im Kern, wenn sie mittels ‚Privatisierung’, verstärktem Wettbewerb ‚OutputSteuerung’ und einer korrespondierenden Form des ‚Qualitätsmanagements’ – ein Begriff der diskursiv an die Stelle von Begriffen wie etwa ‚fachliche Standards’ oder ‚Handlungsmaxime’ gerückt ist (vgl. Merchel 2000) - darauf gerichtet ist, eine effiziente und effektive Praxis der Jugendhilfe hervorbringen hervorzubringen. Dabei wird der „Nachweis von Qualität und Wirksamkeit zu einer zentralen Frage bei der Aufrechterhaltung der ökonomischen Grundlagen von Einrichtungen der Sozialen Arbeit [… und] zu einem Wettbewerbsfaktor zwischen Einrichtungen“ (Merchel 1999: 11). 39 Wenn sich die ‚Werte’ des (Quasi-)Marktes im Spannungsfeld von Wettbewerb und institutionellen Interessen bewegen, so lautet der zentrale ‚ethische Wert’ des Managerialismus im wesentlichen ‚what works’ (vgl. Ball 2002). 198 Damit, und nicht etwa durch die Tatsache selbst, dass sich der Sinn sozialer Interventionen an ihren Wirkungen bemisst, ist eine entscheidende Veränderung der Denk- und Handlungsrationalitäten in den Prozessen der Erbringung sozialer Dienstleistungen durch die Jugendhilfe impliziert. Im sozialen Liberalismus des keynesianischen Wohlfahrtsstaats sind die in ‚das Sozialen’ eingebundenen Programme und Strategien eng mit dem, wie es O’Malley (2001: 16) formuliert, ‚esoterischen Wissen’ der positiven Wissenschaften menschlicher Führung verknüpft. Die durch die überlegene ‚Fachautorität’ der Professionellen begründeten Arrangements von Techniken und Technologien der Führung verlieren im Kontext der skizzierten Veränderungsprozesse an Bedeutung: „Advanced liberalism has transferred its allegiance instead to an array of calculative and more abstract technologies, including budget disciplines, audit and accountancy. These require professionals and experts to translate their esoteric knowledge into a language of costs and benefits that can be given an accounting value, and made, transparent’ to scrutiny. In the form of marketisation, the authority of experts is determined not by their own professional criteria, but by the play of the market” (O’Malley 2001: 16, dazu auch Sommerfeld/Haller 2003). Eine zentrale Basis für die handlungslogische Implementation dieser Form der Output-Orientierung in der Jugendhilfe - vor allem bei ‚Outsorcing’ Entscheidungen in den ‚make or buy decisions’ (vgl. Reitan 1998) – stellt die Trennung der leistungserbringenden und der leistungsfinanzierenden Seite, der sogenannte ‚purchaser-provider split’ (vgl. Muetzelfeldt 1992) in der neu gesteuerten Jugendhilfe dar: [„The purchaser-provider split] centralises decision making and control in the principal as purchaser of services, and delegates or distributes implementation and responsibility to the agent as provider. This centralises strategic control while decentralising tactical responsibility” (Muetzelfeldt 2001: 4, vgl. Clarke et al. 2000, Muetzelfeldt 1992). Eine Kontrolle über die Höhe der Kosten, gelingt für die finanzierende Seite nicht nur dadurch, dass idealtypisch nach Möglichkeit der preiswerteste und gleichzeitig nach vereinbarten Standards effektivste und effizienteste Anbieter den Zuschlag erhält, sondern auch dadurch, dass der Prozess der Ermittlung und Bestimmung des Bedarfs der Nutzer von der Versorgung mit bzw. der Erbringung von Leistungen abgekoppelt wird (vgl. Ellis et al. 1999). Die Bestimmung des Bedarfs - und darauf basierend der angemessenen Maßnahme - bleibt gemäß eines Marktmodells letztlich eine Angelegenheit des ‚zahlenden Kunden’ (purchaser). Im dem auch in dieser Hinsicht am weitesten fortgeschrittenen anglophonen Sprachraum, führte dies zu einer neuen Rollenbeschreibung der durchführenden Ebene - Jordan und Jordan (2000) sprechen von einem ‚arm’s length service’ - die durch die Festlegung verbindlicher Qualitätsstandards der Leistungserbringung eher zusätzlich forciert als entschärft wurde. Die Maxime der Leistungserbringung in der Soziale Arbeit entwickelten sich entsprechend hin zu „heavily prescribed assessments and case management, in which ‚needs talk’ and ‚service talk’ do not necessarily add up […]. Social work tasks increasingly came to have an administrative and technical character rather than a professional one“(Kemshall 2002: 77, vgl. Cheetham 1993). Im Vergleich zu anderen europäischen Nationen ist der ‚neue Managerialismus’ sowie ihm korrespondierende (post-professionelle) Leistungserbringungsmodelle, die etwa als ‚knowlegde’, ‚intelligence’ oder ‚evidence based practice’ bezeichnet werden, in Großbritannien am weitesten fortgeschritten (vgl. u.a. Davis et al. 2000, Corcoran 2000, Sheldon 2000, Macdonald 2002, Chapman/Hough 1998). Die Kernelemente der Bedingungen, die eine Durchsetzung der Strategien einer solchen ‚beweisbasierten Praxis’ ermöglichen, finden sich aber auch in der Bundesrepublik, im 199 Sinne einer - insbesondere im Kontext einer ‚wirkungsorientierten Steuerung’ der Sozialen Arbeit (vgl. BMFSFJ 2002, KGSt 2001, Schröder/Kettiger 2001) forcierten - Betonung von performativen Kriterien und Versuchen der Messung der Effizienz und Effektivität. Etabliert werden soll eine „outputorientierte Steuerung“ in der „die Planung, Durchführung und Kontrolle des Verwaltungshandelns […] strikt an den beabsichtigten und tatsächlichen Ergebnissen auszurichten“ ist (KGSt 1994: 7). Auch jenseits solcher Forderungen der KGSt ist die Relevanz von in der Praxis benenn- und evaluierbaren Leistungsbeschreibungen, die die Basis für alle weiteren Qualitätsentwicklungs- ebenso wie von den Leistungsvereinbarungen sein sollen, im fachlichen Diskurs weitgehend unbestritten, wobei die „Qualitätsentwicklungsvereinbarungen [...] eine Optimierung (Effektivität + Effizienz) der Hilfen zur Erziehung zum Ziel haben“ (AFET 2001). In dieser Hinsicht ist die Überprüfung und Ausrichtung der sozialpädagogischer Praxis an zwei Fragen zentral: das Cost-Benefit und das Cost-Effectiveness Verhältnis, d.h. die „Frage, ob und in welchem Umfang die mit den jeweiligen Aktivitäten […] angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden konnten (Kontrolle der Effektivität durch Evaluation) […und] die Beantwortung der Frage, welcher Aufwand hierfür im einzelnen betrieben wurde (Kontrolle der Effizienz durch Evaluation)“ (Baumgärtner 2002: 605) György Széll (1997:6) beschreibt einen sich damit entwickelnden Common Sense wie folgt: „Mag früher häufig die sozialpädagogische Praxis durch ‚Trial-and-error’-Verfahren bestimmt gewesen sein, so besteht zunehmend das Bedürfnis, aber auch die Notwendigkeit nach einer Kontrolle dieser Praxis anhand von Kriterien. Dabei steht die Frage nach Effektivität und Effizienz dieses Handelns im Vordergrund. Diese Kriterien, die aus der Privatwirtschaft stammen, bestimmen zunehmend das Handeln im gesamten öffentlichen Dienst“. Im Sinne einer Output-Steuerung sollen die Ergebnisse als Maßstab eines ‚Erfolgscontrollings’ dienen (vgl. Banner 1991), während die Umsetzung auf der Basis von fachlichen wie Finanzzielsetzungen in dezentralen Fachbereichen, als weitgehend autonome operierende Einheiten geschehen soll. Bedeutsamkeit „zur Fundierung und Kontrolle von Entscheidungen“ erlangen solche ControllingVerfahren nur über „Vergleiche und über die nach einer Summierung von Einzelleistungen erfolgende einheitliche Bewertung und deren Beurteilung im Hinblick auf die Leistungswirkung (Outcome)“ (Reiss 2001: 231). Damit ist eine Form des ‚Performance-Managements’ beschrieben, in dem unter Marktbedingungen, der kosteneffektivsten Methode zur Realisierung spezifisch definierter Ergebniserwartungen der ein Vorzug eingeräumt wird. Die Ergebniskontrolle nach quantitativen Parametern, benötigt spezifische Standardisierungs- und Normierungsverfahren die sich darin äußern, die Ziele möglichst ‚S.M.A.R.T.’ – „specific, measurable, attainable, relevant, timed“ – zu gestalten (BMFSFJ 1999: 44). Wie das BMFSFJ (1999a: 28) in seinem Leitfaden zur Zielfindung und Zielklärung in der Jugendhilfe erläutert, liegt „der Nutzen der Arbeit mit Zielformulierungen [zu arbeiten…] darin: Klarheit zu gewinnen, Effektivität zu sichern, Effizienz zu steigern [und] Evaluation, Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung zu ermöglichen“. Soweit ein - vor allem von der KGSt vertretener - produktbezogener Steuerungsansatz, darauf zielt alles, was keinen Produktbezug hat zu eliminieren (vgl. Wohlfahrt/Dahme 2002a), basiert der ‚neue Managerialismus’ auf neodiagnostischen - und mit Bezug auf die Nutzer risikokalkulatorische – Techniken, wie etwa denen des ‚Profilings’ und ‚Assesments’, um entsprechend klar definierte Produktbeschreibungen zu liefern und diese schließlich auch Evaluationszwecken zuführen zu können. Insbesondere die Dachverbände, überregionalen Träger und großen Einrichtungen, so Maja Heiner 200 (2001: 491, 485), können „auf empirische Nachweise ihrer Qualität, Effektivität und Effizienz nicht mehr verzichten“ da von „der staatlichen Verwaltung allgemein und vom sozialen Sektor insbesondere [...zunehmend] der Nachweis einer effektiven und effizienten Arbeitsweise“ nach Maßgabe eindeutig festgelegter Leistungs- bzw. Produktbeschreibungen (KGSt 1994) erwartet wird. Eine am, so bestimmten, Kriterium der Effektivität ausgerichtete Soziale Arbeit misst sich demnach lediglich daran „welche Ziele sie tatsächlich erreicht hat, was sie bei ihren Klientinnen und Klienten bezüglich der Problemlösung bewirkt hat und nicht daran, welche guten Intentionen, Werte und Normen sie hat oder hatte“ (Kleve 2001: 32) und selbst die „Erklärungen, warum Projekte (nicht) erfolgreich sind oder waren“ (Heiner 2001: 485) tritt letztlich in den Hintergrund. Die Frage von Effektivität in marktorientierten bzw. marktförmig gestalteten Dienstleistungen beruht demnach auf einer denkbar einfachen ‚Philosophie’: Richtig ist, was einen gegeben ‚Ist-Zustand’ möglicht effektiv und effizient in einen klar definierten ‚Soll-Zustand’ überführt - „What counts is what works“ (Newman 2001). Im Kontext dieser Logik kann es dann auch nicht verwundern, dass, wie Suzy Croft und Peter Beresford (2002: 387, vgl. Williams et al. 1999) ausführen, „the role of service users in evaluating social work effectiveness is […] mainly [seen], as one of providing information rather than helping to define or to measure effectiveness. [… Thus clients are mainly of interest] as a data source for researcher”. Als eine solche Datenquellen sind sie – wenn auch eher in ihrer Gesamtheit denn als Einzelfall – vor allem deshalb notwenig, weil die ‚What Works’ Logik in einer Weise operiert, die auf spezifischen, von der traditionellen, professionellen Rationalität Sozialer Arbeit unterscheidbaren Wissenskategorien beruht. Auf der Ebene der Generierung dieses Wissens finden sich in diesem Zusammenhang zunehmend neuen Muster und Modi der Wissensproduktion (vgl. U.Otto 2002), die sich in Form eines sukzessiven Relevanzverlusts auf jenen Macht-Wissen-Komplex des sozialen Interventionsstaats auswirkt, der eine professionelle und gesellschaftstheoretisch informierte Form der Sozialen Arbeit ermöglicht und erfordert hat. Gefordert ist stattdessen die allgemeinen, ideologielastigen, wohlgemeinten, nebulösen etc. Vorstellungen, aus denen sich die Maßnahmen Jugendhilfe (scheinbar) bisher speisten, abzulösen durch Wissensformen, die eine ‚genaue Analyse’ und Diagnostik der ‚Ist- Situation’ und die Formulierung klar beschriebener, erreichbarer, und messbarer ‚operativer Ziele’ erlaubt (vgl. BMFSFJ 1999: 43). Wie Maja Heiner (2001a: 10) ausführt, geht es entsprechend zunehmend um die Produktion von Wissensform die „primär auf die Bearbeitung von Handlungsproblemen und erst sekundär auf Erkenntnisprobleme […zielen und] nach rasch verfügbaren Erkenntnissen zur Beantwortung aktuell drängender Fragen“ suchen40. Dieses Wissen soll in die sozialpädagogische Praxis nicht nur ‚implementiert’ werden. Vielmehr dient es zur Etablierung elaborierter und ausdifferenzierter Screening-, Indikations-, Diagnose-, und Assessmentverfahren zur Bestimmung des ‚Ist-Zustandes’ der Adressaten und als Basis für die Entwicklung wirkungsspezifischer Handlungsprogramme, die als Anweisungen zur effektiven und effizienten Erzeugung des definierten ‚Soll-Zustands’ dienen sollen. Die Ausrichtung der Praxis an diesem Wissen erscheint zuverlässiger, Von diesem Wissensproduktionsmodus grenzt Maja Heiner (2001: 10), die ‚traditionellen’ Modus der akademischen Wissensproduktion ab: „Er zielt primär auf die Bearbeitung von Erkenntnisproblemen und erst sekundär auf Handlungsprobleme, [er] ist disziplinär organisiert [und er] sucht nach langfristigen Erkenntnissen“. 40 201 vertrauenswürdiger, berechenbarer und einfacher zu dokumentieren sowie der ‚Rechenschaftspflicht’ (accountability) der Leistungserbringer zuordnen, als das (quasi-hermeneutische) Ermessen und die je fallbezogene Einschätzung der Professionellen. Insbesondere die auf Basis professionstheoretischer Überlegungen entworfene Idealfigur eines gesellschaftlich wie wissenschaftlich reflektierten Professionellen (vgl. Dewe/Otto 2001, siehe auch Thiersch 1992) verliert dabei nicht nur aufgrund managerialistischer Führungsstile auf der Ebene der Organisation (vgl. Harris 1996, Meinhold 1998, Otto/Schnurr 2000), sondern vor allem auch durch die Entwicklung eines ‚neuen’, hierzu passenden und die ‚alte’ ‚professionelle Ideologie’ (vgl. Cullen/Gendreau 2001) ablösenden, ‚Macht-WissenKomplexes’ substanziell an Bedeutung. In dieser Hinsicht lässt sich davon sprechen, dass mit dem Einzug mangerialistischer Rationalitäten keinesfalls ‚nur’ eine Reform der Organisation oder eine weitere Rationalisierung der Bürokratie im Weber’schen Sinne vorangetrieben wird, sondern sich die Kontur einer neuen Herrschafts- und Regulationstechnologie gegenüber den Nutzern aus ausbildet. Dies liegt darin begründet, dass die Implementation einer manageriellen ‚What Works’ Logik auf der Ebene der Planung, Gestaltung und Erbringung sozialer Interventionen sehr spezifische und voraussetzungsvolle Operationen verlangt. Geht man davon aus, dass ‚pawlowsche Modelle’ (vgl. Bourdieu 1985b), die die sozialen Akteur als bloße ‚Reaktionsdeppen’ fassen (vgl. von Trotha 1979), nicht nur unhaltbar, sondern gerade im Erbringungskontext einer fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation unbrauchbar sind, kann das für personenbezogene soziale Dienstleistungen charakteristische ‚Technologiedefizit’ (vgl. Luhmann/Schnorr 1979) - nach dem es, pointiert formuliert, der Sozialen Arbeit nicht gelingen kann, den Nachweis zu erbringen, dass ein Vorgehen A tatsächlich die Folge B hat - bezogen auf das einzelne Individuen nicht suspendiert werden. Diese Unsuspendierbarkeit gilt auch mit Blick auf die Interventionsrationalitäten nach Maßgabe managerialistischer Steuerungsmodelle. Nichtsdestoweniger gibt es Möglichkeiten, die ‚Nicht-Normierbarkeit’ – und die damit verbundene ‚Nicht-Optimierbarkeit’ - (vgl. Offe 1983) sozialer Dienste, bzw. die aufgrund unklarer Bedarfs- und Nutzenkalküle (vgl. Olk/Otto 1987) durch Ungewissheit gekennzeichneten Entscheidungsprämissen41, mittels der Rationalitäten einer wesentlich stärker auf da ‚beweisbasierte’ Wirkungen fokussierten Praxisformen zu relativieren. Dies ist durch Interventionsformen möglich, die versprechen die gewünschten Wirkungen zu erzielen, ohne Bezug auf den Einzelnen als prädiktorisch nicht kalkulierbare ‚black box’ (vgl. Bourdieu 1985b: 336) zu nehmen. Dies kann durch die Nutzung von Formen der Wissensgenerierung und (Handlungs-)Technologien geschehen, bei denen es weniger um den konkreten Erfolg im Fall des Einzelnen - und damit auch nicht um Fragen des professionellen Fallverstehens - geht, sondern um die statistische Effizienz standardisierter und weitgehend reliabler Maßnahmeschritte gegenüber ganzen Kohorten. Was nämlich im Einzelfall als eine „durch das Zusammentreffen ganz höchstpersönlicher Umstände gekennzeichnete Struktur“ erscheint, erweist sich „bei der Analyse aggregierter Daten häufig recht überraschend als gleichsam ‚normaler’ Teil eines sozialen Musters [oder] einer sozialen Regelmäßigkeit“ (Scheerer 2001: 156). Der Einzelne als ein 41 Die, wie Marquard et al. (1993) ausführen einer Selbstkonstitution der professionellen Identität der Sozialpädagogen als – ‚gute’ – Helfer den Weg bereiten. 202 unberechenbares, ‚autonomes Subjekt’ mit ‚freiem Willen’42 ist unter diesen Bedingungen eine sehr mäßig relevante Variable43. In diesem Kontext verweist belgische ‚Moralstatistiker’ Adolphe Quetelet bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die ‚grundlegende Tatsache’, dass „die Willensfreiheit des Menschen verblasst und schließlich keine erkennbaren Wirkungen mehr zeitigt, wenn die Beobachtungen sich auf eine große Zahl von Einzelpersonen erstrecken“ (zit. nach Scheerer 2001: 156). Eine Orientierung an größtmöglicher statistischer Effizienz und Effektivität kann mithin die ‚Subjektivität’ eines einzelnen Akteurs ‚heraus-designen’, da sie sich im Kern auf ein Management bzw. die Regulierung von Gruppen Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder bezieht44 Kohorten (vgl. auf der Duchêne/Wanner Basis 1999): populationsstatistischer Eine prädiktorische Berechnung von Effizienz und Effektivität wird möglich. Diese Form der manageriellen - in einem gewissen Sinne kalkulatorischen Überlegungen, wie sie von der Versicherungswirtschaft her bekannt sind bekannt sind folgende (vgl. Cohen 1985, Simon/Feeley 1992) - Kontrolle und Herrschaftsausübung basiert auf der Einsicht, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer bestimmten Strategie für denen einzelnen Fall zwar rekonstruiert werden kann, aber individualprognostisch kaum vorhersagbar ist (‚Technologiedefizit’). Demgegenüber kann die Erfolgswahrscheinlichkeit einer bestimmten Strategie mittels Indikatoren in bezug auf aggregierte (Teil)Populationen statistisch gemessen und auf dieser Basis eine reliablen Aussage über die Effizienz und Effektivität dieser Strategie getätigt werden. In einer standardisierten - ‚S.M.A.R.T.en’ - Form sind diese technologischen Erfolgsbehauptungen, wenn sie auf genügend große auf der Basis spezifischer Faktoren45 ‚geclusterte’ Gruppen bezogen werden, auch in einem prediktorischen Sinne nicht nur aussagekräftig, sondern mit einer ‚quasi-mathematischen’ Genauigkeit zu bestimmen. Eine managerialistische, auf - ‚nachgewiesen’ effizienten und effektiven - performativen ‚Outcome’Indikatoren basierte Form der Steuerung kann, pointiert formuliert, als eine Art fortgeschritten liberale und in die Logik der Sozialverwaltung implementierte Umsetzung einer Herrschaftsweise betrachtet werden, die auf eine Verschiebung zwischen den beiden Polen jener modernen, sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelnden Machtform verweist, die Michel Foucault als (1983) ‚Biomacht’ analysiert: Vom Pol Disziplinierung des Individualkörpers zur Regulation von Populationen. Im Zentrum seht weniger die Formung des einzelnen Individuums, sondern die Lenkung und Regulierung einer aggregierten Gesamtheit oder bestimmter Teile dieser Gesamtheit. Wird eine solche Dieser ist übrigens nicht nur ein ‚Produkt’ der Aufklärung (man denke an Kants ‚Selbstdetermination’ der praktischen Vernunft) sondern ein Kerngehalt jüdisch-christistlischer Kultur überhaupt (so etwa der ‚Schöpfungsauftrag’ in Gen 1, 29). Ausführlich und explizit wird dies beispielsweise in Augustinus ‚De libero arbitrio’ (,Vom freien Willen’) und überhaupt in der Scholastik insbesondere in der ‚Summe Theologica’ von Thomas von Aquin (‚dominium sui actus’)diskutiert (umfassend: Wildfeuer 2002). 43 Wie Wittgenstein (1989) radikalisiert besteht für den einzelnen nicht nur Unvorhersagbarkeit, sondern – ein epistemologischer Indeterminismus gesetzt – es lässt sich mit Blick auf den freien Willen davon sprechen, dass dieser auf für den Akteur darin bestünde dass „künftige Handlungen jetzt nicht gewusst werden können“. 44 Hierin besteht ein zentraler Unterschied zur ‚klassischen’ sozialpädagogischen Diagnostik (vgl. Ziegler 2003). „Der Bezugspunkt der klassischen Diagnostik“, so Merkens (2002: 25), „ist immer das Individuum, während der Bezugspunkt der Evaluation in der Organisation oder einem Programm gesehen werden kann, d.h. im letzteren Fall ist der Bezugspunkt überindividuell“. 45 So hat etwa das Bayerische Landesjugendamt (vgl. 2001) inzwischen einen Diagnosekataloge zum Zweck der Informationssammlung mit 221 Merkmalen sprich Faktoren erstellt, auf dessen Basis denen die Fachkräfte Ressourcen und Risiken ihrer Nutzer abschätzen und sie daraufhin entsprechenden Maßnahmen zuführen sollen. 42 203 managerialistische Herrschaftsform der Leistungserbringung auf die Jugendhilfe bezogen wird, ist damit nicht nur auf der Ebene der Organisation der Verwaltungsabläufe, sondern auch mit Bezug auf die praktische Arbeit „eine Situation […geschaffen], in der professionelles Ermessen subordiniert wird unter die manageriellen Definitionen dessen ‚what works’ und Praxismaterialien folgt, die von extern evaluierten Methoden abgeleitet sind“ (Harris/Kirk 2000: 135, vgl. Brodkin 2000, Hoggett 1996, Jordan/Jordan 2000).Diese Form der effizienz- und effektivitätsbezogenen Standardisierung – die, wie vor allem Chris Pollit (1990) nachzeichnet deutliche Züge dessen trägt, was im Industriekapitalismus als tayloristische Arbeitsteilung implementiert worden war - ist per se jedoch keinesfalls ‚unflexibel’. Im Gegenteil ist es möglich, je flexibel bezogen auf eine bestimmte diagnostisch klassifizierte Kohorte von Nutzern als ‚Ist-Situation’, eine im statisch-statistischen Sinne beweisbasierte, aus managerieller Perspektive effektive und effiziente, verbindliche Modellvorlage einer auf (statistischen) ‚Beweisen’ oder Vergleichen basierte ‚best practice’ zu entwickeln46. Diese, so wird im Online-Verwaltungslexikon ausgeführt, „systematisiert bereits vorhandene Erfahrungen, vergleicht unterschiedliche Lösungen, die in der Praxis eingesetzt werden, bewertet sie anhand betrieblicher Ziele, und legt auf dieser Grundlage fest, welche Gestaltungen und Verhaltensweisen am besten zur Zielerreichung beitragen. Wichtige Elemente sind also: der Verzicht auf den Versuch, das Rad neu zu erfinden, die beste Lösung unbedingt selbst zu entwickeln, statt dessen der Blick über den Zaun, allerdings systematisch und orientiert an klaren Kriterien für die Bewertung; Praxisorientierung, d.h. keine theoretischen Konzepte sind gefragt, sondern nachweisbar erfolgreiche Praxis“. Dabei basiert die das ‚best practice’- Modell auf einer vergleichenden Bewertung (‚Benchmarking’) unterschiedlicher Lösungen in der Praxis und richtet sich darauf, jene Lösung herauszuarbeiten, die am besten – d.h. im je optimalen Verhältnis von ökonomischen, Effektivitäts- und, Effizienzkriterien zur Erreichung eines definierten ‚operationalen’ Ziels beiträgt. In fortgeschrittenen - vor allem im angelsächsischen Sprachraum verbreiteten - Formen des ‚Benechmarking’ steht die Eruierung flexibler, praktisch adaptierbarer Vorlagen im Mittelpunkt als ein „way of winnowing over a period of time what works in producing varying outcomes, at least for a while, for whom and in what circumstances“ (Hughes 2001: 111, vgl. Tilley 2000). In elaborierten Formen des Benchmarking lautet Formel zur Etablierung effektiver und effizienter Standards im wesentlichen: „identifying existing best practice, coupled with incentives for these successful programmes to shear their strategies with others” (Nutley/Davis 2000: 4) Im Prinzip implizieren auch in der Bundesrepublik virulente Formen des Benchmarking als externe Kontrollmöglichkeit zum Effektivitäts- und Produktivitätsvergleich verschiedener Praxismodelle mit dem Ziel ihrer Optimierung und einer Etablierung von Standards (vgl. Wohlfahrt 2001) kaum eine andere Logik. Sie sind eine Form des indikatorenbasierten ‚Performance Management’ (vgl. McLaughlin 2001), wenn auch Variante, die sich - da der Nachweis noch eher auf internen ‚Rankings’, als auf externer Evaluation im statistisch beweisbasierten Sinne erfolgt - auf ‚technologisch’ vergleichsweise niedrigen Niveau bewegt. Mit Blick auf die Denk- und Handlungsrationalitäten der Jugendhilfe dürfte die allgemeinste Zäsur, die mit der Etablierung managerieller Leistungserbringungstechnologie markiert wird darin bestehen, dass „The message here is that ,best practice’ should be adopted by all, and should therefore become ,standard’ practice” (Atkinson 2000: 318). 46 204 die relationale Kerndimension Sozialer Arbeit suspendiert wird. So ist die komplexe Aufgabe einer Vermittlung in dem spannungsreichen Verhältnis von individuellem Akteur und Gesellschaft ungleich schwieriger in ‚S.M.A.R.T.’ formulierte Zielvariablen zu packen, als beispielweise eine mechanische Auflösung dieses dialektischen Verhältnisses in Indikatoren einer positionalen Dimension einerseits und (andere) Indikatoren einer dispositionalen Dimension andererseits. Abgesehen von der Tatsache, dass das komplexe Verhältnis dieser Dimensionen zueinander teilweise völlig andere soziale Phänomenen induziert, als die Addition der einzelnen Dimensionen implizieren würde47, rücken im Zuge einer solchen Zerlegung bezogen auf die Spezifik der Jugendhilfe - die strukturell kaum in der Lage ist isolierte positionale Dimensionen zu bearbeiten (vgl. Olk/Otto 1987) - die isolierten Dispositionen des einzelnen Falls im Sinne einer ‚Verhaltensorientierung’ gegenüber den inhärent gesellschaftlichen und politischen Dimensionen in den Vordergrund. Durch eine Orientierung am messbaren Output, Matthews und Pitts (2001: 6) sprechen von einer ‚Kultur der Performanzindikatoren’, wird diese Fokussierung auf die Ebene des Verhaltens noch verstärkt. In einer solchen Performanzindikatorenkultur, rückt, forciert durch die Verbreitung von Budgetierungen auf der Ebene der Leistungsfinanzierung, ein einzelfallübergreifender, auf Adressatengruppen aggregierter Output ebenso in den Mittelpunkt, wie eine Bevorzugung jener Aktivitäten wird, die direkt messbare Outputs versprechen (vgl. Fabricant/Fisher 2003). Diese Leistungen Sozialer Arbeit werden zumindest relativ zu einer Orientierung an ihrem Beitrag zu prinzipiellen, fachlichen Gesamtzielen, dem Gebrauchswert für die Nutzer oder allgemeinere Fragen sozialer Gerechtigkeit - aufgewertet. Zugleich wird Herrschaftsform vorangetrieben, die sich weg von Fragen professioneller Rationalität entwickelt und hin zu dem, was Brunkhorst (1992: 82 f) in Anlehnung an Weber und Oevermann als technokratischen und bürokratischen Individualismus beschreibt, durchgeführt von Spezialisten ohne Geist. Diese Verschiebung ist ihrerseits in eine umgestaltete, makrostrukturelle Herrschaftsformation eingebettet, die eine Zurückdrängung der Relevanz des öffentlichen Bereichs für die Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen impliziert (vgl. Clarke 2001): Wo einst der demokratisch legitimierte soziale Staat, „willed the means, it now tends to prescribe the ends while others are left to supply the means; and as with all instrumentally-orientated practices, the logic governing the attainment of ends is the logic of rules. In short, where government was, now audit regulation and management is“(Cooper/Lousada 2000: xx). Dabei ist anzunehmen, dass sich diese Rationalitäten der Leistungserbringung zumindest mittelbar auch auf die professionellen Inhalte auswirken. Hierauf machen in einem ganz allgemeinen Sinne Jean-Michel Bonvin und Nicolas Farvaque (2003: 9 f) aufmerksam, wenn sie darauf hinweisen, dass eine solche managerialistische Orientierung „gives clear indications to the staff members, and renders the action potentially more consistent. Moreover, quantitative outcomes are easier to apprehend from outside, and throw crude light on the efficiency of the policy process. However, at a micro level, the respect of individual liberties or projects risks to be denied in order to produce good results. Performance targets act as rules aiming at changing individuals’ behaviour in order to comply with exogenous objectives that may not fit at all with the reality of the situation. If objectives change the behaviour, 47 Hinweise hierfür finden sich etwa am Beispiel der Relevanz von Individual- und sozialökologischen ‚Faktoren’ für individuelle und räumlich aggregierte Verhaltensweisen in den Arbeiten in dem von Farrington et al. 1993 herausgegebenen Sammelband „Integrating Individual and Ecological Aspects of Crime“ 205 it is not necessarily in ways which improve service delivery […], what eventually leads to […] making a good showing on the record as an end- in- itself” Weniger allgemein gesprochen, zeigen sich möglicherweise ganz andere inhaltliche Probleme im Falle einer Adaption beweisbasierter Praxis in der Jugendhilfe. Um ein zugespitztes Beispiel zu geben: Im Vergleich zu ‚Emanzipation’ ‚Mündigkeit’ oder ‚Autonomie’, als Ziele und zentrale Orientierungen einer ‚kritischen’ Sozialpädagogik (vgl. Brumlik 1990, 1996, Sünker 1992), sind Wirkungen, wie etwa die Reduzierung der Rückfallrate devianter Jugendlicher, ungleich genauer beschreibbar, messbar, zeitlich bestimmbar und erreichbar, während erstgenannte kaum klare, isolierbare, in überprüfbare Kausalketten zu packende ‚operative Ziele’ darstellen können. Wie Klaus Mollenhauer (1972: 50) ausführt, lässt sich etwa das, was sich aus einem „Erziehungsziel ‚Emanzipation’ im detaillierten Kontext pädagogischen Handelns als Zwischen- oder Teilziele ergibt [… nicht] mit Bestimmtheit sagen, es sei denn, das was für den Begriff ‚Emanzipation’ als unverzichtbar behauptet wird, nämlich die Chance für Individuen und Gruppen, ihr Handeln selbst zu bestimmen, würde aufgegeben“. In diesem Zusammenhang findet auch die von Thole und Cloos (2000: 558 f) artikulierte Befürchtung ihre Berechtigung „dass bedeutende Fachlichkeitskriterien wie ‚professionelle Wissensstandards, Fähigkeiten zur sozialpolitischen Analyse und Kompetenzen stellvertretender Deutung’ aufgrund geringer Praktikabilität und Messbarkeit aus den Evaluationsratern der Qualitätsmess- und Kontrollverfahren fallen“ (nach: Galuske 2003: 217). Wenn demgegenüber ein Ziel, wie das der Legalbewährung, operationalisierbar und experimentell testbar (vgl. Schumann 2001, Sherman et al. 1997) auf unmittelbare, durch zielgerichtete Interventionen manipulierbare Variablen zurückzuführen ist (kritisch: Hope 2002), spricht, wenn sich etwa eine Verdichtung und Intensivierung überwachender Formen sozialer Kontrolle (vgl. Braga et al. 1999, Eck 1997), durch die möglichst viele eigensinnige Handlungs- und Aneignungsmöglichkeiten geschlossen werden als billiger und vor allem effektiver erweisen als demokratisierende, emanzipatorische, partizipative usw. Modelle, aus einer auf das optimale Erreichen der Zielvariable bezogenen und an messbaren Nachweisen orientierten Perspektive nichts dagegen die letztgenannten Versuche zugunsten der ersten Variante aufzugeben48. Dies ist nicht einfach eine dystopische Zukunftsvision. Deutliche Momente dieser managerielladministrativen, effizienz- und effektivitätsbasierten Steuerungsrationalität weisen etwa die Konjunktur von Screening-Verfahren, ‚Profilings’, und ‚Indikationen’ in der Jugendhilfe (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2002), verschiedene Formen von ‚Trainings’ zum an- und abtrainieren spezifischer performativer Verhaltensweisen (vgl. Krassmann 2000, Weidner et al. 1997), kognitiv-behaviouristische Programme, etc. in Bezug auf Abweichung, Arbeitslosigkeit und eine Reihe weiterer unterschiedlichster Probleme auf. Diese richten sich auf spezifische, ‚Ist-Situationen’, die sich beispielsweise als bestimmte Verhältnisse von ‚Risiko-’ und ‚protektiven’ Faktoren im Rahmen von Assessments feststellen und effektiv und effizient bearbeiten lassen: Durch Programme, die zielgenau auf die spezifischen, Entsprechend wenig kann Walter Hornsteins (2000: 134), Bilanz über die Evaluations- und ‚Qualitätsoffensive’ des Bundes überraschen. „An keiner Stelle“, so führt er aus „treten pädagogisch-politische Ansprüche, überhaupt die Ansprüche der Kinder und Jugendlichen, um deren Lebenschancen und Zukunftsperspektiven es in der Kinder- und Jugendförderung geht, in Erscheinung; insofern besteht eine problematische Ausstrahlung dieses Programms in der ‚Entpolitisierung’, d.h. in der Ausklammerung der gesellschaftspolitischen Dimension von Förderungsentscheidungen“. 48 206 identifizierten Faktoren gerichtet sind, die am kostengünstigsten, einfachsten und aussichtsreichsten beseitigt werden können. Insbesondere die ‚harten’ Programme seien, so lässt sich dann argumentieren, wenn sie nicht flächendeckend eingeführt, sondern ‚fachlich begründet’ für einige wenige Jugendlichen mit bestimmten Merkmalen und unter bestimmten Umständen eingesetzt werden erwiesenermaßen ‚erfolgreich’. Vor allem sind sie aber effizienter, effektiver und ökonomisch sinnvoller, als es freiwillige Angebote bzw. die ‚Regelangebote’ wären, zumindest wenn es darum geht die performative Frequenz unerwünschter Handlungsweisen zu unterdrücken (vgl. dazu auch 11. Kinder- und Jugendbericht 2002) oder unwillige und schwierige Jugendliche ‚in Arbeit’ zu bringen (vgl. das Programm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ 49 des BMFSFJ 2001). Dennoch sind diese Formen der ‚Neo-Diagnostik’ und Standardisierung der Technologien und Handlungsprogramme nicht notwendigerweise als eine Revitalisierung oder gar Verschärfung einer Expertokratie zu verstehen, die mit einer pathologisierenden Entmündigung der Adressaten einhergeht (dazu: Peters 1973). Stattdessen kann eher davon gesprochen werden, dass mit den Diagnose- und Interventionstechniken eine Art neuere Rechte- und Pflichtenkatalog responsibilisierter ‚Kunden’ etabliert wird, der diese dazu anhält mit ihren eigenen individuellen und sozialen Risiken ‚verantwortungsvoll’ d.h. risikominimierend und zu kostenreduzierend umzugehen. Die tendenzielle Umgestaltung des Erbringungskontextes personenbezogener sozialer Dienstleistungen in einer Weise, die das Referenzsystem ‚Staat’ zwar nicht ablöst, aber mit Regelmäßigkeitssystematiken und Logiken durchdringt, die dem Referenzsystem ‚Markt’ entsprechen, sowie die Implementation eines Kundenkonzepts als ein assoziatives Leitmotiv in das Erbringungsverhältnis sozialer Dienstleistungen, wirkt sich demnach, so lässt sich resümieren, unterschiedlich auf die Positionen und Einfluss- wie Gestaltungsspielräume der Nutzer in den Prozessen der Leistungsproduktion aus. Als eine Konsequenz lässt als eine Art ‚Bifurkation’ der Adressaten beschreiben: Während das Kundenkonzept die ‚Doxa’ (vgl. Bourdieu 1987) der keynesianisch-wohlfahrtsstaalich orientierten Jugendhilfe alleine dadurch nachhaltig zu erschüttern in der Lage ist, dass es eine Tendenz zu Selbstbezüglichkeit bürokratisch organisierter Institutionen hinterfragt, ein mehr an Transparenz von Leistungen sowie eine Überprüfung professioneller Denkund Handlungsmuster eingefordert (vgl. Merchel 1995) und dabei auf die Notwendigkeit einer Orientierung am Adressaten im Sinne des Leitbildes ‚Kunde’ verweist, konzentrierten sich die Zuwächse an Gestaltungsmacht im Erbringungsprozess sozialer Dienstleistungen primär in den Gruppen, die ihre Kundenrolle ‚angemessen’ ausfüllen und von ihren Wahlfreiheiten den ‚richtigen’ In diesem Programm wird zu der Notwenigkeit von Risiko- und protektiven Faktoren prüfenden Assessments unter anderem ausgeführt: „Verfahren der Diagnostik in der Benachteiligtenförderung klassifizieren traditionellerweise die Adressaten ihrer Arbeit insbesondere im Hinblick auf ihre Schwächen und Defizite (Lernbehinderte, Leistungsschwache, „mehrfach“ Benachteiligte). In Abgrenzung dazu haben eine Reihe von Trägern damit begonnen, in der Privatwirtschaft entwickelte Verfahren des Assessment so zu adaptieren, dass die Leistungspotenziale der Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen und Benachteiligungen identifiziert werden können und mit passenden Angeboten an diese angeknüpft werden kann. Ein Manko der bisher in der Jugendberufshilfe praktizierten Assessment-Verfahren besteht darin, dass diese zumeist als Auswahlverfahren für ein häufig eng begrenztes Spektrum von Angebotsalternativen dienen (meist handelt es sich um Angebote des Trägers selbst, der sein Assessment durchführt). Es muss aber darum gehen, auf Basis der Assessment-Ergebnisse für die betreffenden Jugendlichen solche passgenauen Lern- und Beschäftigungsangebote zu identifizieren“ (BMFSFJ 2001: 12, Herv. H.Z.). 49 207 Gebrauch machen. Pointiert formuliert, wird dabei eine erweiterte aber ‚regulierte Autonomie’ der Adressaten erprobt, in der sie als ‚Subjekte’ ihrer sozialen Determiniertheit enthoben werden und ihre Autonomie und ihr ‚freier Wille’ zur sine qua non der Ausgestaltung ihrer (Ko-)Produzentenrolle in den Prozessen der Leistungsbringungen erhoben wird. Dies geschieht sofern und sobald die Determinanten dieses ‚freien Willens’ ‚angemessen’ arrangiert sind. Der Tendenz nach geht es im Kontext der Neuen Steuerungsmodellen um Diagnose- und Interventionstechniken die darauf gerichtet sind, für das ‚obere’ Ende der Adressaten notwendige Informationen und Hinweise bereitzustellen um sie zu ermutigen, mit ihren primär als individuelle Lebensführungsrisiken dechiffrierten Problemlagen ‚verantwortungsvoll’ - d.h. risikominimierend und kostenreduzierend - umzugehen. Während eine solche Form der Verkopplung von Führung und Selbstführung für die Adressaten, die sich willig, ‚richtig’, ‚einsichtig’ und ‚effektiv’ in ihre Rolle als ‚selbstverantwortliche Kunden’ einfügen als eine Befreiung aus dem sozialtechologischen Versuch interpretiert werden kann, in möglichst vielen Sphären ihrer Existenz durch direkte bürokratische und professionelle Instruktionen ‚regiert’ zu werden, bleibt eine wachsende, deprivierte Minderheit gegenüber diesen Techniken resistent, weil sie ‚nicht Willens’ ist oder schlicht nicht über ausreichende und ‚verwertbare’ Formen ökonomischen, kulturellen, sozialen und symbolischen Kapitals (Bourdieu 1997) verfügt, um von den ‚Autonomie-Potentialen’ dieser Strategien ‚angemessen’ Gebrauch zu machen (Stenson 1996). Sofern diese residualen Adressaten am ‚unteren Ende’ der Adressaten nicht einfach aus den Prozessen der Leistungserbringung ausgeblendet bleiben, zeichnet sich eine Tendenz ab, nach der der Umgang mit ihnen, sobald ihre ‚Fehlentscheidungen’ erst als ein „Mangel an Selbstverantwortung und Rationalität und damit auch [als] eine Unfähigkeit frei Entscheidungen treffen zu können“ (Groenemeyer 2001: 52) dechiffriert worden sind, durch direkte und ‚berechtigterweise’ direktive Interventionen erfolgt, die weniger den Wünschen und Vorstellungen der Adressaten sonderns staatlich-administrativen (Effizienz-)Rationalitäten folgen und häufiger denn je durch Intrusivität und Rigidität gekennzeichnet sind (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002, Dean 2002). Sofern im Kontext der Regfiguration der Adressaten als ‚Kunden’ die Bedingungen der Möglichkeiten einer Realisierung der - ja keinesfalls ziellosen, sondern an das Kriterium des ‚richtigen Gebrauchs’ rückgebundenen - Erweiterungen bzw. Unterstellungen von ‚Freiheits-’ ‚Autonomie-’ und Lebensgestaltungspotentiale aus dem Blick geraten, droht eine ökonomisierte und (verwaltungs-) modernisierte Jugendhilfe gesellschaftliche Spaltungen weniger zu kompensieren und zu moderieren, als zu spiegeln und in ihre eigene Logik zu verlängern (vgl. Lindenberg 2000). In diesem Kapital sind eher grundlegende Gewichtsverlagerungen in den Regelmäßigkeitsystemen sowie den Denk- und Handlungsrationalitäten der Erbringung personenbezogener Dienstleistungen in Form von Bewegungsrichtungen angesprochen als realtypisch bzw. empirisch in ‚Reinformen’ vorfindbare Praktiken. Demgegenüber kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Bewegungsrichtungen eine unumstrittene Einheitlichkeit aufweisen. Vielmehr finden sich verschiedene ungleichzeitige Dynamiken, Bewegungen und Gegenbewegungen, die nicht immer kompatibel sind 208 und die etablierte Strukturen und Rationalitäten auch nicht völlig ‚ablösen’, sondern modifizieren, neu kontextuieren und mit unter auch schlicht reproduzieren. Sofern die skizzierten Dynamiken jedoch zunehmende Gewichte sind, die auf den Zwischenstand der permanent umkämpften Hegemonieverhältnisse, Leitideen und ‚Hintergrundgrammatiken’ der Denkund Handlungsrationalitäten in der Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen in einer Weise wirken, die diese von den Rationalitäten unterscheidbar macht, die in ihrer Gesamtheit den ebenso permanent umkämpften Common Sense der Jugendhilfe in der fordistischen Phase des Sozialen repräsentiert haben, erscheint es notwendig, den - nur mit Blick auf den Stand der Regulationsweisen der gesellschaftlichen Organisation interpretierbaren - Doppelcharakter der Jugendhilfe als Institution sozialer Unterstützung und Herrschaft, vor dem Hintergrund der Implikationen dieser Dynamiken zu rekonstruieren. Diese Wandlungsprozesse sind weniger mit Blick auf die Frage zu analysieren, ob sie nun ‚mehr Hilfe’ oder ‚mehr Kontrolle’ darstellen, sondern mit Blick auf die möglichen Veränderungen der Relationierung beider Aspekte und mit Blick auf die Rationalitäten, den Strategien, Technologien und Teleologien, denen sie folgen. 209 III. 5 JUGENDHILFE AUF DEM WEG ZUR ‚NORMALITÄT’ Eine modernisierungstheoretische Deutung der mit dem Niedergang der fordistischen Phase des Kapitalismus verbundenen sozialstrukturellen Veränderungen, als Prozesse einer Individualisierung, einer Erosion traditioneller Milieus sowie der daraus resultierenden Risiken der Lebensführung, ist auf der fachlichen Ebene ein wesentlicher Ausgangspunkt einer dienstleistungs- wie präventionsorientierten Neukonstitution der Jugendhilfe. Diese ‚Neukonstitution’ ist von zwei widersprüchlichen Deutungen vorangetrieben worden: Einerseits wird der Jugendhilfe attestiert, sie befände sich auf dem Weg zu ihrer gesellschaftlichen ‚Normalisierung’ und ‚Autonomisierung’ (vgl. Lüders/Winkler 1992). Zum anderen wird beobachtet, dass die Jugendhilfe, als ein wichtiger Garant sozialstaatlicher Leistungen selbst „in den Strudel der ‚Krise des Wohlfahrtsstaates’“ (Sünker 1996: 805) geraten und darum konzeptionell wie strategisch aufgefordert ist, auf eine zunehmende Segmentierung und ‚Spaltung der Gesellschaft’ zu reagieren (vgl. Schaarschuch 1998: 11). Für die Jugendhilfe in ihrer Form als ‚fordistische Profession’ lässt sich im Kontext der Verwerfungen in den Logiken ihres Feldes - dem Feld des Sozialen – von einem grundlegenden ‚Orientierungsdilemma’ sprechen (vgl. Galuske 1993, Schaarschuch 1996). Während es eine zentrale Legitimationsgrundlage der Jugendhilfe bleibt, als ‚sozialintegrative Stützung’ eine Balance herzustellen zwischen der ‚subjektiven Normalität’, als individuelle Handlungsfähigkeit und der gegebenen Organisation sozialen Ordnung, in der sich jene Handlungsfähigkeit aktualisieren muss (vgl. Böhnisch 1994), haben die um die Normallohnarbeitsverhältnisse konstituierten und auf (national)staatlicher Ebene regulierten, Normalitätsmuster des Sozialen, als Zielvorgabe einer sozialstaatlichen Normalität sowie als ein übergreifender gesellschaftlicher Integrationsmodus und damit Referenzpunkt der Jugendhilfe ihre unhinterfragte Dominanz und allgemeine ‚Erreichbarkeit’ eingebüßt (vgl. Böhnisch 1994). Damit wird für die Jugendhilfe eine ‚Integrationsproblematik‘ in Entwicklung dem auf neuer Modi und Existenzbedingungen Strategien und zur Bearbeitung Lebensrisiken der bezogenen, spannungsreichen Verhältnis von sozialem Akteur und der sich wandelnden Organisationslogiken der Gesellschaftsformation, zu einer zentralen Notwendigkeit. Wie einige Autoren hoffen, ist mit der Auflösung traditioneller, ‚fordistischer’ Sinnzusammenhänge des Sozialen und den Veränderungen der politisch regulativen Rationalitäten eines interventionistischen Staates eine Möglichkeit für die Jugendhilfe verbunden, sich auf der Basis einer grundlegenden Kritik der bisher vorherrschenden ‚technologisch’ orientierten Sozialplanung und einer individualisierenden Problembearbeitung „ein neues Selbstverständnis zu erarbeiten, das sich kritisch zu den vorgegebenen Aufgaben im Wohlfahrtsstaat verhält, und einen subjektorientierten Ansatz vertritt, in dem die Konstitutionsbedingungen von Subjektivität Priorität genießen“ (Sünker 1996: 806, vgl. Sünker 1998, 2000, Galuske 1993). Der Behauptung einer solchen Möglichkeit, als einer erst noch zu erarbeitenden Option, steht mit Verweis auf eine Präventions- und Dienstleistungsorientierung die Behauptung einer mehr oder weniger vollzogenen Ablösung der Jugendhilfe von gesellschaftsfunktionalistischen Postulate und ihrer Herrschafts- und Kontrollfunktion entgegen. Die Jugendhilfe, so das Argument, sei bereits faktisch eine ‚autonome’ Institution geworden, die sich aus ihrer sozialpolitischen 210 Instrumentalisierung als Instanz ‚aktiver Proletarisierung’ und anderer hoheitlich erforderter Zumutungen emanzipiert habe. Diese ‚Befreiung’ aus einer Instrumentalisierung der sozialpolitischen Regulation widersprüchlicher gesellschaftlicher Verkehrsverhältnisse sei aber nicht aus einer ‚radikalen’ bzw. antikapitalistischen professionellen oder disziplinären Perspektive erwachsenen, sondern durch den Prozess einer ‚zweiten’, die industriegesellschaftliche Modernisierung selbst modernisierende Moderne gesellschaftlich notwenig geworden (vgl. Rauschenbach/Gängler 1992). Vor dem Hintergrund einer Fragmentierung sozialer Klassen und handlungsleitender Milieus sowie einer gesamtgesellschaftlichen ‚Pluralisierung’, ‚Individualisierung’ und ‚Enttraditionalisierung’, liege es zunehmend in der Verantwortung des einzelnen Individuums, seinen „eigenen Lebenslauf selbst zu gestalten, und zwar auch und grade dort, wo er nichts als das Produkt der Verhältnisse ist [… Dies impliziert zugleich] eine Verwandlung von Außenursachen in Eigenschuld, von Systemproblemen in persönliches Versagen“ (Beck 1986: 216, 150). Dass vor dem Hintergrund diese veränderten sozialen Rationalität biographisch relevante Entscheidungen eines auf sich selbst zurückgeworfenen Einzelnen, im Kontext gleichzeitiger Komplexitätssteigerungen gesellschaftlicher Umwelten, zunehmend ‚riskant’ werden, stellt dabei den Ausgangspunkt für die Behauptung einer notwendigen Neukonstitution der Jugendhilfe dar. Da gemäß der gängigen modernisierungstheoretischen Interpretation die Phänomene einer ‚Risikogesellschaft’ als gewachsene, ubiquitäre Risiken der Lebensführung und soziale Orientierungsschwierigkeiten nicht mehr vorab auf spezifische Klassen und Gruppen eingrenzbar sind, sondern ein gesellschaftlich allgemeines und ‚normales’ Phänomen darstellen, werde auch die Nutzung der personenbezogen sozialer Dienstleitung Jugendhilfe zu einer universellen Normalität. In diesem Zusammenhang präsentiere sich Jugendhilfe „als eines der neuen, charakteristischen Muster einer generellen vergesellschafteten Problemlösungsstrategie“ (Thiersch 1995: 250). Gesellschaftliche und organisatorische Veränderungen hätten „unter dem Strich dazu geführt […], dass die Kinder- und Jugendhilfe zu einem festen integralen Bestandteil der öffentlichen sozialen Grundversorgung geworden ist“ (Rauschenbach 2000: 475). Da die Leistungen der Jugendhilfe eine ‚normale’ Ressource zur Stützung der ‚selbstgebastelten’ biographischen Entwicklung und der ‚autonomen’ Entscheidungen in der Wahl der eigenen Lebensführung für alle Mitglieder der nachwachsenden Generation einer Gesellschaft werden, kann sich die Jugendhilfe von den ihr historisch eingeschriebenen, sozialpolitischen Imperativen lösen, und professionelle wie disziplinäre Eigenständigkeit für sich reklamieren (vgl. u.a. Rauschenbach 1992, 9. Jugendbericht 1994, Thiersch 1995, Merten 1997, Winkler 1995, 1999, kritisch: Schaarschuch 1996c, Brumlik 2000c, Bommes/Scherr 2000). Eine solche ‚Autonomisierung’ hätte zugleich zu einem erheblichen Bedeutungszuwachs bzw. zu einer neuen ‚gesellschaftlichen Schlüsselposition’ Jugendhilfe geführt (vgl. Winkler 1999), die in wachendem Maße weniger mit ‚defizitorientierten’ Kontroll- und Korrektur- sondern verallgemeinerten sozialen ‚Gestaltungsaufgaben’ betraut sei (vgl. Gildemeister 1992). Dieser gesellschaftliche Bedeutungsgewinn der Jugendhilfe werde durch eine in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erfolgte Steigerung der Personalbestände – in den sozialen Berufen hat sich die Zahl den Beschäftigten seit Anfang der 1960er Jahre fast verzehnfacht (vgl. Rauschenbach/Züchner 2001, Rauschenbach/Schilling 1997) – dokumentiert. Die Wachstumsraten der sozialen Dienste - insbesondere im Verhältnisses zur 211 rückläufigen Gesamtzahl ihrer Zielgruppe Kinder und Jugendliche - sei als ein valider Hinweis darauf zu interpretieren, dass alle Akteure der nachwachsenden Generation „in den Stationen ihres Lebenslaufs vorübergehend und zeitweilig zu AdressatInnen des Sozial- und Erziehungssystems werden (können)“ (Rauschenbach 1992: 51) bzw. sich in einer ‚generellen’ Risikostruktur, Problemlagen entwickeln, die „als biographische Wechselfälle in einer sich individualisierenden Gesellschaft prinzipiell jeden treffen (können)“ (9. Jugendbericht 1994: 582). Entsprechend sei auch die gesellschaftliche Aufgabenstellung der Jugendhilfe zu reformulieren: „Weil die in den primären lebensweltlichen Netzwerken vorhandenen Ressourcen sozialer Orientierungen und Unterstützungen im sozialen Nahraum immer mehr abnehmen und von den Einzelnen immer weniger selbstverständlich vorausgesetzt werden können, müssen diese – so die Annahme – zunehmend von sozialen Diensten substituiert werden.“ (Schaarschuch 1998: 12) Wenn die Jugendhilfe somit mehr oder weniger allgemeine ‚Grundprobleme’ bearbeite, habe sie eine strukturelle und funktionale Erweiterung vorzunehmen (vgl. 9. Jugendbericht 1994). Die ‚Stigmata’ der Jugendhilfe, die sich in ihrer Bezogenheit auf soziale Probleme, Devianz und Randständigkeit sowie ihrer entsprechenden Selbstbeschreibung äußern, könnten abgestreift werden. Jugendhilfe könne, insbesondere durch den Wandel von reaktiven zu präventiven Strategien, zu einer ubiquitären und entstigmatisierten (vgl. Lüders/Winkler 1992) Instanz der Hilfe zur ‚Lebensbewältigung‘ (vgl. auch Böhnisch/Schefold 1985) bzw. der Unterstützung, Beratung und Beleitung einer generell risikobehafteten Lebensführung werden (vgl. Rauschenbach 1992). Der ‚gängige Entwurf‘ einer ‚Selbstmarginalisierung’ sei damit obsolet (vgl. Lüders/Winkler 1992). Das gradlinige Umschlagen einer unbestrittenen Quantitätssteigerung zu der skizzierten Form einer funktionalen Qualitätsveränderung bleibt dabei vor allem einer modernisierungstheoretischen Interpretation der Annahme einer Adressatenentgrenzung geschuldet50, die jedoch keinesfalls konkurrenzfrei ist: In einer kulturpessimistischen Interpretation könnte das Anwachsen der Beschäftigtenzahlen und Interventionen der Jugendhilfe als Hinweis auf die Gefahr einer ‚betreuten Gesellschaft’ (kritisch: Brumlik 2000c) und von konservativer Seite als Ausdruck einer ‚Anspruchsinflation’ und eines übertriebenen, egoistischen Pochens auf soziale Rechte seitens der ‚Leistungsverweigerer’ gedeutet werden (vgl. Murray 1996). Von einer herrschaftskritischen Perspektive aus betrachtet, könnten vermehrte Interventionen als Ausdruck eines erhöhten Normalisierungs- bzw. Disziplinierungsbedarfs verstanden werden und aus der Warte einer ‚sozialen’ Hilfeperspektive als Ausdruck einer steigenden Anforderung an die Jugendhilfe aufgrund der Erweiterung der sozialen Ränder (vgl. Galuske 1993: 122 f), gewachsener relativer Deprivation sowie auch einer Zunahme dispositionaler Problemlagen. So besteht kaum ein Zweifel daran, dass soziale Ungleichheit und soziale Problemlagen sich insbesondere in den in den 1990er Jahren sowohl in nur Darüber lässt sich das ‚normative’ Kernelement dieser Qualitätsveränderung zwar durchaus als im engeren Sinne ‚sozialdemokratisch’ beschreiben, weder sonderlich neu – und bedarf auch keiner ‚modernisierungs-’ bzw. risikogesellschaftstheoretischen Begründung - noch sonderlich ‚radikal’. In Großbritannien kann es als ein ‚typisches’ Produkt der späten 1960er Jahre verstanden werden vgl. (Seebohm Committee 1968). „Even in less avant-garde circles” führt Mark Drakeford (2002: 294) zu diesem Thema aus „the nature of social work was moved from the margins of the maladjusted to the mainstream. The Seebohm Committee of 1968 proposed a ,universal’ social work service which ordinary citizens would use as normal as a visit to the doctor or the school”. 50 212 relativ als auch in absoluter vergrößert haben (vgl. Kreckel 2001: 1735), während sich auf der Ebene der politischen Bearbeitung dieser Problemlagen, die Tendenz rekonstruieren lässt, dass „Soziale Arbeit als angemessene Form der Bearbeitung im Eigeninteresse von Gesellschaft und Politik betrachtet wurde bzw. wird. […] Gegenwärtig liegt die Quote der Einkommensarmut bei 13, 6 %, etwa vier Millionen Menschen sind arbeitslos, knapp drei Millionen Menschen beziehen Sozialhilfe, über 180.000 unterziehen sich jährlich einer psychiatrischen Behandlung, ca. 70.000 sitzen in Gefängnissen, und ca. 2, 5 Millionen gelten als behandlungsbedürftige Alkoholabhängige. Knapp 80.000 Kinder und Jugendliche leben in Heimen und betreuten Wohngemeinschaften. Über 800.000 Menschen gelten als Wohnungslose. An Problemlagen besteht also offensichtlich kein Mangel, und die Soziale Arbeit ist immer wieder in der Lage, sich als eine sinnvolle und notwendige Form der jeweiligen Problembearbeitung darzustellen“ (Scherr 2000: 186). Mit Blick auf diese Zahlen erscheint es als eine gewagte Interpretation, etwa die im Verlauf des Jahres 1998 auf die ohne Zweifel beachtliche Anzahl von 548 500 gestiegenen erzieherischen Hilfen (vgl. Statistisches Bundesamt 2000), als ein Quantum zu betrachten, dass nur als Ausdruck der Selbstverständlichkeit der Jugendhilfe in gesellschaftlichen Sphären jenseits ihres ‚traditionellen’ sozial, kulturell und ökonomisch deprivierten Klientels zu verstehen sei. Darüber hinaus kann zu bedenken gegeben werden, dass eine Verbreiterung des Adressatenspektrums von den ‚sozialen Rändern’ in mittleren gesellschaftlichen Sphären in manchen, freiwillig angebotenen Bereichen, nicht zwangsläufig auf eine ubiquitäre gesellschaftliche Risikostruktur verweisen muss, sondern ebenso damit zusammenhängen kann, dass die Einstellungen zu Institutionen von Akteure aus den mittleren Klassen – in der Shell-Jugendstudie (2002: 184f ) etwa der Gruppe der ‚Macher’ – in einem durchschnittlich deutlich höheres Maße positiv konnotiert sind, als die der unteren und untersten Bevölkerungsgruppen (vgl. Ritzen et al. 2001, Short 2002, Woolcock 1998). Es ist also anzunehmen, dass Akteure aus den mittleren Klassen ‚freiwillige Leistungsangebote’ von Institutionen ceteris paribus bereitwilliger in Anspruch nehmen (vgl. Schmidt et al. 2002). Eine Tendenz zur statistischen sozialen ‚Normalverteilung’ der Inanspruchnahme bestimmter freiwilliger Leistungen wäre dann aber weniger das Ergebnis einer ‚Klassenlosigkeit’ des Bedarfs, sondern der statistischen Überproportionalität der Bereitschaft von Akteuren der mittleren Klassen Institutionen für sich zu aktivieren, wie sich etwa auch für den Gebrauch des Polizeinotrufs nachweisen lässt (vgl. Hope et al. 2002, Karstedt 2003)51. Für eine solche Interpretation auch, dass je stärker sich die Maßnahmen der Jugendhilfe vom Charakter ‚freiwilliger Leistungsangebote’ entfernen und je intrusiver sie werden, von einer sozialstrukturellen ‚Normalverteilung’ um so weniger die Rede sein kann (vgl. z.B. Münder et al. 1998, BMFSFJ 1998). Schließlich ist es durchaus bemerkenswert, dass die ‚Normalisierungsthese’ in anderen - in keiner Weise weniger pluralisierten, ausdifferenzierten und individualisierten - Gesellschaften nicht die selbe Prominenz erreicht hat wie im sozialpädagogischen Diskurs der Bundesrepublik. So sind etwa auch in den USA - der Referenz für eine fortgeschritten liberale, individualisierte Gesellschaft - In einer von Tim Hope, Stephan Farral und Susanne Karstedt in England durchgeführten Untersuchung zu ‚Calls and Crimes’ „zeigte sich, dass individuell erworbenes institutionelles Kapital in Form von Wahlbeteiligung und Universitätsbildung im Vergleich zur realisierten Kriminalitätsrate zu einer überproportionalen Mobilisierung der Polizei führt: Die Bewohner in relativ sicheren und wohlhabenden Wohngebieten verfügen über genug Vertrauen in die Polizei, Selbstvertrauen, und die entsprechenden Fähigkeiten, die Polizei auch bei kleineren Störungen zu mobilisieren, und dürfen wahrscheinlich auch mit entsprechendem Entgegenkommen rechnen. Dem entspricht, dass Bewohner von Problemgebieten im Vergleich zu ihrer faktischen Kriminalitätsbelastung die Polizei signifikant weniger mobilisieren“ (Karstedt 2003: 14 f). 51 213 gesellschaftliche Wandlungsprozesse mit Bezug auf eine gesteigerte Inanspruchnahme Sozialer Arbeit diskutiert und die Etablierung einer neuen Professionalität verlangt worden. Nur liegt diesen Diskussionen und Forderungen nicht das Bild einer ‚normalisierten’ Sozialen Arbeit in ‚guter Gesellschaft’ zu Grunde (kritisch: Schaarschuch 1996), sondern das genaue Gegenteil: „Frontline staff today” führt etwa Lizbeth Schnorr (1993: 5) aus „[needs] the skills […] to build respectful, trusting relationships, to work collaboratively with families and with systems and disciplines other than their own, and to be comfortable exercising discretion in dealing with a complex interplay of problems […] This kind of professionalism requires not only new kinds of training but a redefinition of professionalism that values the acquisition and application of skills that effectively address the messy but urgent problems of disadvantaged populations”. In Bezug auf die Normalverteilung und Ubiquität sozialer Probleme, die die Basis für die These der Notwendigkeit einer Reformulierung Sozialer Arbeit als ‚ganz normale’ Sozialisationsinstanz darstellt, lässt sich schließlich auch auf den ‚hausgemachten’ Anteil verweisen. In Übereinstimmung mit den aktuellen Debatten in der Soziologie sozialer Probleme im allgemeinen (vgl. Groenemeyer 2001c) wird aus dieser Perspektive darauf verwiesen, dass die Konstitution sozialer Probleme auch deshalb „immer ‚hybrider’ wird, weil die Konkurrenz der Organisationen und das Nachwachsen der Probleme eine immer artifiziellere Problemdiagnose erfordern52“ (Baecker 1992: 10, zit. nach Flösser 1994: 95). Soziale Arbeit ist, wie etwa Kleve (2001: 32) ausführt, „auf permanenten Problemnachschub angewiesen; sie muss ständig neuen potenziellen Klientinnen und Klienten Hilfe anbieten können oder – wenn das nicht gelingt – ihren Adressatinnen und Adressaten in ausreichendem Maße Kriterien bereitstellen, dass diese sich immer wieder erneut Probleme zurechnen können, damit soziale Hilfe weiterhin geleistet werden kann“. Für eine tendenzielle Adressatenerweiterung – wenn auch nicht ihre Entgrenzung im Sinne der Normalisierungsthese - spricht nichtsdestoweniger, dass für eine Reihe sozialer Problemlagen eine ‚typische’ Zielgruppe, gerade auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Prekarisierung (vgl. European Commission 2002) und einer Ausweitung der ‚Zone der Verwundbarkeit’ (vgl. Castel 1996), nicht mehr ohne weiteres trennscharf zu identifizieren ist. Es lässt sich kaum sinnvoll bestreiten, „dass nicht nur Armut und Arbeitslosigkeit, sondern auch die Strukturen der Normalität, insbesondere Zwänge der Leistungsgesellschaft, zu enormen Problemen der Lebensbewältigung führen können“ (Scherr 1997: 72), dass Lebensführungsprobleme keinesfalls das Produkt einer ‚Innen-AussenSpaltung’ moderner Gesellschaften ist (vgl. Kronauer 1997), und dass mithin keinesfalls nur ‚exkludierte’ und ‚marginalisierte’ Jugendliche der untersten Klassen die Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen (können Lebensbewältigungsprobleme oder und müssen). soziale Aber auch Prekarisierungen dann, bis in wenn sich bestimmte die mittleren Klassen transversalisiert haben (vgl. Bourdieu et al. 1998, Ehrenreich 1992, Galuske 1993), ist kaum zu bestreiten, dass die Qualitäten und Quantitäten von Deklassierung Elend und Marginalität ein 52 Bei einer Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe und einer deutliche Rückläufigen Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen selbst –so hat sich beispielsweise der Anteil der 15-25jährigen in der Bevölkerung seit Beginn der 1980er Jahre nahezu halbiert (vgl. Griese 1999: 472) erhöht sich die Dichte der potentiellen Leistungsangebote pro Kopf. Dass sich in einer Verschiebung dieses Verhältnisses nicht nur der Anteil der ‚potenziellen’, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Anteil an ‚tatsächlichen’ Leistungsempfängern erhöht kann als Erkenntnis allgemeiner organisationssoziologischer Natur betrachtet werden 214 klassenspezifisch äußerst unterschiedliches Ausmaß besitzen (vgl. Bourdieu et al. 1998, Layte et al. 2002). Die These von einer Ubiquität oder einer Verallgemeinerung der Sozialisationsfunktion der Jugendhilfe ist demgegenüber jedoch schon alleine rein quantitativ kaum aufrecht zu erhalten. Selbst wenn von Dopplungen abgesehen wird, entsprechen die zusammengenommen knapp 548 500 erzieherischen Hilfen die das Statistischen Bundesamtes (2000) für das Jahr 1998 ausweist, einem Anteil von 2,27 % der in Frage kommenden Alterspopulation. Auch wenn man davon ausgehen würde, dass sich die Rate auf eine bestimmte Altersgruppe konzentriert und sich, um eine fiktive Zahl zu nennen, für die 14- 18jährigen vervierfacht, wären es immer noch über neun Zehntel, die keine Nutzer dieser Leistungen wären. Das ‚quantitative Argument’ gewachsener Fallzahlen für eine qualitativ substanzielle Veränderung der Jugendhilfe auch dann nur leidlich überzeugend, wenn die Prävalenzrate der Jugendlichen in Jugendhilfemaßnahmen noch wesentlich höher wäre. Um ein zugespitztes Beispiel zu geben: Zwar kann man davon ausgehen, dass Normbrüche ein durch nahezu sämtliche Klassen und Altersgruppen weitgehend ubquitäres Phänomen sind (vgl. Gabour 1994, Kerner 1993, Sessar 1984), allerdings gilt das nicht, zumindest nicht im selben Maße für die Kontakte mit der ‚Institution Verbrechen/Strafe’ (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998). Im Kontext der Maßnahmen dieser Institutionen sind nicht nur die unteren Klassen, sondern wie insbesondere das statistische Verhältnis von Alter und polizeilicher Registrierung, der so genannten - auf Beobachtungen Adolphe Quetelets (1833) zurückgehenden - ‚Crime-Age Curve’ zeigt, vor allem auch Jugendliche deutlich überrepräsentiert. Die ‚Age-Crime Cruve’: Prävalenz polizeilicher Registrierungen männlicher Akteure nach Jahrgangskohorten am Beispiel Freiburg i.Br. (Quelle: Grundis 2000: 6) Betrachtet man dieses Verhältnis von Alter und polizeilicher Registrierung lässt sich nicht nur argumentieren, dass die Polizei eine sehr jugendbezogene Institution sei (vgl. Sessar 1997) – der 215 Gipfel der Alterskurve polizeilicher Registrierungen liegt zwischen 16 und 20 Jahren53 - , sondern auch dass - sofern man auch hier von eine Normalverteilung ohne Dopplungen unterstellt - statistisch betrachtet fast die Hälfte der bis 22 jährigen der Kohorte des Jahrgangs 1970 einschlägige Kontakte mit der Polizei hatte. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der polizeilich registrierten Tatverdächtigen im Kindes- und Jugendalter, ist davon auszugehen dass der Anteil der jüngeren Alterskohorten, die bis zum Alter von 22 Jahren in den ‚Genuss’ personenbezogener Dienstleistungen der Polizei kommen wird noch wesentlich größer sein wird. Den jährlichen Vergleich mit den 548 500 erzieherischen Hilfen im Jahr 1998 braucht eine Gesamtzahl von ungefähr 692260 polizeilich registrierten unter 21jährigen im selben Jahr (1999: 687516, 2000: 687887, 2001: 688741∗) zumindest statistisch nicht zu scheuen. Auf einem etwas niedrigeren Niveau gilt dies auch für die Jugendgerichte. Laut einer im Sicherheitsbericht zitierten Untersuchung von Jehle und Heinz auf der Basis unvollständiger Daten aus dem Bundeszentralregister (1991) war am Ende seines Jugendalters „jeder 6. männliche Jugendliche54 mindestens einmal wegen einer rechtskräftigen Verurteilung oder einer Verfahrenseinstellung nach §§ 45, 47 JGG registriert“ (vgl. BMI/BMJ 2001: 449) worden neueren Untersuchung von Stelly und Thomas (2001) zu Folge gilt dies inzwischen für mehr als Fünftel der Altergruppe der Zehn- bis 21-jährigen. Die Pointe dieser Zahlenspielerei, liegt darin, dass man selbst dann, wenn die ‚Institution Verbrechen/Strafe’ noch viel einseitiger auf Jugendliche bezogen und die absoluten Zahlen noch wesentlich höher wären, kaum auf den befremdlichen Gedanken kommen würde, Polizei und Jugendgerichte seien normale, entstigmatisierte, zentrale Sozialisationsinstanzen für alle Jugendlichen, die ihre Bezogenheit auf soziale Probleme und ihrer Kontrollcharakter überwunden hätten etc.. Das ‚quantitative Argument’ gestiegener Fallzahlen ist – wie die Anwendung dieses Arguments auf das Beispiel von Polizei und Jugendgerichten verdeutlicht haben sollte – kein hinreichender Beleg für einen solchen Wandlungsprozess der Jugendhilfe. Jenseits des bloßen Blicks auf die Entwicklung der Fallzahlen der Jugendhilfe kommt eine jüngere, umfassende Untersuchung über die ‚Leistungen und Grenzen der Heimerziehung’55, zu dem der ‚Normalisierungsthese’ Ergebnis, dass sich Jugendhilfemaßnahmen nach wie vor in erster Linie „an ‚schwierige’ Kinder/Jugendliche richten […,] dass diese ‚schwierigen’ jungen Menschen […] aus problematischen Familienverhältnissen kommen [und die…] in den Hilfen zur Erziehung betreute Menschen zu einem großen Teil aus armen, bildungsbenachteiligten und mehrfachbelasteten Bevölkerungsteilen stammen“ (BMFSFJ 1998: 119 f, 133). Selbst noch bei Beratungsangeboten (§28 SGB VIII) setzen sich die Ratsuchenden primär aus Dies liegt keinesfalls nur darin, dass das Jugendalter eine Phase ‚potentieller Devianz’ darstellt (so etwa Böhnisch 1999). Unter den vielen Gründen, die eine solche Überproportionalität – neben der selektiven Konzentration der formellen und informellen Kontrollakteure auf Jugendliche – haben kann, ist besonders beachtenswert, dass Jugendlich Delikte überproportional oft (in ca. 40 % der Fälle) in Gruppen begehen, d.h. die Zahl der Tatverdächtigen pro Delikt ist deutlich höher als dies bei Erwachsenen der Fall ist. ∗ eigene Berechnung aus der PKS 2001 54 Die Daten beziehen sich auf den Jahrgang 1967 55 Interessanterweise eine Untersuchung unter der Leitung von Hans Thiersch, einem exponierten Vertreter der modernisierungstheorischen ‚Normalisierungsthese’ 53 216 dem ‚traditionellen Klientel’ und ‚Modernisierungsverlierern’ zusammen (vgl. 10. Kinder- und Jugendbericht 1998: 245). Sieht man von der Inanspruchnahme des 1996 vom BVG bestätigten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz durch die Altergruppe der Drei- bis Sechsjährigen ab, umfassen die generalisierten Angebotsbereiche einen qualitativ und quantitativ eher bescheidenen Ausschnitt des Berufsfeldes der Jugendhilfe (vgl. Bommes/Scherr 2000: 21). Die prinzipiell für alle, auch ohne besondere Problemlagen offenen Angebote, wie etwa die der Jugendarbeit, Jugendbildung und Jugendkulturarbeit erreichen nur etwa ein Zehntel jedes Altersjahrgangs (vgl. Bommes/Scherr 2000, Scherr/Thole 1998), der zwar hypothetisch, aber nicht faktisch klassenneutral verteilt ist. Während in den Jugendverbänden die mittleren gesellschaftlichen Straten nach wie vor überrepräsentiert sind, wird für die meisten anderen offenen Felder der Jugendarbeit nicht etwa ein Prozess sozialer Homogenisierung sondern im Gegenteil eine Tendenz zu einer ‚Sozialpädagogisierung’ diagnostiziert (vgl. Giesecke 1984: 443 f). Durch eine ‚Abwandern’ der politisch und kulturell interessierten Mittelschichtjugendlichen (vgl. Ferchhoff et al. 1988) ist die Jugendarbeit faktisch in weiten Bereichen mit sozial Benachteiligten befasst (vgl. Scherr 1997), was zugleich mit der Tendenz verbunden ist „die Jugendarbeit darauf zu reduzieren, Leistungen der sozialen Kontrolle und Prävention für sozial benachteiligte und sozial auffällige Jugendliche zu erbringen“ (Scherr 2002: 99). „Für die Jugendhilfe gilt zudem, dass Angebote für ‚ganz normale Jugendliche’, die keine besonderen Problemlagen aufweisen, im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG § 11-13) nicht als solche Pflichtleistungen der Jugendhilfe festgelegt sind, die in einem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang zu gewähren sind“ (Bommes/Scherr 2000: 21). Vor dem Hintergrund, dass inzwischen teilweise selbst „Pflichtleistungen mit einem Hinweis auf erschöpfte Budgets zurückgewiesen werden“ (vgl. van Santen 1998: 45) sind gerade diese Bereiche jedoch in einer besonderen Weise staatliche Sparzwängen ausgesetzt. Sie werden eher reduziert als ausgebaut. Dem Statistischen Bundesamt (2002) zufolge sind die finanziellen Förderungen für Maßnahmen der Jugendarbeit zwischen 1996 und 2000 bundesweit um insgesamt rund elf Prozent reduziert worden, während die Ausgaben und Maßnahmen gegenüber Erziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten und Verhaltensproblemen weiterhin steigen56 (vgl. Statistisches Bundesamt 2003, 2003a). Darüber hinaus werden auch die Maßnahmen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit selbst in wachsendem Maße als Momente der Kriminalprävention interpretiert und eingesetzt (vgl. Lindner/Freund 2001, Lüders 2000, Pothmann/Thole 2001, Scherr 2002, Sturzenhecker 2000). In einigen Fällen kann dies zwar eine mehr oder weniger kluge Form der Nutzung des hegemonialen Präventionsdiskurses zur Verteidigung von sozialen Errungenschaften und der Bandbreite von Angeboten sein (vgl. Berner/Groenemeyer 2000), von einer Entstigmatisierung der Nutzer oder von einem Ende des Bezugs auf soziale Probleme und Devianz lässt sich dabei jedoch kaum ernsthaft sprechen. Verlässt man den Bereich der Jugend-, Jugendverbands- und Jugendkulturarbeit, ist in Kernbereichen der Jugendhilfe die Annahme von Leistungen - auch dann wenn die Adressaten zu Kunden umdefiniert Die Zahl der erzieherischen Hilfen stieg von 108 000 im Jahr 1991 auf 180 000 Jugendliche und junge Erwachsene im Jahr 1999 (vgl. Statistisches Bundesamt 2001). 56 217 worden sind - häufig weniger das Ergebnis einer „selbstartikulierten Bedürfnislage der Klientel“ (Bettmer 1995: 146) oder Ausdruck der Überzeugung von den angebotenen Produkten, als ein resignativer Ausdruck eines Fehlens anderer Alternativen in Zwangs- und Notlagen (Hoops at al. 2001: 72, Olk 1994: 29) oder Ergebnis einer ‚Drohung’ mit ‚schlimmeren‘ Alternativen durch andere Institutionen (vgl. Bittscheid 1998). In diesem Sinne ist nur für die wenigsten Bereiche der Jugendhilfe - etwa den Kindertageseinrichtungen – ist von einer klassenneutralen Normalverteilung der Nutzer zu sprechen, während längst nicht für alle Einrichtungen von einer im engeren Sinne freiwilligen Inanspruchnahme der Dienstleistungsangebote die Rede sein kann (vgl. Olk 1994). So geht die Initiative Dienstleistungsangebote anzunehmen häufig nicht von den Betroffenen selbst aus, sondern ist ein Ergebnis der Initiative anderer Institutionen wie Schule, Psychiatrie und (Familien)Gerichte (vgl. Münder et al. 1998) oder eines herrschaftlichen Zugriffs aufgrund abweichender Verhaltensweisen (vgl. Schaarschuch 1996b). Ein nach wie vor nicht geringer Teil der sozialarbeiterischen Handlungspraxis bleibt dabei mit mehr oder weniger deutlichen ‚Zwangsinterventionen‘ verbunden (vgl. Bettmer 1995). Selbst die notorisch bemühte Unterscheidung von ‚Leistungen’ und ‚Eingriffen’ der Jugendhilfe stellt sich eher als terminus technicus verwaltungsrechtlicher Einteilungen (vgl. Kunkel 1997), denn als eine trennscharfe Beschreibung der Interventionsdynamiken der Jugendhilfepraxis dar. So können Jugendliche gemäß dem Jugendgerichtsgesetz zu denselben ‚Hilfen’ verurteilt werden, die nach dem SGB VIII als Leistungen angeboten werden (vgl. Deichsel 1997). Die Vertreter des 24. Deutschen Jugendgerichtstags bestehen zurecht darauf, dass auch „nicht im KJHG ausdrücklich genannte sozialpädagogische Angebote selbst im Falle jugendrichterlicher Anordnungen Leistungen der Jugendhilfe [sind]“ (Verlautbarungen zum 24. Deutscher Jugendgerichtstag 1998). Insbesondere seit den Diversionsdebatten ab den 1980er Jahren wird die justizielle Inanspruchnahme der Jugendhilfe massiv ausgebaut (vgl. Will 1997). Der Anteil der Jugendlichen, die solche kontrollierenden Leistungen ‚nutzen’ nimmt insgesamt nicht ab, sondern zu (vgl. Lindenberg 2000): Alleine bezüglich der umfassenden Mitwirkungen der Jugendhilfe bei den Jugendgerichten, wurden „in den letzten Jahren […] jeweils weit über 200.000, bis zum Teil über 300.000 Fälle jährlich abgeschlossen“ (Münder 2001: 1012). In empirischer Hinsicht, so lässt sich zusammenfassen, unterbietet der statistisch wahrscheinliche Adressat der Jugendhilfe nach wie vor positionale oder dispositionale Kulturideale oder es wird das wahrscheinlichkeitskalkulatorische Risiko unterstellt, dass es diese unterbieten könnte. Weiterhin ist der ‚typische’ Adressat im weitesten Sinne ‚unterprivilegiert’ (vgl. Scherr 1998, Petersen 1996), d.h. unterdurchschnittlich qualifiziert, mit einem geringeren Einkommen als der gesellschaftliche Durchschnitt ausgestattet, mit einer spezifischen sozialen Problem- oder rekonstruierbaren Risikolage konfrontiert (vgl. Bommes/Scherr 2000) oder stellt durch seine sichtbaren Lebensäußerungen selbst ein ‚soziales Problem’ oder Risiko dar (vgl. Brusten 1999). Trotz ihrer Expansion hat sich in den klassischen Kernbereichen der Jugendhilfe an der Funktion Sozialer Arbeit, eine gesellschaftliche Reaktion auf abweichendes Handeln und marginalisierte Verhältnisse darzustellen (vgl. Kerber-Ganse 218 1991), wenig verändert. Ihr Existenzgrund besteht weiterhin vor allem darin, dass „es Arme, Abweichende, Kranke, Verwahrloste und Hilfsbedürftige offensichtlich gibt“ (Kunstreich 1998a: 449). Vor diesem Hintergrund ist die breite Rezeption der ‚Normalisierungsthese’ vor allem insofern relevant, wie sie ein bestimmtes Deutungsmuster gesellschaftlicher Wandlungsprozesse impliziert. Der Versuch einer Aufwertung der Jugendhilfe zu einer verallgemeinerten, normalen Schlüsselinstitution der ‚zweiten Moderne’ legt es nahe, die Lösung bzw. Verwaltung einer zunehmenden Zahl struktureller, gesellschaftlicher, positionaler Problemlagen den dispositionsbezogenen Gestaltungsbzw. Interventionsstrategien der Jugendhilfe zu überantworten. In diesem Kontext werden auch die ‚sozialen Probleme’, zu persönlichen Risiken umdefiniert: Eine Problemkonstitution, die weniger standardisierbare und positionskompensierende, sondern in erster Linie die dispositionssensiblen Formen der Interventionen in das Soziale als angemessen erscheinen lässt. In diesem Sinne ist die Aufwertung der Jugendhilfe auf der Basis eines von gesellschaftlichen und sozialstrukturellen Einbettungen abstrahierten und verallgemeinerten Risikobegriffs - jenseits der Intension ihrer Protagonisten – zu einem nicht geringen Teil einer impliziten Grundüberlegung geschuldet, die die Gefahr in sich birgt, bestehende Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse tendenziell zu verschleiern. Aus dieser Perspektive betrachtet erweist sich die Normalisierungsthese in einem gewissen Sinne als mit gängigen ‚neokonservativen’ bzw. ‚neoliberalen’ Gesellschaftsdiagnosen (dazu: Hayes 1994) und den Prämissen einer individualistischen Sozialtheorie (vgl. Hill 2002) kompatibel: In dem Maße wie die Risiken und Probleme der Akteure in einer risikomodernen Perspektive nicht mehr als kollektives Schicksal betrachtet und bearbeitet werden, werden unverändert „gesellschaftlich verursachte Lebensprobleme […] nur noch als individuell zu verantwortende und zu bewältigende Versagenserlebnisse deutbar“ (Albrecht 2001: 27). Schwierigkeiten, Probleme, Risiken etc. werden von gesellschaftlichen Zwängen bzw. den strukturierten politischen und sozialen Positionen der Akteure abgekoppelt und zu einem Produkt der individuellen Dispositionen des einzelnen ‚Subjekts’ – das in seiner vollen ‚Ganzheitlichkeit’ und ‚Selbstidentität’ an den naiven bürgerlichen Idealismus erinnert (kritisch: Meder 1987) – und ‚biographisch’ selbstverantworteter (Fehl)Entscheidungen in der reflexiven Wahl autopoetischer Lebensführung umdefiniert. An die Stelle einer vergesellschafteten Risikoabsicherungen in einem quasi-universalistischen Sinne tritt eine - auch durch die ‚Normalisierungsthese’ programmatischkonzeptionell unterfütterte - Forderung nach einem individualisierten Risikomanagement, das in dem Maße, wie die ‚individuellen’ Risiken zugleich klassentransversal generalisiert werden von jedem Einzelnen eine ‚prudentialistische’ Haltung gegenüber seiner Umwelt (vgl. O’Malley 1992, vgl. auch Shell-Jugendstudie 2002) und ein risikokalkulatorisches Verhältnis zu sich selbst abverlangt. Aus dieser Perspektive betrachtet, bringt die ‚Normalisierungsthese’ - völlig jenseits der empirischen und theoretischen Stichhaltigkeit ihrer Argumentationsführung – zwar nicht unbedingt eine Reflexion substantieller Veränderungen ‚sozialer Tatsachen’ (vgl. Durkheim 1961) aber Veränderung der Organisation und Regulation des Sozialen und damit verbunden des Modus Operandi der Jugendhilfe und der Repräsentation und ‚Subjektivierung’ ihrer Adressaten zum Ausdruck. 219 Auch die Vertreter der Normalisierungsthese verstehen den Hinweis auf eine sozialen Entgrenzung der Adressaten und eine Expansion der Jugendhilfe im Sozialbereich nicht primär als Frage einer gestiegenen Quantität der Interventionen der Jugendhilfe, sondern als ein zentrales Argumente für die These einer prinzipiellen Änderung der gesellschaftlichen Funktion der Jugendhilfe. „[W]eil naturwüchsige und traditionelle Selbstverständlichkeiten ‚verdampft’“ seien (Hamburger 1997: 245), komme der Jugendhilfe notwendig eine „sozialpädagogische ‚Herstellung’ von ‚Normalität’“ zu (Hamburger 1997: 245). Mit einer solchen Erweiterung bzw. Verallgemeinerung der Sozialisationsfunktion der Jugendhilfe sei einer fundamentalen Veränderung in der traditionellen ‚pädagogischen’ Bearbeitung des konfliktträchtigen Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft impliziert. So nähme ihre „prägende Funktionsbestimmung als ‚soziale Kontrolle’ ab und sinkt auf den für viele Berufe im Sozialisationsbereich zu konstatierenden Grad relativer Allgemeinheit“ (9. Jugendbericht 1994: 582). Sozialpädagogische Praxis könne dabei, auf Grund der „Pluralisierung und Individualisierung von Lebenslagen [nicht mehr…] auf eine reaktive Integrations- und Kontrollfunktion reduziert werden, sondern [übernähme] zunehmend lebenslagenstützende und im weitesten Sinne präventive personenbezogene und infrastrukturelle Dienstleistungen“ (Lüders/Winkler 1992: 364, vgl. Gildemeister 1992). Entsprechend sei Jugendhilfe zu einer ‚Risikogewinnerin’ geworden (vgl. Rauschenbach 1992). Während sich die Jugendhilfe aufgrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse ‚normalisiert’, d.h. ein quantitatives Wachstum erfahren und sich von ihrer Positionierung an den gesellschaftlichen Rändern verabschiedet habe, führe die generalisierte Risikostruktur der ‚zweiten Moderne’ in qualitativer Hinsicht zu einer systematische Veränderung ihrer Funktionen. Die durch ihre Komplexität induzierte Störanfälligkeit der sich modernisierenden Gesellschaft (vgl. Stehr 2002) und die damit verbundenen Entgrenzungen sozialer Risiken erfordere den erhöhten Einsatz von Sozialpädagogen in der Funktion „soziale[r] RisikoexpertInnen“ (Rauschenbach 1999: 264), deren präventionsorientierte Interventionsrationalitäten sukzessive in sämtliche Bereiche der Lebensführung potentiell aller Akteure diffundiere (vgl. Lüders/Winkler 1992). Damit sei die Jugendhilfe von einer reaktiven Kontrollinstanz zu präventiven Dienstleistung geworden: ‚Präventionsorientierung’ beschreibt den modus operandi einer ‚normalisierten’ Jugendhilfe. III. 5.1 Obschon NORMALISIERUNG UND PRÄVENTIONSORIENTIERUNG – EIN ENDE DER KONTROLLE? die Jugendhilfe auch im keynesianischen Sozialstaat einer fordistischen Gesellschaftsformation ihrer Konstitution nach eine ‚präventive’ Agentur ist, induzieren die Krisen und Widersprüche der späten fordistischen Sozialstaatsorganisation eine verstärkten Orientierung an ‚präventiven’ Konzepten in der Jugendhilfe. Diese ‚präventive Wende’ reflektiert zum einen die Kritik an den traditionellen Eingriffsformen. Zum anderen ist die Hervorhebung von Prävention auch eine programmatisch-professionspolitische Strategie der Jugendhilfe im Kontext einer Interpretation des gesellschaftlichen Wandlungsprozesses als Entwicklung hin zu einer individualisierten Risikogesellschaft. In diesem Sinne kommt dem Aufstieg des Präventionsdiskurses für die Jugendhilfe 220 die Funktion eines Vehikels zu, für ihre Neugestaltung in einer sich abzeichnenden fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation. Vor dem Hintergrund der emanzipatorischen Kritik einer Kolonialisierung der Lebenswelt durch bevormundenden und bürokratisch organisierten Eingriffe der Sozialadministration, stellt die Forderung nach ‚Prävention‘ zunächst eine ‚fortschrittliche‘ Strukturmaxime einer ‚lebensweltorientierten‘ Jugendhilfe (vgl. Thiersch 1992, 2000) und vor allem die Bekundung des eigenen Anspruchs dar, im Sinne einer Instanz ‚primärer Prävention’ umfassender, eigenständiger und aktiver als bisher Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen. Eine Orientierung an den sozialpolitisch fassbaren Erfordernissen einer solchen ‚primären’, strukturellen Prävention markiert dabei auf einer konzeptionell-programmatischen Ebene das Ziel, in dem „Verhältnis von sozialem Anspruch der Sozialen Arbeit und ihrer kontrollierenden Normalisierungsfunktion eine neue Gewichtung“ vorzunehmen (Böllert 1996: 440). Durch eine ‚präventive Orientierung’ der Jugendhilfe wird in so fern ein primär professionspolitisch fassbares Selbstverständnis zum Ausdruck gebracht, das darauf gerichtet ist die sozial gestaltende Dimension der Jugendhilfe zu stärken und von einer tendenziell stigmatisierenden, einzelfallorientierten und bürokratielastigen, normierend-normalisierenden Eingriffsorientierung einer fürsorgerischen Institution des fordistischen Sozialstaats Abstand zu nehmen. An Stelle fungiert die fachliche ‚Präventionsorientierung’ als konzeptionell-strategischer Teil des Versuchs Jugendhilfe als eine ‚normalisierte’ Instanz zu reformulieren, die in einer Risikogesellschaft Unterstützung ‚für alle’ realisieren soll, zu einem Zeitpunkt bevor sich verallgemeinerte, klassentransversale Risiken zu manifesten Schwierigkeiten dramatisieren (vgl. Thiersch 1999). Die Hoffnung ist, dass sich dabei die Möglichkeit ergäbe, Interventionsformen der Jugendhilfe zu vermeiden, die Maxime des ‚Systems’ auf die ‚Lebenswelt’ transformieren und in Form einer ‚klinischen’, reaktiven Fallbearbeitung häufig eher den Erfordernissen der ‚Organisation’ als den Bedürfnissen der Adressaten entsprechen und in dieser Hinsicht oft willkürlich erscheinenden Lösungsprozeduren folgen. Die in dieser Form verstärkt seit den 1980er Jahren artikulierte Forderung nach ‚Prävention’ zielt demnach zunächst darauf, Wege zu eröffnen, die statt eines „negativ zu bewertenden Eingriff[s] in Lebensverhältnisse […] Adressatennähe, Sozialverträglichkeit und Partizipationschancen“ (Gaiser/Müller-Stackebrandt 1995: 2f) garantieren sollen. ‚Prävention’ birgt in diesem Sinne das Versprechen an die Professionellen und die Adressaten eine Perspektive zu eröffnen, die es ermöglichen soll disziplinierende und paternalistische Momente einer sozialbürokratischen Form der Jugendhilfe zu reduzieren (vgl. Wolf 1997) und zugleich „die spezifischen Bedürfnisse der ‚Klienten’ früher und genauer zu erkennen und situativ zu befriedigen“ (Otto 1983: 219). Im Sinne einer solchen ‚fachlichen’ Präventionsorientierung geht es demnach in erster Line um den Versuch eine (Neu)Konzeption der Jugendhilfe zu elaborieren, um gesellschaftlichen Übel dadurch ‚an der Wurzel zu packen’, dass ‚positive’ und ‚förderliche’ Lebensverhältnisse auf der strukturellen gesellschaftlichen Ebene gestaltet und auf der dispositionalen Ebene der Adressaten die Kompetenzen und Voraussetzungen unterstützt werden, die eine ‚gelingende’ ‚subjektive’ Ausgestaltung der eigenen Lebensverhältnisse ermöglichen. Zugleich wird mit einer ‚präventive Orientierung’ das Versprechen 221 verknüpft, unterschiedliche Lebensentwürfe nicht mehr durch ‚korrektive Interventionen’ pauschal unter gegebene Normalitätsanforderungen zu subordinieren, sondern stattdessen im Gegenteil die Adressaten dabei zu unterstützen, ihre biographischen Selbstkonstruktionen auch gegenüber den Zumutungen ex ante definierter Normalitätsentwürfe zu verteidigen (vgl. Böllert 2001). Aus dieser Perspektive fordert ‚Prävention’ eine aktive, umfassende, sozial- wie kommunalpolitische Gestaltung der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen, die sich ebenso an den Bedürfnissen und Interessen der heranwachsenden Generation selbst orientieren sollte, wie der Verbesserung sowohl der Situationen von Familien, Schulen als auch dem Arbeitsmarkt dienen und sich auf die Etablierung von freiwilligen Angeboten beziehen soll, die eine Verhinderung von Leiden, Benachteiligungen und Erfahrungen des Scheiterns von Kindern und Jugendlichen ebenso fokussieren, wie sie sich auf Bildung und Aufklärung richten (vgl. 8. Jugendbericht 1990, Plewig 2000, Scherr 1998, Thiersch 2000). Um es zusammenzufassen: Die neue ‚fachliche’ ‚Präventionsorientierung’ der Jugendhilfe amalgamiert so ziemlich alles, was aus einer sozialwissenschaftlich aufgeklärten Perspektive an Kritik der ‚kolonialisierenden’, paternalistischen und disziplinierenden Interventionen der Jugendhilfe bzw. Jugendfürsorge in der fordistischen Gesellschaftsformation formuliert worden ist. Allerdings geschieht dies ohne sich auf gegenhegemoniale, fundamental kapitalismuskritische Positionen einzulassen, wie sie im Kontext einer ‚kritischen’ bzw. ‚radikalen Sozialen Arbeit’ (vgl. Sünker 2000) seit den frühen 1970er vorgetragen worden sind. Nichtsdestoweniger ist eine Präventionsorientierung, wie sie im disziplinären Diskurs der Jugendhilfe seit den späten 1980er Jahren verhandelt wird, vor allem ein Synonym für eine Leistungs- und Angebotsorientierung der Jugendhilfe. Sie ist zunächst nicht, zumindest nicht primär, als eine Strategie der vorgängigen Bearbeitung von Normabweichung Kinder und Jugendlicher konzipiert (vgl. Böllert 1996, 2001): Als perspektivische Beschreibung einer modernen Jugendhilfe wird ‚Prävention’ auf einer programmatischen Ebene ausdrücklich unterschieden von „Interventionen [die] in die Lebenssituation von Individuen und soziale Gruppen ziel[en], bei denen ärgerliche, irritierende, störende, selbst- und fremdschädigende oder eben strafrechtlich relevante Verhaltensweisen beobachtet bzw. vermutet werden“ (Scherr 1998: 581; vgl. Böllert 1995). Allerdings ist diese Unterscheidung eher professionspolitisch und mit Blick auf die „Professionalisierungsinteressen der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen […angemessen, die] im einvernehmen mit ihren Adressatinnen und Adressaten handeln [wollen]“ (Peters 2002: 179), als analytisch konsistent. ‚Präventionsorientierung’ Etwas vor überspitzt allem die formuliert markiert Demarkationslinien von eine so formulierte ‚guten’ und ‚schlechten’ Interventionsformen sowie fachlich, politisch und normativ ‚angemessenen’ und ‚unangemessen’ Intentionsanlässen. D.h. die ‚Präventionsorientierung’ fungiert zunächst vor allem als ein „politischlegitimatorische[r] Begriff, der die ‚Philosophie’ des KJHG“ (Zehnter Kinder- und Jugendbericht 1998: 178) zum Ausdruck bringen soll, und zeigt eher eine „programmatisch-strategische Zielvorstellung“ an, als den Rekurs auf einen analytischen Präventionsbegriff bzw. eine analytische Bestimmung der Jugendhilfe und der Ambivalenzen ihrer Interventionen (vgl. Müller 2001). 222 ‚Prävention’, verstanden als „eine Orientierung an lebenswerten, stabilen Verhältnissen und Hilfe bei der Bewältigung kritischer Lebensphasen und -ereignisse“ (Jordan 1996: 316) ist nicht weniger als deckungsgleich mit einer Aus- bzw. Umformulierung des im SGB VIII §1 formulierten präambelförmigen Selbstverständnisses der Jugendhilfe selbst. In diesem Sinne stellt die ‚Präventionsorientierung’ nicht nur eine Maxime unter anderen dar, sondern eine appellative Metakategorie, die eng mit einem neuen Selbstverständnis der Jugendhilfe als ‚normale’ Dienstleistung und einer Abkehr von der im RJWG noch verbliebenen obrigkeitsstaatlichen Konnotationen verbunden ist. Als ein legitimatorischer Perspektivbegriff lässt sich die ‚Präventionsorientierung’ mit anderen Prinzipien, Angeboten, Strategien und Programmatiken der Jugendhilfe beliebig koppeln. So beispielsweise: ‚Prävention durch Integration’ (vgl. Hornstein 2001) ‚Prävention durch Empowerment’ (vgl. Blug 2000), ‚Sozialraum als Prävention’ (vgl. Specht 1999), ‚Jugendhilfeplanung als Prävention’ (vgl. von Santen 2000), ‚Familien stärken als Prävention’ (vgl. Rehse 2000), ‚Prävention durch Partizipation’ (vgl. Autrata 2000), ,Prävention durch Vernetzung’ (vgl. von Santen/van Unen 2000) etc.. Dabei ist Mehrheit der hier zitierten Präventionspräfixe bereits Ausdruck und Teil einer sind vor allem seit Mitte der 1990er Jahre vollziehenden ‚ordnungspolitische Wende’ im Präventionsdiskurs der Jugendhilfe. Hier bietet der Rekurs auf Prävention vor allem die Chance, im Zuge einer Selbstsubordination der bestehenden eigenen Dienstleistungen und Handlungspraxen unter einen - im Kontext der Probleme der Regulation einer ‚Risikogesellschaft’ dominant gewordenen – Sicherheitsdiskurs, die Förderungs- und Finanzierungswürdigkeit des eigenen Tuns zu gewährleisten bzw. die Finanzierungsnotwendigkeit zu verdeutlichen (vgl. Linder/Freund 2001, Baillergeau/Schaut 2001). Eine solche Form der ‚Präventionsorientierung’ bleibt jedoch nicht effektfrei: Sie beinhaltet nicht nur eine „generalisation in the social work field of the notion of prevention to the detrinment of autonomy and emancipation“ (Baillergeau/Schaut 2001: 437), sondern verlässt der Tendenz nach den Fokus auf eine Bearbeitung der positional-dispositionalen Matrix der Akteure und verschiebt die Interventionen der Jugendhilfe zu einem Mittel unter anderen, die darauf zielen, die sichtbare Frequenz missliebiger Verhaltensperformanzen zu unterdrücken und deren ‚Qualitätskriterien’ sich primär auf die „visibilisation and the rapitity of activitities“ reduzieren (Baillergeau/Schaut 2001: 437). Diese Form der Präventionsorientierung stellt in ihrer Programmatik kaum weniger als den Antagonismus zu jener Form der ‚fachlichen’ Präventionsorientierung dar, die im Zuge einer gesellschaftlichen ‚Modernisierung’ den Bedarf einer fachlichen Umorientierung der Jugendhilfe markieren sollte. Allerdings kann sie auch als deren Konsequenz und Verlängerung gefasst werden. Der fachliche Präventionsdiskurs der späten 1980er und frühen 1990er lässt sich in diesem Sinne als ein Übergangsphänomen der Herausbildung einer von den fordistischen Logiken der Jugendhilfe unterscheidbaren Kontrollrationalität verstehen. Der ‚fachlichen’ Präventionsorientierung liegt – und dies stellt der teleologischen Ebene einen Widerspruch zum Ordnungsdiskurs dar - eine dichotomische Unterscheidung des Begriffs der ‚Leistungen’ als Gegenstück zum Begriff des ‚Eingriff’ zu Grunde (vgl. Lüders 1995: 42), die durch den Rekurs auf einen professionell ‚angemessenen’ Präventionsbegriff aufgelöst werden soll. In dem 223 Versuch eine Art Programm für die ‚gute Jugendhilfe’ aufzulegen, die ihre, für die fordistische Gesellschaftsformation typische, doppelte Konstitution als Agentur von Unterstützung und Disziplinierung einseitig auflöst, bleiben allerdings die Konsequenzen aus einer analytischen Klärung des Verhältnisses von Sozialpolitik und Sozialer Arbeit (vgl. Otto 1991, Otto/Flösser 1992, Kaufmann 1999) hinter professionspolitisch-programmatischen Wendungen zurück (vgl. 8. Jugendbericht 1990). In der fachlichen Präventionsorientierung laufen zwei Diskursstränge zusammen: Während sich die mit der Forderung nach einer ‚präventiven Orientierung’ zum Ausdruck gebrachte Kritik der Interventionsperspektive der Jugendhilfe an die vor allem seit den späten 1970er Jahren formulierte Kritik an Bürokratie, expertokratischer und paternalistischer Entmündigung, an kolonialisierendkontrollierenden Übergriffen in ‚lebensweltliche’ Zusammenhänge und administrativer Willkür (vgl. Müller/Otto 1980, 1984) anschließt, basiert die Formulierung einer Jugendhilfe, die sich durch eine präventive Orientierung ihrer Kontrolldimension entledigt habe und als ‚autonomes Teilsystem’ ausschließlich nach dem Code ‚Hilfe’ und ‚Nicht-Hilfe’ operiere (vgl. Merten 1997), im Wesentlichen auf den modernisierungstheoretischen Argumenten der ‚Normalisierungsthese’. Abgesehen von dem semantischen Problem, dass es sich mit Forderung statt intervenierender sozialer Kontrolle verstärkt Prävention zu betreiben, etwa wie mit der Aussage verhält, in Zukunft weniger Auto dafür mehr Mercedes zu fahren, besteht auf einer analytischen Ebene das Problem der Behauptung einer zunehmenden systematischen Irrelevanz einer Herrschaft- und Kontrolldimension der Jugendhilfe darin, dass der Doppelcharakter sozialer Arbeit nicht als Verwobenheit bzw. Synonymität der Momente von Hilfe und Herrschaft gefasst wird, die sich in einer Handlung gegenüber ein und dem selben Adressaten vollzieht (vgl. Müller 2001). Die Frage der Kontrollfunktion sozialer Arbeit wird damit nicht in Bezug auf die Ambivalenz sozial regulativer Interventionen thematisiert - in der die ‚Dimension’ ‚Hilfe’ selbst widersprüchlich ist, weil sie als eine Interpenetration in die Lebensführung und hervorbringenden Bearbeitung der Identität ihrer Adressaten auch als eine Form der ‚Kontrolle’ thematisiert werden kann (vgl. Piven/Cloward 1977, Peters 1998, Bommes/Scherr 2000) -, sondern eher als Addition verschiedener Momente verstanden, in der die Jugendhilfe sowohl ‚helfende’ als auch ‚kontrollierende’ Momente habe und es darauf ankäme, die ‚helfende’ Dimension hervorzuheben, und die ‚kontrollierende’ zu unterdrücken. Diese Position mag (professions)politisch sinnträchtig sein. Theoriearchitektonisch ist damit jedoch die sowohl sozialtheoretisch als auch mit Blick auf die ‚soziale’ Konstitutionslogik der Jugendhilfe problematische Annahme unterstellt, Jugendhilfe könne die Aufgabe der Vermittlung zwischen dem einzelnen sozialen Akteur und ‚der Gesellschaft’ (vgl. Sünker 1996) auf der Ebene des ‚Helfens’ ohne Rekurs auf die Ansprüche gesellschaftlicher Organisation vollziehen, d.h. Individuen als stabile Identitäten ‚autonomer Subjekt’ nicht in, sondern gegenüber den Zwängen, Normen und Ordnungen einer (kapitalistischen) Gesellschaft ‚hervorbringen’. Die analytisch konsistenteste Formulierung einer solchen Annahme basiert auf der These, dass im Rahmen gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse die um lohnarbeitszentrierte Rollen formierte ‚fordistische’ ‚Normalität’ an Gültigkeit verloren hätte. Damit hätten die freigesetzten, individuellen sozialen Akteure ihre Lebensentwürfe, Lebensläufe und Lebensbedingungen nicht nur zunehmend 224 selbst zu gestalten (vgl. Böllert 2001), sondern auch ihre Subordinierung unter eine verallgemeinerte Normalitätsunterstellung, wie sie in den klassischen, korrigierenden Interventionen angelegt gewesen sei, wäre nunmehr obsolet (vgl. Brüggemann-Helmold et al. 1996). Pluralisierte Lebensentwürfe und Beziehungsmuster, Auflösungen traditioneller gesellschaftlicher schicht- und klassenspezifischer Trennlinien und die Erosion verallgemeinerbarer Normalitätsentwürfe (vgl. Böllert 1995, 2001) liesen die bisher gültigen Normalitätszumutungen nicht nur in einem politischen Sinne kritikwürdig (vgl. Clarke 1979, Hollstein/Meinhold 1973, Piven/Cloward 1971), sondern - nicht aufgrund eines ‚politischen Kampfes’ sondern aufgrund gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse – auch in einem ‚gesellschaftsfunktionalen’ Sinne kontraproduktiv und ‚technologisch’ zunehmend undurchführbar erscheinen (vgl. Böllert 1995, Böhnisch 1994). Die ‚Interventionszentriertheit’ des keynesianischen Sozialstaats werde folglich durch einen „Zwang zu einer Präventionslogik in der Risikogesellschaft“ (Böllert 1992: 163) abgelöst. Dabei werde Soziale Arbeit als eine soziale Risikovorsorge refiguriert, in der den Professionellen der Status von ‚RisikoexpertInnen’ zukomme (vgl. Rauschenbach 1999) die an die Stelle der ‚fordistischen Sozialpädagogen’ als ‚Sozialingenieure’ treten. Die präventiven Aufgaben der Jugendhilfe, seien vor diesem Hintergrund als Hilfen zum persönlichen Management der Risiken, Brüche und Ungleichzeitigkeiten der eigenen Biographie der Adressaten sowie zur Herausbildung und Stützung risikomoderner Identitäten zu fassen. Unberücksichtigt einer ganzen Reihe konzeptionell-logischer Probleme in dieser Argumentationen57 z.B. dass Prävention im Gegensatz zur Interventionen keiner Normalitätsunterstellung bedürfe - bleibt vor allem Frage unbeantwortet, warum der ‚Zwang zu einer Präventionslogik’ die Kontrollfunktion der Jugendhilfe zum ‚Abschmelzen’ bringen soll – schließlich ließe sich ja auch davon sprechen, dass Machtbeziehungen versteht man sie etwa – wie Michel Crozier und Erhard Friedberg (1979) - als differenzielle Grade der Kontrollmöglichkeiten von Ungewissheitszonen gerade wegen einer Ubiquität von Risiken eher an Relevanz gewinnen als verlieren. Demgegenüber wird das Abschmelzen von Kontrolle häufig schlicht gesetzt oder etwa damit begründet, dass es „SozialarbeiterInnen inzwischen innerhalb gewisser juristischer Grenzen unmöglich geworden [sei] zwischen Norm/Abweichung klar zu unterscheiden. Die Pluralisierung der Lebenswelten, Individualisierungsprozesse und die funktionale Ausdifferenzierung verunmöglichen geradezu das Festhalten an der Leitdifferenz von Norm/ Abweichung“ (Kleve 1999: 376). So lange sich diese Aussage auf ein Norm bzw. Normalitäten bezieht, wie sie strukturfunktionalistische Analysen als Bezugsgrößen sozialer Interventionen thematisiert haben (vgl. Merton 1968, Parsons 1939, 1969), lässt sich durchaus darauf verweisen, dass ein Festhalten an einer Differenz von Norm Dabei ist die Engführung von Prävention und ‚Risikogesellschaft’ zunächst insbesondere dann theorieimmanent plausibel, wenn der Begriff ‚Risikogesellschaft’ eine gesellschaftliche Formation bezeichnen soll, die im wesentlichen durch die Verteilung von ‚Risiken’ strukturiert ist. Risiken zeichnen sich qua Definition dadurch aus, dass sie auf wahrscheinliche Zukünfte verwiesen und bereits ihre bloße Bestimmung eines prädiktorischen Elements bedarf (vgl. Prins 1996). Interventionen, die sich durch dieses Element definieren, bzw. legitimieren stellen - ebenfalls qua Definition – präventive Interventionen war- Wird die Verteilung von Risiken als das entscheidende gesellschaftliche bzw. persönliche Problem der Adressaten personenbezogener sozialer Dienste rekonstruiert, lässt sich weitgehend widerspruchsfrei eine weitere Forcierung risikokalkulatorischer Interventionen als problemangemessene Strategie Sozialer Arbeit in der ‚Risikogesellschaft’ darstellen. 57 225 und Abweichung problematisch ist, die auf einer Fassung gesellschaftlicher Normalität als homöostatische Gleichgewichtszustände beruhen und Abweichung als Störung dieses Gleichgewichts verstehen. Dafür, dass ein solches Verständnis von Normen und Normalität problematisch ist, sprechen jedoch nicht ‚substanzielle’ gesellschaftliche Wandlungsprozesse, sondern auch theoretische und epistemologische Einwände, die sich z.B. in der ‚konstruktivistischen Wende’ sowie im ‚cultural turn’ der Sozial-, Human-, Kultur- und Geschichtswissenschaften manifestieren. Diese Einwende haben unter anderem etwa dazu geführt, dass die „lange Zeit dominierende Perspektive des Strukturfunktionalismus mit seinem Versprechen einer ‚technischen’ an objektiven Kriterien und Funktionserfordernissen ausgerichteten Analyse sozialer Probleme“ (Groenemeyer 2001: 6) seit den 1970er Jahren ihren erkenntnistheoretisch dominanten Status in den sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen um Normalität, Abweichung und Kontrolle verloren hat. Wenn aktuale individualisierungs- und strukturfunktionalistisch modernisierungstheoretische interpretierten Vergangenheit Diagnosen einer gegenübergestellt im wesentlichen wenden, sind die beobachteten Veränderungen möglicherweise nicht nur - und vielleicht nicht einmal in erster Linie auf die Veränderung des Gegenstands selbst, sondern auch auf perspektivische Veränderungen in der Betrachtung und Analyse des Gegenstands zurückzuführen58 und/oder auf eine „Veränderung politisch-ideologischer Rahmenbedingungen, deren Wirkungsmacht das soziologische [und sozialpädagogische] Denken sich nicht zu entziehen vermochte“ (Schetsche 2000: 46, vgl. Reinarman/Levine 1997). Sofern Abweichung aber - wie in den devianztheoretischen Überlegungen vorgeschlagen (vgl. Kap. II. 2) - als Unterbietung je feldspezifisch wirksamer sektoraler Hegemonien - bzw. als die Delegitimierung von Dispositionen auf Basis der ‚Zumutungen’ und Geltungsansprüche dieser sektoralen Hegemonien gefasst wird, kann die Vorstellung einer einheitlichen, auf den gesamten sozialen Raum aggregierten ‚Normalität’ - die über eine Beschreibung fundamentalster gesellschaftlicher Strukturierungen hinausgeht -, als Grundlage für Herrschafts-, Zurichtungs-, und Kontrollvorgänge aufgegeben werden, ohne die Tatsache der Existenz dieser Vorgänge in Frage zu stellen (dazu auch Alber 2002). Sofern ‚Gesellschaften’ werder substantialistisch noch die Summe einzelner Elemente wie Individuen oder Handlungen gefasst werden, sondern als relationale Gefüge, die in historisch-spezifische Diskursformationen eingebettet sind und sich über Differenzen erschließen (vgl. Bourdieu 1997a, 1997b, Bublitz 2003), so lässt sich davon sprechen, dass sich symbolische bzw. diskursive Formationen – ohne dass damit unterstellt wird, dass sich ihre Reichweite notwendigerweise über den gesamten sozialen Raum hinweg gleichmäßig aufspannt - auch „in Klassifikationen und Teilungspraktiken von erwünschten und verworfenen Subjekten [… materialisieren und damit] So kann auch die ‚Normalisierungsthese’ selbst als Produkt einer Verschiebung von marxistischen und ‚emanzipatorischen’ über ‚alltags-’ und ‚lebenswelttheoretische’ zu modernisierungstheoretischen Perspektiven verstanden werden, durch die der Gesellschaft in der Sozialen Arbeit nicht mehr, wie Mollenhauer einst behauptete ihr ‚schärfster Kritiker’ (vgl. Mollenhauer 1968) erwächst, sondern „ein Anbieter von Dienstleistungen, der gesellschaftliche Anerkennung einfordert“ (Scherr 2000b: 188) In diesem Sinne hat sich unabhängig davon, inwieweit sich ihr Gegenstand selbst substanziellen verändert soziale Arbeit auch nicht zuletzt „in so fern normalisiert […], als sie zu einem ganz normalen Studium und einem ganz normalen Beruf geworden ist, die keineswegs mehr gesellschaftskritischen Motiven verpflichtet sind“ (Scherr 2000b.: 182). 58 226 konstitutiv für das [sind], was als Normalität und Abweichung gilt“ (Bublitz 2003: 84, vgl. Weiß et al 2001). Kontrolle - die ihrerseits einen praxiswirksamen Bestandteil und ein regulatives Element sozialer Relationen darstellt – reagiert aus dieser Perspektive auf ‚Abweichung’ nicht aufgrund einer objektiv bestimmbaren ‚Fehlabstimmung’ in Bezug auf eine gegebene Homöostase, sondern auf der Basis praxislogisch wirksamer symbolischer Hegemonien. Als ein Teil gesellschaftlicher Praxis verweist ihre primäre Verortung weniger auf synchrone Momentaufnahmen des sozialen Raums, sondern primär auf die Dynamiken relativ autonomer sozialer Felder. Die Feststellung einer Auflösung einer funktionalistisch fassbaren, auf die Gesellschaft als Gesamtsystem bezogenen verbindlichen ‚Normalität’ und eine damit verbundene ‚Liberalisierung’ einer für die fordistische Phase des Kapitalismus vergleichsweise deutlich rekonstruierbaren ‚Intoleranz gegenüber Diversität’ (vgl. Young 1999) in Folge von Modernisierungsprozessen mag mehr oder weniger sinnträchtig sein, impliziert aber keinesfalls automatisch einen Verlust gesellschaftlicher Macht, Herrschaft und Kontrolle (vgl. Bauman 1998, Young 1999). Auch wenn Bryan S. Turners (1997: xviii) Einwand, dass eine wesentlich auf die Momente von „Deregulation und Dezentralisierung“ verweisende Neukonstitution moderner Gesellschaften als ‚Risikogesellschaften’ - insbesondere in Bezug auf die Erzeugung von ‚Selbstkontrolle’ und ‚Selbstregulation’ – ‚mehr’, subtilere und systematischere Formen sozialer Kontrolle als bisher benötige, nicht von der Hand zu weisen ist, impliziert eine solche Dynamisierung gesellschaftlichen Ordnungsrahmens jedoch auch keinen einfachen Zuwachs an Kontrolle. Die herrschafts- und kontrolltheoretisch entscheidende Pointe, wie sie im Kontext von machtanalytisch sensible individualisierungs- und risikotheoretischen Überlegungen unterschiedlicher Theoretikern wie etwa Zygmunt Bauman (1997), Robert Castel (1983), Stan Cohen (1985), Mitchell Dean (2000), Mary Douglas (1994), François Ewald (1993), Deborah Lupton (1999) Pat O’Malley (1998), Jonathan Simon (1987) und Henning Schmidt-Semisch (2002) vorschlagen wird, ist eine andere: Dort wo sich traditionelle, ‚fordistische‘ Formen von Zwang, Bindung und Disziplinierung in einem Auflösungsprozess befinden – Foucault hat bereits 1978 darauf aufmerksam gemacht dass es ‚offensichtlich’ sei, dass „wir uns in Zukunft von der Disziplinargesellschaft, wie sie heute besteht, verabschieden müssen“ (Foucault 1994a: 533), da sie inzwischen „‚unökonomische’ und ‚archaische’ Form der Macht“ (nach Lemke 2003: 268) repräsentiere -, entsteht nicht einfach ein herrschaftsfreies Vakuum, sondern es finden sich andere, transformierte oder modulierte, strukturelle und praktischtechnologische Entsprechungen. Diese tendieren nicht nur dazu die Chancen, Freiheiten und Möglichkeitsspielräume der sozialen Akteure in unterschiedlichem Maße zu erweitern oder einzuschränken, sondern auch auf eine neue Weise und nach anderen Mustern und Regelmäßigkeiten verteilen (vgl. Brumlik 1996, Lianos/Douglas 2000, Stehr 2000), wobei jedoch vor allem die ,Verlierer’ in diesem neu geregelten Spiel häufig die selben bleiben. Folgt man der Analyse Langans (1998), kann insbesondere in der Hochphase des fordistischkeynesanischen Wohlfahrtsstaats die Erbringung und Verteilung von Leistungen durch die sozialen Dienste in einem spezifischen Verhältnis von Universalismus und Paternalismus betrachtet werden. Während die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in so fern einen quasi-universalistischen Charakter 227 haben, wie sie zumindest bestrebt sind, verfügbare Leistungen jedem entsprechend seines Bedarf zukommen zu lassen, besteht das paternalistische Moment darin, dass der helfende und kompensierende Staat, seine Leistungen nicht nur erbringt, sondern den Bedarf sowie die Reichweite und die Art und Weise wie dieser zu decken sei, selbst und nach eigenen Kriterien definierte. Unabhängig von der ökonomischen Krise des sozialen Staates und den Fragen der Finanzierbarkeit, impliziert die Fokussierung auf ‚Risiken’ und die Interpretation der Gesellschaft als individualisierte ‚Risiko-’ eher denn als ‚Klassengesellschaft’ einen zentralen Wandel in der professionellen Perspektive. Während es, pointiert formuliert, im fordistischen Sozialstaat der Bedarf der Akteure im Kontext ihrer Lebenslagen bzw. ungleichen sozialen Positionierungen ist, der die Grundlage für eine, die Ergebnisse der Marktmechanismen modifizierende Verteilung der Ressourcen, bzw. der ‚Kapitalen’ durch die sozialen Dienste wie die Sozialpolitik insgesamt repräsentiert, wird im Kontext einer risikosozialen Reorientierung die Frage des Risikos und der ‚Vulneralität’ die Schlüsseldimension, der Verteilung und Versorgung mit sozialen (Dienst)Leistungen (vgl. Kemshall 2002). Steht die Frage von Risiken und Vulnerabilität im Mittelpunkt des Interesses wird damit eine vom ‚Vorsorgestaat’ (vgl. Ewald 1991) unterscheidbare Form der Prävention evoziert, in deren Mittelpunkt weniger eine kollektivistische Absicherungen sondern jene ‚rechtzeitigen Interventionen’ stehen (vgl. Böllert 1996), die es durch eine Etablierung von Wissensbeständen und Techniken einer möglicht frühen Identifizierung erlauben sollen, Risiken der sozialen Akteure möglichst effektiv und effizient abzuwehren ‚bevor es zu spät ist’ (BMFSFJ 1999). Wie Hazel Kampshell (2002: 22) ausführt, widmen sich Sozialpolitik und soziale Dienste in einer als ‚Risikogesellschaft’ rekonstruierten, fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation zunehmend eher der Frage der Verteilungen von Risiken als der „distribution of wealth, and [...] the avoidance of harms rather than the persuit of the collective good“. Dabei wird die modernistische Agenda der fordistischen Sozialpolitik und Wohlfahrtserbringung zunehmend zurückgedrängt und eine Betonung der Kompensation ungleicher Lebenslagen und -chancen durch die Unterstützung der Möglichkeiten der Risikovermeidung im Kontext der ‚riskanten Freiheiten’ des ‚individuellen’ Lebensstils relativiert (vgl. Castel 1986, 1991). Wenn sich in einer fortgeschritten liberalen ‚Risikogesellschaft’ das Opus Operandum der Sozialpolitik und damit verbunden auch der sozialen Dienste verändert hat, kann - vor dem Hintergrund der Prämisse, dass die unterstützenden und kontrollierenden Dimension der Jugendhilfe keine Addition unterschiedlicher und unabhängiger Momente darstellen, sondern wechselseitig aufeinander verwiesene Konstitutionsgrößen ein und der selben Praxis sind - davon ausgegangen werden, dass sich auch die ‚Kontrolldimension’ einer refigurierten Jugendhilfe auf keinen anderen Gegenstand beziehen, als den, auf den sich auch ihre Unterstützungsleistungen richten. Verschiebt sich demnach der Gegenstand Sozialer Arbeit ist ein Verweis darauf, dass die Intensität jener inhaltlichen Strategien mit der sie sich ‚kontrollierend’ auf ihren ‚alten’ Gegenstand bezog hatte abnimmt, eine tautologische Feststellung59. Im Kontext dieser Feststellung ist jedoch die Diese Feststellung kommt etwa der Aussage gleich, dass sich eine Institution, sofern sie sich primär auf das Problem A und nicht auf das Problem B richtet, in erster Linie auf Phänomene die mit dem Problem A in Verbindung fokussiert und nicht die Phänomene die mit B in Zusammenhang gebracht werden 59 228 entscheidende Frage inwiefern der ‚Modus Operandi’ sozialer Kontrolle durch die veräderte Rekonstruktion des ‚Opus Operandum’ - d.h. der sozialen Akteure in einer ‚individualisierten’ ‚Risikogesellschaft’ – eine strategisch, technologisch und teleologisch veränderte Qualität aufweist, aus dem Blick geraten. Damit ist in keiner Weise unterstellt, die Ambivalenzen der ‚Risikogesellschaft’ würden im fachlichen Diskurs der Jugendhilfe nicht thematisiert werden. Ganz im Gegenteil ist der diskurskonjunkturelle Aufschwung der Präventionsorientierung vor allem auf einer fachlich-disziplinären Ebene nicht zuletzt ein Resultat der Einsicht in die Ambivalenzen und ‚Risiken’ der Risikogesellschaft. Eine entscheidende Blindstelle des dominanten ‚modernisierungstheoretischen’ Diskurses liegt jedoch in der ‚realistischen’ Interpretation dieser Risiken (vgl. Lemke 1997, O’Malley 2001b, Sparks 1997) und vor allem in der Art und Weise ihrer (mangelnden) Rückkopplung an die Macht-, Herrschafts- und Kontrollformen wie funktionen der Jugendhilfe. So wird eine Veränderung der Kontrolldimension der Jugendhilfe wird nicht zuletzt durch einen in der modernisierungstheoretischen Fundierung der Präventionsorientierung selbst angelegten - ‚neohegelianischen’ – objektivistisch bzw. naturalisierten ‚Risikorealismus’ induziert60 (vgl. Lemke 1997, Elliott 2002), der die Frage sozialer Risiken – bzw. wie es Luhmann (1993) formuliert der Attributionsvorgang in dem Schädigungen der eigenen Entscheidung zugeschrieben werden - weniger als ein figuratives Element der Organisation sozialer Ordnung61, sondern vielmehr als Ausdruck realer, objektiver Phänomene rekonstruiert, die mit einer im Prozess der Modernisierung erfolgenden In- und Extensivierung der Inanspruchnahme von Natur (vgl. Metzner 2002) als deren soziale Entsprechung einhergehen und sich in Form einer eher außerpolitischen, der Tendenz nach entwicklungslogischen Substitution kollektiver Sinnzusammenhänge durch das Moment der Eigenverantwortung für das eigene Leben zeitigen: „[Thus] uncertainty is rarely analysed as a distinctive modality of governance that is associated with specific ways of problematizing the future, and with associated techniques of the self and technologies of government. It is as if uncertainty is merely vagueness, rather than a specific and enduring way of governing the self, economic activity and social relations” (O’Malley 2000b: 461). Demgegenüber lässt sich mit Blick auf die Organisation fortgeschritten liberaler Gesellschaftsformationen argumentieren, dass – unabhängig von historischen Entwicklung der ‚realen Sicherheit’ menschlichen Lebens (vgl. Kaufmann 1973, Aharoni 1981) - die Rede von der Risikogesellschaft vor allem eine Metapher für Regulationsprozesse darstellt, in der immer weitere Bereiche der gesellschaftlichen Wirklichkeit paradigmatisch über die Dichotomie von Risiko und Sicherheit interpretiert werden (vgl. Groenemeyer 2002: 125, Lianos/Douglas 2000). In dieser Perspektive ist die Rede von sozialen Risiken selbst ein Element der Organisation und Regulation sozialer Ordnungen bzw. der ‚Regierung’ von ‚Subjekten’: Demgegenüber lässt sich behaupten, dass die Rede ‚Risiko’ in der Praxis der Jugendhilfe schon alleine in so fern auf eine diskursive Praxis darstellt als das wahrscheinliche, zukünftige „harmful event or behaviour […] of concern […i]s unsually framed by the type of agency the practitioner works in“ (Kamshall (2002: 123). 61 Ein besonders deutliches Beispiel hierfür ist es, wenn etwa Ulrich Beck konstatiert, dass sich Risiken ‚beyond insurability’ zeitigen, die Risikogesellschaft sei deshalb „an uninsured society“ (Beck 1999a: 53). Damit gerät die Frage aus dem Blick 60 229 „Risk is […] a way in which we govern and are governed. It is a name given to their characteristic elements by particular programmes that seek to govern our consumption and lifestyle, our exposure to certain hazards, or, indeed, whatever is to be governed in the name of risk” (O’Malley 2000a: 458). In einem gewissen Sinne lässt sich der modernisierungstheoretische ‚Risikorealismus’ demnach selbst als Hinweis für eine veränderte Form des ‚Regierens’ verstehen. Für die Soziale Arbeit impliziert er vor allem eine (neo-)ätiologische Orientierung, die in ihrer Konsequenz zu jener ‚ordnungspolitischen Hegemonie’ (vgl. Kappeler 2000) zu führen droht, die in der programmatischen Konnotation der ‚fachlichen Präventionsorientierung’ gerade abgelehnt bzw. überwunden werden sollte. Eine risikorealistische Begründung der Präventionsorientierung impliziert es nämlich, ‚Risiken’ und ‚Risikofaktoren’ in einer naturalisierten Form ernst zu nehmen (vgl. Kunstreich/Peters 1990) und gerade deshalb proaktiv zu bekämpfen, damit nicht reaktiv gegen die unterstellten negativen Folgen – genauer: den irreversiblen, teuersten, schlimmsten etc. Fall (vgl. Ewald 1998) - interveniert werden muss62. Dabei induziert die präventive Logik, sich auf die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von kalkulierbaren Gefahren, d.h. von Risiken zu beziehen - womit die von Yair Aharoni (1981) mit Blick auf den Wohlfahrtstaat konstatierte ‚No-Risk Society’ in Bezug auf gegenwärtigen Rationalitäten der gesellschaftlichen Regulation eine im Kern treffende Diagnose als die der ‚Risikogesellschaft’ darstellt – je nach der Allgemeinheit bzw. Spezifität der identifizierten Risiken zwei unterschiedliche Interventionslogiken der Jugendhilfe. Eine gegenüber eher unspezifischen Risikopotentialen unterstellte „Ubiquität der Risiken der selbstzurechenbaren Lebensführung erfordert eine tendenziell alle Mitglieder der Gesellschaft umfassende Unterstützung bei der Risikokalkulation und -abschätzung“ (Schaarschuch 2003: 60 f) im Sinne einer ‚klugen’ und verantwortlichen Form einer rationalen Lebens- bzw. Selbstführung (vgl. O’Malley 1992, Krasmann 2000a). In einem gewissen Sinne wird der durch die ‚Normalisierungsthese’ reklamierte Anspruch auf eine tendenzielle soziale ‚Allzuständigkeit’ aufgrund einer ‚generalisierten Risikostruktur’ - der in fortgeschritten liberaler Gesellschaften niemand zu entkommen scheint (vgl. Giddens 2000a) - in ‚ironischer Weise’ eingelöst (vgl. Schaarschuch 2003). Basis für diese Einlösung ist eine durch eine Refiguration der ökonomischen, politischen und symbolischen gesellschaftlichen Organisation induzierte Ausweitung sozialer Prekarisierung (vgl. Bourdieu 1998a) - bzw. dessen, was wie sie Gesellschaften mit Blick auf die Kontingenzbearbeitung von Risiken organisieren, und welche Risiken durch diese Organisation produziert werden (dazu: Ewald 1993). 62 Zwar wird kritisiert, dass eine häufig einseitige Ausrichtung der präventiven Interventionen der Jugendhilfe auf eine Verhinderung von Risiken und Abweichungen, die von Kindern und Jugendlichen ausgehen, kaum mit den Arbeitsprinzipien der Jugendhilfe vereinbar ist (vgl. Frehsee 1998, 2001, Lindner/Freund 2001, Krafeld 1992, Schmitt-Zimmermann 2000 Thiersch/Specht 1981) allerdings ist die gerne zitierte Differenz diesem scheinbar auf ordnungspolitische Aspekte verweisenden Präventionsbegriff, und einer Legitimation präventiver Strategien mit Blick auf die Risiken denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind bzw. sich selbst aussetzen – wie es etwa in der zeitgenössischen Rede von „potenziell viktimogen erscheinenden Situation[en]“ (Heinz 1997: 66) zu Ausdruck kommt - keineswegs trennscharf: beide Dimensionen des Risikos werden unter ‚Risikoverhalten’ subsumiert (vgl. Raithel 2001, 2002) und legitimieren häufig die selben Formen der Intervention (vgl. Groenemeyer 2001, Sparks/Leacock 2002) und zwar insbesondere wenn es gelingt Kinder und Jugendliche gleichzeitig selbst als Träger jener Risiken zu offerieren, vor denen sie präventiv geschützt werden sollen (Kappeler 2000: 24, Kemshall 2002a). (Diese Tendenz zeigt sich besonders deutlich in der hauptsächlich ‚kriminalpräventiven’ Rede von „gefährdete[n] und gefährliche[n] Kinder[n] und Jugendliche[n]“ [Diakonisches Werk 1999] bzw. von Kindern und Jugendlichen als ‚Opfer und Täter’ [vgl. BMI/BMJ 2001, DVJJ 1999]) . 230 Bauman (1998) als ‚existential insecurity’ und ‚psychological uncertainty’ nennt -, sowie die Tendenz, immer weitere Bereiche der sozialen Wirklichkeit symbolisch über Sicherheit und Risiken zu dechiffrieren (vgl. Groenemeyer 2001, Kemshall 2002, Lianos/Douglas 2000, O’Malley 1996, 2001). In diesem Zusammenhang weitet sich ein gesellschaftlicher Regulationsanspruch aus (vgl. Turner 1997), der sich im Sinne einer verallgemeinerbaren Form des ‚Risikomanagements’ (vgl. Kemshall 2002, 2002a, O’Malley 1998) als Perspektive der Institutionen sozialer Regulation und als ‚normative’ Aufforderung an einzelne ‚selbstverantwortliche’ Akteure etabliert (vgl. Beste 2000a, Legnaro 1997, 1998, Schmidt-Semisch 2002, O’Malley 1992). Diese Verschiebungen implizieren jedoch kein ‚Abschmelzen’ sozialer Kontrolle und herrschaftlicher Zumutungen, sondern eine andere Form der ‚Regierung’ im Sinne der Etablierung eines veränderten Modus der Verknüpfung der Führung mit der Selbstführung der ‚Subjekte’, in dessen Kontext jene (soziale) ‚Sicherheit’, die der fordistische Interventionsstaat tendenziell jedem Bürger versprochen hatte (vgl. Kaufmann 1973), durch die Herausbildung eines vielseitigen, die einzelnen Akteure ‚responsiblisierenden’, präventiven Risikomanagements – das mit der Figur des selbstverantwortlichen Kunden und seiner (konsumeristischen Wahl-)Freiheit harmonisiert - als Bestandteil einer Restrukturierung sozialer Ordnung konterkariert wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Generierung eines, wie es Pat O’Malley (2000b: 461) formuliert, „stance of reasonable foresight or everyday prudence (distinct from both statistical and expert-based calculation) with respect to potential harms”: „In a sense, the subjects of this technology of risk are imagined as consumers (albeit ,sovereign consumers’), for, as elsewhere in discourses of the freedom of choice, their liberty exists in the capacity to choose rationally among available options and to assemble from these the risk minimizing elements of a responsible lifestyle” (O’Malley 2000b: 465). Im Gegensatz zu der tendenziell generalisierten Regulationsrationalität gegenüber eher unspezifischen sozialen Risikopotentialen, gewinnt vor allem mit Blick auf die in sozialer, ökonomischer, kultureller und symbolischer Hinsicht eher deprivierten Akteure eine Form der Risikoregulation an Bedeutung, die sich in Anlehnung an Henman (2002: 4) als „profiled risk government“ beschreiben lässt. Dabei geht es um Interventionen in die Lebenspraxis der Akteure, die, im Gegensatz zur allgemeinen Förderung einer selbstverantwortlichen risikominimierenden Lebensführungsrationalität, auf „statistical and expert-based calculation[s]“ beruhen (O’Malley 2000b: 461). Im Mittelpunkt dieser interventionistischen Risikoregulation steht ein Fokus auf spezifizierbare ‚Risikofaktoren’, der eine beträchtliche Aufwertung gegenüber der Frage einer kompensatorischen Bearbeitung von Lebensführungsproblemen, die - im Sinne der Risikoregulationslogik des Sozialen - mit Ungleichheits-, Herrschafts-, bzw. Klassenverhältnissen in Zusammenhang gebracht werden. Sowohl die Frage der ‚tieferliegender Ursachen’ als auch die Frage der je ‚individuellen Ursache’ eines ‚Problems’ relativieren sich dabei gegenüber eher pragmatischen Versuchen einer Reduktion von Probleminzidenzraten. Diese Verschiebung hängt eng mit den auf die Möglichkeiten der Prädiktion verwiesenen Interventionsrationalitäten einer problemspezifischen Präventionsstrategie zusammen. Die dieser Form der Prävention zugrunde liegende Basisoperation der Prädiktion bezieht sich auf aggregierte ‚Risikofaktoren’, oder genauer auf das Verhältnis von ‚Risiko-’ und ‚protektiven’ Faktoren (vgl. Hawkins et al. 2000). Ein solcher Bezug ist ein unsuspendierbarer Bestandteil einer 231 ‚problemspezifischen’ Form der Prävention, denn während die je individuelle Ursache eines Problems nur ex post rekonstruiert werden kann, zielen diese Formen der Prävention ja darauf proaktiv d.h. vor einer spezifischen Probleminzidenz anzusetzen. Damit ist solche fallspezifische Rekonstruktion der Ursachen ‚des Problems’ ausgeschlossen: rekonstruiert werden können nur die Faktoren, die mit dem in den Blick genommen Problem in einen entwicklungsdynamischen Zusammenhang gebracht werden können. Solche Risikofaktoren sind mit dem je individuellen Ursachenzusammenhang eines Problems weder gleichzusetzen, noch als eine individuelle Prädiktion in einem empirischen Sinne besonders aussagekräftig (vgl. Sampson 2000). Risikofaktoren sind keine ‚Ursachen’ (vgl. Farrington 2000), sondern jene mit dem Symptom korrelierende Faktoren, bei denen die Wahrscheinlichkeit der Problemprävalenz „increases as they intensify or clustering increases“ (Farrington/West 1993). Diese Cluster von Risikofaktoren sind die Basis für das „systematisch[e] Suchen und Herausfiltern potentieller Zielgruppen“ (Vlek 2000: 210), das die Voraussetzung für spezifische Formen der Prävention darstellt (vgl. Vlek 2000, Reese/Silbereisen 2001): „Risky subpopulations are defined by characteristics of individuals […] thereby constituting risk profiles. These profiles are typically constructed using statistical analysis to identify characteristics that have a greater probability of danger than the average population. Once defined, the risk population defined by these profiles is identified and acted upon. […] In contrast to [… a generalized] risk government, which operates by spreading risks across the whole (insured) population, profiled risk government operates by dividing the population into two groups constituted by those individuals fitting the risk profile who are the locus of government and who bear the cost of the risk though do not necessarily bear the danger/pathology, and those who do not fit the profile. In short, risk is associated with group membership“ (Henman 2002: 4). Auf der Ebene Wissensgenerierung korespendiert mit dieser Präventionsperspektive die Forderung, nach genauen Analysen, Daten und Forschungen darüber, was am effektivsten funktioniere, um die Präventionsbemühungen danach auszurichten (Baumgärtner 2002, BMFSFJ 2002, Reese/Silbereisen 2001, Schäfer 2000). Prävention in diesem Sinne impliziert eine Orientierung an ‚Outcomes’, die sich durch eine auf die Ebene spezifischer, identifizierbarer Gruppen bzw. Kohorten (‚target groups’) aggregierte Prävalenzrate der zu verhinderten Probleme bestimmt und verweist auf Interventionen, die sich auf jene Faktoren bzw. Faktorencluster richten, die mit diesem ‚Outcome’ korrelieren (vgl. Hollin 2001, Hope 2002, Hughes 2001, Matthews/Pitts 2001). In diesem Sinne lässt sich mit Robert Castel (1983: 51) davon sprechen, dass Prävention „mit der Auslösung des Begriffs des Subjekts oder des konkreten Individuums verbunden [ist], der durch einen Komplex von Faktoren, die Risikofaktoren, ersetzt wird“ . Sind diese Risikofaktoren ausgemacht, kann eine zielgerichtete in ihren Wirkungen messbare Prävention beginnen, während die ‚klassische’ Frage ‚nach ‚sozialen Ursachen’ bzw. warum und unter welchen Bedingungen sich diese Faktoren ‚clustern’, zunehmend zu einer mehr oder weniger belanglosen akademischen Sophisterei wird, die keinen Beitrag zu einer effektiven, effizienten, zielgerichteten und vor allem möglichst praktikablen Präventionsstrategie zu leisten in der Lage ist (vgl. Felson 1998, kritisch: Matthews/Pitts 2001)63. Betracht man sich jedoch die ‚Target Group’, die an die Stelle eines Begriffs des ‚Subjekts’ rückt, so ironischerweise auf, dass im Kontext einer solchen Risikofaktorenanalyse unter der Hand ein vor allem „[D]o not wory about academic theories“ fordert folgerichtig Felson (1998: 166) von Professionellen und Praktikern im präventiven Bereich: „Just go out and gether facts“. 63 232 im Laufe der 1980er Jahre mühsam überwundener Prototyp des ‚typischen Klienten’ re-installiert wird. So möchte etwa David Farrington (1997) in seiner Längsschnittuntersuchung zur frühen Vorhersage (‚early prediction’) von Jugendgewalt nachgewiesen haben, dass die Wahrscheinlichkeit einschlägig auffällig zu werden mit spezifischen, identifizierbaren Risikofaktoren steigt. Liegt im Kindesalter keiner dieser ‚Risikofaktoren’ vor, liege die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solches Problem im Jugendalter manifest werde bei drei Prozent, bei einem Cluster von vier Risikofaktoren bestehe bereits eine Wahrscheinlichkeit von 31 % (vgl. auch Lipsey/Derzon 1998). Auf dieser Basis, so das Versprechen, lassen sich nicht nur frühzeitig ‚Risikosubjekte’ identifizieren, sondern auch Programme gestalten, die so ausgelegt sind, dass sie sich möglichst gezielt und spezifisch auf die Minimierung des Risikofaktors bzw. der Risikofaktoren richten, die am einfachsten, effektivsten und vor allem billigsten zu bearbeiten sind, um den gewünschten ‚Outcome’ zu erreichen. Ein ‚theoretisches’ bzw. ‚professionelles’ Verständnis über die ‚Ursachen’ des Problems ist nicht erforderlich (vgl. Kemshall 2002a, MacDonald 2002). Diese Form des ‚profiled risk government’ (Henman 2002: 4), wirkt nicht nur auf die Begründungen, Technologien und Strategien der ‚präventiven’ Interventionen, sondern auch auf die ‚Subjektivierung’ der Adressaten der Risikoregulationsstrategien. Typische ‚Risikofaktoren’ sind etwa Schulversagen, niedriges Familieneinkommen, große Familiengröße ‚poor parental childrering behaviour’ Desorganisation in der Wohngegend, einschlägiger Einfluss von peers, Fragen des ‚nonverbal IQ’ (man denke an die Arbeiten Bernsteins [1972]), ‚antisoziale’ Einstellungen der Eltern und so weiter (vgl. Farrington 1997, Hawkins et al. 2000, Lipsey/Derzon 1998). In dieser Hinsicht lässt sich davon sprechen, dass ein ‚Cluster’ dieser Risikofaktoren, ziemlich genau der Kategorie entspricht, die - aus der Perspektive der Fürsorgeerziehung betrachtet - ‚Verwahrlosung’ heißt. Während wenig Zweifel daran bestehen dürfte, in welchen sozialen Klasse sich diese Faktoren ,clustern’ (vgl. Ahlheim et al. 1972, Herriger 1979, Hollstein/Meinhold 1973) und trotz der damit implizierten Nähe des so rekonstruierten ‚Risikosubjekts’ zu dem ‚verwahrlosten Subjekt’ der Fürsorgeerziehung, sind mit dem Bezug auf diese Risikofaktoren drei wesentliche - ‚post-fordistische’ Verschiebungen in den Interventionsrationalitäten der Jugendhilfe impliziert. Die, zumal in einer ‚risikorealistischen’ Perspektive festgestellte, Ubiquität und strukturelle Unsuspendierbarkeit von ‚Risiken’ bzw. eines ‚generellen Risikoklimas’ in ‚Risikogesellschaften’ gesetzt, impliziert dies handlungs- und konzeptionslogisch eine Form personenbezogener sozialer Dienstleistungserbringung, die nicht sich nicht auf die (unmögliche) ‚Eliminierung’ von Risiken, sondern nur auf deren möglichst effektives ,Management’ konzentriert. Risikomanagement bezieht sich auf verschiedene Strategien zur Risikoreduktion und Schadensminimierung (vgl. Kamshall 2002, Parsloe 1999). Mit Blick auf Strategien, die sich auf das Verhalten der Adressaten beziehen, verschiebt sich der Fokus von Fragen der Non-Konformität - mit Referenz zur ‚Normalität des Fordismus’ – hin zum personalisierbaren bzw. persönlichen Risikoverhalten (und dessen Zerlegung in Faktoren). Der Bezug auf Risikofaktoren - die im Gegensatz zu der als ‚Konstruktion’ erkannten Frage der ‚Abweichung’ im risikorealistischen sozialpädagogischen Diskurs als ‚naturalisierte’ (und messbare) ‚Tatsachen’ verhandelt werden (kritisch: Thompson/Wildavsky 1982, Kunstreich/Peters 1990) - treibt dabei eine Relativierung der 233 Dominanz des professionellen Wissens (vgl. Otto/Dewe 2001) gegenüber einem klinischdiagnostischen ‚Risiko-Assessment’ voran (vgl. Kemshall 2002, 2002a, Ziegler 2003). Die dritte Verschiebung besteht darin, dass es mit dem Bezug auf Risiken nicht mehr ausschließlich darum geht, die ‚Lücke’ zwischen der positional-dispositionalen Matrix und fixierten Normalitätsunterstellungen zu schließen. Die Bearbeitung bzw. ein Management von Risiken bedarf in einer fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformation nicht zwangsläufig einer ex ante fixierte Normalitätskonstruktion und einer Feststellung der ‚Entfernung’ der Akteure von dieser Normalität als Grundlage ‚präventiver’ Strategien. Die Frage des Risikos und vor allem die ‚Entdeckung’ der ‚protektiven Faktoren’64 evoziert vielmehr auf die Hervorbringung einer Form der Lebensführung gerichtete Maßnahmen, deren Zentrum die ‚risikosoziale Dreifaltigkeit’ persönlicher Vorsicht, kalkulatorischer Rationalität und persönlicher Selbstverantwortung („prudence, rationality and responsibility“ Adams 1995: 16) bildet: „Managing their own relation to risk has become an important means by which individuals can express their ethical selves and fulfil their responsibilities and obligations as ‚good citizens’“ (Petersen/Lupton 1996: 65). Der ‚Wille zum Empowern’ (Cruishank 1999) bzw. Versuche des ‚Stark-Machens’, der ‚Ermutigung’ des Einzelnen als sein eigenes ‚Planungsbüro’ usw., die an Stelle des ‚passiven’ ‚Versorgenlassens’ wie an Stelle der klassischen ‚pädagogischen’ Figuren des ‚Formens’ (der Pädagoge als ‚Bildhauer’) oder des ‚Wachsenlassens’ (der Pädagoge als ‚Gärtner’) treten, verweißen auf nichts anderes. In seiner Analyse über die Veränderung der Muster von sozialer Kontrolle und Selbstkontrolle macht Cas Wouters (1999) darauf aufmerksam, dass die Subjektrepräsentationen und die Regulationsweisen fortgeschritten liberaler Gesellschaften, weniger auf Formen sozialer Kontrolle beruhen, die die normative Einbindung der sozialen Akteure in die verallgemeinerten Standards gesellschaftlicher Normalitätskonstrukte erzwingen, als vielmehr auf der individuell kalkulierenden und flexiblen Selbstkontrolle selbstverantwortlicher ‚Subjekte’: „only a more ego-dominated self-regulation allowed for the reflexive and flexible calculation that came to be expected“ (Wouters 1999: 416). So fern sich diese Selbstkontrolle external kaum direkt ‚erzeugen’, wohl aber ‚stimulieren’ lassen, kann eine solche arrangierte Kontrollrationalitäten auch als eine modifizierte Form jener funktionalistischen Perspektive auf soziale Kontrolle verstanden werden, die identifizierbare und unterscheidbare Kontrollobjekte und Kontrollsubjekte kennt. Die Modifikation besteht darin, dass das Kontrollobjekt und -subjekt (scheinbar) zusammenfällt. Je stärker der Eindruck dieser Identität ist, desto latenter und ‚unsichtbarer’ – d.h. nicht weniger ‚effektiv’ oder ‚erzwingend’ - ist der Kontrollcharakter: ,Selfregulation’, so Winkler (1975: 125) „has always been the cunning ruler’s form of social control, to make people believe they rule themselves. Today we do not talk of ‘self-regulation’. Instead we call it ,participation’”. Internalisierte Selbstkontrolle, kalkulatorisches Risikomanagement und individuelle Verantwortung, statt einer externalen – mitunter gängelnden und bevormundenden - Organisation, 64 Pat O’Malley (2001: 99) spricht von einer ‚invention of the protective factor’ vor allem seit den 1990er Jahren: „[The]emergence of the ‚protective factor’ […is] a part of a process of risk sequencing that defines precise strategies for governing risk in ways that do not address the prime risk factor itself. Where this is the case, and it very often is, two kinds of explanation are given. The first […] points out that certain risk factors are recognized, but that they are not amenable to minimization, at least in practical and foreseeable terms. The second argument suggests that such risk factors somehow are inadequate predictors and thus may be, in some fashion, discounted as targets for intervention” (O’Malley 2001: 99). 234 Überwachung und Instandhaltung einer verallgemeinerbaren, sozialen Normalität sind nicht nur Indikatoren für eine ‚Befreiung’ des Subjekts aus - ‚moralisch autoritären’ - Kontrollzumutungen, sondern auch Effekt einer fortgeschritten liberalen politischen Rationalität einer Privatisierung ‚sozialer’ Probleme und Risiken. Die Privatisierung sozialer Risiken wird einer Politik sozialer Probleme begleitet, die weniger darauf gerichtet ist, diese ursächlich und umfassend zu lösen, als auf einer aggregierten gesellschaftlichen Ebene ihre performative Kontingenz zu managen und auf der individuellen Ebene als ‚Bewältigungsmoderation’ dazu beizutragen, ihre individuellen Effekte abzufedern und auszubalancieren. Die impliziert nicht nur, dass die umfassende, ‚top-down’ gewährleistete ‚administrative Solidarität’ zu eher residualen Formen der Unterstützung und sektoralen Sicherung sozialer Integration umgestaltet wird - deren ‚Qualitätskriterium’ nicht mehr das Ausmaß der DeKommodifizierung ist (vgl. Lessenich 2000) -, sondern auch eine andere politische Rationalität der Risikoabsicherung: „Die heutige Versicherung gegen Risiken ist nicht mehr der auf die Zukunft gerichtete Akt eines ‚Wir’ auf der Basis einer bekannten Vergangenheit, sondern der aus einer unbekannten Zukunft rückwärts gerichtete Akt eines ‚Ich’ eines alleinigen Unternehmers seines persönlichen Schicksals“ (Fitzpatrick 2001: 34, vgl. Klein/Millar 1995) Kontrolltheoretisch impliziert dies die Etablierung eines Kontrollstils der, zumindest in einzelnen Bereichen, nicht nur vergleichsweise erweiterte Freiheitsspielräume für die ‚biographischen Selbstentscheidungen’ des Subjekts zulässt, sondern selbst nur auf der Basis einer (regulierten) Autonomie selbstverantwortlicher – aber zur ‚Vorsicht’, Eigenvorsorge und einem ‚vernünftigen’ Lebensstil angehaltener – Subjekte wirken kann. Es geht in diesem Sinne weniger um eine Kontrollrationalität die – wie im fordistischen Interventionsstaat - der gleichermaßen normierend und fürsorglich in die Lebensführung des Individuums eingreift, sondern um eine Kontrollrationalität die die Eigeninitiative und Selbstverantwortung der Individuen betont und zum Ausgangspunkt einer fortgeschritten liberalen ‚Governance’ macht, deren Leitidee als eine Form des ‚Regierens’ beschrieben werden kann, die weniger auf einer Unterdrückung von Subjektivität und die Herrschaft über die Freiheit der Individuen beruht, als auf einer Regierung durch Freiheit der Subjekte hindurch (vgl. Legnaro 1998, Krasmann 1999, Garland 1997,2001). Aus dieser Perspektive liegt die Pointe des Empowerns, ‚Stark-Machens’, der Mobilisierung ‚dezentraler Selbsthilfe- und Selbstorganisationskräfte’, des Ermutigens des Einzelnen als ‚Planungsbüro in eigener Sache’ etc. um „aus der Klientel des fürsorglichen Staates verantwortliche Subjekte“ (Wendt 1993: 261, vgl. Fretschner et al. 2003, Keupp 1996) zu machen darin, dass die Fähigkeit ‚richtige’ Entscheidungen ‚frei’ zu treffen (vgl. Castel 1983) gefördert, ausgebaut und als Handlungskompetenz internalisiert werden soll. Im Umkehrschluss zeigt die ‚falsche’ Entscheidung zu treffen „einen Mangel an Selbstverantwortung und Rationalität und damit auch eine Unfähigkeit freie Entscheidungen treffen zu können“ (Groenemeyer 2001: 52, vgl. Cruikshank 1999) an, der andere Interventionsformen ‚notwendig’ macht. Zwar erfolgt in diesem Kontext zunächst durchaus eine ‚Überwindung’ eines Defizitmodells zu Gunsten des Ansetzen an den ‚Stärken und Ressourcen’ der Adressaten, die eine Verschiebung der Regierungsund Kontrollstrategie weg von dem direkten Versuch der ‚Formung des Guten’ hin zu einer 235 ‚Identitätspolitik’, als Führung der Lebensführung (‚conduct of conduct’) (vgl. Foucault 2000) anzeigt, aber diese ist trotz der Betonung individueller Autonomie und Verantwortung – in den Worten von Nikolas Rose (1993: 295) „the shaping an utilizing the freedom of autonomous actors“ - ist eben nicht auf eine ‚ziellose’ Stärkung und Erweiterung von Handlungsfähigkeit, Selbststeuerung, Selbstbewusstsein bezogen. Verbunden mit dem Aufstieg einer ‚fortgeschritten liberalen’ Form der Regulation und Organisation sozialer Ordnung, lassen sich Formen der ‚Regierung durch Individualisierung’ (vgl. Lemke 2003: 272) rekonstruieren, die auf ein verändertes Verhältnis von Individuen und der staatlich kollektivierten Form der Gesellschaftlichen verweisen. Sie zielen vor allem die „production of certain subjects who are prepared to take responsibility for their own actions in their relations with others […requiring] the practice of ethical techniques for self-inspection and self regulation through choice“ (White/Hunt 200: 111). Im Mittelpunkt des ‚Regierung’ steht demnach eine vor der ‚Ermächtigung’ der Akteure, die darin besteht einen Habitus zu erzeugen, der es erlaubt, die Führungskapazitäten vom Staat weg und in die Verantwortung und Rationalität der Lebensführung der einzelnen Akteure zu legen. In diesem Sinne zielt das Empowerment tatsächlich darauf Beschränkungen der Akteure zurückzudrängen und eigenverantwortliches Handeln nicht zuzulassen und zu ermöglichen, sondern sie dazu bewegen bzw. es den je einzelnen Akteuren abzuverlangen (vgl. Cruikshank 1999, Lemke 2003). Dies Logik lautet es seien nicht nur und nicht primär sozial-strukturelle Größen „which decide whether unemployment, alcoholism, criminality, child abuse etc. can be solved, but instead individualsubjective categories. [The related notion of] ,self esteem’ thus has much more to do with self assessment than with self respect, as the self continuously has to be measured, judged, and disciplined in order to gear personal ,empowerment’ to collective yardsticks” (Lemke 2002: 62). Die im Empowerment angelegte Form der Kontrolle orientiert sich dabei „implizit oder explizit an einem Modell von ‚lifestyle correctness’“ (Gronemeyer 2001: 52). Neben deren Organisation über die Selbst-Kontrolle der Akteure finden sich Bemühungen um die Implementation eines Arrangements das „auf informelle soziale Kontrollen des Entzugs von Solidarität baut“ (Gronemeyer 2001: 52) und schließlich die residuale Möglichkeit eines Rückgriffs auf instrusivere und disziplinierende Kontrollstrategien bestehen, die diese ‚lifestyle correctness’ „über direkte Sanktion und Repression eingefordert“ (Gronemeyer 2001: 52) aber sich auf jene Akteure und Gruppen reduzieren können, die sich nicht entsprechend ‚empowern’ lassen können oder wollen. Dass die ‚Empowerment’ Ansätze zwar nicht ‚weniger’ aber häufig eine ‚weichere’ Form sozialer Kontrolle darstellen, spricht zunächst für und nicht gegen diese Ansätze. Für die Soziale Arbeit als eine Instanz sozialer Kontrolle, der es - ‚professionsstrategisch’ wie ‚professionsmoralisch’ - entspricht ihren Nutzern mit einem Minimum an ‚repressiven’ Elementen und möglich einvernehmlich zu begegnen (vgl. Peters 1995, 2002) - d.h. in Bezug auf ihr (Hilfe- und) Kontrollmoment eine Art ‚WinWin-Situation’ zu erzeugen –, können Strategien des ‚Empowerment’ insbesondere dann, wenn sie auf eine ‚Befähigung’ zur gesellschaftlichen Teilhabe als demokratische Staatsbürger zielen (vgl. Schaarschuch 1999, Cruikshank 1999) durchaus angemessen sein. Eine ‚Gefahr’ besteht allerdings darin, dass die ‚Empowerment’ Ansätze im ‚Gebrauchswert’ für ihre Adressaten, hinter die ‚paternalistischen’ und ‚stigmatisierenden’ ‚Defizit-Ansätze’ zurückfallen können, wenn sie sich - wie in 236 ihrer dominanten Variante – nicht vornehmlich an einem ‚empowern’ gegenüber Machtstrukturen (zu dieser ‚radikalen’ politischen Variante vgl. Bachrach/Botwinick 1992, Greener 2002), sondern dispositional ausrichten und politisch als ein ‚Zauberwort’ verwendet werden, die einen Euphemismus für die Strategie darstellen, den Benachteiligten und Subdominanten dadurch zu mehr Autonomie und Selbstverantwortung zu verhelfen, dass ihnen die Leistungen und Rechte gekürzt werden (vgl. Stern 1999, 2000). Die ‚Defizitansätze’ sind – ungeachtet der Kritik an ihrem stigmatisierenden Gehalt – auf einer legitimatorischen Ebene letztlich dazu gezwungen, die tatsächlichen oder vermeintlichen Hintergründe und Ursachen für die erkannten ‚Defizite’ und ‚Schwächen’ zu bearbeiten. Auch wenn diese Bearbeitung häufig auf eine individualisierende und mitunter pathologisierend Weise erfolgte (vgl. Peters 1969), war zumindest für die Jugendhilfe die Grundausrichtung eine gesellschaftsreformerische (vgl. Brumlik 2000a): die Bearbeitung der positional-dispositionalen Matrix der Akteure als ‚reaktiver Bedingungsveränderung’ (vgl. Peters 1995). Im Rahmen einer Orientierung an den gegebenen ‚Stärken’ und einer netzwerkbezogenen Förderung jener individuellen und gemeinschaftlichen Ressourcen (vgl. Enke 1998), die aktual bereits vorliegen, ist demgegenüber eine Bearbeitung zugrunde liegender gesellschaftlichen Bedingungen keinesfalls zwingend. Untersuchungen von Barbara Cruikshank (1999) zu den Empowerment-Programmen in den USA, verweisen z.B. darauf, dass diese mit dem Versprechen den ‚demokratischen Bürger’ zu stärken angetretenen Strategien, - ebenso wie in dem in der Bundesrepublik virulenten Diskurs - darauf gerichtet sind, die ‚lebensweltlichen’ Potentiale und insbesondere das Wissen deprivierter Akteure um ihre eigene Situation nicht durch ‚bürokratische Bevormundung’ zu überformen, sondern dafür zu nutzen, ihre Lage zu verbessern. „Dass dies jedoch nicht unbedingt dazu führt, Macht auf die Betroffenen zu übertragen und die gesellschaftlich strukturellen Ursachen für Kriminalität, Armut etc. zu beseitigen, sondern allein erst mal eine veränderte Einstellung der Betroffenen erzeugen soll ist die Kehrseite dieser ‚self-esteem’-Bewegung. Vielmehr werden so gesellschaftspolitische Probleme privatisiert und individualisiert um auf der subjektiven Ebene ein Gefühl von subjektiver Ermächtigung zu bewirken [… Dabei ist es] nicht die verarmte oder stigmatisierte Bevölkerung selbst, die sich selbst ermächtigt, sondern Regierungsprogramme, die dieses organisieren“ und im Falle des Scheiterns die der ‚Apathie’ der Betroffenen verantwortlich machen können (Wöhl 2003: 134). Die habituelle Inkorporierung eigener ‚Stärken’ im Rahmen einer durch materielle und symbolische Macht(mittel) und deren differentiellen Verteilung strukturierten Lebensweise kann ebenso wie die „constraints the previous actions place upon the present“ (Greener 2002: 698) ignoriert werden, wenn es darum geht innerhalb des Gegebenen ‚Handlungsfähigkeit’ - im Sinne der Kompetenz ‚selbstverantwortlich’ ‚richtige’ Entscheidungen zu treffen - zu ermöglichen und wenn diese Entscheidungen im Kontext individueller Dispositionen bzw. des ‚Humankapitals’ der Akteure interpretiert und in so fern ‚privatisiert’ werden. Dabei sind strukturelle Fragen ausgeklammert, bzw. auf die Frage des ‚richtigen’ Handelns unter gegebenen Bedingungen oder die mangelnde oder fehlerhafte individuelle Kontrolle dieser Bedingungen durch den einzelnen sozialen Akteur reduziert (vgl. Gronemeyer 2001, Krafeld et al. 1998). In dieser Hinsicht stellt ‚Empowerment’ in seiner individualisierenden Variante (vgl. Cruikshank 1993) letztlich ein sozialpädagogisches Äquivalent zu der sozialpolitischen Agenda dar, auf das ‚Rudern’ zu verzichten und ‚steuernd’ brachliegende Ressourcen und Potenziale zu aktivieren. ‚Aktivierung’ und ‚Empowerment’ bleiben auf die 237 unmittelbaren ‚Gründe’ und Zusammenhänge von ‚Problemen’, ‚Abweichungen’, ‚Konflikten’ etc. sowie auf die unmittelbaren Möglichkeiten ihrer Kontrolle und Regulation beschränkt, während der Frage strukturellen Bedingungsmatrix vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Empowerment-Ansätze sind mit Bezug auf ihre Interventionsmittel Ansätze, die nicht auf die Ausweitung von ‚legal-kapitalbasierten’ Ansprüchen (‚entitlements’) oder die Redistribution von ökonomischen Ressourcen zielen, sondern vornehmlich - wenn nicht ausschließlich – auf die (individual)habitusformierende Wirkung sozialen und kulturellen Kapitals setzen. Insbesondere in ihrer Kopplung mit ‚präventiven’ Überlegungen sind Interventionsimplikationen die Empowerment Ansätze zwar nicht zwangsläufig intrusiv, dafür aber umso expansiver. Da man nie genug und nie früh genug ‚empowern’ kann, werden in einer Kopplung mit dem ‚präventiven Blick’ mehr oder weniger zudringliche und umfassende Formen der Strukturierung von Lebensräumen, Regulierungen von Partizipationsmöglichkeiten und Zugangsansprüchen sowie Einengungen praxislogischer Aneignungsmöglichkeiten in das Vorfeld eventuell möglicher Störungen, Gefährdungen und Risiken verlegt (vgl. Frehsee 1998: 130). Gerade in den Händen der Protagonisten jener Konzepte, die auf die Notwenigkeit primärer Prävention verweisen, erweitert sich der gierige Anspruch einer ‚diffusen Allzuständigkeit’ in ein unbestimmtes Vorfeld potentieller Inzidenzen (vgl. Lindner/Freund 2001). Letztlich werden die möglichen Interventionsanlässe prinzipiell ins Unendliche verlängert, während die Interventionen selbst sowohl von den Beschränkungen und Notwendigkeiten der Legitimation durch gesetzliche Grundlagen - weil sie sich als unproblematische, ausschließlich helfende Leistung darstellen lassen (vgl. Blanke/Sachße 1987: 260, Kersting 2001) – als auch von der Verantwortung für die Konsequenzen dieser Bemühungen befreit werden können, weil diese den Adressaten der Interventionen – ihrer „Apathie und [ihrem] Mangel an Vorsicht“ (Cohen 1993: 221) selbst anzulasten ist. Dies gilt nicht nur hinsichtlich potentieller Schädigungen die von den Adressaten präventiver Bemühungen ausgehen, sondern auch mit Bezug auf die Opfer von Schädigungen. Im Rekurs auf den Begriff des ‚Risikoverhalten’ lassen sich die identischen delegitmierten Handlungsformen thematisieren und bearbeiten, die auch mit den Begriffen Devianz, abweichendes Verhalten, Delinquenz etc. verhandelt werden können, jedoch lässt sich darauf verweisen, dass diese Lebensäußerungen und habituelle Einstellungsmuster nicht deswegen zum Problem werden, weil sie von sozialen Normen abweichen, sondern wegen den möglichen Gefahren für die weitere Entwicklung des Akteurs selbst (vgl. Silbereisen/Kastner, 1987, Raithel 2002). Richard Sparks und Vivian Leacock 2002 sprechen bereits von einer diskursiven Bewegung vom Begriff des Risikos hin zu einer Konzentration zur ‚AtRisk-Ness’ (vgl. Edwards et al. 2000, Kemshall 2002, Petersen 1997 siehe auch Merkens 1994). Da eine solche präventive Orientierung auf das Risiko für die ‚At-Risk’- Jugendlichen selbst – entgegen einem ‚reaktiven Zugriff’ - weder der Explizierung noch der Feststellung einer Normunterbietung bedarf, kann sie deren - präventive Maßnahmen erfordernde - Potentialität im Rekurs auf die Ubiquität von Risiken auf tendenziell alle Kinder und Jugendlichen verallgemeinern (vgl. Lindner/Freund 2001, Lüders 1999). Durch dem Verweis auf einen grundsätzlich riskanten Charakter des Aufwachsens in einer ‚Risikogesellschaft’ können die Risiken, Gefahren und Gefährdungen als 238 selbstverständlich vorausgesetzt werden und brauchen im einzelnen weder durch ‚objektive’ Eigenschaftsbeschreibungen eingeschätzt (vgl. Plewig 1980), noch im genauem Inhalt ihrer negativen Auswirkungen expliziert werden (vgl. Groenemeyer 2001). Damit lassen sich ‚Risikoträger’ nach weitgehend beliebigen Kriterien identifizieren (Wambach 1983): Das gesamte Jugendalter kann als ‚Lebensphase potentieller Devianz’ (vgl. Böhnisch 1999) bzw. als ‚Lebensphase des Risikos’ (vgl. Anhorn 2002, Raithel 2001) fokussiert werden. Während sich eine Ausweitung und Vorverlagerung der Regulationsansprüche mithin präventionssystematisch ergibt, basiert der ordnungspolitische, bzw. verhaltensorientierte Zuschnitt der Präventionsbemühungen auf der individualisierungstheoretischen Kontextuierung einer - durch die Differenz von Politik und Sozialpädagogik (vgl. Sünker 1989) - der Jugendhilfe in ihrem notwendigen Bezug auf den handelnden Akteur ex ante eingeschriebenen Dispositionssensibilität. Wenn im Kontext der ‚Normalisierungsthese’ eine strukturlogische Irrelevanz der sozialen Positionierung unterstellt wird, erweitert sich die Dispositionssensibilität der Jugendhilfe in der Bearbeitung der positionaldispositionalen Matrix ihrer Akteure zu einem Zwang zur Dispositionsorientierung, der sich auch in einem entsprechenden Präventionsbegriff niederschlägt. Dieser dispositionsorientierte Präventionsbegriff ist nicht strukturell positionskompensierend, sondern erhebt vor allem Anspruch auf die Bearbeitung jener Risikoquellen, die aus menschlichem Verhalten entspringen (vgl. Frehsee 2001) – insbesondere jenem einer ‚moralfernen’ Provenienz (vgl. Heyting 1994). Wenn die Lebensführungsproblematiken der Adressaten der Jugendhilfe als allgemeine Modernisierungsrisiken gefasst und zugleich dynamisiert, individualisiert und biographisiert werden, lässt sich auf der Ebene der Repräsentation der Adressaten, das fordistische Bild der ‚Abweichler’, ‚Devianten’ oder ‚Kriminellen’ nicht mehr aufrecht erhalten, die ‚als Opfer ihrer Verhältnisse’ nicht primär nach Schuld und Verantwortung zu befragen waren, sondern vor allem im Kontext der individuell nicht zurechenbaren inneren und äußeren Ursachen und Bedingungen verortet wurden (vgl. Scherr 1998, Groenemeyer 2002), die aus den sozial ungerechten Strukturen der Gesellschaft auf die Individuen ‚abstrahlen’ (vgl. Sack 1993). Die dispositionale ‚Hilfe’ zum persönlichen Risikomanagement in der Risikogesellschaft mit dem Ziel der Risikovermeidung bzw. -bewältigung, tritt in den programmatischen Präventionskonzeption – vor dem Hintergrund der Grenzen sozialpolitisch positional orientierter sozialer Gestaltung und Sicherung an die Stelle disziplinierenden Zurichtung. Dies geschieht jedoch um den Preis einer tendenziellen Verschiebung von der normierenden Normalisierung ‚problematischer’ Lebenslagen mittels des den Versuch der (Re-)Integration in den vollen Bürgerstatus qua Lohnarbeit - als singuläre politische Identität des Fordismus - zugunsten einer Bearbeitung partikularer sozialer Identitäten innerhalb der risikoträchtigen Fragilität heterogener sozialer Kontexte (vgl. Purvis/Hunt 1999): „Nicht mehr die im Diskurs über Inklusion enthaltene Idee der Chancengleichheit steht im Vordergrund, sondern die Idee der Risikobegrenzung“ (Groenemeyer 2002: 126, vgl. Kemshall 2002). Im Zuge einer solchen Präventionsorientierung weiten die Regulationsansprüche der Jugendhilfe aus, während teleologische und sozialgestalterische Ansprüche wie Demokratisierung, Autonomie und Emanzipation sukzessive an Bedeutung verlieren (vgl. Baillergeau/Schaut 2001, Kemshall 2002). 239 Die ‚präventive Wende’ in der Jugendhilfe lässt sich kontrolltheoretisch als eine Kritik der - ja auch in fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformationen keinesfalls obsoleten - fordistischen Fassung sozialer Kontrolle als Normalisierung und Disziplinierung fassen, die von der teilweisen Ablösung und Modulation durch andere Präventionsmodi und Kontrolllogiken begleitet wird. Die ‚traditionellen’ Kontrollmuster existieren dabei neben und komplementär zu den ‚neuen’ und es gibt eher fließende Übergänge als harte Brüche zwischen beiden. Damit ist eine Beantwortung der Frage welche Kontrollform, in welchem Feld, unter welchen Bedingungen, von welchem Kontrollsubjekt ausgehend, gegenüber welchen Kontrollobjekten in den Vordergrund gerät, alleine deshalb eher tentativ als exakt möglich, weil die Strategien selbst eher kontingent als kohärent sind. III. 5.2 EXKURS: DIE NOTWENDIGE KONTROLLDIMENSION DER JUGENDHILFE – EINE KURZE VERTEIDIGUNG Beschreibungen einer Jugendhilfe bzw. Jugendfürsorge, die mit (mehr oder weniger) ‚fürsorglichen’ Bevormundungen, Disziplinierungs- und Kolonialisierungsversuchen, Besänftigung und Zurichtung von Benachteiligten oder anderen Kontrollzumutungen, machtbasierten und herrschaftsförmigen Eingriffen nichts zu schaffen hat, sind historisch nicht neu. Auch das positiv formulierte Gegenstück, nämlich die Beschreibung einer Jugendhilfe als eine herrschaftstheoretisch neutrale ‚Unterstützung‘, ‚Beratung‘, und ‚Begleitung‘, die nur noch ‚helfe’ (vgl. Merten 1997), zu einer Herausbildung selbstidentischer Personen beitrage, „Subjektivität in allen Dimensionen“ (Winkler 1992: 72) verbürge, ohne stigmatisierende und paternalistische Effekte ausschließlich ‚echte’ Ressourcenprobleme der Lebensführung im Dienste des Subjekts löse und der Gleichen mehr, ist historisch nicht ohne Vorläufer. Pointiert formuliert, kann man davon sprechen, dass, abgesehen von einer relativ kurzen Phase in der die Herrschafts- und Kontrolldimension der Jugendhilfe vor allem im Kontext neomarxistischer und etikettierungstheoretischen Ansätze in den Mittelpunkt des disziplinären Diskurses rückte, die notorische Tendenz besteht, die Hilfsdimension hervorzuheben, die Kontrolldimension jedoch auszuklammern (vgl. Bailey/Brake 1975) oder sie ‚im Prinzip’ anzuerkennen, jedoch für mittlerweile anachronistisch bzw. zu einem bloßes ‚Imageproblem’ zu erklären. So bedauert etwa der Direktor des Hamburger Jugendamtes im Jahr 1927: „[I]mmer noch gilt das Jugendamt als ‚Buhmann’, immer noch wirkt die berechtigte Abneigung gegen die ‚Strafschule’ – die bekanntlich schon 1905 aufgehoben ist – mit, obwohl […] die Erziehungsanstalten des Amtes in rein erzieherisch-fürsorgerischem Geist geführt werden. […] Immer wieder müssen wir um das Vertrauen der Eltern bitten, die sonst das Erziehungswerk sehr erschweren oder gar aussichtslos machen“ (zit. nach Crew 1992: 286). Dabei ist es natürlich richtig, dass die Rigidität der Verhaltenszumutungen, Moralisierungen und Identitätszurichtungen ebenso wie der bevormundende und unterdrückende Charakter der Interventionen der Jugendfürsorge im Wilhelmismus zum Angebotscharakter einer dienstleistungsorientierten Jugendhilfe in einem kaum vergleichbaren Verhältnis steht. Ebenso wenig kann sinnvoll bestritten werden, dass es – abgesehen von der Zeit nationalsozialistischer Barbarei -, rein formalrechtlich betrachtet, eines der hervorstechenden Momente der Entwicklung vom RJWG zum KJHG ist, sich kontinuierlich von einem polizeilich-ordnungsrechtlichen Zuschnitt verabschiedet zu haben. Allerdings haben diese Entwicklungen und Errungenschaften einer modernen Jugendhilfe mit 240 einem ‚Ende der Kontrolle’ wenig zu tun, und auch die Rede von einem ‚Abschmelzen’ der Kontrollfunktion der Jugendhilfe ist mit nicht überwindbaren Problemen verbunden. Diese Probleme bestehen zumindest dann, wenn ‚soziale Kontrolle’ als eine analytische und nicht als eine normative Kategorie gebraucht wird, wobei der normative Gebrauch des Kontrollbegriffs – als etwas ‚Schlechtes’, als synonym für Unterdrückung oder als die ‚dunkle Seite’ der Jugendhilfe - ohnehin kaum zu überzeugen vermag: Zwar ist Jugendhilfe sozialstaatstheoretisch, moraltheoretisch, demokratietheoretisch etc. in je angemessener Form unterschiedlich beschreibbar, spricht man aber in sozialwissenschaftlicher Weise von ‚sozialer Kontrolle’ ist Jugendhilfe eine Instanz sozialer Kontrolle: Eine Instanz die auf Risiken und Probleme im Sozialen reagiert und versucht diese zu lösen, zu regulieren, auszugleichen, Hilfe zu deren Bewältigung zu leisten, sie erträglich zu machen, in andere Formen zu bringen und so weiter. All dies stellt zugleich einen Beitrag zur Gestaltung, Aufrechterhaltung und Herstellung sozialer und politischer Ordnungen bzw. der Regelmäßigkeiten der Formen des Zusammenlebens sowie der Art und Weise dar, wie sich Akteure in sozialen Feldern bewegen, und wie sie sich bewegen können bzw. sollen. Ist Jugendhilfe demnach eine Instanz sozialer Kontrolle, können sich zwar ihre Kontrollstile (vgl. Cohen 1993), -logiken und -ziele verändern - sie können beispielsweise weniger intrusiv, repressiv oder befehlend und stattdessen eher partizipativ und auf Verhandlung, Vermittlung und Interessenausgleich ausgerichtet sein, sie können punitive Sanktionen durch primär sozialpolitische Maßnahmen ersetzen, sie können weniger auf direkte Unterdrückungen von Lebensäußerungen als auf die Hervorbringung ‚gelingender’ Identitäten zielen usw. - aber die Kontrolle einer Kontrollinstanz selbst kann per se nicht abschmelzen oder ähnliches, zumindest so lange nicht geklärt ist, was unter ‚sozialer Kontrolle’ verstanden und welche Kontrollform als Vergleichgröße herangezogen wird. Es geht also weniger darum, ob Jugendhilfe soziale Kontrolle ausübt, sondern wie sie es tut. Wird soziale Kontrolle in einem engen kriminologischen Sinn gefasst, lässt sie sich als das Ensemble alle jener Reaktionen betrachten, die den Charakter einer negativen Sanktionierung devianter Handlungsweisen annehmen (vgl. Sack 1993a: 418). Geht man jedoch davon aus, dass sich Devianz erst dadurch konstituiert, dass sie als Unterbietung hegemonialer symbolischer Standards negative Reaktionen in ihrer Umwelt hervorruft (vgl. Sumner 2001, Tittle 1995), rückt dieser Gedanke in die Nähe einer Tautologie. Selbst wenn man die Ebene sozialwissenschaftlicher Definitionen von Devianz verlässt, ist die Annahme nicht abwegig, dass negative Reaktion auf Störungen, Ärgernisse und Unbill – was auch immer je darunter verstanden wird – , wie es Scheerer (1993: 71 f) formuliert, so ewig sind „wie das Glück oder Unglück der Menschen […] und wie jeder andere Teil der condito humana“. Aber auch wenn man von der Banalität absieht, dass Vertreter der Jugendhilfe mit einiger Regelmäßigkeit auf Unerfreuliches unerfreut reagieren und stattdessen den Blick weg von spontanen, emotionalen, subjektiven Reaktionen, hin auf stärker institutionalisierte, mehr oder weniger rational angewendete Formen negativer Sanktionen richtet, sind diese Kontrollformen der Jugendhilfe keinesfalls fremd. So sieht etwa Böhnisch (1999: 188 f) im ‚Grenzen setzen’ einen „integrale[n] Bestandteil einer gelingenden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ und spricht davon, dass im „pädagogischen Feld […] Erziehung und Strafe uno actu zusammenfallen“. Auch der Bundesverband 241 privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe (VPK 2003: 36) betont, dass Sozialpädagogen die „Pflicht haben, deutlich und energisch bei Normverstößen von Kindern und Jugendlichen zu reagieren und zu intervenieren“. Selbst wenn demnach planvolle Bestrafungen einen bestimmten (diskurskonjunkturell mehr oder weniger bedeutsamen) Typus öffentlicher Erziehung darstellen, ist es fraglich, ob gerade diese Form sozialer Kontrolle überhaupt jemals konstitutiv für personenbezogene soziale Dienste war (skeptisch: Peters 1995, 2002) - der oben zitierte Jugendamtsdirektor weist dies jedenfalls von sich. Selbst im stationären Strafvollzug – dem Extrempol der negativen Sanktion – repräsentierten die sozialen Dienste ja gerade einen Typus der Sanktion, der weniger auf Strafe, als auf Besserung und Reintegration gerichtet ist65. Betrachtet man sich die Eingebundenheit der Jugendhilfe in den jugendstrafjustizellen Bereich, in dem die enge, kriminologisch fassbare Kontrollform eine vergleichsweise große Rolle spielt, so nimmt diese in Bezug auf die Jugendhilfe in dem Maße, wie der spezialpräventive Resozialisierungsgedanke im Strafkomplex an Bedeutung verliert zwar im ‚stationären’ Bereich des Strafen in so fern ab, dass die Kontrollrationalitäten der Jugendhilfe substituiert werden, in dem Maße wie eine ‚Informalisierung der Justiz’ (vgl. Albrecht 2000) voranschreitet, finden sich jedoch Hinweise darauf, dass sozialpädagogische Kontrolllogiken im ‚ambulanten’ Bereich einen Bedeutungsgewinn erfahren. Beide Momente sind im Kontext von ‚Gabelungsprozessen’ (vgl. Bottoms 1977) im Jugendstrafrecht feststellbar. Von einem generellen Rückgang der ‚kriminologischen Form’ sozialer Kontrolle in der Jugendhilfe kann jedoch keine Rede sein. Dort wo eine Eskamotierung der Jugendhilfe aus dieser Kontrollarena vorgenommen werden soll - wie etwa im Kontext schärfer punitiv konturierter Reaktionen auf Jugenddelinquenz - drängen Vertreter der Jugendhilfe, bzw. der Verbände – sei als ‚Stakeholder’ im Kontrollgeschäft, sei es im tatsächlichen oder vermeintlichen Interesse der Jugendlichen - in der Regel auf den ‚Erziehungsgedanken’ und ein ‚jugendgemäßes Strafverfahren’, dessen ‚Jugendgemäßheit’ mehr oder weniger mit dem gestaltenden Einfluss der Jugendhilfe gleichgesetzt wird (so etwa die AGJ 2001). Fasst man dagegen soziale Kontrolle in einem ‚weiten’ sozialwissenschaftlichen Sinn als Versuch der Anordnung, Gestaltung und Regulation oder kurz der ‚Steuerung’ (engl. ‚control’) von intersubjektiven Prozessen und ihren Bedingungen, mit dem Zweck normative Erwartungen zu stabilisieren und den sozialen Verkehr berechenbar zu machen (vgl. Kreissl 2000), so ist wie René König ausführt „soziale Kontrolle ein zentraler Bestandteil allen sozialen Daseins“ (König 1968: 287). Sie umfasst nicht nur Momente einer strafende Ahndung oder des Zwangs – im Gegenteil, zumindest bei Edward A. Ross wird soziale Kontrolle als die demokratische Alternative zu Hierarchie und Zwang formuliert (dazu Fraser 2003) - und kann auf einer analytischen Ebene auch nicht einfach mit dem im sozialen Interventionsstaat vorherrschenden Kontrollmodus der Disziplinierung als normierend-assimilierender Normalisierung gleichgesetzt werden, ohne andere Modi in ihrem teils funktionsäquivalenten, teils modulierten, teils alternativen – Kontrollcharakter zu ignorieren. Oder zumindest gerichtet war. Das Straf-Wohlfahrt-Paradigma hat sich, wie gezeigt werden wird, durchaus in eine andere Richtung verschoben. Dabei nimmt die für die Jugendhilfe a-typische Form der sozialen Kontrolle im ‚kriminologischen’ Sinne eher wieder zu als ab. 65 242 Die Kontrolle von Verhalten lässt sich allgemein als ein Prozess oder ein koordiniertes Arrangement von Prozessen beschreiben „by which norms are established, the behaviour of those subject to the norms monitored or fed back into the regime, and for which there are mechanisms for holding the behaviour of regulated actors within the acceptable limits of the regime (whether by enforcement action or by some other mechanism)” (Scott, 2001: 331). Analytisch ist es daher sinnvoll, soziale Kontrolle als die Gesamtheit aller Mechanismen zu betrachten, die als direkte oder indirekte Hervorbringung oder Unterdrückung, Manipulation, Überwachung, Förderung, Verwaltung, Zuteilung, Organisation, Förderung, Erziehung, Beobachtung, Befriedung, Interessenabgleich, Verantwortungszuschreibung, Mitteldistribution, Inklusion und Exklusion, Koordination, bis zu ‚Lebensführungsentscheidungshilfen’ und anderen Formen der Beeinflussung interpersonaler Kooperation wie (intra-)individueller Selbststeuerung, sowie die Gestaltung und das Arrangement ihrer strukturellen Einbindungen im Sinne einer sozialen, ökonomischen, kulturellen, physikalischen und symbolischen Produktionen, Reproduktion, Regulation und eines Managements ihres zeitlich-räumlich, situativen, gesellschaftlichen oder feldspezifischen Möglichkeitsspielraums, gefasst werden können. Zu den Mitteln sozialer Kontrolle in einem solchen weiten Sinn zählen demnach Recht und Religion, Sitten, Traditionen und Gebräuche, Sprache und Wissen ebenso wie Sozialtherapie, Beratung Begleitung und Unterstützung und selbst noch das gelenkte Vergnügen, wie es etwa in ‚Disney World’ rekonstruiert werden kann (Shearing/Stenning 1987). Die Forderung, Jugendhilfe solle das Soziale stärker ‚präventiv’ gestalten, fällt ebenso unter diesen Kontrollbegriff, wie Sozialisationsprozesse, als vergesellschaftende Hervorbringung von Subjekten eine – gerade in ihrer institutionalisierten Form fundamentale – Form sozialer Kontrolle sind (vgl. Cohen 1985): „Social control“, stellt etwa Robert E. Park (1921: 20) fest, „is the central fact and the central problem of society“. In einem gewissen Sinne lassen sich daher zwar nicht alle Phänomene einer Gesellschaft als soziale Kontrolle verstehen, aber nahezu alles, was als soziale Interaktion gefasst werden kann - oder, noch weiterreichender, was sich als soziale Tatsache darstellen lässt – „kann mit Gewinn auch unter d[em] Gesichtspunkt [sozialer Kontrolle] analysiert werden“66 (Scheerer 2000: 167). Trotz aller theoretischer ‚Uferlosigkeit’ des Begriffs sozialer Kontrolle (vgl. Peters 2000), bleibt doch „der genuine Handlungskern der gleiche: Die gezielt intendierte Beobachtung auf eine eventuelle Differenz von Soll- und Ist-Wert“ (Nogala 2000c: 126) verbunden mit dem Ziel einer gegenwärtigen oder erwartbaren Abweichung von dem Soll-Wert entgegenzutreten. Auch dann, wenn die fordistischkenysianistische Form der Vergesellschaftung und Risikoabsicherung als ‚socialized actuarialism‘ (vgl. O´Malley 1992: 257) zurückgedrängt und die dazugehörigen disziplinierenden und ‚kolonialisierenden‘ Kontrollmodi zumindest teilweise – wie etwa im Falle der Kritik der ‚Eingriffsorientierung’ im Kontext des ‚fachlichen’ Präventionsdiskurses ‚leistungsorientierten’ SGB VIII - (vgl. als Böllert 1995) anachronistische bzw. und der Implementation freiheitsberaubende des Modelle zurückgewiesen werden (vgl. Hoggett 2001), bleibt dieser Handlungskern der Kontrolle in der Stan Cohen (1985) spricht von sozialer Kontrolle als einem ‚Mickey Mouse Concept’. Dennoch, um im Sprachspiel zu bleiben: auch die ‚Disney order is not so Mickey Mouse’ (Shearing/Stenning 1987). 66 243 Jugendhilfe unberührt. Zwar mag die Gültigkeit und Reichweite des wohlfahrtsstaatlich-fordistischen Sollwerts ‚fluider’ geworden sein (vgl. Bauman 1998) und sich die Angleichung des ‚Ist-Werts’ auf andere - z.B. auf Kommunikation, Partizipation und Konsens gerichtete - Techniken verlagern, aber die Jugendhilfe verzichtet weder auf das eine noch das andere (eine ‚Output-Orientierung’ und ex ante Formulierung von ‚strategischen und operativen Zielen’ im Kontext der instrumentell rationalisierenden Neuen Steuerungsmodelle ruft dies ebenso deutlich in Erinnerung, wie die Rede von ‚Prävention‘ und die Bestimmung dessen, was ‚präventiert’ werden soll). Jugendhilfe kann auf diese Operationen gar nicht verzichten. Würde sie dies in einem fundamentalen Sinne tun, d.h. diese auch nicht implizit und routinehaft vollziehen, so wären damit zwei mögliche Alternativen impliziert: 1. Die einzelnen Interventionen, die von der Jugendhilfe vollzogen werden sind in jeder Hinsicht in Intention und Vollzug vollkommen kontingent, plan- und ziellos, auf nichts bezogen und auf nichts gerichtet. Letztlich würde es Jugendhilfe damit nicht mehr geben – sie ließe sich auch in keiner Weise bestimmen – und selbst wenn es ‚so etwas’ gäbe, wäre es bloße, ‚diffus unzuständige’ Zeitverschwendung. 2. Ist- und Sollwert sind dauerhaft und unhinterfragt identisch. Die in diesem Kontext vollzogenen Interventionen wären ebenfalls im besten Falle nutz- und sinnlos, im schlechtesten nutz-, sinnlos und paternalistisch. In beiden Fällen wäre Jugendhilfe bestenfalls überflüssig. Über diese Banalität, die den Handlungskern sozialer Kontrolle beschreibt, hinaus ist es jedoch notwendig weitere Parameter anzugeben, die der Kontrolle als einem sozialem Vorgang eine spezifische Kontur geben: Soziale Kontrolle, soweit sie sich auf Menschen und menschliches Handeln bezieht, ist als eine Beziehung zwischen mindestens zwei, mittelbar oder unmittelbar wechselseitig aufeinander bezogen agierenden sozialen Akteuren, ein unbedingt relationaler Begriff (vgl. Nogala 2000). Diese Relationalität ist für die Jugendhilfe gerade in ihrer analytischen Fassung als personenbezogene soziale Dienstleistung bereits theoriearchitektonisch immanent. Im Falle sozialer Kontrolle ist diese Relation durch eine Machtasymmetrie gekennzeichnet, die es dem ‚Kontrollsubjekt’ (vgl. Franz 2000) „ermöglicht, jene Faktoren zu steuern, die als bestimmend für die Herstellung der gewünschten Ziele angesehen werden“ (Wolf 1997: 106): Das ‚Kontrollsubjekt’ konstituiert sich dadurch, dass es über einen Vorsprung an Machtmitteln verfügt – für die Jugendhilfe vornehmlich soziales und kulturelles Kapital. Ein Machtvorsprung der Jugendhilfe ist im Falle des Vollzugs nichtkonsensual und ‚unfreiwillig’ erbrachtet Leistungen unmittelbar evident. Aber auch jenseits so genannter ‚eingriffsorientierter’ ‚echt hoheitlicher’ Interventionen ist ein Machtgefälle von Adressaten und Professionellen, beispielsweise in Form eines Wissensvorsprungs oder einer höheren infrastrukturellen Möglichkeit regulatorischer Einflussnahmen, ein ebenso zentrales wie notwendiges Moment in allen Leistungserbringungen der Jugendhilfe. Schon alleine da gerade auch bei ‚Angeboten’ der konkrete Nutzer den Professionellen und seine Leistungen persönlich notwendiger braucht als umgehrt, ist ein Machtgefälle zwischen Adressat und Professionellem für die Jugendhilfe konstitutiv (vgl. Brumlik 1992, Schaarschuch 1998). Hätte die Jugendhilfe mit Bezug auf das vom Nutzer artikulierte oder von ihr selbst eruierte Anliegen bzw. Problem nicht ‚mehr’ oder ‚passendere’ 244 Machtmittel als der Nutzer selbst, könnte sie ihn auch nicht unterstützen, beraten usw., sie hätte sie keinen Gebrauchswert für ihn. Dabei führt der leistungsermöglichende Machtvorsprung zwar nicht zwangsläufig zu einem unilinearen, wohl aber zu einem asymmetrisch–nichtreziproken Verhältnis. Inwiefern und in welcher Form sich das Machtgefälle zwischen Professionellen und Adressat äußert, hängt von dem Grad der faktischen Interessendivergenz im Spannungsverhältnis von (administrativ repräsentierter) Gesellschaft, Organisation, Profession und Nutzer ab. Besteht eine weitgehende Interessengleichheit, können Kontrollprozesse unabhängig vom Grad der Machtdifferenz konsensual verlaufen, während sich eventuelle Spannungen sich von einem Konflikt um den ‚opus operandum’ vor allem auf ‚technische’ Fragen des ‚modus operandi’ verlagern. Weiter ist es denkbar, dass auch im Falle von Interessendifferenzen von ihrer Durchsetzung entweder ganz abgesehen oder zeitweilig und taktisch vermieden wird, um teure, unerwünschte oder offen konfliktuöse Folgen zu verhindern (vgl. Nogala 2000: 127). Schließlich bietet der Machtvorsprung dem ‚Kontrollsubjekt’ aber auch die Möglichkeit seine Regulationsversuche im Zweifelsfall auch gegenüber einem ‚unwilligen’ ‚Kontrollobjekt’ durchzusetzen. Diese Durchsetzung kann durch ‚aktive’ Sanktionen – in welcher Form auch immer – geschehen oder in ‚passiver’ Form einfach dadurch, dass das unwillige Kontrollobjekt die mittelbaren oder unmittelbaren negativen Konsequenzen seiner Unwilligkeit – beispielsweise den Ausfall ‚subjektiv’ oder ‚objektiv’ eufunktionaler Leistungen - zu tragen hat. Die Folgen von Unwilligkeit, mangelnder Kooperationsbereitschaft und unselbstverantwortlicher (Fehl)Entscheidungen bestehen dann in einer nicht aktiv von außen an den Akteur herangetragenen Strafe - der absichtsvollen Zufügung von Leid (vgl. Christie 1986) - sondern durch ‚Selbstschädigung’ als Konsequenz der ‚Unvernünftigkeit’ ergeben, die der externalen Kompensation entzogen bleiben. D.h. die Logik des ‚passiven’ oder strukturellen Zwangs besteht nicht in der Aufforderung ‚Du musst mitspielen ob du willst oder nicht’ sondern, sondern in einem Angebot and den vernünftigen und rational abwägenden Akteur das ungefähr lautet: ‚Hier sind die Spielregeln. Du hast die Wahl. Spiel mit oder lass es bleiben. Wenn Du nicht mitspielst, dann trag die Konsequenzen’. Mit dem Bestehen auf einen Kontrollcharakter der Jugendhilfe soll keinesfalls gesagt werden, dass alles ‚beim Alten geblieben’ sei, oder dass ein tendenzieller Verzicht auf ‚aktive’ Sanktionen und ‚moralisch autoritäre Kontrollformen’ (vgl. Steinert 1992) keinen Fortschritt und Freiheitsgewinn für, oder gar eine noch perfidere Kontrollform gegenüber den betroffenen Akteure darstellen würde. Die Betonung von Freiwilligkeit und Wahlfreiheit ist ein historischer, demokratischer Fortschritt. In jedem Fall aber, wird in den skizzierten Kontrollsituation eine Norm zur Geltung und mithin das Interesse zum Ausdruck gebracht, eine (ausweisbare) Ordnung, in der diese Norm eingebunden ist, durchzusetzen beziehungsweise zu (re)etablieren. Sofern sich Kontrolle auf eine solche Ordnung bezieht, bezeichnet sie nicht die dieser Ordnung vorgängigen bzw. diese Ordnung etablierenden sozialen Kämpfe und Auseinandersetzungen, die noch auf einer diachronen Ebene eines Widerstreits mit offenem Ausgang angesiedelt sind – und für die Jugendhilfe als offener ‚Kampf’ antagonistischer Interessen überdies jede Form eines ‚Arbeitsbündnisses’ von Professionellen und Adressaten ex ante verunmöglichen würden -, sondern ist als eine synchrone Zustandsbewahrung zu fassen, die einem solchen Widerstreit logisch nachgeordnet ist. 245 Ein durch diese Parameter bestimmbarer Vorgang ‚soziale Kontrolle’ kann im Sinne einer ‚PerspektivBezeichnung’ als ein Ensemble all dessen definiert werden, was das in Bezug auf diese Ordnung unerwünschte „Verhalten verhindern soll und/oder faktisch verhindert (auch der Versuch der Verhinderung kann ein Kontrollverhalten sein) – sowie all dessen, was auf ein unerwünschtes Verhalten reagiert“ (Scheerer 2000: 167) und zwar unabhängig davon, ob diese Reaktion direkt und interpersonal oder mittelbar und durch strukturelle Anordnungen von Möglichkeitsspielräumen erfolgt, und auch unabhängig davon, ob die Interventionen die gewünschten Effekte auch tatsächlich zeitigen oder nicht. Betrachtet man die Kontrolldimensionen der Jugendhilfe in dem Verhältnis von Praxisformen der mittelbar oder unmittelbar betroffenen Akteure und den Strukturen der Felder in denen ihre Praxis situiert ist, erscheint es verkürzt, die Kontrolleffekte der Jugendhilfe alleine in den sich akut vollziehenden prozessualen Interventionen zu verorten und das überdauernd wiederkehrende Resultat der Steuerungs- und Regulationsversuche zu ignorieren, in denen die Kontrolldimension ihren aktualprozessualen Charakter verliert und ihren sozialregulatorischen Effekt dadurch äußert, dass sie zu einem strukturierten und strukturierenden Zustand ‚gerinnt’ (vgl. Nogala 2000). Dabei sind diese beiden Ebenen nur analytisch trennbar, denn auch die sich je akut vollziehenden Kontrollinteraktionen sind nicht freischwebend in einem Vakuum angesiedelt, sondern werden selbst von den historisch zu (Kontroll)Strukturen geronnenen Regelmäßigkeiten der Kontrollpraktiken strukturiert und präsuppositioniert. Insofern bei den Interventionen der Jugendhilfe auf strukturelle (Kontext)Bedingungen der Situierung der Akteure und ihrer Praxisformen rekurriert wird - d.h. auf der Ebene der Machtmittel die jugendhilfetypische Kombination von personal inkorporierbarem ‚kulturellem Kapital’ und ‚sozialem Kapital’ – lässt sich die Kontrolldimension der Jugendhilfe idealtypisch insbesondere in zwei Dimensionen verorten: 1. In der Durchführung von professionellen Handlungen des ‚Kontrollsubjekts’, die als kulturkapitalbasierte Interventionen auf der Seite des ‚Kontrollobjekts’ bestimmte Dispositionen und Handlungsmuster hervorbringen, beziehungsweise (prä)strukturieren sollen. 2. In den Versuchen einer zielgerichteten diachronen Strukturierung, im Sinne von vornehmlich sozialkapitalbasierten Interventionen, die zu einer Hervorbringung, Änderung, oder Aufrechterhaltung von Strukturen beitragen, die in einer überdauernden Form strukturierend auf die Handlungen der Adressaten wirken. Diese beiden Dimensionen werden in den jugendhilfetypischen Bezügen auf eine positionaldispositionale Matrix zu Versuchen der Lenkung und Regulation der Praxisformen ihrer Adressaten innerhalb ihres qua Praxis strukturierten Möglichkeitsspielraums verknüpft, die idealerweise zu einer Art professionell induzierten ‚Äquilibration’ von Praxis, Habitus und Struktur auf einer ‚höheren’ Ebene führen sollen. Es bietet sich daher an, einen Wandel der Formen und des Inhalts der Kontrolldimensionen der Jugendhilfe nicht in nur in Bezug auf die durchaus wichtige Frage ihrer Dichte, ihrer Frequenz und ihres Rigiditäts- und Repressionsgrad hin zu analysieren, sondern vor allem auch hinsichtlich ihres 246 praktisch und analytisch fundamentalen Bezugs auf und ihrer Aktualisierung der postionaldispositionalen Matrix, auf deren Basis ihre Nutzer repräsentiert bzw. ‚subjektiviert’ werden III. 5. 3 NEUE KONTROLLMUSTER IN DER JUGENDHILFE Die These ist, dass sich nicht nur und nicht in erster Line die Kontrolldimension der Jugendhilfe als solche, sondern ihre Strategien, Rationalitäten und der Inhalte wie die Formen ihres Bezugs auf die positional-disositionale Matrix ihrer Adressaten verändert haben. Die typische Kontrollform der Jugendhilfe, als eine fordistische Profession, war die Sozialdisziplinierung. Von einem völligen Verschwinden dieser Kontrollform kann zwar keine Rede sein, aber ihre Dominanz ist relativiert worden. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass Veränderungen auf der Ebene administrativer Kontrollformen ihren Ausdruck und ihre Basis bereits in den tendenziellen Veränderung der Sozialverwaltungsarbeiten findet, wie sie in den Bestrebungen zu einer Verwaltungsmodernisierung und dabei insbesondere Modernisierungsvarianten normalisierende, in den gefunden assimilative durch haben: und die Neuen der sukzessiven In disziplinierende Steuerungsmodelle Zurückdrängung Interventionsstrategien induzierten einer für typischen ‚Konditionalprogrammierung’ auf der administrativen Ebene zugunsten einer ‚Finalprogrammierung’ (vgl. Luhmann 1964). Kinder- und jugendhilferechtlich ist dieser Wandel durch ein verändertes Selbstverständnis des SGB VIII dokumentiert, in dessen Gesetzestext der Schwerpunkt auf den ‚Leistungen’ liegt, während ordnungspolitische und fürsorgerische Aspekte zwar nicht verschwunden (vgl. SGB VIII § 42 ff) aber in den Hintergrund getreten sind (vgl. Münder 2001: 1002). In einer der ‚Wenn-Dann-Logik‘ folgenden Konditionalform der ‚Ordnungsverwaltungen‘ wird Verwaltungshandeln durch externe Anlässe in der Form ausgelöst, dass der Vorgang nach Rechtsnormen geprüft und zumindest idealtypisch in einer wenn auch faktisch immer durch das notwendige ‚Ermessen‘ gebrochenen (vgl. Brodkin 2000) subsumptionslogischen Deduktion einschlägigen Vorschriften zugeordnet. Plakativ gesprochen war das Ziel die möglichst genaue Anpassung der Wirklichkeit an die Norm. Ebenso idealtypisch betrachtet, entspricht es den Logiken der Finalprogrammierungen von ‚Leistungsverwaltungen‘, dass sie jenseits einzeln fixierter externer Anlässe und ohne starre Verknüpfungen durch - mehr oder weniger vage und flexible - Aufträge und Zielvereinbarungen so wie Effektivitäts- und Effizienzkriterien gesteuert wird (vgl. Offe 2001a: 433). Insofern sich diese Idealtypen im Kontext der administrativen ‚Umprogrammierung’ durch die ‚Verwaltungsmodernisierung’ empirisch realtypisch niederschlagen muss davon ausgegangen werden, dass sich auch die verwaltungsmäßigen Akten eingelagerte Kontrollform - nicht zwangsläufig ihr Ausmaß – verändert haben. Dies gilt auch dann, wenn beispielsweise festgestellt werden kann, dass äußerliche Formerfordernisse des Verwaltungshandeln abnehmen, während kooperative bzw. partnerschaftliche Handlungsweisen und der Aushandlungsspielräume zunehmen, was die Fähigkeit zur unlinearen Durchsetzung von Souveränität und Staatswillen, sei durch den (lokalen) Staat selbst oder durch staatliche und 247 staatsabhängige Institutionen einschränkt (vgl. Stehr 2000). Das Anwachsen von Aushandlungsspielräumen trifft – bezogen auf die ‚Kundenspaltung’ der Jugendhilfe – nicht nur auf den ‚zahlenden’ Kunden zu. Auch für die direkten Nutzer bzw. Adressaten der Jugendhilfe lässt sich der Tendenz nach davon sprechen, dass sich die Kontrollform von der Subordinierung seines ‚Falls‘ unter eine Norm, in die vorab weit weniger bestimmte Sphäre einer flexiblen Aushandlung verschiebt, allerdings um den ‚Preis’ der Erhöhung seiner eigenen Mitverantwortung - auch im Falle des Scheiterns. Selbst wenn ein ‚Eingriff’ von einer ‚Leistung’ dadurch unterschieden werden könnte, dass erstgenannter eine direkte, hoheitliche, nicht erbetene Intervention in die Lebensverhältnisse von Bürger und Bürgerinnen darstellt (vgl. Münder 2000: 40), während ‚Leistungen’ hierauf verzichten und auch wenn man eine Verschiebung vom Eingriff zur Leistung in diesem Sinn als Freiheits- und Autonomiegewinn der Nutzer betrachten und (professions-) politisch positiv beurteilen kann, greift es analytisch zu kurz, eine subsidiäre Verlagerung vom Eingriff zur Leistung mit einer substanziellen Abschwächung von administrativen Kontrolldimensionen selbst gleichzusetzen. Dabei ist nicht einmal das Anbieten von Leistungen gemeint, die faktisch nicht angelehnt werden können (vgl. Loedemel/Trickey 2002) und auch nicht, dass dies regelmäßig zu Bedingungen geschieht, die dem Einfluss des Nutzers weitgehend enthoben bleiben. Es ist auch nicht gemeint, dass weder die staatliche Kustodialfunktion, noch die Möglichkeit, im Falle eines Misslingens der freiwilligen ‚Leistungsangebote’ von den ‚echt hoheitlichen’ ‚anderen Aufgaben’ der Kinder- und Jugendhilfe Gebrauch zu machen, in ihrem Kern in Frage gestellt worden sind. Wesentlich ist, dass sich die Kontrollmodi – vielleicht weniger im Einzelnen als in ihrer Gesamtschau – eher moduliert als in ihrer Quantität verschoben haben. Die zentrale Veränderung betrifft auch hier die institutionelle Repräsentation des Nutzers, die gerade im Kontext von ‚Finalprogrammierungen’ in der Leistungsverwaltung weniger der Vorstellung eines ‚abhängigen Klienten‘ folgt, der den feststellbaren, mehr oder weniger miserablen Bedingungen seines sozialen Daseins unterworfen ist, sondern der eines selbstverantwortlichen ‚Subjekts‘, als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ kalkulierender Unternehmer seiner selbst. Je nach Handlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit, führt dies für einige ‚Kunden‘ der Jugendhilfe unzweifelhaft dazu, dass sich das Machtgefälle zwischen ihnen als ‚Kontrollobjekt‘ und den Vertretern der Instanzen als ‚Kontrollsubjekt’ verkleinert, d.h. ihnen – sieht man von Finanzierungsvorbehalten ab - mehr Handlungsoptionen und Möglichkeiten zur Interessendurchsetzung gewährt werden, als dies in den Normierungen der Konditionalprogramme angelegt war. Für ‚Kunden‘ in schwächeren Verhandlungspositionen und in Verhandlungen in denen die divergierende Interessen der verschiedenen ‚Arten‘ von Kunden auftreten, realisiert sich dieser Souveränitätsgewinn auf der Nutzerseite jedoch faktisch nicht automatisch. Die Bedingungskontexte, das Ausmaß und die Reichweite der Handlungsmöglichkeiten sind sozial deutlich ungleich verteilt (vgl. Stehr 2000), was faktisch zu einer relationalen Verhärtung existierender Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen ebenso wie zu einer Neuverteilung von Privilegien für die ‚gute Gesellschaft’ der Jugendhilfe führen kann (vgl. Stehr 2000, Schaarschuch 1996). Auch wenn sich für die ‚glücklicheren‘ Kunden die Kontrollaktivität der Jugendhilfe, langfristig betrachtet, von zwangsausübenden oder überwachenden 248 zu schlichtenden und vermittelnden oder anleitenden und auf Konsens und Überzeugung gerichtete Formen - zumindest so lange, wie sie sich einigermaßen willig und einsichtig zeigen - verschoben hat, bleibt Kontrolle als Intervention in Handlungen und Zustände, die als ‚abweichend‘ oder ‚verbesserungsbedürftig‘ betrachtet werden, bestehen (vgl. Franz 2000). Dies gilt vor allem für den weniger begünstigten und/oder ‚einsichtigen‘ Teil der Jugendhilfepopulation ebenso wie für diejenigen, die sich nicht in adäquater Weise ‚empowern‘ lassen wollen oder können (vgl. Stenson 1996). Für genau diese lässt sich seit einigen Jahren ein deutlicher Trend zur verstärkten Ausübung von Zwang und Überwachung feststellen (vgl. Dahme/Wohlfahrt 2002, Jordan/Jordan 2000, Kantel 2002). In einer sublimierten Form lassen sich auch in einer finalprogrammierten und dabei ökonomischen Rationalitäten folgenden Jugendhilfe Züge dessen finden, was Wacquant (2001: 402) ‚Liberal-Paternalimus’ nennt: „it is liberal at the top, […] and it is paternalistic and punitive at the bottom“. Das Problem der ‚klassischen’, benachteiligten Klientel der Jugendhilfe kann sich unter Umständen gerade vor dem Hintergrund, dass auf ‚Aushandlungsprozesse’ verstärkt Wert gelegt, und ihr Gelingen und Misslingen zu einem Gradmesser für den Erfolg der Leistungsangebote wird, dadurch verschärfen, dass sie mit einiger Regelmäßigkeit die Gruppen und Akteure darstellen, die „nur bedingt über die kommunikative Kompetenz verfügen, die notwendig ist, um in solchen Aushandlungsprozessen nicht nur zu bestehen, sondern auch aktiv mitbestimmend teilzuhaben“ (Böhnisch 1999: 168). Als Antragssteller müssen sie in der Lage sein, ihre Lebensweise mit den administrativen Experten auszuhandeln. Dabei werden nicht nur kommunizierte Inhalte, sondern implizit auch Sprachweise und -form und der performative Gehalt ihres Äußeren zum Gegenstand offizieller Prüfung (vgl. Marx 1995: 228). Das ungleich verteilte symbolische Kapital, die ‚richtige’ Sprache zu sprechen, um in der institutionellen Sprachlogik ‚gehört’ zu werden ‚Finalprogrammierung’ zusätzliches Gewicht. 249 (vgl. Bourdieu 1990), gewinnt in einer III. 6 EINE JUGENDHILFE OHNE INTEGRATIONSPERSPEKTIVE? Neben den ausgeführten Reformen auf der Ebene der Organisation der Jugendhilfe, sollen in diesem Kapital zwei Argumente, die für die Relativierung einer ‚normierend-normalisierenden’ Kontrollform sprechen, diskutiert werden. Zum einen ein ‚technologisches’ Argument, zum anderen ein für die Jugendhilfe ungleich wichtigeres Argument, das auf eine strukturelle Veränderung des Gegenstandsbereichs verweist, auf den die normierend-normalisierenden Interventionen der Jugendhilfe zielten. Das erste Argument ist lautet, dass in fortgeschritten liberalen Gesellschaften eine ‚technische’ Vorraussetzung der ‚Disziplinierung’ sukzessive verloren geht. ‚Disziplinierung’ bezeichnet das assimilative, normierend normalisierende Aufzwingen, repetetive Eintrainieren, Überwachen und institutionalisierte Reproduzieren einer bestimmten, verallgemeinerten Lebensform und Form des Sozialkontakts, die zugleich eine bestimmte Selbstbeziehung induzieren soll. Diese Selbstbeziehung soll in einem möglichst optimalen Passungsverhältnis zu dem gegebenen Netz sozialer Regeln stehen. Vor allem Foucault weist dabei auf die unauflösbare Verzahnung von ‚Macht’ und ‚Wissen’ hin: „Wir können gewissermaßen gar nicht in ein soziales Regelwerk unter psychischem Druck eingeübt werden, wenn wir nicht gleichzeitig auch die entsprechenden Formen des Wissens über uns selbst und restliche Wirklichkeit erkennen. Insofern hängen […] Macht und Wissen aufs engste zusammen: Mit jeder Etablierung eines bestimmten Machtsystems, verstanden als das Netzwerk all derjenigen praktischen Regeln, die eine soziale Lebensweise begründen, geht die institutionelle Privilegierung besonderer Wissensformen und Rechtfertigungspraktiken einher, die festlegen, was wir über die Welt überhaupt in Erfahrung bringen können“ (Honneth 2001: 22). Unter den Bedingungen notwenig ausdifferenzierter und pluralisierter Marktgesellschaften und der Resubjektivierung – möglichst aller – Subjekte als ‚autonome’ Marktsubjekte, die nicht nur ‚frei’ über ihren Lebensstil entscheiden sollen, sondern den zugleich auch eine Lebensführungsverantwortung zugeschrieben wird, wird die „meagalogical and obsessive fantasy“ (Rose 1990: 289) der Disziplinargesellschaft als ‚totally administered society’ (vgl. Rose 1993) nicht nur kontraproduktiv, sondern sozialtechnisch unmöglich. Disziplinierung verweist auf einen Kontrollmodus der Assimilation und Kontingenzreduktion, die differenzierte, professionalisierte und rationalisierte Fragen der Gewinnung von Informationen über und der ‚richtigen’ Technik der neutralisierenden Beherrschung von sozialen Risiken fokussiert, und dabei vor allem eine Angelegenheit des Expertenwissens verschiedener Diziplinen darstellt. Disziplinierung ist ein Teil jener präventiven Haltung, die, wie François Ewald (1998: 13) ausführt, „sich prinzipiell auf das Vertrauen in die Wissenschaft und ihre Gutachten stützt“. Man muss die Wissensgesellschaftsmetapher nicht teilen um der Einsicht zuzustimmen, dass Wissens für jeden einzelnen Akteur, in nahezu sämtlichen Lebensbereichen, die zentrale aber je ‚subjektiv’ variierende Ressource seiner Produktion und Reproduktion darstellt (vgl. Stehr 2000). So fern es richtig ist, dass der fortschritten liberale Arbeitsmarkt, Flexibilität, Selbstverantwortung und Selbstorganisation seiner ‚Arbeitskraftunternehmer’ bedarf (Voß/Pongratz 2001, Beck/Boness 2002) und in diesem Kontext das individuelle ‚Wissensmanagement’ (vgl. Mandel/Reinmann-Rothmeier 2000) und damit verbunden die Variabilität, Fragmentiertheit, Widersprüchlichkeit sowie die bloße Menge an Wissens- und Lebensmustern in einer Weise zunimmt, dass alleine das Erfordernis an Wissen über die einzelnen 250 Lebensformen und Lebensentscheidungen, sowie ihrer Bedingungen und der Möglichkeiten der Veränderung diese Bedingungen, das für eine umfassende, disziplinierende Kontrollform notwendig wäre, ein so exzessives Ausmaß erreichen müsste, dass es die Kapazitäten jeder Disziplin und Institution schlicht sprengen würde (vgl. Vaughan 2000, Stehr 2000). Neben diesem ‚technischen’ Problem besteht ein weiteres Problem disziplinierender Kontrollformen. In einer zugespitzten, aber treffenden Metapher beschreibt Young (1999a: 390) die fordistische oder ‚moderne’, inklusive Gesellschaftsformation als ‚anthropophagisch’. Es gilt den Abweichler vor allem dadurch zu bändigen, dass er gesellschaftlich ‚absorbiert’ wird. So verstanden war dies eine Logik, die zumindest ein gewisses ‚Verständnis-’ oder besser eine ‚Verständigungsbereitschaft’ gegenüber dem Abweichler beinhaltete, die jedoch mit einer Intoleranz gegenüber Differenz verbunden war. Eine relativ rigide Orientierung an verallgemeinert gültigen Normalitätsstandards, wurde an eine Orientierung gekoppelt die auf der Ebene des einzelnen Kontrollobjekts, die Dimension der Hilfe - als Verbesserung der positional- dispositionalen Matrix - betonte. In diesem Kontext ist der strukturelle, und dem Problem der begrenzten ‚Machtressource Wissen’ selbst vorgängige Wandel des Referenzsystems, auf das sich ihre ‚nomierend-normalisierenden’ Interventionen ‚traditionell’ beziehen für die Jugendhilfe noch wesentlicher als das ‚technische’ Problem der Sozialdisziplinierung. Die Ablösung der fordistischen Phase des Kapitalismus ist zugleich von einer veränderten Form der Subjektivierung in fortgeschritten liberalen Gesellschaften begleitet, die auch jene soziale Ordnung fragmentiert welche den zentralen Bezugsrahmen für die normierende Normalisierung der Jugendhilfe darstellte. Nicht nur aufgrund markoökonomischer Entwicklungen, sondern auch weil die neoliberalen Strategien „‚let the genie out of the bottle’ because the rise of individualism and consumerism celebrate diversity, choice, difference and fragmentation“ (McLaughlin/Murji 2001: 105). Wie Kessl und Otto (2002) nachzeichnen, werden jene Strategien, die radikale, emanzipatorische Kritiker forderten und die eine der Tendenz nach technokratische ‚normierend-normalisierende’ Jugendhilfe mehr oder weniger absichtsvoll vermieden hatte, zunehmend zu einem funktionalen Mittel der Wahl: Die Individuelle und intersubjektive Selbstorganisation, eine Schaffung von Freiräumen und die Reduzierung der Notwendigkeit einer direkten pädagogischen Führung auf ein Minimum. Damit ist zunächst ein relativer Bedeutungsverlust der sozialdisziplinierenden Kontrollfunktionen der Jugendhilfe genau impliziert. Wie bereits ausführlich diskutiert war aber genau diese Sozialdisziplinierungsfunktion die ‚Kehrseite der Medaille’ oder besser das negativ konnotierte Synonym der Bemühungen der Jugendhilfe um die ‚Integration’ ihrer Adressaten in die fordistische Gesellschaft. Weil das ‚doppelte Mandates’ eben keine ‚zwei Hälften’, sondern eher zwei organisch verbundene Effekte hatte, bedeutetet die Relativierung der Sozialdisziplinierungsfunktion der Jugendhilfe zugleich die Relativierung ihrer bisherigen sozialstaatlich orientierten, allgemeinen Integrationsfunktion in der Bearbeitung des Verhältnisses von sozialem Akteur und Gesellschaft. Böhnisch und Schefold (1985: 54 f) insistieren bereits Mitte der 1980er Jahren auf einen strukturellen Veränderungsbedarf der Jugendhilfe. Dieser wird nicht von der Kontrollkritik aus argumentiert, sondern quasi von der anderen Seite her begründet. Mit einer Gefährdung einer „Perspektive der prinzipiellen Reintegration in die Arbeitsgesellschaft“, so das Argument, sei „auch das sozialstaatliche 251 Modell der erweiterten Integration grundlegend in Frage gestellt“. In dem Maße wie sich die fordistische Ordnung des ökonomisch-sozialen Hintergrunds zugunsten einer einseitigen Dominanz einer Ökonomie der Ökonomie (vgl. Bourdieu 1998) verschoben hat, ist die bisherige Selbstverständlichkeit, mit der sich die Jugendhilfe auf ihre Hintergrundsicherheit verlassen konnte im Verschwinden begriffen (vgl. Böhnisch/Schröer 2001). Da sich trotz der ‚Krise des Sozialstaates’, in einer nach-fordistischen Gesellschaftsformation insgesamt keine regulative Alternative zum Wohlfahrtsstaat gefunden hat (vgl. Böhnisch 1994: 20) ist jedoch für die Jugendhilfe nicht geklärt, auf welche Inklusionsperspektive jenseits der fordistisch-sozialstaatlichen zurückgegriffen werden kann. Diese sozialregulative Krise im Kontext einer Infragestellung des allgemeinen Prinzips der Erreichbarkeit gesellschaftlicher Integration qua Lohnarbeit wird dadurch verstärkt, dass in der fortgeschritten liberalen gesellschaftlichen Formation eine integrierende Form der Lohnarbeit zwar eine knappe Ressource wird, aber gleichzeitig als Ressource zum Zugang gesellschaftlicher Teilhabe vor allem auch weil sie zunehmend sozialpolitisch alternativlos vorangetrieben wird - an (subjektiver) Bedeutung gewinnt (vgl. Schaarschuch 1998). Sofern es aber diese gesellschaftlichen Hintergrundstrukturen sind, die von einer ‚Normalisierung’ Sozialer Arbeit reflektiert werden, ist diese Normalisierung auf der Ebene der Adressaten zugleich einer ‚Normalität sozialer Desintegration’ (vgl. Schaarschuch 1996) geschuldet, der systematisch keine verallgemeinerte Strategie eines Vergesellschaftungs- und vergesellschafteten Teilhabeentwurfs gegenübergestellt wird. Jenseits partikularistischer, ‚neo-sozialen’ Strategien, hatten sich zunächst Böhnisch und Schefold (1985) theoretisch konsequent von der Suche nach einer umfassenden, gesellschaftlich integrativen Funktion Sozialer Arbeit verabschiedet, und ein ‚Wegdenken’ von der Integrationsperspektive hin zu einem ‚Paradigma der Lebensbewältigung’ eingefordert. Unabhängig von der Frage ihrer Alternativen im Einzelnen, kennzeichnet das Aufgeben gesellschaftlicher Integration als ihre zentrale Ausrichtung zugleich die Kontur einer Sozialen Arbeit, die im Rekurs auf die Flexiblitätsanforderungen einer fragmentierten, sektoralisierten und gespaltenen Gesellschaftsformation, verschiedene Formen und Grade sozialer Prekarität zwischen den Polen einer Ermöglichung und Sicherstellung sozialer Teilhabe auf der einen und sozialen Entkopplungen auf der anderen Seite, zu vermitteln hat (vgl. Schaarschuch 1998). Vor diesem Hintergrund ist ein Bedeutungszuwachs verständigungsorientierten Vermittlungshandeln - sei es zur Stützung von Lebenswelten, sei es zur Unterstützung situativen Bewältigungshandeln - als zentraler Strategie- und Praxismodus der Jugendhilfe jenseits einer Integrations- bzw. verallgemeinerten Teilhabeperspektive theoretisch durchaus denkbar. Unter den Bedingungen gesellschaftlicher Spaltung wäre dies aber letztlich kaum mehr als eine euphemistische Umschreibung einer Form des Daseinsmanagements innerhalb einer ‚Zone der Verwundbarkeit’ (vgl. Castel 1996, 2001), ohne dass damit notwendigerweise eine Perspektive auf einen substanziellen sozialen Fortschritt der Adressaten impliziert wäre. In diesem Kontext könnte sich die Jugendhilfe auf eine Hilfe, Unterstützung und Beratung im alltäglichen ‚lebensweltlichen’ ‚Durchkommen’ im Gegebenen konzentrieren, würde es aber zugleich aufgeben, eine Perspektive des sozialen ‚Vorwärtskommens’ zu formulieren. 252 Die Frage der Stützung der ‚Lebenswelt’, der von einer umfassenden sozialen Teilhabe entkoppelten Bevölkerungsgruppen, kann sich allerdings dann nicht ohne Zynismus stellen, wenn deren Position bereits im Wesentlichen durch Nicht-Zugänge gekennzeichnet ist. Überspitzt bedeutet ein solches Verhandeln über Prekarität innerhalb derselben, animierend bis steuernd auf die Dispositionen der Betroffenen so einzuwirken, dass sie sich mit ihrer gegebenen Position abfinden, und bestenfalls zu verhindern, dass sie völlig in das ‚abrutschen’, was Robert Castel (1996) treffend die ‚Zone der Exklusion’ nennt. Dass, wie z.B. Uwe Bittlingmeyer (2000: 8) den „völlig unscharfe[n[ coping-Begriff“ in der Sozialpädagogik wie der in der Armutsforschung kritisiert, „alle sozialen Akteure die systematisch gestiegene Produktion von Unsicherheit und Flexibilitätsanforderungen in irgendeiner Form verarbeiten ist trivial. Entscheidend ist aber, ob damit eine individuelle Mobilität oder aber die Reproduktion des sozialen status quo einhergeht“. Genau diese Frage bleibt auch in einem ‚Bewältigungsparadigma’ jenseits einer Perspektive gesellschaftlicher Integration offen. Deutlicher als im ‚Bewältigungsparadigma’ noch, kommt dieses Dilemma in den Konzepten eines gelingenderen Alltags innerhalb der ‚Lebenswelt’ zum Ausdruck. Hans Thiersch (2000: 531) beispielsweise, spricht in diesem Kontext nicht nur von einer Differenz, sondern gar von einem „Gegensatz und Systemintegration und Sozialintegration“. Die Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit widmet sich dabei - während Fragen der Kontrollfunktion vor allem in erstgenannter vermutet werden - der Frage der ‚Sozialintegration’. In diesem Sinne stellt die ‚Lebensweltorientierung’ in der Tat eine Art, wie es Christian Schrapper (2001: 76) formuliert „,Godesberger Programm’ der modernen Sozialpädagogik“ dar, das sich in der Frage ob „Klasse oder Biographie, soziale Schicht oder konkretes Leben“ die zentralen Bezugsgrößen in der Bearbeitung sozialer Problemlagen der Akteure sein sollen dazu entschieden hat die Unmittelbarkeit des ‚konkreten Lebens’ und „Kompetenzen und Ressourcen“ zu fokussieren, über die die Akteure verfügen, um „ihre Probleme eigenständig und in ihrem Sinne (eigensinnig) zu lösen” und von „theoretisch abgeleiteten Vorgaben für das ,richtige’ Leben” Abstand zu nehmen“ (vgl. dazu kritisch: Brumlik 1992). Der Verzicht auf unmittelbare Ableitungen aus positivistischen Einsichten in soziale Strukturen mag zwar noch so einsichtig sein, das entscheidende ‚Integrationsproblem’ in Bezug auf fortgeschritten liberale Gesellschaften wird dabei allerdings eher umgangen als gelöst: Um theoretisch gehaltvoll von ‚Lebenswelt’, als begrenzbaren und benennbaren Gegenstand sprechen, ist es erforderlich, von einem durch spezifische Regelmäßigkeiten und spezifische Logiken kollektiver Praxis strukturierten Sinnzusammenhang auszugehen. In der dominierenden sozialpädagogischen Fassung von ‚Lebenswelt’ werden diese als primäre durch soziale Interaktionen vermittelte soziale Räume lebenspraktischer Unmittelbarkeit gefasst (dazu: Boden/Molotch 1994). In einer solchen ‚konkreten’ Form können sie aber kaum widerspruchsfrei als Orte verständigungsorientierten Handelns (vgl. Habermas 1983) verhandelt werden. Als Orte alltäglicher Praxis stellen sie eher (disaggregierte) strukturierte ‚soziale Räume’ (vgl. Bourdieu 1985) dar - oder wie es Ray 1999 (6 f) formuliert, „structured unequal, and socially constructed environment within which organizations are embedded and to which organizations and activists constantly respond [… and thus] configurations of forces and […] sites of struggle to maintain or transform those forces” -die ihrerseits durch soziale Abstände, herrschaftsförmige 253 Relationen, rigide Distinktionsprozesse symbolische Demarkationslinien und interessegebundenen ‚Klassen-’ und ‚Konkurrenzkämpfe’ gekennzeichnet sind und die in diesem Feld stattfinden und eben nicht nur von außen darauf einwirken. Sofern von konfliktuösen, durch Ungleichheit und Machtdifferentiale gekennzeichneten Prozessen in den kollektiven Alltagspraxen innerhalb der Lebenswelten der Akteure nicht abstrahiert wird, ist es nicht einsichtig, warum diese Orte und Entitäten, in die die Soziale Arbeit gemäß ihrer Funktions- und Zielperspektive certeris paribus zu intervenieren hätte, einen konzeptionell-programmatischen Ziel- und Orientierungspunkt Sozialer Arbeit darstellen sollen, die Lebenszusammenhänge und Daseinspraxen beschreiben, die als solche für die Soziale Arbeit funktional und normativ in den Mittelpunkt zu stellen sind. Zwar scheint die Annahme einer relativen Eigenlogik lebensweltlich strukturierter Praktiken durchaus sinnträchtig, jedoch sind die Fragen relationaler sozialer Abstände ebenso wie die gerade in Alltagspraktiken eingelagerten materiellen, kulturellen und symbolischen Machtrelationen keinesfalls bloße Produkte der unmittelbar alltagspraktischen Regelmäßigkeiten einer zur kollektiven Robinsonade aggregierten ‚Lebenswelt’. Der soziale Mirkokosmos ‚Lebenswelt’ verfügt nicht über eine substanzhafte, ontologische Autonomie sui generis, die unabhängig von den Logiken, Regelmäßigkeiten, Verhältnissen und Positionierungen in der weiter gefassten gesellschaftlichen Markoebene des sozialen Raums besteht. Aus der Einsicht, dass Problemkonfigurationen in einer bestimmten Form in der alltagspraktischen Lebenswelt virulent werden, kann nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass diese auch hierin begründet und sinnvollerweise dort zu bearbeiten wären. Sofern der konfliktuöse Charakter der Lebenswelt ebenso wie ihre Strukturierung durch und Relationierung innerhalb weit reichender gesellschaftlicher Prozesse und Formierungen theoretisch und konzeptionell ausgeblendet bleiben, wird es zu einer impliziten Aussage der ‚Lebensweltorientierung’, dass die Regelmäßigkeiten des Zusammenlebens nun mal so sind wie sie eben sind und es nur zu Überlegen sei, wie man ‚vom Subjekt ausgehend’ das Mitspielen innerhalb dieses Spiels ‚gelingender’ machen kann. Eine Bearbeitung der innerhalb und außerhalb gegebener ‚Lebenswelten’ angelegten Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse ist in einer solchen Orientierung weniger angelegt als der Versuch einer Optimierung eines ‚doxischen’ Passungsverhältnisses der Dispositionen und Handlungsmöglichkeiten des Akteurs mit den gegebenen Strukturen seines sozialen Daseins. Gefordert wird ein Verständnis der „Probleme der Sozialen Arbeit […] von den heutigen, konkreten Bewältigungsaufgaben, wie sich Menschen in ihrer Lebenswelt den Ressourcen und den Problemen dieser Lebenswelt stellen“ und dem Versuch ihnen „in der gegebenen brüchigen Normalität Unterstützungen und Lernhilfen zur Bewältigung“ (Thiersch 1998a: 18 ff) zu geben. Diese Bewältigung leistet aber der betroffene Akteur selbst. Hilfe zur Lebensbewältigung innerhalb von ‚Lebenswelten’ ohne die Perspektive gesellschaftlicher Integration, kann jedoch unter derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen analytisch konsequent zu Ende gedacht, für benachteiligte Gruppen nicht mehr bedeuten, als das erträglich machen ihrer Existenz im Sinne eines ‚Überlebens’ im marginalisierten Status quo am unteren Rand der Gesellschaft. In diesem Sinne ist - ungeachtet der in der Normalisierungsthese ausgedrückten ‚Befreiungsperspektiven’ - die derzeitige Alternative einer 254 Jugendhilfe, die es aufgegeben hat, ein bestimmtes Normalitätskonzept durchzusetzen, kaum mehr als ein „pädagogische[s] ‚Management der Spaltung der Gesellschaft´“ (Schaarschuch 1996: 92). Auch die in einem solchem ‚Management’ nicht suspendierte Kontrolldimension der Jugendhilfe hat im Vergleich zu dem kritisierten Integrations-Disziplinierungs-Nexus im fordistischen Sozialstaat eine strukturell andere Qualität. Mit einem Schwinden der assimilativen Integrationsfunktion in einem quasi-universellen sozialstaatlich induzierten und garantierten Sinne, verschiebt sich das Verhältnis von sozialer und gesellschaftlich arrangierter Inklusion und der individuellen Bringschuld als deren (zu erzeugende) Voraussetzung. Entlang der gesellschaftlichen Spaltungslinien kann man für eine Jugendhilfe ohne Inklusionsperspektive von zwei Varianten der Leistungserbringung sprechen. Die ‚privilegierteren’, ‚unproblematischen’ Nutzer der Jugendhilfe können zwischen den Angeboten, die die Jugendhilfe ihnen bereitstellt, relativ frei wählen, während – insofern ein Normalisierungsbedarf wegfällt – auf der Ebene der Kontrolle, Normierung, im Sinne der Erzeugung eines erwünschten Sozialcharakters, gleichsam an Bedeutung verliert. Für die ‚unterprivilegierten’ und/oder ‚problematischen’ Nutzer wird im bei einem Wegfall einer integrativen Perspektive eine andere Seite dieser Verschiebung wirksam. Eine Seite in der die Normierungsperspektive alleine bestehen bleibt und bezogen auf die Strukturierung und Gesamtorganisation der Gesellschaft ohne die positive Bestimmung ihrer Aufgabe im Sinne der Erzeugung gesellschaftlicher Teilhabe, eine rein negative Bestimmung, wie beispielsweise die Verhinderung von ‚Auffälligkeit’ und ‚Kriminalität’ erhält. Chassé und Wensierski (1999: 11) beobachten beispielsweise eine grundlegende „Infragestellung des sozialen Zusammenhangs der Gesellschaft infolge der Modernisierung und ihrer Zuspitzung durch Globalisierung […Diese stelle die] Soziale Arbeit in ihrer Zentrierung auf gesellschaftliche Integration vor die Herausforderung, daß ihre kompensatorischen Hilfen strukturell unwirksam werden. Bei der Fortschreibung der gegenwärtigen Entwicklung würde Sozialer Arbeit die Aufgabe des Managements von ausgeschlossenen Personen und Milieus zufallen – eine keineswegs abseitige Schreckensvision. Das für soziale Arbeit konstitutive doppelte Mandat wäre in Zukunft aufgespalten in Hilfe für die Integrierten und Kontrolle für die Ausgeschlossenen.“ Dabei lassen sich für die Soziale Arbeit ‚in guter Gesellschaft’ (Schaarschuch 1996) - d.h. für die Nutzer am ‚oberen’ Ende - vor allem „beratende, therapierende und sozialstrukturelle Angebote und Projekte [finden], am ‚unteren’ hingegen, im Bereich manifest abweichender Verhaltensweisen, kommt es zu einer […] ‚Rückkehr des strafenden Staates“ (Beckmann 2001: 55). Diese Diagnose entspricht den Beobachtungen von Lutz (2000: 118) über die Entwicklung der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern, die in einer starken „Betonung von Prävention als Problemverhinderung bei gleichzeitigem Bestrafungsdiskurs […und einer] Fixierung auf ‚ausgewählte’ und ‚lohnenswerte’ Klienten […bestehen würde, wobei] professionelle Hilfe und methodische Hilfen […] vor allem Entwicklungswilligen und –fähigen reserviert [blieben]“. Aber auch in den ‚alten Ländern’ findet sich eine seit längerem berichtete Tendenz zu einer weitgehend zwanglosen „Jugendhilfe de luxe mit immer mehr Alltagsnähe, diskursoffen und erlebnisintensiv, für die Bessergestellten [und einen auf…] Disziplinierungstechniken aufbauende[n], durch ein wenig Therapie abgefederte[n] Verwahrungsbereich für nicht integrierbare (und damit auch nicht divertierbare) Restgruppen“ (von Wolffersdorff 1993: 55). Für die Jugendhilfe ist es demnach fraglich, ob das im Kontext des keynesianischen Sozialstaats dialektisch wirksame Bedingungsverhältnis von ‚integrativer’ Hilfe und ‚normierender’ Kontrolle, in 255 beide Richtungen kollabiert, wenn die Integrationsperspektive weg bricht, oder ob sich die Normierung eines erwünschten Sozialcharakters auch ohne ein integratives Versprechen - das mit der Einlösung der gestellten Anforderungen strukturell wirksam wird - als operativer Handlungsmodus der Jugendhilfe vollzieht. Dabei spricht einiges dafür, dass es auch ohne sozialstaatliche Integrationsperspektive eine „Platzanweisung an die Sozialpädagogik [bleibt]– ob ihr das schmeckt oder nicht -, die Aufgabe zu leisten, soziale Kontrolle möglichst präventiv mittels Anbieten von ‚Hilfen’ zu bewirken; also zu bewirken, dass es Devianten lohnend erscheint, ‚sich zu benehmen’ und den übrigen sich daran ein Beispiel zu nehmen, so dass der Einsatz von Zwangsmitteln und Sanktionen […] auf das unvermeidbare Minimum beschränkt werden kann“ (Hörster/Müller 1996: 616). Dies gilt nicht nur für den Bereich des ‚Kriminellen’. Exemplarisch wäre eine Jugendberufshilfe zu nennen, die für einen großen Teil ihrer Klientel versucht den (‚moralischen’) Habitus des Lohnarbeiters zu erzeugen (vgl. Gericke et al 2001), ohne die Perspektive der allgemeinen Inklusion in den Arbeitsmarkt aufrecht erhalten zu können, sondern für diesen funktional vor allem ein Organ der selektiven Distribution, a priori gegebener Zugangsmöglichkeiten zum Lohnarbeiterstatus darstellt. Beispielsweise im Kontext von Assessments und Maßnahmen zur Erhöhung der ‚Employabilität’ im Rahmen des Beitrags der Jugendhilfe zu einer sozialpolitischen Umorientierung in Richtung ‚workfare’, kann dies durchaus Formen einer ‚Normalisierung an der Oberfläche’ annehmen: Einer spezifischen und durchaus rigiden Dispositions- und Verhaltensorientierung die kein verallgemeinertes Teilhabeversprechen als ihr organisches Gegenstück mehr gibt (vgl. Jordan/Jordan 2000). In diesem Sinne impliziert der ‚Wille zur Inklusion’ zwar Disziplinierung als seine im Kern unsuspendierbare Kehrseite, die Kehrseite von Kontrolle und Disziplinierung muss aber weder logisch noch faktisch das Versprechen von Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe sein. Allerdings ist auch diese ‚Normierung an der Oberfläche’ nicht automatisch eine rein zwangförmige Normierung, die keine Zugeständnisse an die Eigeninteressen der sozialen Akteure macht. Selbst im äußersten Falle kann sich die Motivation der betroffenen Akteure den ‚nicht ablehnbaren Angeboten’ (vgl. Lodemel/Trickey 2001) und anderen sozialpädagogisch gestaltete Maßnahmen, um der persönlich zugeschriebenen Lebensführungsverantwortung Nachdruck zu verleihen, all zuviel Unwilligkeit oder Widerständigkeit entgegen zu bringen, alleine deshalb in Grenzen halten – bzw. die ‚ko-produktive’ Annahme dieser Dienstleistungsangebote kann alleine deshalb durchaus ‚freiwillig’ erfolgen - weil sie schlicht noch die vergleichsweise Besten der gegebenen Optionen darstellen. Dabei geht es dann weniger um sanktionierende Maßnahmen durch die Jugendhilfe selbst, als um die implizite oder explizite Drohung mit den Alternative – etwa mit einer (weiteren) Kürzung von Sozialleistungen, einer Überstellung an die Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Maßnahmen, die im eher Umfeld der ‚Institution Verbrechen/Strafe‘ (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998) angesiedelt sind da es, wie es z.B. in den Vorschlägen der Jugendministerkonferenz (2000) und auch im 11. Kinderund Jugendhilfehilfebericht (2002) heißt, Mittel jenseits der freiwilligen Angebote bedarf, wenn sich die Adressaten diesen entziehen. Jugendhilfe ist dann zwar nicht im engeren Sinn der Betreiber der Sanktionen (vgl. Peters 2002) oder gar einer institutionell legitimierten und durchgeführten Form des Ausschusses, aber in einem gewissen Sinne ein vorgelagerter Lieferant der Klassifikationen über den ‚schuldhaft‘ auszuschließenden Sozialcharakter (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 1998). 256 So lange Soziale Arbeit eine integrative Perspektive als Basis ihrer (präventiven) Interventionen anbieten konnte, wandte sie sich zwar in erster Linie an die Verlierer in den praktischen Ökonomien der Felder, konnte aber sicherstellen, dass sie in dem Spiel – wenn auch nach den Regeln des Spiels mitspielen konnten. In diesem Sinne kann man nicht nur von einer Dialektik von Integration und Normalisierung bzw. Normierung sprechen, sondern bezogen auf den einzelnen Akteur von einer Synonymität dieser Dimensionen. Sie stehen funktional nicht in einem These-Antithese Verhältnis, sondern sind zwei synchrone Seiten einer Medaille. Auch mit einem Wegfall der integrativen Perspektive werden gesellschaftlich wie feldspezifisch ‚entkoppelte’ (Castel 1996) Gruppen offensichtlich nicht nur mit den punitiven Strategien des staatlichen Souveräns bearbeitet, sondern sind nach wie vor ein Klientel der Soziale Arbeit. In dieser Hinsicht wäre zumindest funktional „in der gespaltenen Gesellschaft für [… die Soziale Arbeit] auch die Funktion des Verwahrens gesellschaftlich Überflüssiger“ denkbar (Schaarschuch 2000b: 167). In diesem Falle wäre die konstitutive Gleichzeitigkeit von Integration und Normierung/Normalisierung als ‚doppeltes Mandat’ im keynesianische Wohlfahrtsstaat ohne ‚Verlust’ einer Kontrollfunktion aufgelöst. Eine Relativierung einer gesamtgesellschaftlich gültigen Normalität, die die Kontrastfolie für gesellschaftliche Integration darstellt, bedeutet eben keinesfalls, dass die Unterscheidung abweichend versus konform obsolet wäre oder sich in subjektive Beliebigkeiten aufgelöst hätte. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass Normierung, z.B. in Form von ‚harten’, negativen Grenzziehungen wie im Falle von Kriminalität als statischer erwiesen haben als die positive Feststellung gesellschaftlicher ‚Normalität’ in die es zu integrieren gilt. Während die Disziplinierung sozialer Akteure qua Sozialer Arbeit ein unhintergehbarer Teil ihrer Normalisierungsfunktion innerhalb des Sozialstaates ist, ist, wie es Lothar Böhnisch (1994: 28) treffend formuliert, was ohne ein quasi-universelles öffentlich-sozialstaatliches Integrationsversprechen „an Integrativem faktisch bleibt […] der Ordnungsstaat, dessen Institutionen bei abnehmender sozialintegrativer Dynamik in den Vordergrund treten.“ Bezogen auf das ‚klassische’ doppelte Mandat ist es demnach nicht unplausibel, die normierende Dimension als Konstante, die integrative Dimension als spezifische, historische Variable zu verhandeln67: Das klassische doppelte Mandant ist nur in einer Richtung ein tatsächlich doppeltes: Integration beinhaltet immer zugleich Normierung, aber Normierung bedeutet eben nicht immer Integration. Betracht man die beiden Dimensionen des doppelten Mandats der Jugendhilfe im fordistischen Sozialstaat, so fällt zunächst auf, dass sie keinesfalls auf einer Ebene liegen. Bezieht man diese Dimensionen auf das Verhältnis von Position und Disposition, so richtet sich Integration primär auf eine gesellschaftliche bzw. politische Position, während Normierung zuvorderst auf die individualisierbaren Dispositionen eines sozialen Akteurs zielt. Mit Blick auf diese Bezugsdifferenz lässt sich eine ganze Reihe von Ansätzen vorstellen, die Dispositionen oder auch bloße Verhaltensweisen ohne substanziellen Bezug auf soziale Positionen bearbeiten. 67 So hatte beispielsweise die frühneuzeitliche Armenfürsorge ohne Zweifel Ordnungsfunktionen, ihre Hilfedimension war aber eher karitativ und bis zu einem gewissen Grad auch reformativ gegenüber ihren Subjekten als gesellschaftsintegrativ ausgerichtet. 257 Mit Bezug auf den Wandel der Kontrollformen der Jugendhilfe ist ein Blick auf die von David Riesman entwickelte Metapher des ‚innengeleiteten’ Menschen gewinnbringend, dem er - Theorien der ‚Massengesellschaft’ bzw. ‚Massenkultur’ reflektierend - den wesentlich flexibleren und kontextsensiblen ‚außengeleiteten Menschen’ gegenüberstellt: Der innengeleitete Mensch wird von einer Art langfristigem, früh internalisierten 68 beeindruckenden ‚innerem Kompass’ und von situativen Wandlungen wenig zu in seinen Wertungen und Verhaltensweisen geleitet. In einem gewissen Sinne reflektiert Sozialdisziplinierung als eine Erzeugung eines Passungsverhältnis von Habitus und Normalitätsanforderungen diesen ‚innengeleiteten’ Menschen. Werden allerdings Flexibilitätsanforderungen größer und finden Integrationsbemühungen in einem geringerem Maße eine für alle Akteure erreichbare (vgl. Böhnisch 1994) verallgemeinerte, ‚assimilative’ gesellschaftliche Normalität, verliert diese Figur ihre handlungsbestimmende Dominanz (vgl. Dubet 2003), während situative Angemessenheit und modularisierende Anpassungsfähigkeit an Bedeutung gewinnen (vgl. Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995). Gilles Deleuze (1990) spitzt diese Position in seiner ‚Innenansicht über die kontrollierte Gesellschaft’ auf die Frage zu, ob der Versuch der Hervorbringung von Personen als In-Dividuen (‚Unteilbare’) nicht selbst einen Anachronismus darstelle, da ein permanenter Übergang in unterschiedliche Sinn-, Regelmäßigkeits-, Norm-, Erwartungs- und Lebenskonstellationen eine Form der Identitätsarbeit erfordere, der vielmehr die Figur eines wandlungs- bzw. modulationsfähigen ‚Dividuums’ entspreche (vgl. Bradley 1997). Sofern man mit Bourdieu (2001: 238) davon sprechen kann, dass die Habitus der Akteure einer „ständigen Revision unterworfen“ sind und diese in Abhängigkeit der Individuen „und der ih[nen] eigenen Flexibilität oder Rigidität schwankt“ kann davon gesprochen werden, dass ein gesellschaftliches Arrangement bzw. eine politischsymbolische Figuration evoziert wird, die in Bezug auf die Habitusformierung der Akteure darauf zielt die „Anpassungsfähigkeit“ des Habitus hervorzuheben, und damit den „Opportunismus einer Art mens momentanea“ (Bourdieu 2001: 238) – bzw. einen unsteten, widersprüchlichen und ‚zerrissenen Habitus’ (vgl. Bourdieu 2001c: 83) - zu einer Tugend werden lässt, während die Fähigkeit „in der Begegnung mit der Welt ein Gefühl innerer Geschlossenheit zu bewahren“ (Bourdieu 2001: 238) zunehmend als ein Problem der (post-)modernen Lebensführung repräsentiert wird (vgl. Ebrecht 2002). Das ‚Dividuum’ ist in der Tat nicht weit entfernt von jener Leitfigur des ‚situational man’ (vgl. Lofland 1967), bzw. des ‚homo oeconomicus’, der weniger aufgrund seiner moralischen Dispositionen, sondern vor dem Hintergrund einer persönlichen Kalkulation der Gelegenheitsstrukturen, den Wahrscheinlichkeiten der Entdeckung und der mutmaßlichen Reaktion entweder abweichend oder konform reagiert, und auf dem eine ganze ‚postmoderne Denkrichtung’ (vgl. Kunz 1998) zeitgenössischer Kontroll- und Präventionsformen aufbaut (vgl. Lyon 1994, von Hirsch et al. 2000). Sofern auch in der Jugendhilfe diversifizierte, je feldspezifisch-sektorale Modulationsanforderungen in dem Maße in den Vordergrund, wie eine umfassende gesellschaftliche Teilhabeperspektive oder gar sicherung nicht mehr gewährleistet ist, macht es mehr Sinn von einer Vielzahl ‚doppelter Mandate‘ gemäß den Regelmäßigkeiten und relativ autonomen praktischen Ökonomien der einzelnen Felder und François Dubet (2003: 79) verweist darauf, dass sich dieser ‚innere Kompass’ weniger durch Traditionen, sondern vor allem durch einen „Grundbestand autonomer Werte“ konstituiert hat. 68 258 Subfelder - zu sprechen, als von dem einen ‚doppelten Mandat’ das in einer verallgemeinerten ‚integrierenden Hilfe und normierenden Normalisierung’ besteht. ‚Doppelte Mandate‘ jenseits sozialstaatlicher Integration lassen sich z.B. als (flexible und kontextbezogene) Formen der Normierung vorstellen, denen in unterschiedlichem Maße (karitative) Hilfen, eine Vermeidung punitiver Reaktionen, eine individuell konzipierte ‚Lebensbewältigung’, biographische Stützungen, Lebenslaufbegleitungen, Formen der Integration in einem spezifischen, partikularen sozialen Feld, Aktivierung zur Teilnahme an partikular-gemeinschaftlichen Aktivitäten innerhalb eines spezifischen sozialen Raums usw. gegenüberstehen. Solche Interventionsrationalitäten jenseits des Versprechens einer Integration in das Soziale - in dem Sinne, dass durch eine wohlfahrtspolitische bzw. sozialstaatliche Moderierung Systemintegration und soziale Integration mehr oder weniger ineinander fallen (vgl. Dubet 2003) - bedeuten demnach zwar kein Abrücken von Kontroll- und Normierungsaufgaben aber eben auch nicht zwangsläufig, dass die normierenden Funktionen in der Sozialen Arbeit an – relativem - Gewicht gewinnen. Die spezifischen sektoralen Formen der Normierung können zwar ohne ein wohlfahrtsstaatliches Teilhabeversprechen als Ganzes auskommen, aber kaum ohne Bezug auf die Bedürfnisse der sozialen Akteure. Treffend hat Karl Otto Hondrich (1975) darauf hingewiesen, dass sich (Normierungs-)Macht aus menschlicher Bedürftigkeit – bzw. ‚Begehren’ (vgl. Lemke 1997) - speist. „Wenn man sich den Rückzug eines Menschen in die Bedürfnislosigkeit vorstellt“, führt er aus (1975: 68 f) aus, sei „ein Grenzfall menschlicher und sozialer Existenz erreicht, der gegenüber Sanktionen unempfindlich macht und große Handlungsfreiheit mit höchstem Risiko verbindet; Machtdrohungen greifen nicht mehr, der Mensch wird gegenüber allen Machtbeziehungen souverän“. In diesem Kontext lässt sich argumentieren, dass es den Interventionslogiken – und dem Rekurs auf die Machtmittel soziales und kulturelles Kapital – der Sozialen Arbeit entspricht, sich von allen Instanzen sozialer Kontrolle am deutlichsten an der Frage der Bedürfnisse ihrer Adressaten und Adressatinnen auszurichten (vgl. Peters 2002). Eine solche Orientierung an den artikulierten oder rekonstruierten Bedürfnissen der Adressaten ist zugleich ein wesentliches Merkmal und eine Bedingung dafür eine Handlung semantisch angemessener Weise als ‚Hilfe’ zu bezeichnen (vgl. Brumlik/Keckeisen 1976, Müller/Sünker 1995, Müller 2001, Peters 2002). In diesem Sinne spricht nichts dagegen, dass nicht nur eine der Hilfe inhärente Form der Kontrolle in der Sozialen Arbeit zu rekonstruieren ist (vgl. Bommes/Scherr 2000), sondern dass auch jenseits eines generalisierten Teilhabeversprechens einer sozialpädagogisch adäquaten Form der Kontrolle ein Moment der Hilfe – d.h. der Bedürfnisorientierung - immanent sein kann und in aller Regel auch ist. Auch wenn der Verlust einer sozialstaatlich induzierten Perspektive gesellschaftlicher Teilhabe, als positive Feststellung gesellschaftlicher ‚Normalität’, in die es zu integrieren gilt, sich in der Weise auf die Dimensionen von ‚Hilfe und Kontrolle’ der Jugendhilfe auswirkt, dass diese in fortgeschritten liberalen Gesellschaftsformationen flexibler, stärker individualisiert, diversivifiziert, situations- und kontextbezogen und im Kotau mit jenen sozialen Ordnungen und Regelmäßigkeits- und (Sub)Normsystemen, auf die sie sich beziehen, auch ‚verstreuter’ und ‚fragmentiert’ (vgl. Cohen 1979, 1985, Hall 1992, Lacombe 1996) geworden ist, bedeutet dies keinesfalls, dass für eine Organisation 259 der Teilhabe an dem gesellschaftlichen ‚Großraum’ des Sozialen (vgl. Karstedt 2003) keine Substitutive gefunden werden könnten. Wie im folgenden Kapitel ausgeführt wird, hat ‚Integration’ weder für die Frage der Generierung sozialer Ordnung noch für die Jugendhilfe an Bedeutung verloren. In diesem Zusammenhang kann vor allem eine ‚Nah-’ oder ‚Sozialraumorientierung’ in der Sozialen Arbeit als der Entwurf einer sozialen Entität gefasst werden, in der ‚Integration’ - durch ‚aktive’ ‚Teilnahme’ - unterhalb einer verallgemeinerten und supra-feldspezifischen Gesellschaftsbegriff verhandelt werden kann. In diesem Fall ist für die Jugendhilfe eine ‚neue’ Integrationsperspektive gefunden worden, die sich zugleich als flexibler und kontextsensibler erweist als die in eine wohlfahrtsstaatliche, gesellschaftliche Normalität, nämlich ‚Integration’ und flexible Normierung gemäß je feldspezifischen oder sektoralen Hegemonien. 260