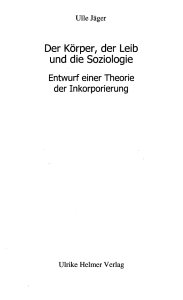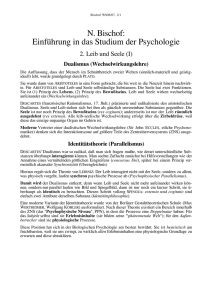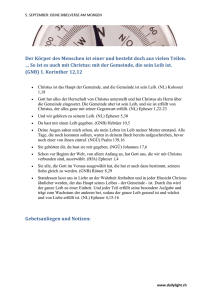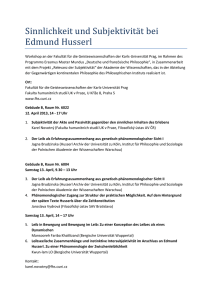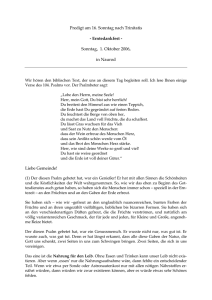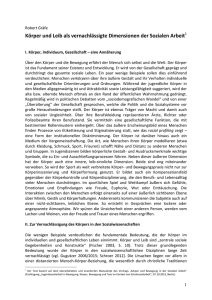‹Umlernen!› - Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Werbung

‹Umlernen!› Über das Vergessen der Leiblichkeit in der Medizin Vortrag von Prof. Dr. Frank Mathwig anlässlich des Nationalen Palliative Care Kongresses vom 13. - 14. November 2012 in Biel Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK Sulgenauweg 26 CH-3000 Bern 23 Telefon +41 (0)31 370 25 25 [email protected] www.sek.ch 1. Einleitung Der schwere Stand der Leiblichkeit in der Medizin verweist auf kein disziplininternes Defizit, sondern – allgemeiner und umfassender – auf ein Erbe der neuzeitlichen Philosophie. Descartes denkendes Ich, das sich seiner Leiblichkeit entledigt, degradiert den eigenen Körper zu einem verfügbaren Objekt. Damit schafft er – quasi nebenbei – überhaupt erst die Voraussetzungen für die moderne Medizin. Bereits Nietzsche monierte ein solches Denken und empfahl: «Also Umlernen! [...] Das Geistige ist als Zeichensprache des Leiblichen festzuhalten»1 Obwohl der Philosoph nicht in den gängigen medizinischen Curricula auftaucht, ist seine Forderung alles andere als unerheblich für das Fach. Sie lenkt den Blick auf die korrektur- bzw. ergänzungsbedürftigen anthropologischen Voraussetzungen medizinischen Handelns. Die folgenden Bemerkungen drehen sich näherhin um zwei Fragen: 1. Was ist gemeint, wenn vom Leib die Rede ist? Und 2. Welche Rolle spielt die Leib-Kategorie bei Palliative Care bzw. welche Bedeutung sollte sie haben? 2. Vom ‹Missverständnis des Leibes› als Körper Der Ausdruck ‹Leib› – in Abgrenzung zum ‹Körper› – präsentiert eine Eigenart der deutschen Sprache. Die meisten anderen europäischen Sprachen kennen nur einen einzigen Begriff: griechisch soma, lateinisch corpus, französisch corps oder englisch body. Mit der philosophischen Tradition kann ‹Leib› als belebter und beseelter Körper definiert und damit von anderen physischen Körpern abgegrenzt werden. Vor dem Hintergrund eines naturwissenschaftlich-rationalistischen Weltbildes richtet sich die Leibkategorie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kritisch gegen eine Objektivierung des menschlichen Körpers und betont dagegen die Untrennbarkeit von Körper, Geist und Seele.2 Der französische Existenzphilosoph Gabriel Marcel bringt den Zusammenhang auf den Punkt: «Wird dieser Leib, als der ich inkarniert lebe, objektiviert, so erscheint mein Körper, das Missverständnis des Leibes. Dieser Körper kann, wie die imaginäre Seele, die ihn informieren soll, in beliebiger Weise objektiv betrachtet, klinisch untersucht und chirurgisch amputiert werden. Diesen Körper habe ich; ich bin aber mein Leib.»3 Das Wissen über den eigenen Körper gewinnen wir – durch Beobachtung – von aussen: Im Spiegel kann ich mich in einer Weise betrachten, die meiner leiblichen Perspektivität 1 Nietzsche, KSA Bd. 10, 285. Vgl. ders., Zarathustra, in: KSA 4, 40: «Das schaffende Selbst schuf sich Achten und Verachten, es schuf sich Lust und Weh. Der schaffende Leib schuf den Geist als eine Hand seines Willens.» 2 Moderne Wegbereiter dieser Kritik waren in ganz unterschiedlicher Weise Edmund Husserl, Martin Heidegger, Helmut Plessner, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty oder Gabriel Marcel, gegenwärtig etwa Wilhelm Schmitz, Bernhard Waldenfels oder Gernot Böhme. Die feministische und Genderdiskussion, sowie eine kritische Medizinsoziologie und -ethik liefern ebenfalls wichtige Impulse für das Thema. 3 Gabriel Marcel, Leibliche Begegnung. Notizen aus einem gemeinsamen Gedankengang, in: Hilarion Petzold (Hg.), Leiblichkeit. Philosophische, gesellschaftliche und therapeutische Perspektiven, Paderborn 1985, 15–46 (16). 2 verschlossen bleibt. Medizinische Geräte liefern Daten über meinen Körper, die Ärztin oder der Arzt informieren mich über bestimmte körperliche Zustände, ich unterschreibe Einwilligungen über medizinische Eingriffe an meinem Körper. Allgemein formuliert: Wir konstruieren aus einer Aussensicht Körperbilder (body images), im Sinne von habituellen, visuell-räumlichen Vorstellungen vom eigenen Körper, seinem Aussehen und seinen Eigenschaften.4 Dem folgt eine medizinische Entwicklung, die immer mehr Techniken bereitstellt, um die faktische Beschaffenheit des Körpers irgendwelchen Wunschbildern anzupassen (Schönheitsoperationen, Enhancement-Technologien, Prothetische Chirurgie etc.). Die moderne Medizin erlaubt also eine immer perfektere Externalisierung und Objektivierung des eigenen Körpers. Allerdings riskiert ein solches Körperverständnis stets, von der anderen Dimension des menschlichen Körpers überrascht oder eingeholt zu werden: von der Tatsache dass ein menschlicher Körper niemals anders als der Leib einer konkreten Person existiert. Am eindrücklichsten zeigt sich diese Bezogenheit im Schmerz, bei dem jeder Abstand zum Körper verloren geht. Gegenüber dem Schmerz gibt es keine Beobachterperspektive. Er «tilgt den Abstand zur Situation und zu sich selbst. Das Selbst wird in die Gegenwart eingeschmolzen. Die Differenz zwischen Aussen und Innen, zwischen Geschehnis und Erlebnis ist ausgelöscht. [...] Die Kontrolle über den Körper ist dahin. Er ist kein Werkzeug des Handelns mehr.»5 Im Schmerz ist – mit Sigmund Freud – das Ich nicht mehr «Herr im eigenen Haus».6 Aus dem aktiven Subjekt wird nicht nur ein dem Schmerz (ohnmächtig) ausgeliefertes, sondern auch ein leidendes Subjekt. Hier zeigt sich, was dem vormodernen Denken ganz selbstverständlich war: die Nähe von Passivität und Pathos. Das Pathos als Passivität – positiv im Sinne von Leidenschaft oder Hingabe und negativ als Leiden – wird von der uns vertrauten Unterscheidung zwischen aktiv und passiv nicht eingefangen.7 Es sträubt sich gegen unser Alltagsdenken, weil es die dualen Aktionsformen unserer Grammatik und Handlungslogik auf den Kopf stellt. Es ist weder das Gegenteil von Aktivität oder Souveränität, noch gleichbedeutend mit Abhängigkeit oder Unfreiheit. In der Kürze kann Pathos als Disposition verstanden werden, freilich nicht in einem psychologischen Sinne, sondern in der Weise eines leiblichen Disponiert-Seins, das dem Handeln und Wissen als ihrem ‹Woher› und ‹Worauf› vorausgeht.8 4 Vgl. Thomas Fuchs, Leib, Raum Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart 2000, 42. Wolfgang Sofsky, Traktat über die Gewalt, Frankfurt 1996, 74. 6 Siegmund Freud, Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, in: ders., GW 12, Frankfurt/M. 1947, 3-12 (11). 7 Vgl. grundlegend Philipp Stoellger, Passivität aus Passion. Zur Problemgeschichte einer ‹categoria non grata›, Tübingen 2010. 8 Martin Heidegger, Was ist das – die Philosophie?, Pfullingen 1956, 39, spricht von «Stimmung» im doppelten Sinne des «Gestimmtseins» (worauf) und «Bestimmtseins» (woher). In diesen Zusammenhang gehört auch die Foucaultsche Kategorie des Dispositivs vgl. Michel Foucault, Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978 sowie Giorgio Agamben, Was ist ein Dispositiv?, Zürich, Berlin 2008. 5 3 Diese hier nur angedeuteten phänomenologisch-existenzialen Überlegungen führen zu einer zunächst paradox erscheinenden Konsequenz: Der Mensch kann sich von seinem Leib nicht distanzieren, er ist ihm in der Unmittelbarkeit seiner «Involviertheit»9 (vor-)gegeben. Der Unterscheidung zwischen ‹einen Körper haben› und ‹ihr› resp. ‹sein Leib sein› entsprechen also nicht die Aktionsmodi von ‹aktiv› und ‹passiv›, sondern die kategoriale Differenz zwischen ‹Verfügbarkeit› und ‹Unverfügbarkeit›: Verfügbarkeit des Körpers durch Distanzierung und Unverfügbarkeit des Leibes durch die Unmittelbarkeit pathischen Erlebens. Die Pointe dieser Unterscheidung besteht darin, dass sie im medizinischen Funktionssystem gar nicht vorkommt. Der Leib ist keine medizinische Kategorie. Anders gesagt: Die Formulierung in einer Broschüre für Betroffene «In der Palliative Care wird der Mensch ganzheitlich betreut und seine Selbstbestimmung gestärkt.»10 beschreibt keine medizinische Massnahme und kein Ziel medizinischen Handelns. ‹Leib-Sorge› gelingt nicht durch die disziplinexterne Anreicherung medizinischer Kernkompetenzen, wie es momentan etwa mit der Etablierung von spiritual care versucht wird. Solche Strategien bestätigen lediglich die allgemein gültige Einsicht von Georg Picht: «Wir handeln falsch, weil wir falsch denken.»11 Die Aufnahme fachfremder Kompetenzen in die medizinischen Curricula transformiert die systemspezifische Körperfokussierung nicht in eine systemexterne Leibperspektivität. 3. Palliative Care als ‹Leib-Sorge› Jenseits gesundheitspolitischer Verteilungskämpfe kommt man nicht um die Einsicht herum, dass die letzte Lebensphase und das Sterben keine Krankheiten sind, sondern Ausdruck der leiblichen Natur und die Finals menschlicher Lebensgeschichten. Der letzte Lebensabschnitt ist zwar häufig mit Krankheiten verbunden, aber er ist keine Krankheit.12 Er bedarf einer medizinischen Beteiligung, eignet sich aber nicht als medizinische Fallgeschichte. Fundamentale Leiberfahrungen stellen sich ja vor allem dann ein, wenn die Externalisierung des Körpers nicht mehr gelingt und die Manipulationen am Körper an ihre Grenzen stossen. Dann müssen wir anerkennen: «Mein Leib ist nicht meiner, weil ich ihn mir angeeignet habe, sondern weil ich mir selbst als Leib gegeben bin.»13 Gegen diese existenzielle Leiberfahrung ist kein medizinisches Kraut gewachsen. 9 Vgl. dazu Gernot Böhme, Ethik leiblicher Existenz, Frankfurt/M. 2008; ders., Der Begriff des Leibes. Die Natur, die wir selbst sind, in: DZPhil 59/2011, 553–563. 10 EDI/GDK/palliativech (Hg.), Unheilbar krank – und jetzt? 11 Georg Picht, Zum Begriff der Verantwortung, in: ders., Hier und Jetzt: Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima, Bd. I, Stuttgart 1980, 215. 12 Vgl. die treffende Formulierung in Oliver Tolmein, Keiner stirbt für sich allein. Sterbehilfe, Pflegenotstand und das Recht auf Selbstbestimmung, München 2006, 7: «Ich bin nicht krank, ich sterbe nur!». 13 Böhme, Ethik, a.a.O., 160. 4 Jede ‹Gegen›-Reaktion wäre auch völlig fehl am Platz, weil solche Leiberfahrungen nicht in den Handlungsraum unserer aktiv-passiv-Logik gehören. Die Raummetapher kann dabei durchaus wörtlich genommen erden: «Sterben gehört nicht ins Krankenhaus»14 und Palliative Care entsprechend nur in gewisser Hinsicht in die Hände der Medizin. Zugespitzt: Nicht der Körper ist das Problem (er liefert allenfalls die Symptome), sondern die Faktizität der Leiblichkeit drängt sich in ihrem spezifischen Doppelcharakter auf: als Gabe und Aufgabe.15 Die Anerkennung der eigenen ‹Gegebenheit› als Leib, d.h. in und mit der eigenen Leiblichkeit eröffnet einen Blick auf die pathische Seite menschlicher Existenz, die seit jeher das Thema von Theologie und Seelsorge ist. Nicht dass solche Einsichten nicht auch anders zu haben wären.16 Aber sie werden nirgendwo präsenter und eindringlicher reflektiert und gelebt, als in der christlichen Theologie und kirchlichen Praxis. Sie öffnen den Blick für die basalen Erfahrungen von Leiblichkeit gegenüber dem partikularen Denken im medizinischen System. Hier geht es nicht mehr um die eigene Autonomie im Handeln, sondern um die andere Souveränität im Erleben des eigenen Gegebenseins. Die Einsicht ist für ein angemessenes Verständnis von Palliative Care fundamental. Greifbar würde dieses Bewusstsein, wenn die Betroffenen der bekannten Formel aus der Abendmahlsliturgie ganz selbstverständlich noch einen weiteren Sinn geben könnten: «Das ist mein Leib» (Mt 26,26). Autor: Frank Mathwig © Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK Bern, 13./14. November 2012 [email protected] www.sek.ch 14 Vgl. Sterben gehört nicht ins Krankenhaus. Interview Christina Hucklenbroich mit Michael de Ridder, in: FAZ 7.11.2012, N 2. 15 Vgl. Böhme, Der Begriff, a.a.O., 562. 16 Vgl. etwa den brillanten Essay des politischen Philosophen Michael J. Sandel, Plädoyer gegen die Perfektion. Ethik im Zeitalter der genetischen Technik, Berlin 2008. 5