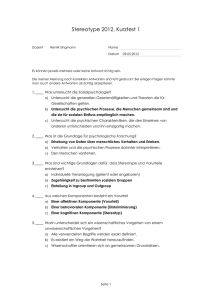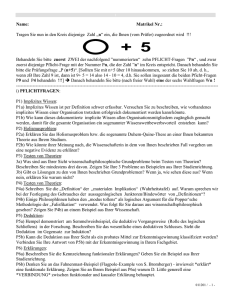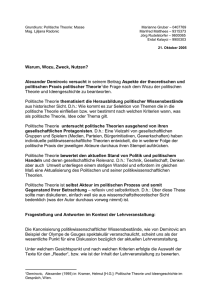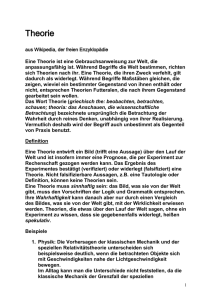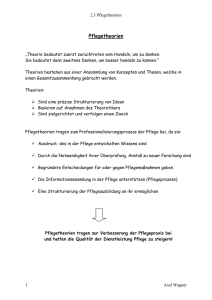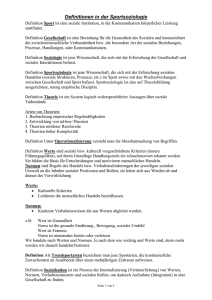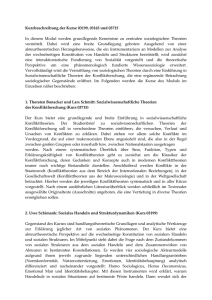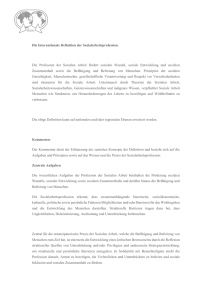Vorlesung7.WS.2016-17 - Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz
Werbung

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen - aus wissenschaftstheoretischer Perspektive Vorlesung Ludwig-Maximilians-Universität München WS 2016/17 2 3 Vorlesung 7 (30.11.2016) Teil II (=> die sachliche Phase A) THEORIE ALS SPRACHLICH FORMULIERTES SYSTEM 1. Einführung 2. Der kontextuelle Aspekt der Theorie 2.1. Theorie und Praxis 2.2. Theorie und Axiome 2.3. Theorie und Tatsachen: Naturalisierung der Theorie? THEORIE ALS SPRACHLICH FORMULIERTES SYSTEM Einführung Reflexion als solche, mithin auch die philosophische Reflexion kann man auf ein qualitativ neues Niveau heben, indem man sie sozial institutionalisiert. Das führt dazu, dass sich die Reflexion von den situativen und personalen Einschränkungen löst und einen dauerhaften Charakter gewinnt. Diese Lösung der Reflexion von Situationen und Personen hat offenbar weitreichende Folgen. Im Rahmen des Alltagsbewusstseins bleibt Reflexion immer improvisiert; d.h. es gibt manche Handlungszwänge und Grenzen, subjektive Perspektiven und die Notwendigkeit, mit epistemischen Routinen zu arbeiten. Dies ändert sich jedoch durch Institutionalisierung. Institutionalisierte Reflexion ist zwar nicht unbedingt frei von Begrenzungen, aber sie ist nicht mehr auf situative und individuelle Verarbeitungskapazitäten beschränkt. Sie kann deshalb Reflexion (als solche) in eine systematische Form bringen und diese Form dann stets modernisieren und aufbewahren. Durch methodisch kontrollierte Wissenserzeugung entstehen in dieser Weise Theorien, d.h. systematisch begründete Interpretationen. Unter der methodischen Kontrolle ist hier das planmäßige und angemessene Verfahren zur Gewinnung von verlässlichen Informationen zu verstehen, die Gegenstand und Prüfstein von Theorien sind. 4 Eine Theorie ist dabei die Form, in der Reflexion organisiert werden kann, wenn sie sich von den Zwängen der alltäglichen Praxis löst, um dann einen „professionellen“ und differenzierten Charakter zu erhalten. Theorie konzentriert sich auf sich selbst, entwickelt ihre eigenen Strukturen und Kriterien und entfernt sich vom alltäglichen Denken, Reden und Tun. Darum kann man durchaus behaupten, dass Theorien sich von den Vorstellungen des Alltagsbewusstseins nicht nur dank ihrer Reichweite unterscheiden, sondern auch dank ihrer Sprache. Theorien verwenden also ihre eigene Sprache, die sich von der natürlichen Sprache dadurch unterscheidet, dass sie keine offene Semantik und Grammatik besitzt, sondern nur bestimmte Bedeutungen und Verknüpfungen erlaubt. Obwohl der Gegenstand der Theorien-Sprache und der Umgang mit ihr gewissermaßen eingeengt und reduziert sind, hindert das sie noch nicht, klare und präzise Formulierungen zu schaffen. Insofern gelten Theorien als Idealform (institutionalisierter) Reflexion. Als solche ermöglichen sie dann erst die Wissenschaft, die sich aber wiederum mit Hilfe von (wissenschaftlichen) Theorien objektiv zu demonstrieren habe. Mit dieser Reflexion beginnen wir die sachliche Phase der Wissenschaftstheorie zu erarbeiten, deren leitende Begriffe sind: Theorie, Wissenschaft und Wissenschaftstheorie. Dabei gilt zunächst die These, Theorie sei sprachlich formuliertes System. Um diese These begründen zu können, muss dann die Frage nach dem „Wie der Theorie“ gestellt werden. Dies erfordert jedoch die Klärung der Begriffe, welche jede Theorie notwendig voraussetzen muss. Daraus ergibt sich, dass Begriffe auch das Fundament der Wissenschaftstheorie (WT) bilden, die verstehen will, wie wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung funktioniert. Anders ausgedrückt: Die WT fragt nach dem „Wie des Wissens“. Der kontextuelle Aspekt der Theorie Theorien stellen das in einem Zustand vorhandene Wissen in objektivierter, meist sprachlich niedergelegter Weise dar. Sie sind dann vor allem in Form von Hypothesen und Daten relativ leicht identifizierbar und in zusammengehörige Gruppen klassifizierbar. Theorien, die ein gewisses Maß an Kohärenz aufweisen, erlauben die Konstruktion von Modellen. Damit sind viele Faktoren angesprochen, die wir in weiteren Abschnitten genauer analysieren werden. Hier geht es vorab darum, den Kontext dieser Analyse zu bestimmen. Den Kontext bildet jeweils ein bestimmtes Begriffspaar, wobei die leitende Komponente immer die Theorie selbst ist: (1) Theorie und Praxis; (2) Theorie und Axiome; und (3) Theorie und Tatsachen; (4) Theorie und Begriffe; (5) Theorie und Statistik; und (6) Theorie und Realismus. 5 Theorie und Praxis Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis weist einen besonderen Charakter auf, der sich im Entfaltungsprozess von Wissenschaften deutlich offenbart. Denn zum einen lassen sich etliche logische Beziehungen nachweisen: Es gibt etwa keine Theorie ohne Praxis, und zwar in dem Sinne, dass man jedwede Theorie nur im Kontext einer bestimmten Praxis richtig verstehen kann, und umgekehrt. Zum anderen kann eine Theorie ihre völlige semantische Ausgestaltung erst dann erlangen, wenn sie sich auch in die Tat umsetzen lässt, d.h. wenn ihr eine praktische Umrahmung zugeschrieben werden kann. Wollen wir jedoch unsere Argumentation anders formulieren, so können wir sagen, alle Praxis sei an vorgegebene Bedingungen gebunden und in eine vorgegebene Ordnung hineingestellt, mit der sie rechnen und die sie im Voraus erkennen muss, sollte sie nicht scheitern. Im Gegensatz zur Praxis wird also die Theorie in erster Linie für die bloße Erkenntnis, für das bloß zuschauende Betrachten gehalten, während Praxis jede Art von Tätigkeit außer der Erkenntnis selbst bedeutet, insbesondere die nach außen gewandte Tätigkeit. Sowohl bei Aristoteles als auch bei Kant werden die Termini „Praxis“ (gr. πρᾶξις) und „praktisch“ (gr. πρακτικός) der sittlichen Willenshandlung vorbehalten; für die sich auf äußere Gegenstände wendende Tätigkeit werden hingegen die Ausdrücke „Téchnē“ (gr. Τέχνη) und „technisch“ (gr. τεχνικός) gebraucht. Bei Aristoteles lesen wir unter anderem Folgendes: (1) „Dennoch aber glauben wir, dass Wissen und Verstehen mehr der Kunst zukomme als der Erfahrung und halten die Künstler für weiser als die Erfahrenen, dass Weisheit einen jeden mehr nach dem Maßstabe des Wissens begleite“ (Met 981a). (2) „Da unfreiwillig ist, was aus Zwang oder Unwissenheit geschieht, so möchte freiwillig sein, dessen Prinzip in dem Handelnden selbst ist und zwar so, dass er auch die einzelnen Umstände der Handlung kennt“ (NE III 21f). Selbst wenn diese beiden Fragmente den verschiedenen Werken Aristoteles entnommen wurden, zeigen sie den Begriff des Praktischen ganz klar auf im Kontext der Handlung bzw. der Erfahrung, die aber meist auch in einem Handlungszusammenhang steht. Ähnliches finden wir bei Kant vor, wenn er zwischen der „Kritik der reinen (d.h. theoretischen) Vernunft“ und der „Kritik der praktischen Vernunft“ differenziert. Verbleiben wir noch bei der Analyse der Relation zwischen Theorie und Praxis, dann stellen wir unter anderem fest, mit der Theorie als bloßer Erkenntnis seien 6 Meditationen und Spekulationen verbunden, die eine besondere Aufmerksamkeit von Erkennen und Denken verlangen. Eine derartige Aufmerksamkeit trägt zudem erheblich zur Entfaltung praktischer Disziplinen wie Medizin, Rechtswissenschaft, Ingenieurwissenschaften usf. bei. Diese Disziplinen setzen jedoch stets entsprechende Theorien voraus, damit ihre zweckbezogene Artikulation sich möglichst effizient ausgestalten kann. Genauer gesagt werden insbesondere Modelle verwendet, die eine grundlegende Komponente von Theorien darstellen. In praktischen Disziplinen dienen also Modelle weniger der Repräsentation realer Systeme, sondern mehr als Grundlage zur Konstruktion neuer realer Systeme. In der Technik will man etwa bestimmte Systeme ganz neu herstellen, in der Medizin geht es vor allem um die Heilung von Krankheiten und in den juristischen Disziplinen um die Subsumption realer Ereignisse unter gegebene Gesetze sowie um die Urteilsfindung. Das, was auf diesen Gebieten jeweils angestrebt wird, könnte man als „intendierte Systeme“ bezeichnen, die sich empirischen Regularitäten verdanken. Diese Regularitäten stellen einen kausalen oder probabilistischen Zusammenhang her. Bringen wir dazu ein Beispiel aus dem Medizinbereich vor: „In der Medizin wurde in den 60er Jahren die Myokardprotektion durch Kardioplegie nach Bretschneider als Methode eingeführt, bei Herzoperationen Schäden am Myokard zu vermeiden, die ohne zusätzliche Vorkehrungen dann auftreten, wenn die Operationsdauer mehr als 15 Minuten beträgt. Mit dieser Methode wird das Herz durch eine Kombination von Hypothermie, Natriumentzug und Kaliumentzug ruhiggestellt und damit die Zeit, in der ohne Folgeschäden operiert werden kann, auf etwa 120 Minuten verlängert. Die so teilweise gefundene und teilweise hergestellte Regularität lautet wie folgt: Wenn bei einer Herzoperation Myokardprotektion vorgenommen wird, kann bis zu 120 Minuten operiert werden, ohne dass Folgeschäden am Myokard auftreten.“ Wenn man schon den letzten Satz des obigen Zitats einer Analyse unterzieht, d.h. den Satz „Wenn bei einer Herzoperation Myokardprotektion vorgenommen wird, kann bis zu 120 Minuten operiert werden, ohne dass Folgeschäden am Myokard auftreten“, kann man eine Art Theoriegeladenheit von Beobachtungssätzen feststellen. Wir können also empirisch beobachten, dass das Myokard (= Herzmuskel) keinen Schaden erleidet, wenn es entsprechend geschützt wird. Unsere empirische Beobachtung wird also hier durch eine Theorie „positiv getragen“, deren Fundament eine kausale Regularität darstellt. Es kann aber auch eine andere „negativ gefärbte“ Konstellation vorkommen: Theorien können selber an der Erfahrung scheitern, die einen wesentlichen Teil von Praxis darstellt. Es handelt sich also um die empirische Prüfung von Theorien, die darin besteht, dass man nach logischen Widersprüchen zwischen Theorien und Beobachtungssätzen sucht. Die Erfahrung kann nicht unmittelbar 7 herangezogen werden, weil Theorien nur Sätze über Erfahrungstatsachen logisch widersprechen können. Popper bezeichnete solche Sätze zunächst als „Basissätze“, dann aber als „Prüfsätze“. Prüfsätze sollen - anders als die Protokollsätze im Logischen Empirismus etwa bei Carnap – nicht durch die Erfahrung sicher begründet werden. Wie Theorien sind sie nicht verifizierbar, sie sind auch nicht letztlich sicherbar, sondern bleiben stets hypothetisch. Das liegt daran, dass Sätze über Beobachtungen theoretische Bestandteile enthalten. Darum sprechen wir von der Theoriegeladenheit von Beobachtungssätzen. Nehmen wir den Satz „Hier steht ein Glas Wasser“. Begriffe wie „Glas“ und „Wasser“ transzendieren die Erfahrung. „Glas“ bringt z.B. die Erwartung zum Ausdruck, dass der so bezeichnete Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft hat und sich so verhält, wie es für Glas die Regel ist. Damit wird dem Gegenstand mehr zugeschrieben, als beobachtet werden kann. Etwas als Glas zu bezeichnen, beinhaltet z.B. die These, es sei zerbrechlich. Das ist aber nicht Teil der Erfahrung des vor uns stehenden Gegenstandes. Vielleicht wird die Zerbrochenheit des Glases erfahren, wenn es zu Boden gefallen ist. Mit der Bezeichnung „Glas“ wird also ein gesetzmäßiges Verhalten unterstellt, welches für Dinge charakteristisch ist, die aus Glas sind. Für die Beschreibung von gesetzmäßigem Verhalten sind aber Axiome erforderlich. Theorie und Axiome Wenn wir ein gesetzmäßiges Verhalten beschreiben, dann bedienen wir uns meist einer Theorie. In jeder Theorie kommt aber Axiomen eine besondere Rolle zu. Ein Axiom ist ein Grundsatz einer Theorie, einer Wissenschaft oder eines axiomatischen Systems, der innerhalb dieses Systems nicht begründet oder deduktiv abgeleitet wird. Mit anderen Worten: Ein Axiom ist ein Satz, der nicht in der Theorie bewiesen werden soll, sondern beweislos vorausgesetzt wird. Axiome werden als Gegenbegriffe zu Theoremen verwendet. Theoreme sind ähnlich wie Axiome - Sätze eines formalisierten Kalküls, die durch Ableitungsbeziehungen verbunden sind. Theoreme sind also Sätze, die durch formale Beweisgänge von Axiomen abgeleitet werden. Und die Axiome kann man als Bedingungen der vollständigen Theorie verstehen, insofern diese in einem formalisierten Kalkül ausdrückbar sind. Durch die Auswahl der Axiome können verschiedene Theorien innerhalb einer interpretierten formalen Sprache unterschieden werden. Bei nicht-interpretierten Kalkülen der formalen Logik sprechen wir nicht von Theorien, sondern von 8 logischen Systemen, die durch Axiome und Schlussregeln vollständig bestimmt sind. Damit wird der Begriff der Ableitbarkeit relativiert. Die Ableitbarkeit besteht allerdings immer nur in Bezug auf ein gegebenes System. Die Axiome und die abgeleiteten Aussagen gehören zur Objektsprache, die Regeln hingegen zur Metasprache. Der Terminus „Axiom“ tritt generell in drei Grundbedeutungen auf, d.h. als (1) klassischer (materialer) Axiombegriff – ist ein unmittelbar einleuchtendes, bzw. konventionell akzeptiertes Prinzip, wird auf die Elemente der Geometrie des Euklid und die Analytica posteriora des Aristoteles zurückgeführt, und war bis in das 19. Jahrhundert herrschend; (2) naturwissenschaftlicher (physikalischer) Axiombegriff – ist ein Naturgesetz, das als Prinzip für empirisch gut bestätigte Regeln postuliert werden kann. Axiom ist hier, d.h. in empirischen Wissenschaften, ein grundlegendes Gesetz, das vielfach empirisch bestätigt worden ist, z.B. die Newtonschen Axiome der Mechanik; und (3) moderner (formaler) Axiombegriff – ist eine grundlegende Aussage, die Bestandteil eines formalisierten Systems ist, ohne Beweis angenommen wird, und aus der zusammen mit anderen Axiomen alle Sätze (d.h. Theoreme) des Systems logisch abgeleitet werden. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass ein Axiom unbeweisbar sein muss. Die Eigenschaft, ein Axiom zu sein, ist relativ zu einem formalen System. Denn was in einer Wissenschaft ein Axiom ist, kann in einer anderen lediglich ein Theorem sein. Dementsprechend könnte man auch konkrete Beispiele formulieren. Wenn man also das Gebiet der traditionellen Logik betritt, so findet man hier als Axiome etwa * den Satz von der Identität: „A ist mit B identisch dann und nur dann, wenn alle Eigenschaften von A mit allen Eigenschaften von B identisch sind“, * den Satz vom Widerspruch: „Es ist unmöglich, dass dieselbe Bestimmung demselben Seienden unter der gleichen Rücksicht zugleich zukommt und nicht zukommt“, *den Satz vom ausgeschlossenen Dritten: „Zwischen Sein und Nichtsein desselben gibt es kein Drittes, das weder Sein noch Nichtsein ist“, und *den Satz vom zureichenden Grund: „Jeder Sachverhalt hat einen zureichenden Seinsgrund“. Im Hinblick auf die klassische Logik können wir etwa vom Komprehensionsaxiom reden: „Zu jedem Prädikat P gibt es eine Menge aller Dinge, die dieses Prädikat erfüllen“. Auf dem Gebiet der Mathematik stoßen wir unter anderem auf das Parallelenaxiom: „Zu jeder Geraden und jedem Punkt, der nicht auf dieser 9 Geraden liegt, gibt es genau eine zu der Geraden parallele Gerade durch diesen Punkt“. Schließlich lassen sich auch Theorien der empirischen Wissenschaften (z.B. der Physik) „axiomatisiert“ rekonstruieren: Es gibt also eine Axiomatisierung der Quantenmechanik, Thermodynamik, die Axiomatische Quantenfeldtheorie usf. Theorie und Tatsachen: Naturalisierung der Theorie? Aus dem vorangehenden Abschnitt ergibt sich, dass Axiome, wenn sie in den empirischen Wissenschaften angewendet werden, eine Art Brücke zwischen Theorie und Tatsachen darstellen. Jetzt wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die beiden Zwischenstücke dieser Relation richten, d.h. auf Theorie und Tatsachen, und dann deren Verhältnis zueinander prüfen. Anschließend werden wir nach der Möglichkeit der Naturalisierung von Theorien fragen. Der erste ernsthafte Versuch, wissenschaftliche Theorien zu erfassen, führte im logischen Empirismus dazu, Theorien als deduktiv abgeschlossene Mengen von Sätzen zu definieren, d.h. von Satzmengen, die alle ihre logischen Folgerungen schon enthalten. Dieser Begriff erfasst zwar mit der Betonung logischer Beziehungen einen wesentlichen Aspekt wissenschaftlichen Vorgehens, aber es ist ohne weitere Argumentation klar, dass empirische Wissenschaft (bzw. Theorie) mehr als Sätze und logische Ableitungen beinhaltet. Aus dieser epistemischwissenschaftlichen Lage können wir vielleicht gewissermaßen herauskommen, wenn wir den Begriff der Tatsache ins Spiel bringen. Betrachten wir dazu einige Überlegungen Wittgensteins aus seinem „Tractatus“. Er schreibt: „[…] Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es alle Tatsachen sind. Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist. Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt. Die Welt zerfällt in Tatsachen […]. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten“ (TLP 1.1 – 2). Wittgenstein gebraucht also den Begriff „Tatsache“, um die Theorie der Welt zu „konstruieren“. Wenn man aber Tatsache als Komponente mit einem empirischen Hintergrund versteht, so kann man auch die Relevanz empirischer Elemente beim Aufbau von Theorien (der Welt) problemlos erkennen. Dabei handelt es sich vor allem um Beobachtungen und Experimente, mit deren Hilfe die epistemischen Subjekte den Zugang zu Tatsachen der Welt haben. 10 Will man jedoch Beobachtungen und Experimente als wissenschaftliche Instrumente richtig verstehen, dann muss man sie vorab von den Gebieten fernhalten, auf welchen von den Scheinproblemen geredet wird. Gemeint sind also manche Bereiche der Philosophie und Theologie. Denn die streng empirischen Wissenschaftler, wie z.B. Physiker behaupten etwa, Philosophie sei das Bemühen, eine schwarze Katze in einem dunklen Zimmer zu fangen. Bei den Theologen würde es noch schlimmer, da existiert nicht einmal die schwarze Katze, und trotzdem ertönt der Ruf „Wir haben sie!“. Nennen wir zwei klassische Beispiele von Scheinproblemen bzw. sinnlosen Begriffen (aus naturwissenschaftlicher Sicht gesehen): (1) Engel – es ist sinnlos zu fragen, ob Engel einen Körper haben, ob sie männlich oder weiblich sind usf.? Das heißt, Engel werden als Metapher angesehen; (2) die Mitte des Universums – angesichts dessen, was wir heute über das Universum wissen, kann man die Formulierung „die Mitte des Universums“ nicht gelten lassen, weil das Weltall keine schlichte Kugel ist. Wie oben angedeutet erlangen wir den Zugang zu Tatsachen unter anderem durch die Analyse von Beobachtungen und Experimenten. Auch wenn wir stets mit empirischen Wahrnehmungen beginnen, wie dies vor allem Kant einleuchtend zeigte, reichen sie doch nicht aus, um Wissenschaft zu begründen. Ein Wissenschaftler, somit auch Theoretiker nimmt nicht nur wahr, sondern er beobachtet desgleichen. Zwar ist jede Beobachtung auch Wahrnehmung, aber nicht jede Wahrnehmung ist Beobachtung. Wenn ich etwas beobachten will, spitzt sich die Wahrnehmung gleichsam zu. Wahrnehmungen habe ich, beobachten tue ich. Ich kann auch experimentieren. Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, bringen wir mit Bruno Heller zwei Beispiele vor: (1) „Herr Schmidt ist furchtbar neugierig. Hinter der Gardine lauert er auf seine Nachbarin, späht über den Gartenzaun und registriert, was drüber vor sich geht. Da steigt ein schmucker Herr aus dem Auto, klingelt an der Haustür gegenüber. Ein neuer Liebhaber, der Gerichtsvollzieher oder…? Eins kann man Herrn Schmidt nicht absprechen: Er nimmt an seiner Umwelt teil, er hat Interesse an ihr.“ (2) Der kleine Max will wissen, ob ein Frosch nach Ameisen schnappt. Im Teich wird sich kaum Gelegenheit dazu bieten; also fängt der kleine Max einen Frosch, sucht sich ein paar Ameisen und serviert sie dem Frosch auf der Platte des Gartentischs. Mal sehen, was passiert. Fehlanzeige! Vermutlich war der Frosch satt.“ (Heller, B., Wie entsteht Wissen? Eine Reise durch die Wissenschaftstheorie, Darmstadt 2005, 97f.) 11 Im ersten Beispiel werden die Relevanz und der Kontext von Beobachtung hervorgehoben. Ich sehe einen Vogel am Himmel vorüber fliegen, aber ich beobachte, wie er sein Nest baut. Der Übergang vom alltäglichen zum wissenschaftlichen Beobachten geht fließend vor sich. Dabei schwingt immer etwas Neugier mit, aber ein Forscher beobachtet seine Objekte systematisch, d.h. er bringt bereits gewisse Vermutungen über das mit, was passieren kann. Beobachten geht von Erwartungen aus. Deshalb kann man sagen, dass jede Beobachtung theoriegeleitet ist. Sie erfolgt nicht ins Blaue hinein, sondern im Horizont eines bestimmten Vorwissens. Vor der Beobachtung steht zumindest ein Gedanke, manchmal ein ganzes Gedankengerüst. Es gibt allerdings Situationen, wo das Beobachten nicht ausreicht. Beobachten kann man nur, was bereits da ist, ob es sich um die Nachbarin von Herrn Schmidt handelt, den Nestbau eines Vogels oder eine Sonnenfinsternis. Demnach gibt es wissenschaftliche Gebiete, auf denen nur die Beobachtung als einziger methodischer Weg denkbar ist, etwa die Astronomie. Es gibt aber auch Gebiete, wo das Experimentieren sinnvoll und sogar erforderlich ist. So will etwa der kleine Max (im 2. Beispiel) wissen, ob ein Frosch nach Ameisen schnappt, und konstruiert dazu ein Experiment. Experimente haben jedoch immer etwas Künstliches an sich, weil wir als Menschen gezwungen sind, künstliche Welten zu bauen. Nur so kann man den bloßen Urzustand hinter sich lassen. Experimentieren gehört also zur Kultur der Menschheit. Da Beobachtungen und Experimente immer in einem gedanklichen Rahmen erfolgen, der ihnen den Stempel aufdrückt, könnte man auch von der Naturalisierung von Theorien reden. Beobachtungen und Experimente liefern also keine „nackten Tatsachen“. Abschließend ist noch zu fragen, was eine Tatsache überhaupt sei. Denn bis jetzt wurde nur die Frage beantwortet, wie wir den Zugang zu Tatsachen erlangen können. Und die Antwort lautete: durch Beobachtungen und Experimente. Ich blicke nach oben und sehe den blauen Himmel. Ist aber der „blaue Himmel“ eine Tatsache? Nein! Denn erstens hat niemand den Himmel blau angestrichen, sondern das Sonnenlicht wird in der Atmosphäre gestreut, und dadurch entsteht der Eindruck: blau. Und zweitens kann man das Reden vom „Himmel“ grundsätzlich verwerfen. Ist ein Flugzeug, das seine Bahn in 1000 m Höhe zieht, „im Himmel“? Wer von einer Wahrnehmung spricht, hat also noch längst keine Tatsache vor Augen. Verdeutlichen wir dies noch mit dem Hinweis auf Galilei, der dem Hofstaat in Florenz einmal zeigen wollte, dass es auf dem Mond Gebirge gibt und die Sonne Flecken haben kann. So baute er ein Fernrohr auf und bat seine 12 Begleiter hindurchzuschauen. Für die an Aristoteles glaubenden Astronomen war das unvorstellbar. Einige lehnten es überhaupt ab, solch ein fragwürdiges Instrument zu benutzen, andere sahen nichts. Galilei war sehr enttäuscht. Imre Lakatos erklärt diese Konstellation folgendermaßen: „Es handelte sich nicht um einen Konflikt zwischen Galileos – reinen und untheoretischen – Beobachtungen und der Aristotelischen Theorie, sondern um einen Konflikt zwischen Galileos „Beobachtungen“ – gesehen im Lichte seiner optischen Theorie, und den „Beobachtungen“ der Aristoteliker – gesehen im Lichte ihrer Theorie des Himmels“. (Lakatos, I., Falsifiacation and the Methodology of Scientic Research Programmes, in: ders. u.a. (Hrsg.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, 96 [deutsche Version 1974])